IKSonline - 2008
- 3566 reads
Januar 2008
- 769 reads
Ein Bericht über Buchvorstellungen und Diskussionen auf der Nürnberger Buchmesse 2007
- 3795 reads
Vom 14. – 16. Dezember 2007 fand die 12. Linke Literaturmesse in Nürnberg statt. Veranstaltet wird dieses Ereignis von dem Archiv und der Bibliothek Metroproletan sowie dem Gostenhofer Literatur- und Kulturverein Libresso in Nürnberg (www.linke-literaturmesse.org [1]). Dort finden jährlich Veranstaltungen, Buchvorstellungen, Lesungen sowie natürlich eine Verkaufsmesse statt. Die IKS hat sich in diesem Jahr vor allem deshalb daran beteiligt, um ihr soeben auf Deutsch erschienenes Buch über die Italienische Kommunistische Linke bekannt zu machen. Wir nutzten unsere Anwesenheit, um uns an den vor Ort stattfindenden Diskussionen zu beteiligen. Es wurden teilweise sehr interessante neue Bücher vorgestellt, und es fand ein anregender Meinungsaustausch nicht nur auf den Veranstaltungen und Buchvorstellungen statt, sondern auch an den Büchertischen und anderswo. Wir wollen an dieser Stelle ein Echo der Diskussionen wiedergeben, wobei wir über unsere eigene Veranstaltung – auf der wir unser neues Buch vorgestellt haben – gesondert berichten werden.
Demokratie und Reformismus
Da wir erst am Samstagmorgen anwesend sein konnten, bekamen wir die Vorstellung der Ulrike Meinhof-Biografie von Jutta Ditfurth am Freitag Abend nicht mit. Da wir außerdem unseren Büchertisch betreuen mussten, war die Buchvorstellung Kapitalismus versus Barbarei mit dem Autor Michael Klundt (Hrg.) am frühen Nachmittag die erste Veranstaltung, die wir besuchen konnten. Der Autor, ein Vertreter der Linkspartei, wies auf die faktische Entwicklung der Barbarei in der modernen Welt hin. So z.B. auf die geschätzten 6.000 Menschen, die im vergangenen Jahr bei dem verzweifelten Versuch, von Afrika aus die Kanarischen Inseln und somit das Territorium der Europäischen Union zu erreichen, ertrunken waren. Er schien einseitig die „neoliberalen“ Vertreter der Bourgeoisie dafür verantwortlich zu machen. Bezug nehmend auf eine Formulierung Hitlers, derzufolge die wirtschaftliche Form, welche am besten der politischen Institution der Demokratie entspreche, der Kommunismus sei, deutete er an, dass das Großbürgertum seit 1989 der parlamentarischen Demokratie überdrüssig geworden sei und nach Wegen suche, sich dieser zu entledigen. Vor diesem Hintergrund behauptete er, dass selbst die banalsten Reformprojekte der „Linke“ gegenwärtig eine neue Brisanz gewännen. Wir erwiderten darauf, dass es keine Anzeichen einer solchen Entwicklung gibt. Vielmehr haben die Jahrzehnte nach der Niederlage Hitlerdeutschlands dem „Westen“ zu Genüge bewiesen, dass die Demokratie die ideale Herrschaftsform des modernen Kapitalismus liefert und dass die herrschende Klasse gerade heute, in Zeiten steigender Kampfbereitschaft der Arbeiterklasse, dieses Mittel der sozialen Kontrolle nicht aus der Hand geben wird. Was den angeblich fortschrittlichen Reformismus der „Linke“ betrifft, so wollten wir wissen, ob der Autor auch die SPD-PDS-Koalition in Berlin dazu zähle. Darauf antwortete er, wie die Anderen auch, mit der Behauptung, dass die Vorläuferregierung an allem Schuld sei. Die Diskussion endete mit der Erörterung der Frage, ob Reformen im heutigen Kapitalismus überhaupt möglich sind.
Islamismus und westlicher Imperialismus
Der deutsche Journalist Marc Thörner hat seine Erfahrungen als Reporter an der Kriegsfront im Irak oder auch als Beobachter einer Reihe „islamischer“ Länder in Buchform verarbeitet (Der falsche Bart). In seinem Vortrag thematisierte er die Rolle des Westens gegenüber islamistischen Gruppen wie die GIA in Algerien. Er legte dar, wie die Regierung in Algier, mit Unterstützung Frankreichs, die terroristische GIA - eine Abspaltung der ebenfalls islamistischen FIS – instrumentalisierte, um an der Regierung zu bleiben. Auch wies er darauf hin, wie führende islamistische Theoretiker aus bürgerlichen Ideologien des Westens geschöpft haben, vornehmlich aus den antimodernen und antimaterialistischen Strömungen Europas. Am Beispiel Tunesiens zeigte er auf, wie auch Deutschland im Namen des „Kampfes gegen den Terrorismus“ Folterregimes unter die Arme greift und die dortigen Polizeikräfte auch noch ausbildet. Was die Lage im Irak betrifft, so erläuterte er den Strategiewechsel der USA im Irak, die im „sunnitischen Dreieck“ inzwischen auf die alten Baathisten aus dem Umfeld des inzwischen hingerichteten, ehemaligen Diktators Saddam Hussein setzen. In der Diskussion wies die IKS auf die wachsenden sozialen Spannungen in diesem Teil der Welt hin, welche in den offiziellen Medien verschwiegen werden. Wir erwähnten die Streikbewegungen in Ägypten oder Dubai, die Wut der Bevölkerung im Irak auf die angeblich „eigenen“ Terrorgruppen, aber auch die Unzufriedenheit vieler amerikanischer Soldaten im Irak. Letzteres bestätigte Thörner. Dabei sagte er, dass der schlimmste Kriegstreiber in der US-Armee vor Ort nicht einmal das Offizierskorps sei, sondern die Militärgeistlichkeit.
RAF und Antisemitismus
Joachim Bruhn und Jan Gerber vom Verlag ça ira (Freiburg im Breisgau) stellten ihr Buch vor: Rote Armee Fiktion. Sie begannen mit einer Einschätzung des Buches von Ditfurth über Ulrike Meinhof, das das „Niveau der Bunte“ (eine deutsche Klatschzeitschrift) habe und das Wesentliche an Meinhof übersehen habe: dass sie politisch ungebildet gewesen und mehr oder weniger zufällig in die Illegalität abgerutscht sei. Ebenso entschieden wandten sich Bruhn und Gerber gegen die von den Medien und der politischen Klasse betriebenen Glorifizierung der Opfer des Terrors. Obwohl Attentate zum Berufsrisiko der Manager und Politiker gehören wie die Staublunge zum Bergarbeiter, habe man noch nie von einer öffentlichen Würdigung des Leidens Letzterer gemerkt. Zu Recht verwiesen die Autoren auf die Sinnlosigkeit terroristischer Anschläge sowie auf ihre Verwurzelung im Unverständnis, dass nicht die Führer, die lediglich „Charaktermasken“ des Kapitals sind, sondern die Funktionsweise des Systems das Grundproblem darstellt. Der geplante Brandanschlag der RAF auf ein Kaufhaus in Frankfurt wurde als Beispiel für den kleinbürgerlichen, vom protestantischen Moralismus beeinflussten Moralismus Meinhofs und ihrer Umgebung genannt: Sie predigten Askese, Reinheit und Lustfeindlichkeit, anstatt zu begreifen, dass es darum geht, Luxus und das schöne Leben allen Menschen zu ermöglichen. Auch die autoritäre Staatsgläubigkeit der RAF wurde anhand des Hangs dieser Gruppe thematisiert, sich gegenüber der Bundesregierung als „Gegenstaat“ aufzuspielen. Unter Hinweis auf die Tradition des Rätekommunismus Anton Pannekoeks und Cajo Brendels wurde auch der „Leninismus“ der RAF kritisiert. Gemeint ist damit die Vorstellung, dass dem Proletariat revolutionäres Bewusstsein von Außen, durch linke Intellektuelle, „vermittelt“ werden müsse. Vor allem wurden die antisemitischen Tendenzen der RAF (Anschläge auf jüdische Einrichtungen, Parteinahme für „die Palästinenser“ im Nahostkonflikt, Begrüßung des Anschlags gegen israelische Sportler bei den Olympischen Spielen von 1972 in München u.a. durch Ulrike Meinhof) thematisiert und ebenso verurteilt wie ihr positiver Bezug auf die deutsche Nation als ein angeblich vom amerikanischen Imperialismus zu befreiendes Subjekt. Es wurde aufgezeigt, wie diese reaktionären Vorstellungen mehr oder weniger zum Allgemeingut der damaligen linken, „antiimperialistischen“ Szene gehörten und zum Teil noch gehören. In unserer Wortmeldung unterstützten wir viele Aussagen in beiden Referaten. Was die Rolle des Antisemitismus betrifft, so hat bereits Trotzki darauf hingewiesen, wie dieser wesentlich zum System des Stalinismus gehörte und zur Stabilisierung des eigenen Regimes zielstrebig eingesetzt wurde. Aber auch wenn August Bebel mit seiner Bezeichnung des Antisemitismus als „Sozialismus des dummen Kerls“ die davon ausgehende Gefahr unterschätzte, so war die marxistische Arbeiterbewegung in Deutschland zurzeit der Antisozialistengesetze nicht antisemitisch, sondern der Vorkämpfer dagegen. Erst die Niederlage der Weltrevolution ermöglichte den Vormarsch des Nationalismus und des Rassismus vor allem mit dem Sieg der stalinistischen Konterrevolution. Was die Bezugnahme auf den Rätekommunismus betrifft, so haben wir darauf hingewiesen, dass für den damaligen „Rätekommunismus“ wie für die Kommunistische Linke insgesamt das wirklich bedeutende und zukunftsweisende Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre weder die RAF noch die Studentenbewegung war, sondern das Wiederauftauchen wilder, illegaler, außergewerkschaftlicher und oft antigewerkschaftlicher Kämpfe der Arbeiterklasse. Wir betonten die Wichtigkeit der Wiederaneignung der Lehren dieser Kämpfe gerade heute, im Vorfeld erneuter größerer Arbeiterkämpfe. Diese Wortmeldung löste eine heftige Reaktion Joachim Bruhns aus. Die positive Bezugnahme der Kommunistischen Linken auf die Arbeiterklasse und ihre Kämpfe teile er keineswegs. Die Nazizeit habe in Deutschland eine Volksgemeinschaft zustande gebracht, einen die Kapitalisten und die Arbeiterklasse einschließenden Mob erzeugt, welcher bis heute Bestand habe. So sei für ihn jede positive Bezugnahme auf Arbeiterkämpfe und Arbeiterforderungen ausgeschlossen. An dieser Stelle mussten wir die Veranstaltung verlassen, um unsere eigene abzuhalten. Wir waren aber dankbar für diese Klarstellung. Sie macht deutlich, dass das Milieu der sog. Antideutschen (zu dem ça ira und Bahamas gehören), sofern es die Unterstützung eines imperialistischen Lagers gegen ein anderes (jenes Israels und der USA im Nahostkonflikt) zur Leitlinie seiner Politik macht, nichts zu tun haben kann mit der Tradition eines Anton Pannekoek oder Cajo Brendel, welche sich internationalistisch auf die Seite des Proletariats gegen alle imperialistischen Lagern gestellt haben.
In der Scheiße leben
Ingrid Scherf stellte das lesenswerte Buch von Mike Davis über die Explosion der Megacities vor: Planet der Slums. Davis zieht Parallelen zwischen der Schilderung der Lage der arbeitenden Bevölkerung im Frühkapitalismus durch Friedrich Engels (Die Lage der Arbeiterklasse in England) und das Leben eines Großteils der Menschheit heute. Die Exkremente von fünf Milliarden Menschen werden entweder unbehandelt entsorgt oder nicht einmal das – so dass die Menschen mitten drin leben müssen. Eine Stadt wie Kinshasa in Zentralafrika, welche bald zehn Millionen Einwohner haben wird, verfügt über gar kein Abwassersystem. Davis spricht ein Thema an, welches aus Sicht des Marxismus zu den Grundproblemen der Klassengesellschaft gehört, die eine künftige kommunistische Gesellschaft lösen muss: der wachsende Widerspruch zwischen Stadt und Land. So war es wichtig, dass ein Teilnehmer der Diskussion auf die Notwendigkeit verwies, den Zustrom vom Lande in die Stadt umzukehren. Ingrid Scherf wiederum antwortete darauf, dass dies unmöglich sei, ohne die Ursachen der Landflucht wie die Verarmung der Kleinproduzenten, ihre Vertreibung zugunsten von Weltmarktplantagen, Bürgerkriege usw. zu beseitigen. So entwickelte sich eine Diskussion über die Frage, inwiefern die Slums von heute eine Barriere für die Entwicklung künftiger Kämpfe darstellen aufgrund von Zerfallserscheinungen wie Bürgerkriege, Kriminalität und Bandenwesen, und inwiefern andererseits ein multinationales erwerbstätiges wie auch erwerbsloses Proletariat auch dort entsteht, ohne Vaterland und ohne dass es etwas zu verlieren hat, das sich an einem weltweiten revolutionären Ansturm der Zukunft beteiligen könnte. Es wurde auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Slumgesellschaften weder als homogene noch als passiv-hilflos auf Almosen angewiesene Gemeinschaften zu betrachten. Beispiele wurden gegeben von Kämpfen der Bewohner für den Anschluss an den öffentlichen Verkehr und an andere Infrastrukturen – nicht zuletzt um zur Arbeit gelangen zu können. Dies weist auf die Rolle der lohnarbeitenden, proletarisierten Schichten in diesen Teilen der Welt und der Gesellschaft hin. Auch wurde thematisiert, dass aufgrund der Erwerbslosigkeit der Männer zunehmend Arbeiterfrauen aktiviert werden. Schließlich regte eine junge Teilnehmerin ein Nachdenken über die Slumentwicklung in den kapitalistischen Metropolen an. Dies veranlasste Ingrid Scherf zu der Bemerkung, dass beispielsweise in New York die schlimmsten Elendsviertel inzwischen abgetragen worden sind, ohne dass Klarheit darüber herrsche, was aus ihren einstigen Bewohnern geworden sei.
Die Macht des Geldes
Theo Wentzke vom GegenStandpunkt Verlag stellte sein Buch Das Geld vor. Wir werden seine langen und aus unserer Sicht korrekten und interessanten Ausführungen dazu nicht wiedergeben. Sein Buch ist lehrreich und lesenswert. Man kann das alles natürlich auch bei Marx im Kapital nachlesen. Nachteilig an dieser Buchvorstellung wie auch an der von ça ca ira oder von Robert Kurz (worauf wir gleich zu sprechen werden) war, dass die Einleitungen fast die gesamte vorgesehene Zeit ausfüllten (eine Stunde). Bei der Veranstaltung zur RAF wurde eine Diskussion nur dadurch ermöglicht, dass der Raum am Abend nicht mehr gebraucht, somit die Zeit überzogen werden konnte. Diese Unart erinnert an die Uni, wo der Professor lehrt und die Schüler zuhören, um zu lernen (oder auch nicht). Es entspricht keineswegs dem kollektiven Charakter der Arbeiterklasse, deren Bewusstseinsentwicklung grundsätzlich nur kollektiv vonstatten geht.Somit konnten auch hier am Ende nur wenige kurze Fragen gestellt werden. Ein Genosse vom rätekommunistischen Kreis Revolution Times widersprach zu Recht unter Hinweis auf die Lohnarbeit, Warenproduktion und Geldwirtschaft, Ausbeutung und Entfremdung der Produzenten von ihrem Produkt und ihr Ausschluss von der Bestimmung über die Produktion der Behauptung Wentzkes, derzufolge in den stalinistischen Ländern kein Kapitalismus geherrscht habe. Die IKS wiederum wies darauf hin, dass der Vortrag wesentliche Folgen der kapitalistischen Geldwirtschaft außer Acht gelassen hatte, welche für Marx zentral waren, insbesondere die Überproduktionskrise und die Verarmung des Proletariats aufgrund der Entwicklung der Massenarbeitslosigkeit (industrielle Reservearmee resp. „Surplusbevölkerung“). Wentzke erklärte, diese Aspekte seien nur wegen Zeitmangels nicht angesprochen wurden. Eine Aussage, die wir bemerkenswert finden. Wir haben ganz andere Veranstaltungen von GegenStandpunkt erlebt, wo die Idee der Überproduktionskrise als Blödsinn abgekanzelt wurde. Denn die Frage der Krise stellt die Frage des Klassenkampfes und die Notwendigkeit der Revolution – Fragen, mit denen GSP bislang nichts zu tun haben wollte.
Die Frage der „nachholenden Modernisierung“
Unter dem Titel „Kapitalismuskritik light“ stellte Robert Kurz kein neues Buch vor, sondern einen neuen Arbeitskreis: Exit, der sich von Krisis abgespalten hat. Diese Gruppe treibt u.a. die Frage an: Was war das 1989 zusammengebrochene System im Osten? Was war die damit verbundene „alte“ Arbeiterbewegung? Seine Antwort: ein Prozess der „nachholenden Modernisierung“. Soll heißen: anstatt antikapitalistisch zu sein, hat die alte Arbeiterbewegung, haben Gewerkschaften, Sozialdemokratie sowie der „Kommunismus“ des Ostblocks dem Kapitalismus den Weg gebahnt. Einige Altstalinisten empörten sich über die Idee, dass die Ostblockstaaten nicht sozialistisch gewesen seien, und meinten, mit dieser Behauptung verabschiede man sich überhaupt von der Idee des Sozialismus. Die Kritik der IKS setzte an einer ganz anderen Stelle an. Wir begrüßten die Feststellung, dass die Ostblockländer nicht sozialistisch, sondern kapitalistisch waren. Zugleich äußerten wir die Befürchtung, dass der Begriff der nachholenden Modernisierung zu einer Beschönigung des Stalinismus führen könnte. Denn aus unserer Sicht ist der Stalinismus nicht nur kein Sozialismus gewesen, sondern nicht einmal eine fortschrittliche Entwicklung des Kapitalismus oder eine Tendenz zum Kapitalismus, sondern die Konterrevolution gegen die proletarische Weltrevolution. Das Wesen des Stalinismus war die Vorstellung des „Sozialismus in einem Land“, d.h. der Glaube an die Möglichkeit einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung durch eine Abkoppelung vom Weltmarkt (Autarkie). Damals führten die Marxisten zwei Hauptargumente gegen diese Auffassung an. Zum einen zeigten sie auf, dass der Sozialismus in einem Land unmöglich ist, da der Kapitalismus ein Weltsystem ist und nur als solches überwunden werden kann. Zum anderen wiesen sie darauf hin, dass nicht nur der Sozialismus, sondern selbst eine fortschrittliche Entwicklung des Kapitalismus in einem Land – also abgetrennt vom Weltmarkt – unmöglich, ja eine reaktionäre Utopie darstellt. Das Scheitern des Stalinismus wie auch anderer Autarkiemodelle - wie des Kemalismus in der Türkei - hat in den letzten Jahren diese Aussagen bestätigt.In seiner Erwiderung behauptete Robert Kurz, diese von uns vertretene Argumentationslinie führe geschichtsphilosophische Begriffe wie „fortschrittlich“ oder „reaktionär“ in die Diskussion ein, welche aus der Zeit der Aufklärung und von Hegel stammen und heute fragwürdig geworden sind. Darauf entgegneten wir, dass die Vorstellung, wonach der Kapitalismus, wie jede andere Produktionsweise, nach einer Phase der Förderung der Entwicklung der Gesellschaft zu einer Fessel dieser Entwicklung wird, nicht von Hegel stammt, sondern zu den Grundlagen des zuerst von Marx entwickelten historischen Materialismus gehört. Aufgrund von Zeitmangel konnte jedoch diese Diskussion leider nicht fortgeführt werden.Abgesehen von dieser Frage konzentrierte sich der Vortrag von Kurz im Wesentlichen auf eine Kritik an anderen gängigen „linken“ Auffassungen, die er als „Kapitalismuskritik light“ bezeichnete. Dabei ging er wesentlich behutsamer vor als ein Vertreter der „Antideutschen“, der die „Globalisierungsgegner“ von Heiligendamm undifferenziert als „antisemitischen Mob“ bezeichnete. Was allerdings Kurz wie viele andere „Marxologen“ aus unserer Sicht kennzeichnet, ist, dass sie nichts als Kritik und keine Perspektiven anzubieten haben. Dabei rührt der Reichtum beispielsweise der von Marx entwickelten Kritik an der „politischen Ökonomie“ gerade daher, dass er den Kapitalismus vom Standpunkt seiner Überwindung aus betrachtete – vom Standpunkt des Kommunismus. Dez 2007,
Gegen die Angriffe der Regierung müssen wir alle gemeinsam kämpfen
- 2904 reads
Im Namen einer „gerechteren Gesellschaft“ haben Sarkozy und seine Milliardärskumpels die Unverfrorenheit, uns aufzufordern, die Abschaffung bzw. Änderung der „Sonderrentenrechte“ zu akzeptieren und 40 Jahre lang für die Rente zu arbeiten. Was die Eisenbahnarbeiter, die Beschäftigten der RATP, der Gas- und Elektrizitätswerke fordern, wurde deutlich in ihren Hauptversammlungen zum Ausdruck gebracht: Sie wollen keine „Privilegien“, sie wollen die siebenundreißigeinhalb Jahre für alle! Wenn dieser Angriff auf die „Sonderrentenrechte“ hingenommen wird, dann wird, wie die ArbeiterInnen sehr gut wissen, der Staat demnächst von uns fordern, erst 41, dann 42 Jahre lang Beiträge zu leisten, um eine vollständige Rente zu erhalten – möglicherweise sogar noch länger, wie in Italien (das demnächst zu einem Renteneintrittsalter von 65 übergehen wird) oder in Deutschland und Dänemark, wo das Renteneintrittsalter auf 67 Jahre ausgedehnt wurde.
In den Universitäten hat diese Regierung (in Komplizenschaft mit der UNEF – der französischen Studentengewerkschaft – und der Sozialistischen Partei) klammheimlich ein Gesetz verabschiedet, das Tür und Tor öffnet für ein Universitätssystem der zwei Geschwindigkeiten: auf der einen Seiten ein paar „Eliteuniversitäten“, die für die Studenten mit dem besten Abschluss reserviert sind, und auf der anderen Seite eine Masse von niederen Universitäten, die die meisten jungen Studenten, die aus ärmeren Verhältnissen kommen, auf ihre künftige Rolle als arbeitslose oder prekäre ArbeiterInnen vorbereiten.
Im Öffentlichen Dienst stellt sich die Regierung darauf ein, bis 2012 300.000 Arbeitsplätze zu vernichten, und dies just zu einer Zeit, in der LehrerInnen sich überfüllten Klassenzimmern gegenübersehen und in der eine wachsende Zahl von Staatsangestellten dazu gezwungen wird, immer mehr Aufgaben zu erfüllen und immer mehr Stunden zu arbeiten. Im privaten Sektor finden alle Nase lang Stellenabbau und Entlassungen statt, und dies zu einer Zeit, in der die Sarkozy-Regierung eine Reform des Arbeitsrechts ausheckt, deren Schlüsselwort „Flexi-Sicherheit“ lautet, die es den Arbeitgebern noch leichter machen wird, uns auf die Straße zu werfen. Ab dem 1. Januar 2008 werden wir neue Gesundheitsbeiträge zahlen dürfen, die von gestiegenen Rezeptgebühren, von wachsenden Krankenhausgebühren (eingebracht vom früheren Minister Ralite, einem Mitglied der Kommunistischen Partei Frankreichs), von einer Gebühr in Höhe von 90 Euros für medizinische Operationen, etc. begleitet werden.
Sarkozy fordert uns auf, „mehr zu arbeiten, um mehr zu verdienen“. Doch tatsächlich werden wir dazu aufgefordert, mehr zu arbeiten und weniger zu verdienen. Der Schwindel erregende Fall in der Kaufkraft wird nun auch noch von einem exorbitanten Preisanstieg aller Grundnahrungsmittel flankiert: Milchprodukte, Brot, Kartoffeln, Obst und Gemüse, Fisch, Fleisch... Gleichzeitig schnellen die Mietpreise in die Höhe: Immer mehr ProletarierInnen leben in unsicheren oder ungesunden Wohnverhältnissen. Immer mehr ProletarierInnen, selbst jene mit einem Job, sinken in die Armut, sind nicht in der Lage, sich eine anständige Ernährung, Wohnung und Gesundheitsfürsorge zu leisten. Und doch erzählen sie uns: „Es ist noch nicht vorbei“. Die Zukunft, die sie für uns parat halten, die Angriffe, die sie uns versprechen, werden noch schlimmer sein. Und dies, weil die französische Bourgeoisie nun versucht, zu ihren Rivalen in den anderen Ländern aufzuschließen. Angesichts der Verschlimmerung der Krise des Kapitalismus, der Verschärfung der Konkurrenz auf dem Weltmarkt müsse man „konkurrenzfähig“ sein. Dies bedeutet die Steigerung der Angriffe auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeiterklasse.
Der einzige Weg, sich diesen Angriffen zu widersetzen, ist die Aufnahme des Kampfes
Der Zorn und die Unzufriedenheit, die sich heute auf den Straßen und den Arbeitsplätzen artikuliert, konnte sich nur verbreiten, weil überall die ArbeiterInnen mit der Notwendigkeit konfrontiert sind, auf die gleichen Angriffe zu reagieren. Seit 2003 hat die Arbeiterklasse (die laut der Bourgeoisie eine „überholte Idee“ ist) ihren Willen demonstriert, Widerstand zu leisten gegen die Angriffe auf die Renten 2003 in Frankreich und Österreich, gegen die Reform des Gesundheitswesens, gegen Entlassungen in den Schiffswerften im spanischen Galizien 2006 oder im Automobilsektor in Andalusien im letzten Frühjahr. Heute kämpfen ihre Klassenbrüder bei den deutschen Eisenbahnen für Lohnerhöhungen. In all diesen Kämpfen, von Chile bis Peru, von den Textilarbeiterinnen in Ägypten bis zu den Bauarbeitern in Dubai, wird das Entstehen eines tiefen Gefühls der Klassensolidarität sichtbar, welches die Ausweitung der Kämpfe gegen die gemeinsam erlittene Ausbeutung vorantreibt. Dieselbe Klassensolidarität erhob ihr Haupt in der Studentenbewegung gegen die CPE im Frühjahr 2006 und befindet sich im Zentrum der heutigen Bewegung. Vor nichts fürchtet sich die Bourgeoisie mehr als davor.
Die Gewerkschaften spalten und sabotieren die Antwort der ArbeiterInnen
Zuerst dem Sonderrentenrecht besonders in Bereichen wie den öffentlichen Transport (SNCF, RATP) und der Energie (EDF, GDF) an den Kragen zu gehen erbringt dem Staat nur lächerliche Ersparnisse. Es handelt sich um eine rein strategische Wahl, die darauf ausgerichtet ist, die Arbeiterklasse zu spalten. Die Linke und die Gewerkschaften sind im Grunde völlig in Übereinstimmung mit der Regierung. Sie haben stets die Notwendigkeit von „Reformen“ hervorgehoben, besonders auf dem Gebiet der Renten. Mehr noch, es war der frühere sozialistische Premierminister Ricard gewesen, der Anfang der 1980er Jahre das „Weißbuch“ über die Renten produziert hatte, das als Blaupause für all die Angriffe diente, welche von den folgenden Regierungen, linken wie rechten, in die Praxis umgesetzt wurden. Die Kritik, die heute von den Linken und den Gewerkschaften geübt wird, gilt lediglich der Form: Die Angriffe seien nicht „demokratisch“ beschlossen worden, es habe nicht genügend „Konsultationen“ gegeben. Da die Linken zeitweilig raus aus dem Spiel sind, fällt die entscheidende Rolle bei der Kontrolle der Arbeiterklasse den Gewerkschaften zu. Letztere teilen sich die Arbeit mit der Regierung und unter sich auf, mit dem Ziel, die Antwort der ArbeiterInnen zu spalten und zu sabotieren. Die Bourgeoisie muss vor allem die ArbeiterInnen vom öffentlichen Transportsektor isolieren, sie von der restlichen Arbeiterklasse abschneiden.
Dies im Hinterkopf, hat die Bourgeoisie die gesamten Medien aufgeboten, um den Streik zu diskreditieren und die Idee zu streuen, dass andere ArbeiterInnen von einer egoistischen Minderheit privilegierter Arbeiter zur Geisel genommen werden, indem sie ausgiebigen Gebrauch von der Tatsache machte, dass der vom „Sonderrentenrecht“ am meisten betroffene Sektor der öffentliche Transport ist. Sie zählte dabei auf die Unbeliebtheit eines langen Transportstreiks, besonders in der SNCF (traditionell der kämpferischste Bereich, wie in den Streiks vom Winter 1986/87 und 1995), um die „Passagiere“ gegen die Streikenden aufzubringen.
Jede Gewerkschaft spielte ihre Rolle bei der Spaltung und Isolierung der Kämpfe:
-
Die FGAAC (die kleine Zugführergewerkschaft, welche lediglich drei Prozent der SNCF-ArbeiterInnen respräsentiert, aber immerhin 30 Prozent aller Zugführer) rief, nachdem sie zu einer „Neuauflage“ des Streiks am 18. Oktober zusammen mit den Gewerkschaften SUD und der FO aufgerufen hatte, noch am Abend der Demonstration zu Verhandlungen mit der Regierung, um einen „Kompromiss“ und einen speziellen Status für die Zugführer auszuarbeiten, und schließlich zur Wiederaufnahme der Arbeit am nächsten Morgen auf, übernahm also die Rolle des durchtriebenen „Verräters“.
-
Die CFDT (eine Gewerkschaft, die mit der Sozialistischen Partei verlinkt ist) rief nur die Eisenbahnarbeiter zum Streik und zur Demonstration an diesem Tag auf, um „nicht alle Probleme und Forderungen zu vermischen“, um ihren Generalsekretär Chereque zu zitieren; anschließend beeilte sie sich, ausgerüstet mit derselben Taktik, zur Suspendierung des Streiks in der SNCF und zur Rückkehr zur Arbeit in anderen Bereichen aufzurufen, sobald die Regierung ihre Absicht ankündigte, Verhandlungen von Unternehmen zu Unternehmen zu eröffnen.
-
Die CGT, die Hauptgewerkschaft (die mit der Kommunistischen Partei verbunden ist), spielte eine ausschlaggebende Rolle bei dem Manöver, die ArbeiterInnen zurückzudrängen. Sie beschränkte sich selbst auf einen 24-stündigen Streik am 18. Oktober (und überließ es den regionalen Gewerkschaften, die „Initiative“ bei der Verlängerung des Streiks zu übernehmen). Dann übernahm sie die Initiative bei der Ausrufung eines neuen Eisenbahnerstreiks, diesmal für den 13. November, und scharte andere Sektoren und Gewerkschaften hinter diesem Vorschlag. Am 10. November bat der Generalsekretär der CGT, Thibault, die Regierung, multilaterale Verhandlungen (Regierung, Management und Gewerkschaften) über die Sonderrechte zu eröffnen (was nichts als ein Bluff war, weil es die Regierung ist, die den Direktoren öffentlicher Unternehmen direkt ihre Politik diktiert); zwei Tage später, am 12., dem Vorabend des Streiks, rief sie zu einer neuen Initiative auf: Sie schlug erneute multilaterale Verhandlungen vor, diesmal von Unternehmen zu Unternehmen. Dies hieß, die ArbeiterInnen für Idioten zu halten, weil es exakt dieser Rahmen war, den die Regierung ursprünglich anstrebte, um ihre Reformen voranzutreiben, nämlich die Verhandlung zu stückeln, Unternehmen für Unternehmen, Fall für Fall. Diese Kehrtwendung provozierte wütende Reaktionen in den Hauptversammlungen, was die Gewerkschafts“basis“ dazu zwang, die Fortsetzung des Streiks zu befürworten.
-
FO und SUD (eine Gewerkschaft, die von der trotzkistischen Ligue Communiste Revolutionaire unter der Führung von Olivier Besancourt gelenkt wird) versuchten, den Streik noch einige Tage nach dem 18. Oktober mittels einer Minderheit weiterlaufen zu lassen, und fuhren fort, sich gegenseitig dabei zu überbieten, die radikalste Gewerkschaft zu sein. Sie drängten die ArbeiterInnen dazu, den neuaufgelegten Streik bis zum All-Gewerkschafts-Streik am 20. November im Öffentlichen Dienst fortzuführen, und riefen dazu auf, Kommandoaktionen wie die Blockierung der Schienen durchzuführen, statt danach zu streben, den Kampf auf andere Sektoren auszuweiten.
-
Ein Führer der UNSA, ebenfalls Anhänger einer Streik-Neuauflage, erklärte, dass die Demonstrationen getrennt stattfinden sollten und dass die Eisenbahnarbeiter nicht mit öffentlichen Angestellten marschieren sollten, weil „sie nicht dieselben Forderungen haben“.
In dieser Phase gelang es all diesen Gewerkschaften, bei der EDF und der GDF eine ruhige Rückkehr zur Arbeit zu bewerkstelligen. Am Mittwoch, den 21., unmittelbar nach der Demonstration, traten die sechs Gewerkschaftsverbände mit einer Plattform von spezifischen Forderungen in die Verhandlungen über die Zukunft der Eisenbahner.
Um wirksam zu kämpfen, können wir uns nur auf uns selbst verlassen!
Trotz des Bestrebens der Regierung, den Arbeiterwiderstand zu brechen, trotz aller gesetzlicher Verbote, die samt und sonders darauf abzielten, die Rückkehr zur Arbeit zu erzwingen, trotz der Komplizenschaft der Gewerkschaften und ihrer Sabotagearbeit blieb nicht nur der Zorn und die Militanz der ArbeiterInnen erhalten; zunehmend machte sich auch die Erkenntnis von der Notwendigkeit breit, die verschiedenen Kämpfe zu vereinen. Zum Beispiel in Rouen am 17. November, wo Studenten von der Fakultät von Mont-Saint-Aignan loszogen, um streikende Eisenbahnarbeiter aufzusuchen, gemeinsam mit ihnen aßen und an ihren Hauptversammlungen wie auch an der Operation „Freie Passage“ auf der Autobahn teilnahmen. Allmählich kommen Keime der Idee von der Notwendigkeit eines massiven und vereinten Kampfes der gesamten Arbeiterklasse gegen die unvermeidliche Häufung von Angriffen seitens der Regierung zum Vorschein. Damit dieser Kampf Realität wird, müssen die ArbeiterInnen die Lehren aus der Gewerkschaftssabotage ziehen. Um wirksam zu kämpfen, um den Kampf auszuweiten, können sie sich nur auf sich selbst verlassen. Sie haben keine andere Wahl, als durch ihre eigenen Kämpfe die Sache selbst in die Hand zu nehmen und die Fallen sowie spalterischen Manöver der Gewerkschaften zu demaskieren. Mehr als jemals zuvor liegt die Zukunft in der Weiterentwicklung des Klassenkampfes.
Wm 18.11.07
Geographisch:
- Frankreich [2]
Aktuelles und Laufendes:
- Arbeiterkampf [3]
Intervention von IKS-Mitgliedern auf zwei Eisenbahnerversammlungen
- 3049 reads
Am Montag, den 19. November, nahm in einer großen Provinzstadt eine kleine Gruppe von Studenten, die auf unserer letzten öffentlichen Veranstaltung gewesen war, eine Delegation von älteren politisierten Arbeitern, Mitglieder der IKS, zu zwei Hauptversammlungen von Eisenbahnern mit. Da die Gewerkschaften darauf geachtet hatten, dass diese Versammlungen in verschiedene Sektoren aufgespalten wurden, teilten sich unsere Genossen auf, um auf beiden Versammlungen zu reden: auf einer Versammlung des Bahnhofspersonals und auf einer Versammlung der Lokführer.
In beiden Versammlungen gab es einen herzlichen Empfang durch die Eisenbahner. Auf dem Treffen des Bahnhofspersonals stellte sich unser Genossen mit den Worten vor, dass er kein Eisenbahner sei, sondern ein pensionierter Arbeiter, dass er dennoch gekommen sei, um seine Solidarität zum Ausdruck zu bringen. Er fügte hinzu, dass er, wenn möglich, gern sprechen würde, um seine Gedanken darzulegen über das, was Solidarität bedeutet. Die EisenbahnerInnen, die ihn willkommen geheißen hatten, dankten ihn für sein Kommen und sagten: „Natürlich kannst du sprechen.“
Die Versammlung begann gegen halb zwölf und endete gegen halb eins. In der Leitung der Versammlung saß ein Haufen Gewerkschaftsrepräsentanten: FO, CFDT, CFTC, CGT, SUD... Jeder von ihnen hielt eine Rede, in der er uns an die Forderungen der Bewegung erinnerte und sagte, dass es notwendig sei, ein Kräfteverhältnis „auf höherer Stufe“ zu etablieren; in der er die Verhandlungen, die erst kürzlich angekündigt worden waren, als eine Perspektive für den Kampf darstellte und darauf bestand, dass die Versammlungen entscheiden müssen – dies alles jedoch mit einem stark regionalistischen Unterton. Nicht nur, dass es eine Versammlung für einen einzigen Bereich war; darüber hinaus mangelte es ihren Interventionen an jeglichem Interesse für die Lage der Studenten und der Angestellten des Öffentlichen Dienstes. Ein Gewerkschaftsdelegierter behauptete gar, dass die Perspektive darin bestünde, zu kämpfen, um „Reformen zu erlangen“, und nicht darin, gemeinsam zu kämpfen, da es nicht die Orientierung der Gewerkschaften sei, alles zu „revolutionisieren“. Der CFDT-Repräsentant äußerte, dass die regionale Föderation nicht mit der nationalen Führung übereinstimme, die zur Beendigung des Streiks aufgerufen hatte.
Im Anschluss an diese Reden ging ein junger Eisenbahner auf unseren Genossen zu und sagte: „Du kannst sprechen, wenn du möchtest.“ Die Gewerkschaftsredner, die begriffen, was vor sich ging, sagten, dass es notwendig sei, noch ein bisschen zu warten, ehe man ihm das Wort erteilt. Zunächst müsse man zur Abstimmung über den erneuerbaren Streik schreiten, erst dann könne man den seinen Vorschlägen zum weiteren Vorgehen zuhören. Dies beweist nur, dass am Vorabend der Demonstration vom 20. November die Gewerkschaftsrepräsentanten sich veranlasst sahen, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Dagegen unterließ sie es im öffentlichen Sektor, aus Solidarität mit den Eisenbahnern zum Kampf aufzurufen (1). Es lag auf der Hand, dass die Gewerkschaften nicht begierig auf diese „Minderheit“ von Studenten waren, die nur Ärger bereiten konnten und ihre „Kiste der Ideen“ (nach dem Modell der Bewegung gegen den CPE im Frühjahr 2006) zur Eisenbahnerversammlung mitbrachten, die die Gewerkschaftsfunktionäre als ihr Privateigentum betrachteten. Diese Art von Versammlung, organisiert, gemanagt und sabotiert von den Gewerkschaften, sah keine wirkliche Diskussion, keinen Gedankenaustausch vor, ja erlaubte sie nicht. Und doch gab es eine ganz reale Wut und Kampfbereitschaft. Von den 117 Stimmen stimmten 108 EisenbahnerInnen für die Wiederaufnahme des Streiks. Erst nach der Abstimmung wurde unser Genosse ans Mikrophon gelassen. Für die Gewerkschaften waren Vorschläge von „auswärtigen Elementen“ nicht dazu da, von den EisenbahnerInnen diskutiert zu werden. Hier ist der Inhalt seiner Intervention:
„Ich bin kein Eisenbahner. Ich bin Rentner. Doch ich bin gekommen, um meine Solidarität mit eurem Kampf auszudrücken. Von ‚außen‘ besehen, gibt es heute etliche Kämpfe gegen die Angriffe, die das Leben der ArbeiterInnen und die Arbeitsbedingungen betreffen. Ihr, die ihr für eure Renten kämpft, die Studenten, die in Zukunft Arbeiter sein werden und die gegen eine Reform kämpfen, die bestimmte Hochschulen in niedere Universitäten verwandelt, die Angestellten des Öffentlichen Dienstes (wie jene von der Nationalen Bildung) werden morgen demonstrieren, da ihre Arbeitsbedingungen immer unerträglicher werden und ein Haufen Jobs flöten gegangen sind. All diese Kämpfe sind derselbe Kampf für die Verteidigung unserer Lebensbedingungen. Ich habe gerade gehört, dass wir ein Kräfteverhältnis auf einer ‚höheren Stufe‘ durchsetzen sollten. Ich stimme dem zu. Doch wie bewerkstelligen wir dies? Ich denke, dass wir alle zusammen kämpfen müssen. Dies deshalb, weil es eine Menge Solidarität seitens der Lohnabhängigen gegenüber den Studenten gab, so dass angesichts massiver Demonstrationen gegen den CPE die Regierung am Ende zurückweichen musste. Morgen müssen wir in großer Zahl zur Demonstration gehen, aber ich denke auch, dass es gut wäre, wenn es einen Banner gäbe, wo so etwas wie ‚Eisenbahner, Studenten, öffentliche Angestellte: alle vereint im Kampf‘ draufsteht. Und schließlich ist es am Ende der Demo nötig, dass die Eisenbahner, statt nach Hause oder in ein Café zu gehen, mit den Studenten, die öffentlichen Angestellten mit den Eisenbahnern und Studenten diskutieren. Wir müssen miteinander diskutieren, weil wir nur so beginnen können, die benötigte Einheit zu schmieden. Der einzige Weg, um uns selbst gegen die Attacken zu verteidigen, ist, diese Einheit zu bilden.“ Die Intervention erhielt einen freundlichen Beifall.
Bevor die Versammlung begonnen hatte, hatte unser Genosse ein wenig mit den Eisenbahnern über die Lügen in den Medien diskutiert. Diese Lügen sind jedem klar, außer den Blinden und den Tauben (und den Gegendemonstranten von Liberté Cherie). Am Ende der Versammlung kam er noch einmal mit einer kleinen Gruppe von jungen Eisenbahnern ins Gespräch. Er fragte sie: „Wie denkt ihr über ein gemeinsames Banner?“ Einer von ihnen antwortete: „Eigentlich sind die meisten dafür, aber die Gewerkschaften sind dagegen.“ Deutlicher kann man sich kaum über die spalterische Rolle der Gewerkschaften äußern. Dennoch entwickelt sich, trotz des Widerstandes der Gewerkschaften, allmählich die Idee der Einheit und Solidarität unter allen ArbeiterInnen.
In der anderen Hauptversammlung, der der Lokführer, wurden unsere Genossen, welche die Studenten begleiteten, gleichfalls sehr herzlich willkommen geheißen. Sie waren in der Lage, zu intervenieren, um dieselbe Orientierung wie unsere anderen Genossen zu vertreten. Die Studenten waren begeistert über die Idee eines gemeinsamen Banners. Die Interventionen der Studenten und unserer Genossen stießen auf offene Ohren, trotz der Tatsache, dass die Lokführer noch immer die Illusion hatten, dass sie sich allein erfolgreich verteidigen könnten, da sie den Verkehr lahmlegen könnten. Es ist aber die Einheit der ArbeiterInnen und nicht das simple „Blockieren“, was die Stärke der Arbeiterklasse ausmacht. Dieser Fetisch des „Blockierens“ ist heute das neue Ass im Ärmel der Gewerkschaften und bezweckt die Verhinderung jeglicher wirklichen Ausweitung und Vereinigung der Kämpfe.
Seit dem 18. Oktober ging es darum, eine Klasseneinheit gegen die spalterische Arbeit der Gewerkschaften zu bilden. Doch wie diese kleine Gruppe von Studenten in einer Diskussion mit uns nach der Versammlung sagte: „Die Attacken der Bourgeoisie gegen alle Bereiche der Arbeiterklasse sind so breit gefächert, dass dies nur die Tendenz zur Einheit der Kämpfe erleichtern kann.“ Diese kleine Studentengruppe hat sehr gut verstanden, was ein Student von der Universität von Cenesier in Paris 2006 gesagt hatte: „Wenn wir alle allein kämpfen, werden sie uns zum Frühstück verspeisen.“ Und weil sie nicht ihre Eisenbahner-Genossen der Isolation überlassen wollten, die ansonsten von den Milizen des Kapitals aufgemischt worden wären, hielten sie Ausschau nach der Solidarität von authentischen Kommunisten (einige von ihnen waren in den 70er und 80er Jahren von der CGT-Gewerkschaft physisch angegriffen worden). Es trifft allerdings zu, dass seit dem Fall der Berliner Mauer die CGT und die so genannte Kommunistische Partei sehr viel „demokratischer“ geworden sind. Die Studenten, die in der Lage gewesen waren, die Tür zu den Eisenbahnerversammlungen (die im Gefängnis der örtlichen Gewerkschaftsfunktionäre gehalten wurden) aufzustoßen, sagten unseren Genossen: „Es ist großartig, solche ‚Eltern‘ wie euch zu haben.“ Sie sind völlig anders als die „aufbegehrenden“ Studenten Ende der 60er Jahre, die so sehr von der „Generationenlücke“ gezeichnet waren und die in ihrer Rebellion gegen ihre Eltern, die den Terror des Nazismus und Stalinismus erlebt hatten, zu Slogans griffen wie: „Bringt die ältere Generation in die Konzentrationslager!“ (2).
Die Intervention unserer Genossen bezweckte nicht, Mitgliedskarten zu verkaufen und zu jedem Preis zu rekrutieren, da die IKS anders als die Trotzkisten und andere Organisationen der „Linken“ keine Organisation ist, die am bürgerlichen Wahlzirkus teilnimmt. Auch ist es nicht ihr Ziel, „der Bewegung unter die Arme zu greifen, wie einige Anti-Partei-Ideologen denken. Was jene anbelangt, die weiterhin blinden Alarm schlagen und vor den zähnefletschenden Bolschewiki warnen, so können wir nur dazu raten, endlich einmal die tatsächliche Geschichte kennenzulernen und nicht die Lügen der bürgerlichen Propaganda zu wiederholen. Die neue Generation der Arbeiterklasse, ob Eisenbahner oder Studenten, entdeckt die Wahrheit über die reale „Demokratie“ und über die wahre Solidarität, selbst wenn sie noch Illusionen hat und nicht auf die Schule der Erfahrung verzichten kann. Der Mut, den sie schon jetzt besitzt, wo sie gerade beginnt, den Direktiven der Gewerkschaftsbosse nicht zu folgen und die wahre Kultur der Arbeiterklasse zum Leben wiederzuerwecken, zeigt, dass die Zukunft der Menschheit immer noch in ihren Händen liegt.
GM, November 2007
Geographisch:
- Frankreich [2]
Aktuelles und Laufendes:
- Arbeiterkampf [3]
Lohnkampf der Krankenschwestern in Finnland im Herbst 2007
- 3597 reads
In Finnland gab es neulich eine ungewöhnliche Arbeitskampfmethode der Krankenschwestern. Die Gewerkschaft für das Krankenpflegepersonal, Tehy, hatte ihre Mitglieder dazu aufgerufen, zum 19. 11. 2007 ihre Arbeitsstelle zu kündigen, sollte der kommende Tarifvertrag ihre Forderungen nicht erfüllen. Die Gewerkschaft fordert 430 bis 650 Euro pro Monat, zu realisieren innerhalb der kommenden zweieinhalb Jahre. Die Unzufriedenheit unter dem Krankenhauspersonal war groß, der durchschnittliche Lohn bei Krankenschwestern mit mehrjähriger Berufserfahrung liegt so um die 1400,00 Euro netto. Knapp 13 000 KrankenpflegerInnen hatten sich verpflichtet, gemeinsam zu kündigen. Das ist ungefähr die Hälfte der Pflegepersonals in finnischen Krankenhäusern. Sie hatten die Nase voll, ließen sich auch nicht durch der Hetzkampagnen seitens der Regierung und der Medien von ihrem Vorhaben abbringen. Die schlecht bezahlten Krankenschwestern und Pfleger hatten große Sympathie bei den Arbeitern, die wussten, dass es notwendig ist, sich gegen die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen zu wehren. Die Protestierenden hatten auch die Gewissheit, wiedereingestellt zu werden, da es in Finnland an Pflegepersonal mangelt.
Die jetzige Mitte-Rechts-Regierung unter dem ‚liberalen’ Ministerpräsident Matti Vanhanen ist erst im März dieses Jahres gewählt worden. Die Lohnforderung des Krankenhauspersonals entspricht dem Wahlversprechen des rechten Koalitionspartners. Sie hatten versprochen, im Falle ihres Wahlsieges die Gehälter um 540 Euro zu erhöhen, um so, wie es hieß, den europäischen Standard zu erreichen. Das hatten die Betroffenen ernst genommen.
Die Krankenhausverwaltungen warnten vor chaotischen Zuständen. Die Arbeitgeber drohten zudem, dass es keine automatische Wiedereinstellung nach Beendigung des Konfliktes geben werde. Sie warfen den kämpfenden Krankenschwestern vor, dass diese Arbeitskampfmaßnahme Menschenleben aufs Spiel setze. Wer Menschenleben wirklich aufs Spiel setzt, dazu nur ein Beispiel aus dem ganz normalen üblichen Alltag: Wie überall werden auch in Finnland viele Kliniken geschlossen, so dass Geburten im Krankenwagen keine Seltenheit mehr sind. In Lappland kann der Weg zur Klinik 500 km betragen, aber das Problem ist kein typisches für Lappland, in Süd - Finnland werden sogar noch mehr Kinder im Krankenwagen geboren.
Die Arbeitgeber riefen nach Gesetzesänderungen, um Arbeitskämpfe in „kritischen“ Bereichen einschränken zu können. Die Arbeitgeber klagten vor dem Arbeitsgericht, dass 800 Kündigungen rechtswidrig wären. Sie bekamen recht. Die 800 Krankenschwestern mussten ihre Kündigungen zurückziehen, da sie als Beamte laut Gerichtsbeschluss gar nicht an Arbeitskämpfen teilnehmen dürften und die Kündigungen ja eine Arbeitskampfmaßnahme wären. Die Gewerkschaften versuchten, wie so oft, den Kampf der Arbeiterklasse auf den Boden der Gerichte zu ziehen, indem sie vor dem Arbeitsgericht die Klage einreichten, dass die Arbeitgeber den Krankenschwestern ungesetzlicherweise Drohbriefe geschickt hätten, worin stand, dass ihre Stellen Arbeitsuchenden angeboten würden. Das Gericht gab der Klage nicht statt.
Die Krankenhäuser mussten Notpläne machen, worin der Transport von Kranken mit dem Flugzeug nach Upsala in Schweden und nach Bonn in Deutschland vorgesehen war. Die Verhandlungen kamen nicht wie gewünscht voran. Die Kampfbereitschaft beim Pflegepersonal war enorm. Die Regierung beschloss am Vorabend des Kündigungstermins am 17. 11. ein Gesetz zum Schutz der Patienten. Dieses Gesetzt erlaubt die Zwangsverpflichtung des Krankenhauspersonals. Man hatte vor über 2600 Krankenschwestern per brieflicher Ladung zur Arbeit zu zwingen. In Interviews sagten die Krankenschwestern und Pfleger, dass sie dafür Sorge getroffen hätten, dass man sie nicht zuhause anträfe, sollten Zwangsverpflichtungen vorgenommen werden, und viele würden endgültig ihrem Pflegejob den Rücken kehren. Die Krankenschwestern, die nicht an diesen Kampfmaßnahmen teilnahmen, sagten, sie würden auch überlegen, was man anderes beruflich machen könnte, weil die Zustände untragbar wären.
Buchstäblich in letzter Minute am 19. November einigen sich die Arbeitgeberseite und die Gewerkschaft Tehy auf einen Tarifvertrag, der eine Laufzeit von vier Jahren hat, und eine Gehaltssteigerung von 22% – 28% monatlich vorsieht. Außerdem gibt es eine Einmalzahlung von 270 Euro im Dezember. Die Freude ist bei den Krankenschwestern groß. Sie sind aber auch empört, dass man sie beschuldigt hat, die Kranken im Stich zu lassen und dass man so weit gehen muss, selbst zu kündigen, um eine Lohnerhöhung zu bekommen. Ein Kommentar einer Krankenschwester: „Lange hat man uns erzählt, es gäbe genug Arbeitslose, die unsere Arbeit mit Kusshand übernehmen würden, jetzt stellt man fest, dass es doch nicht so einfach ist.“ Im Gegenteil, man war drauf und dran, das Krankenhauspersonal zwangszuverpflichten. Es gibt aber sofort zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern Uneinigkeit darüber, wie dieser Vertrag ausgelegt wird. Die Kommunen wollen den Vertrag als Arbeitgeber so auslegen, dass die Gehaltserhöhung zwischen 16% und 18% liegt. Die Frage, für wen dieser Vertrag gilt, ist offen. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass der Vertrag nur für ihre Mitglieder gilt, leider denken auch Teile der Krankenschwestern so. So versucht man den Kampf im Gesundheitswesen, welcher von den Betroffenen selbst ausging, dazu auszunutzen, um das Personal zu zwingen, der Gewerkschaft beizutreten, um die Lohnerhöhung überhaupt zu erhalten. Bedenklich scheint den Betroffenen Klausel im Vertrag, dass ein Teil der Erhöhung an die Entwicklung der Produktivität gekoppelt ist. Also, je weniger Krankenschwestern es im Jahre 2010 sind, desto höher werden die Löhne der verbleibenden Krankenschwestern und –pfleger ausfallen. Diese Klausel im Vertrag zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberseite ist eine Schweinerei. Die Krankenschwestern sollen im ‚eigenen’ Interesse dafür sorgen, dass Personal abgeschafft wird, damit sie mit ihren Löhnen über die Runden kommen. Überall wird jetzt gewiss, dass die Gewerkschaften, nachdem sie sich in der Öffentlichkeit profiliert haben, im Stillen den Vertrag möglichst zu Ungunsten der Arbeiter auslegen werden.
Der Premierminister Vanhanen hat zwei Tage nach dem Zustandekommen des Tarifvertrages eine Rede gehalten, wobei die Gewerkschaft wie die Sozialdemokratie ihr Fett abbekamen. Er warf der Gewerkschaft Tehy vor, ihre Mitglieder nicht darüber informiert zu haben, dass falls Patienten zu Schaden oder gar zu Tode kämen, die Krankenschwestern persönlich dafür hätten haften müssen. Er beschuldigte das Personal, sie hätten mit ihren Kündigungen, durch die sie höhere Löhne erzwingen wollten, also nur für mehr Geld die Gesundheit und das Leben der Patienten aufs Spiel gesetzt zu haben. Besonders scharf griff er die Sozialdemokratische Partei an, sich ganz offen an die Seite der Kämpfenden gestellt zu haben, und damit unverantwortlicherweise ein solches Verhalten der Krankenschwestern gutgeheißen hätte. Der Bourgeoisie kommt es zugute, wenn die Sozialdemokratie in der Opposition wieder an Glaubwürdigkeit gewinnen kann. Dazu trägt bei, es so hinzustellen, dass die Sozialdemokratie sich von der Rechten absetzt und von diesen bekämpft wird, dass sie für die Belange der Arbeiter einträte.
Diesen Lohnkampf der Krankenschwestern in Finnland muss man in Zusammenhang mit der weltweiten Situation der Arbeiterklasse sehen. Es ist bezeichnend, dass sich selbst in den Kernbereichen wie Lokführern oder Krankenschwestern immer mehr das Phänomen „working poor“ durchsetzt. Solche Streiks erfahren bei der Bevölkerung große Popularität und Unterstützung, so in Deutschland der Lokführerstreik oder in Frankreich der Streik der Eisenbahner. Die jeweiligen Bourgeoisien haben diese Streiks für etwas Spezifisches für diese Länder oder für bestimmte Berufsgruppen hingestellt. In all diesen Streiks haben die Betroffenen anhören müssen, dass sie egoistisch Vorteile für sich allein ergattern wollen, und keine Rücksicht auf die anderen nehmen würden. Trotz der Hetze in den Medien, hat die Bevölkerung ihre Sympathien im Großen und Ganzen den Streikenden entgegengebracht. Das ist gerade deshalb möglich, weil diese Bewegungen für bessere Lebensbedingungen keine Einzelerscheinungen sind. Die Leute spüren, dass die Kämpfenden ein Teil von uns Arbeitern sind, bewundern deren Mut und sehen in ihnen so etwas wie Vorkämpfer. Dieses Gespür innerhalb der Klasse kennt keine Landesgrenzen, sie ist international, so wie die Klasse selbst. (Anfang Jan.2008)
Aktuelles und Laufendes:
- Arbeiterkampf [3]
Nieder mit dem Polizeistaat. Solidarität aller Arbeiter mit den von der Polizei niedergeknüppelten Studenten!
- 3106 reads
Letzte Woche hat die Regierung Sarkozy/Fillon/Hortefeux/Pécresse und Konsorten (in stillschweigender Komplizenschaft mit der Sozialistischen Partei und der ganzen „pluralistischen Linken“) den Gipfel der Schande und des Sadismus überschritten. Nachdem bislang Illegale in Namen der Politik der „Auswahl der Einwanderer“ gewaltsam aus dem Land vertrieben wurden, sind nun die streikenden Studenten dran und man knüppelt wild auf sie ein. Die Studenten, die sich gegen das Gesetz zur Privatisierung der Universitäten (LRU) wehren, sehen sich nun schlimmster Repression ausgesetzt. Im Namen von „Demokratie“ und „Freiheit“ trafen einige Universitätspräsidenten, die sich an das Kapital verkauft haben, die Entscheidung, die Bürgerkriegspolizei CRS und die mobilen Eingreiftruppen herbeizurufen, um die besetzten Universitäten in Nanterre, Tolbiac, Rennes, Aix-Marseille, Nantes, Grenoble frei zu knüppeln.
Die Ordnung des kapitalistischen Terrors
Die Repression war besonders heftig in Rennes und vor allem in Nanterre. Nach anfänglichem Einsatz von Polizeihunden haben die Universitätspräsidenten Hundertschaften vom CRS angefordert, um die Unis zu räumen. Die besetzenden Studenten wurden mit Knüppeln und Tränengas vertrieben. Mehrere Studenten wurden verletzt und verhaftet. Die CRS haben ihren Sadismus auf die Spitze getrieben, als sie einem Studenten die Brille (ein Symbol derjenigen, die studieren und Bücher lesen!) wegrissen und zerstörten. Die Sarkozy und dem Kapital treuen Medien haben über die Repression berichtet und sie gerechtfertigt, als sie die Stellungnahmen der Universitätspräsidenten veröffentlichten. In den 20-Uhr-Nachrichten des Fernsehkanals France 2 rechtfertigte der Präsident der Universität Nanterre die Repression mit den Worten: „Dies ist kein Kampf, dies sind jugendliche Delinquenten“. Ein anderer hysterischer Diener des Kapitals, der Präsident der Universität Rennes, behauptete ohne Skrupel, dass die Revoltierenden „Terroristen und Rote Khmer“ seien.
Es ist klar, dass der ehemalige erste Polizist Frankreichs, Nicolas der Kleine (Sarkozy war zuvor Innenminister), entschlossen ist, die französischen Universitäten mit dem Kärcher zu reinigen und die Kinder der Arbeiterklasse als „Strolche“ „Straftäter“, „Kriminelle“ abzustempeln (so der Präsident der Uni Nanterre). Und aus der Sicht der Politiker (wie sagte Madame Pécresse am 7. November in LCI? „Die Besetzungen sind vor allem ein politischer Akt“) handelt es sich nur um „Terroristen“. Als die Innenministerin Alliot-Marie ihren Polizisten den Einsatzbefehl zur Räumung der besetzten Universitäten erteilte, ging ihre „Freundin“, Madame Pécresse, in ihrem Zynismus sogar so weit, zu behaupten, dass sie den „Studenten ein Gefühl der Sicherheit vermitteln“ wolle.
Die Beschäftigten aus allen Bereichen sollen wissen: Wer auch immer in den Kampf tritt, wild und „unpopulär“ streikt (man kann sich darauf verlassen, dass die Medien und Tele-Sarkozy jeden Tag ihre Propaganda verschärfen werden), der wird, wie die Eisenbahner oder die U-Bahn-Beschäftigten, welche angeblich die „Reisenden in Geiselhaft“ nehmen, als „Terrorist“ und Störer der öffentlichen Ordnung bezichtigt werden.
Die wahre „gelbe Gefahr“ sind nicht die angeblichen „Roten Khmer“ der Universität Rennes. Es sind vielmehr die Vertreter der herrschenden Ordnung, die die Streiks der jungen Generation der Arbeiterklasse mit Hilfe der Spitzel und Kriecher niederknüppeln und mit Tränengas zerstreuen wollen: die Universitätspräsidenten. Die wahren „Terroristen“, die wahren Kriminellen sind diejenigen, die uns regieren und die schmutzigen Manöver dieser Gangsterklasse, der dekadenten Bourgeoisie, ausführen. Ihre Ordnung ist die des erbarmungslosen Terrors des Kapitals.
Diese Gangsterklasse gab sich jedoch nicht damit zufrieden, ihre Hundemeute und die Knüppelgarde der CRS auf die streikenden Studenten zu hetzen. In einigen Universitäten, die von der Polizei geräumt wurden, wurden auch die Streikkassen der Studenten „beschlagnahmt“. So hatten zum Beispiel in Lyon am 16. November besetzende Studenten einige Hundert Euro für ihre Streikkasse sammeln können. Während bis an die Zähne bewaffnete CRS die Uni räumten, beschlagnahmte die Universitätsverwaltung die Lebensmittel, die den Studenten gespendet worden waren, sowie deren Streikkasse. Das ist empörend und widerwärtig! Das Vorgehen der Kleinkriminellen der Bourgeoisie unterscheidet sich in nichts von der Vorgehensweise der „Schläger“ in den Vororten, die im November 2006 vom bürgerlichen Staat gegen die Anti-CPE-Bewegung mobilisiert worden waren, um die demonstrierenden Studenten anzugreifen und ihnen ihre Handys zu rauben!
Dies ist das wahre Gesicht der parlamentarischen Demokratie: Die öffentliche „Ordnung“ ist die Ordnung des Kapitals. Es ist die Ordnung des Terrors und des Kapitals, der Bullen und Medien. Eine Ordnung, die die Lügen und Manipulationen der Tele-Sarkozys verbreitet. Es ist die Ordnung der Machiavellis, die uns spalten wollen, um besser zu herrschen. Es ist die Ordnung derjenigen, die uns gegeneinander aufhetzen wollen und die gleiche Strategie benutzen wie die Vorgänger-Regierung Villepin/Sarkozy im Frühjahr 2006: Diese wollte die Bewegung durch die Anzettelung von Gewalt in die Sackgasse führen.
Die Solidarität zwischen Studenten und Eisenbahnern weist uns den Weg
Die wilde Repression gegen die Studenten ist ein dreister Angriff gegen die ganze Arbeiterklasse. Die große Mehrzahl der gegen die Privatisierung der Unis und die Einführung von Studiengebühren als Zugangskriterium zur Uni kämpfenden Studenten sind Arbeiterkinder und nicht, wie bestimmte Medien und die Sozio-Ideologen des Kapitals verbreiten, Kleinbürger. Viele von ihnen sind Kinder von Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes oder Einwandererkinder (insbesondere in Vorort-Unis wie in Nanterre oder Saint-Denis). Der proletarische Charakter des Kampfes der Studenten gegen das Précesse-Gesetz wurde durch die Tatsache ersichtlich, dass die Streikenden ihre Forderungen erweiterten: Die meisten besetzten Unis nahmen in ihrem Forderungskatalog nicht nur die Rücknahme der LRU, sondern auch die Verteidigung der Sonderbedingungen des Renteneintrittsalters (welche die Regierung beispielsweise im Öffentlichen Dienst, bei den Eisenbahnern, abschaffen will) auf wie auch die Ablehnung des Horefeux-Gesetzes und der Sarkozy-Politik der „Auswahl der Einwanderer“, die Abehnung der Zusatzzahlungen beim Medikamentenkauf und der Angriffe der Regierung gegen die gesamte Arbeiterklasse. Sie betonten die für die Vereinigung der Arbeiter notwendige SOLIDARITÄT, welche für den Zusammenschluss im Kampf gegen das Branchendenken und der „Verhandlungen“ von Betrieb zu Betrieb, von Branche zu Branche (was die Gewerkschaften befürworten) unerlässlich ist. Die Studenten setzten diese Solidarität auch konkret in die Tat um. So haben sich in den französischen Provinzstädten und in Paris Hunderte von Studenten den Demonstrationen der Eisenbahner angeschlossen (insbesondere am 13. und 14. November), die sich gegen die Abschaffung gesonderter Renteneintrittsbedingungen zur Wehr setzten. In einigen Städten (Rennes, Caen, Rouen, Saint-Denis, Grenoble) wurde diese Solidarität der jungen Generation von den Eisenbahnern sehr begrüßt; sie wurden zu deren Vollversammlungen eingeladen und führten gemeinsame Aktionen durch (z.B. traten sie gemeinsam an Autobahnabfahrten auf, wo Studenten und Eisenbahner die Autofahrer an den Zahlstellen kostenlos vorbeiließen und ihnen die Gründe für ihre Aktionen erklärten). Heute überlegen, diskutieren, handeln (und essen) Eisenbahner und Studenten gemeinsam. In einigen Universitäten wie in Paris-8 Saint-Denis (deren Präsidenten Menschen und nicht hysterische Hyänen sind, die mit den Wölfen heulen) schlossen sich ihnen die Dozenten und das Verwaltungspersonal an.
Der proletarische Charakter des Kampfes der Studenten wurde auch darin deutlich, dass die Studenten bei der Besetzung der Unis nicht nur aus dem Grunde die Räume besetzen wollten, um ihre Vollversammlungen abzuhalten und politische Debatten zu führen, die allen offen stehen (ja, Frau Pécresse, der Mensch ist eine Gattung, die im Gegensatz zum Affen über eine Sprache verfügt und ein politisches Wesen ist, wie einige Beschäftigte von Sonderförderungsausbildungsstätten bewiesen haben). In einigen Universitäten haben die streikenden Studenten beschlossen, in den besetzten Räumen auch Illegalen, also Menschen ohne Personalpapiere (die sans-papiers), Schutz zu bieten.
Aufgrund dieser aktiven Solidarität, die auf andere Bereiche überzugreifen droht, hat die Regierung Sarkozy/Fillon (und ihre „Eisernen Ladies“ Pécresse, Alliot-Marie, Dati sowie andere käufliche, unterwürfige Elemente) beschlossen, ihre Bullen zu schicken, um der Arbeiterklasse das Rückgrat zu brechen. Die französische Bourgeoisie will die gleiche Politik anwenden wie damals Thatcher in Großbritannien. Sie will wie in Großbritannien jegliche Solidaritätsstreiks untersagen, um 2008, sobald die Gemeinderatswahlen vorüber sind, freie Hand bei ihren noch brutaleren Angriffen zu haben. Heute versucht die herrschende Klasse mit der Gewalt und Repression ihres Handlangers Sarkozy, ihre „demokratische“ Ordnung durchzusetzen.
Die von den Studenten und einigen Eisenbahnern initiierte Solidaritätsbewegung zeigt, dass der Kampf gegen den CPE nicht in Vergessenheit geraten ist – trotz der ohrenbetäubenden Kampagne rund um die Präsidentschaftswahlen. Die Solidarität zwischen kämpfenden Studenten und einem Teil der Beschäftigten der SNCF und der RATP (die Pariser Metro) weist uns den Weg. Alle arbeitslosen und noch beschäftigten Arbeiter, ob französischer Abstammung oder Einwanderer, ob im Öffentlichen Dienst oder in der Privatindustrie, müssen diesen Weg einschlagen. Es ist der einzige Weg, um gegen die Angriffe der Bourgeoisie und gegen ihr dekadentes System, das der jungen Generation keine andere Zukunft anzubieten hat als die der Arbeitslosigkeit, prekären Arbeitsbedingungen, Armut und Repression (heute Knüppel und Tränengas, morgen Maschinengewehre!), ausreichend Gegendruck aufzubauen.
Dass der Oberbulle Frankreichs, Sarkozy, seine Bullen nicht schon 2006 auf die besetzenden Studenten gehetzt hatte, lag weniger daran, dass er moralische Bedenken gehabt hatte, sondern vielmehr daran, dass er damals Präsidentschaftskandidat war und nicht einen Teil der Wählerschaft verprellen wollte, deren Kinder in den Universitäten eingeschrieben sind. Jetzt, als Präsident, will er seine Muskeln spielen lassen, eine Rechnung begleichen und seine Wut darüber freien Lauf zu lassen, dass die französische Bourgeoisie 2006 den CPE zurücknehmen musste (hatte nicht Sarkozy nach seiner Wahl sofort darüber schwadroniert, dass „der Staat nicht zurückweichen darf“?). Sarkozy will der Clique um Villepin beweisen, dass er nicht nachgeben wird (denn wie Raffarin sagte: „Bei uns darf nicht die Straße herrschen“). Der Zynismus, mit dem er im Namen der „Transparenz“ die Erhöhung seines Gehalts um 140 Prozent ankündigte, während er sich gleichzeitig bei all den Angriffen gegen den Lebensstandard der Arbeiter unnachgiebig zeigte, ist eine wahre Provokation. Die Arbeiterklasse übers Ohr hauen, sie verspotten – das will Sarkozy. „Wir lassen es nicht zu, die Privilegien der Bourgeoisie anzufassen. Ich bin von den Franzosen gewählt worden; jetzt habe ich einen Blankoscheck, um das zu machen, was ich will.“ Aber abgesehen von den persönlichen Ambitionen dieser sinistren Gestalt vertritt Sarkozy auch die gesamte Kapitalistenklasse. Die Auseinandersetzung mit den Eisenbahnern verfolgt nur ein Ziel: Der gesamten Arbeiterklasse soll eine Niederlage beigefügt werden; das seinerzeit in der Bewegung gegen den CPE vorherrschende Gefühl, dass nur ein vereinter Kampf zählt, soll verdrängt werden. Deshalb möchte Sarkozy gegenüber den Eisenbahnern nicht nachgeben und die Universitäten in wahre Polizeifestungen umwandeln.
Aber egal wie dieser Konflikt zwischen der Regierung Sarkozy/Fillon/Pécresse und der Arbeiterklasse ausgehen wird, der Kampf zahlt sich schon jetzt aus: Die Solidaritätsbewegung zwischen Eisenbahnern und Studenten, der sich schon andere Teile der Arbeiterklasse angeschlossen haben (insbesondere unter den Universitäts-Beschäftigten), wird eine unauslöschliche Spur im Bewusstsein hinterlassen, genau wie der Kampf gegen den CPE selbst. Wie alle Arbeiterkämpfe, die zur Zeit weltweit stattfinden, ist er ein wichtiger Bestandteil auf dem Weg zur zukünftigen Überwindung des Kapitalismus. Der Hauptgewinn des Kampfes ist der Kampf selbst, die Erfahrung lebendiger und aktiver Solidarität der Arbeiterklasse auf dem Weg zu ihrer Befreiung und zur Befreiung der gesamten Menschheit.
„Arbeiter, ob aus Frankreich oder Einwanderer, ob im staatlichen Bereich oder in der Privatindustrie beschäftigt, Studenten, Schüler, Arbeitslose: Wir führen den gleichen Kampf gegen die Angriffe der Regierung. Nieder mit dem Polizeistaat. Dem Terror des Kapitals müssen wir die Solidarität der ganzen Arbeiterklasse entgegenstellen!“ Sofiane, 17. November 2007.
Geographisch:
- Frankreich [2]
Nokia - Allgemeiner Lohnraub: Gegen den Terror des Kapitals - Arbeitersolidarität
- 3014 reads
Beiläufig, zufällig nur erfuhren gut 2000 Mitarbeiter des Handyherstellers Nokia Mitte letzter Woche, dass das Werk Bochum, von dem ihre Existenzen leider abhängen, geschlossen werden soll. Keine drei Tage später wurde schon Hunderten von mit Zeitverträgen ausgestatteten MitarbeiterInnen gekündigt. Ihnen wurde mitgeteilt, dass sie ab sofort auf dem Firmengelände nichts mehr zu suchen haben. Die Restlichen „dürfen“ eine kurze Zeit noch die Arbeit der bereits Entlassenen mitverrichten, bis auch sie auf die Straße gesetzt werden. So werden die Lebensplanungen von über 4000 Menschen im Werk Bochum und in der Zulieferindustrie über Nacht zunichte gemacht.
Das wahre Gesicht des Kapitalismus
Die deutsche politische Obrigkeit hat diese Umgangsweise des finnischen Weltkonzerns mit markigen Worten quittiert. Der NRW Ministerpräsident Rüttgers sprach von „Subventionsheuschrecken“, Bundesfinanzminister Steinbrück von „Karawanenkapitalismus“. Sie wollen uns damit sagen, Nokia habe einen sonst überall vorherrschenden “rücksichtsvollen“ und „sozial verantwortlichen“ Umgang der Kapitalisten mit der arbeitenden Bevölkerung verletzt. Da können wir den hohen Herren von der Politik nicht folgen. Es ist vielmehr so, dass die Brutalität und Unverfrorenheit von Nokia absolut typisch ist für das heutige Verhalten der Besitzerklasse gegenüber der Arbeiterklasse. Keine Firmenzentrale im fernen Helsinki, sondern ein deutsches Arbeitsgericht war es, welches monatelang den bundesweiten Streik der Eisenbahner schlichtweg verbot, den Arbeitskampf der Ausgebeuteten unter Strafe stellte. Die deutsche Telekom war es, welche 10.000 MitarbeiterInnen auf einen Schlag ausgliederte, um sie für deutlich weniger Geld länger arbeiten zu lassen. Und als im vergangenen Sommer viele Jugendliche, die für sich keine Perspektive mehr innerhalb dieses Gesellschaftssystems sehen, sich aufmachten, um gegen den G-8 Gipfel in Heiligendamm zu protestieren, erblickte die Bundesanwaltschaft darin die Bildung von terroristischen Vereinigungen. Die Antwort der Staatsgewalt auf die neue Generation ließ nicht lange auf sich warten: Vorbeugehaft sowie das Einsperren von Demonstranten in Käfige wie auf Guantanamo. Und dieselben Politiker, die sich nun mit den „Nokianern“ solidarisch erklären, haben monatelang in aller Öffentlichkeit gegen die Eisenbahner gehetzt, als diese sich aus guten Gründen zur Wehr gesetzt haben. Dieselben Vertreter des Bundes und des Landes NRW, welche Nokia vor zehn Jahren 88 Millionen Euro in den Rachen warfen, um den Kapitalisten ihr Bochumer Werk mitzufinanzieren, hetzen jetzt angesichts der bevorstehenden Tarifauseinandersetzungen gegen Lohnerhöhungen im öffentlichen Dienst! Ja die Zeiten, als Belegschaften regelmäßig „stufenweise“ und „sozialverträglich“ abgetragen wurden, gehören der Vergangenheit an. Die ungeheuere Verschärfung des Konkurrenzkampfes auf Weltebene, die hinter der Immobilienkrise sich abzeichnende Zuspitzung der Überproduktionskrise des Kapitalismus zwingen die alten Industriestaaten, die Maske der „Sozialpartnerschaft“ fallen zu lassen, welche in den meisten Weltteilen ohnehin nie groß aufgesetzt wurde. Was hat beispielsweise NRW-Chef Rüttgers getan, nachdem er auf dem Nokiagelände in Bochum die Betroffenen mit leeren Worthülsen abzuspeisen versucht hatte? Er eilte nach Düsseldorf zurück, um ein weiteres „Rettungspaket“ von voraussichtlich 2 Milliarden Euro für seine Landesbank WestLB zu schnüren, welche sich bei der US Immobilienkrise ein wenig verspekuliert hatte. Die vom deutschen Staat an Nokia verschenkten 88 Millionen Euro, worüber die politische Klasse sich nun öffentlich ereifert, sind eine lächerliche Summe im Vergleich zu den Milliarden, welche in den letzten Monaten locker gemacht wurden, um einen Zusammenbruch des maroden kapitalistischen Finanz- und Bankensektors zu vermeiden. Da hat die Besitzerklasse nicht mal mehr das Bisschen für die Lohnabhängigen übrig, das sie in früheren Zeiten eingesetzt hatte, um den „sozialen Frieden“ abzusichern. Hier liegt der Grund, warum das Kapital mit immer unverblümterer Brutalität gegenüber der Arbeiterklasse vorgeht. Nicht an der „Taktlosigkeit“ eines einzelnen Konzerns liegt es, sondern an der Notwendigkeit eines ganzen Systems, wenn heute immer systematischer versucht wird, die Lohnabhängigen einzuschüchtern. Die Brutalitäten gegenüber den Nokianern oder gegenüber den Lokführern sind kein Ausrutscher Einzelner, sondern pure Absicht. Sie zielen darauf ab, uns zu terrorisieren, um uns gefügig zu machen. Da arbeiten die „bösen“ Kapitalisten“ und der uns angeblich umsorgende Staat Hand in Hand. Nicht nur die Kündigung droht den Betroffenen bei Nokia und anderswo, sondern das, was danach kommt: Hartz IV!
Die Bochumer Werksschließung: Ein Angriff gegen die gesamte Arbeiterklasse
Die Nachricht von der beabsichtigten Werksschließung bei Nokia in Bochum wurde genau drei Tage bekannt, nachdem die Lokführer bei der Deutschen Bahn 8% mehr Lohn und eine Reduzierung ihrer Arbeitszeit um eine Stunde durchgesetzt hatten. Das muss nicht Zufall sein. Dieser Teilerfolg bei der Bahn nach Jahren der Reallohnsenkung ist nicht nur ein Schlag ins Gesicht für die Pläne der herrschenden Klasse, auf Kosten der Beschäftigten die DB in ein international tätiges Logistikunternehmen zu verwandeln. Es ist eine Ermutigung für die ganze Arbeiterklasse, dem Beispiel der Eisenbahner zu folgen und sich einen Ausgleich für die rapide steigenden Preise und Steuerlast zu erkämpfen. Ob beabsichtigt oder nicht, ob mit der Staatsmacht abgesprochen oder nicht (welche in Deutschland bei Entlassungen von über 50 Beschäftigten auf einmal vorab informiert wird): Die Nachricht von der Bochumer Werksschließung kam für das Kapital genau zum richtigen Zeitpunkt. Sie dient als Warnung an die gesamte arbeitende Bevölkerung, angesichts des Teilerfolgs bei der Bahn nicht „übermütig“ zu werden. Die Botschaft lautet: „erkämpfte Lohnerhöhungen der Beschäftigten werden durch Massenentlassungen von Seiten des Kapitals quittiert! Vergesst nicht, wer in dieser Gesellschaft am längeren Hebel sitzt, nämlich die Besitzer der Produktionsmittel!“Nachdem es ein Jahrzehnt lang die Reallöhne – auch im internationalen Vergleich – besonders stark abgesenkt, und sich dadurch Wettbewerbsvorteile erzwungen hatte, weiß das deutsche Kapital heute sehr genau, dass eine allgemeine Unzufriedenheit der arbeitenden Klasse sich angestaut hat. So ist die Kapitalseite heute emsig bemüht, durch v.a. kosmetische „Korrekturen“ beim Arbeitslosengeld, dem Gerede von „Mindestlöhnen“, „Reichenbesteuerung“ und „sozialer Gerechtigkeit“ die Wogen zu glätten. Denn eine allgemeine Streikwelle würde uns Lohnabhängigen einen Teil unserer Klassenidentität und unser Selbstvertrauen wieder geben. Der „Standort Deutschland“ will außerdem verhindern, dass durch eine solche allgemeine Kampfeswelle ein Teil der angesammelten Konkurrenzvorteile wieder verloren gehen könnten. Zwar hat in dieser Hinsicht die Regierung vorgesorgt: Maßnahmen wie die seit Anfang 2007 in Kraft getretene Mehrwertsteuererhöhung oder die geplante massive Besteuerung von Sparkonten ab 2009 sollen den größten Teil eventueller Reallohnerhöhungen wieder in die Taschen des Staates und der Unternehmen umleiten. Dennoch setzt das Kapital auch auf offene Einschüchterung, damit weder die bevorstehenden Lohnkämpfe noch die daraus hervorgehenden Abschlüsse zu umfangreich werden. Auch in dieser Hinsicht richtet sich der Angriff gegen die Nokiabeschäftigten in Wahrheit gegen die gesamte Arbeiterklasse!
Arbeitersolidarität gegen die Gewalt des Kapitals
Gegenüber der Wucht der kapitalistischen Angriffe kann es nur eine Antwort geben: Die Arbeitersolidarität. Dass die Betroffenen die Notwendigkeit dieser Klassensolidarität immer deutlicher spüren, zeigt die erste Reaktion der Bevölkerung des Ruhrgebiets auf die Nachricht von der Werksschließung bei Nokia. Die Beschäftigten spürten sofort das Bedürfnis, sich auf dem Werksgelände zu versammeln. Da standen die ZeitarbeiterInnen und die (nur scheinbar) „Festangestellten“ Schulter an Schulter, um ihrer Empörung Ausdruck zu verleihen. Wichtiger noch: Nicht allein die üblichen rituellen Gewerkschaftsdelegationen waren vertreten, sondern es strömten Lohnabhängige aus den unterschiedlichsten Betrieben der Region herbei, um ihre Solidarität kundzutun. Die Leute von Opel erklärten: Ihr habt uns 2004 in unserem Kampf gegen die Werksschließung unterstützt, jetzt unterstützen wir euch! Bei den Gesprächen bezog man sich wie selbstverständlich auf die gemeinsamen Kampferfahrungen unserer Klasse, um gegenüber der jetzigen Lage eine Perspektive zu gewinnen. So war von der beispielhaften Kampfkraft der Eisenbahner die Rede. Auch wurde darauf hingewiesen, dass die Werksschließung bei Opel in Bochum vor vier Jahren nicht durch Unterordnung und „Opferbereitschaft“ der Beschäftigten, sondern allein durch die große Kampfkraft der Betroffenen und die Solidarität der gesamten arbeitenden Bevölkerung verhindert wurde. Die Lehren von vor 20 Jahren bei Krupp wurden ebenfalls aufgegriffen: Die Kraft der Solidarität, aber auch die Verelendung, welche auf der doch noch durchgesetzten Werksschließung damals in Duisburg-Rheinhausen folgte. Dort auf dem Nokiagelände und in den darauffolgenden Tagen tauchte ein Ausdruck der Arbeitersolidarität wieder auf, welcher zukunftsweisend ist. In den letzten Jahren wurde der Kampf gegen Massenentlassungen und Werksschließungen hauptsächlich von den unmittelbar Betroffenen getragen, während andere Beschäftigte oder Erwerbslose sich mehr unterstützend, sozusagen von außen helfend beteiligten. Das war 2006 bei der AEG in Nürnberg so, 2004 bei Opel Bochum und auch 1987 bei Krupp. Jetzt war aus dem Opelwerk in Bochum zu vernehmen, dass die Beschäftigten dort sich an einem eventuellen Streik der Nokianer beteiligen wollen. Das hat es im Ansatz bereits 2004 bei Mercedes gegeben, als die Beschäftigten im Werk Bremen mitgestreikt haben aus Solidarität mit ihren KollegInnen in Stuttgart. Damals handelte es sich noch um eine Solidarität unter Beschäftigten ein und desselben Konzerns, die sich nicht gegeneinander ausspielen lassen wollten. Nun keimt ein Bewusstsein wieder auf, dass auch die Lohnsklaven aus verschiedenen Firmen, Branchen usw. gemeinsame Interessen haben, die nur gemeinsam verteidigt werden können. Diese Einsicht gewinnt nicht nur in Deutschland, sondern weltweit an Boden. So haben gegen Jahresende 2006 in Frankreich kämpfende Eisenbahner und Studenten gemeinsame Kampfversammlungen abgehalten.Auch die große Popularität, welche der Eisenbahnerstreik in Deutschland innerhalb der arbeitenden Bevölkerung genossen hat, muss in diesem Lichte gesehen werden. Der herrschenden Klasse ist es zwar gelungen, die massive Unzufriedenheit eines Teils der Eisenbahner mit den bestehenden, v.a. dem DGB angegliederten Gewerkschaften wieder in kapitalistisch geordnete – sprich gewerkschaftliche – Bahnen zu lenken mittels einer Scheinradikalisierung der fossilen GDL. Dadurch ist ein Bild in der Öffentlichkeit gestiftet worden, welches der herrschenden Klasse nur recht sein kann. Dies ist das Bild von einer Berufsgruppe – in diesem Fall die Lokführer –, welche sich von einem gemeinsamen Kampf mit anderen Berufsgruppen oder Sektoren der Klasse verabschiedet, um zu versuchen, auf eigene Faust das Beste für sich herauszuholen. Aller Erfolge der GDL bei der Isolierung des Lokführerstreiks zum trotz entspricht dieses Bild heute nicht der Stimmung der Arbeiterklasse. Die Lokführer werden vielmehr als Vorkämpfer eines notwendig gewordenen allgemeinen Kampfes angesehen. Mit ihrer Bekundung der Bereitschaft zur aktiven Solidarität mit den Nokianern ist es den Opelaner in Bochum gelungen, dieser Gemeinsamkeit, welche nur indirekt durch die allgemeine Beliebtheit des Lokführerstreiks zum Ausdruck kam, eine direkte Konkretisierung zu geben. Wir können und müssen dem Terrorsystem der kapitalistischen Konkurrenz die Stirn bieten! Wir können und wir müssen den Versuch der herrschenden Klasse durchkreuzen, mittels Angriffe wie bei Nokia nicht nur die Betroffenen, sondern uns alle einzuschüchtern. Begreifen wir die Gleichzeitigkeit der Angriffe mittels Arbeitslosigkeit und Inflation als Herausforderung, unsere eigenen Kräfte zu bündeln. Während bei Nokia, bei Motorola in Flensburg oder bei BMW Jobs vernichtet werden, stehen in vielen Branchen Tarifverhandlungen an, es wächst der Unmut gegenüber Reallohnverlusten. Es gilt, direkte Verbindungen zwischen den kämpferischsten Arbeiterinnen und Arbeitern der verschiedenen Bereiche zu knüpfen, ohne gewerkschaftliche „Vermittlung“. Es gilt, sich den Versammlungen und Demonstrationen anderer Bereiche zielstrebig anzuschließen bzw. die eigenen Aktionen für andere zu öffnen. Es gilt, dort die Gemeinsamkeit der Interessen aller Lohnabhängigen hervorzuheben und gemeinsame Forderungen zur Sprache zu bringen. Es gilt, den Kampf gegen Massenentlassungen und die Lohnkämpfe bewusst zu verbinden, sie immer mehr zusammenzuführen. Gegenüber der gewerkschaftlichen Absonderung, wie von der GDL vorexerziert, und dem gewerkschaftlichen Streikbrechertum, wie zuletzt von Transnet gegenüber dem Lokführerstreik praktiziert, müssen die Kämpferischsten sich für die Eigenständigkeit der Aktionen der Betroffenen selbst stark machen. Nur eine breite, allgemeine Aktion, welche die Logik des Kapitals in Frage stellt, welche gegen das Prinzip der kapitalistischen Konkurrenz das sozialistische Prinzip der Solidarität geltend macht, kann Angriffe wie bei Nokia aufhalten.
Gegen den Terror des Kapitalismus hilft nur die Solidarität der Arbeiterklasse! 20.01.08
Dieser Artikel wird von der IKS als Flugblatt auf der Demonstration am 22.01.08 in Bochum verteilt.
Nationale Situationen:
Aktuelles und Laufendes:
- Arbeiterkampf [3]
Russland 1917, Deutschland 1918 : Die Ausdehnung der Russischen Revolution beendete den Weltkrieg
- 8616 reads
Im Gegensatz zu den Behauptungen der offiziellen Geschichtsschreibung der herrschenden Klasse ging der 1. Weltkrieg am 11. November 1918 nicht zu Ende, weil die Verbündeten Deutschland-Österreich eine entscheidende militärische Niederlage erlitten hatten oder nicht mehr über die Kräfte zur Fortsetzung des Krieges verfügten. Nein, der Waffenstillstand wurde einzig unterzeichnet, weil die herrschende Klasse auf beiden kriegführenden Seiten der Gefahr der weltweiten Ausdehnung der proletarischen Oktoberrevolution von 1917 in Russland gegenüberstand. Tatsächlich war es die unmittelbare Gefahr der Erhebung des Proletariats in Europa, die die Kapitalisten dazu zwang, das Gemetzel einzustellen. Wenn es der Arbeiterklasse gelungen war, so weit voranzukommen, so nur, weil dem ein langer Prozess vorausgegangen war, in dem sie ihre Kräfte gesammelt hatte. Schon im Sommer 1916 entfalteten sich große Massenbewegungen, insbesondere in Deutschland, in denen die Wut der ArbeiterInnen gegen das Leid, die Entbehrungen und die Armut, die auf den Krieg zurückzuführen waren, zum Ausdruck gebracht wurden. Aber man kann erst vom wahren Beginn der revolutionären Welle im Februar 1917 in Russland reden. Der 23. Februar hätte eigentlich ein einfacher Gedenktag an die Arbeiterfrauen im Rahmen der üblichen Demonstrationen der sozialistischen Parteien sein sollen, aber dieser Tag löste eine Explosion der großen Verbitterung aus, die sich in den Reihen der ArbeiterInnen wie auch anderer armer Schichten der Bevölkerung gegen die Tag für Tag schlechter werdende Lebensmittelversorgung der damaligen Hauptstadt Russlands und der durch die Kriegswirtschaft bewirkten Überausbeutung gesteigert hatte. Während die Bewegung am 23. Februar noch die Forderung nach Brot erhob, entwickelte sie sich in den nächsten Tagen schnell zu einem Aufstand, der wegen der blutigen Repression durch das Zarenregime noch ungewollt begünstigt wurde. Am 26. Februar schlossen sich aufgrund der Ausstrahlung der Arbeiterkämpfe Soldaten der Bewegung an. Am 27. Februar wurde das Zarenregime gestürzt, eine bürgerlich demokratische Regierung (eine so genannte „provisorische Regierung“) ernannt, während sich die Arbeiterklasse in den Fabriken und den anderen Arbeitsstätten in selbständigen Arbeiterräten organisierte und Delegierte in den zentralen Sowjet der Stadt schickte. Da die neue Regierung in den darauf folgenden Monaten den Krieg jedoch fortsetzen wollte und gegenüber dem Hunger und den durch den Krieg und die Kriegswirtschaft auferlegten Entbehrungen nichts anzubieten hatte, da stattdessen die Arbeiter viel länger als acht Stunden arbeiten mussten, wurden diese immer kämpferischer und ihr Bewusstsein immer weiter vorangetrieben. Im April 1917 trat die bolschewistische Partei für die Losung „Brot und Frieden“ und „Alle Macht den Räten“ ein. Die Arbeiterklasse radikalisierte sich immer mehr, da die provisorische Regierung noch entschlossener als der Zar für den Krieg mobilisierte. Nach neuen Aufständen im Juli, in denen das Proletariat zum Rückzug gezwungen wurde (denn die Bedingungen zum Sturz der Kerenski-Regierung waren noch nicht herangereift), versuchte der dem Zar ergebene General Kornilow einen Putsch gegen die provisorische Regierung. Dieser Versuch wurde vor allem durch die massive Mobilisierung der Arbeiter in Petrograd vereitelt, was der Arbeiterklasse einen neuen Aufschwung verlieh und wodurch die Bolschewiki und ihre Losungen noch mehr Zulauf erhielten. Nach dem 22. Oktober 1917 fanden Versammlungen statt, in denen gewaltige Arbeitermassen zusammenkamen, und in denen die Losungen „Nieder mit der provisorischen Regierung! Nieder mit dem Krieg“, „Alle Macht den Räten“ aufkamen. Am 25. Oktober stürmten die Arbeitermassen mit den Matrosen der „Roten Flotte“ der Kronstädter Garnison den Winterpalast und verjagten die Kerenski-Regierung. Das war die Oktoberrevolution. Der Gesamtrussische Sowjetkongress, der zum gleichen Zeitpunkt stattfand und in dem die bolschewistische Partei über die Mehrheit verfügte, kündigte in einer Resolution die Übernahme der Macht an: „Gestützt auf den Willen der gewaltigen Mehrheit der Arbeiter, Bauern und Soldaten, gestützt auf den in Petrograd vollzogenen siegreichen Aufstand der Arbeiter und der Garnison, nimmt der Kongress die Macht in seine Hände“. (Lenin, „An die Arbeiter, Soldaten und Bauern“, Lenin, Bd. 26, S. 237). Am 26. Oktober verabschiedete der Kongress in seiner zweiten Sitzung ein „Dekret über den Frieden“ und schaffte gleichzeitig die Notmaßnahmen ab, damit die Bevölkerung in Russland nicht mehr unter den Kriegsfolgen litt. Die revolutionären Ereignisse in Russland hatten natürlich unter den ArbeiterInnen Europas und der ganzen Welt eine enorme Ausstrahlung. Dies war zunächst am stärksten spürbar unter den Arbeitern jener Länder, die direkt am imperialistischen Gemetzel beteiligt waren. Dadurch wurden sie überall zu Demonstrationen gegen den Krieg und zu Kundgebungen zur Unterstützung des Roten Oktober ermuntert. Eine Folge war, dass es an der Front zu Verbrüderungen unter kämpfenden Soldaten der verfeindeten Länder kam. In Deutschland, wo es das zahlenmäßig größte und am stärksten konzentrierte Proletariat mit der umfassendsten politischen Erfahrung gab, ging die Ausstrahlung am weitesten. Nach einem Zeitraum der Reifung im Jahre 1917 entwickelte sich 1918 hier eine revolutionäre Dynamik, die Anfang November, d.h. am 4. November, ihren Höhepunkt erreichte. An jenem Tag meuterten die Matrosen von Kiel. Dabei gelang es ihnen, einen Großteil der Soldaten (Arbeiter in Uniform) sowie auch Arbeiter aus den Betrieben auf ihre Seite zu ziehen. Insbesondere in Berlin und Bayern kam es zu Zusammenschlüssen. Damit reagierten die Arbeiter in Deutschland auf die Aufrufe, die ihre Klassenbrüder und -schwestern in Russland an sie seit Oktober 1917 gerichtet hatten, damit sie sich in den Kampf um die Weltrevolution einreihen und dabei die Führung übernehmen. Ihr Aufstand ermöglichte auch den Aufstand jener Truppenteile, die bis dahin der Regierung des Kaisers Wilhelm II. ergeben gewesen waren. Innerhalb weniger Tage entstanden überall im Land - dem russischen Beispiel folgend - Arbeiterräte. Die herrschende Klasse verstand die Notwendigkeit, sich des Kaisers zu entledigen, der schließlich am 9. November zurücktrat; die Republik wurde ausgerufen. Die Regierungsgeschäfte wurden geleitet von den SPD-Leuten Ebert und Scheidemann (die 1914 die Kriegskredite bewilligt und den Burgfrieden unterstützt hatten). Diese schlossen unmittelbar danach mit der französischen Regierung einen Waffenstillstand. Wie wir in einem früheren Artikel in unserer Zeitung Révolution Internationale Nr. 173 (November 1988) anlässlich dieser Ereignisse geschrieben hatten: „Mit ihrer Aufstandsbewegung hatten die Arbeiter in Deutschland den größten Massenkampf der Arbeiterklasse in ihrer Geschichte ins Rollen gebracht. Die ganze Burgfriedenspolitik, welche die Gewerkschaften während des Krieges praktiziert hatten, und die Politik des Klassenfriedens zwischen den Klassen brach unter den Schlägen des Klassenkampfes auseinander. Mit diesen Aufständen schüttelten die Arbeiter die Niederlage vom August 1914 ab und erhoben nun wieder die Stirn. Der Mythos einer deutschen (oder anderen) Arbeiterklasse, die vom Reformismus gelähmt wäre, brach zusammen (…) In die Fußstapfen des Proletariats in Russland tretend, stellten sich die Arbeiter in Deutschland nach den Arbeiteraufständen und dem Anfang der Bildung von Arbeiterräten in Österreich und Ungarn 1919 an die Spitze der ersten großen internationalen Welle von revolutionären Kämpfen, die aus dem Krieg hervorgegangen waren“. Und um nicht der Gefahr ausgesetzt zu sein, wie in Russland durch die revolutionäre Welle von Kämpfen weggespült zu werden, beeilte sich die deutsche Bourgeoisie sicherlich mit Unterstützung der herrschenden Klasse der anderen Länder und früheren Kriegsgegner, den imperialistischen Krieg, der vier Jahre zuvor vom Zaun gebrochen worden war, zu beenden. Um der Ausbreitung der proletarischen Revolution entgegenzutreten, haben sich die Bourgeoisien der Welt verständigt, um nur wenige Tage nach dem Aufstand der Matrosen in Kiel gegen das deutsche Militär sehr schnell einen Waffenstillstand zu schließen. Später wurde die revolutionäre Bewegung in Deutschland blutig niedergeschlagen (insbesondere während der „blutigen Woche“ im Januar 1919, als ihre berühmtesten Führer, revolutionäre Spartakisten wie Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, von Freikorps ermordet wurden, die im Sold der SPD standen) (2). Diese Niederlage des Proletariats in Deutschland sollte später zum Tod der Revolution in Russland führen. Nichtsdestotrotz hatte die Weltarbeiterklasse in diesen beiden Ländern gezeigt, dass sie die einzige Kraft in der Gesellschaft ist, die – wenn sie auf ihrem Klassenterrain kämpft, den Krieg beenden kann. RI 1) Trotz des Fortbestehens eines politischen Regimes mit feudalem Charakter hatte sich der Kapitalismus in Russland stark entwickelt und große Industriezentren geschaffen: Zum Beispiel waren die Metallfabriken von Putilow mit ihren 40.000 Beschäftigten die größte Fabrik der Welt. 2) Siehe insbesondere die Artikelreihe über die Deutsche Revolution in Nr. 16 und 17, in der die Entwicklung im Detail, vom Waffenstillstand bis zur Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, nachgezeichnet wird und die besser ermöglicht zu begreifen, was damals in Deutschland passiert ist. 3) Siehe auch unseren Artikel in der Internationalen Revue Nr. 23 – „1918-1919 – Die proletarische Revolution bringt den imperialistischen Krieg zu Ende“.
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Februar 2008
- 850 reads
Die Italienische Kommunistische Linke - Ein Beitrag zur Geschichte der revolutionären Bewegung 1926-1945
- 3059 reads
Jüngste Buchveröffentlichung der IKS
Bestellungen an: [email protected] [6] 291 S. Preis: 10 Euro,
Inhaltsverzeichnis:
Einleitung
KAPITEL 1Die Ursprünge (1912 – 1926) Die Geburt der Sozialistischen Partei Italiens Die Linke innerhalb der Partei (1913-1918)Auf dem Weg zur Eroberung der Partei (1918-1921) Bordiga und der “Partito Comunista d’Italia”„Bolschewisierung” und die Reaktion der Linken Die Beziehungen zu Karl Korsch Bordigas Entwicklung nach 1926
KAPITEL 2Italienische Linke oder Deutsche Linke? (1927-1933) Von “Réveil Communiste” zu “L’Ouvrier Communiste” Pappalardi und die italienischen „Bordigisten” Réveil Communiste (1927-29) Der Einfluss der KAPD: „L’Ouvrier Communiste” (1929-31)
KAPITEL 3Die Geburt der linken Fraktion der PCI (1927- 1933)
Die Mitglieder: Arbeiterimmigranten Ottorino Perrone
Die Organisation der Fraktion: Frankreich, die USA,
Belgien Die Gründungskonferenz in Pantin
Erste Kontakte mit der Linksopposition „Prometeo” und Trotzki
Beziehungen mit der Neuen Italienischen Opposition, der deutschen und der französischen Opposition
Gründe und Konsequenzen des Ausschlusses der Fraktion aus der trotzkistischen Opposition
KAPITEL 4„Bilan”: Mit Riesenschritten in die Niederlage (1933-1939) Das Gewicht der Konterrevolution „Die Mitternacht des Jahrhunderts” „Bilans” Auseinandersetzung mit dem Antifaschismus und derVolksfrontDer Kongress der Fraktion 1935 Die isolierte Fraktion Die Diskussionen mit Union CommunisteDie Communist League of Struggle Die Revolutionary Workers‘ League und Oehler Der endgültige Bruch mit dem Trotzkismus Erste Arbeitsgemeinschaft mit der belgischen Ligue des Communistes Internationalistes
KAPITEL 5Der Krieg in Spanien: Kein Verrat! Die Mehrheit der Fraktion und die dramatischen Ereignissen in Spanien Auf dem Weg in die Spaltung: Argumente und Aktivitäten der Minderheit in Spanien Die Geburt der Belgischen Fraktion Kontakte mit Mexiko: Paul Kirchhoff und der „Grupo de Trabajadores” Das Internationale Büro der Fraktionen: Die Schwächen der Kommunistischen Linken
KAPITEL 6Hin zum Krieg oder zur Revolution? (1937 – 1939) Krieg oder Revolution? Die Wurzeln des imperialistischen Krieges:Die Dekadenz des Kapitalismus Die reaktionäre Funktion der Nationalbewegungen in den Kolonien Die Diskussion über die Kriegswirtschaft
KAPITEL 7Bilanz der Russischen Revolution Die Methode von „Bilan” Der Ausgangspunkt: die Partei Die objektiven Bedingungen: die kapitalistische Dekadenz Die subjektiven Bedingungen: die Partei Gewerkschaften und Klassenkampf Die Niederlage der Russischen Revolution Das Wesen des russischen Arbeiterstaates Der Staat in der Übergangsperiode
KAPITEL 81939-45 Prüfung durch den Krieg Die Herausforderung des Krieges: Von der Fraktion zur Partei Der Schock des Krieges Der „Kern der Kommunistischen Linken” Die Revolutionären Kommunisten Deutschlands undder holländische Spartacusbond Der Einfluss der Ereignisse vom März 1943 in Italien auf die FraktionPolitische Meinungsverschiedenheiten mit VercesiItalia di Domani: Vercesis Aktivitäten in der Brüsseler Antifaschistischen Koalition Die Bildung der französischen Fraktion: die Spaltung von der Italienischen Fraktion
KAPITEL 9„Partito Comunista Internazionalista” (1943-45) Die Gründung des PCInt: Damen und Prometeo Bordiga und Pistone: Die „Frazione di sinistra dei comunisti e socialisti” Die Föderation Pugliens und der„Partito Operaio Comunista” Der Kongress des PCInt in Turin (Dezember 1945) Die Entwicklung der Partei nach 1946: Spaltungen Die französischen Linkskommunisten(Internationalisme) Schlussfolgerungen
ANHANG ICommunisme Nr. IPrinzipienerklärung der Belgischen Fraktion der Internationalen Kommunistischen Linken ANHANG IIManifest der kommunistischen Linken an die ProletarierEuropas (Juni 1944) Einleitung der IKS (1984) Manifest der kommunistischen Linken an die Proletarier Europas (Juni 1944)
Politische Strömungen und Verweise:
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Eine Debatte über die Gewerkschaftsfrage im NLO –Köln
- 2795 reads
Am 12.2. fand in Köln eine Diskussionsveranstaltung des Netzwerk Linke Opposition mit Themenschwerpunkt Gewerkschaften statt. Es war vereinbart worden, dass Vertreter der „Internationalen Sozialisten“ und der IKS jeweils ihre Standpunkte zur Eröffnung der Diskussion vorstellen sollten. Zudem hatten die IKS und IS jeweils zwei Texte zur Vorbereitung zirkuliert (weiter unten haben wir diesen Text angehängt). In der Einleitung der IS wurde hervorgehoben, dass die großen revolutionären Bewegungen immer aus den Gewerkschaften hervorgegangen seien. Gewerkschaften seien nötig, um die bewussten Arbeiter zu sammeln. Auch wenn die Gewerkschaftsführung von Anfang an, d.h. schon von ihrer Gründung im 19. Jahrhundert an, dem Kapital treu ergeben gewesen seien, könnte man eigentlich nicht von den Gewerkschaften reden, denn letztendlich sei doch die Basis die eigentliche Gewerkschaft. Die Gewerkschaften seien Kampforganisationen, mit deren Hilfe die Arbeiter ihre Einheit schweißen könnten. Dann räumte der Redner der IS ein, dass die Gewerkschaften von Anfang an „eingebaute“ Schwächen mit sich trügen. So seien sie, wie der Name sagte, Organisationen, die nur Gewerke repräsentieren. Damit förderten sie die Spaltungen der Arbeiterklasse in verschiedene Bereiche; auch hätten sie immer nur für Verbesserungen innerhalb des Systems und nie gegen das System gekämpft; schließlich seien die Gewerkschaften immer für eine Trennung zwischen Politik und Wirtschaft eingetreten. Während das Kapital versuche, Organisationen für sich einzuverleiben und das Verhalten der Gewerkschaftsbürokratie ein Beispiel dafür sei, sei die Gewerkschaftsbürokratie dennoch ein (wenn auch widerwilliger) Partner bei antifaschistischen Bündnissen. Aufgabe der Revolutionäre sei es, bei den Gewerkschaften mitzuarbeiten, Mandate als Vertrauensleute anzustreben, denn schließlich habe die Arbeiterklasse noch kein anderes Instrument zum Kampf entwickelt als Gewerkschaften. Die IKS hatte zur Vorbereitung der Diskussion einen kurzen Text erstellt (siehe weiter unten), den wir jedoch aus Zeitgründen auf dem Treffen nicht separat vorstellten. Stattdessen haben wir, um leichter in die Diskussion einzusteigen, auf die Position der IS geantwortet. Hier ein Teil unserer Antwort. * Die Bejahung einer Gewerkschaftsarbeit - mit der Begründung, das Bewusstsein einer Reihe von Arbeitern unzureichend entwickelt ist -, geht von der Annahme aus, dass die Gewerkschaften Ort und Instrument der Bewusstseinsentwicklung sind. Die Gewerkschaften waren zwar im 19. Jahrhundert zeitweise und in einem begrenztem Maße ein Ort, wo nicht nur Solidarität praktiziert wurde, wo es ein wirkliches Arbeiterleben gab und wo das Bewusstsein in einem beschränktem Maße vorangetrieben werden konnte, aber seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts ist in ihnen immer mehr jegliches proletarisches Leben erloschen. Stattdessen binden sie die Arbeiter an das kapitalistische System und seine Ideologie. * Indem man behauptet, die Gewerkschaftsführung habe schon immer im Interesse des Kapitals gehandelt, oder sie sei zumindest stark von Reformismus befallen, wird der Kern der ganzen reformistischen Versumpfung zurückgeführt auf die Frage der Führung und man behauptet weiterhin, grundsätzlich seien die Gewerkschaften weiterhin eine Waffe, die nur von der Last der Bürokratie befreit werden müsste. Aus der Sicht der IKS ist das Gewicht des Reformismus eher auf eine Epoche zurückzuführen, als die materiellen Grundlagen für diese Illusionen noch vorhanden waren. Dies war eine bestimmte Phase Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts; dieser Phase wurde aber der Boden entzogen mit dem Anbruch der neuen Epoche des 1. Weltkrieg, als die materiellen Bedingungen für die Art und Weise, wie die Gewerkschaften zuvor kämpften, nicht mehr vorhanden waren. Die marxistische Bewegung hat gegen die aufkommenden reformistischen Illusionen gekämpft, aber der Kern ihrer Kritik war nie, dass dieses Problem auf das Verhalten der Führer allein zurückzuführen sei, sondern stattdessen sahen sie die tieferliegenden Wurzeln in der Trennung zwischen politischem und ökonomischen Kampf, zwischen Minimal- und Maximalprogramm, in der branchenmäßigen Zersplitterung usw. Nicht nur hat die Führung verraten, sondern die Gewerkschaften sind seit dem 1. Weltkrieg zu einer entscheidenden Stütze für das Kapital geworden – ihre konterrevolutionäre Rolle während der revolutionären Kämpfe in Deutschland belegt dies.* Die Einheit der Arbeiter lässt sich heute nicht durch irgendwelche Gewerkschaften herstellen, sondern nur durch den gemeinsamen, sich vereinigenden Kampf aller Teile der Klasse, der anfängt mit Demonstrationen, Vollversammlungen usw. und in der Bildung von Arbeiterräten gipfelt. Seit der Bildung der ersten Arbeiterräte 1905 und vor allem in der Welle von revolutionären Kämpfen 1917-23 haben sich die Arbeiter immer wieder selbständig organisiert (Beispiel 1956 in Budapest, 1968 in Frankreich, 1969 in Deutschland, 1980 in Polen, die Kämpfe gegen den CPE in Frankreich 2006). Das Grundproblem besteht aber darin, dass man keine Einheitsorgane aufrechterhalten kann, weil der Kampf nicht permanent stattfindet, sondern explosiv ausbricht.
Gewerkschaften – ein Instrument des Staates oder von ‚schlechten’ Führern geleitet?
In den nachfolgenden Wortmeldungen, die wir aus Platzgründen nicht vollständig und chronologisch sondern nur auszugsweise wiedergeben können, pflichtete ein Genosse, der seit Jahren bei „Wildcat“ aktiv mitarbeitet, dem Standpunkt der IKS bei, dass es eine qualitative Veränderung der Gewerkschaften an der Wende vom 19./20. Jahrhundert gegeben habe. Er erläuterte, im 19. Jahrhundert seien Gewerkschaften „instabile“ Gebilde gewesen, mit schnell wachsender Mitgliedschaft in bestimmten Bereichen der Arbeiterklasse. Im 20. Jahrhundert dagegen seien die Gewerkschaften sozusagen „stabile“ Organe geworden, weil sie eine staatliche „Befestigung“ erhalten hätten, um eine Rolle als Ordnungsfaktor auszuüben. Die Gewerkschaften seien seitdem nicht so sehr von Arbeitern geschaffen worden, sondern eher staatliche Geschöpfe mit staatlich gestifteter Lizenz zum Organisieren der Arbeiter. In einer ersten Antwort reagierte ein Vertreter der IS mit dem Einwand, dass zwar die Gewerkschaftsbürokratie eigene Interessen hätte, eigentlich nur ihre Privilegien verteidigte und ohnehin nur unter dem Druck der Arbeiter handelte, aber die Hauptmotivation beim Eintritt in die Gewerkschaften sollte sein, dort Leute zu suchen. Man müsse Verbindungen als Vertrauensleute aufbauen. Die IS betonte, die erste Anlaufadresse müssten die Gewerkschaften sein, außerdem könnte nur mit deren Hilfe ein Netzwerk der Solidarität hergestellt werden. Diese Ausrichtung wurde von einem Anhänger der „Internationale Bolschewistische Tendenz“ (Bolschewik) unterstützt, der dafür plädierte, kommunistische Fraktionen in den Gewerkschaften zu errichten. Gegenüber dieser Rechtfertigung der Gewerkschaftsarbeit durch IS, man treffe dort die kämpferischsten Leute, forderte der Wildcat-Genosse die Mitglieder von IS auf, eine Bilanz ihrer Erfahrung mit der Basisarbeit in den Gewerkschaften vorzulegen, die diese Position auch wirklich bestätigen könnte. Er hob hervor, dass er seinerseits nach jahrelanger Erfahrung mit Streiks und anderen Kampf- und Protestformen, immer wieder feststellen musste, dass er bei den Gewerkschaftsversammlungen nie irgendeine Basis getroffen habe. Es habe einfach nie oder nur ganz selten und wenn ganz wenige Arbeiter auf diesen Gewerkschaftstreffen gegeben, stattdessen meist nur Funktionäre. Er meinte, es sei viel besser anstatt immer wieder für Gewerkschaftsarbeit zu plädieren, einfach zu den Kämpfen hinzugehen und vor Ort direkt Kontakt zu knüpfen. Mit der Unterscheidung zwischen Führung und Basis werde das Kernproblem vertuscht, dass es ein strukturelles Problem gebe. Die Gewerkschaften seien verfestigte Strukturen, eng mit dem Staat verbunden. Auch die IKS entgegnete in mehreren Wortmeldungen, dass die Gewerkschaften längst kein Ort proletarischen Lebens mehr seien. Seit fast 100 Jahren haben sich die Bedingungen geändert, und die Arbeitermüssen sich branchenübergreifend zusammenschließen, um die Kapitalisten zum Nachgeben zu zwingen. Dies kann mit der „Struktur“ der Gewerkschaften nicht gelingen. Der Kampf kann heute nicht mehr in die Hände der Gewerkschaften gelegt werden, sondern die Arbeiter müssen sich selbst organisieren. Die Gewerkschaften handeln als Wachhunde des Kapitals in den Betrieben, welche die Arbeiter daran hindern, die Initiative zu ergreifen und ihr Bewusstsein trüben. Die Aussage der IS, dass die wichtigsten Kämpfe immer mit den Gewerkschaften geführt wurden, sagten wir, entspricht nicht der Erfahrung der Geschichte denn mit der Bildung der Arbeiterräte 1905 hätten die Arbeiter die „praktische ‚Form gefunden, die das Proletariat in Stand setzt, seine Herrschaft zu verwirklichen“ (Lenin). Die Geschichte der wichtigsten Kämpfe des 20. Jahrhundertsund bis heute sei eine Geschichte des eigenständigen, außerhalb und gegen die Gewerkschaften geführten Kampfes. Die tieferliegende Ursache dafür sei die weitreichende Umwälzung der Bedingungen des Kapitalismus seit dem 1. Weltkrieg. Auch wenn in der Diskussion keine Zeit blieb, näher auf diese veränderten Bedingungen des Kapitalismus einzugehen, zeigte sich, dass hier zwei unterschiedliche Ansätze aufeinprallten – die von den IS vertretene Sicht, vom 19. Jahrhundert habe sich bis heute nichts am Charakter der Gewerkschaften geändert; die andere Auffassung, eine eher den historischen Umwälzungen Rechnung tragende Sichtweise (von dem Wildcat-Genossen und von der IKS vertreten), dass sich der Charakter der Gewerkschaften gewandelt habe, die von eher ehemaligen Arbeiterorganisation zu einem staatlichen Ordnungsfaktor mutiert sei. Ein weiterer Grund für das Mitwirken in den Gewerkschaften war aus der Sicht der IS, dass man nicht einfach warten könne, bis sich Arbeiterräte gebildet hätten. Überhaupt könne man nicht einfach die Arbeiter außerhalb der Gewerkschaften allein auf sich gestellt lassen. Wie die Gewerkschaften aussähen, was sie täten – läge an uns. Auch wenn die Gewerkschaften ans System angekettet worden seien, müssten wir die Gewerkschaften für uns instrumentalisieren.
Selbständiges Handeln der Arbeiterklasse erforderlich?
Dem gegenüber erhob eine Teilnehmerin den Einwand, man dürfe nicht die Sicht haben, die Arbeiter solle man nicht alleine stehenlassen, sondern sie könnten sehr wohl eigenständig entscheiden, wüssten, wo sie sich Hilfe holen können. Allerdings hätten sie meist schlechte Erfahrung mit den Gewerkschaften gemacht. Die IKS meinte, es geht immer zunächst darum, die Eigeninitiative der Betroffenen zu fördern, jegliches Bestreben zusammenzukommen zu unterstützen, um die Lage gemeinsam zu beraten, gemeinsam zu überlegen, an wen man sich wenden könne. Je mehr sich zusammenschlössen, je mehr sich ein Kampf radikalisiere, desto mehr Ausstrahlung könne eine Bewegung haben. Ausgangspunkt eines langen Prozesses, der erst in einer revolutionären Situation zur Bildung von Arbeiterräten führt, müsse jeweils das selbständige Handeln der Betroffenen sein. Diese Dynamik verlangt aber den Zusammenschluss aller Arbeiter über alle sie spaltenden Gräben hinweg. Bei diesem Prozess können die Gewerkschaften nicht zu Instrumenten zugunsten der Arbeiter „verwandelt“ werden, sondern sie wirken immer als Hindernis, das überwunden werden müsse. Erfolge der Arbeiter werden nicht erzwungen dank einer unmöglich gewordenen Umwandlung der Gewerkschaften zu Kampforganen sondern nur dank des Handelns der Betroffenen. Einer Frau, die auf eine gar nicht bescheidene Weise von sich behauptete, keine Intellektuelle zu sein um unter Berufung auf das angeblich niedrige Bildungs- und Bewussteinsniveau der Arbeiter die Gewerkschaften für notwendig hielt, damit die Arbeiter ihre Macht erkennen und ausüben, wurde entgegengehalten, die Arbeiter können ihr Selbstvertrauen nur entwickeln, ihre eigene Macht nur dann verspüren, wenn sie selbst handeln. Zudem hatte Rosa Luxemburg in ihrer Schrift „Sozialreform oder Revolution“ betont: „Es kann keine gröbere Beleidigung, keine ärgere Schmähung gegen die Arbeiterschaft ausgesprochen werden als die Behauptung: theoretische Auseinandersetzungen seien lediglich Sache der ‚Akademiker’“.Während in der Diskussion die Mitglieder der IS immer wieder die Behauptung aufstellten, in den Gewerkschaften knüpfe man die großen Kontakte, nur so könne man in Verbindung mit den Arbeitern stehen, letztendlich den Beweis für ihre „erfolgreiche Kontaktarbeit“ aber schuldig blieben, und gleichzeitig der Vorwurf durchdrang, die IKS stehe eher abseits von den Kämpfen, schilderte die IKS anhand von einigen Beispielen (Polen 1980, Krupp-Rheinhausen 1987, Frankreich 2006, 2007) dass man als Revolutionäre nur außerhalb und unabhängig von den Gewerkschaften tätig sein kann. Im Verlaufe dieses Abends waren bei diesem Streitgespräch in der Tat zwei unterschiedliche, sich gegenseitig ausschließende Herangehensweisen aufeinandergestoßen. 15.02.08
Schriftlicher Beitrag der IKS
zur Debatte der Gewerkschaftsfrage auf dem NLO-Treffen im Februar 2008
Es gibt die Auffassung, dass die Revolution jeder Zeit möglich wäre, dass sie nur vom Willen abhinge. Die Marxisten betonen dagegen, dass die Revolution nur unter bestimmten Bedingungen möglich ist.
Es gibt die Auffassung, dass der alltägliche Abwehrkampf der Arbeiter und die Revolution nichts miteinander zu tun hätten. Manche politische Organisationen lehnen den Abwehrkampf ab, weil er der Revolution entgegengesetzt sei. Sie wollen die Revolution sofort. Es gibt die Auffassung, dass die Organisationen, die heute ungeeignet für den Arbeiterkampf sind und ihm feindlich gegenüberstehen, das schon immer gewesen seien. Der Marxismus sieht die Dinge historisch. Es gibt nichts, was für alle Zeiten gut oder schlecht ist; alles wandelt sich. Nach der Lehre des Marxismus war selbst der Kapitalismus nicht schon immer etwas Schlechtes, ist der Kapitalismus nichts an sich ‚Teuflisches’. Er war gegenüber dem Feudalismus etwas Fortschrittliches. Er ermöglichte die Entwicklung der Produktivkräfte, was eine Vorbedingung für den Kommunismus ist, der nur als eine Gesellschaft der Fülle möglich ist, und er brachte seinen eigenen Totengräber, das Weltproletariat, hervor. Eine Gesellschaftsform macht eine Entwicklung durch. In ihrem Entstehen, ihrer aufsteigenden Phase stellt sie einen geschichtlichen Fortschritt dar, beseitigt manche Übel der vorhergehenden Gesellschaft. In dieser Zeit steht die Revolution noch nicht auf der Tagesordnung, sondern erst ab dem Zeitpunkt, an dem eine Gesellschaftsform ihre historische Aufgabe erfüllt hat, und nun zu einem Hindernis für die weitere Entwicklung wird.
Der Arbeiterkampf im 19. Jahrhundert
In der aufsteigenden Phase entwickelte sich der Weltmarkt. Die Arbeiterklasse konnte durch den Zusammenschluss in Gewerkschaften Verbesserungen erreichen. Im 19. Jahrhundert gab es eine Trennung zwischen politischem und wirtschaftlichem Kampf. Der wirtschaftliche Kampf wurde von den Gewerkschaften geführt und der politische von der sozialdemokratischen Partei. Der wirtschaftliche Kampf richtete sich gegen einzelne Kapitalisten und die streikenden Arbeiter wurden von den anderen Arbeitern unterstützt, die das nur konnten, wenn sie nicht selber streikten. Damals konnten sich noch die verschiedensten Arbeitervereine bilden, Kultur- und Sportvereine, die noch wirklich ein Gegenpol zur bürgerlichen Welt waren. Dort wurde die Solidarität gepflegt, der Zusammenhalt, eine Unterstützungskasse angelegt.
Die Wende des 1. Weltkriegs
Der 1. Weltkrieg war Ausdruck dafür, dass der Kapitalismus nun zu einem Hindernis für die weitere Entwicklung der Menschheit geworden war. Der 1. Weltkrieg war Ausdruck eines verschärften, mörderischen Konkurrenzkampfes, der jede nationale Bourgeoisie zwang, die Arbeiterklasse bluten zu lassen. Der Weltmarkt war geschaffen und damit in gewisser Hinsicht ein Schritt hin zur Einheit der Menschheit getan. Der 1. Weltkrieg als Krieg um die Neuaufteilung des Weltmarkts unter die einzelnen Staaten. Die Gewerkschaften waren zu Staatsorganen, zu Instrumenten des Kapitals geworden, die zusammen mit ihrer jeweiligen Bourgeoisie, die ganze Wirtschaft auf den Krieg ausrichteten, den Arbeitern den Burgfrieden aufzwangen und ‚ihre’ jeweiligen Arbeiter zum massenhaften Mord an ihren Klassenschwestern und –brüdern aufriefen.
Die Gewerkschaften – Waffe der Arbeiter oder des Kapitals?
Nun stand die Weltrevolution auf der Tagesordnung, die Abschaffung der Lohnarbeit, der Staaten, der Konkurrenz- und Warengesellschaft. Die Gewerkschaften haben ihre ursprüngliche Funktion verloren als Vertreter der Ware Arbeitskraft. Und sie haben eine neue Funktion, nun an der Seite der Bourgeoisie, die Kämpfe in Sackgassen laufen zu lassen, Wut verpuffen zu lassen usw. usw. Ohne die Überwindung des Kapitalismus kann die Arbeiterklasse auf die Dauer nicht mehr überleben. Sie muss die Revolution machen, um überleben zu können. Um dahin zu kommen, die Revolution machen zu können, muss sie gegen die Verschlechterung ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen kämpfen, muss sie sich ihres revolutionären Wesens bewusst werden, muss sie ihre Einheit schmieden - auch letzteres ein Grund, die Gewerkschaften abzulehnen, selbst wenn sie Vertreter der Ware Arbeitskraft wären, weil sie der Einheit entgegenarbeiten, indem sie die Arbeiter in Branchen spalten. Es kann keine Trennung mehr zwischen politischem und wirtschaftlichem Kampf geben. Bei jedem größerem Kampf steht die Arbeiterklasse gegen alle tragenden Kräfte der Gesellschaft, gegen die Unternehmer, die Gewerkschaften, die Medien, die Parteien. Die Lohnkämpfe werden zu einer Schule für die Revolution.Hinter jedem Streik lauert, wie Lenin sagt, das Gespenst der Revolution. Der Kampf der Arbeiter ist ein Kampf gegen die Ausbeutung und stellt damit die Machtfrage über die Verfügung des Mehrprodukts. In den Kämpfen muss das Proletariat die Perspektive des Kommunismus entwickeln.
Der Massenstreik- Fusion von politischem und ökonomischem Kampf
1905 hat die Arbeiterklasse in Russland und schon vorher in Belgien ein neues Mittel für ihren Kampf gefunden: den Massenstreik, und eine neue Organisationsform: die Arbeiterräte. Beide sind eine Einheit von politischem und wirtschaftlichen Kampf. Da die Revolution, die Befreiung der Arbeiter ansteht, und die nur das Werk der Arbeiter selbst sein kann, ist jede Stellvertreterpolitik ausgeschlossen, also auch der Parlamentarismus. Der Massenstreik kann nicht wie ein Generalstreik geplant oder der Tag X vorbereitet werden, sondern er kommt aus den Tiefen der gesellschaftlichen Entwicklung und der unterirdischen Reifung der Bewusstseinsentwicklung der Arbeiter.Der staatliche Totalitarismus ist so stark geworden, dass es nur noch im Kampf Arbeiterorgane wie Streikkomitees geben kann. Wenn man versucht, sie nach dem Kampf aufrechterhalten, werden sie unweigerlich aufgesaugt und degenerieren zu gewerkschaftsähnlichen Gruppen. Nur wenn möglichst große Teile der Klasse mobilisiert sind, wenn es ständig Vollversammlungen und Debatten gibt, wenn die Klasse wachsam ist, wenn die Klasse agiert, können Masseneinheitsorgane bestehen.
In allen größeren Kämpfen der Arbeiterklasse kommt es zu Vollversammlungen und zu auf den Vollversammlungen gewählten Streikkomitees und Delegierten. Das sind Keimformen der Arbeiterräte. Beide die Räte und deren Keimformen sind die politisch und wirtschaftlichen Masseneinheitsorgane der Klasse. Sie sind für alle offen, ob Christ oder Moslem, ob arbeitslos oder nicht, ob Gewerkschaftsmitglied oder nicht, ob CDU-, SPD- oder Nichtwähler. Sie sind Orte der Debatte, der Zurückdrängung der bürgerlichen Ideologie. Es ist möglichst die ganze Klasse in die jeweiligen Kämpfe einbezogen werden.
Aktuelles und Laufendes:
- Arbeiterkampf [3]
Gegen die weltweiten Angriffe des krisengeschüttelten Kapitalismus: eine Arbeiterklasse – ein Klassenkampf
- 2835 reads
Seit fünf Jahren hat sich der Klassenkampf weltweit kontinuierlich weiterentwickelt. Gegen die simultanen und immer schlimmeren Attacken, mit denen sie konfrontiert wird, reagiert die Arbeiterklasse, indem sie ihre Kampfbereitschaft demonstriert und sowohl in den sog. entwickelten als auch in den unterentwickelten Ländern den Kampf aufnimmt.
Bekräftigung der weltweiten Entwicklung des Klassenkampfes
Im Laufe des Jahres 2007 sind in vielen Ländern Arbeiterkämpfe ausgebrochen.
Ägypten: Bereits im Dezember 2006 und Frühjahr 2007 standen die 27.000 ArbeiterInnen der Fabrik Ghazl Al Mahallah, etwa hundert Kilometer von Kairo entfernt, im Mittelpunkt einer großen Welle von Kämpfen. Am 23. September, inmitten einer mächtigen Welle von Kämpfen, nahmen sie den Kampf erneut auf. Der Regierung versäumte es, ihr Versprechen zu halten und 150 Tageslöhne an alle ArbeiterInnen auszuzahlen, ein Versprechen, mit dem sie dem vorausgegangenen Streik ein Ende bereitet hatte. Ein Streikender, der von der Polizei festgenommen worden war, erklärte: „Uns wurden 150 Tageslöhne versprochen; wir wollen lediglich, dass man unsere Rechte respektiert: Wir sind entschlossen, bis ans Ende zu gehen.“ Die ArbeiterInnen listeten ihre Forderungen auf: einen Bonus von 150 ägyptischen Pfund (umgerechnet weniger als 20 Euros, während die Monatslöhne zwischen 200 und 250 ägyptischen Pfund schwanken); kein Vertrauen in den Gewerkschaftsausschuss und den Vorstand der Gesellschaft; einen Bonus, der auf den Grundlohn angerechnet wird und nicht am Produktionsergebnis gebunden ist; eine Erhöhung der Lebensmittelzuschüsse; einen an die Preise geknüpften Mindestlohn; Fahrkostenzuschüsse für ArbeiterInnen, die gezwungenermaßen weit entfernt von der Fabrik wohnen, und eine Verbesserung des Gesundheitsdienstes. Die ArbeiterInnen anderer Textilbetriebe, wie jene von Kafr Al Dawar, die bereits im Dezember 2006 erklärten: „Wir sitzen alle im gleichen Boot und unternehmen dieselbe Reise“, demonstrierten einmal mehr ihre Solidarität und traten Ende September in den Streik. In den Kairoer Getreidemühlen gingen die Beschäftigten zu einem Sitzstreik über und übermittelten eine Solidaritätsbotschaft, in der sie die Forderungen der Textilarbeiterinnen unterstüzten. In den Betrieben von Tanta Linseed and Oil folgten die Beschäftigten dem Beispiel von Mahallah, indem sie eine ähnliche Liste von Forderungen veröffentlichten. In diesen Kämpfen wurde auch eine vehemente Ablehnung der offiziellen Gewerkschaften zum Ausdruck gebracht, die als die treuen Bluthunde der Regierung und der Bosse betrachtet werden: „Der Repräsentant der offiziellen, staatlich kontrollierten Gewerkschaften, der daher gekommen war, um seine Kollegen aufzufordern, den Streik zu beenden, befindet sich im Krankenhaus, nachdem er von wütenden Arbeitern zusammengeschlagen worden war. ‚Die Gewerkschaften gehorchen lediglich den Anweisungen von oben, wir wollen unsere eigenen Repräsentanten wählen‘, erklärten die ArbeiterInnen“ (zitiert in Libération, 1.10.2007). Die Regierung sah sich veranlasst, den ArbeiterInnen einen Zuschlag von 120 Tageslöhnen anzubieten und zu versprechen, das Management zu belangen. Doch die ArbeiterInnen haben gezeigt, daß sie bloßen Versprechungen nicht mehr trauen; Stück für Stück vertrauten sie ihrer kollektiven Stärke und ihrer Entschlossenheit, zu kämpfen, bis ihre Forderungen erfüllt wurden.
Dubai: In diesem Emirat am Persischen Golf bauen Hunderttausende von Bauarbeitern, zumeist aus Indien, Pakistan, Bangladesh und China, Luxushotels und Paläste für 100 Euro im Monat und werden in der Nacht wie Vieh in schmutzige Baracken gepfercht. Bereits im Frühjahr 2006 waren Streiks ausgebrochen, und auch im Oktober 2007 trotzten 4.000 von ihnen der Androhung von Repressalien, des Job- und Lohnverlustes sowie der lebenslangen Abschiebung aus Dubai und gingen auf die Straße, womit sie weitere 400.00 Bauarbeiter dazu brachten, zwei Tage lang mit ihnen in den Ausstand zu treten.
Algerien: Angesichts des wachsenden Unmuts riefen die autonomen Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes für den 12. und 15. Januar 2008 gegen den Kollaps der Kaufkraft und die neuen Gehaltstarife für Lehrer zu einem landesweiten Streik der Staatsangestellten, insbesondere der Lehrer, auf. Doch der Streik weitete sich auch auf andere Sektoren aus, einschließlich der Beschäftigten im Gesundheitsbereich. Die Stadt Tisi Ouzou wurde völlig lahmgelegt, der Streik der Lehrkräfte war in den Städten Oran, Constantine, Annaba, Bechar, Adrar und Saïda besonders massiv.
Venezuela: Schon im Mai 2007 hatten sich die Ölarbeiter gegen Entlassungen in einem Staatsunternehmen gewehrt. Im September mobilisierten sie sich während der Arbeitsvertragsverhandlungen erneut, um höhere Löhne zu fordern. Auch der Mai erlebte eine Mobilisierung von Studenten gegen das Regime, die die Verbesserung der Lebensbedingungen für die Ärmsten der Bevölkerung und der ArbeiterInnen forderten. Die Studenten organisierten allgemeine Versammlungen, die für alle offen waren, mit gewählten Streikkomitees. Jedesmal hinterließ die von der Chavez-Regierung, dem „Apostel der bolivarischen Revolution“, veranlasste Repression einige Tote und Hunderte von Verletzten.
Peru: Im April begann ein unbefristeter Streik in einem chinesischen Unternehmen, der sich - zum ersten Mal seit 20 Jahren - schnell auf den Kohlebergbau im ganzen Land ausweitete. Das Unternehmen Sider Peru in Chimbote wurde trotz der Versuche der Gewerkschaften, den Streik zu isolieren und zu sabotieren, vollständig lahmgelegt. Die Ehefrauen der Bergarbeiter demonstrierten zusammen mit ihnen; auch schlossen sich ihnen große Teile der örtlichen Bevölkerung, einschließlich Bauern und Arbeitslose, an. In Casapalca in der Nähe von Lima stellten die Bergarbeiter die Minenmanager, die ihnen mit Entlassungen gedroht hatten, falls sie ihre Arbeit verlassen, unter ihre Obhut. Studenten aus Lima, denen sich ein Teil der Bevölkerung anschloss, machten sich auf, um ihnen Lebensmittel zu bringen und zu unterstützen. Im Juni wurde ein großer Teil der landesweit etwa 325.000 Lehrer mobilisiert, ebenfalls von weiten Teilen der Bevölkerung unterstützt, trotz aller gegenteiligen Bemühungen der Gewerkschaften. Jedesmal reagierte die Regierung mit Verhaftungen, Kündigungsdrohungen, mit dem Einsatz von Vertragsarbeitern, um die streikenden Bergarbeiter zu ersetzen, und mit der Organisierung massiver Medienkampagnen, um die streikenden Lehrer zu verleumden.
Türkei: Angesichts von Lohneinbußen und Arbeitsplatzunsicherheit infolge der Privatisierung und des Transfers von 10.000 Jobs zu Subunternehmen streikten Ende des vergangenen Jahres 26.000 ArbeiterInnen von Türk Telecom 44 Tage lang – der größte Streik in der Türkei seit dem Bergarbeiterstreik von 1991. Vor dem Hintergrund einer Militärkampagne gegen die Kurden im irakischen Grenzgebiet wurden einige „Rädelsführer“ verhaftet, der Sabotage, ja des Hochverrats gegen die nationalen Interessen beschuldigt und mit Sanktionen und Kündigungen bedroht. Am Ende behielten sie ihre Jobs, und obendrein wurde eine Lohnerhöhung von zehn Prozent ausgehandelt.
Finnland: Die Bourgeoisie war bereits weit gekommen beim Abbau der sozialen Sicherheit in Finnland, als 70.000 Pflegekräfte (vornehmlich Krankenschwestern) im Oktober einen Monat lang in den Ausstand traten, um eine Lohnerhöhung von mindestens 24 Prozent zu fordern. Die Gehälter sind so niedrig (zwischen 400 und 600 Euro im Monat), dass viele von ihnen dazu gezwungen sind, Arbeit im benachbarten Schweden zu suchen. 12.800 Krankenschwestern drohten, kollektiv zu kündigen, falls die Regierung und die Gewerkschaft Tehy es in ihren Verhandlungen versäumt, ihren Forderungen nachzukommen – die Regierung hatte lediglich eine 12-prozentige Erhöhung angeboten. In einigen Krankenhäusern drohten ganze Stationen geschlossen zu werden.
Bulgarien: Nach einem eintägigen symbolischen Streik traten die Lehrer Ende September in einen unbefristeten Streik, um Gehaltserhöhungen zu fordern: 100 Prozent für Realschullehrer (die im Durchschnitt 174 Euro im Monat verdienen) und eine 5-prozentige Erhöhung des nationalen Bildungsetats. Der Streik war in dem Moment zu Ende, als die Regierung versprach, die Lehrergehälter 2008 zu überprüfen.
Ungarn: Aus Protest gegen die Stilllegung unprofitabler Linien und gegen die Regierungsreform der Renten und der Gesundheitsfürsorge traten die Eisenbahnarbeiter in den Streik. Am 17. Dezember zogen sie weitere 32.000 ArbeiterInnen aus anderen Branchen (Lehrer, Pflegekräfte, Busfahrer, Angestellte des Budapester Flughafens) in den Streik. Am Ende waren die Gewerkschaften trotz der Tatsache, dass das Parlament die Reform durchgewunken hat, in der Lage, die Mobilisierung in den Industrien zu benutzen, um den Kampf der Eisenbahnarbeiter zu ersticken; sie riefen zur Rückkehr zur Arbeit am nächsten Tag auf.
Russland: Trotz des Gesetzes, das alle Streiks, die länger als 24 Stunden dauern, für illegal erklärt, trotz der gerichtlichen Verurteilungen von Streikenden, trotz ständiger Polizeiübergriffe und des Einsatzes von Kriminellen gegen die kämpferischsten ArbeiterInnen, ist im vergangenen Frühjahr zum ersten Mal seit zehn Jahren eine Streikwelle durchs Land geschwappt, von Westsibirien bis zum Kaukasus. Zahllose Industriebranchen wurden dabei in Mitleidenschaft gezogen: Baustellen in Tschetschenien, ein Sägewerk in Nowgorod, ein Krankenhaus in dem Gebiet von Tchita, Hausinstandhaltungsarbeiter in Saratow, Angestellte von Fast-Food-Restaurants in Irkutsk, die Fabrik von General Motors in Togliattigrad und eine wichtige Maschinenfabrik in Karelien. Die Bewegung kulminierte im November mit einem dreitägigen Streik der Hafenarbeiter in Tuapse am Schwarzen Meer, dem zwischen dem 13. und 17. November die Hafenarbeiter von drei Petersburger Betrieben folgten. Am 26. Oktober traten Postangestellte in den Streik, so wie auch im gleichen Monat die Angestellten von Elektrizitätswerken. Zugführer bei den Eisenbahnen drohten, zum ersten Mal seit 1988 wieder zu streiken. Das völlige mediale Ausblenden dieser Streikwelle, die durch die massive Inflation und Preissteigerungen von 50 – 70 Prozent bei Grundnahrungsmitteln ausgelöst worden war, wurde vor allem durch den Streik der Fordarbeiter in Vsevolojsk in der Region von St. Petersburg am 20. November durchbrochen. Die Föderation Unabhängiger Gewerkschaften, die die Regierung ganz offenkundig mit Samthandschuhen anfasst und Streiks jeglicher Art feindlich gegenübersteht, erwies sich als unfähig, auch nur die geringste Rolle bei der Kontrolle der Arbeiterbewegung zu spielen. Dafür beutete das Management der Großbetriebe mit der Hilfe der herrschenden Klasse des Westens ausgiebig die Illusionen der ArbeiterInnen über „freie“ oder „klassenkämpferische“ Gewerkschaften aus und ermutigte die Entstehung neuer gewerkschaftlicher Strukturen, wie die Überregionale Gewerkschaft der Automobilarbeiter, die auf Initiative des Gewerkschaftskomitees von Ford geschaffen wurde und unabhängige Gewerkschaften aus etlichen Großbetrieben, wie Avto-VAZ-General Motors in Togliattigrad und Renault-Autoframos in Moskau, um sich scharte. Es sind diese neuen „unabhängigen“ Gewerkschaften, die – durch die Isolierung der ArbeiterInnen in ihren Fabriken und die Einschränkung der Solidaritätsbekundungen anderer ArbeiterInnen auf reine Sympathiebekundungen und finanzielle Hilfe – die ArbeiterInnen in die bittersten Niederlagen treiben. Erschöpft und mittellos nach einem Monat Streik, waren Letztere gezwungen, zur Arbeit zurückzukehren, nachdem sie nichts oder – in den Worten des Managements – ein vages Versprechen erhalten hatten, nach der Rückkehr zur Arbeit in Verhandlungen zu treten.
Italien: Am 23. November organisierten die Basisgewerkschaften (Confederazione Unitaria di Base – CUB, die Cobas - und etliche branchenübergreifende „Kampf“-Gewerkschaften) einen eintägigen Generalstreik gegen ein am 23. Juli von der Regierung und den drei Hauptgewerkschaften (CGIL, CISL, UIL) unterschriebenes Abkommen - das Angriffe gegen die Arbeitsplatzsicherheit und eine drastische Reduzierung der Renten- und Gesundheitsausgaben vorsieht -, dem sich zwei Millionen ArbeiterInnen anschlossen. Mehr als 400.000 Menschen nahmen an 25 Demonstrationen überall im Land teil, die größten in Rom und Mailand. Alle Branchen waren betroffen, besonders aber das Transportwesen (Eisenbahnen, Flughäfen), der Maschinenbau (in der Fiat-Fabrik von Pomigliano wurde der Streikaufruf zu 90 Prozent befolgt) und die Krankenhäuser. Ein großer Teil der Streikenden bestand aus jungen Leuten mit Zeitverträgen (von denen es mehr als sechs Millionen gibt) und nicht-gewerkschaftlichen ArbeiterInnen. Der Zorn über die abnehmende Kaufkraft spielte eine wichtige Rolle bei dem Umfang dieser Mobilisierung.
Großbritannien: Zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt traten Postangestellte, besonders in Liverpool und Südlondon, spontan in eine Reihe von Streiks gegen Lohnkürzungen und drohenden Arbeitsplatzverlust. Die Kommunikationsarbeiter-Gewerkschaft (CWU) antwortete darauf mit der Isolierung der ArbeiterInnen, indem sie deren Aktivitäten auf das Aufstellen von Streikposten an den bestreikten Sortierämtern beschränkte. Gleichzeitig unterschrieb die CWU ein Abkommen mit dem Management, um die Flexibilität bei den Jobs und den Löhnen zu erhöhen.
Deutschland: Der „rollende Streik“ der Eisenbahner für höhere Löhne dauerte zehn Monate und wurde von der GDL (Gewerkschaft Deutscher Lokführer) kontrolliert. Die Gewerkschaften spielten eine Hauptrolle bei der Spaltung der ArbeiterInnen; einige Gewerkschaften hielten am legalen Rahmen fest, während andere radikaler in der Bereitschaft schienen, das Gesetz zu brechen. Die Medien organisierten eine riesige Kampagne, um die „selbstsüchtigen“ Streikenden zu verleumden, die jedoch eine Menge Sympathie von den Fahrgästen erhielten, die größtenteils selbst ArbeiterInnen sind und in wachsendem Maße bereit sind, sich mit jenen zu identifizieren, die sich im Kampf gegen dieselbe „soziale Ungerechtigkeit“ befinden, die sie selbst fühlen. Die Zahl der Eisenbahner hat sich in den letzten zwanzig Jahren halbiert, während sich gleichzeitig die Arbeitsbedingungen verschlechterten und die Löhne in den letzten fünfzehn Jahren eingefroren waren, so dass die Eisenbahner heute zu den am schlechtesten bezahlten Arbeitern in Deutschland gehören (Monatsgehälter von nur 1500 Euro im Durchschnitt). Unter dem Druck der Eisenbahner wurde ein neuer dreitägiger Streik im November vom Gericht stattgegeben, parallel zum Eisenbahnerstreik in Frankreich, der auf große Unterstützung in der deutschen Öffentlichkeit stieß. Dies führte im Januar zu einer Lohnerhöhung von 11 Prozent (weitaus weniger als die geforderten 31 Prozent und teilweise bereits überholt); um Dampf abzulassen, wurde die Wochenarbeitszeit der 20.000 Lokführer von 41 auf 40 Stunden reduziert – beginnend mit dem Februar 2009.
Für das Ende 2008 kündigte der finnische Handyhersteller Nokia die Schließung seines Bochumer Werkes an, d.h. die Kündigung von 2.300 ArbeiterInnen und die Gefährdung weiterer 1.700 Jobs unter den ZeitvertragsarbeiterInnen in der Stadt. Am Tag nach der Ankündigung, am 16. Januar, verweigerten die ArbeiterInnen die Arbeit, und Automobilarbeiter aus der nahe gelegenen Opel-Fabrik sowie von Mercedes, Stahlarbeiter vom Dortmunder Hoechst-Betrieb, Maschinenbauer von Herne und Bergarbeiter der Region versammelten sich vor den Fabriktoren von Nokia, um ihren KollegInnen ihre Unterstützung und Solidarität auszudrücken. Das deutsche Proletariat im Zentrum Europas wird durch seine systematische Erfahrung in Sachen Solidarität und militanter Kampf einmal mehr zum Leuchtturm für den internationalen Klassenkampf. Es sei daran erinnert, dass schon im Jahr 2004 die Arbeiter von Daimler-Benz in Bremen spontan gegen die Versuche des Managements in den Ausstand getreten waren, sie gegen ihre Kollegen in der Stuttgarter Daimler-Fabrik auszuspielen, denen die Entlassung drohte. Einige Monate später waren die bereits genannten Opel-Arbeiter an der Reihe, spontan gegen dieselbe Art von Pressionen durch das Management zu streiken. Daher versuchte die herrschende Klasse in Deutschland, dieselben Ausdrücke der Solidarität und die Mobilisierung über Industriebranchen hinweg zu vermeiden, indem sie die Aufmerksamkeit auf den altbekannten Fall einer Verlagerung (die Nokiafabrik zieht nach Cluj in Rumänien) zu lenken und eine riesige Medienkampagne (mit den vereinten Kräften der Regierung, Landespolitikern, der Kirche und der Gewerkschaften) zu entfachen, um den finnischen Konzern anzuklagen, die Regierung hintergangen zu haben, nachdem er all die Subventionen für den Erhalt seiner Bochumer Fabrik erhalte hatte.
Während die gesamte Arbeiterklasse Ziel unablässiger Angriffe der herrschenden Klasse (Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67, Entlassungspläne, Kürzungen der Sozialhilfe durch die Agenda 2010...) ist, wird der Kampf gegen Entlassungen und Arbeitsplatzvernichtung in wachsendem Maße von Forderungen nach Lohnerhöhungen und gegen die zerfallende Kaufkraft ergänzt. 2007 war die Zahl der Streiktage die höchste seit 1993 nach der Wiedervereinigung (70 Prozent von ihnen gingen aufs Konto der Streiks im Frühjahr gegen die Auslagerung von 50.000 Jobs in der Telekommunikationsindustrie).
Frankreich: Das künftige Potenzial war vor allem durch die Streiks der Lokführer und der Straßenbahnfahrer in Frankreich im Oktober und November demonstriert worden, ein Jahr nach den Kämpfen im Jahr 2006, die die Regierung damals dazu gezwungen hatten, das neue Gesetz (CPE) zurückzunehmen, das auf die Verringerung der Arbeitsplatzsicherheit für junge Leute abzielte, und in denen die studentische Jugend eine Hauptrolle gespielt hatte. Der Streik im Transportwesen folgte einem fünftägigen Streik der Flugzeugcrews bei Air France gegen die Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen, Spiegelbild des allgemeinen Anstiegs der Militanz und des sozialen Unmuts.
Weit entfernt davon, sich an einem „privilegierten“ Rentensystem zu klammern, forderten die Eisenbahner die Rückkehr zur Rente nach 371/2 Beitragsjahren für alle. Besonders die jungen Arbeiter der SNCF demonstrierten eine große Entschlossenheit, um den Streik auszudehnen und mit dem Korporatismus zu brechen, der die Eisenbahner in verschiedene Kategorien (Lokführer, Mechaniker, Zugbesatzung) spaltete, was so schwer auf den Kämpfen von 1986/87 und 1995 gelastet hatte. Dabei offenbarten sie ein starkes Gefühl der Solidarität innerhalb der Arbeiterklasse insgesamt.
Gleichzeitig war die Studentenbewegung gegen die Universitätsreform (bekannt als „Loi Pécresse“) - die darauf abzielte, die Universitäten aufzuteilen in einige wenige Eliteinstitutionen für die Bourgeois und in Massenuniversitäten, von denen der Rest mit Zeitarbeitsverträgen abgeht - eine Verlängerung der Bewegung von 2006 in dem Sinne, als ihr Forderungskatalog nicht nur die Rücknahme des Loi Pécresse vorsah, sondern auch die Ablehnung aller Angriffe der Regierung mit einschloss. Es wurden ganz reale Solidaritätsbande zwischen Studenten und Eisenbahnern sowie Straßenbahnfahrern geknüpft, die sich im gegenwärtigen Kampf - wenn auch begrenzt – in solchen Momenten ausdrücken wie in ihren allgemeinen Versammlungen, vereinten Aktionen und gemeinsamen Mahlzeiten.
Diese Kämpfe konfrontieren überall die Sabotage und Spaltung, zu denen die Gewerkschaften ermutigen, die immer mehr ihre wahre Funktion als Diener des bürgerlichen Staates enthüllen, da sie die Kärrnerarbeit bei den Angriffen gegen die Arbeiterklasse leisten müssen. In den Kämpfen der Eisenbahner und Straßenbahnfahrer im Oktober und November 2007 in Frankreich war das geheime Einverständnis der Gewerkschaften mit der Regierung augenscheinlich. Und jede Gewerkschaft spielten ihren Part bei der Spaltung und Isolierung der Kämpfe. (1)
Vereinigte Staaten: Die Vereinte Automobilarbeiter-Gewerkschaft sabotierte den Streik bei General Motors im September, daraufhin bei Chrysler im Oktober und verhandelte mit dem Management über den Transfer medizinischer und sozialer Belange an die Gewerkschaften im Austausch für den „Schutz“ der Jobs und einem vierjährigen Einfrieren der Löhne. Dies ist nichts als Schwindel, da das Management hinter der Aufrechterhaltung der Zahl der Arbeitsplätze die Ersetzung von permanenten Vollzeit-ArbeiterInnen durch ZeitarbeiterInnen mit niedrigeren Löhnen plant, die dennoch gezwungen werden, der Gewerkschaft beizutreten.
Dieses Verhalten der Gewerkschaft – schlechtere Bedingungen für künftige Jobs zu akzeptieren – ist weit entfernt von der Entschlossenheit, die die New Yorker U-Bahn-Beschäftigten im Jahr 2005 an den Tag gelegt hatten, welche unter großen Opfer gegen eine vorgeschlagene Abmachung streikten, die die künftige Generationen bestrafen würde, während die heutigen ArbeiterInnen relativ verschont geblieben wären; ausdrücklich hatten sie ihre Solidarität nicht nur mit ihren KollegInnen erklärt, sondern auch mit den noch ungeborenen Arbeitergenerationen.
Die Hauptcharakteristiken des heutigen Kampfes
Die Bourgeoisie ist in wachsendem Maße gezwungen, angesichts der Diskreditierung des Gewerkschaftsapparates Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Daher erleben wir, je nach Land, das Auftreten von Basisgewerkschaften oder „radikalerer“ Gewerkschaften bzw. Gewerkschaften, die „frei und unabhängig“ zu sein behaupten, um die Kämpfe zu kontrollieren, um die Fähigkeit der ArbeiterInnen, die Kontrolle über den Kampf selbst zu übernehmen, in Schach zu halten und vor allem um jeglichen Denkprozess, jegliche Diskussion und jeglichen Anstieg im Bewusstsein unter den ArbeiterInnen zu unterbinden.
Die sich entwickelnden Kämpfe stehen auch einer breiten Hasskampagne, die von der herrschenden Klasse dirigiert wird, und einer Steigerung der Repressionsmaßnahmen gegenüber. In Frankreich wurde nicht nur eine große Kampagne organisiert, um die „Kunden“ gegen streikende TransportarbeiterInnen auszuspielen, die ArbeiterInnen unter sich zu spalten und den Impuls zur Solidarität zu brechen – es wird auch immer öfter versucht, die Streikenden zu kriminalisieren. Am 21. November, am Ende des Streiks, wurde eine ganze Kampagne um Sabotageakte an Eisenbahngleisen und Oberleitungen entfesselt, um die ArbeiterInnen als „uverantwortlich“ und gar als „Terroristen“ hinzustellen. Dieselbe Kriminalisierung richtete sich gegen die Studenten, deren Streikposten vor den Universitäten als „Rote Khmer“ oder „Delinquenten“ dargestellt wurden. Dieselben Studenten wurden Opfer gewaltsamer Repression durch die Polizei, als diese die Streikposten beiseite drängte und die besetzten Universitäten räumte. Dutzende von Studenten wurden verletzt oder festgenommen und summarisch zu langen Gefängnisstrafen verurteilt.
Diese aktuellen Kämpfe bekräftigen voll und ganz die Charakteristiken, die wir in der Resolution über die internationale Lage, welche vom 17. Kongress der IKS im Mai 2007 verabschiedet worden war, in den Blickpunkt gerückt hatten. (2)
·„... sie schließen immer mehr die Frage der Solidarität mit ein. Dies ist äußerst wichtig, weil sie par excellence das Gegenstück zum Verhalten des ‚Jeder-für-sich-selbst‘ bildet, das so typisch für den gesellschaftlichen Zerfall ist, und vor allen Dingen weil sie im Mittelpunkt der Fähigkeit des Weltproletariats steht, nicht nur seine gegenwärtigen Kämpfe weiterzuentwickeln, sondern auch den Kapitalismus zu stürzen“. Trotz aller Bemühungen der Bourgeoisie, die Kämpfe davon fernzuhalten, lag in den Kämpfen in Frankreich im Oktober und November der Duft der Solidarität in der Luft.· Die Kämpfe drücken eine Desillusionierung über die Zukunft aus, die der Kapitalismus uns anbietet: „... nahezu vier Jahrzehnte der offenen Krise und der Angriffe gegen die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse, besonders der Anstieg der Arbeitslosigkeit und der prekären Arbeit hat die Illusionen weggefegt, dass ‚morgen alles besser sein wird‘: die älteren Arbeitergenerationen sind sich genauso wie die neuen weitaus bewusster über die Tatsache, dass ‚morgen alles noch schlimmer sein wird‘.“· „Heute ist es nicht die Möglichkeit der Revolution, die die Hauptquelle des Denkprozesses ausmacht, sondern - angesichts der katastrophalen Perspektiven, die der Kapitalismus für uns parat hält – ihre Notwendigkeit.“ Das Nachdenken über die Sackgasse des Kapitalismus ist mehr und mehr ein bestimmendes Element bei der Reifung des Klassenbewusstseins.
·„1968 drückten die Studentenbewegung und die Bewegung der ArbeiterInnen, auch wenn die eine der anderen auf dem Fuße folgte, zwei verschiedene Realitäten bezüglich des Eintrittts des Kapitalismus in seine offene Krise aus: für die Studenten eine Revolte des intellektuellen Kleinbürgertums angesichts der Perspektive einer Auszehrung ihres gesellschaftlichen Status‘; für die ArbeiterInnen ein ökonomischer Kampf gegen die Anfänge der Herabsetzung ihres Lebenstandards. 2006 war die Bewegung der StudentInnen eine Bewegung der Arbeiterklasse.“ Heute ist die Mehrheit der Studenten in der Arbeiterklasse integriert: Die meisten von ihnen müssen arbeiten, um ihr Studium oder ihre Wohnung zu finanzieren; sie sind beständig prekären Arbeitsbedingungen, Arbeitslosigkeit oder perspektivlosen Jobs ausgesetzt. Das Zwei-Geschwindigkeitssystem der Universitäten nach Vorbereitung durch die Regierung wird sie noch näher ans Proletariat rücken. In diesem Sinn bestätigt die französische Studentenmobilisierung 2007 das Jahr 2006, das deutlich auf dem Terrain der Arbeiterklasse stand und Methoden der Arbeiterklasse benutzte: souveräne Massenversammlungen, die allen ArbeiterInnen offen standen.
Heute zeichnet sich der Entwicklungsprozess des Klassenkampfes auch durch die Entwicklung der Diskussion innerhalb der Arbeiterklasse aus, durch das Bedürfnis nach kollektivem Nachdenken, durch die Politisierung suchender Elemente, was am Auftauchen oder an der Reaktivierung proletarischer Gruppen und Diskussionszirkel im Kielwasser bedeutsamer Ereignisse (Ausbruch imperialistischer Konflikte) oder von Streiks deutlich wird. In der ganzen Welt gibt es eine Tendenz, sich auf internationalistische Positionen hinzu zu bewegen. Wir finden ein charakteristisches Beispiel in der Türkei, wo die Genossen der Gruppe EKS eine internationalistische Stellung gegen den Krieg im Irak und gegen die Intervention der Türkei dort verteidigen, indem sie Klassenpositionen der Kommunistischen Linken vertreten. (3)
Auch in weniger entwickelten Ländern wie die Philippinen und Peru oder in hochindustrialisierten Ländern, wo die Tradition der Arbeiterbewegung weniger ausgeprägt ist, wie Korea und Japan, sind revolutionäre Bewegungen aufgekommen. In diesem Zusammenhang hat die IKS ihre Verantwortung angenommen, wie angesichts unserer jüngsten Interventionen ersichtlich wird, als wir an so verschiedenen Orten wie Peru, Brasilien, Dominikanische Republik, Japan und Südkorea an öffentlichen Veranstaltungen teilgenommen hatten, zu ihnen ermutigt oder sie selbst organisiert hatten.
„Es liegt in der Verantwortung revolutionärer Organisationen und besonders der IKS, ein aktiver Faktor im Denkprozess zu sein, der sich bereits innerhalb der Klasse abspielt, nicht nur indem sie aktiv in den Kämpfen zu intervenieren, wenn diese sich zu entwickeln beginnen, sondern auch indem sie die Entwicklung von Gruppen und Einzelnen stimulieren, die danach streben, sich dem Kampf anzuschließen.“ Mit diesen Minderheiten wird das wachsende Echo der Propaganda und Positionen der Kommunistischen Linken ein wesentlicher Faktor bei der Politisierung der Arbeiterklasse bis zur Überwindung des Kapitalismus sein.
W. (19. Januar 2008)
(1) Für weitere Informationen über die Sabotage der Gewerkschaften siehe die in unserer französischen Presse im November und Dezember 2007 veröffentlichten Artikel, von denen einige auch auf Englisch in World Revolution, Nr. 310 [9] verfügbar sind.
(2) Siehe International Review, Nr. 130, 3. Quartal 2007.
(3) Siehe ihr Flugblatt, das wir auf unserer Website veröffentlicht hatten.
Aktuelles und Laufendes:
- Arbeiterkampf [3]
Erbe der kommunistischen Linke:
April 2008
- 751 reads
Diskussionsveranstaltung: Mai 68 und die revolutionären Perspektiven
- 2889 reads
Diskussionsveranstaltung: Mai 68 und die revolutionären Perspektiven
Mai 68: ... die Studentenproteste. Die idealistischen 1960er Jahre, all das Gerede von Klassenkampf, Revolution, gehört dies nicht alles auf den Misthaufen der Geschichte? Nein: Mai 68 in Frankreich war nicht einfach ein Studentenaufstand. Die brutale Repression gegen die Studenten im Quartier Latin war nur der Funke, der eine größere Bewegung anfachte; eine Bewegung der Arbeiterklasse, des größten spontanen Streiks in der Geschichte der Arbeiterklasse. Es waren Ereignisse von historischer Bedeutung. Mehr als vier Jahrzehnte lang war die Arbeiterklasse mit Niederlagen und einer Konterrevolution konfrontiert gewesen, bei der die Bourgeoisie versuchte, alle Überreste und Erinnerungen an die internationale Welle von revolutionären Kämpfen auszulöschen, die die Welt nach der Oktoberrevolution 1917 in Russland erschüttert hatten. Stalinismus, Faschismus, der „Kampf der Demokratien" im 2. Weltkrieg gegen den Faschismus, der kalte Krieg zwischen Ost und West, die Propaganda der angeblichen Integration der Arbeiterklasse in die Konsumgesellschaft -all dies waren unterschiedliche Gesichter dieser Konterrevolution. Die Ereignisse des Mai 1968 ermöglichten einen dramatischen Bruch mit dieser dunklen Zeit der Konterrevolution und ebneten den Weg zu einer internationalen Welle von Arbeiterkämpfen (Heißer Herbst in Italien und Deutschland 1969, der Aufstand in Córdoba, Argentinien, die großen Streiks in Polen 1970, Anfang der 1970er Jahre in Großbritannien und anderswo).Weit entfernt davon, in die kapitalistische Gesellschaft integriert zu sein, zeigte die Arbeiterklasse Ende der 1960er und in den 1970er Jahren ihre Fähigkeit, auf die ersten Zeichen der neu hereingebrochenen Wirtschaftskrise des Systems zu reagieren. Die Krise ist seitdem nicht verschwunden, sondern sie hat sich während der letzten 40 Jahre nur noch mehr zugespitzt. Und ungeachtet vieler Rückschläge, Schwierigkeiten und unterschiedlichster Erfahrungen ist die Arbeiterklasse nicht besiegt worden. Die jüngsten Kämpfe in verschiedenen Ländern wie auch das Auftauchen einer neuen Generation von Jugendlichen, die sich grundlegende Fragen über die Zukunft stellen, welche der Kapitalismus der Menschheit anzubieten hat, belegen dies. Das ist das wahre Erbe von 1968: Das Wiedererstarken des Klassenkampfes als der einzige Hebel, um diese Gesellschaft zu überwinden. Diese Gesellschaft wird weiterhin von den Kräften geschützt, die dazu beitrugen, die Bewegung vor 40 Jahren zu sabotieren: Parlament und Wahlzirkus, Gewerkschaften und die Linksparteien. Das Erbe von 1968 ist vor allem die ganze Erfahrung der Selbstorganisierung mittels Aktionskomitees, leidenschaftlicher Debatten in Vollversammlungen, der Wiedergeburt der Idee von Arbeiterräten und die Wiederentdeckung einer begrabenen revolutionären politischen Tradition. Kurzum die Perspektive der proletarischen Revolution als die einzig realistische Alternative gegenüber einer im Zerfall begriffenen kapitalistischen Gesellschaft.
Es werden Zeitzeugen aus Frankreich berichten, die vor 40 Jahren an den Ereignissen des Mai 68 in Frankreich beteiligt waren, entsprechend inspiriert wurden und seitdem für die Überwindung des Kapitalismus kämpfen. Sie werden den Bogen spannen zum Kampf der Studenten in Frankreich gegen den CPE 2006 und zu den Perspektiven heute
Veranstaltungen über diese wichtigen Ereignisse in:
- Berlin, 8. Mai, um 18.30 Uhr, Rotes Antiquariat, Rungestr. 20, U-/S-Bahn Jannowitzer Brücke
- Hannover, 9. Mai, um 19.00 h, Kornstr. 28,
- Köln: 17. Mai um 14.00 Uhr, an der Neusser Str. 340, U-Bahnhaltestelle Florastr.
- Zürich: 16. Mai um 20.00 Uhr im Volkshaus (Helvetiaplatz), Grüner Saal
Diese Veranstaltung ist zusammen mit der Gruppe Eiszeit organisiert. Beide Organisationen werden ihre jeweiligen (kurzen) Einleitungen zur Diskussion vortragen.
Weitere Veranstaltungen der IKS in anderen Ländern siehe: www.internationalism.org [11]
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Historische Ereignisse:
- Mai 1968 [13]
Mai 68 : Die Studentenbewegung in Frankreich und auf der Welt (2. Teil)
- 6466 reads
Im ersten Teil dieses Artikels, der sich mit der Bewegung des Mai 1968 befasste, haben wir ihre erste Phase nachgezeichnet, die der Mobilisierung der Studenten. Wir haben aufgezeigt, dass die studentische Agitation in Frankreich vom 22. März 1968 bis Mitte Mai nur der Ausdruck einer internationalen Bewegung war, die fast alle westlichen Staaten erfasste. Ausgelöst wurde die Bewegung 1964 in den USA an der Universität Berkeley, Kalifornien. Am Schluss des ersten Teils des Artikels schrieben wir: „Ein Merkmal dieser ganzen Bewegung war natürlich vor allem die Ablehnung des Vietnamkrieges. Aber während man eigentlich hätte erwarten können, dass die stalinistischen Parteien, die mit dem Regime in Hanoi und Moskau verbunden waren, wie zuvor bei den Antikriegsbewegungen während des Koreakrieges zu Beginn der 1950er Jahre, die Führung dieser Bewegung übernehmen würden, geschah dieses nicht. Im Gegenteil; diese Parteien verfügten praktisch über keinen Einfluss, und sehr oft standen sie im völligen Gegensatz zu den Bewegungen. Dies war eines der Merkmale der Studentenbewegung Ende der 1960er Jahre; es zeigte die tiefgreifende Bedeutung auf, die ihnen zukommen sollte.“Diese Bedeutung werden wir jetzt aufzuzeigen versuchen. Dazu müssen wir natürlich unbedingt die damaligen Themen der studentischen Mobilisierung in Erinnerung zu rufen.
Die Themen der Studentenrevolte in den 1960er Jahren in den USA...
Wie schon erwähnt war der Widerstand gegen den Vietnamkrieg der USA der wichtigste und weitest verbreitete Mobilisierungsfaktor in allen Ländern der westlichen Welt. Es ist sicherlich kein Zufall, dass die Studentenrevolten im wichtigsten Land der Erde einsetzten. Die Jugend in den USA wurde direkt und unmittelbar mit der Frage des Krieges konfrontiert, da in ihren Reihen junge Männer rekrutiert wurden, die zur Verteidigung „der freien Welt“ in den Krieg geschickt wurden. Zehntausende amerikanische Jugendliche haben für die Politik ihrer Regierung ihr Leben gelassen; Hunderttausende sind verletzt und verstümmelt aus Vietnam zurückgekehrt, Millionen bleiben ihr Leben lang geprägt durch das, was sie in diesem Land erlebt haben. Abgesehen von dem Horror, den sie vor Ort durchgemacht haben, wurden viele mit der Frage konfrontiert: Was machen wir eigentlich in Vietnam? Den offiziellen Erklärungen zufolge waren sie dorthin geschickt worden, um die ‚Demokratie’, ‚die freie Welt’ und die ‚Zivilisation’ zu verteidigen. Aber was sie vor Ort erlebten, widersprach völlig den offiziellen Rechtfertigungen: Das Regime, das sie angeblich verteidigen sollten, die Regierung in Saigon, war weder ‚demokratisch’ noch ‚zivilisiert’. Sie war eine Militärdiktatur und extrem korrupt. Vor Ort fiel es den Soldaten sehr schwer nachzuvollziehen, dass sie die ‚Zivilisation’ verteidigten, wenn von ihnen verlangt wurde, dass sie sich selbst wie Barbaren verhalten sollten, die unbewaffnete arme Bauern, Frauen, Kinder und Alte terrorisieren und umbringen sollten. Aber nicht nur die Soldaten vor Ort waren von den Schrecken des Krieges angeekelt, sondern dies traf auch auf wachsende Teile der US-Jugend insgesamt zu. Junge Männer fürchteten nicht nur in den Krieg geschickt zu werden, und junge Frauen fürchteten nicht nur den Verlust ihrer Freunde, sondern man erfuhr auch immer mehr von den rückkehrenden ‚Veteranen’, oder ganz einfach durch das Fernsehen (1) von der Barbarei, die dort herrschte. Der schreiende Widerspruch zwischen den offiziellen Reden der US-Regierung von der ‚Verteidigung der Zivilisation und der Demokratie’, auf die sich die US-Regierung berief und ihr tatsächliches Handeln in Vietnam war einer der wichtigsten Faktoren, der zur Revolte gegen die Autoritäten und die traditionellen Werte der US-Bourgeoisie führte (2). Diese Revolte hatte in einer ersten Phase die Hippie-Bewegung mit empor gebracht, eine gewaltlose und pazifistische Bewegung, die sich auf ‚Flower power“ (Macht der Blumen) berief, und von der ein Slogan lautete: „Make Love, not War“ (Macht Liebe, nicht Krieg). Es war wahrscheinlich kein Zufall, dass die erste größere Studentenmobilisierung an der Universität Berkeley entstand, d.h. in einem Vorort von San Francisco, das damals das Mekka der Hippies war. Die Themen und vor allem die Mittel dieser Mobilisierungen ähnelten noch dieser Hippie-Bewegung: „Sit-in“; eine gewaltlose Methode, um die „Free Speech“ (Redefreiheit) für politische Propaganda an den Universitäten zu fordern, insbesondere auch um die ‚Bürgerrechte’ der Schwarzen zu unterstützen und die Rekrutierungskampagnen der Armee, die in den Universitäten stattfanden, anzuprangern. Jedoch stellte wie in anderen Ländern später auch, insbesondere 1968 in Frankreich, die Repression in Berkeley (ca. 800 Protestierende wurden verhaftet) einen wichtigen Faktor der ‚Radikalisierung’ der Bewegung dar. Von 1967 an, nach der Gründung der Youth International Party (Internationalen Partei der Jugend) durch Abbie Hoffman und Jerry Rubin, der eine kurze Zeit bei der Bewegung der Gewaltlosen mitgewirkt hatte, gab sich die Bewegung der Revolte eine ‚revolutionäre’ Perspektive gegen den Kapitalismus. Die neuen ‚Helden’ der Bewegung waren nicht mehr Bob Dylan oder Joan Baez, sondern Leute wie Che Guevara (den Rubin 1964 in La Havanna getroffen hatte). Die Ideologie dieser Bewegung war unglaublich konfus. Es gab anarchistische Bestandteile (wie den Freiheitskult, insbesondere die sexuelle Freiheit oder Freiheit des Drogenkonsums), aber auch stalinistische Bestandteile (Kuba und Albanien wurden als Beispiele gepriesen). Die Aktionen ähnelten sehr denen der Anarchisten – wie Lächerlichmachen und Provokationen. So bestand eine der ersten spektakulären Aktionen des Tandems Hoffman-Rubin darin, Bündel Falschgeld in der New Yorker Börse zu verteilen, woraufhin sich die dort Anwesenden wie wild auf sie stürzten, um welche zu ergattern. Und während des Kongresses der Demokratischen Partei im Sommer 1968 schlugen sie als Präsidentenkandidaten das Schwein Pegasus vor (3), während sie gleichzeitig bewaffnete Auseinandersetzungen mit der Polizei vorbereiteten. Zusammenfassend kann man zu den Hauptmerkmalen der Proteste, welche sich in den 1960er Jahren in den USA ausbreiteten, sagen, dass sie sich sowohl gegen den Vietnamkrieg als auch gegen die Rassendiskriminierung, gegen die ungleiche Behandlung der Geschlechter und gegen die traditionelle Moral und die Werte Amerikas wandten. Wie die meisten der Beteiligten feststellten (als sie sich wie revoltierende Bürgerkinder verhielten), waren diese Bewegungen keineswegs Regungen der Arbeiterklasse. Es ist sicherlich kein Zufall, dass einer ihrer ‚Theoretiker’, der Philosophieprofessor Herbert Marcuse, meinte, die Arbeiterklasse sei ‚integriert’ worden, und dass die revolutionären Kräfte gegen den Kapitalismus unter anderen Gesellschaftsschichten zu finden seien, so beispielsweise die Schwarzen, die Opfer der Rassendiskriminierung waren, die Bauern der Dritten Welt oder revoltierende Intellektuelle.
… und in den anderen Ländern
In den meisten anderen Ländern des Westens ähnelten die Studentenbewegungen der 1960er Jahre stark denen der USA: Verwerfung der US-Intervention in Vietnam, Revolte gegen die Autoritäten, insbesondere die akademischen Autoritäten, gegen die Autorität im Allgemeinen, gegen die traditionelle Moral, insbesondere gegen die Sexualmoral. Dies ist einer der Gründe, weshalb die stalinistischen Parteien, die ein Symbol des Autoritarismus waren, keinen Widerhall unter den Revoltierenden finden konnten, obgleich sie die US-Intervention in Vietnam heftig an den Pranger stellten. Dabei wurden die von den USA bekämpften militärischen Kräfte in Vietnam, welche als ‚anti-kapitalistisch’ auftraten, total vom sowjetischen Block unterstützt. Es stimmt, dass der Ruf der UdSSR sehr stark unter der Niederschlagung des Aufstands in Ungarn 1956 gelitten hatte und dass das Bild des alten Apparatschiks Breschnew keine großen Träume aufkommen ließ. Die Revoltierenden der 1960 Jahre hingen lieber Poster von Ho Chi Minh (ein alter Apparatschik, der aber eher vorzeigbar war und als ‚heldenhafter’ erschien) und am liebsten noch das romantische Photo von Che Guevara auf (ein anderes Mitglied einer stalinistischen Partei, aber halt ‚exotischer’) oder von Angela Davis auf (sie war auch Mitglied der stalinistischen Partei der USA, aber sie hatte den doppelten Vorteil eine Schwarze und Frau zu sein, und zudem noch genau wie Che Guevara ‚gut’ auszusehen). Diese Komponente, sowohl gegen den Vietnamkrieg gerichtet zu sein und als ‚libertär’ zu erscheinen, tauchte ebenfalls in Deutschland auf. Die berühmteste Figur der Bewegung, Rudi Dutschke, stammte aus der ehemaligen DDR, wo er sich als junger Mann schon gegen die Niederschlagung des Ungarn-Aufstandes gewehrt hatte. Seine ideologischen Bezugspunkte waren der ‚junge Marx’ sowie die Frankfurter Schule (der Marcuse angehörte), und auch die Situationistische Internationale (auf die sich die Gruppe „Subversive Aktion“, deren Berliner Sektion er 1962 gründete, berief). Vor den Ereignissen von Mai 68 in Frankreich war die APO in Deutschland der wichtigste Bezugspunkt der Studentenrevolten in Europa. Die Themen und Forderungen der Studentenbewegung, die sich 1968 in Frankreich entfaltete hat, waren im Wesentlichen die gleichen. Im Laufe der Entwicklung wurde der Widerstand gegen den Vietnamkrieg durch eine Reihe von Slogans in den Hintergrund gedrängt, die situationistisch oder anarchistisch inspiriert waren (oder gar surrealistisch), und die man immer häufiger auf den Mauern lesen konnte („Die Mauern haben das Wort“). Die anarchistische Ausrichtung wurde insbesondere in folgenden Slogans deutlich: „Die Leidenschaft der Zerstörung ist eine schöpferische Freude.“ (Bakunin)„ Es ist verboten zu verbieten.“„Freiheit ist das Verbrechen, das alle Verbrechen beinhaltet.“„Wahlen sind Fallen für Dumme.“„Frech und unverschämt zu sein, ist die neue revolutionäre Waffe.“Diese wurden durch jene Forderungen ergänzt, die zur „sexuellen Revolution“ aufriefen: „Liebt euch aufeinander liegend!“ „Knöpft euer Gehirn so oft auf wie euren Hosenschlitz!“ „Je mehr ich Liebe mache, desto mehr habe ich Lust die Revolution zu machen. Je mehr ich die Revolution mache, desto mehr habe ich Lust Liebe zu machen.“ Der Einfluss des Situationismus spiegelte sich in Folgendem wider:„Nieder mit der Konsumgesellschaft!“ „Nieder mit der Warengesellschaft des Spektakels!“„Schaffen wir die Entfremdung ab!“„Arbeitet nie!“„Seine Wünsche für die Wirklichkeit nehmen, denn ich glaube an die Wirklichkeit meiner Wünsche.“ „Wir wollen keine Welt, in der die Sicherheit nicht zu verhungern eingetauscht wird mit dem Risiko vor Langeweile zu sterben.“ „Langeweile ist konterrevolutionär.“ „Wir wollen leben ohne Stillstand und uns grenzenlos amüsieren.“„Seien wir realistisch, verlangen wir das Unrealistische!“Übrigens tauchte auch die Generationenfrage (die in den USA und in Deutschland sehr präsent war) in verschiedenen Slogans (oft auf sehr schändliche Weise) auf: „Lauf Genosse, die alte Welt liegt hinter dir!“„Die Jungen machen Liebe, die Alten machen obszöne Gesten.“ Im Frankreich des Mai 68, wo Barrikaden errichtet wurden, hörte man auch Slogans wie: „Die Barrikaden versperren die Straßen, aber öffnen den Weg.“„Der Abschluss allen Denkens ist der Pflasterstein in deiner Fresse, CRS [Bürgerkriegspolizei]." „Unter dem Pflasterstein liegt der Strand.“Die größte Verwirrung, die in dieser Zeit vorzufinden war, kommt durch die beiden folgenden Slogans zum Ausdruck:„Es gibt kein revolutionäres Denken. Es gibt nur revolutionäre Handlungen.“ „Ich habe etwas zu sagen, aber ich weiß nicht was.“
Die Bedeutung der Studentenbewegung der 1960er Jahre
Diese Slogans wie die meisten, die in den anderen Ländern zirkulierten, zeigen deutlich, dass die Studentenbewegung der 1960er Jahre keineswegs das Wesen der Arbeiterklasse widerspiegelte, auch wenn es in verschiedenen Ländern (wie in Italien oder Frankreich) den Willen gab, eine Brücke zu den Arbeiterkämpfen zu schlagen. Diese Herangehensweise spiegelte übrigens eine gewisse Überheblichkeit gegenüber der Arbeiterklasse wider, die mit einer gewissen Faszination für den Arbeiter als Blaumann durchmischt war, welcher der Held von schlecht verdauten Texten der Klassiker des Marxismus war. Im Kern war die Studentenbewegung der 1960er Jahre kleinbürgerlicher Natur. Einer der klarsten Aspekte neben seinem anarchisierenden Erscheinungsbild war der Wille „das Leben sofort umzuwälzen“. Der ‚revolutionäre’ Radikalismus der Führung dieser Bewegung, sowie die Gewaltverherrlichung, die von einigen Teilen der Bewegung betrieben wurde, spiegelt ebenfalls ihr kleinbürgerliches Wesen wider. Die ‚revolutionären’ Anliegen der Studenten von 1968 waren zweifelsohne aufrichtig, aber sie waren stark geprägt von einer Sicht der Welt aus einer Dritten-Welt-Perspektive (Guevarismus und Maoismus) sowie vom Antifaschismus. Die Bewegung hatte eine romantische Sichtweise der Revolution, ohne auch nur die geringste Vorstellung von der wirklichen Entwicklung der Bewegung der Arbeiterklasse zu haben, die zur Revolution führt. Die Studenten in Frankreich, die sich für „revolutionär“ hielten, glaubten, dass die Bewegung des Mai 68 schon die Revolution war, und die Barrikaden, die Tag für Tag errichtete wurden, wurden als die Erben der Barrikaden von 1848 und der Kommune von 1871 dargestellt. Eines der Merkmale der Studentenbewegung Ende der 1960er Jahre war der „Generationenkonflikt“, der sehr große Graben zwischen der neuen Generation und der ihrer Eltern, denen verschiedene Vorwürfe gemacht wurden. Insbesondere die Tatsache, dass diese hart hatte schuften müssen, um Armut und auch Hunger zu überwinden, die durch den 2. Weltkrieg entstanden waren. Man warf ihr vor, dass sie sich nur um ihr materielles Wohlergehen kümmerte. Deshalb feierten die Fantastereien über die „Konsumgesellschaft“ und Slogans wie „Arbeitet nie!“ solche Erfolge. Als Nachfolger einer Generation, die von der Konterrevolution voll getroffen worden war, warf die Jugend der 1960er Jahre der älteren Generation vor, sich den Ansprüchen des Kapitalismus unterworfen und angepasst zu haben. Im Gegenzug verstanden viele Eltern nicht und hatten Schwierigkeiten zu akzeptieren, dass ihre Kinder Verachtung zeigten für die Opfer, die sie hatten erbringen müssen, um ihren Kindern bessere wirtschaftliche Verhältnisse zu ermöglichen, als sie sie selbst erlebt hatten. Aber dennoch gab es einen wirklichen ökonomischen Bestimmungsgrund für die Studentenrevolte der 1960er Jahre. Damals gab es keine größere Bedrohung durch Arbeitslosigkeit oder durch prekäre Arbeitsbedingungen nach dem Studium, wenn man die Lage mit der heute vergleicht. Die Hauptsorge der studentischen Jugend war damals, dass sie nicht mehr den gleichen sozialen Aufstieg würde machen können wie die vorhergehende Akademikergeneration. Die Generation von 1968 war die erste Generation, die mit einer gewissen Brutalität mit dem Phänomen der „Proletarisierung der Führungskräfte“ konfrontiert wurde, welches von den Soziologen der damaligen Zeit eingehend untersucht wurde. Dieses Phänomen hatte sich seit einigen Jahren ausgebreitet, noch bevor die Krise offen in Erscheinung trat, sobald die Studentenzahl beträchtlich zugenommen hatte. Diese Zunahme entsprach den Bedürfnissen der Wirtschaft aber auch dem Willen und der Möglichkeit der Generation ihrer Eltern, ihren Kindern eine bessere wirtschaftliche und soziale Lage angedeihen zu lassen, als es ihre eigene war. Unter anderem hatte diese massenhafte Zunahme der Studenten die wachsende Malaise hervorgerufen, die auf den Fortbestand von Strukturen und Praktiken an den Universitäten zurückzuführen war, welche aus einer Zeit stammten, in der nur eine Elite die Uni besuchen konnte, und in der stark autoritäre Strukturen vorherrschten. Während die Studentenbewegung, welche 1964 einsetzte, sich in einer Zeit des „Wohlstandes“ des Kapitalismus entfaltete, sah die Lage 1967 schon anders aus, als die wirtschaftliche Situation sich schon sehr stark verschlechtert hatte – wodurch die studentische Malaise vergrößert wurde. Dies war einer der Gründe, weshalb die Bewegung 1968 ihren Höhepunkt erlebte. Und dies erklärt auch, warum im Mai 1968 die Arbeiterklasse auf den Plan trat und die Bewegung anführte. Darauf werden wir im nächsten Artikel eingehen. Fabienne, 29.3.2008. (1) Während des Vietnamkrieges waren die US-Medien den Militärbehörden nicht unterworfen. Diesen „Fehler“ beging die US-Regierung während der Auslösung des Irakkrieges 1991 und 2003 nicht mehr. (2) Solch ein Phänomen wiederholte sich nicht mehr nach dem 2. Weltkrieg. Die US-Soldaten hatten ebenfalls eine Hölle erlebt, insbesondere jene, die 1944 in der Normandie gelandet waren, aber fast alle Soldaten und die Bevölkerung insgesamt waren angesichts der Barbarei des Nazi-Regimes bereit, diese Opfer zu bringen(3) Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten die französischen Anarchisten einen Esel für die Parlamentswahlen nominiert.
Geographisch:
- Deutschland [14]
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Rubric:
Mai 2008
- 757 reads
Die Hungerrevolten zeigen die Notwendigkeit der Überwindung des Kapitalismus
- 3329 reads
In den letzten Wochen ist in etlichen Ländern der kapitalistischen Peripherie eine Reihe von Revolten, Proteste und Streiks gegen die steigenden Nahrungsmittel- und Energiekosten ausgebrochen. Auf ihrem jüngsten Treffen haben die Wachhunde der kapitalistischen Institutionen – IWF, Weltbank und G8 – vor einer gigantischen Destabilisierung und vor Konflikten in fast 40 Ländern rund um den Globus gewarnt. Es ist kein Zufall, dass die Hungerrevolten jetzt ausbrechen, da der starke Anstieg in den Nahrungsmittelpreisen keine natürliche In den letzten Wochen ist in etlichen Ländern der kapitalistischen Peripherie eine Reihe von Revolten, Proteste und Streiks gegen die steigenden Nahrungsmittel- und Energiekosten ausgebrochen. Auf ihrem jüngsten Treffen haben die Wachhunde der kapitalistischen Institutionen - IWF, Weltbank und G8 - vor einer gigantischen Destabilisierung und vor Konflikten in fast 40 Ländern rund um den Globus gewarnt. Es ist kein Zufall, dass die Hungerrevolten jetzt ausbrechen, da der starke Anstieg in den Nahrungsmittelpreisen keine natürliche Katastrophe ist, sondern das Resultat aus der Verschärfung der kapitalistischen Krise. Die Bedingungen verschlechtern sich für die ArbeiterInnen in allen Ländern Seitdem die weltweite Finanzkrise begonnen hatte, haben sich die Lebensbedingungen für die Arbeiterklasse überall auf der Welt drastisch verschlechtert. Während in den vorherigen Phasen der sich verschärfenden Krise die ArbeiterInnen in den peripheren Ländern weitaus härter und schneller betroffen waren als die ArbeiterInnen der Industrieländer, erleben wir nun, dass die ArbeiterInnen der Industriezentren und der Peripherie gleichzeitig - auch wenn in unterschiedlichem Umfang - unter den Folgen der Krise leiden. Ob in den USA, wo jeden Monat um die 200.000 Menschen infolge der Hypothekenkrise ihr Heim verlieren, wo Tausende ihren Job verlieren und sich steigenden Nahrungsmittel- und Energiepreisen ausgesetzt sehen, ob in Europa, wo die Preise vieler Grundnahrungsmittel um 30 bis 50 Prozent gestiegen sind, ob in den „aufstrebenden Ländern" wie Indien und China, wo die Lebensmittelpreise ebenfalls stark angestiegen sind, oder in den peripheren Ländern, niemals zuvor seit 1929 wurden so viele Menschen in solch einer kurzen Zeitspanne von den Auswirkungen der Krise bedroht. Doch selbst 1929 verbreitete sich die Hungersnot nicht so schnell unter den armen Massen in der kapitalistischen Peripherie. Und wir stehen erst am Anfang dieses Abstiegs. Die steigenden Ölpreise haben die Produktions- und Transportkosten aufgebläht, was sich in den Nahrungsmittelpreisen für die Konsumenten niederschlägt. Der Preis für Reis, Weizen und andere Feldfrüchte ist in den meisten Ländern um 50 bis 100 Prozent gestiegen, in manchen Fällen hat er sich verdoppelt und verdreifacht, mit einer dramatischen Beschleunigung insbesondere in den letzten paar Wochen. Die Konsequenzen für Arbeiter, Bauern und die Massen der Arbeitslosen in den peripheren Ländern sind besonders brutal.
Die Inflation der Nahrungsmittelpreise und die Unruhen
Zwischen dem Frühjahr 2007 und Februar 2008 hat sich der Preis für Weizen und Soja verdoppelt. In den letzten zehn Monaten ging der Preis für Körnerfrüchte (Mais) um 66, für Reis um 75 Prozent in die Höhe. Der von der FAO etablierte Nahrungsmittelindex stieg zwischen März 2007 und März 2008 um 57 Prozent. Dennoch hält die FAO daran fest, dass die Preisexplosion nicht die Folge schrumpfender Ernteerträge ist, sei doch die weltweite Getreideproduktion 2007 um fünf Prozent gestiegen. Und doch sterben täglich 100.000 Menschen an Hunger oder an Krankheiten, die unmittelbare Konsequenzen des Hungers sind. Alle fünf Sekunden stirbt ein Kind unter zehn Jahren an Hunger. 900 Millionen Menschen sind ständig unterernährt. Als Reaktion darauf sind Unruhen ausgebrochen in Ägypten, Burkina Faso, Südafrika, Kamerun, Marokko, Mosambique, im Senegal, in Elfenbeinküste, Mauretanien, im Jemen, in Indonesien, Indien, Bangladesh, Thailand, auf den Philippinen, in Mexiko und Peru, in Argentinien, Honduras, Haiti...
Eine „herzzerreißende Auswahl" der herrschenden Klasse
"Die UN werden eine ‚herzzerreißende' Auswahl bei der Adressierung ihrer Nothilfe treffen müssen, es sei denn, dass die Regierungen mehr Geld ausgeben und helfen, immer teurer werdende Nahrungsmittel zu kaufen, warnte ein Sprecher des Welternährungsprogramms (WEP), um 73 Millionen Menschen in 80 Ländern in diesem Jahr zu ernähren.... Wenn wir in diesem Sommer nicht mehr erhalten, werden wir eine ganz herzzerreißende Auswahl vornehmen müssen - entweder reduzieren wir die Begünstigten oder wir reduzieren die Rationen... Das WEP hat an die Regierungen appelliert, weitere 500 Millionen Dollar zu spenden, um mit den höheren Nahrungsmittelpreisen zu Rande zu kommen. Die USA haben 200 Millionen für die Nothilfe freigemacht, Deutschland zehn Millionen." (The Guardian, 16.4.08)
Während der IWF voraussagt, dass die Kosten der jüngsten Finanzkrise bis zu 1.000.000.000.000 (1 Billion) betragen werden und verschiedene Länder bereits Hunderte von Milliarden Dollar für Rettungsoperationen für notleidende Banken ausgegeben haben, geht den Lebensmittelhilfe-Organisationen das Geld aus, da die großen Länder nur Krümel geben... Sicherlich ziehen es die kapitalistischen Institutionen vor, Banken zu retten, statt mehr als eine Milliarde Menschen zu ernähren, doch die jüngste Ernährungskrise wird wenigstens weitere 500 Millionen Hungernde innerhalb einiger Monate hinzufügen...
Während in den Industrieländern sich viele ArbeiterInnen 30-50prozentigen Preiserhöhungen bei Nahrungsmitteln und Energie ausgesetzt sehen und insbesondere die Arbeitslosen und prekär Beschäftigten mit Schwierigkeiten haben, mit ihren Einkünften auszukommen, bedeutet die Verdoppelung der Preise für Grundnahrungsmittel in den peripheren Ländern der Welt die Gefahr des Verhungerns. Da mehr als eine Milliarde Menschen von weniger als einem Dollar am Tag leben und da viele von ihnen bis zu 90 Prozent ihres Einkommens für Nahrungsmittel ausgeben müssen, bedroht ein solch krasser Anstieg der Lebensmittelpreise sie unmittelbar.
Diese katastrophale, lebensbedrohliche Situation führte zu einer Reihe von Hungerrevolten und Streiks für höhere Löhne etc. Aus Furcht vor einer Explosion der Proteste haben die Regierungen Vietnams und Indiens - beide Länder sind Reisexporteure - die Ausfuhr von Reis ausgesetzt. Kasachstan - achtgrößter Getreideexporteur - hat angedroht, ebenfalls den Getreideexport auszusetzen. Auf den Philippinen drohte die Regierung lebenslängliche Strafen für diejenigen an, die Reis horten! Infolgedessen werden Nahrungsmittel immer knapper, da wichtige Getreidearten entweder zunehmend gehortet werden oder weil ihr Export zusammenbricht. Selbst in den USA schränken die Großhändler den Einkauf von Mehl, Reis und Speiseöl ein, da die Nachfrage das Angebot weit übertrifft. Es gibt auch Anekdoten über einige Verbraucher, die Getreidelager horten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis noch größere Preiserhöhungen die USA, Europa und Ostasien erreichen.
Die Angst vor dem Hunger ist ein Albtraum, der den Aufstieg der Menschheit von Anbeginn begleitet - und angespornt - hat. Die Hauptursache dieser Gefahr war stets die verhältnismäßige Primitivität der Produktivkräfte der Gesellschaft gewesen. Die Hungersnöte, die periodisch die vor-kapitalistischen Gesellschaften heimgesucht hatten, waren die Folge eines unzureichenden Verständnisses und einer mangelhaften Beherrschung der Naturgesetze. Seitdem die Gesellschaft sich in Klassen aufgeteilt hat, waren die Ausgebeuteten und Armen stets die Hauptopfer dieser Rückständigkeit und Fragilität der menschlichen Existenz gewesen. Nun jedoch, wo zusätzliche 100 Millionen menschliche Wesen praktisch über Nacht vom Hunger bedroht werden, wird es immer deutlicher, dass heute die Hauptursache des Hungers nicht in der Rückständigkeit der Wissenschaft und Technologie, sondern in der Rückständigkeit unserer gesellschaftlichen Organisation liegt. Selbst die Repräsentanten der offiziellen Institutionen der herschenden Ordnung sehen sich gezwungen zuzugeben, dass die gegenwärtige Krise „menschengemacht" ist. Während seiner aufsteigenden Epoche fühlte sich der Kapitalismus trotz allen Elends, das er verursachte, in der Lage, langfristig die Menschheit von der Geißel des Hungers zu befreien. Dieser Glaube gründete sich auf die Fähigkeit des Kapitalismus - tatsächlich auf seine dringenden Bedürfnisse als ein Konkurrenzsystem -, permanent die Produktivkräfte zu revolutionieren. In den Jahren, die dem II. Weltkrieg folgten, wies man auf die Erfolge der modernen Landwirtschaft, die Entwicklung des Wohlfahrtsstaates, die Industrialisierung neuer Regionen des Planeten, die Steigerung der Lebenserwartung als Beweis hin, dass man die „Schlacht gegen den Hunger", die von der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft ausgerufen worden war, letztendlich gewinnen werde. Erst kürzlich behauptete das kapitalistische Regime, dass es durch die wirtschaftliche Entwicklung von Ländern wie China oder Indien etliche Hunderte von Millionen vor den Klauen des Hungers bewahrt habe. Und selbst jetzt möchte es uns glauben machen, dass in die Höhe schnellende Preise weltweit das Produkt des wirtschaftlichen Fortschritts seien, des neuen Wohlstandes, der in den aufstrebenden Ländern geschaffen werde, des neuen heftigen Verlangens der Massen nach Hamburger und Joghurt. Doch selbst wenn dies stimmen würde, müssten wir uns über den Sinn eines Wirtschaftssystems Gedanken machen, das nur in der Lage ist, die einen Menschen zum Preis des Lebens anderer Menschen, den Verlierern im Konkurrenzkampf ums Überleben, zu ernähren.
In Wirklichkeit ist der explodierende Hunger in der Welt von heute nicht einmal das Ergebnis solch eines verabscheuungswürdigen „Fortschritts". Was wir erblicken, ist die Verbreitung des Hungers in den rückständigsten Regionen der Welt und in den „aufstrebenden" Ländern. Überall auf der Welt ist der Mythos, dass der Kapitalismus das Gespenst des Hungers bannen kann, als erbärmliche Lüge entlarvt worden. Wahr ist, dass der Kapitalismus die materiellen und gesellschaftlichen Vorbedingungen für solch einen Sieg geschaffen hat. Nachdem er dies getan hat, ist der Kapitalismus selbst zum größten Hindernis für einen solchen Fortschritt geworden. Die Massenproteste gegen den Hunger in Asien, Afrika und Lateinamerika in den vergangenen Wochen enthüllen der Welt, dass die Ursachen des Hungers nicht natürlich, sondern gesellschaftlich sind.
Die Ursachen der gegenwärtigen Krise
Die Politiker und Experten der herrschenden Klasse haben eine Reihe von Erklärungen für die gegenwärtige dramatische Situation. Diese beinhalten den Wirtschafts"boom" in Teilen Asiens, die Verbreitung des „Biosprits", die ökologischen Katastrophen und der Klimawechsel, die Ruinierung der landwirtschaftlichen Subsistenzwirtschaft in den „unterentwickelten" Ländern, einen spekulativen Run auf Nahrungsmittel, die Einschränkungen der Agrarproduktion, die durchgesetzt werden, um die Nahrungsmittelpreise hochzutreiben, etc. All diese Erklärungen enthalten ein Körnchen Wahrheit. Keine von ihnen erklärt jedoch für sich genommen irgendetwas. Sie sind die besten Symptome - mörderische Symptome -, die zusammengenommen die Hauptursachen des Problems anzeigen. Die Bourgeoisie wird stets Lügen über ihre Krise verbreiten, ja sich selbst belügen. Doch was derzeit auffällt, ist das Ausmaß der Unfähigkeit der Regierungen und Experten, zu verstehen, was vor sich geht, oder gar ihren Reaktionen den Anschein von Kohärenz zu verleihen. Die Hilflosigkeit der angeblich allmächtigen herrschenden Klasse wird immer augenscheinlicher. Was bei den verschiedenen Erklärungen auffällt, ist - abgesehen von ihren zynischen und heuchlerischen Charakter - die Tatsache, dass jede Fraktion der herrschenden Klasse danach trachtet, die Aufmerksamkeit auf jenen Aspekt zu lenken, der ihre eigenen unmittelbaren Interessen am meisten betrifft. Ein Beispiel: Ein Gipfeltreffen von G8-Politikern ruft die „Dritte Welt" dazu auf, durch eine unmittelbare Senkung ihrer Zölle gegen Agrarimporte auf die Hungerrevolten zu reagieren. Mit anderen Worten: der erste Gedanke dieser feinen Repräsentanten der kapitalistischen Demokratie war, von der Krise zu profitieren, um ihre eigenen Exportchancen zu erhöhen! Ein weiteres Beispiel: die jüngste „Debatte" in Europa. Die Industrielobby zetert über den landwirtschaftlichen Protektionismus der Europäischen Union, den Ruin der Subsistenzwirtschaft in der „Dritten Welt" etc. Und warum? Weil sie sich von der industriellen Konkurrenz Asiens bedroht fühlt, will sie die landwirtschaftlichen Subventionen zusammenstreichen, die von der Europäischen Union bezahlt werden und die man sich nicht länger leisten könne, wie diese Lobby meint. Die Bauernlobby ihrerseits sieht in den Hungerrevolten einen Beweis für die Notwendigkeit, die Subventionen zu erhöhen. Die Europäische Union hat die Gelegenheit genutzt und die Ausweitung der landwirtschaftlichen Produktion zu Diensten der „erneuerbaren" Energie - wie in Brasilien, einem ihrer Hauptrivalen auf diesem Gebiet - verurteilt.
Die „Teilerklärungen" der Bourgeoisie sind, abgesehen davon, dass sie der zynische Ausdruck ihrer rivalisierenden Partikularinteressen sind, nur dazu da, um die Verantwortung des kapitalistischen Systems für die gegenwärtige Katastrophe zu verbergen. Insbesondere kann keines dieser Argumente und nicht einmal alle Argumente zusammengenommen die beiden Hauptkennzeichen der aktuellen Krise erklären: ihr Ausmaß und ihre plötzliche, brutale Beschleunigung zurzeit.
Das Ausmaß der kapitalistischen Krise
Während in der Vergangenheit Hunderte von Millionen Chinesen nur wenig zu essen hatten (die berühmte "eiserne Reisschüssel"), gebe es nun einen stärkeren Verzehr von Fleisch, Milchprodukten und Weizen. Eine wachsende Nachfrage nach mehr Fleisch und Milch bedeute, Futtergetreide für Vieh und Geflügel übernimmt die Landwirtschaft, was wiederum bedeutet, dass immer weniger Münder von demselben Nutzland ernährt werden können. Dies ist die Haupterklärung, die von vielen Fraktionen der Bourgeoisie vorgebracht wird. Die Proletarisierung eines Teils der Bauernmassen, die radikal deren Lebensstil gewandelt und sie in den Weltmarkt integriert hat, wird von der herrschenden Klasse als eine große Verbesserung ihrer Bedingungen betrachtet. Doch was zu erklären bleibt, ist, wie diese Verbesserung, diese Befreiung von Millionen aus den Klauen des Hungers sich in ihr... Gegenteil verkehren konnte. Der Präsident der Weltbank, Robert Zoellick, erklärte jüngst, dass die steigenden Preise den ganzen Fortschritt, der im "Kampf gegen die Armut" zuletzt erzielt worden war, zunichte machten.
Biokraftstoffe: Die Ersetzung des Benzins durch Weizen, Körnerfrüchte, Palmöl etc. hat in der Tat zu dramatischen Kürzungen der Nahrungsmittelerzeugnisse geführt. Nicht nur dass die "Verschmutzungs"bilanz von Biokraftstoffen negativ ist (jüngste Untersuchungen zeigen, dass Biokraftstoffe die Luftverschmutzung steigern, da sie noch gefährlichere Partikel als normales Benzin ausstoßen, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass einige Biokraftstoffe fast soviel Öl als Energie benötigen, wie sie selbst an Energie produzieren), auch ihre ökologischen und ökonomischen Konsequenzen sind für die gesamte Menschheit katastrophal. Solch ein Wechsel zur Kultivierung von Weizen, Körnerfrüchten/Mais, Palmöl etc. für die Herstellung von Energie statt für die Ernährung ist ein typischer Ausdruck für die kapitalistische Blindheit und Destruktivität. Er wird zu einem Teil von dem zwecklosen Versuch angetrieben, den steigenden Erdölpreisen Herr zu werden, und zu einem anderen Teil - besonders in den Vereinigten Staaten - von der Hoffnung, ihre Abhängigkeit von importiertem Öl zu reduzieren, um ihre Sicherheitsinteressen als imperialistische Macht zu schützen. Weit davon entfernt, die Krise zu erklären, ist der Biosprit-Skandal ein Symptom - und ein aktiver Faktor - ihrer Ausmaße.
Exportsubventionen und Protektionismus: Einerseits gibt es landwirtschaftliche Überproduktion in einigen Ländern und eine permanente "Exportoffensive"; gleichzeitig können sich andere Länder nicht mehr selbst ernähren. Konkurrenz und Protektionismus in der Landwirtschaft bedeuten, dass - ganz so wie bei anderen Waren in der Wirtschaft - die produktiveren Bauern in den Industrieländern große Teile ihrer Feldfrüchte (oft mit staatlicher Suvention) in die "Drittwelt"-Länder exportieren und so die einheimische Bauernschaft ruinieren - was den Exodus vom Land in die Stadt steigert, die weltweiten Flüchtlingsströme anschwellen lässt und zur Abwanderung von einst landwirtschaftlich genutztem Land führt. In Afrika sind beispielsweise die einheimischen Bauern von europäischen Geflügel- und Rindfleischexporten ruiniert worden. Mexiko stellt nicht mehr genügend Nahrungsmittel her, um seine Bevölkerung zu ernähren. Das Land muss jährlich mehr als 10 Milliarden Dollar für den Import von Nahrungsmittel ausgeben. "Linke" Propagandisten der herrschenden Klasse, aber auch viele wohlmeinende, jedoch in die Irre geleitete oder schlecht informierte Menschen rufen zu einer Rückkehr zur Subsistenzwirtschaft in den "peripheren" Ländern und zur Abschaffung der landwirtschaftlichen Subventionen sowie des Schutzes ihrer eigenen Märkte durch die alten kapitalistischen Ländern auf. Was diese Argumente nicht in Betracht zu ziehen vermögen, ist, dass der Kapitalismus von Anbeginn von der Eingliederung der Subsistenzwirtschaft in den Weltmarkt gelebt hat und auf diese Weise expandierte, was den Ruin und die oft gewaltsame Trennung der einheimischen Bauern von ihrem Land, von ihren Produktionsmitteln bedeutete. Die Wiedererlangung des Landes durch die Produzenten ist nur im Rahmen der Überwindung des Kapitalismus selbst denkbar. Dies heißt nichts anderes als die Überwindung des Privateigentums an Produktionsmitteln und der Produktion für den Markt sowie des Antagonismus zwischen Stadt und Land, die fortschreitende Auflösung der Mega-Citys durch eine weltweite und planvolle Rückkehr Hunderter von Millionen von Menschen aufs Land: nicht zum althergebrachten Land der bäuerlichen Isolation und Rückständigkeit, sondern zu einem Land, das durch seine Vernetzung mit den Citys und mit einer weltweiten menschlichen Kultur neu belebt wird.
Indem die bürgerlichen Medien diese o.g. Faktoren auflisten, versuchen sie die Demaskierung der tieferen Hauptursachen zu verhindern. In Wirklichkeit erleben wir nicht zuletzt die kombinierten, akkumulierten Konsequenzen der langfristigen Auswirkungen der Umweltvergiftung und der zutiefst zerstörerischen Tendenzen des Kapitalismus in der Landwirtschaft.
Die Destruktivität des Kapitalismus in Landwirtschaft und Umwelt
Etliche zerstörerische Tendenzen sind offen zutage getreten. Entsprechend des Konkurrenzdrucks ist die traditionelle Bauernwirtschaft verschwunden; die Bauern sind zu Abhängigen von Kunstdünger, Pestiziden und künstlicher Bewässerung geworden. Das International Rice Research-Institut warnt, dass der Erhalt des Reisanbaus durch den übermäßigen Gebrauch von Dünger und die Beeinträchtigung der Bodenqualität gefährdet sei.
"Zum Verkauf bestimmte Feldfrüchte in Monokultur wurden zur Regel; der Ertrag wurde verdoppelt, doch auf Kosten eines dreimal höheren Wasserverbrauchs durch den Zugriff auf das Grundwasser mit elektrischen Pumpen. Dies und die Überdüngung hat weitverbreiteten Schaden an Boden und Wasser angerichtet" (1) Zurzeit sind etwa 40 Prozent der landwirtschaftlichen Produkte das Ergebnis von künstlicher Bewässerung; 75 Prozent des weltweit verfügbaren Trinkwassers wird zu diesem Zweck von der Landwirtschaft Zweck verbraucht. Das Anpflanzen von Luzernen in Kalifornien, von Zitrusfrüchten in Israel, von Baumwolle rund um den Aralsee in der früheren Sowjetunion, von Weizen in Saudiarabien oder im Jemen, d.h. das Anpflanzen von Feldfrüchten in Gebieten, die nicht die natürlichen Bedingungen für ihr Wachstum bieten, bedeutet eine enorme Verschwendung von Wasser in der Landwirtschaft. Der massive Einsatz von "gekreuztem Saatgut" (hybrid seeds) stellt eine direkte Gefahr für die natürliche Vielfalt dar. (2)
In vielen Gebieten der Welt wird der Boden immer mehr vergiftet. In China sind 10 Prozent des Anbaugebiets kontaminiert; jährlich sterben 120.000 Bauern durch die Bodenverschmutzung an Krebs. Ein Resultat dieser Bodenauszehrung durch das rastlose Streben nach Produktivität ist die Tatsache, dass die Nahrungsmittel in den Niederlanden, das "landwirtschaftliche Kraftwerk" Europas, äußerst nährstoffarm sind.
Und mit jedem Grad Celsius, mit dem die globale Erwärmung zunimmt, gehen die Reis-, Weizen- und andere Getreideerträge um 10 Prozent zurück. Die jüngsten Hitzewellen in Australien haben zu beträchtlichen Schäden an den Feldfrüchten und zur Austrocknung des Bodens geführt. Jüngste Erkenntnisse haben aufgezeigt, dass der Anstieg der Temperaturen die Überlebensfähigkeit vieler Pflanzen bedroht oder ihren Nährwert reduziert. Trotz neuer Anbaugebiete, die für die Bewirtschaftung gewonnen wurden, schrumpft die nutzbare landwirtschaftliche Fläche weltweit infolge der Auslaugung, der Erosion, der Vergiftung und der Auszehrung des Bodens.
So taucht eine Gefahr auf, die die Menschheit lange als Albtraum der Vergangenheit abgetan hat. Die kombinierten Auswirkungen der klimatisch bedingten Austrocknung und der Fluten sowie ihre Konsequenzen für die Landwirtschaft, die kontinuierliche Zerstörung und Reduzierung von fruchtbarem Boden, die Vergiftung und Überfischung der Meere führt zu einem Mangel an Nahrungsmitteln. Seit 1984 kann die weltweite Getreideproduktion nicht mehr mit dem Wachstum der Erdbevölkerung Schritt halten. Innerhalb von zwanzig Jahren ist sie von 343 Kilo pro Person auf 303 Kilo gefallen (Carnegie Department of Global Ecology in Stanford). Die Verrücktheit des Sytems bedeutet, dass der Kapitalismus gezwungen ist, ein Über-Produzent fast aller Güter zu sein, während er andererseits einen Mangel an Lebensmitteln schafft, indem er die eigentliche, natürliche Grundlage für sein Wachstum zerstört. Die wirklichen Ursachen für diese Absurdität liegen in der kapitalistischen Produktion begründet: "Auf der anderen Seite reduziert das große Grundeigentum die agrikole Bevölkerung auf ein beständig sinkendes Minimum und setzt ihr eine beständig wachsende, in großen Städten zusammengedrängte Industriebevölkerung entgegen; es erzeugt dadurch Bedingungen, die einen unheilbaren Riß hervorrufen in dem Zusammenhang des gesellschaftlichen und durch die Naturgesetze des Lebens vorgeschriebnen Stoffwechsels, infolge wovon die Bodenkraft verschleudert und diese Verschleuderung durch den Handel weit über die Grenzen des eignen Landes hinausgetragen wird. (Liebig.) (...) Große Industrie und industriell betriebene große Agrikultur wirken zusammen. Wenn sie sich ursprünglich dadurch scheiden, daß die erste mehr die Arbeitskraft und daher die Naturkraft des Menschen, die letztere mehr direkt die Naturkraft des Bodens verwüstet und ruiniert, so reichen sich später im Fortgang beide die Hand, indem das industrielle System auf dem Land auch die Arbeiter entkräftet und Industrie und Handel ihrerseits der Agrikultur die Mittel zur Erschöpfung des Bodens verschaffen" (Karl Marx - Friedrich Engels - Werke, Band 25, "Das Kapital", Bd. III, Sechster Abschnitt, S. 815, 47. Kapitel, Metäriewirtschaft und das bäuerliche Parzelleneigentu, Dietz Verlag, Berlin/DDR 1983)
Eine brutale Beschleunigung des Krisentempos
Seit dem Zusammenbruch der Immobilienspekulation in den USA und anderen Ländern (Großbritannien, Spanien, etc.) suchen viele Hedgefonds und andere Investoren nach alternativen Möglichkeiten, um ihr Geld anzulegen. Derzeit stehen die landwirtschaftlichen Feldfrüchte im Visier der Spekulation. Die zynische Rechnung der Spekulation in Zeiten einer ernsten Krise: Landwirtschaftliche Feldfrüchte sind eine "todsichere Wette", da sie zu den letzten Dingen gehören, auf die die Menschen "verzichten" können! Milliarden von spekulativen Dollars sind bereits in Agrarkonzernen angelegt worden. Diese kolossalen spekulativen Summen haben mit Sicherheit die drastischen Preiserhöhungen mit beschleunigt, doch sie sind nicht die tatsächliche Hauptursache. Wir können davon ausgehen, dass sich der Preisanstieg landwirtschaftlicher Produkte fortsetzen würde, selbst wenn die Spekulation beendet werden würde.
Dennoch verschafft uns dieser Einblick in die Rolle der Spekulation (die isoliert betrachtet ein red herring ist) eine Ahnung über die Verknüpfungen in der zeitgenössischen Weltwirtschaft. In Wirklichkeit gibt es eine Verbindung zwischen der "Eigentumskrise" und dem Erdbeben im weltweiten Finanzkapital einerseits und der Preisexplosion bei den Nahrungsmitteln andererseits. Die Weltrezession von 1929, die brutalste in der Geschichte des Kapitalismus bis dahin, wurde von einem dramatischen Verfall der Preise begleitet. Die Verarmung der Arbeitermassen zu jener Zeit war mit der Tatsache verknüpft, dass die Löhne im Zusammenhang mit der Massenarbeitslosigkeit noch dramatischer fielen als andere Preise. Heute dagegen werden die Tendenzen einer weltweiten Rezession, die manifest werden, von einer allgemeinen Woge der Inflation begleitet. Die in die Höhe schnellenden Preise der Nahrungsmittel sind die Speerspitze dieser Entwicklung, auf jederlei Art verknüpft mit den steigenden Kosten für Energie, Transport und so weiter. Das jüngste Hineinpumpen von Milliarden von Dollar in die Wirtschaft durch die Regierungen, um die vor der Pleite stehenden Banken und das Finanzsystem zu stützen, hat wahrscheinlich mehr als jeder andere Faktor zur derzeitigen weltweiten Inflationsspirale beigetragen. Dies auch, weil er den Schuldenberg enthüllt, auf dem das "Krisenmanagement" der letzten Jahrzehnte zu einem großen Teil basierte, und somit das "Vertrauen" unter den Geschäftsleuten untergräbt.
Die Arbeitermassen der Welt sind in einem eisernen Schraubstock eingezwängt. Während einerseits die weltweite Arbeitslosigkeit einen unbarmherzigen Druck auf die Löhne ausübt, fressen andererseits die in die Höhe schnellenden Preise den Wert des Wenigen weg, was die ProletarierInnen noch verdienen.
Die derzeitige Verschärfung der weltweiten und historischen Krise des Weltkapitalismus zeigt sich als eine vielköpfige Hydra. Zusammen mit der monströsen Eigentums- und Finanzkrise, die weiterhin im Zentrum des Kapitalismus schwelt, ist bereits ein zweites Monster in Gestalt von in die Höhe schnellender Preise und des Hungers erschienen. Und wer kann uns sagen, was noch alles folgen wird? Im Augenblick scheint die herrschende Klasse noch überwältigt und irgendwie hilflos zu sein. Ihre hektischen Reaktionen enthüllen den Versuch, die staatliche Kontrolle über die Wirtschaft zu verstärken und ihre Politik international zu koordinieren, aber sie illustrieren auch die Verschärfung der Konkurrenz zwischen den kapitalistischen Nationen. Die besänftigenden Worte der Politikmacher bezwecken, der Welt, ja sich selbst das Gefühl auszureden, immer mehr die Kontrolle darüber zu verlieren, was mit ihrem System geschieht. Eine Entwicklung, die die herrschende Klasse mit einer zweifachen Gefahr konfrontiert: der Gefahr der Destabilisierung ganzer Länder oder ganzer Kontinente und ihres Versinkens in eine Spirale des Chaos sowie der langfristigen Gefahr einer revolutionären Erhebung, die den Kapitalismus selbst in Frage stellt.
Die Verantwortung des Proletariats
Wegen der zerstörerischen Auswirkungen der kapitalistischen Produktionsweise auf die Landwirtschaft und auf die Umwelt ist die Menschheit tatsächlich mit einem Rennen gegen die Zeit konfrontiert. Je mehr der zerstörerische Kapitalismus die Welt verwüstet, desto mehr ist die Grundlage für das Überleben der Menschheit bedroht. Jedoch zwingen die drastische Verschlechterung der Wirtschaftskrise und die spekulativen Effekte auf die Nahrungsmittelpreise die Arbeitermassen, Arbeitslosen und Bauern, umgehend zu reagieren. Ihr Kampf ist einerseits ein defensiver Kampf ums Überleben, andererseits jedoch wirft er die Notwendigkeit auf, die Ursachen ihrer lebensbedrohlichen Lage auszumerzen.
Fußnoten:
(1) Dies ist einem interessanten Artikel bei Libcom von Ret Marut entnommen. ("A world food crisis: empty rice bowls and fat rats [15]").
(2) "Dies ist ein modifiziertes Saatgut - so kontruiert, dass es sich selbst nicht reproduzieren und nur mit Hilfe von Kunstdünger wachsen kann. So werden die Farmer in die Abhängigkeit von multinationalen Konzernen gesperrt, die ihnen dieses Saatgut verkaufen. In der einheimischen Landwirtschaft schließt das Bebauungssystem ein symbiotisches Verhältnis zwischen Boden, Wasser, Nutzvieh und Pflanzen mit ein. Die hybride Landwirtschaft ersetzt diese Integration auf bäuerlicher Ebene durch die Integration von Inputs wie Saatgut und Chemikalien. Das einheimische Anbausystem beruht nur auf innere organische Inputs. Das Saatgut kommt von der Farm, die Düngung des Bodens kommt von der Farm, und die Schädlingsbekämpfung ist in den Kreuzungen der Feldfrüchte eingebaut. Im hybriden Komplex sind die Erträge an den erworbenen Inputs von Saatgut, Kunstdünger, Pestiziden, Erdöl und intensiver Bewässerung gebunden (...) Wenn die Bauern vom Mischsaatgut abhängig werden, wird diese natürliche Vielfalt und die lokale Anpassungsfähigkeit verloren gehen. Solch eine Kommerzialisierung tradioneller bäuerlicher Techniken erzeugt häufig einen fürchterlichen Druck auf die Bauern - in Indien haben im vergangenen Jahr 10.000 Bauern Selbstmord begangen, hauptsächlich wegen Zahlungsschwierigkeiten (...) Den Einsatz von Kunstdünger anstelle organischer Methoden, um den Boden wieder fruchtbar zu machen, wie die Kompostierung, Fruchtfolgen und der natürliche Dünger erzeugt leblose, ausgedörrte Böden, die anfällig gegenüber der Bodenerosion sind. Geschätzte 24 Milliarden Tonnen Erdboden des weltweiten Ackerlandes erodieren jährlich. Der Anteil von Staubpartikel in der unteren Atmosphäre hat sich in den vergangenen 60 Jahren verdreifacht." (Ret Marut, oben zitiert)
Theoretische Fragen:
- Umwelt [16]
Erbe der kommunistischen Linke:
Mai 68: Das Erwachen der Arbeiterklasse - 3. Teil
- 3079 reads
Gegenüber all den Lügen, die heute zum Mai 68 verbreitet werden, müssen die Revolutionäre die Wahrheit wiederherstellen. Sie müssen auch die Mittel anbieten, um die Bedeutung und die Lehren dieser Ereignisse zu begreifen. Sie müssen insbesondere verhindern, dass ihre Lehren unter einem Haufen Blumen und Kränzen begraben werden. Gegenüber all den Lügen, die heute zum Mai 68 verbreitet werden, müssen die Revolutionäre die Wahrheit wiederherstellen. Sie müssen auch die Mittel anbieten, um die Bedeutung und die Lehren dieser Ereignisse zu begreifen. Sie müssen insbesondere verhindern, dass ihre Lehren unter einem Haufen Blumen und Kränzen begraben werden. Wir haben schon damit angefangen, indem wir bislang zwei Artikel zum Mai 68 veröffentlicht haben, die auf die ersten Bestandteile der Ereignisse des Mai 68 zurückkommen – die Studentenproteste. In diesem Artikel wollen wir auf den wesentlichsten Bestandteil der Ereignisse eingehen – die Bewegung der Arbeiterklasse. In dem ersten Artikel dieser Reihe schrieben wir am Schluss zu den Ereignissen in Frankreich: „Am 14. Mai gingen die Diskussionen in vielen Betrieben weiter. Nach den gewaltigen Demonstrationen am Vorabend, die den ganzen Enthusiasmus und ein Gefühl der Stärke zum Vorschein gebracht hatten, war es schwierig die Arbeit wieder aufzunehmen, so als ob nichts passiert wäre. In Nantes traten die Beschäftigen von Sud-Aviation in einen spontanen Streik und beschlossen die Besetzung des Werkes. Vor allem die jüngeren Beschäftigten trieben die Bewegung voran. Die Arbeiterklasse war auf den Plan getreten.“ Diese Schilderung werden wir hier fortsetzen.
Die Ausdehnung der Streiks
In Nantes stießen die jungen Arbeiter, die im gleichen Alter waren wie die Studenten, die Bewegung an. Ihre Argumentation war einfach aber einleuchtend: „Wenn die Studenten, die ja mit einem Streik keinen Druck ausüben können, die Kraft besaßen, die Regierung zum Nachgeben zu zwingen, können die Arbeiter die Regierung auch zum Nachgeben zwingen.“ Die Studenten der Stadt wiederum erklärten sich mit den Arbeitern solidarisch; sie reihten sich in deren Streikposten ein: Verbrüderung. Die Kampagnen der CGT und der KPF warnten vor den „linken Provokateuren, die im Dienste der Arbeitgeber und des Innenministers stehen“ und die Studenten unterwandert hätten; aber diese Kampagnen zeigten keine große Wirkung. Insgesamt standen am Abend des 14. Mai 3100 Arbeiter im Streik. Am 15. Mai breitete sich die Bewegung auf die Renault-Werke in Cléon in der Normandie, und auf zwei weitere Fabriken in der Region aus: totaler Streik, unbegrenzte Werksbesetzungen, rote Fahnen an den Fabriktoren. Am Ende des Tages streikten 11.000 Beschäftigte. Am 16. Mai schlossen sich die Beschäftigten der anderen Renault-Werke an: rote Fahnen über Flins, Sandouville, Le Mans und Billancourt. An jenem Abend befanden sich 75.000 Arbeiter im Streik; aber als die Arbeiter von Renault-Billancourt in den Kampf traten, wurde ein deutliches Signal gesetzt. Es handelte sich um die größte Fabrik in Frankreich (35.000 Beschäftigte) und seit langem galt ein Sprichwort: „Wenn Renault niest, hat Frankreich Schnupfen.“ Am 17. Mai gab es 215.000 Streikende. Die Streiks erreichten nunmehr ganz Frankreich, vor allem die Provinz. Es handelte sich um eine vollkommen spontane Bewegung; die Gewerkschaften liefen ihr nur nach. Überall standen die jungen Arbeiter an ihrer Spitze. Häufig verbrüderten sich Studenten und junge Arbeiter. Junge Arbeiter zogen in die besetzten Universitäten und forderten die Studenten auf, zu ihnen in die Kantinen zum Essen zu kommen. Es gab keine genauen Forderungen. Stattdessen äußerte sich eher Unmut. Auf einer Fabrikmauer in der Normandie stand: „Wir brauchen Zeit zum Leben und mehr Würde!“ An jenem Tag rief die CGT zur „Ausdehnung des Streiks“ auf. Sie hatte Angst, von der „Basis überrollt“ und von der CFDT, welche von den ersten Tagen an viel präsenter war, verdrängt zu werden. Wie man damals sagte, war sie auf den „fahrenden Zug aufgesprungen“. Ihr Aufruf wurde erst am nächsten Tag bekannt. Am 18. Mai standen mittags eine Million Arbeiter im Streik, noch bevor der Streikaufruf der CGT bekannt wurde. Am Abend streikten zwei Millionen Beschäftigte. Am 20. Mai streikten sechs Millionen, und am 21. Mai hatten schon 6.5 Millionen die Arbeit niedergelegt. Am 22. Mai befanden sich acht Millionen im unbefristeten Streik. Es handelte sich um den größten Streik in der Geschichte der internationalen Arbeiterbewegung. Er war sehr viel massiver als die vorher berühmt gewordenen Streiks – der ‚Generalstreik’ des Mai 1926 in Großbritannien (der eine Woche dauerte) und die Streiks im Mai-Juni 1936 in Frankreich. Alle Bereiche waren betroffen: Industrie, Transport und Verkehr, Energie, Post und Telekommunikation, Erziehungswesen, Verwaltungen (mehrere Ministerien waren vollkommen lahm gelegt), Medien (das staatliche Fernsehen streikte, die Beschäftigten prangerten vor allem die aufgezwungene Zensur an), Forschungslabore usw. Selbst die Bestattungsunternehmer streikten (Mai 68 war ein schlechter Zeitpunkt zum Sterben). Gar Berufssportler schlossen sich der Bewegung an. Die rote Fahne wehte über den Gebäuden des französischen Fußballverbandes. Die Künstler standen nicht abseits, das Filmfestival in Cannes wurde auf Veranlassung der Regisseure unterbrochen.In dieser Zeit wurden die besetzten Universitäten (wie auch andere öffentliche Gebäude wie das Odéon-Theater in Paris) zu Orten ständiger politischer Debatte. Viele Arbeiter, insbesondere die Jungen, aber nicht nur diese, beteiligten sich an diesen Diskussionen. Arbeiter baten diejenigen, die die Notwendigkeit einer Revolution vertraten, zu den Versammlungen in den besetzten Betrieben zu kommen und dort ihren Standpunkt zu vertreten. So wurde der kleine Kern von Leuten, die später die Sektion der IKS in Frankreich gründen sollte, dazu aufgefordert, in der besetzten Fabrik JOB ihre Auffassungen von den Arbeiterräten zu erklären. Und am bedeutendsten war, dass diese Einladung von Mitgliedern der …CGT und der KPF ausgesprochen wurde. Diese mussten eine Stunde lang mit den Hauptamtlichen der CGT des großen Werkes Sud-Aviation verhandeln, die gekommen waren, um die Streikposten der JOB zu ‚verstärken’, bevor sie die Zustimmung erhielten, ‚Linksradikale’ in das Werk zu lassen. Mehr als sechs Stunden lang diskutierten Arbeiter und Revolutionäre, auf Papierrollen sitzend, über die Revolution, die Geschichte der Arbeiterbewegung, die Sowjets und gar über den Verrat ... der KPF und der CGT. Viele Diskussionen fanden ebenfalls auf den Straßen und Bürgersteigen statt (im Mai 68 herrschte überall schönes Wetter). Sie entstanden spontan, jeder hatte etwas zu sagen („Man hört dem anderen zu und redet miteinander“ war einer der Slogans). Überall herrschte so etwas wie Feststimmung, außer in den ‚Reichenvierteln’, wo sich Angst und Hass ansammelten. Überall in Frankreich, in den Stadtvierteln, in einigen großen Betrieben oder in den benachbarten Bezirken tauchten „Aktionskomitees“ auf. Dort wurde darüber diskutiert, wie man kämpfen sollte, wie eine revolutionäre Perspektive aussehen könnte. Im Allgemeinen wurden diese Diskussionen von linken oder anarchistischen Gruppen angestoßen, aber dort versammelten sich viel mehr Leute als Mitglieder dieser Organisationen. Selbst bei der ORTF, den staatlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten, entstand ein Aktionskomitee, das insbesondere von Michel Drucker mit angetrieben wurde, und an dem sich der unbeschreibliche Thierry Rolland beteiligte.
Die Reaktionen der Bourgeoisie
In Anbetracht dieser Lage befand sich die herrschende Klasse in einer Phase des Umherirrens, was sich durch verwirrte und unwirksame Initiativen äußerte. So diskutierte und verwarf das Parlament, welches von der Rechten beherrscht wurde, einen Zensurantrag, der von der Linken zwei Wochen zuvor eingebracht worden war: Die offiziellen Institutionen der Republik Frankreichs schienen in einer anderen Welt zu leben. Das Gleiche traf auf die Regierung zu, die an jenem Tag beschloss, Daniel Cohn-Bendit, der nach Deutschland gereist war, die Wiedereinreise zu verbieten. Diese Entscheidung ließ die Unzufriedenheit nur noch weiter hochkochen. Am 24. Mai kam es zu mehreren Demonstrationen, insbesondere um gegen das Aufenthaltsverbot Cohn-Bendits zu protestieren: „Nieder mit den Landesgrenzen!“ „Wir sind alle deutsche Juden!“ Trotz des von der CGT gelegten Sperrrings gegen die „Abenteurer“ und „Provokateure“ (d.h. die „radikalen“ Studenten) schlossen sich viele junge Arbeiter diesen Demonstrationen an. Am Abend hielt der Präsident der Republik, General de Gaulle, eine Rede. Er schlug ein Referendum vor, damit die Franzosen sich zur „Beteiligung“ äußern (eine Art Assoziation Kapital-Arbeit). Weltfremder konnte man nicht sein. Diese Rede stieß auf taube Ohren. Sie zeigte die totale Verwirrung der Regierung und der Bourgeoisie im Allgemeinen (1). In den Straßen hatten die Demonstrationen die Rede in Transistorradios verfolgt. Die Wut stieg sofort weiter an: „Wir pfeifen auf seine Rede.“ In ganz Paris und in mehreren Provinzstädten kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen; Barrikaden wurden errichtet. Zahlreiche Schaufenster wurden zerschlagen, Autos in Brand gesetzt. Dadurch richtete sich ein Teil der öffentlichen Meinung gegen die Studenten, die nunmehr als „Krawallmacher“ angesehen wurden. Es ist übrigens wahrscheinlich, dass sich unter die Demonstranten Mitglieder der gaullistischen Milizen oder Zivilpolizisten gemischt hatten, um Öl aufs Feuer zu gießen und der Bevölkerung Angst einzujagen. Es war aber auch klar, dass viele Studenten glaubten, sie würden die ‚Revolution machen’, indem sie Barrikaden errichteten oder Autos anzündeten, die als Symbol der ‚Konsumgesellschaft’ galten. Aber diese Handlungen brachten vor allem die Wut der Demonstranten, Studenten und jungen Arbeiter über die lächerlichen und provozierenden Reaktionen der Behörden gegenüber der größten Streikwelle der Geschichte zum Vorschein. Ein Ausdruck dieser Wut gegen das System: das Symbol des Kapitalismus, die Pariser Börse, wurde in Brand gesetzt. Schließlich konnte die Bourgeoisie erst am darauf folgenden Tag wirksamere Maßnahmen ergreifen. Am Samstag, den 25. Mai, wurden Verhandlungen im Arbeitsministerium (rue de Grenelle) zwischen Gewerkschaften, Arbeitgebern und der Regierung aufgenommen. Von Anfang an waren die Arbeitgeber bereit, mehr zuzugestehen, als was die Gewerkschaften erwartet hatten. Es war offensichtlich, dass die Bourgeoisie Angst hatte. Der Premierminister Pompidou leitete die Verhandlungen. Am Sonntagmorgen traf er den Chef der CGT, Séguy, eine Stunde lang unter vier Augen. Die beiden Hauptverantwortlichen für die Aufrechterhaltung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung in Frankreich brauchten Zeit, um ohne Zeugen die Bedingungen für die Wiederherstellung der Ordnung zu besprechen (2). In der Nacht vom 26. zum 27. Mai wurde das „Abkommen von Grenelle“ unterzeichnet: - Lohnerhöhung von 7% für alle ab dem 1. Juni, plus 3% zusätzlich ab dem 1. Oktober;- Erhöhung der Mindestlöhne um 25%;- Kürzung der „Eigenleistungen“ im Gesundheitswesen von 30% auf 25% (insbesondere die Gesundheitsausgaben, die die Sozialversicherung nicht übernahm); - Anerkennung der Gewerkschaften in den Betrieben;- Sowie eine Reihe von sehr vagen Versprechungen des Beginns von Verhandlungen, insbesondere über die Frage der Arbeitszeit (die damals durchschnittlich 47 Stunden pro Woche betrug). In Anbetracht der Stärke der Bewegung handelte es sich um eine wahre Provokation: - Die 10% Lohnerhöhung sollte schnell durch die Inflation aufgefressen werden (damals gab es eine hohe Inflationsrate); - nichts zur Frage des Lohnausgleichs für die Inflation; - nichts Konkretes zur Verkürzung der Arbeitszeit. Man gab sich damit zufrieden, als Ziel die „schrittweise“ Rückkehr zur 40 Stundenwoche (welche schon 1936 offiziell erreicht worden war) zu proklamieren. Wäre man dem von der Regierung vorgeschlagenen Rhythmus gefolgt, hätte man das Ziel 2008 erreicht!- Die einzigen, die etwas Wesentliches erreichten, waren die am geringsten bezahlten Arbeiter (man wollte die Arbeiterklasse spalten und sie zur Wiederaufnahme der Arbeit drängen) sowie die Gewerkschaften (welche für ihre Saboteursrolle belohnt wurden). - Am 27. Mai verwarfen die Vollversammlungen das „Abkommen von Grenelle“ einstimmig. Bei Renault Billancourt haben die Gewerkschaften eine ‚Showveranstaltung’ organisiert, über die von den Medien groß berichtet wird. Als er von den Verhandlungen zurückkam, sagte Séguy zu den Journalisten, „die Wiederaufnahme der Arbeit steht unmittelbar bevor“, und er hoffte sehr wohl, dass die Arbeiter von Billancourt ein Beispiel dafür liefern würden. Aber 10.000 Beschäftigte, die sich seit dem Morgen versammelt hatten, hatten die Fortsetzung der Streiks beschlossen, noch bevor die Gewerkschaftsführer angekommen waren. Benoît Frachon, ‘historischer’ Führer der CGT (der sich schon an den Verhandlungen von 1936 beteiligt hatte) erklärte: „Das Abkommen von Grenelle wird Millionen von Arbeitern einen Wohlstand bieten, den sie nicht erhofft hatten.“ Todesstille im Saal. André Jeanson von der CFDT freute sich über das anfängliche Votum zur Fortsetzung des Streiks und sprach von der Solidarität zwischen Arbeitern, Studenten und kämpfenden Oberschülern: stürmischer Beifall. Schließlich trug Séguy einen „objektiven Bericht“ der „Errungenschaften von Grenelle“ vor: minutenlanges Pfeifkonzert. Danach machte Séguy eine Kehrtwendung: „Wenn man nach dem hier gehörten urteilen muss, werdet ihr euch nicht über den Tisch ziehen lassen!“ Applaus, aber aus der Menge rief eine Stimme: „Er führt uns hinters Licht.“ Der beste Beweis der Verwerfung des „Abkommens von Grenelle“: die Zahl der Streikenden stieg noch am 27. Mai auf neun Millionen. Am 9. Mai fand im Sportstadion Charléty in Paris eine große Versammlung statt. Sie wurde von der Studentengewerkschaft UNEF, der CFDT (welche sich radikaler als die CGT gab) und linken Gruppen einberufen. In den Reden wurden revolutionäre Töne geschwungen. Man wollte für die wachsende Unzufriedenheit mit der CGT und der KPF ein Ventil finden. Neben den Vertretern der Extremen Linken waren auch Politiker der Sozialdemokratie wie Mendès-France anwesend (ehemaliger Regierungschef in den 1950er Jahren). Cohn-Bendit, der mit schwarz gefärbten Haaren aus Deutschland zurückgekehrt war, trat auch auf (am Vorabend war er in der Sorbonne erschienen). Der 28. Mai war der Tag der Manöver und Schachzüge der linken Parteien. Am Morgen hielt François Mitterrand, Vorsitzender der « Fédération de la gauche démocrate et socialiste“ (in der die Sozialistische Partei, die Radikale Partei und verschiedene kleine linke Gruppe vertreten waren) eine Pressekonferenz ab. Er meinte, es gebe ein Machtvakuum – deshalb kündigte er seine Kandidatur als Präsident der Republik an. Am Nachmittag schlug Waldeck-Rochet, der Führer der KPF, eine Regierung mit „kommunistischer Beteiligung“ vor. Es ging darum zu vermeiden, dass die Sozialdemokraten die Lage allein zu ihren Gunsten ausnutzten. Am 29. Mai folgte eine große Demonstration, zu welcher die CGT aufrief und in der sie eine „Volksregierung“ forderte. Die Rechten warnten sofort vor einem „kommunistischen Komplott“. An diesem Tag „tauchte“ General de Gaulle ab. Einige brachten das Gerücht in Umlauf, er trete ab; tatsächlich flog er nach Deutschland, um dort die Unterstützung des General Massus, welcher in Deutschland die französischen Besatzungstruppen befehligte, und die Loyalität der Armee sicher zu stellen. Der 30. Mai stellte eine Art entscheidenden Tag dar bei dem Versuch der Bourgeoisie, die Lage wieder in den Griff zu kriegen. De Gaulle hielt erneut eine Rede. „Unter den gegenwärtigen Bedingungen trete ich nicht zurück (…). Ich löse heute die Nationalversammlung auf ...“ Gleichzeitig fand in Paris auf den Champs-Élysées eine gewaltige Demonstration zur Unterstützung de Gaulles statt. Aus den Reichenvierteln, den wohlhabenden Vororten und auch vom Land wurde mit Armeelastern das „Volk“ herangekarrt. Es kamen zusammen die Verängstigten und Besitzenden, die Bürgerlichen, die Vertreter der Religionsschulen für die Kinder der Reichen, die Führungsschichten, die sich ihrer ‚Überlegenheit’ bewusst waren, die kleinen Geschäftsinhaber, die um ihre Schaufenster fürchteten; Kriegsveteranen, die wegen der Angriffe auf die Nationalfahne erbost waren, die Geheimpolizei, die mit der Unterwelt unter einer Decke steckte, aber auch alte Algeriensiedler und die OAS, junge Mitglieder der faschistoiden Gruppe Occident, die alten Nostalgiker Vichys (obwohl diese alle de Gaulle verachteten). All diese feinen Leute strömten zusammen, um ihren Hass auf die Arbeiterklasse und ihre ‚Ordnungsliebe’ zu bekunden. Aus der Menge, zu der auch alte Kämpfer des „freien Frankreich“ gehörten, drangen Rufe wie „Cohn-Bendit nach Dachau!“. Aber die „Partei der Ordnung“ beschränkte sich nicht auf die Demonstranten auf den Champs-Elysées. Am gleichen Tag rief die CGT zu branchenmäßigen Verhandlungen zur „Verbesserung der Errungenschaften von Grenelle“ auf. Es handelte sich um ein Mittel zur Spaltung der Bewegung, um sie so vernichten zu können.
Die Wiederaufnahme der Arbeit
Von jenem Donnerstag an wurde die Arbeit wieder aufgenommen, allerdings nur langsam, denn am 6. Juni streikten immer noch ca. 6 Millionen Beschäftigte. Die Arbeit wurde in großer Zerstreuung wieder aufgenommen. 31. Mai: Stahlindustrie Lothringens, Textilindustrie Nordfrankreichs,4. Juni: Arsenale, Versicherungen5. Juni : Elektrizitätswerke, Kohlebergwerke6. Juni : Post, Telekommunikation, Transportwesen (In Paris setzte die CGT Druckmittel zur Wiederaufnahme der Arbeit ein. In jedem Betriebswerk kündigten die Gewerkschaftsführer an, dass in den anderen Depots die Arbeit schon wieder aufgenommen worden sei, was eine Täuschung war.);7. Juni: Grundschulen10. Juni: das Renault-Werk in Flins wurde von der Polizei besetzt. Ein von den Polizisten verprügelter Gymnasiast fiel in die Seine und ertrank;11. Juni: Intervention der CRS (Bürgerkriegspolizei) in den Peugeot-Werken in Sochaux (zweitgrößtes Werk in Frankreich). Zwei Arbeiter wurden getötet. In ganz Frankreich kam es erneut zu gewalttätigen Demonstrationen. „Sie haben unsere Genossen getötet.“ Trotz des entschlossenen Widerstands der Arbeiter räumten die CRS das Sochaux-Werk. Aber die Arbeit wurde erst 10 Tage später wieder aufgenommen. Aus Furcht, dass die Empörung erneut zu einem Wiederaufleben der Streiks führte (immerhin standen noch drei Millionen Beschäftigte im Streik), riefen die Gewerkschaften (mit der CGT an der Spitze) und die Linksparteien (mit der KPF an der Spitze) nachdrücklich zur Wiederaufnahme der Arbeit auf, „damit die Wahlen stattfinden können und der Sieg der Arbeiterklasse vervollständigt werden kann.“ Die Tageszeitung der KPF, l’Humanité, trug die Schlagzeile: „Gestärkt durch ihren Sieg nehmen Millionen Beschäftigte die Arbeit wieder auf.“ Der systematische Streikaufruf durch die Gewerkschaften vom 20. Mai an konnte nun erklärt werden: Sie wollten die Bewegung kontrollieren, damit sie so leichter zur Wiederaufnahme der Arbeit in den weniger kämpferischen Teilen und zur Demoralisierung der anderen Bereiche drängen konnten. Waldeck-Rochet erklärte in seinen Reden während des Wahlkampfes, dass die « Kommunistische Partei eine Partei der Ordnung ist ». In der Tat konnte die bürgerliche „Ordnung“ schrittweise wiederhergestellt werden. 12. Juni: Wiederaufnahme der Arbeit in den Schulen der Sekundarstufe14. Juni: Air France und Seeschiffahrt16. Juni : Besetzung der Sorbonne durch die Polizei17. Juni: chaotische Wiederaufnahme der Arbeit bei Renault Billancourt18. Juni: De Gaulle ließ die Führer der OAS freisetzen, die noch im Gefängnis saßen;23. Juni: Erster Wahltag der Parlamentswahlen mit großen Stimmengewinnen für die Rechten;24. Juni: Wiederaufnahme der Arbeit bei Citroën Javel, mitten in Paris (Krasucki, Nummer 2 der CGT, trat vor der Vollversammlung auf und rief zum Streikabbruch auf.)26. Juni: Usinor Dünkirchen30. Juni : Stichwahl mit einem historischen Sieg der Rechten. Einer der Betriebe, die als letzte die Arbeit wieder aufnahmen, waren die Radio- und Fernsehanstalten am 12. Juli. Viele Journalisten wollten nicht wieder bevormundet und zensiert werden, wie das vorher so sehr durch die Regierung geschehen ist. Nach der Wiederaufnahme der Arbeit wurden viele von ihnen entlassen. Überall wurde die Ordnung wiederhergestellt, gerade auch bei den Medien, die wichtig waren für die gezielte „Bearbeitung“ der Bevölkerung. So endete der größte Streik der Geschichte im Gegensatz zu den Behauptungen der CGT und der KPF in einer Niederlage. Eine schwere Schlappe, die durch die Rückkehr der Parteien und „Autoritäten“ bekräftigt wurde, welche während der Bewegung die ganze Wut und Verachtung auf sich gezogen hatten. Aber die Arbeiterbewegung weiß schon seit langem: „Das eigentliche Resultat ihrer Kämpfe ist nicht der unmittelbare Erfolg, sondern die immer weiter um sich greifende Vereinigung der Arbeiter“ (Kommunistisches Manifest). Aber ungeachtet ihrer unmittelbaren Niederlage haben die Arbeiter in Frankreich 1968 einen großen Sieg nicht nur für sich selbst, sondern für das ganze Weltproletariat errungen. Dies werden wir in unserem nächsten Artikel aufzeigen, in dem wir versuchen werden, die tiefer liegenden Ursachen wie auch die historische und internationale Dimension dieses „schönen Mai“ in Frankreich herauszustellen. Fabienne (27/04/2008) 1) Am Tag nach dieser Rede kündigten die Beschäftigten der Kommunen in vielen Städten an, dass sie sich weigerten, das Referendum zu organisieren. Auch wussten die Behörden nicht, wie sie Wahlzettel drucken sollten – die Staatsdruckerei wurde bestreikt und die nicht streikenden privaten Druckereien verweigerten den Druckauftrag. Die Arbeitgeber wollten keine zusätzlichen Scherereien mit ihren Beschäftigten haben. 2) Man erfuhr später, dass Chirac, Staatssekretär im Ministerium für soziale Angelegenheiten, ebenfalls Krasucki, die Nummer 2 der CGT, (auf einem Dachboden!) getroffen hat.
Geographisch:
- Frankreich [2]
Aktuelles und Laufendes:
- Mai 68 [18]
Leute:
- Cohn-Bendit [19]
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Historische Ereignisse:
- Mai 68 [20]
Theoretische Fragen:
- Arbeiterklasse [21]
Juli 2008
- 766 reads
40 Jahre seit Mai 1968: Das Ende der Konterrevolution - Das historische Wiedererstarken der Arbeiterklasse - 2. Teil
- 3735 reads
Gegenüber all den Lügen, die heute zum Mai 68 verbreitet werden, müssen die Revolutionäre die Wahrheit wiederherstellen. Sie müssen auch die Mittel anbieten, um die Bedeutung und die Lehren dieser Ereignisse zu begreifen. Sie müssen insbesondere verhindern, dass ihre Lehren unter einem Haufen Blumen und Kränzen begraben werden.
Wir haben schon damit angefangen, indem wir bislang einen Artikel in unserer Internationalen Revue veröffentlicht haben, der auf die ersten Bestandteile der Ereignisse des Mai 68 zurückkommt – die Studentenproteste in Frankreich und auf der Welt. In diesem Artikel wollen wir auf den wesentlichsten Bestandteil der Ereignisse eingehen – die Bewegung der Arbeiterklasse. In dem ersten Artikel dieser Reihe schrieben wir am Schluss zu den Ereignissen in Frankreich: „Am 14. Mai gingen die Diskussionen in vielen Betrieben weiter. Nach den gewaltigen Demonstrationen am Vorabend, die den ganzen Enthusiasmus und ein Gefühl der Stärke zum Vorschein gebracht hatten, war es schwierig die Arbeit wieder aufzunehmen, so als ob nichts passiert wäre. In Nantes traten die Beschäftigen von Sud-Aviation in einen spontanen Streik und beschlossen die Besetzung des Werkes. Vor allem die jüngeren Beschäftigten trieben die Bewegung voran. Die Arbeiterklasse war auf den Plan getreten.“ Diese Schilderung werden wir hier fortsetzen.
Die Ausdehnung der Streiks
In Nantes stießen die jungen Arbeiter, die im gleichen Alter waren wie die Studenten, die Bewegung an. Ihre Argumentation war einfach aber einleuchtend: „Wenn die Studenten, die ja mit einem Streik keinen Druck ausüben können, die Kraft besaßen, die Regierung zum Nachgeben zu zwingen, können die Arbeiter die Regierung auch zum Nachgeben zwingen.“ Die Studenten der Stadt wiederum erklärten sich mit den Arbeitern solidarisch; sie reihten sich in deren Streikposten ein: Verbrüderung. Die Kampagnen der KPF (1) und der CGT (2) warnten vor den „linken Provokateuren, die im Dienste der Arbeitgeber und des Innenministers stehen“ und die Studenten unterwandert hätten; aber diese Kampagnen zeigten keine große Wirkung. Insgesamt standen am Abend des 14. Mai 3100 Arbeiter im Streik. Am 15. Mai breitete sich die Bewegung auf die Renault-Werke in Cléon in der Normandie, und auf zwei weitere Fabriken in der Region aus: totaler Streik, unbegrenzte Werksbesetzungen, rote Fahnen an den Fabriktoren. Am Ende des Tages streikten 11.000 Beschäftigte.
Am 16. Mai schlossen sich die Beschäftigten der anderen Renault-Werke an: rote Fahnen über Flins, Sandouville, Le Mans und Billancourt. An jenem Abend befanden sich 75.000 Arbeiter im Streik; aber als die Arbeiter von Renault-Billancourt in den Kampf traten, wurde ein deutliches Signal gesetzt. Es handelte sich um die größte Fabrik in Frankreich (35.000 Beschäftigte) und seit langem galt ein Sprichwort: „Wenn Renault niest, hat Frankreich Schnupfen.“
Am 17. Mai gab es 215.000 Streikende. Die Streiks erreichten nunmehr ganz Frankreich, vor allem die Provinz. Es handelte sich um eine vollkommen spontane Bewegung; die Gewerkschaften liefen ihr nur nach. Überall standen die jungen Arbeiter an ihrer Spitze. Häufig verbrüderten sich Studenten und junge Arbeiter. Junge Arbeiter zogen in die besetzten Universitäten und forderten die Studenten auf, zu ihnen in die Kantinen zum Essen zu kommen. Es gab keine genauen Forderungen. Stattdessen äußerte sich eher Unmut. Auf einer Fabrikmauer in der Normandie stand: „Wir brauchen Zeit zum Leben und mehr Würde!“ An jenem Tag rief die CGT zur „Ausdehnung des Streiks“ auf. Sie hatte Angst, von der „Basis überrollt“ und von der CFDT (3) , welche von den ersten Tagen an viel präsenter war, verdrängt zu werden. Wie man damals sagte, war sie auf den „fahrenden Zug aufgesprungen“. Ihr Aufruf wurde erst am nächsten Tag bekannt. Am 18. Mai standen mittags eine Million Arbeiter im Streik, noch bevor der Streikaufruf der CGT bekannt wurde. Am Abend streikten zwei Millionen Beschäftigte.
Am 20. Mai streikten sechs Millionen, und am 21. Mai hatten schon 6.5 Millionen die Arbeit niedergelegt.
Am 22. Mai befanden sich acht Millionen im unbefristeten Streik. Es handelte sich um den größten Streik in der Geschichte der internationalen Arbeiterbewegung. Er war sehr viel massiver als die vorher berühmt gewordenen Streiks – der ‚Generalstreik’ des Mai 1926 in Großbritannien (der eine Woche dauerte) und die Streiks im Mai-Juni 1936 in Frankreich. Alle Bereiche waren betroffen: Industrie, Transport und Verkehr, Energie, Post und Telekommunikation, Erziehungswesen, Verwaltungen (mehrere Ministerien waren vollkommen lahm gelegt), Medien (das staatliche Fernsehen streikte, die Beschäftigten prangerten vor allem die aufgezwungene Zensur an), Forschungslabore usw. Selbst die Bestattungsunternehmer streikten (Mai 68 war ein schlechter Zeitpunkt zum Sterben). Gar Berufssportler schlossen sich der Bewegung an. Die rote Fahne wehte über den Gebäuden des französischen Fußballverbandes. Die Künstler standen nicht abseits, das Filmfestival in Cannes wurde auf Veranlassung der Regisseure unterbrochen. In dieser Zeit wurden die besetzten Universitäten (wie auch andere öffentliche Gebäude wie das Odéon-Theater in Paris) zu Orten ständiger politischer Debatte. Viele Arbeiter, insbesondere die Jungen, aber nicht nur diese, beteiligten sich an diesen Diskussionen. Arbeiter baten diejenigen, die die Notwendigkeit einer Revolution vertraten, zu den Versammlungen in den besetzten Betrieben zu kommen und dort ihren Standpunkt zu vertreten. So wurde der kleine Kern von Leuten, die später die Sektion der IKS in Frankreich gründen sollte, dazu aufgefordert, in der besetzten Fabrik JOB ihre Auffassungen von den Arbeiterräten zu erklären. Und am bedeutendsten war, dass diese Einladung von Mitgliedern der …CGT und der KPF ausgesprochen wurde. Diese mussten eine Stunde lang mit den Hauptamtlichen der CGT des großen Werkes Sud-Aviation verhandeln, die gekommen waren, um die Streikposten der JOB zu ‚verstärken’, bevor sie die Zustimmung erhielten, ‚Linksradikale’ in das Werk zu lassen. Mehr als sechs Stunden lang diskutierten Arbeiter und Revolutionäre, auf Papierrollen sitzend, über die Revolution, die Geschichte der Arbeiterbewegung, die Sowjets und gar über den Verrat ... der KPF und der CGT. Viele Diskussionen fanden ebenfalls auf den Straßen und Bürgersteigen statt (im Mai 68 herrschte überall schönes Wetter). Sie entstanden spontan, jeder hatte etwas zu sagen („Man hört dem anderen zu und redet miteinander“ war einer der Slogans). Überall herrschte so etwas wie Feststimmung, außer in den ‚Reichenvierteln’, wo sich Angst und Hass ansammelten. Überall in Frankreich, in den Stadtvierteln, in einigen großen Betrieben oder in den benachbarten Bezirken tauchten „Aktionskomitees“ auf. Dort wurde darüber diskutiert, wie man kämpfen sollte, wie eine revolutionäre Perspektive aussehen könnte. Im Allgemeinen wurden diese Diskussionen von linken oder anarchistischen Gruppen angestoßen, aber dort versammelten sich viel mehr Leute als Mitglieder dieser Organisationen. Selbst bei der ORTF, den staatlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten, entstand ein Aktionskomitee, das insbesondere von Michel Drucker (4) mit angetrieben wurde, und an dem sich der unbeschreibliche Thierry Rolland (5) beteiligte.
Die Reaktionen der Bourgeoisie
In Anbetracht dieser Lage befand sich die herrschende Klasse in einer Phase des Umherirrens, was sich durch verwirrte und unwirksame Initiativen äußerte. So diskutierte und verwarf das Parlament, welches von der Rechten beherrscht wurde, einen Zensurantrag, der von der Linken zwei Wochen zuvor eingebracht worden war: Die offiziellen Institutionen der Republik Frankreichs schienen in einer anderen Welt zu leben. Das Gleiche traf auf die Regierung zu, die an jenem Tag beschloss, Daniel Cohn-Bendit, der nach Deutschland gereist war, die Wiedereinreise zu verbieten. Diese Entscheidung ließ die Unzufriedenheit nur noch weiter hochkochen. Am 24. Mai kam es zu mehreren Demonstrationen, insbesondere um gegen das Aufenthaltsverbot Cohn-Bendits zu protestieren: „Nieder mit den Landesgrenzen!“ „Wir sind alle deutsche Juden!“ Trotz des von der CGT gelegten Sperrrings gegen die „Abenteurer“ und „Provokateure“ (d.h. die „radikalen“ Studenten) schlossen sich viele junge Arbeiter diesen Demonstrationen an. Am Abend hielt der Präsident der Republik, General de Gaulle, eine Rede. Er schlug ein Referendum vor, damit die Franzosen sich zur „Beteiligung“ äußern (eine Art Assoziation Kapital-Arbeit). Weltfremder konnte man nicht sein. Diese Rede stieß auf taube Ohren. Sie zeigte die totale Verwirrung der Regierung und der Bourgeoisie im Allgemeinen (6). Auf den Straßen hatten die Demonstrationen die Rede in Transistorradios verfolgt. Die Wut stieg sofort weiter an: „Wir pfeifen auf seine Rede.“ In ganz Paris und in mehreren Provinzstädten kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen; Barrikaden wurden errichtet. Zahlreiche Schaufenster wurden zerschlagen, Autos in Brand gesetzt. Dadurch richtete sich ein Teil der öffentlichen Meinung gegen die Studenten, die nunmehr als „Krawallmacher“ angesehen wurden. Es ist übrigens wahrscheinlich, dass sich unter die Demonstranten Mitglieder der gaullistischen Milizen oder Zivilpolizisten gemischt hatten, um Öl aufs Feuer zu gießen und der Bevölkerung Angst einzujagen. Es war aber auch klar, dass viele Studenten glaubten, sie würden die ‚Revolution machen’, indem sie Barrikaden errichteten oder Autos anzündeten, die als Symbol der ‚Konsumgesellschaft’ galten. Aber diese Handlungen brachten vor allem die Wut der Demonstranten, Studenten und jungen Arbeiter über die lächerlichen und provozierenden Reaktionen der Behörden gegenüber der größten Streikwelle der Geschichte zum Vorschein. Ein Ausdruck dieser Wut gegen das System: das Symbol des Kapitalismus, die Pariser Börse, wurde in Brand gesetzt. Schließlich konnte die Bourgeoisie erst am darauf folgenden Tag wirksamere Maßnahmen ergreifen. Am Samstag, den 25. Mai, wurden Verhandlungen im Arbeitsministerium (rue de Grenelle) zwischen Gewerkschaften, Arbeitgebern und der Regierung aufgenommen. Von Anfang an waren die Arbeitgeber bereit, mehr zuzugestehen, als was die Gewerkschaften erwartet hatten. Es war offensichtlich, dass die Bourgeoisie Angst hatte. Der Premierminister Pompidou leitete die Verhandlungen. Am Sonntagmorgen traf er den Chef der CGT, Séguy (7) , eine Stunde lang unter vier Augen. Die beiden Hauptverantwortlichen für die Aufrechterhaltung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung in Frankreich brauchten Zeit, um ohne Zeugen die Bedingungen für die Wiederherstellung der Ordnung zu besprechen (8). In der Nacht vom 26. zum 27. Mai wurde das „Abkommen von Grenelle“ unterzeichnet:
- Lohnerhöhung von 7% für alle ab dem 1. Juni, plus 3% zusätzlich ab dem 1. Oktober;
- Erhöhung der Mindestlöhne um 25%;
- Kürzung der „Eigenleistungen“ im Gesundheitswesen von 30% auf 25% (insbesondere die Gesundheitsausgaben, die die Sozialversicherung nicht übernahm);
- Anerkennung der Gewerkschaften in den Betrieben;
- Sowie eine Reihe von sehr vagen Versprechungen des Beginns von Verhandlungen, insbesondere über die Frage der Arbeitszeit (die damals durchschnittlich 47 Stunden pro Woche betrug). In Anbetracht der Stärke der Bewegung handelte es sich um eine wahre Provokation:
- Die 10% Lohnerhöhung sollte schnell durch die Inflation aufgefressen werden (damals gab es eine hohe Inflationsrate);
- nichts zur Frage des Lohnausgleichs für die Inflation;
- nichts Konkretes zur Verkürzung der Arbeitszeit. Man gab sich damit zufrieden, als Ziel die „schrittweise“ Rückkehr zur 40 Stundenwoche (welche schon 1936 offiziell erreicht worden war) zu proklamieren. Wäre man dem von der Regierung vorgeschlagenen Rhythmus gefolgt, hätte man das Ziel 2008 erreicht!
- Die einzigen, die etwas Wesentliches erreichten, waren die am geringsten bezahlten Arbeiter (man wollte die Arbeiterklasse spalten und sie zur Wiederaufnahme der Arbeit drängen) sowie die Gewerkschaften (welche für ihre Saboteursrolle belohnt wurden).
- Am 27. Mai verwarfen die Vollversammlungen das „Abkommen von Grenelle“ einstimmig. Bei Renault Billancourt haben die Gewerkschaften eine ‚Showveranstaltung’ organisiert, über die von den Medien groß berichtet wird. Als er von den Verhandlungen zurückkam, sagte Séguy zu den Journalisten, „die Wiederaufnahme der Arbeit steht unmittelbar bevor“, und er hoffte sehr wohl, dass die Arbeiter von Billancourt ein Beispiel dafür liefern würden. Aber 10.000 Beschäftigte, die sich seit dem Morgen versammelt hatten, hatten die Fortsetzung der Streiks beschlossen, noch bevor die Gewerkschaftsführer angekommen waren. Benoît Frachon, ‘historischer’ Führer der CGT (der sich schon an den Verhandlungen von 1936 beteiligt hatte) erklärte: „Das Abkommen von Grenelle wird Millionen von Arbeitern einen Wohlstand bieten, den sie nicht erhofft hatten.“ Todesstille im Saal. André Jeanson von der CFDT freute sich über das anfängliche Votum zur Fortsetzung des Streiks und sprach von der Solidarität zwischen Arbeitern, Studenten und kämpfenden Oberschülern: stürmischer Beifall. Schließlich trug Séguy einen „objektiven Bericht“ der „Errungenschaften von Grenelle“ vor: minutenlanges Pfeifkonzert. Danach machte Séguy eine Kehrtwendung: „Wenn man nach dem hier gehörten urteilen muss, werdet ihr euch nicht über den Tisch ziehen lassen!“ Applaus, aber aus der Menge rief eine Stimme: „Er führt uns hinters Licht.“ Der beste Beweis der Verwerfung des „Abkommens von Grenelle“: die Zahl der Streikenden stieg noch am 27. Mai auf neun Millionen. Am 9. Mai fand im Sportstadion Charléty in Paris eine große Versammlung statt. Sie wurde von der Studentengewerkschaft UNEF, der CFDT (welche sich radikaler als die CGT gab) und linken Gruppen einberufen. In den Reden wurden revolutionäre Töne geschwungen. Man wollte für die wachsende Unzufriedenheit mit der CGT und der KPF ein Ventil finden. Neben den Vertretern der Extremen Linken waren auch Politiker der Sozialdemokratie wie Mendès-France anwesend (ehemaliger Regierungschef in den 1950er Jahren). Cohn-Bendit, der mit schwarz gefärbten Haaren aus Deutschland zurückgekehrt war, trat auch auf (am Vorabend war er in der Sorbonne erschienen). Der 28. Mai war der Tag der Manöver und Schachzüge der linken Parteien. Am Morgen hielt François Mitterrand, Vorsitzender der « Fédération de la gauche démocrate et socialiste“ (in der die Sozialistische Partei, die Radikale Partei und verschiedene kleine linke Gruppe vertreten waren) eine Pressekonferenz ab. Er meinte, es gebe ein Machtvakuum – deshalb kündigte er seine Kandidatur als Präsident der Republik an. Am Nachmittag schlug Waldeck-Rochet, der Führer der KPF, eine Regierung mit „kommunistischer Beteiligung“ vor. Es ging darum zu vermeiden, dass die Sozialdemokraten die Lage allein zu ihren Gunsten ausnutzten. Am 29. Mai folgte eine große Demonstration, zu welcher die CGT aufrief und in der sie eine „Volksregierung“ forderte. Die Rechten warnten sofort vor einem „kommunistischen Komplott“. An diesem Tag „tauchte“ General de Gaulle ab. Einige brachten das Gerücht in Umlauf, er trete ab; tatsächlich flog er nach Deutschland, um dort die Unterstützung des General Massus, welcher in Deutschland die französischen Besatzungstruppen befehligte, und die Loyalität der Armee sicher zu stellen. Der 30. Mai stellte eine Art entscheidenden Tag dar bei dem Versuch der Bourgeoisie, die Lage wieder in den Griff zu kriegen. De Gaulle hielt erneut eine Rede. „Unter den gegenwärtigen Bedingungen trete ich nicht zurück (…). Ich löse heute die Nationalversammlung auf ...“ Gleichzeitig fand in Paris auf den Champs-Élysées eine gewaltige Demonstration zur Unterstützung de Gaulles statt. Aus den Reichenvierteln, den wohlhabenden Vororten und auch vom Land wurde mit Armeelastern das „Volk“ herangekarrt. Es kamen zusammen die Verängstigten und Besitzenden, die Bürgerlichen, die Vertreter der Religionsschulen für die Kinder der Reichen, die Führungsschichten, die sich ihrer ‚Überlegenheit’ bewusst waren, die kleinen Geschäftsinhaber, die um ihre Schaufenster fürchteten; Kriegsveteranen, die wegen der Angriffe auf die Nationalfahne erbost waren, die Geheimpolizei, die mit der Unterwelt unter einer Decke steckte, aber auch alte Algeriensiedler und die OAS (9), junge Mitglieder der faschistoiden Gruppe Occident, die alten Nostalgiker Vichys (obwohl diese alle de Gaulle verachteten). All diese feinen Leute strömten zusammen, um ihren Hass auf die Arbeiterklasse und ihre ‚Ordnungsliebe’ zu bekunden. Aus der Menge, zu der auch alte Kämpfer des „freien Frankreich“ gehörten, drangen Rufe wie „Cohn-Bendit nach Dachau!“. Aber die „Partei der Ordnung“ beschränkte sich nicht auf die Demonstranten auf den Champs-Elysées. Am gleichen Tag rief die CGT zu branchenmäßigen Verhandlungen zur „Verbesserung der Errungenschaften von Grenelle“ auf. Es handelte sich um ein Mittel zur Spaltung der Bewegung, um sie so vernichten zu können.
Die Wiederaufnahme der Arbeit
on jenem Donnerstag an wurde die Arbeit wieder aufgenommen, allerdings nur langsam, denn am 6. Juni streikten immer noch ca. 6 Millionen Beschäftigte. Die Arbeit wurde in großer Zerstreuung wieder aufgenommen.
31. Mai: Stahlindustrie Lothringens, Textilindustrie Nordfrankreichs,
4. Juni: Arsenale, Versicherungen
5. Juni : Elektrizitätswerke (10), Kohlebergwerke6. Juni : Post, Telekommunikation, Transportwesen (In Paris setzte die CGT Druckmittel zur Wiederaufnahme der Arbeit ein. In jedem Betriebswerk kündigten die Gewerkschaftsführer an, dass in den anderen Depots die Arbeit schon wieder aufgenommen worden sei, was eine Täuschung war.);
7. Juni: Grundschulen
10. Juni: das Renault-Werk in Flins wurde von der Polizei besetzt. Ein von den Polizisten verprügelter Gymnasiast fiel in die Seine und ertrank;
11. Juni: Intervention der CRS (Bürgerkriegspolizei) (11) in den Peugeot-Werken in Sochaux (zweitgrößtes Werk in Frankreich). Zwei Arbeiter wurden getötet. In ganz Frankreich kam es erneut zu gewalttätigen Demonstrationen. „Sie haben unsere Genossen getötet.“ Trotz des entschlossenen Widerstands der Arbeiter räumten die CRS das Sochaux-Werk. Aber die Arbeit wurde erst 10 Tage später wieder aufgenommen. Aus Furcht, dass die Empörung erneut zu einem Wiederaufleben der Streiks führte (immerhin standen noch drei Millionen Beschäftigte im Streik), riefen die Gewerkschaften (mit der CGT an der Spitze) und die Linksparteien (mit der KPF an der Spitze) nachdrücklich zur Wiederaufnahme der Arbeit auf, „damit die Wahlen stattfinden können und der Sieg der Arbeiterklasse vervollständigt werden kann.“ Die Tageszeitung der KPF, l’Humanité, trug die Schlagzeile: „Gestärkt durch ihren Sieg nehmen Millionen Beschäftigte die Arbeit wieder auf.“ Der systematische Streikaufruf durch die Gewerkschaften vom 20. Mai an konnte nun erklärt werden: Sie wollten die Bewegung kontrollieren, damit sie so leichter zur Wiederaufnahme der Arbeit in den weniger kämpferischen Teilen und zur Demoralisierung der anderen Bereiche drängen konnten. Waldeck-Rochet erklärte in seinen Reden während des Wahlkampfes, dass die « Kommunistische Partei eine Partei der Ordnung ist ». In der Tat konnte die bürgerliche „Ordnung“ schrittweise wiederhergestellt werden.
12. Juni: Wiederaufnahme der Arbeit in den Schulen der Sekundarstufe
14. Juni: Air France und Seeschiffahrt16. Juni : Besetzung der Sorbonne durch die Polizei
17. Juni: chaotische Wiederaufnahme der Arbeit bei Renault Billancourt
18. Juni: De Gaulle ließ die Führer der OAS freisetzen, die noch im Gefängnis saßen;
23. Juni: Erster Wahltag der Parlamentswahlen mit großen Stimmengewinnen für die Rechten;
24. Juni: Wiederaufnahme der Arbeit bei Citroën Javel, mitten in Paris (Krasucki, Nummer 2 der CGT, trat vor der Vollversammlung auf und rief zum Streikabbruch auf.)
26. Juni: Usinor Dünkirchen
30. Juni : Stichwahl mit einem historischen Sieg der Rechten. Einer der Betriebe, die als letzte die Arbeit wieder aufnahmen, waren die Radio- und Fernsehanstalten am 12. Juli. Viele Journalisten wollten nicht wieder bevormundet und zensiert werden, wie das vorher so sehr durch die Regierung geschehen ist. Nach der Wiederaufnahme der Arbeit wurden viele von ihnen entlassen. Überall wurde die Ordnung wiederhergestellt, gerade auch bei den Medien, die wichtig waren für die gezielte „Bearbeitung“ der Bevölkerung. So endete der größte Streik der Geschichte im Gegensatz zu den Behauptungen der CGT und der KPF in einer Niederlage. Eine schwere Schlappe, die durch die Rückkehr der Parteien und „Autoritäten“ bekräftigt wurde, welche während der Bewegung die ganze Wut und Verachtung auf sich gezogen hatten. Aber die Arbeiterbewegung weiß schon seit langem: „Das eigentliche Resultat ihrer Kämpfe ist nicht der unmittelbare Erfolg, sondern die immer weiter um sich greifende Vereinigung der Arbeiter“ (Kommunistisches Manifest). Aber ungeachtet ihrer unmittelbaren Niederlage haben die Arbeiter in Frankreich 1968 einen großen Sieg nicht nur für sich selbst, sondern für das ganze Weltproletariat errungen. Dies werden wir in unserem nächsten Artikel aufzeigen, in dem wir versuchen werden, die tiefer liegenden Ursachen wie auch die historische und internationale Dimension dieses „schönen Mai“ in Frankreich herauszustellen.
Die internationale Bedeutung des Streiks im Mai 1968
In den meisten Büchern und Fernsehsendungen, die sich in der letzten Zeit mit dem Thema Mai 1968 befassten, wird der internationale Charakter der Studentenbewegung, welche in Frankreich zu jener Zeit im Gange war, unterstrichen. Es herrscht, wie wir auch in früheren Artikeln festgestellt haben, Einverständnis darüber, dass die Studenten in Frankreich nicht die ersten waren, die massiv auf den Plan traten. Sie waren sozusagen auf den fahrenden Zug aufgesprungen, welcher in den US-amerikanischen Universitäten im Herbst 1964 in Gang gesetzt wurde. Von den USA ausgehend, hatte diese Bewegung die meisten westlichen Ländern erfasst und dabei in Deutschland 1967 seinen spektakulärsten Höhepunkt erlebt, was die Studenten in Deutschland zu einem "Bezugspunkt" für die Studenten Europas machte. Aber die gleichen Journalisten oder „Historiker“, die vorbehaltlos das internationale Ausmaß der Studentenproteste Ende der 1960er Jahre unterstreichen, hüllen sich in allgemeines Schweigen über die Arbeiterkämpfe, die damals weltweit stattfanden. Natürlich können sie den gewaltigen Streik, der den wichtigsten Moment der Ereignisse des Jahres 1968 in Frankreich darstellt, nicht einfach ausblenden und schweigend darüber hinweggehen. Aber wenn sie sich dazu äußern, dann nur, um zu sagen, die Bewegung der Arbeiter sei eine auf Frankreich beschränkte Ausnahmeerscheinung, gewesen.
In Wirklichkeit war die Bewegung der Arbeiterklasse in Frankreich ebenso wie die der Studenten, Teil einer internationalen Bewegung, und sie kann auch nur im internationalen Kontext verstanden werden. Dies wollen wir unter anderem im folgenden Artikel aufzeigen.
Die französische "Besonderheit"
Es stimmt, dass die Lage in Frankreich im Mai 1968 eine besondere war, die in keinem anderen Land in dem Ausmaß vorzufinden war, allenfalls marginal: eine massive Bewegung der Arbeiterklasse, die sich von der Studentenbewegung ausgehend entwickelt hatte. Es ist offensichtlich, dass die Mobilisierung der Studenten, die danach einsetzende Repression – welche Erstere wiederum anfachte – sowie das Zurückweichen der Regierung nach der "Nacht der Barrikaden" vom 10. auf den 11. Mai eine Rolle nicht nur bei der Auslösung der Arbeiterstreiks, sondern auch beim Ausmaß derselben gespielt haben. Aber wenn die Arbeiterklasse in Frankreich solch eine Bewegung ausgelöst hat, dann geschah dies nicht, weil sie "dem Beispiel der Studenten folgen" wollte, sondern weil in ihren eigenen Reihen eine tiefe und weit verbreitete Unzufriedenheit, aber auch die politische Kraft herrschte, um solch einen Kampf aufzunehmen.
Dieser Tatbestand wird in der Regel durch die Bücher und Fernsehprogramme, welche sich mit Mai 68 befassten, nicht verheimlicht. Es wird oft in Erinnerung gerufen, dass die Arbeiter von 1967 an wichtige Kämpfe geführt haben, die sich in vielem von der Zeit davor unterschieden. Während die kleinen, harmlosen Streiks und die gewerkschaftlichen Aktionstage keine große Begeisterung hervorriefen, flammten nunmehr sehr heftige Konflikte auf, mit einer großen Entschlossenheit der Beschäftigten, die mit einer gewaltsamen Repression durch die Arbeitgeber und die Polizei konfrontiert wurden und unter denen die Gewerkschaften mehrfach die Kontrolle verloren hatten. So kam es schon Anfang 1967 zu größeren Zusammenstößen in Bordeaux (im Flugzeugwerk Dassault), in Besançon und in der Gegend von Lyon (Streik und Besetzung in Rhodia, Streik bei Berliet mit anschließender Aussperrung der Arbeiter durch die Arbeitgeber und Besetzung des Werkes durch die Bürgerkriegspolizei CRS), in den Bergwerken Lothringens, in den Schiffswerften von Saint-Nazaire (die am 11. April durch einen Generalstreik lahmgelegt wurden).
In Caen in der Normandie fanden die wichtigsten Kämpfe der Arbeiterklasse vor dem Mai 1968 statt. Am 20. Januar 1968 hatten die Gewerkschaften von Saviem (LKW-Hersteller) zu einem anderthalbstündigen Streik aufgerufen, aber die Gewerkschaftsbasis, die diese Maßnahme als unzureichend betrachtete, trat am 23. Januar spontan in den Streik. Am übernächsten Tag, um 4.00h morgens, griff die CRS die Streikposten an und vertrieb sie, um den Managern und den Streikbrechern den Zugang zur Fabrik zu ermöglichen. Die Streikenden beschlossen, in das Stadtzentrum zu ziehen, wo sich ihnen Arbeiter anderer Betriebe anschlossen, die ebenfalls in den Streik getreten waren. Um acht Uhr morgens bewegten sich ca. 5.000 Menschen friedlich auf das Stadtzentrum zu, bis sie von der Bürgerkriegspolizei (12) brutal angegriffen wurden. So schlugen diese mit ihren Gewehrkolben auf die Demonstranten ein. Am 26. Januar bekundeten Beschäftigte aus allen Bereichen (unter ihnen Lehrer) wie auch viele Studenten ihre Solidarität. An einer Solidaritätsveranstaltung um 18 Uhr auf dem Marktplatz beteiligten sich ca. 7.000 Menschen. Am Ende der Veranstaltung griff die CRS erneut an, um den Platz zu räumen – aber sie wurde vom heftigen Widerstand der Arbeiter überrascht. Die Zusammenstöße dauerten die ganze Nacht. Über 200 Menschen wurden verletzt, Dutzende verhaftet. Sechs junge Demonstranten, alles junge Arbeiter, wurden zu Haftstrafen von 15 Tagen bis zu drei Monaten verurteilt. Aber anstatt die Kampfbereitschaft der Arbeiter zu schwächen und diese zurückzudrängen, bewirkte diese Repression nur die weitere Ausdehnung der Bewegung. Am 30. Januar zählte man ca. 15.000 Streikende in Caen. Am 2. Februar wurden die staatlichen Behörden und die Arbeitgeber zum Rückzug gezwungen. Die Strafverfolgungen gegen die Demonstranten wurden fallengelassen; die Löhne wurden um drei bis vier Prozent angehoben. Am nächsten Tag nahmen die Beschäftigten die Arbeit wieder auf, aber unter dem Druck der jungen Beschäftigten kam es mindestens noch einen Monat lang zu weiteren Arbeitsniederlegungen bei Saviem.
Doch Saint-Nazaire im April 67 und Caen im Januar 68 waren nicht die einzigen von Generalstreiks betroffenen Städte. Auch in anderen, weniger großen Städten wie Redon im März, Honfleur im April kam es zu größeren Streiks. Diese massiven Streiks aller Beschäftigten einer Stadt sollten einen Vorgeschmack von dem liefern, was im Mai im ganzen Land passieren sollte.
Deshalb kann man nicht behaupten, dass das Gewitter des Mai 68 wie ein Blitz aus heiterem Himmel erfolgt war. Die Studentenbewegung hatte etwas angezündet, das längst bereit war zu brennen.
Natürlich haben die "Spezialisten", insbesondere die Soziologen, versucht, die Ursachen dieser "Ausnahme" Frankreich aufzuzeigen. Sie haben vor allem auf die hohen Wachstumszahlen der Industrie in Frankreich während der 1960er Jahre verwiesen, wodurch das alte, landwirtschaftlich geprägte Land zu einem modernen und mächtigen Industriestaat wurde. Diese Tatsache erkläre das Auftreten und die Rolle einer großen Zahl von jungen Arbeitern, die in Fabriken angestellt waren, die oft erst kurz zuvor errichtet worden waren. Diese jungen Arbeiter, die häufig vom Land kamen, seien meistens nicht gewerkschaftlich organisiert gewesen; auch seien sie schlecht mit der Kasernendisziplin in den Betrieben zurechtgekommen, zudem sie trotz ihrer Berufsausbildung meist lächerlich geringe Löhne erhielten.
So lässt sich erklären, warum die jüngsten Mitglieder der Arbeiterklasse als erste den Kampf aufgenommen haben, und auch, warum die meisten wichtigen Bewegungen, die dem Mai 1968 vorhergingen, in Westfrankreich ausgelöst wurden: Diese Region wurde erst relativ spät industrialisiert. Aber die Erklärungen der Soziologen vermögen nicht zu erklären, warum nicht nur die jungen Arbeiter 1968 in Streik getreten sind, sondern die große Mehrheit der ganzen Arbeiterklasse, d.h. quer durch alle Generationen, gestreikt hat.
… und international
Hinter einer solch tiefgreifenden und weitreichenden Bewegung wie die des Mai 68 steckten notwendigerweise tiefergehende Ursachen, die weit über Frankreich hinausreichten. Die gesamte Arbeiterklasse Frankreichs ist damals faktisch in einen Generalstreik getreten, da alle Teile der Arbeiterklasse mittlerweile von der Wirtschaftskrise erfasst worden waren, die 1968 erst in ihrer Anfangsphase steckte. Diese Krise war aber keineswegs auf Frankreich beschränkt, sondern erfasste den Weltkapitalismus insgesamt. Die Auswirkungen dieser weltweiten Wirtschaftkrise in Frankreich (Anstieg der Arbeitslosigkeit, Lohnstopps, Produktivitätserhöhungen, Angriffe auf die Sozialleistungen) liefern die Haupterklärung für den Anstieg der Kampfbereitschaft in Frankreich 1967: „In allen Industriestaaten Europas und in den USA stieg die Arbeitslosigkeit an und die wirtschaftlichen Aussichten verschlechterten sich. England, das trotz einer Vielzahl von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung eines Gleichgewichts Ende 1967 dazu gezwungen war, das Pfund abzuwerten, löste eine Reihe von Abwertungen vieler anderer Währungen aus. Die Regierung Wilson kündigte ein außergewöhnliches Sparprogramm an: massive Kürzung der Staatsausgaben (...), Lohnstopps, Einschränkung der Binnennachfrage und der Importe, besondere Anstrengungen zur Ankurbelung der Exporte. Am 1. Januar 1968 schrie Johnson [der damalige US-Präsident] Alarm und kündigte unumgängliche harte Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des wirtschaftlichen Gleichgewichts an. Im März brach die Dollarkrise aus. Die Tag für Tag pessimistischere Wirtschaftspresse erwähnte immer öfter das Gespenst der Wirtschaftskrise von 1929 […] Die ganze Bedeutung des Mai 1968 lag darin, eine der ersten und größten Reaktionen der Arbeiter gegen eine sich weltweit verschlechternde wirtschaftliche Lage gewesen zu sein“ (Révolution Internationale - alte Reihe, Nr. 2, Frühjahr 1969).
Tatsächlich haben besondere Umstände dazu geführt, dass der erste große Kampf der Arbeiterklasse gegen die Angriffe der Kapitalisten, die später an Schärfe noch zunehmen sollten, in Frankreich ausgefochten wurde. Doch sehr schnell traten auch Arbeiter anderer Länder in den Kampf. Den gleichen Ursachen folgten die gleichen Wirkungen.
Am anderen Ende der Welt, in Cordoba (Argentinien), kam es im Mai 1969 zu dem, was später als „Cordobazo“ in die Geschichte eingehen sollte. Nach einer ganzen Reihe von Arbeitermobilisierungen in vielen Städten gegen die brutalen wirtschaftlichen Sparmaßnahmen und die Repression durch das Militärregime hatten Polizei und Armee am 29. Mai die Kontrolle verloren, obwohl Letztere sogar Panzer aufgeboten hatte. Die Arbeiter hatten die zweitgrößte Stadt des Landes übernommen. Die Regierung konnte die „Ordnung“ am folgenden Tag nur dank des massiven Einsatzes des Militärs wiederherstellen.
In Italien begannen zum gleichen Zeitpunkt die größten Arbeiterkämpfe seit dem II. Weltkrieg. Bei Fiat in Turin legten mehr und mehr Arbeiter die Arbeit nieder, zunächst im größten Werk der Stadt, bei Fiat-Mirafiori, ehe die Bewegung dann die anderen Werke in Turin und Umgebung erreichte. Während eines gewerkschaftlichen Aktionstages am 3. Juli 1969 gegen die Mietpreiserhöhungen zogen demonstrierende Arbeiter, denen sich Studenten anschlossen, zum Mirafiori-Werk. Die Polizei griff daraufhin die Demonstrierenden gewalttätig an. Die gewaltsamen Auseinandersetzungen hielten die ganze Nacht an und dehnten sich auf andere Stadtviertel aus.
Ab Ende August, als die Arbeiter aus ihrem Sommerurlaub zurückkehrten, kam es erneut zu Arbeitsniederlegungen – dieses Mal jedoch auch bei Pirelli (Reifenhersteller) in Mailand und in vielen anderen Betrieben.
Doch die italienische Bourgeoisie, die aus der Erfahrung des Mai 68 gelernt hatte, ließ sich im Gegensatz zu der französischen Bourgeoisie nicht überraschen. Sie versuchte mit aller Macht zu verhindern, dass die spürbare, starke gesellschaftliche Unzufriedenheit zu einem gesellschaftlichen Flächenbrand ausuferte. Deshalb versuchte der zu ihren Diensten stehende Gewerkschaftsapparat, die anstehenden Tarifverhandlungen, insbesondere in der Metallindustrie, in der Chemiebranche und im Baugewerbe, auszunutzen, um Spaltungsmanöver durchzuführen, mit denen die Arbeiter dazu veranlasst werden sollten, für „gute Abschlüsse“ in ihrer jeweiligen Branche zu kämpfen. Die Gewerkschaften verfeinerten die Taktik der „Schwerpunktstreiks“: An einem Tag streikten die Metaller, an einem anderen die Beschäftigten der chemischen Industrie, an einem dritten die des Baugewerbes. Man rief auch zu „Generalstreiks“ auf, aber diese sollten jeweils auf eine Provinz oder eine Stadt beschränkt bleiben. Sie richteten sich gegen die Preiserhöhungen oder Mietpreissteigerungen. In den Betrieben selbst plädierten die Gewerkschaften für rotierende Streiks; eine Abteilung nach der anderen sollte die Arbeit niederlegen. Dies geschah unter dem Vorwand, so dem Arbeitgeber den größtmöglichen Schaden zuzufügen und für die Streikenden den Schaden so gering wie möglich zu halten. Gleichzeitig unternahmen die Gewerkschaften alles, um die Kontrolle über eine Basis wiederherzustellen, die ihnen immer mehr entglitt. Nachdem die Arbeiter in vielen Betrieben aus Unzufriedenheit mit den traditionellen Gewerkschaftsstrukturen Vertrauensleute wählten, wurden diese postwendend als „Fabrikräte“ institutionalisiert, die die „Basisorgane“ der Einheitsgewerkschaft sein sollten, welche die drei Gewerkschaftsverbände CGIL, CISL und UIL gemeinsam gründen wollten.
Nach mehreren Monaten, während derer die Kampfbereitschaft durch eine Reihe von „Aktionstagen“ erschöpft wurde, die jeweils voneinander abgeschottet in verschiedenen Branchen und Städten stattfanden, wurden zwischen Anfang November und Ende Dezember die Tarifverträge Zug um Zug unterzeichnet. Und schließlich explodierte am 12. Dezember - wenige Tage vor dem Abschluss des Tarifvertrages in der bedeutendsten Branche, der privaten Metallindustrie, wo die Arbeiter am radikalsten gekämpft hatten - eine Bombe in einer Mailänder Bank. Dabei kamen 16 Menschen ums Leben. Das Attentat wurde Anarchisten in die Schuhe geschoben (einer von ihnen, Giuseppe Pinelli, starb in den Händen der Mailänder Polizei), aber viel später stellte sich heraus, dass das Attentat von gewissen Kreisen des Staatsapparates angezettelt worden war. Die geheimen Strukturen des bürgerlichen Staates leisteten so den Gewerkschaften Hilfestellung, um für Verwirrung in den Reihen der Arbeiter zu sorgen, während gleichzeitig ein Vorwand für die Verstärkung des Repressionsapparates gefunden worden war.
Das Proletariat Italiens war jedoch nicht das einzige, das sich im Herbst 1969 regte. In geringerem Maße traten auch die Arbeiter in Deutschland auf den Plan; im September 1969 kam es zu wilden Streiks gegen die von den Gewerkschaften unterzeichneten Tarifabschlüsse der Lohndämpfung. Diese Tarifabschlüsse wurden von den Gewerkschaften in Anbetracht der Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in Deutschland als „realistisch“ gelobt. Die Wirtschaft in Deutschland war trotz des Wirtschaftswunders von den zunehmenden Schwierigkeiten der Weltwirtschaft seit 1967 nicht verschont geblieben – 1967 rutschte Deutschland zum ersten Mal seit dem II. Weltkrieg in die Rezession ab.
Auch wenn dieses Wiedererwachen der Arbeiterklasse in Deutschland noch sehr verhalten war, kam diesem eine besondere Bedeutung zu. Auf der einen Seite handelt es sich um den zahlenmäßig größten und konzentriertesten Teil der Arbeiterklasse in Europa. Aber vor allem hat die Arbeiterklasse in Deutschland in der Geschichte eine herausragende Stellung innerhalb der Weltarbeiterklasse eingenommen – und diesen Platz wird sie auch in Zukunft einnehmen. In Deutschland war der Ausgang der internationalen revolutionären Welle von Kämpfen, die von Oktober 1917 in Russland an die kapitalistische Herrschaft auf der ganzen Welt bedroht hatte, infragestellt worden. Die von den Arbeitern in Deutschland erlittene Niederlage nach ihrem revolutionären Ansturm zwischen 1918-1923 hatte der schrecklichsten Konterrevolution, die die Weltarbeiterklasse jemals erlebt hatte, den Weg bereitet. Dort, wo die Revolution am weitesten gediehen war, in Deutschland und Russland, hatte die Konterrevolution die schlimmsten und barbarischsten Formen angenommen: Stalinismus und Naziherrschaft. Diese Konterrevolution hatte fast ein halbes Jahrhundert gedauert und erlebte ihren Gipfelpunkt im II. Weltkrieg, der es im Gegensatz zum I. Weltkrieg dem Proletariat nicht ermöglicht hatte, sein Haupt zu erheben, sondern seine Niederlage nur verschärft hatte, insbesondere durch die durch den Sieg der „Demokratie“ und des „Sozialismus“ entstandenen Illusionen.
Die gewaltigen Streiks des Mai 1968 in Frankreich, schließlich der „Heiße Herbst“ in Italien hatten den Beweis erbracht, dass die Weltarbeiterklasse die Zeit der Konterrevolution überwunden hatte, und dass im Gegensatz zur Krise von 1929 die nun mehr neu einsetzende Krise nicht zu einem neuen Weltkrieg führen sollte, sondern zu einer Intensivierung der Klassenkämpfe, welche die herrschende Klasse daran hinderten, ihre barbarische Lösung für die Erschütterungen ihrer Wirtschaft durchzusetzen. Die Kämpfe der Arbeiter in Deutschland im September 1969 bestätigten dies später, und in einem noch größeren Maße taten dies auch die Kämpfe der polnischen Arbeiter aus den Ostseestädten im Winter 1970-71.
Im Dezember 1970 reagierte die Arbeiterklasse in Polen spontan und massiv auf eine Erhöhung der Preise von mehr als 30%. Die Arbeiter zerstörten den Sitz der stalinistischen Partei in Gdansk, Gdynia und Elblag. Die Streikbewegung dehnte sich von der Ostseeküste auf Poznan, Katowice, Wroclaw und Krakov aus. Am 17. Dezember schickte Gomulka, der Generalsekretär der an der Macht befindlichen stalinistischen Partei, seine Panzer an die Ostküste. Mehrere Hundert Arbeiter wurden getötet. Straßenkämpfe fanden in Szczecin und Gdansk statt. Die Bewegung konnte aber nicht durch Repression unterdrückt werden. Am 21. Dezember brach eine Streikwelle in Warschau aus. Gomulka musste abtreten. Sein Nachfolger, Gierek, verhandelte sofort persönlich mit den Werftarbeitern von Szczecin. Gierek machte einige Konzessionen, aber weigerte sich die Preiserhöhungen zurückzunehmen. Am 11. Februar brach ein Massenstreik in Lodz aus. Gierek musste schließlich nachgeben: die Preiserhöhungen wurden gestrichen. Die stalinistischen Regimes waren die schlimmste Verkörperung der Konterrevolution gewesen. Im Namen des „Sozialismus“ und im „Interesses der Arbeiterklasse“ wurde die schrecklichste Terrorherrschaft gegen die Arbeiter ausgeübt. Der „heiße“ Winter der polnischen Arbeiter 1970-71 sowie auch die Streiks, die nach Bekanntwerden der Kämpfe in Polen auf der anderen Seite der Grenze ausbrachen, insbesondere in Lwow (Ukraine) und Kaliningrad bewiesen , dass selbst dort, wo die Konterrevolution in Gestalt der „sozialistischen“ Regimes immer noch das Zepter in der Hand hielt, ein Durchbruch erzielt worden war.
Wir können an dieser Stelle nicht alle Arbeiterkämpfe aufzählen, die nach 1968 stattgefunden haben und diese grundlegende Umwälzung des Kräfteverhältnisses zwischen den beiden Klassen Bourgeoisie und Proletariat auf Weltebene bewirkt haben. Wir wollen stellvertretend nur zwei Beispiele erwähnen: Spanien und England.
Trotz einer wütenden Repression, die vom Franco-Regime ausgeübt wurde, hielt die Kampfbereitschaft der Arbeiter noch bis 1974 massiv an. In Pamplona, Navarra, überstieg die Zahl der Streiktage pro Arbeiter noch die der französischen Arbeiter 1968. Alle Industriegebiete (Madrid, Asturien, Baskenland) wurden erfasst. In den großen Arbeiterzusammenballungen der Vororte von Barcelona dehnten sich die Streiks am weitesten aus. Fast alle Betriebe der Region wurden bestreikt. Es kam zu exemplarischen Solidaritätsstreiks (oft begannen Streiks in einem Werk ausschließlich aus Solidarität mit den Beschäftigten anderer Betriebe).
Das Beispiel des englischen Proletariats ist ebenfalls sehr aufschlussreich, denn hier handelte es sich um das älteste Proletariat der Welt. Während der 1970er Jahre fanden dort massive Kämpfe gegen die Ausbeutung statt (1979 wurden mehr als 29 Millionen Streiktage registriert, die englischen Arbeiter standen in der Streikstatistik an zweiter Stelle hinter den französischen Arbeitern mit ihren Streiks 1968). Diese Kampfbereitschaft zwang die englische Bourgeoisie zweimal dazu, sogar ihren Premierminister auszutauschen: Im April 1976 wurde Callaghan durch Wilson ersetzt, und Anfang 1979 wurde Callaghan durch das Parlament abgesetzt.
So liegt die grundlegende historische Bedeutung des Mai 68 weder in den „französischen Besonderheiten“ noch in der Studentenrevolte, ebensowenig in der heute so viel gepriesenen ‚Revolution der Sitten?’, sondern darin, dass die Weltarbeiterklasse die Konterrevolution überwunden hatte und in einen neuen historischen Zeitraum von Zusammenstößen mit der kapitalistischen Ordnung eingetreten war. Diese neue Periode zeichnet sich ebenso dadurch aus, dass sich politisch-proletarische Strömungen, welche von der Konterrevolution praktisch eliminiert oder zum Schweigen gebracht worden waren, neu entwickelt haben, darunter die IKS. Darauf werden wir in einem weiteren Artikel eingehen.
Das internationale Wiederauftauchen revolutionärer Kräfte
Die Schäden der Konterrevolution in den Reihen der Kommunisten
Anfang des 20. Jahrhunderts führte das Proletariat während und nach dem 1. Weltkrieg gigantische Kämpfe, in denen der Kapitalismus beinahe überwunden worden wäre. 1917 wurde die bürgerliche Macht in Russland gestürzt. Zwischen 1918-1923 gab es in dem wichtigsten Land Europas, in Deutschland, mehrere Anläufe zur Überwindung des Kapitalismus. Diese revolutionäre Welle fand in allen Winkeln der Erde ihren Widerhall, d.h. überall wo es eine entwickelte Arbeiterklasse gab, von Italien bis Kanada, von Ungarn bis China.
Aber der Weltbourgeoisie gelang es, diese gigantische Bewegung der Arbeiterklasse einzudämmen, und sie blieb nicht dabei stehen. Sie brach die schrecklichste Konterrevolution in der Geschichte der Arbeiterbewegung vom Zaun. Diese Konterrevolution entwickelte sich in Gestalt einer unvorstellbaren Barbarei, deren bedeutendsten Ausdrücke der Stalinismus und Nationalsozialismus waren. Diese wüteten besonders stark dort, wo die Revolution am weitesten gegangen war, nämlich in Russland und in Deutschland.
In diesem Zusammenhang verwandelten sich die kommunistischen Parteien, welche in der revolutionären Welle von Kämpfen an der Spitze gestanden hatten, zu Parteien der Konterrevolution.
Der Verrat der kommunistischen Parteien löste in ihren Reihen die Entstehung von linkskommunistischen Fraktionen aus, welche wirklich revolutionäre Positionen weiter verteidigen wollten Ein ähnlicher Prozesses hatte schon innerhalb der sozialistischen Parteien stattgefunden, als diese 1914 aufgrund ihrer Unterstützung des imperialistischen Krieges ins bürgerliche Lager übergewechselt waren. Aber während diejenigen, welche innerhalb der sozialistischen Parteien gegen deren opportunistisches Abgleiten und deren Verrat ankämpften, an Stärke und Einfluss in der Arbeiterklasse gewannen, so dass sie nach der Russischen Revolution sogar eine neue Internationale gründen konnten, verlief die Entwicklung der linken Strömungen, die aus den kommunistischen Parteien hervorgingen, aufgrund des zunehmenden Gewichtes der Konterrevolution anders. Während sie anfänglich eine Mehrheit der Mitglieder in den Parteien in Deutschland und Italien umfassten, verloren diese Strömungen schrittweise ihren Einfluss in der Arbeiterklasse und den größten Teil ihrer Mitglieder. Oder sie gingen unter durch eine Zersplitterung in eine Reihe von kleinen Gruppen, wie in Deutschland, noch bevor das Hitler-Regime die letzten Militanten auslöschte oder sie ins Exil zwang.
Während der 1930er Jahre zählten neben der Strömung um Trotzki, welche immer mehr vom Opportunismus zerfressen wurde, die Gruppen, welche die revolutionären Positionen weiterhin entschlossen verteidigten wie die Gruppe Internationaler Kommunisten (GIK) in Holland (die sich auf den "Rätekommunismus" berief und die Notwendigkeit einer proletarischen Partei verwarf) und die Linksfraktion der Kommunistischen Partei Italiens (welche die Zeitschrift Bilan veröffentlichte) nur einige wenige Dutzend Mitglieder. Diese konnten keinen Einfluss auf die Arbeiterkämpfe ausüben.
Im Gegensatz zum 1. Weltkrieg hat der 2. Weltkrieg keine Umkehrung des Kräfteverhältnisses zwischen Proletariat und Bourgeoisie ermöglicht. Ganz im Gegenteil. Durch die historische Erfahrung klüger geworden und dank der wertvollen Unterstützung der stalinistischen Parteien setzte die Bourgeoisie alles daran, jegliche neue Regungen der Arbeiterklasse im Keim zu ersticken. In der demokratischen Euphorie der "Befreiung" standen die Gruppen der Kommunistischen Linken noch isolierter da als in den 1930er Jahren. In Holland löste der Communistenbond Spartacus den GIC bei der Verteidigung rätistischer Positionen ab. Diese wurden ebenfalls ab 1965 von der Gruppe Daad en Gedachte, einer Abspaltung vom Bond, vertreten. Diese beiden Gruppen veröffentlichten viele Texte, obwohl sie durch ihre rätekommunistische Position behindert waren, welche die Rolle einer Avantgardeorganisation für die Arbeiterklasse verwarf. Aber das größte Hindernis war das ideologische Gewicht der Konterrevolution. Dies traf auch auf Italien zu, wo die Bildung der Partito Comunista Internazionalista (die Battaglia Comunista und Prometeo veröffentlichte) im Jahre 1945 um Damen und Bordiga die Versprechen nicht hielt, welche ihre Mitglieder sich erhofft hatten. Während diese Organisation bei ihrer Gründung über ca. 3.000 Mitglieder verfügte, wurde sie infolge von Demoralisierung und Spaltungen – insbesondere nach der von Bordiga betriebenen Spaltung 1952, die zur Bildung der Parti Communiste International führte (sie veröffentlichte Programma Comunista), immer mehr geschwächt. Einer der Gründe für die Spaltungen und Schwächung liegt in der Aufgabe einer ganzen Reihe von Errungenschaften, die von Bilan in den 1930er Jahren erzielt worden waren.
In Frankreich verschwand 1952 die Gruppe Gauche Communiste de France (GCF), die 1945 gebildet worden war, und welche die Kontinuität mit den Positionen Bilan's (bei gleichzeitiger Integration programmatischer Positionen der Deutsch-Holländischen Linken) darstellte und 42 Ausgaben ihrer Zeitschrift Internationalisme herausbrachte. Abgesehen von den Leuten, die der Parti Communiste International verbunden waren und Le Prolétaire veröffentlichten, vertrat eine andere Gruppe bis Anfang der 1960er Jahre Klassenpositionen in der Zeitschrift Socialisme ou Barbarie (SouB). Aber diese aus dem Trotzkismus hervorgegangene Abspaltung nach dem 2. Weltkrieg gab schrittweise und ausdrücklich den Marxismus auf. Infolgedessen verschwand die Gruppe 1966.
Ende der 1950er und Anfang der 1960er Jahre hatten mehrere Spaltungen von Socialisme ou Barbarie insbesondere gegenüber der Frage des Marxismus zur Bildung von kleinen Gruppen geführt, welche sich der rätistischen Bewegung anschlossen, insbesondere gehörte dazu ICO (Informations et Correspondances Ouvrières).
Man könnte nach andere Gruppen in anderen Ländern erwähnen, aber kennzeichnend für die Lage der damaligen Strömungen, die in den 1950er und Anfang der 1960er Jahren kommunistische Positionen vertreten haben, war ihre große zahlenmäßige Schwäche. Ihre Publikationen zirkulierten eher in eingeweihten Kreisen, sie waren international isoliert. Darüber hinaus gab es theoretisch-programmatische Rückschritte, die entweder einfach zu ihrem Verschwinden oder zu einer sektenhaften Entwicklung geführt haben, wie das insbesondere bei der Parti Communiste International der Fall war, die sich als die einzige kommunistische Organisation auf der Welt betrachtete.
Das Wiedererstarken der revolutionären Positionen
Der Generalstreik 1968 in Frankreich, schließlich die verschiedenen massiven Bewegungen der Arbeiterklasse, über die wir im vorherigen Artikel berichtet haben, haben erneut die Idee der kommunistischen Revolution in zahlreichen Ländern auf die Tagesordnung gestellt. Die Lügen des Stalinismus, der sich als "kommunistisch" und "revolutionär" darstellte, zerbrachen überall. Daraus schlugen natürlich die Strömungen Kapital, die die UdSSR als "Mutterland des Sozialismus" bezeichneten, wie die maoistischen oder trotzkistischen Organisationen. 1968 erlebte die trotzkistische Bewegung, die sich auf ihren Kampf gegen Stalinismus berief, eine Art Neugeburt. Sie konnte damals aus dem Schatten der stalinistischen Parteien treten, der lange auf ihnen gelegen hatte. Ihr Wachstum war teilweise spektakulär, insbesondere in Frankreich, Belgien oder Großbritannien. Aber seit dem 2. Weltkrieg gehörte diese Strömung dem proletarischen Lager nicht mehr an, insbesondere weil sie "die Arbeitererrungenschaften der UdSSR" verteidigt hatte, d.h. sie hatte das von der UdSSR beherrschte imperialistische Lager verteidigt. Nachdem die Arbeiterstreiks, die sich seit Ende der 1960er Jahre entfalteten, die arbeiterfeindliche Rolle der stalinistischen Parteien und Gewerkschaften, der wahren Rolle der Wahlen und der Demokratie als Herrschaftsinstrument der Bourgeoisie offenbart hatten, wurden viele Leute dazu bewogen, sich mit politischen Strömungen zu befassen, die in der Vergangenheit die Rolle der Gewerkschaften und des Parlamentarismus am deutlichsten entblößt hatten und den Kampf gegen den Stalinismus am klarsten verkörperten – die Kommunistische Linke.
Nach Mai 1968 wurden die Schriften Trotzkis sehr weit verbreitet, aber auch die Pannekoek's, Gorter's (13) , Rosa Luxemburgs, die als eine der Ersten kurz vor ihrer Ermordung im Januar 1919 die bolschewistischen Genossen vor gewissen Gefahren gewarnt hatten, die die Revolution in Russland bedrohten.
Neue Gruppen sind in Erscheinung getreten, die sich mit der Erfahrung der Kommunistischen Linken befassten. Diejenigen, die verstanden, dass der Trotzkismus eine Art linker Flügel des Stalinismus geworden war, wandten sich eher dem Rätismus zu als der Italienischen Linken. Dafür gab es mehrere Gründe. Die Verwerfung der stalinistischen Parteien ist oft mit der Verwerfung des Begriffs der kommunistischen Partei selbst verbunden. Dies war gewissermaßen der Preis, den die Neuen, welche sich der proletarischen Revolution zuwandten, der stalinistischen Lüge von der Kontinuität zwischen Bolschewismus und Stalinismus, zwischen Lenin und Stalin, zu zahlen hatten Diese falsche Idee wurde im Übrigen zum Teil durch die Positionen der bordigistischen Strömung mit verbreitet. Sie war die einzige Strömung, die aus der Italienischen Linken hervorgegangen war, welche sich international ein wenig ausbreiten konnte, und sich auf den "Monolithismus" in ihren Reihen berief. Andererseits war dies eine Folge der Tatsache, dass die Strömungen, welche sich weiterhin auf diese Gruppierung beriefen, im Wesentlichen die Ereignisse des Mai 1968 nicht verstanden und sie verpasst haben, weil sie hinter ihnen nur einen Studentenprotest sahen und nicht die tiefer dahinter liegende historische Bedeutung.
Während gleichzeitig neue, vom Rätismus inspirierte Gruppen auftauchten, verbuchten die schon früher bestehenden Gruppen große Erfolge. Ihre Mitgliederzahlen nahmen spektakulär zu, während sie gleichzeitig zu einem politischen Bezugspunkt wurden. Dies traf insbesondere auf die Gruppe Informations et Correspondance Ouvrières (ICO= Arbeiterkorrespondenz und –informationen) zu, die aus einer Abspaltung von SouB 1958 hervorgegangen war, und die 1969 ein internationales Treffen in Brüssel organisierte, an der sich insbesondere Cohn-Bendit, Mattick (ein ehemaliges Mitglied der Deutschen Linken beteiligte, welcher in die USA ausgewandert war und dort verschiedene rätistische Zeitschriften veröffentlichte) und Cajo Brendel, Haupttriebkraft von Daad en Gedachte. Aber die Erfolge des "organisierten" Rätismus waren nur von kurzer Dauer. Die Gruppe ICO löste sich 1974 auf. Die holländischen Gruppen fielen zusammen, nachdem ihre Haupttriebkräfte ihre Aktivitäten einstellten
In Großbritannien fiel die Gruppe Solidarity, die von den Positionen von Socialisme ou Barbarie inspiriert wurde, und einen ähnlichen Erfolg wie ICO hatte, nach einer Reihe von Spaltungen 1981 auseinander (obwohl ihre Londoner Sektion die Zeitschrift noch bis 1992 veröffentlichte). In Skandinavien haben die rätistischen Gruppen, die sich nach 1968 entwickelt haben, eine Konferenz im September 1977 in Oslo organisiert – aber dieser folgten keine weiteren Schritte.
Letztendlich hat sich die Strömung in den 1970er Jahren am weitesten entwickelt, die mit den Positionen von Bordiga (der im Juli 1970 starb) verbunden ist. Ihre Mitgliedschaft stieg damals insbesondere nach dem Ausbruch von Krisen bei linksextremen Gruppen (insbesondere bei maoistischen Gruppen). 1980 war die Internationale Kommunistische Partei die Organisation, welche sich auf die Kommunistische Linke berief, mit dem größten Einfluss auf internationaler Ebene. Aber diese "Öffnung" der bordigistischen Strömung für Leute, die sehr stark von der extremen Linken geprägt waren, führte 1982 zu ihrem Zusammenbruch. Seitdem besteht sie weiter als eine Reihe von kleinen, auf sich beschränkten Sekten.
Der Anfang der IKS
Der bedeutendste langfristige Ausdruck dieses wieder erwachten Interesses an den Positionen der Kommunistischen Linken war unsere eigene Organisation (14). Diese wurde im Wesentlichen vor gerade 40 Jahren gegründet, im Juli 1968 in Toulouse, als ein kleiner Kern von Leuten, der ein Jahr zuvor einen Diskussionskreis um einen Genossen R.V. gegründet hatte, eine erste Prinzipienerklärung verabschiedete. Dieser Genosse R.V. hatte seine ersten politischen Erfahrungen in der Gruppe Internacionalismo in Venezuela gesammelt. Diese Gruppe war 1964 von dem Genossen MC gegründet worden, der die Haupttriebkraft bei der Gauche Communiste de France (Kommunistische Linke Frankreichs – GCF – 1944 52) gewesen war, nachdem er zuvor von 1938 an der Italienischen Fraktion der Kommunistischen Linken angehört hatte, und der schon seit 1919 Militant gewesen war (im Alter von 12 Jahren). Zunächst war er in der Kommunistischen Partei Palästinas, dann in der Französischen Kommunistischen Partei aktiv gewesen. Während des Generalstreiks im Mai 1968 hatten Mitglieder des Diskussionszirkels mehrere Flugblätter mit dem Namen "Bewegung für den Aufbau von Arbeiterräten" (MICO) verteilt. Sie hatten mit anderen Leuten diskutiert, bevor sie dann im Dezember 1968 die Gruppe Révolution Internationale gründeten. Diese Gruppe hatte Kontakt aufgenommen mit zwei anderen Gruppen, die der rätekommunistischen Bewegung angehörten – Rätekommunistische Organisation Clermont-Ferrand und "Rätekommunistische Hefte", die in Marseille ansässig war. Mit diesen beiden Gruppen wurden dann weitere Diskussionen geführt.
Schließlich schlossen sich diese drei Gruppen 1972 zusammen, um die spätere Sektion der IKS in Frankreich, Révolution Internationale, zu gründen, welche dann mit der Veröffentlichung der Zeitschrift mit dem gleichen Namen (neue Serie) begann. In Fortsetzung der Politik von Internacionalismo, der GCF und Bilan's, nahm Révolution Internationale Diskussionen mit verschiedenen Gruppen auf, die ebenfalls nach 1968 aufgetaucht waren, insbesondere in den USA (Internationalism). 1972 schickte Internationalism ein Schreiben an ca. 20 Gruppen, die sich auf die Kommunistische Linke beriefen, und rief zur Schaffung eines Netzes zum Austausch und der internationalen Debatte auf. Révolution Internationale reagierte darauf sehr positiv, und schlug dabei als Arbeitsperspektive die Organisierung einer internationalen Konferenz vor. Die anderen Gruppen, welche positiv reagierten, gehörten alle der rätekommunistischen Bewegung an. Die Gruppen, welche sich an die Italienische Linke anlehnten, stellten sich entweder taub oder hielten diese Initiative für verfrüht. Auf der Grundlage dieser Initiative fanden zwischen 1973 und 1974 mehrere Treffen in England und Frankreich statt, an denen sich insbesondere aus Großbritannien (World Revolution, Revolutionary Perspectives und Workers' Voice) beteiligten, die ersten beiden Gruppen waren aus einer Abspaltung von Solidarity hervorgegangen und die letzte aus einer Abspaltung von den Trotzkisten).
Schließlich führte dieser Zyklus von Treffen im Januar 1975 zu einer Konferenz, bei der die Gruppen, welche die gleiche politische Orientierung teilten - Internacionalismo, Révolution Internationale, Internationalism, World Revolution, Rivoluzione Internazionale (Italien) und Accion Proletaria (Spanien) beschlossen, sich zur Internationalen Kommunistischen Strömung zusammenzuschließen.
Die IKS beschloss dann die Fortsetzung der Politik der Kontaktaufnahme und Diskussionen mit anderen Gruppen der Kommunistischen Linken. So nahm die IKS an den Konferenzen in Oslo 1977 (mit Revolutionary Perspectives) teil und antwortete positiv auf die 1976 von Battaglia Comunista vorgeschlagene Initiative zur Abhaltung einer internationalen Konferenz von Gruppen der Kommunistischen Linken.
Die drei danach stattgefundenen Konferenzen – 1977 in Mailand, 1978 in Paris, 1980 in Paris – stießen auf ein wachsendes Interesse unter den Leuten, die sich auf die Kommunistische Linke beriefen, aber die Entscheidung Battaglia Comunista's und der Communist Workers' Organisation (die aus einem Zusammenschluss von Revolutionary Perspectives und Workers' Voice in Großbritannien hervorgegangen war), die IKS aus dem Diskussionsprozess auszuschließen, bedeutete dann auch das Ende der Konferenzen (15) . Der sektiererische Rückzug (zumindest die Abgrenzung gegenüber der IKS) von Battaglia Comunista und der Communist Workers’ Organisation (die sich 1984 im Internationalen Büro für die Revolutionäre Partei – IBRP zusammenschlossen) zeigte, dass die Initialzündung durch das historische Wiederauftauchen der Arbeiterklasse im Mai 1968, die zur Bildung der Kommunistischen Linken geführt hatte, nun zu Ende gekommen war.
Aber trotz der Schwierigkeiten, auf die die Arbeiterklasse während der letzten Jahrzehnte gestoßen ist, insbesondere aufgrund der ideologischen Kampagnen über den "Tod des Kommunismus" nach dem Zusammenbruch der stalinistischen Regime, hat es die Weltbourgeoisie nicht geschafft, der Arbeiterklasse eine entscheidende Niederlage beizufügen. Dies kommt durch die Tatsache zum Ausdruck, dass die Kommunistische Linke (die hauptsächlich durch das IBRP (16) und vor allem die IKS verkörpert wird) ihre Positionen aufrechterhalten hat und heute auf ein wachsendes Interesse bei den Leuten stößt, die infolge des langsamen Wiedererstarkens des Klassenkampfes seit 2003 nach einer revolutionären Perspektive suchen.
Fabienne, 6. Juli 2008
(1) Kommunistische Partei Frankreichs
(2) CGT=Confédération générale du Travail: Sie ist die stärkste Gewerkschaftszentrale, insbesondere im Industriebereich, im Transportwesen und unter den Beamten. Sie wird von der KPF kontrolliert.
(3) Confédération francaise démocratique du Travail. Dieser Gewerkschaftsverband ist christlichen Ursprungs aber Anfang der 1960er Jahre verwarf sie ihren Bezug auf das Christentum und sie wurde seitdem stark von der Sozialistischen Partei beeinflusst sowie von einer kleinen sozialistischen Partei (PSU) , die seitdem eingegangen ist.
(4) Fernsehberichterstatter, der sehr auf „Ausgleich“ bedacht war
(5) Sportkommentator mit zügellosem Chauvinismus
(6) Am Morgen nach der Rede weigerten sich die Beschäftigten der Kommunalbetriebe an vielen Orten, das Referendum zu organisieren. Auch wussten die Behörden nicht, wo sie die Stimmzettel drucken sollten. Die staatliche Druckerei wurde bestreikt und die nicht streikenden privaten Druckereien verweigerten die Annahme des Auftrags. Ihre Arbeitgeber wollte keine zusätzlichen Scherereien mit ihren Arbeitern haben
(7) Georges Séguy war ebenso Mitglied des Politbüros der KPF.
(8) Man erfuhr später, dass Chirac, Staatssekretär im Sozialministerium ebenso Krasucki (auf einem Speicher) getroffen hat. Dieser war damals die Nummer 2 der CGT.
(9) Eine geheime bewaffnete Organisation: eine geheime Militär- und Partisanenorganisation, die für den Verbleib Frankreichs in Algerien kämpfen wollte. Anfang der 1960er Jahre verübte sie terroristische Attentate und sie versuchte gar de Gaulle umzubringen.
(10) Electricité de France
(11) CRS=Compagnies républicaines de Sécurité: nationale Polizeikräfte, spezialisiert auf die Niederschlagung von Straßendemonstrationen.
(12) Kräfte der Nationalgendarmerie (d.h. der Armee), die die gleiche Rolle wie die CRS haben
(13) Die beiden Haupttheoretiker der Holländischen Linken
(14) Eine umfassendere Darstellung der Geschichte der IKS findet man in "Aufbau der revolutionären Organisation: 20 Jahre IKS – Internationale Revue Nr. 16 – und "30 Jahre IKS: Von Vergangenheit für die Zukunft lernen" -Internationale Revue Nr. 37
(15) Zu den Konferenzen siehe unseren Artikel: „Die internationalen Konferenzen der Kommunistischen Linken (1976-1980) – Lehren einer Erfahrung für das proletarische Milieu“ – Internationale Revue Nr.38
(16) Jegliche Entwicklung des IBRPs im Vergleich zur IKS ist hauptsächlich auf ihr Sektierertum sowie seine opportunistische Umgruppierungspolitik zurückzuführen (wodurch sie oft schon auf Sand gebaut hat). Siehe dazu unseren Artikel „Eine opportunistische Politik der Umgruppierung führt lediglich zu „Fehlgeburtern“, Internationale Revue Nr. 36))
Aktuelles und Laufendes:
- Mai 68 [18]
- Arbeiterkämpfe 1968 [22]
- Studentenrevolte Mai 68 [23]
Politische Strömungen und Verweise:
- Trotzkismus [24]
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Historische Ereignisse:
- Mai 68 [20]
- Arbeiterkämpfe 1968 [25]
- Studentenrevolte Mai 68 [26]
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Mai 68: Das internationale Wiederauftauchen der revolutionären Kräfte /5. Teil
- 3373 reads
Unser letzter Artikel zu Mai 68 endete mit den folgenden Sätzen…
«So liegt die grundlegende historische Bedeutung des Mai 68 weder in den „französischen Besonderheiten“ noch in der Studentenrevolte, ebenso wenig in der heute so viel gepriesenen ‚Revolution der Sitten’, sondern darin, dass die Weltarbeiterklasse die Konterrevolution überwunden hatte und in einen neuen historischen Zeitraum von Zusammenstößen mit der kapitalistischen Ordnung eingetreten war. Diese neue Periode zeichnet sich ebenso dadurch aus, dass sich politisch-proletarische Strömungen, welche von der Konterrevolution praktisch eliminiert oder zum Schweigen gebracht worden waren, neu entwickelt haben, darunter die IKS.»
Darauf werden wir in einem weiteren Artikel eingehen.
Die Schäden der Konterrevolution in den Reihen der Kommunisten
Anfang des 20. Jahrhunderts führte das Proletariat während und nach dem 1. Weltkrieg gigantische Kämpfe, in denen der Kapitalismus beinahe überwunden worden wäre. 1917 wurde die bürgerliche Macht in Russland gestürzt. Zwischen 1918-1923 gab es in dem wichtigsten Land Europas, in Deutschland, mehrere Anläufe zur Überwindung des Kapitalismus. Diese revolutionäre Welle fand in allen Winkeln der Erde ihren Widerhall, d.h. überall wo es eine entwickelte Arbeiterklasse gab, von Italien bis Kanada, von Ungarn bis China.
Aber der Weltbourgeoisie gelang es, diese gigantische Bewegung der Arbeiterklasse einzudämmen, und sie blieb nicht dabei stehen. Sie brach die schrecklichste Konterrevolution in der Geschichte der Arbeiterbewegung vom Zaun. Diese Konterrevolution entwickelte sich in Gestalt einer unvorstellbaren Barbarei, deren bedeutendsten Ausdrücke der Stalinismus und Nationalsozialismus waren. Diese wüteten besonders stark dort, wo die Revolution am weitesten gegangen war, nämlich in Russland und in Deutschland.
In diesem Zusammenhang verwandelten sich die kommunistischen Parteien, welche in der revolutionären Welle von Kämpfen an der Spitze gestanden hatten, zu Parteien der Konterrevolution.
Genau so wie der Verrat der sozialistischen Parteien 1914 in Anbetracht des imperialistischen Kriegs die Bildung von Strömungen hervorgerufen hatte, die in den Reihen der sozialistischen Parteien die proletarischen Prinzipien weiter verteidigen wollten, und welche dann auch bei der Gründung der kommunistischen Parteien mitwirkten, hatte der Verrat derselben zur Entstehung von linkskommunistischen Fraktionen geführt, welche wirklich kommunistische Positionen weiter verteidigen wollten. Aber während diejenigen, welche innerhalb der sozialistischen Parteien gegen deren opportunistisches Abgleiten und deren Verrat ankämpften, an Stärke und Einfluss in der Arbeiterklasse gewannen, so dass sie nach der Russischen Revolution sogar eine neue Internationale gründen konnten, verlief die Entwicklung der linken Strömungen, die aus den kommunistischen Parteien hervorgingen, aufgrund des zunehmenden Gewichtes der Konterrevolution anders. Während anfänglich eine Mehrheit der Mitglieder in den Parteien in Deutschland und Italien tätig war, verloren diese Strömungen schrittweise ihren Einfluss in der Arbeiterklasse und den größten Teil ihrer Mitglieder. Oder sie gingen unter durch eine Zersplitterung in eine Reihe von kleinen Gruppen, wie in Deutschland, noch bevor das Hitler-Regime die letzten Militanten auslöschte oder sie ins Exil zwang.
Während der 1930er Jahre zählten neben der Strömung um Trotzki, welche immer mehr vom Opportunismus zerfressen wurde, die Gruppen, welche die revolutionären Positionen weiterhin entschlossen verteidigten wie die Gruppe Internationaler Kommunisten (GIK) in Holland (die sich auf den "Rätekommunismus" berief und die Notwendigkeit einer proletarischen Partei verwarf) und die Linksfraktion der Kommunistischen Partei Italiens (welche die Zeitschrift Bilan veröffentlichte) nur einige wenige Dutzend Mitglieder. Diese konnten keinen Einfluss auf die Arbeiterkämpfe ausüben.
Im Gegensatz zum 1. Weltkrieg hat der 2. Weltkrieg keine Umkehrung des Kräfteverhältnisses zwischen Proletariat und Bourgeoisie ermöglicht. Ganz im Gegenteil. Durch die historische Erfahrung klüger geworden und dank der wertvollen Unterstützung der stalinistischen Parteien setzte die Bourgeoisie alles daran, jegliche neue Regungen der Arbeiterklasse im Keim zu ersticken. In der demokratischen Euphorie der "Befreiung" standen die Gruppen der Kommunistischen Linken noch isolierter da als in den 1930er Jahren. In Holland löste der Communistenbond Spartacus den GIC bei der Verteidigung kommunistischer Positionen ab. Diese wurden ebenfalls ab 1965 von der Gruppe Daad en Gedachte, einer Abspaltung vom Bond, vertreten. Diese beiden Gruppen veröffentlichten viele Texte, obwohl sie durch ihre rätekommunistische Position behindert waren, welche die Rolle einer Avantgardeorganisation für die Arbeiterklasse verwarf. Aber das größte Hindernis war das ideologische Gewicht der Konterrevolution. Dies traf auch auf Italien zu, wo die Bildung der Partito Comunista Internazionalista (die Battaglia Comunista und Prometeo veröffentlichte) im Jahre 1945 um Damen und Bordiga die Versprechen nicht hielt, welche ihre Mitglieder sich erhofft hatten. Während diese Organisation bei ihrer Gründung über ca. 3.000 Mitglieder verfügte, wurde sie infolge von Demoralisierung und Spaltungen – insbesondere nach der von Bordiga betriebenen Spaltung 1952, die zur Bildung der Parti Communiste International führte (sie veröffentlichte Programma Comunista), immer mehr geschwächt. Einer der Gründe für die Spaltungen und Schwächung liegt in der Aufgabe einer ganzen Reihe von Errungenschaften, die von Bilan in den 1930er Jahren erzielt worden waren.
In Frankreich verschwand 1952 die Gruppe Gauche Communiste de France (GCF), die 1945 gebildet worden war, und welche die Kontinuität mit den Positionen Bilan's (bei gleichzeitiger Integration programmatischer Positionen der Deutsch-Holländischen Linken) darstellte und 42 Ausgaben ihrer Zeitschrift Internationalisme herausbrachte. Abgesehen von den Leuten, die der Parti Communiste International verbunden waren und Le Prolétaire veröffentlichten, vertrat eine andere Gruppe bis Anfang der 1960er Jahre Klassenpositionen in der Zeitschrift Socialisme ou Barbarie (SouB). Aber diese aus dem Trotzkismus hervorgegangene Abspaltung nach dem 2. Weltkrieg gab schrittweise und ausdrücklich den Marxismus auf. Infolgedessen verschwand die Gruppe 1966.
Man könnte nach andere Gruppen in anderen Ländern erwähnen, aber kennzeichnend für die Lage der damaligen Strömungen, die in den 1950er und Anfang der 1960er Jahren kommunistische Positionen vertreten haben, war ihre große zahlenmäßige Schwäche. Ihre Publikationen zirkulierten eher in eingeweihten Kreisen, sie waren international isoliert. Darüber hinaus gab es theoretisch-programmatische Rückschritte, die entweder einfach zu ihrem Verschwinden oder zu einer sektenhaften Entwicklung geführt haben, wie das insbesondere bei der Parti Communiste International der Fall war, die sich als die einzige kommunistische Organisation auf der Welt betrachtete.
Das Wiedererstarken der revolutionären Positionen
Der Generalstreik 1968 in Frankreich, schließlich die verschiedenen massiven Bewegungen der Arbeiterklasse, über die wir im vorherigen Artikel berichtet haben, haben erneut die Idee der kommunistischen Revolution in zahlreichen Ländern auf die Tagesordnung gestellt. Die Lügen des Stalinismus, der sich als "kommunistisch" und "revolutionär" darstellte, zerbrachen überall. Daraus schlugen natürlich die Strömungen Kapital, die die UdSSR als "Mutterland des Sozialismus" bezeichneten, wie die maoistischen oder trotzkistischen Organisationen. 1968 erlebte die trotzkistische Bewegung, die sich auf ihren Kampf gegen Stalinismus berief, eine Art Neugeburt. Sie konnte damals aus dem Schatten der stalinistischen Parteien treten, der lange auf ihnen gelegen hatte. Ihr Wachstum war teilweise spektakulär, insbesondere in Frankreich, Belgien oder Großbritannien. Aber seit dem 2. Weltkrieg gehörte diese Strömung dem proletarischen Lager nicht mehr an, insbesondere weil sie "die Arbeitererrungenschaften der UdSSR" verteidigt hatte, d.h. sie hatte das von der UdSSR beherrschte imperialistische Lager verteidigt. Nachdem die Arbeiterstreiks, die sich seit Ende der 1960er Jahre entfalteten, die arbeiterfeindliche Rolle der stalinistischen Parteien und Gewerkschaften, der wahren Rolle der Wahlen und der Demokratie als Herrschaftsinstrument der Bourgeoisie offenbart hatten, wurden viele Leute dazu bewogen, sich mit politischen Strömungen zu befassen, die in der Vergangenheit die Rolle der Gewerkschaften und des Parlamentarismus am deutlichsten entblößt hatten und den Kampf gegen den Stalinismus am klarsten verkörperten – die Kommunistische Linke.
Nach Mai 1968 wurden die Schriften Trotzkis sehr weit verbreitet, aber auch die Pannekoek's, Gorter's, Rosa Luxemburgs, die als eine der Ersten kurz vor ihrer Ermordung im Januar 1919 die bolschewistischen Genossen vor gewissen Gefahren gewarnt hatten, die die Revolution in Russland bedrohten.
Neue Gruppen sind in Erscheinung getreten, die sich mit der Erfahrung der Kommunistischen Linken befassten. Diejenigen, die verstanden, dass der Trotzkismus eine Art linker Flügel des Stalinismus geworden war, wandten sich eher dem Rätismus zu als der Italienischen Linken. Dafür gab es mehrere Gründe. Die Verwerfung der stalinistischen Parteien ist oft mit der Verwerfung des Begriffs der kommunistischen Partei selbst verbunden. Auch trug die Tatsache, dass die bordigistische Strömung (sie war die einzige Strömung, die aus der Italienischen Linken hervorgegangen war, welche sich international ein wenig ausbreiten konnte) die Idee der Machtergreifung durch die kommunistische Partei vertrat und sich auf den "Monolithismus" in ihren Reihen berief, dazu bei, dass das Misstrauen gegenüber der historischen Strömung der Italienischen Linken zunahm. Andererseits war dies eine Folge der Tatsache, dass die Strömungen, welche sich weiterhin auf diese Gruppierung beriefen, im Wesentlichen die Ereignisse des Mai 1968 nicht verstanden und sie verpasst haben, weil sie hinter ihnen nur einen Studentenprotest sahen und nicht die tiefer dahinter liegende historische Bedeutung.
Während gleichzeitig neue, vom Rätismus inspirierte Gruppen auftauchten, verbuchten die schon früher bestehenden Gruppen große Erfolge. Ihre Mitgliederzahlen nahmen spektakulär zu, während sie gleichzeitig zu einem politischen Bezugspunkt wurden. Dies traf insbesondere auf die Gruppe Informations et Correspondance Ouvrières (ICO= Arbeiterkorrespondenz und –informationen) zu, die aus einer Abspaltung von SouB 1958 hervorgegangen war, und die 1969 ein internationales Treffen in Brüssel organisierte, an der sich insbesondere Cohn-Bendit, Mattick (ein ehemaliges Mitglied der Deutschen Linken beteiligte, welcher in die USA ausgewandert war und dort verschiedene rätistische Zeitschriften veröffentlichte) und Cajo Brendel, Haupttriebkraft von Daad en Gedachte. Aber die Erfolge des "organisierten" Rätismus waren nur von kurzer Dauer. Die Gruppe ICO löste sich 1974 auf. Die holländischen Gruppen fielen zusammen, nachdem ihre Haupttriebkräfte ihre Aktivitäten einstellten
In Großbritannien fiel die Gruppe Solidarity, die von den Positionen von Socialisme ou Barbarie inspiriert wurde, und einen ähnlichen Erfolg wie ICO hatte, nach einer Reihe von Spaltungen 1981 auseinander (obwohl ihre Londoner Sektion die Zeitschrift noch bis 1992 veröffentlichte). In Skandinavien haben die rätistischen Gruppen, die sich nach 1968 entwickelt haben, eine Konferenz im September 1977 in Oslo organisiert – aber dieser folgten keine weiteren Schritte.
Letztendlich hat sich die Strömung in den 1970er Jahren am weitesten entwickelt, die mit den Positionen von Bordiga (der im Juli 1970 starb) verbunden ist. Ihre Mitgliedschaft stieg damals insbesondere nach dem Ausbruch von Krisen bei linksextremen Gruppen (insbesondere bei maoistischen Gruppen). 1980 war die Internationale Kommunistische Partei die Organisation, welche sich auf die Kommunistische Linke berief, mit dem größten Einfluss auf internationaler Ebene. Aber diese "Öffnung" der bordigistischen Strömung für Leute, die sehr stark von der extremen Linken geprägt waren, führte 1982 zu ihrem Zusammenbruch. Seitdem besteht sie weiter als eine Reihe von kleinen, auf sich beschränkten Sekten.
Der Anfang der IKS
Der bedeutendste langfristige Ausdruck dieses wieder erwachten Interesses an den Positionen der Kommunistischen Linken war unsere eigene Organisation (3). Diese wurde im Wesentlichen vor gerade 40 Jahren gegründet, im Juli 1968 in Toulouse, als ein kleiner Kern von Leuten, der ein Jahr zuvor einen Diskussionskreis um einen Genossen R.V. gegründet hatte, eine erste Prinzipienerklärung verabschiedete. Dieser Genosse R.V. hatte seine ersten politischen Erfahrungen in der Gruppe Internacionalismo in Venezuela gesammelt. Diese Gruppe war 1964 von dem Genossen MC gegründet worden, der die Haupttriebkraft bei der Gauche Communiste de France (Kommunistische Linke Frankreichs – GCF – 1944 52) gewesen war, nachdem er zuvor von 1938 an der Italienischen Fraktion der Kommunistischen Linken angehört hatte, und der schon seit 1919 Militant gewesen war (im Alter von 12 Jahren). Zunächst war er in der Kommunistischen Partei Palästinas, dann in der Französischen Kommunistischen Partei aktiv gewesen. Während des Generalstreiks im Mai 1968 hatten Mitglieder des Diskussionszirkels mehrere Flugblätter mit dem Namen "Bewegung für den Aufbau von Arbeiterräten" (MICO) verteilt. Sie hatten mit anderen Leuten diskutiert, bevor sie dann im Dezember 1968 die Gruppe Révolution Internationale gründeten. Diese Gruppe hatte Kontakt aufgenommen mit zwei anderen Gruppen, die der rätekommunistischen Bewegung angehörten – Rätekommunistische Organisation Clermont-Ferrand und "Rätekommunistische Hefte", die in Marseille ansässig war. Mit diesen beiden Gruppen wurden dann weitere Diskussionen geführt.
Schließlich schlossen sich diese drei Gruppen 1972 zusammen, um die spätere Sektion der IKS in Frankreich, Révolution Internationale, zu gründen, welche dann mit der Veröffentlichung der Zeitschrift mit dem gleichen Namen (neue Serie) begann. In Fortsetzung der Politik von Internacionalismo, der GCF und Bilan's, nahm Révolution Internationale Diskussionen mit verschiedenen Gruppen auf, die ebenfalls nach 1968 aufgetaucht waren, insbesondere in den USA (Internationalism). 1972 schickte Internationalism ein Schreiben an ca. 20 Gruppen, die sich auf die Kommunistische Linke beriefen, und rief zur Schaffung eines Netzes zum Austausch und der internationalen Debatte auf. Révolution Internationale reagierte darauf sehr positiv, und schlug dabei als Arbeitsperspektive die Organisierung einer internationalen Konferenz vor. Die anderen Gruppen, welche positiv reagierten, gehörten alle der rätekommunistischen Bewegung an. Die Gruppen, welche sich an die Italienische Linke anlehnten, stellten sich entweder taub oder hielten diese Initiative für verfrüht. Auf der Grundlage dieser Initiative fanden zwischen 1973 und 1974 mehrere Treffen in England und Frankreich statt, an denen sich insbesondere aus Großbritannien (World Revolution, Revolutionary Perspectives und Workers' Voice) beteiligten, die ersten beiden Gruppen waren aus einer Abspaltung von Solidarity hervorgegangen und die letzte aus einer Abspaltung von den Trotzkisten).
Schließlich führte dieser Zyklus von Treffen im Januar 1975 zu einer Konferenz, bei der die Gruppen, welche die gleiche politische Orientierung teilten - Internacionalismo, Révolution Internationale, Internationalism, World Revolution, Rivoluzione Internazionale (Italien) und Accion Proletaria (Spanien) beschlossen, sich zur Internationalen Kommunistischen Strömung zusammenzuschließen.
Die IKS beschloss dann die Fortsetzung der Politik der Kontaktaufnahme und Diskussionen mit anderen Gruppen der Kommunistischen Linken. So nahm die IKS an den Konferenzen in Oslo 1977 (mit Revolutionary Perspectives) teil und antwortete positiv auf die 1976 von Battaglia Comunista vorgeschlagene Initiative zur Abhaltung einer internationalen Konferenz von Gruppen der Kommunistischen Linken.
Die drei danach stattgefundenen Konferenzen – 1977 in Mailand, 1978 in Paris, 1980 in Paris – stießen auf ein wachsendes Interesse unter den Leuten, die sich auf die Kommunistische Linke beriefen, aber die Entscheidung Battaglia Comunista's und der Communist Workers' Organisation (die aus einem Zusammenschluss von Revolutionary Perspectives und Workers' Voice in Großbritannien hervorgegangen war), die IKS aus dem Diskussionsprozess auszuschließen, bedeutete dann auch das Ende der Konferenzen. Der sektiererische Rückzug (zumindest die Abgrenzung gegenüber der IKS) von Battaglia Comunista und der Communist Workers’ Organisation (die sich 1984 im Internationalen Büro für die Revolutionäre Partei – IBRP zusammenschlossen) zeigte, dass die Initialzündung durch das historische Wiederauftauchen der Arbeiterklasse im Mai 1968, die zur Bildung der Kommunistischen Linken geführt hatte, nun zu Ende gekommen war.
Aber trotz der Schwierigkeiten, auf die die Arbeiterklasse während der letzten Jahrzehnte gestoßen ist, insbesondere aufgrund der ideologischen Kampagnen über den "Tod des Kommunismus" nach dem Zusammenbruch der stalinistischen Regime, hat es die Weltbourgeoisie nicht geschafft, der Arbeiterklasse eine entscheidende Niederlage beizufügen. Dies kommt durch die Tatsache zum Ausdruck, dass die Kommunistische Linke (die hauptsächlich durch das IBRP und vor allem die IKS verkörpert wird) ihre Positionen aufrechterhalten hat und heute auf ein wachsendes Interesse bei den Leuten stößt, die infolge des langsamen Wiedererstarkens des Klassenkampfes seit 2003 nach einer revolutionären Perspektive suchen.
Fabienne, 6. Juli 2008
(1) Mai 68 – 4. Teil. « Die internationale Bedeutung des Generalstreiks in Frankreich“. Weltrevolution Nr. 149
(2) Die beiden Haupttheoretiker der Holländischen Linken
(3) Eine umfassendere Darstellung der Geschichte der IKS findet man in "Aufbau der revolutionären Organisation: 20 Jahre IKS – Internationale Revue Nr. 16 – und "30 Jahre IKS: Von Vergangenheit für die Zukunft lernen" -Internationale Revue Nr. 37
Politische Strömungen und Verweise:
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Historische Ereignisse:
- Mai 1968 [13]
Nahrungskrise, Hungerrevolten: Nur der Klassenkampf des Proletariats kann dem Hunger ein Ende bereiten
- 3140 reads
In der Nr. 132 der International Review (engl. Ausgabe, Nr. 41 deutsche Ausgabe) haben wir ausführlich über die Entwicklung der Arbeiterkämpfe berichtet, die gleichzeitig auf der Welt ausgebrochen sind als Reaktion auf die Zuspitzung der Krise und der Angriffe gegen die Lebensbedingungen der Arbeiter. Die neuen Erschütterungen der Weltwirtschaft, die Geißel der Inflation und der Nahrungskrise werden das Elend der verarmtesten Teile der Bevölkerung in den peripheren Ländern nur noch verschärfen. Diese Entwicklung, welche die Sackgasse offenbart, in welcher das kapitalistische System steckt, hat in zahlreichen Ländern Hungerrevolten ausgelöst, während sich gleichzeitig Arbeiterkämpfe entfalteten, in denen für Lohnerhöhungen als Reaktion auf die Preisschübe bei Grundnahrungsmitteln gekämpft wurde. Aufgrund der Zuspitzung der Krise werden die Hungerrevolten und die Arbeiterkämpfe immer mehr zunehmen und gleichzeitig stattfinden. Diese Revolten gegen die Misere sind auf die gleiche Ursache zurückzuführen: Die Krise der kapitalistischen Gesellschaft, ihre Unfähigkeit, der Menschheit eine Zukunft anzubieten oder sogar nur ein einfaches Überleben eines Teils der Gesellschaft zu ermöglichen. Aber sie verfügen nicht über das gleiche Potenzial. Nur der Kampf der Arbeiterklasse auf ihrem eigenen Boden kann dem Elend, dem sich ausbreitenden Hunger ein Ende setzen – dazu ist aber die Überwindung des Kapitalismus und die Errichtung einer neuen Gesellschaft erforderlich, in der es keine Not, keinen Hunger und keine Kriege geben wird.
Die Nahrungskrise offenbart den Bankrott des Kapitalismus
Der gemeinsame Nenner der Hungerrevolten, die seit Anfang des Jahres an mehreren Orten auf der Welt ausgebrochen sind, sind die Preisschübe der Nahrungsmittel oder ihr Mangel. Darunter haben vor allem die armen Bevölkerungsteile und die Arbeiter in zahlreichen Ländern brutal zu leiden. Einige Zahlen belegen dies aufschlussreich: Der Maispreis hat sich seit 2007 vervierfacht, der Weizenpreis hat sich seit Anfang 2008 verdoppelt und die Nahrungsmittelpreise sind allgemein um 6o% während der letzten beiden Jahre in den ärmeren Ländern gestiegen. Ein Zeichen der Zeit - die zerstörerischen Wirkungen der weltweiten Preissteigerungen von 30-50% der Lebensmittel haben nicht nur die ärmsten Bevölkerungsteile sondern auch die 'reichsten' Länder getroffen. So können zum Beispiel in den USA, der weltgrößten Wirtschaftsmacht der Erde, 28 Millionen Amerikaner nicht mehr ohne die Lebensmittelverteilung durch die Kommunen und Bundesstaaten auskommen.
Jetzt schon sterben jeden Tag auf der Welt 100.000 Menschen an Hunger, ein Kind unter 10 Jahren stirbt alle 5 Sekunden, 842 Millionen Menschen leiden unter schwerer chronischer Unterernährung; viele von ihnen sind dadurch erwerbsunfähig. Und jetzt schon kämpfen zwei von sechs Milliarden Menschen (d.h. ein Drittel der Bevölkerung) um ihr tägliches Überleben aufgrund der ansteigenden Nahrungsmittelpreise.
Die Experten der herrschenden Klasse selbst – IWF, FAO, UNO, G 8 usw. – haben angekündigt, dass dies kein vorübergehender Misstand sei, und dass er nicht nur chronisch wird, sondern sich weiter zuspitzen wird infolge der schwindelerregenden Preissteigerungen der Grundnahrungsmittel und deren Verknappung im Verhältnis zu den Bedürfnissen der Menschen auf der Erde. Während die Erde eigentlich 12 Milliarden Menschen ernähren könnte, sterben in Wirklichkeit Millionen von Menschen an Hunger aufgrund der Gesetze des Kapitalismus, der überall auf der Welt das herrschende System geworden ist. Die Produktion in diesem System dient nicht der Bedürfnisbefriedigung der Menschen, sondern der Profitmaximierung. Dieses System ist völlig unfähig, die Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen. Übrigens bewegen sich alle Erklärungsansätze der gegenwärtigen Nahrungskrise in die gleiche Richtung - es handelt sich um eine Produktion, die den blinden und irrationalen Gesetzen des Systems unterworfen ist:
1. Der schwindelerregende Anstieg der Ölpreise, der zu erhöhten Transportkosten führt, sowie die erhöhte Nahrungsmittelproduktion usw. Dieses Phänomen ist eine für das System typische Absurdität. Sie wohnt dem System inne und kommt nicht irgendwie von Außen.
2. Der große Anstieg der Lebensmittelnachfrage, die auf eine gewisse Erhöhung der Kaufkraft der Mittelklasse und neuer Nahrungsgewohnheiten in den so genannten 'Schwellenländern' wie Indien oder China zurückzuführen sei. Selbst wenn es ein Fünkchen Wahrheit in dieser Erklärung gibt, offenbart sie dennoch den wahren "wirtschaftlichen Fortschritt", der durch die Erhöhung der Kaufkraft einiger Menschen dazu führt, dass Millionen andere Menschen zum Hunger verdammt sind aufgrund des daraus entstehenden gegenwärtigen Nahrungsmittelmangels auf dem Weltmarkt.
3. Die frenetische Spekulation mit Agrarprodukten. Auch dies ist eine reine kapitalistische Ausgeburt; ihr ökonomisches Gewicht ist um so schwerwiegender, da die reale Wirtschaft in immer größeren Schwierigkeiten steckt. Einige Beispiele: Die Weizenvorräte haben ihren niedrigsten Stand seit 30 Jahren erreicht. Der Spekulationswahnsinn der Anleger hat nunmehr Agrarprodukte im Visier mit der Hoffnung, dass man in diesem Bereich mehr abzocken kann, da dies seit der Immobilienkrise in jener Branche nicht mehr möglich ist. An der Chicagoer Börse "ist der Handel mit Soja, Weizen, Mais, Schweinefleisch und gar mit Lebendvieh" um 20% im ersten Quartal dieses Jahres gestiegen (Le Figaro, 15.4.08).
4. Der aufblühende Markt der Biotreibstoffe, der zudem noch angetrieben wird von den explodierenden Ölpreisen, ist ebenso zur Zielscheibe frenetischer Spekulation geworden. Diese neue Gewinnquelle ist für das Wachstum des Biotreibstoffs auf Kosten der Pflanzen, die der Ernährung dienen, verantwortlich. Viele Länder, in denen bislang Grundnahrungsmittel angebaut wurden, haben ihre Anbauflächen umgestellt, um nunmehr Pflanzen für Biotreibstoff zu züchten. Unter dem Vorwand gegen die Klimaerwärmung anzukämpfen, schrumpft so die Menge konsumierbarer Grundnahrungsmittel und ihre Preise ziehen dramatisch an. Dies trifft zum Beispiel auf Congo-Brazzaville zu, wo ganz extensiv Zuckerrohr mit diesem Ziel angebaut wird, während gleichzeitig die Bevölkerung hungert. Während in Brasilien 30% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze lebt und kaum überleben kann, wird die Wahl der anzubauenden Agrarprodukte immer mehr durch den run auf die Biotreibstoffe bestimmt.
5. Der Handelskrieg und der Protektionismus, die ebenfalls typische Merkmale des Kapitalismus sind und im Agrarbereich wüten, haben dazu geführt, dass die produktivsten Bauern der Industriestaaten exportieren (oft mit Hilfe von Regierungssubventionen) und damit einen Teil ihrer Produktion in den Dritte-Welt-Ländern verkaufen, wodurch die Bauern vor Ort ruiniert werden. Diese sind seit langem unfähig, die örtliche Bevölkerung ausreichend zu ernähren oder auch nur Hilfsgüter anbieten zu können. In Afrika zum Beispiel sind viele örtliche Bauern durch die europäischen Exporte von Hühnern und Rindfleisch ruiniert worden. Mexiko kann nicht mehr genügend Grundnahrungsmittel herstellen, um seine Bevölkerung zu ernähren. Als Folge muss das Land jetzt Lebensmittel im Wert von 10 Milliarden Dollar einführen.
6. Der unverantwortliche Einsatz von Ressourcen dieses Planeten, der durch die Jagd nach unmittelbaren Profiten bestimmt wird, führt letzten Endes zur Erschöpfung derselben. Die Überdüngung zerstört das Gleichgewicht des Bodens. Das International Rice Research-Institut warnt, dass der Erhalt des Reisanbaus durch den übermäßigen Gebrauch von Dünger und die Beeinträchtigung der Bodenqualität mittelfristig gefährdet sei. Die Überfischung der Meere hat ebenso schon zu einer Verknappung zahlreicher Fischsorten geführt.
7. Die Folgen der Erwärmung des Planeten, insbesondere Überschwemmungen und Dürren werden zu Recht als Grund für die gesunkenen nutzbaren landwirtschaftlichen Anbauflächen angeführt. Aber letzten Endes sind diese Umweltschäden die Folgen einer frenetischen Industrialisierung durch den Kapitalismus auf Kosten der unmittelbaren und langfristigen Bedürfnisse der Menschen. So haben die jüngsten Hitzewellen in Australien zu schwerwiegenden Schäden und einem großen Rückgang der Nahrungsmittelproduktion geführt. Und das Schlimmste steht erst noch vor uns, denn Berechnungen zufolge wird ein Anstieg der Temperatur um ein Grad Celsius einen Rückgang der Reis, Weizen- und Maisernte um 10% bewirken. Forschungsergebnisse zeigen, dass der Temperaturanstieg die Überlebenschancen vieler Tiere und Pflanzen bedroht und den Nährwert vieler Pflanzen reduziert.
Aber Hunger ist nicht die einzige Folge der Absurditäten der Ausbeutung der Reichtümer der Erde. So kommt es infolge der Biotreibstoffproduktion zu einer Erschöpfung der anbaufähigen Flächen. Darüber hinaus führt dieser "saftige" Markt zu einem wahnsinnigen und gegen die Natur gerichteten Verhalten: In den USA, wo schon mehr als 30% des Maisanbaus für die Herstellung von Ethanol verwendet wird, werden gigantische Anbauflächen für den Anbau von "energiereichem" Mais benutzt. Dazu werden aber Anbauflächen verwendet, die dafür überhaupt nicht geeignet sind. Dadurch wird eine enorme Verschwendung von Dünger und Wasser verursacht, und das Endergebnis ist zudem noch sehr magert. Jean Ziegler erklärte dazu: "Um 50 Liter Bioethanol zu tanken, muss man 232 Kilo Mais verwenden" – aber um ein Kilo Mais zu züchten, muss man 1000 Liter Wasser verwenden! Jüngste Untersuchungen zeigen, dass nicht nur die "Umweltbilanz" der Biotreibstoffe negativ ist (jüngste Erhebungen deuten darauf hin, dass sie die Luft mehr verschmutzen als normale Treibstoffe), aber ihre globalen Konsequenzen auf ökologischer und ökonomischer Ebene sind für die gesamte Menschheit verheerend. Zudem ist in vielen Teilen der Erde der Boden immer stärker verseucht oder gar völlig vergiftet. Der Boden in China ist zum Beispiel zu 10% vergiftet, 120.000 Bauern sterben jedes Jahr an Krebs, der durch Bodenverseuchung hervorgerufen wurde.
All die Erklärungen, welche uns zur Ernährungskrise gegeben werden, enthalten ein Körnchen Wahrheit. Aber keine von ihnen kann als solche eine wirkliche Erklärung liefern. Da es sich um die Grenzen des Systems handelt, insbesondere wenn diese in Form der Krise in Erscheinung treten, hat die herrschende Klasse keine andere Wahl als die Ausgebeuteten anzulügen. Sie leiden unter den Folgen dieser Entwicklung. Ihnen gegenüber versuchen die Herrschenden zu verbergen, dass diese Gesellschaft nicht von ewigem Bestand ist, genauso wenig wie frühere Ausbeutungsgesellschaften ewig existierten. Aber auf einer gewissen Art muss die herrschende Klasse auch sich selbst als gesellschaftliche Klasse belügen, um zu vertuschen, dass ihre Herrschaft historisch zum Verschwinden verurteilt ist. Aber was heute ins Auge sticht, ist der Gegensatz zwischen den von der herrschenden Klasse gemachten Versicherungen und ihrer Unfähigkeit, gegenüber der Nahrungskrise mit einem Mindestmaß an Glaubwürdigkeit und Effizienz zu reagieren.
Die verschiedenen angebotenen Erklärung und Lösungen entsprechen – abgesehen von ihrer zynischen und heuchlerischen Art – alle den eigenen und unmittelbaren Interessen der einen oder anderen Fraktion der herrschenden Klasse. Einige Beispiele zur Verdeutlichung. Auf dem letzten G 8 Gipfel haben die Führer dieser Staaten die Repräsentanten der armen Länder aufgefordert, gegenüber den Hungerrevolten zu reagieren. Sie schlugen die sofortige Senkung der Handelszölle auf Agrarprodukte vor. Mit anderen Worten: der erste Gedanke dieser feinen Repräsentanten der kapitalistischen Demokratie war, von der Krise zu profitieren, um ihre eigenen Exportchancen zu erhöhen! Die europäische Industrielobby erhob gegenüber dem Agrarprotektionismus der Europäischen Union ein Zetergeschrei, die unter anderem beschuldigt wird, für den Ruin der Subsistenzwirtschaft in der Dritten-Welt verantwortlich zu sein (1). Und warum? Aus Angst vor der industriellen Konkurrenz aus Asien wollen diese die Agrarsubventionen, die von der EU bezahlt werden, reduzieren, weil diese nicht mehr finanzierbar seien. Die Agrarlobby wiederum sieht in den Hungerrevolten den Beweis der Notwendigkeit der Erhöhung derselben Agrarsubventionen. Die Europäische Union hat die Gelegenheit benutzt, um den Einsatz der Agrarproduktion zugunsten "erneuerbarer Energien" in Brasilien zu verurteilen, das eines der EU-Hauptrivalen in dieser Branche ist. Der Kapitalismus hat wie kein anderes System vor ihm die Produktivkräfte bis zu solch einem Punkt entwickelt, dass sie die Errichtung einer Gesellschaft ermöglichen würden, in der die menschlichen Bedürfnisse befriedigt werden könnten. Aber die so in Bewegung gesetzten Kräfte können nicht in den Dienst der großen Mehrheit der Menschen gestellt werden, solange sie durch die Gesetze des Kapitalismus gefesselt werden. Stattdessen wenden sie sich gegen die Menschen. „Wir haben in den fortgeschrittensten Industrieländern die Naturkräfte gebändigt und in den Dienst der Menschen gepresst; wir haben damit die Produktion ins unendliche vervielfacht, dass ein Kind jetzt mehr erzeugt als früher hundert Erwachsene. Und was ist die Folge? Steigende Überarbeit und steigendes Elend der Massen (…) Erst eine bewusste Organisation der gesellschaftlichen Produktion, in der planmäßig produziert und verteilt wird, kann die Menschen ebenso in gesellschaftlicher Beziehung aus der übrigen Tierwelt herausheben, wie dies die Produktion überhaupt für die Menschen in spezifischer Beziehung getan hat“ (Friedrich Engels, Einleitung zur Dialektik der Natur, MEW 20, S. 323).
Seitdem der Kapitalismus in seine Niedergangsphase eingetreten ist, tragen die von den Menschen produzierten Reichtümer nicht dazu bei, die Menschen aus der Herrschaft der Notwendigkeit zu befreien, sondern sie bedrohen die Menschheit in ihrer Existenz selbst. Somit wird die Menschheit heute durch eine neue Gefahr bedroht: weit verbreiteter Hunger – während man noch vor einiger Zeit behauptete, die Gefahr des Verhungerns höre der Vergangenheit an. Aber wie die Klimaerwärmung zeigt, die ganze Produktion – auch die der Agrarprodukte – ist den blinden Gesetzen des Kapitalismus unterworfen. Die Grundlagen des Lebens auf der Erde werden durch die Plünderung der Ressourcen des Planeten bedroht.
Der Unterschied zwischen den Hungerrevolten und den Aufständen in den Vororten
Heute sind die ärmsten Menschen der Dritten Welt vom Hunger betroffen. Die Plünderungen von Geschäften sind eine vollkommen legitime Reaktion gegen eine untragbare Lage in ihrem Überlebenskampf. Auch wenn diese Hungerrevolten zu Zerstörungen und Gewalt führen, dürfen sie nicht auf die gleiche Ebene gestellt werden wie die Revolten in den Städten (wie in Brixton, Großbritannien 1981 oder in den französischen Vororten 2005) oder wie die Rassenunruhen (wie die von Los Angeles 1992), weil sie eine andere Bedeutung haben als diese (2).
Obwohl sie die „öffentliche Ordnung“ stören und materielle Schäden anrichten, dienen letztere letzten Endes nur den Interessen der herrschenden Klasse, welche sehr wohl dazu in der Lage ist, diese Aufstände nicht nur gegen die Aufständischen selbst auszuschlachten, sondern sie gegen die gesamte Arbeiterklasse auszunutzen. Insbesondere bieten diese Ausdrücke verzweifelter Gewalt (an denen sich meist Lumpenproletarier beteiligten) der herrschenden Klasse oft einen Vorwand zur Verstärkung ihres Repressionsapparates mit einer verstärkten polizeilichen Überwachung der Elends- und Arbeiterviertel..
Diese Art Aufstände sind ein reines Zerfallsprodukt des Kapitalismus. Sie spiegeln die Verzweiflung und das Gefühl des „no future“ wider, das sich durch ihren völlig absurden Charakter äußert. Dies traf zum Beispiel auf die Unruhen in den französischen Vorstädten im November 2005 zu, als die Jugendlichen ihre gewalttätigen Aktionen keinesfalls gegen die Stadtviertel der Reichen, wo die Ausbeuter wohnen, richteten, sondern gegen ihre eigenen Wohnviertel, die seitdem noch mehr heruntergekommen und noch unerträglicher geworden sind. Und die Tatsache, dass ihre eigene Familien, ihre eigenen Nachbarn und die ihnen Nahestehenden die Hauptopfer der Verwüstungen wurden, belegt den völlig blinden, verzweifelten und selbstmörderischen Charakter dieser Aufstände. Angesteckt wurden nämlich die Autos der Arbeiter, die in diesen Wohnvierteln leben, und zerstört wurden die Schulen und Turnhallen, die von ihren Brüdern und Schwestern oder den Nachbarkindern benutzt werden. Und gerade weil diese Aufstände völlig absurd waren, konnte die herrschende Klasse sie gegen die Arbeiterklasse selbst einsetzen. In den Medien wurden sie von der herrschenden Klasse dazu ausgeschlachtet, um viele Arbeiter aus den ärmeren Vierteln glauben zu lassen, dass die jungen Aufständischen keine Opfer des krisengeschüttelten Kapitalismus sind, sondern kleine "Diebe“. Abgesehen von der Tatsache, dass diese Aufstände nur zu einer verstärkten „Ausländerjagd“ geführt haben, konnten sie nur dazu dienen, jegliche Solidarität der Arbeiterklasse mit diesen aus der Produktion ausgeschlossenen Jugendlichen zu untergraben. Diese Jugendlichen sehen keine Perspektive und werden ständig durch die Polizei belästigt.
Im Gegensatz zu den Aufständen in den Städten und den Rassenunruhen, welche die Bourgeoisie völlig kontrollieren und gegen die Arbeiterklasse wenden kann, um die Arbeiterklasse zu spalten und ihre Solidarität zu vereiteln, sind die Hungersrevolten vor allem und hauptsächlich ein Ausdruck des Bankrotts der Weltwirtschaft und der Irrationalität seiner Produktionsweise. Diese äußert sich heute durch eine Ernährungskrise, von der nicht nur die Ärmsten der „armen“ Länder betroffen sind, sondern immer mehr Lohnabhängige in den „entwickelten“ Ländern. Es ist kein Zufall, dass die meisten Arbeiterkämpfe, die sich heute überall auf der Welt entfalten, oft um Lohnerhöhungen drehen. Die galoppierende Inflation, der Preisanstieg der Waren, die zur Deckung der Grundbedürfnisse benötigt werden, zusammen mit den Reallohnsenkungen und der Renten, die durch die Inflation angenagt werden, über die prekären Arbeitsbedingungen und den Entlassungswellen sind Ausdrücke der Krise, die alle Bestandteile enthält, damit die Frage des Hungers, des Überlebenskampfes in der Arbeiterklasse nunmehr aufkommen.
Jetzt schon haben Untersuchungen aufgezeigt, dass in Frankreich die Supermärkte und die großen Einkaufszentren, in denen die Arbeiter kaufen gehen, große Absatzschwierigkeiten haben und ihr Warensortiment und Liefermengen reduzieren. Wenn die Ernährungskrise schon die Arbeiter der ‚armen’ Länder (und zunehmend auch die Arbeiter der Zentren des Kapitalismus) erfasst, wird es der herrschenden Klasse viel schwerer fallen, die Hungerrevolten gegen den Klassenkampf des Proletariats auszunutzen. Hunger und Not – das sind die Perspektiven des Kapitalismus für die Menschheit. Das wird jetzt schon durch die Hungerrevolten, die jüngst in mehreren Ländern ausgebrochen sind, deutlich.
Natürlich sind diese Aufstände auch Verzweiflungstaten der ärmsten Massen in den 'armen' Ländern. Sie bieten keine Perspektive für die Überwindung des Kapitalismus. Aber im Gegensatz zu den Aufständen in den Städten oder den Rassenunruhen stellen die Hungerrevolten eine Bündelung der absoluten Misere dar, in welche der Kapitalismus immer größere Teile der Bevölkerung treibt. Sie zeigen das auf, was auf die Arbeiterklasse zukommt, wenn diese Produktionsform nicht überwunden wird. Deshalb tragen sie zur Bewusstwerdung des Proletariats über den unvermeidbaren Bankrott der kapitalistischen Wirtschaft bei. Und sie zeigen auch, mit welchem Zynismus und welcher Brutalität die herrschende Klasse auf die Wutausbrüche derjenigen reagiert, die Geschäfte plündern, um nicht zu verhungern: Repression, Tränengas, Schlagstöcke und Maschinengewehre. Aber im Gegensatz zu den Revolten in den Vorstädten, sind diese Hungerrevolten kein die Arbeiterklasse spaltender Faktor. Im Gegenteil, trotz der Gewalt und der Zerstörungen, die sie vielleicht hervorrufen, neigen die Hungerrevolten eher dazu, ein spontanes Gefühl der Solidarität unter den Arbeitern zu bewirken, da diese auch die Hauptleidtragenden der Nahrungskrise sind und immer mehr Schwierigkeiten haben, ihre Familien durchzubringen. Deshalb können die Hungerrevolten nur schwerer von der herrschenden Klasse ausgeschlachtet und zur Spaltung der Arbeiter eingesetzt werden.
Gegenüber den Hungerrevolten bietet nur der Kampf der Arbeiter eine Perspektive.
Obwohl sich heute in den 'armen' Ländern gleichzeitig Arbeiterkämpfe gegen die kapitalistische Misere und Hungerrevolten entfalten, handelt es sich um zwei parallele Bewegungen aber mit jeweils unterschiedlichem Wesen.
Selbst wenn sich Arbeiter an Hungerrevolten und an Plünderungen beteiligen, ist dies kein Boden für den Klassenkampf. Denn es handelt sich dabei um einen Boden, auf dem das Proletariat in all den anderen verarmten und marginalisierten "Volksschichten" aufgelöst wird. Bei dieser Art Bewegung kann die Arbeiterklasse nur ihre Klassenautonomie verlieren und ihre eigenen Kampfmethoden aufgeben: Streiks, Demonstrationen, Vollversammlungen.
Die Hungerrevolten sind nur ein Strohfeuer, Revolten ohne Fortsetzung, die keinesfalls das Problem des Hungers lösen können. Sie sind lediglich eine unmittelbare und verzweifelte Reaktion gegenüber der absoluten Misere. Sobald die Geschäfte geplündert sind, bleibt nichts mehr übrig, während Lohnerhöhungen, die Arbeiter erkämpft haben, länger Bestand haben (auch wenn sie später wieder verloren gehen). Selbstverständlich darf die Arbeiterklasse gegenüber der Hungersnot, vor der heute die Bevölkerung in den Ländern der Peripherie des Kapitalismus steht, nicht gleichgültig bleiben. Dies trifft um so mehr zu, da die Arbeiter in diesen Ländern ebenso von der Nahrungskrise betroffen sind und immer mehr Schwierigkeiten haben, ihre Familien mit ihren miserablen Löhnen zu ernähren.
Die gegenwärtigen Ausdrucksformen der kapitalistischen Krise, insbesondere die Preisschübe und die Zuspitzung der Ernährungskrise werden dazu neigen, die Lebensbedingungen der Arbeiter und der verarmten Massen immer mehr zu verschlechtern. Deshalb werden die Arbeiterkämpfe in den ‚armen’ Ländern und die Hungerrevolten immer mehr zunehmen. Aber während die Hungerrevolten keine Perspektiven aufzeigen können, stellen die Arbeiterkämpfe die Grundlage dar, auf der die Arbeiter ihre eigene Stärke und eigene Perspektiven entfalten können. Das einzige Mittel des Proletariats, um den immer gewalttätiger werdenden Angriffen des Kapitalismus entgegenzutreten, ist seine Fähigkeit, seine Klassenautonomie zu bewahren, indem es seine Kämpfe und seine Perspektiven auf seinem eigenen Boden entfaltet. Insbesondere müssen die Arbeiter in den Vollversammlungen und Massendemonstrationen gemeinsame Forderungen erheben, welche die Solidarität mit den hungernden Massen zum Ausdruck bringen. Bei diesen Forderungen müssen die kämpfenden Arbeiter nicht nur Lohnerhöhungen und Senkungen der Grundnahrungsmittel verlangen, sondern sie müssen in ihre Forderungen auch die kostenlose Verteilung der lebensnotwendigsten Nahrungsmittel für die Ärmsten, die Arbeitslosen und die Bedürftigen aufnehmen. Nur indem sie ihre eigene Kampfmittel und ihre Klassensolidarität mit den Hungernden und Unterdrückten entfaltet, kann die Arbeiterklasse die anderen nicht-ausbeutenden Schichten der Gesellschaft auf ihre Seite ziehen.
Der Kapitalismus kann der Menschheit keine Perspektive mehr anbieten außer immer barbarischere Kriege, tragischere Katastrophen, eine zunehmende Misere für den Großteil der Weltbevölkerung. Die einzige Möglichkeit, damit die Gesellschaft diese Barbarei überwindet, besteht in der Abschaffung des kapitalistischen Systems. Und die einzige Kraft, die den Kapitalismus überwinden kann, ist die Weltarbeiterklasse. Weil diese aber bislang noch nicht die Kraft entfaltet hat, diese Perspektive durch die Entwicklung und massive Ausdehnung ihrer Kämpfe umzusetzen, sind immer größere Bevölkerungsmassen in den Ländern der "3.Welt" dazu getrieben, sich an verzweifelten Hungerrevolten zu beteiligen, um zu überleben. Die einzig wirkliche Lösung für die Nahrungskrise ist die Entfaltung der Arbeiterkämpfe mit dem Ziel der kommunistischen Weltrevolution, wodurch die Hungerrevolten eine Perspektive und eine Stoßrichtung erhalten. Das Proletariat kann die anderen nicht-ausbeutenden Schichten aber nur für sich gewinnen und um sich scharen, wenn es sich als eine revolutionäre Klasse behauptet. Nur durch die Entfaltung und Vereinigung ihrer Kämpfe kann die Arbeiterklasse zeigen, dass sie die einzige gesellschaftliche Kraft ist, die diese Welt umwälzen und eine radikale Lösung für die Geißel des Hungers anbieten kann, aber auch eine Lösung für all die Kriege und alle anderen Ausdrucksformen der Verzweiflung, die zum Fäulnisprozess dieser Gesellschaft beitragen.
Der Kapitalismus hat die Bedingungen des Überflusses geschaffen, aber solange diese Gesellschaft nicht überwunden ist, können diese nur zu einer absurden Situation führen, wo die Überproduktion von Waren gleichzeitig besteht mit dem Mangel an den grundlegendsten Waren.
Die Tatsache, dass der Kapitalismus nicht mehr dazu in der Lage ist, die Bevölkerung zu ernähren und ganze Bevölkerungsteile dem Hunger aussetzen muss, ist eine dringende Aufforderung an die Arbeiterklasse, ihre historische Aufgabe zu erfüllen. Nur mit Hilfe der kommunistischen Weltrevolution können die Grundlagen für eine wahre Überflussgesellschaft gelegt werden, in der das Problem des Hungers ein für allemal aus dieser Welt geschafft sein wird. – Juli 2008
(1) Der Begriff "3.Welt" war 1952 mitten im Kalten Krieg durch den französischen Ökonomen und Demographen Alfred Sauvy erfunden worden, um anfänglich jene Länder zu beschreiben, die weder dem westlichen noch dem russischen Block direkt zugeordnet werden konnten. Aber diese Bedeutung ist schließlich praktisch fallen gelassen worden, insbesondere seit dem Fall der Berliner Mauer. Aber er wurde ebenso verwendet, um die Länder zu kennzeichnen, in denen es ein nur sehr schwaches Wirtschaftswachstum gibt, mit anderen Worten die ärmsten Länder des Planeten, insbesondere in Afrika, Asien oder Südamerika. In diesem Sinne haben wir diesen Begriff weiter benutzt, der an Aktualität nichts verloren hat.
(2) Hinsichtlich der Rassenunruhen von Los Angeles siehe unseren Artikel "Gegenüber dem Chaos und den Massakern – nur die Arbeiterklasse kann eine Antwort bieten" – in International Review Nr. 70. Zu den Aufständen in den französischen Vororten im Herbst 2005 siehe "Soziale Unruhen – Argentinien 2001, Frankreich 2005 …. Nur der Kampf der Arbeiterklasse bietet eine Zukunft" (International Review 124) und "Thesen zur Studentenbewegung des Frühjahrs 2006" – Sonderausgabe von Weltrevolution.
Aktuelles und Laufendes:
- Nahrungskrise [28]
- Lebensmittelpreisexplosion [29]
- Hungerrevolten [30]
- Hunger Arbeiterklasse [31]
Theoretische Fragen:
- Umwelt [16]
August 2008
- 692 reads
Krieg in Georgien – alle Mächte sind für den Krieg verantwortlich!
- 3104 reads
Krieg in Georgien – alle Mächte sind für den Krieg verantwortlich!
Wieder einmal herrscht Krieg im Kaukasus. Zu einem Zeitpunkt, als Bush und Putin Süßigkeiten in Beijing kosteten und praktisch Schulter an Schulter der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele beiwohnten, die angeblich ein Symbol des Friedens und der Versöhnung unter den Völkern darstellen, haben der georgische Präsident Saakaschwili, ein Schützling des Weißen Hauses, und die russische Bourgeoisie ihre Soldaten in den Krieg geschickt und ein schreckliches Massaker an der Bevölkerung verübt. Dieser Krieg hat zu einer neuen quasi ‚ethnischen’ Säuberung auf beiden Seiten geführt, deren genaue Opferzahl gegenwärtig nicht eingeschätzt werden kann (man geht von mehreren Tausend Toten aus), von denen wiederum ein Großteil Zivilisten sind. Jedes Lager beschuldigt die andere für den Krieg verantwortlich zu sein oder rechtfertigt sich, so gehandelt zu haben, weil man mit dem Rücken zur Wand stand. Die Bevölkerung vor Ort – ob die russischen, ossetischen, abchasischen oder georgischen Ursprungs, deren Städte, Dörfer und Wohnungen bombardiert, angesteckt, geplündert und zerstört werden, wird von allen nationalistischen bürgerlichen Fraktionen zur Geisel genommen. Sie wird überall den gleichen Massakern, den gleichen Grausamkeiten ausgesetzt. Die Arbeiter dürfen dabei keine Seite verteidigen. Sie dürfen nicht zwischen ihren Ausbeutern wählen. Sie müssen sich weiterhin gegen sie auf ihrem Klassenterrain mobilisieren und die nationalistischen und kriegerischen Forderungen verwerfen wie: « Verteidigen wir unsere russischen Brüder und Schwestern im Kaukasus“ oder „Verteidigen wir das Volk, welches Vertrauen in russische Hilfe hat“ oder „Gott rette die territoriale Integrität Georgiens“ – all diese Slogans dienen nur der einen oder anderen kapitalistischen Bande, die alle nur die Bevölkerung als Kanonenfutter einsetzen wollen.
Eine neuer Beleg für die kriegerische Barbarei des Kapitalismus
Als Reaktion auf eine Reihe von Provokationen der russischen Bourgeoisie und ihrer separatistischen Fraktionen in Ossetien meinte der georgische Präsident Schaakaschwili ungestraft eine brutale Invasion der Miniprovinz Südossetien in der Nacht vom 7. auf den 8. August anleiern zu können. Die georgischen Truppen wurden dabei von der Luftwaffe unterstützt. Zchinwali, die ‚Hauptstadt’ der abtrünnigen, pro-russischen Provinz, wurde dabei in Schutt und Asche gelegt. Während Moskau ihm treue Milizen in den anderen Kriegsherd in Georgien, das ebenso abtrünnige Abchasien, schickte, und diese dabei das Kodori-Tal besetzten, haben die russischen Truppen ebenso brutal und barbarisch reagiert, indem sie massiv mehrere georgische Städte bombardierten (darunter den Hafen Poti an der Schwarzmeerküste, welcher völlig zerstört und geplündert wurde, und vor allem Gori, aus der die meisten Einwohner nach intensivem Beschuss flüchteten). Blitzschnell haben die russischen Panzer ein Drittel des georgischen Territoriums besetzt, dabei gar die Hauptstadt bedroht. Die Panzer rückten bis auf wenige Kilometer an die Hauptstadt Tiflis heran, ohne Schritte für einen Rückzug nach der Unterzeichnung des Waffenstillstandes eingeleitet zu haben. Auf beiden Seiten die gleichen schrecklichen Szenen und das gleiche Abschlachten. Fast die ganze Bevölkerung von Zchinwali und Umgebung (es handelte sich um ca. 30.000 Flüchtlinge) musste aus dem Kampfgebiet flüchten. Innerhalb einer Woche stieg, den Angaben des Sprechers des Flüchtlingsrats zufolge, die Zahl der Flüchtlinge im ganzen Land (die terrorisiert und ohne Hab und Gut das Weite suchten) auf über 115.000 an. Der Großteil der Einwohner von Gori ist geflüchtet. Der Konflikt hatte seit langem geschwelt. Südossetien und Abchasien, beides Gebiete, in denen Schmuggler und andere Banden den Alltag prägen, sind selbsternannte pro-russische Minirepubliken, die unter ständiger russischer Kontrolle stehen. Seit fast 20 Jahren, als Georgien seine Unabhängigkeit erklärte und im Verlaufe der nachfolgenden Kriege, sind diese Republiken zum Schauplatz ständiger Konflikte und Schießereien zwischen den beiden Nachbarstaaten geworden. Die Instrumentalisierung der russischen Minderheiten in Georgien zum Zwecke der Rechtfertigung der aggressiven imperialistischen Politik Russlands erinnert an die Politik Deutschlands nicht nur zur Zeit der Naziherrschaft (die Episode der Sudetendeutschen in der Tschechoslowakei) sondern während des ganzen 20. Jahrhunderts. Wie ein Experte in der Zeitung Le Monde vom 10.08.08 erklärte: „Südossetien ist weder ein Land noch ein Regime. Es ist eine durcheinander gewürfelte Gesellschaft, zusammengesetzt aus russischen Generälen und ossetischen Banditen, die sich auf dem Hintergrund des Konfliktes mit Georgien bereichern wollen.“ Die Rückkehr zum entfesseltsten Nationalismus und zu militärischem Abenteurertum ist für die herrschende Klasse immer das bevorzugte Mittel um zu versuchen, Probleme der Innenpolitik zu regeln. Nachdem der georgische Präsident mit 95% Stimmenanteil nach der gegen den ehemaligen ‚sowjetischen’ Minister Schewardnadse gerichteten „Rosenrevolution“ im Herbst 2003 gewählt worden war, hatte er Anfang 2008 große Schwierigkeiten wiedergewählt zu werden, obgleich er Unterstützung durch die USA erhielt. Aber Korruption und sein autokratischer Regierungsstil hatten seine Glaubwürdigkeit stark angekratzt. Dieser bedingungslose Anhänger Washingtons übernahm übrigens die Staatsgeschäfte in einem Staat, welcher seit seiner Gründung 1991 am Tropf der USA, dem Führer der von Bush Sen. Verheißenen ‚neuen Weltordnung’ hängt. Russland und Putin haben nun Saakashwili eine Falle gestellt, in welche dieser auch gelaufen ist. Sie haben damit die Gelegenheit genutzt, ihre Muskeln spielen zu lassen und ihre Autorität im Kaukasus wiederherzustellen (welcher einen wahren Splitter in der russischen Achillesverse darstellt), und um so auf die seit 1991 erfolgte Einkreisung Russlands durch die Nato zu reagieren. Aus russischer Sicht hat diese Einkreisung ein unerträgliches Niveau erreicht, nachdem nun die USA den Beitrittswunsch Georgiens und der Ukraine zur Nato unterstützen. Auch und vor allem kann Russland nicht hinnehmen, dass in Polen und der Tschechischen Republik Raketenabwehrbasen errichtet werden, die aus russischer Sicht nicht gegen den Iran gerichtet sind, sondern gegen Russland selbst. Russland hat die Tatsache ausgenützt, dass die Hände des Weißen Hauses gebunden sind, dessen Truppen im Irak und in Afghanistan in der Klemme stecken. So konnte Russland eine militärische Gegenoffensive im Kaukasus starten, nachdem es erst kurz zuvor durch den äußerst mörderischen Krieg in Tschetschenien seine Autorität ein wenig wiederherstellen konnte. Aber die Verantwortung für diesen Krieg und das Abschlachten beschränkt sich nicht auf die direkten Teilnehmer. Allen imperialistischen Mächten, die heute heuchlerisch Krokodilstränen über das Schicksal Georgiens vergießen, klebt Blut an den Fingern – so zum Beispiel den USA mit ihren beiden Golfkriegen, Frankreich und seiner Beteiligung am Völkermord in Ruanda 1994, oder auch Deutschland, das 1992 den Balkan mit in den Krieg trieb.
Die Masken fallen!
Das Ende des kalten Krieges und der Blockpolitik hat nicht zu einem „Zeitraum des Friedens und der Stabilität“ auf der Welt geführt. Von Afrika bis zum Mittleren Osten, über den Balkan und nun im Kaukasus ist davon nichts zu spüren. Das Auseinanderbrechen des ehemaligen stalinistisch beherrschten Blocks hat in Wirklichkeit nur neue imperialistische Appetite gestärkt und ein wachsendes kriegerisches Chaos hervorgebracht.
Georgien liegt übrigens in einer wesentlichen strategischen Schlüsselstellung– deshalb wurde es während der letzten Jahre immer wieder umworben. Während der stalinistischen Zeit war es nur ein Transitland für russische Öllieferungen zwischen Wolga und Ural. Seit 1989 ist es ein Schlüsselgebiet für die Ausbeutung der Reichtümer des Kaspischen Meeres. Im Mittelpunkt dieses Gebietes gelegen, ist Georgien zu einem Hauptdreh- und Angelpunkt für die Öl- und Gaslieferungen aus dem Kaspischen Meer, Aserbaidschan, Kasachstan, Turkmenistan geworden, und seit 2005 verbindet die 1800 km lange Ölpipeline BTC, die direkt unter US-Führung gebaut wurde, den aserbaidschanischen Hafen Baku über Tiflis direkt mit dem türkischen Ölhafen Ceyhan. Damit wurde Russland bei dem Transport des Öls aus dem Kaukasus verdrängt. Aus Moskaus Sicht gibt es eine unmittelbare Bedrohung, dass Zentralasien, wo sich 5% der Weltreserven an Öl und Gas befinden, zu einer Alternative für die dominierende Rolle Russlands bei der Versorgung Europas mit Gas wird. Dies um so mehr, da die Europäische Union seit einiger Zeit von dem Projekt einer Gasleitung von 330 km Länge namens Nabucco träumt, die parallel zur BTC verläuft, und direkt die Gasfelder des Irans und Aserbaidschans mit Europa durch die Türkei verbindet, während der neue Präsident Russlands, Medwedew - ein ehemaliger Chef von Gazprom - , darauf reagiert hat, indem er ein gewaltiges Konkurrenzprojekt vorgeschlagen hat, welches unter dem Schwarzen Meer verläuft und somit Europa direkt verbindet. Die erwarteten Kosten werden auf ca. 20 Milliarden Dollar geschätzt.
Hin zu einem neuen ‘kalten Krieg’ ?
Die beiden ehemaligen Blockführer, Russland und USA, stehen sich nun erneut gefährlich gegenüber; aber der heutige imperialistische Rahmen unterscheidet sich stark von dem des kalten Krieges, als es eine lückenlose Blockdisziplin gab. Seinerzeit wollte man uns lange glauben machen, der Konflikt zwischen den beiden Blöcken sei vor allem der Ausdruck eines ideologischen Kampfes: Der Kampf zwischen den Kräften der Freiheit und Demokratie gegen den Totalitarismus, welcher mit dem Kommunismus gleichgesetzt wurde. Heute kann man genau sehen, wie sehr uns diejenigen, welche einen ‚neuen Zeitraum des Friedens und der Stabilität“ versprochen hatten, getäuscht hatten. Ihr Aufeinanderprallen ist nur ein bestialischer und mörderischer Ausdruck des unverblümten Kampfes um schmutzige und niederträchtige imperialistische Interessen. Heute werden die Beziehungen der Staaten untereinander durch die Tendenz des Jeder-für-sich beherrscht. Der Waffenstillstand spiegelt nur den Triumph der Kremlherren und der russischen Überlegenheit auf militärischer Ebene in Georgien wider, der eine erniedrigende quasi-Kapitulation Georgiens (dessen territoriale Integrität nicht sichergestellt ist) vor den von Moskau diktierten Bedingungen bedeutete. So stellt diese Parodie von „Friedenskräften“, die in Südossetien und Abchasien stationiert wurden und sich ausschließlich aus Soldaten der russischen Armee zusammensetzen, eine offizielle Anerkennung des ständigen Verbleibs von russischen Besatzungstruppen inmitten georgischen Territoriums dar. Russland hat seinen militärischen Vorteil ausgenutzt, um sich in Georgien mit seinen Truppen niederzulassen, die in fast ganz Georgien ungeachtet der Verurteilung der ‚internationalen Gemeinschaft’ ihren Einzug gehalten haben. Der ‘Schutzherr’ Georgiens, die USA, hat ebenso erneut einen herben Rückschlag einstecken müssen. Während Georgien einen hohen Tribut für seine Anbindung an die USA zahlen musste (ein zweitausend Mann starkes Kontingent von georgischen Soldaten wurde in den Irak und Afghanistan geschickt), konnte dagegen Uncle Sam seinem Verbündeten lediglich ‚moralische Unterstützung’ anbieten und Russland mit leeren Verurteilungen überhäufen ohne auch nur eine Hand heben zu können, um Georgien effektiv verteidigen zu können. Der wichtigste Aspekt dieser Schwächung ist, dass das Weiße Haus nicht einmal einen Alternativplan für diesen brüchigen Waffenstillstand anbieten konnte, der sich auf einen Kuhhandel stützt. Die USA sind sogar gezwungen, den „europäischen Plan“ zu schlucken; schlimmer noch, es handelt sich um ein Abkommen, dessen Bedingungen von Moskau diktiert wurden. Noch erniedrigender war, dass die US-Außenministerin Condoleeza Rice eigens anreisen musste, um den georgischen Präsidenten zu zwingen, das Abkommen zu unterzeichnen. Dies offenbart die amerikanische Hilflosigkeit und den Niedergang der ersten Weltmacht. Diese neue Etappe der US-Schwächung wird die Glaubwürdigkeit der USA noch weiter untergraben und Sorgen unter den Staaten verstärken, die - wie Polen und die Ukraine - auf deren Unterstützung angewiesen sind. Während die USA ihre Unfähigkeit offenbaren, wird auch gleichzeitig durch diesen Konflikt die Haltung des jeder-für-sich unter den Europäern deutlich. Gegenüber der Lähmung der USA ist die ‚europäische Diplomatie’ in Aktion getreten. Es ist ganz aufschlussreich, dass der französische Präsident Sarkozy als Sprecher Europas in seiner Eigenschaft als Ratspräsident aufgetreten ist, obwohl er in Wirklichkeit oft nur seine eigenen Interessen mit einem marktschreierischen und Aufsehen erregenden Stil vertritt. Seine ‚Dienste' entbehren jeder Kohärenz; stattdessen entpuppt er sich immer als Meister kurzfristiger, überstürzter Schritte auf internationaler Ebene. Erneut wollte Sarkozy seinen Senf zur Beilegung des Konfliktes beitragen, vor allem um damit zu prahlen. Aber der berühmte „französische Friedensplan“ (er konnte nicht lange die Illusion aufrechterhalten, es handele sich um einen nationalen oder europäischen Erfolg) ist nur ein lächerlicher Schein, welcher kaum die Tatsache verdecken kann, dass seine Bedingungen ganz einfach von Russland aufgezwungen wurden. Und wie könnte Europa daraus Nutzen ziehen, wenn es in seinen Reihen die unterschiedlichsten und gegensätzlichsten Positionen gibt? Wie könnte es auch nur ein Mindestmaß an Einheit mit Polen und den Baltischen Staaten in seinen Reihen geben, welche aufgrund ihrer tief verwurzelten anti-russischen und anti-deutschen Haltung inbrünstige Verteidiger Georgiens sind. So hatte sich Deutschland gegen das Streben der USA nach verstärktem Einfluss in der Region mit am entschlossensten gegen die Aufnahme Georgiens und der Ukraine in die Nato ausgesprochen. Wenn jüngst Angela Merkel eine spektakuläre Kehrtwende vollzog und dem georgischen Präsidenten ihre Unterstützung für die Bewerbung um die Aufnahme versicherte, geschah dies, weil sie durch die wachsende Unpopularität Russlands dazu gezwungen wurde, das sich im von ihm besetzten Teil Georgiens hochmütig verhält, aber von der ‚internationalen Gemeinschaft’ stark verurteilt wird. Europa gleicht eher einem Haifischbecken, wo Frankreich seine eigene Politik verfolgt und durch seinen Versuch, Wolf und Schaf zu versöhnen, Putin einen tollen Dienst erwiesen hat, oder wo Großbritannien sehr schnell Stellung für Georgien bezog, um sich besser seinem großen Rivalen, Deutschland, entgegenzustellen. Und der Nutzen, den Russland aus dieser Entwicklung zieht, ist selbst sehr begrenzt. Sicher hat Russland seine imperialistische Position nicht nur im Kaukasus kurzfristig verstärken können – und dies allein lässt schon Schlimmes befürchten. Die Armada der russischen Flotte hat die Kontrolle über die See gewonnen und drohte damit, jedes Schiff zu versenken, das sich ihr in dieser Region näherte. Obwohl Russland seine Position unmittelbar im Kaukasus ausbauen kann, reicht dieser militärische Sieg nicht aus, um die USA von ihrem Projekt der Errichtung von Raketenabschussanlagen auf europäischem Boden abzubringen. Im Gegenteil: Washington ist dadurch angetrieben worden, die Installierung noch schneller voranzutreiben, wie das soeben mit Polen unterzeichnete Abkommen zur Errichtung des Raketenschilds zeigt. Als Vergeltungsmaßnahme hat der stellvertretende russische Generalstabschef Russlands schon damit gedroht, Polen zu einem bevorzugten Ziel seines nuklearen Arsenals zu machen. In Wirklichkeit ist der russische Imperialismus weniger an der Unabhängigkeit oder der Annektierung Südossetiens und Abchasiens interessiert; er will viel mehr eine Position der Stärke erlangen, um bei den Verhandlungen über die Zukunft Georgiens die Fäden zu ziehen. Aber seine kriegerische Aggressivität und das Ausmaß der eingesetzten militärischen Mittel in Georgien wecken bei seinen imperialistischen Rivalen alte Ängste, und bei seinem Versuch der Durchbrechung seiner Isolierung ist es diplomatisch isolierter als je zuvor. Keine Macht kann beanspruchen, die Lage im Griff zu haben oder sie gar zu kontrollieren; und die Schwankungen und Umkehrungen von Bündnissen, die wir sehen, spiegeln eine gefährliche Zuspitzung der imperialistischen Rivalitäten wider.
Im Kapitalismus ist kein Frieden möglich
Aber es gibt keinen Zweifel daran, dass alle imperialistischen Mächte, ob groß oder klein, das gleiche Interesse und das gleiche Bestreben an den Tag legen, um eine Rolle zu spielen und einen Platz auf diplomatischer Ebene in einer Region einzunehmen, in der es eine Bündelung großer geo-strategischer Interessen gibt. Dies zeigt, wie stark alle imperialistischen Mächte für diese Situation verantwortlich sind. Mit dem Öl und dem Gas aus der Region des Kaspischen Meeres oder der zentralasiatischen, oft türkisch-sprachigen Länder, stehen die vitalen Interessen der Türkei und des Irans auf dem Spiel. In Wirklichkeit mischt aber die ganze Welt bei diesem Konflikt mit. Im Kaukasus kann man viel leichter menschliches Kanonenfutter auftreiben, da diese Region ein bunt gemischtes ethnisches Mosaik ist. Die Osseten sind zum Beispiel iranischen Ursprungs. Man kann sich leicht vorstellen, dass eine interessierte Macht solch eine ethnische Zerstückelung ausnutzt und die nationalistischen Flammen mit anfacht Die vorherrschende Rolle Russlands stellt ebenso eine schwere Bürde dar. Sie weist auf andere, schwerer wiegende zukünftige imperialistische Spannungen hin: Man konnte die Ängste und Mobilisierung der Baltischen Staaten und vor allem der Ukraine beobachten; die Ukraine verfügt immer noch über viele Waffen und vor allem ein Atomwaffenarsenal, also eine ganz andere Nummer als Georgien. Dieser Krieg erhöht das Risiko einer destabilisierenden Feuersbrunst nicht nur auf regionaler Ebene, sondern er wird auch unvermeidbare weltweite Auswirkungen haben hinsichtlich des Gleichgewichtes der zukünftigen imperialistischen Beziehungen. Der „Friedensplan“ ist nur ein Scheinfriedensplan, nichts als Sand in den Augen. Alle Elemente für eine neue zukünftige kriegerische Eskalation sind vorhanden, wodurch sich eine ganze Kette von Feuersbrünsten in der Region vom Kaukasus bis zum Mittleren Osten entfalten würde. Nicht durch die Forderung nach mehr Demokratie, den Respekt der Menschenrechte, oder der Glaube an die Abkommen unter imperialistischen Gangstern oder ihre internationalen Übereinkommen werden die gegenwärtigen Verhältnisse überwunden. Der einzige Weg, um dem Krieg ein Ende zu setzen, ist die Überwindung des Kapitalismus. Und dies kann nur durch den Kampf der Arbeiterklasse geschehen. Die einzigen Verbündeten der Arbeiterklasse sind die anderen Arbeiter, über alle Grenzen, Völker und nationalistische Fronten hinweg. Die einzige Art, wie die Arbeiter der ganzen Welt ihre Solidarität gegenüber ihren Klassenbrüdern und –schwestern in Russland, Georgien, Ossetien, Abchasien oder gegenüber den Opfern der Kriege und der Massaker zum Ausdruck bringen können, besteht darin, dass sie ihren Kampf für die Überwindung des Systems verstärken. Dem kriegerischen Nationalismus der herrschenden Klasse können wir nur den Aufruf des Kommunistischen Manifestes entgegenstellen: Die Arbeiter haben kein Vaterland. Arbeiter aller Länder, vereinigt Euch! W.17.08.08
Geographisch:
Aktuelles und Laufendes:
- Georgien [33]
- Krieg im Kaukasus [34]
Leute:
- Shaakaswili [35]
Theoretische Fragen:
- Internationalismus [36]
Nahrungsmittelkrise: Der Preis der kapitalistischen Gier wird uns in den Hungertod treiben - Bericht von den Philippinen
- 3169 reads
Der Artikel, den wir unten veröffentlichen, ist uns von den Genossen der Gruppe Internationalysmo von den Philippinen zugeschickt worden. Er zeigt uns den wirklichen Wert der Krokodilstränen, die von der herrschenden Klasse der Philippinen, ob in der Regierung oder in der Opposition, über das Leid der Bevölkerung infolge der Ernährungskrise vergossen werden, eine Krise, die nicht das Ergebnis schlechter Ernten ist, sondern die Folge des unstillbaren Durstes der kapitalistischen Wirtschaft nach Profit, ganz gleich,
Der Artikel, den wir unten veröffentlichen, ist uns von den Genossen der Gruppe Internationalysmo von den Philippinen zugeschickt worden. Er zeigt uns den wirklichen Wert der Krokodilstränen, die von der herrschenden Klasse der Philippinen, ob in der Regierung oder in der Opposition, über das Leid der Bevölkerung infolge der Ernährungskrise vergossen werden, eine Krise, die nicht das Ergebnis schlechter Ernten ist, sondern die Folge des unstillbaren Durstes der kapitalistischen Wirtschaft nach Profit, ganz gleich, was es kostet. Und die Zeche wird von den in Armut lebenden Massen, die von der massiven Steigerung der Lebensmittelpreise betroffen sind, sowohl unmittelbar als auch langfristig bezahlt, da die zynische Unverantwortlichkeit der kapitalistischen Klasse in zunehmendem Maße das ökologische System ruiniert, von dem die Nahrungsmittelproduktion der Menschheit abhängt.
Die Analyse des Artikels konzentriert sich auf die Biospritherstellung und auf die Erosion der Reisanbaugebiete durch ein Über-Bewirtschaften des Bodens. Ein Punkt sollte aus unserer Sicht noch hinzugefügt werden: die Rolle, die die Umleitung von Spekulationskapital aus den US-amerikanischen und europäischen Immobilienmärkten in die Warenmärkte – und insbesondere in die Zukunftsmärkte für Nahrungsmittel – spielt. Laut Jean Ziegler, UN-Sonderberichterstatter über das Recht auf Ernährung, können - neben der Verwendung von Getreide für Biosprit als Hauptschuldigen beim Anstieg der Nahrungsmittelpreise – immerhin 30 Prozent des Anstiegs direkt der Spekulation auf den Warenterminmärkten zugeschrieben werden.
Die Welternährungskrise trat erst kürzlich in den Blickpunkt des medialen Interesses, aber sie ist ein Phänomen, das sich über Jahrzehnte beständig weiterentwickelt hat. Die Hungerrevolten von Haiti bis Bangladesh, von Pakistan bis Ägypten mögen das Thema der in die Höhe schnellenden Kosten für Grundnahrungsmittel in den Mittelpunkt der weltweiten Aufmerksamkeit gerückt haben, doch bleibt die Tatsache gültig, dass sie alle das Resultat von Jahren einer sich anhäufenden kapitalistischen Verheerung sind. Eine Zeitlang versuchten nationale Regierungen wie das Arroyo-Regime, die Zeichen der immer näher rückenden Krise zu ignorieren, selbst als die Preise für Reis auf den staatlichen Märkten in den Philippinen auf ein 34-Jahres-Hoch schnellten. Der philippinische Präsident spöttelte gar, dass es so etwas wie Reiskürzungen nicht geben könne, denn diese seien „physische Phänomene, bei denen sich Leute auf den Straßen anstellen, um Reis zu kaufen. Sieht man heute derartige Schlangen?“ (2)
Die Welt befindet sich inmitten einer unerhörten Inflation, die die Nahrungsmittelpreise auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten getrieben hat. Diese Teuerung betrifft zuvorderst alle Arten von Nahrungsmittel, vor allem aber die wichtigsten Erzeugnisse wie Korn, Reis und Weizen. Laut der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft stiegen zwischen März 2007 und März 2008 die Getreidepreise um 88 Prozent, die Preise für Speiseöl und Fett um 106 Prozent und die Preise für Molkerei-Produkte um 48 Prozent. Ein Weltbank-Bericht wies ferner darauf hin, dass in den 36 Monaten vor dem Februar 2008 überall auf der Welt die Nahrungsmittelpreise um 83 Prozent gestiegen sind; er erwartete, dass die meisten Nahrungsmittelpreise bis 2015 weit über dem Stand von 2004 verbleiben. (3)
In Thailand schnellte der Preis für die beliebteste Reissorte, für die man in den letzten fünf Jahren 138 Dollar die Tonne bezahlt hatte, am 24. April 2008 auf ein Rekordhoch von über 1.000 Dollar pro Tonne, und Händler sowie Exporteure erwarten, dass sich dies angesichts der angespannten Versorgungslage noch fortsetzen wird. (4) Dasselbe Phänomen wiederholt sich überall auf der Welt. Allein auf den Philippinen stieg der Preis für Reis im Einzelhandel von 60 Cent pro Kilogramm vor einem Jahr auf 75 Cent pro Kilo heute. Und in einem Land, wo 68 seiner 90 Millionen Einwohner von weniger als zwei US-Dollar pro Tag leben (5), ist dies ein Albtraum von horrenden Ausmaßen.
Die Welternährungskrise ist das unvermeidliche Ergebnis der permanenten Krise des Kapitalismus seit Ende der 1960er Jahre. Viele Volkswirtschaften kämpfen darum, flott zu bleiben in einer Welt der intensiven Konkurrenz und des kapitalistischen Profitstrebens auf einem bereits gesättigten Weltmarkt. Infolgedessen praktizieren die Regierungen eine Wirtschaftspolitik, die darauf ausgerichtet ist, das Wachstum von Industrien anzuregen; eine Politik, die immer mehr Geld in die eigene Wirtschaft steckt, statt für die Befriedigung der Bedürfnisse des Volkes zu sorgen. Kombiniert mit dem unhaltbaren Gebrauch der natürlichen Ressourcen und dem ungestümen Drang der Industrieproduktion nach Profit, der die Umweltverschmutzung und die Emission von Treibhausgasen weltweit verschlimmert, sieht sich die Menschheit nun einem zerstörerischen Gebräu nach kapitalistischer Rezeptur gegenüber.
Auf dem Gebiet der landwirtschaftlichen Produktion haben die Verwendung von Stickstoff und die Übersäuerung der Böden zur Ankurbelung der kapitalistischen Agrarproduktion die Gesamtproduktivität der einst fruchtbaren Zonen der Agrarproduktion ruiniert. Und auch wenn es zutrifft, dass die Anwendung moderner Bewirtschaftungsmethoden zu Beginn der grünen Revolutionen weltweit anfangs eine Steigerung der Produktivität erbracht hatte, so ist es auch wahr, dass es in vielen Teilen der Welt seither eine allmähliche Abnahme der landwirtschaftlichen Produktion gab. Laut eines Berichts des in London ansässigen Instituts für Gesellschaftswissenschaften:
„In Indien sank der Ertrag von Getreide pro Einheit des verwendeten Düngers während der Jahre der grünen Revolution um zwei Drittel.
Zwischen 1970 und 2000 wuchs die Steigerungsrate des jährlichen Verbrauchs von Düngemitteln für asiatischen Reis vom Dreifachen auf das Vierzigfache der Reiserträge an (8). In Zentral-Luzon, der Hauptinsel der Philippinen, stieg der Reisertrag während der 1980er Jahre um 13 Prozent, dies jedoch nur um den Preis einer 21prozentigen Steigerung des Verbrauchs von Düngemitteln. In den Central Plains ging der Ertrag lediglich um 6,5 Prozent hoch, während der Düngemittelverbrauch um 24 Prozent zunahm und der Verbrauch von Pestiziden um 53 Prozent hochschnellte. Auf West-Java stand einer 23prozentigen Ertragssteigerung eine 65 bzw. 69prozentige Zunahme von Pestiziden und Düngemitteln gegenüber. Jedoch war es das absolute Sinken der Erträge trotz eines hohen Inputs von Düngemitteln, das letztendlich die Blase der Grünen Revolution zum Platzen brachte. Nach dramatischen Steigerungen zu Beginn der Grünen Revolution begannen die Erträge ab den 1990er Jahren zurückzugehen. Auf Zentral-Luzon, Philippinen, stiegen die Reiserträge während der 70er Jahre stetig an, erreichten zu Beginn der 80er Jahre ihren Höhepunkt und sind seither allmählich gefallen. Ähnlich ging es im Reis-Weizen-System in Nepal und Indien zu. Wo die Erträge noch nicht fallen, hat sich die Wachstumsrate rapide verlangsamt oder auf einem Niveau eingependelt, wie in China, Nordkorea, auf den Philippinen, in Birma, Indonesien, Thailand, Pakistan und Sri Lanka geschehen.
Seit 2000 sind die Erträge weiter zurückgegangen, bis zu dem Umfang, dass in sechs der letzten sieben Jahre die Weltgetreideproduktion hinter dem Konsum zurückgefallen ist.“ (6)
Das Streben eines dekadenten, in seinen eigenen Widersprüchen verstrickten Systems nach Profit ist in die Zerstörung der natürlichen Fruchtbarkeit der ausgelaugten Böden gemündet. Auch wenn es zutrifft, dass die Weltwirtschaft immer noch mehr Nahrungsmittel produziert, als die Welt benötigt, ist vieles von dem, was produziert und auf dem globalen kapitalistischen Markt gehandelt wird, verdorben, ehe es den Markt erreicht, und wenn es ankommt, können Millionen von Menschen sich seinen Erwerb nicht mehr leisten. Letztendlich ist der Schlusspunkt die Pauperisierung der Arbeiterklasse und die Unterjochung eines immer größeren Teils der Menschheit unter äußerste Armut und Not. Denn der Kapitalismus ist an erster Stelle an der Akkumulation von Mehrwert interessiert und niemals an der Befriedigung der Bedürfnisse der Gesellschaft.
Die „Reiskrise“ auf den Philippinen
Laut Arturo Yap, dem Landwirtschaftsminister der Philippinen, „haben (wir) keine Ernährungskrise, sondern vielmehr eine Krise der Reispreise. Alle von uns suchen nach neuen Lösungen – wie man sich nicht nur der Versorgungsfrage, sondern auch der Preisfrage zuwendet, wie man (sicherstellen kann), dass die armen Familien etwas zum Essen haben.“ Er sagte, dass es fünf ernste Gründe für die „Reis“-Lage auf den Philippinen gebe, denen sich die Regierung widmen müsse: Die Versorgungslage sei erstens größtenteils durch die wachsende Nachfrage einer wachsenden Bevölkerung betroffen; zweitens durch die Auswirkungen des Klimawechsels; drittens durch die boomende Nachfrage nach Biosprit; viertens durch die fortgesetzte Umwandlung von Ackerland zugunsten einer nicht-landwirtschaftlichen Nutzung; und schließlich gebe es eine Vernachlässigung der Bewässerungsanlagen.
Auf dem ersten Blick mag man die so genannten Ursachen der philippinischen „Reis“-Krise für sich genommen als gültig betrachten. Doch die Tatsache hinter alldem ist die unbestrittene Wahrheit, dass der Rahmen, innerhalb dessen jene aufgezählten Ursachen wirken, die eigentliche Ursache ist, die alle anderen auslöst – der kapitalistische Rahmen der Produktion weltweit. Erstens ist die Behauptung, dass das Angebot angeblich von der wachsenden Nachfrage einer wachsenden Bevölkerung betroffen ist, nichts anderes als eine Ausrede angesichts der Tatsache, dass das, was von der kapitalistischen Weltwirtschaft produziert wird, eher an der Produktion von Mehrhwert als an der Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse orientiert ist. Zweitens sind auch die Auswirkungen des Klimawechsels auf die landwirtschaftliche Produktion an sich eine direkte Folge des kapitalistischen Rahmens der Produktion. Beispielsweise ist es nicht die Industrialisierung an sich, die verantwortlich ist für die Veränderung der klimatischen Bedingungen, sondern „das überwiegende Bestreben des Kapitalismus, die Profite zu maximieren, und seine konsequente Missachtung der menschlichen und ökologischen Bedürfnisse, es sei denn, sie fallen mit dem Ziel der Reichtumsvermehrung zusammen“ (7). Es gibt keinen Zweifel, dass es durch die Hände des kapitalistischen Weltsystems, das von einem unablässigen Streben nach Profit und wirtschaftlicher Expansion getrieben wird, zu einer entsetzlichen Verschlechterung der Umwelt gekommen ist. Aber Fakt ist, alle bürgerlichen Staaten, einschließlich des philippinischen Staates, der die astronomischen Kosten der ökologischen Verschlechterung am eigenen Leib erlebt, beschützen den Profithunger ihres jeweiligen nationalen Kapitals und ihre politischen Marionetten, um Forschung und Entwicklung einer umweltfreundlicheren Energiequelle für die Industrieproduktion zu sabotieren. Drittens ist der so genannte Umkehreffekt der boomenden Nachfrage nach Biosprit an die Landwirtschaft selbst das Resultat der von allen Regierungen (einschließlich der Arroyo-Regierungen) praktizierten Politik, nach alternativen Energiequellen zu suchen, um die Last der Abhängigkeit ihrer Industrie von ausländischem Erdöl etwas zu mindern. Hinzu kommt, dass die Senkung der Ausgaben fürs Öl zugunsten „sozialer“ Zwecke die Kapazität der Staaten zu Rüstungsproduktion und Krieg steigert. Es sind keineswegs ökologische Anliegen, die die Politik zur Entwicklung von Biokraftstoffen antreiben, sondern die Notwendigkeit für jedes nationale Kapital, sich selbst vor den steigenden Rohölpreisen auf dem Weltmarkt abzuschirmen, was so weit geht, die Kriegsanstrengungen aller bürgerlichen Staaten zu „unterstützen“. Es ist höchst aufschlussreich, dass schon im Zweiten Weltkrieg sowohl die Alliierten wie die Vereinigten Staaten als auch die Achsenmächte wie Deutschland bei ihren Kriegsbemühungen Biokraftstoffe verwendeten. Im Falle der Philippinen steht die Logik, Agrarerzeugnisse von den Tellern wegzulenken und auf die Bedürfnisse der Biosprit-Industrie auszurichten, in Übereinstimmung mit den Anstrengungen der philippinischen Regierung, mehr hochbezahlte, lukrativere Feldfrüchte zu produzieren, um das Streben nach zusätzlichen Dollareinnahme-Quellen zu forcieren. Viertens ist die fortgesetzte Umwandlung von Agrarland in Parzellen, Golfplätze, Einkaufszentren und Industriekomplexe ebenfalls eine direkte Folge der Landwirtschaftspolitik der Regierungen, besonders auf den Philippinen. Das jahrzehntealte Allgemeine Agrarreformprogramm (CARP – Comprehensive Agrarian Reform Program) scheiterte katastrophal. CARP ist nicht nur ein mystifizierendes und reaktionäres Programm der philippinischen Bourgeoisie; darüber hinaus ist es auch ökonomisch nicht lebensfähig. In einem Zeitalter, in dem die intensive kapitalistische Konkurrenz auf dem Weltmarkt die kleinen landwirtschaftlichen Produzenten wegen der hohen Bewirtschaftungskosten und den wachsenden Schulden zur Strecke bringt, sind die Bauern gezwungen, entweder ihrem Land den Rücken zuzukehren oder sich selbst prekären Arrangements zu unterwerfen, wie die Subunternehmer größerer Unternehmen, eine Praxis, die in der Region von Mindanao auf den Philippinen weitverbreitet ist. (8) Was das ewige Problem der schlimmen Vernachlässigung der Bewässerungssysteme auf den Philippinen angeht, so ist dies eher eine Frage des Mismanagements und der Korruption in der Regierung, ein Ausdruck des Zerfalls der ideologischen Formen in der kapitalistischen Dekadenz, in der Selbstgefälligkeit und die Mentalität des „Jeder-für-sich“ über alles andere herrscht.
Wie von einem Staat zu erwarten, der mit einer Krise von so großer Tragweite inmitten der kapitalistischen Dekadenz konfrontiert ist, antwortete der philippinische Staat durch die Arroyo-Regierung in Form aktiver Staatsinterventionen – eine Reaktion, die von allen linkskapitalistischen Formationen auf den Philippinen zusammen mit ihren Bemühungen, zu staatlich verordneten Lohnerhöhungen aufzurufen, unterstützt und grimmig entschlossen weiterentwickelt wird. So wie sich die Krisenschübe intensivieren, so häufen sich auch die verschleiernden Bemühungen des Staates, sie einzudämmen. Linke wie Rechte des Kapitals sind eins, wenn es darum geht, das Hirngespinst zu verbreiten, dass „nur der Staat“ die ArbeiterInnen und die Ärmsten der Armen vor den Hungerschüben und dem äußersten Elend bewahren könne. Sie ignorieren völlig die Tatsache, dass der Staat, den sie zu mehr Interventionen ermutigen wollen, jenes Organ ist, das die bürgerliche Diktatur durchsetzt, das die Quelle der Versklavung und des Leids – den Kapitalismus – beschützt. In ihrem Versuch, in Form und Inhalt „radikaler“ zu sein, drängten einige linkskapitalistische Strömungen auf eine aggressive und absolute Kontrolle der Gesellschaft durch den Staat.
Die linkskapitalistische Kritik, dass das, was der Staat tut – „Steigerung“ des Etats des Landwirtschaftsministeriums, Vergeben von „Reissubventionen“ für die „Ärmsten der Armen“ und die staatliche Konkurrenz zu den Privathändlern beim Kauf und Einkauf von Reis -, nicht genug sei und dass es an „politischem Willen“ mangele, zeigt deutlich, dass die Linksextremisten die absolute staatliche Kontrolle wollen. Sie gehen dabei sogar so weit, dass sie ihr uraltes Dogma der Parteiherrschaft und des Totalitarismus schwingen – die komplette und allumfassende Kontrolle durch den Staat, wie in den so genannten sozialistischen Ländern, die sie als „Überbleibsel“ der Oktoberrevolution verteidigen.
Es gibt keine Lösung der Krise innerhalb des kapitalistischen Systems
Rechte wie Linke des Kapitals sind sich einig darin, verschleiernde Programme in die Welt zu setzen, die die Tatsache verbergen sollen, dass es innerhalb des Systems keine Lösung der Krise gibt. Der Widerspruch zwischen Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse ist bereits auf die Spitze getrieben. Keine reformistischen oder vorübergehendenen Interventionen des Staates können etwas an der Tatsache ändern, dass – gleich, welche Lösungen innerhalb des Bollwerks des Kapitalismus formuliert werden – dies zu einer noch intensiveren Krise und Umweltzerstörung führen wird. Jede wirksame Lösung, die das Kapital anbieten kann, wird lediglich eine noch größere Bürde für die Arbeiterklasse und die sich abplackenden Massen bedeuten. Selbst wenn der Staat absolute Kontrolle über das Wirtschaftsleben der Gesellschaft ausübt, so wird sich die Krise dennoch weiter verschärfen, und dies infolge der Sättigung der Märkte und der Unfähigkeit der Bevölkerung, die überbordende Produktion von Waren innerhalb eines Systems aufzunehmen, das sein Leben der Konkurrenz und dem Profit verdankt. Die Geschichte hat bereits bewiesen, dass der Staatskapitalismus und der Totalitarismus eine zwecklose Reaktion des Kapitals im Angesicht einer permanenten und sich verschärfenden Krise ist. Der Zusammenbruch der Sowjetunion und Osteuropas Anfang der 1990er Jahre liefert Zeugnis ab für diese Tatsache.
Die Lösung der Krise liegt nicht innerhalb des sterbenden Systems, sondern außerhalb von ihm. Es liegt in den Händen der einzigen revolutionären Klasse – der Arbeiterklasse -, die Saat für die künftige kommunistische Revolution zu legen. Die Lösung ist nicht innerhalb des kapitalistischen Bollwerks noch ist sie auf den Spuren der Reformen oder im friedlichen Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus zu finden. Die Lösung liegt nicht in der absoluten Kontrolle des Wirtschaftslebens der Gesellschaft durch den Staat, sondern in der Zerstörung des Kapitalismus an sich wie auch des bürgerlichen Staates, der als Herrschaftsmaschinerie dient.
Mit anderen Worten: die Lösung der Ernährungskrise ist die Zerstörung eines Produktionssystems, das auf dem Markt und Profit basiert, und die Etablierung eines Systems, das auf der absoluten Produktion für die menschlichen Bedürfnisse basiert. Und der erste Schritt in diese Richtung und in Richtung einer revolutionären Umwandlung der Gesellschaft ist nicht die legalistische und reformistische Herangehensweise etlicher linksextremistischer Organisationen, noch liegt es in den Händen einer absolutistischen Staatsintervention, ihn zu tun. Er geschieht nicht auf dem friedlichen und „legalistischen“ Weg der lakbayan (Protestkarawanen und lange Märsche), die von den linksbürgerlichen Formationen popularisiert werden. Er geschieht auch nicht mittels Gewerkschaftstum. Die Lösung liegt in den Händen der Arbeiterklasse (9), die die Attacken des Kapitals auf ihrem eigenen Terrain mit ihren eigenen einheitlichen Kampforganen konfrontiert – die Arbeiterversammlungen, die Vorläufer der Arbeiterräte.
Arbeiter aller Länder, vereinigt euch! Nur auf dem Weg der Klasseneinheit wird nach der unvermeidlichen Zuspitzung der proletarischen Bewegung die proletarische Weltrevolution eingeleitet.
Internationalysmo, 7. Mai 2008
Fußnoten:
(1) Siehe in Environment News Service den englischsprachigen Bericht und auf der United Nations Site den französischen Bericht.
(2) Gil C. Cabacungan Jr., Arroyo warnte vor Reiskrise, Philippine Daily Inquire, 24. März 2008.
(3) „Die steigende Tendenz der internationalen Nahrungsmittelpreise setzte sich 2008 fort, ja beschleunigte sich. Die US-Weizenexportpreise stiegen von $375/Tonne im Januar auf $440/Tonne im März, und die thailändischen Reisexportpreise stiegen von $365/Tonne auf $562/Tonne. Dies war nur die Spitze einer 181prozentigen Verteuerung der globalen Weizenpreise in den 36 Monaten vor dem Februar 2008 und einer 83prozentigen Steigerung aller globalen Nahrungsmittelpreise in derselben Periode (...) Die beobachtete Verteuerung der Nahrungsmittelpreise ist kein vorübergehendes Phänomen, sondern wird sich noch weiter hinziehen. Es wird erwartet, dass die Preise für Getreide 2008 und 2009 hoch bleiben werden und dann zu fallen beginnen, da Angebot und Nachfrage auf die hohen Preise reagieren; jedoch werden sie aller Voraussicht nach bis 2015 für alle Getreidearten weit über dem Niveau von 2004 bleiben.“ (Rising Food Prices: Policy Options and World Bank Response, S. 2, unsere Hervorhebung, unsere Übersetzung)
(4) „Bangkok, 24. April – Die Benchmark thailändischer Reispreise sprang am Dienstag um mehr als fünf Prozent auf ein Rekordhoch von $1.000 die Tonne, und Händler unter den weltweit größten Exporteuren warnten vor weiteren Preissteigerungen, wenn der Iran und Indonesien in den Markt treten.“ (Reuters, Die Preise klettern auf ein neues Rekordhoch von über $1.000 pro Tonne, 24.4.2008 – gemeldet auf Flex News, unsere Übersetzung)
(5) Nationales Büro für Statistiken, Erhebung über Familieneinnahmen und –ausgaben 2006, Tag der Veröffentlichung: 11. Januar 2008.
(6) „Beware the New ‚Doubly Green Revolution‘“, ISIS-Presseveröffentlichung, 14.1.2008, unsere Übersetzung.
(7) Como, „Imperialist chaos, ecological disaster: Twin-track to capitalist oblivion“, Internationale Revue Nr. 129 (engl., franz. und span. Ausgabe), 2. Quartal, September 2007, S. 2.
(8) „Die Soyapa Erzeuger-Genossenschaft beschäftigt 360 VertragsarbeiterInnen, sowohl Erwachsene als auch Kinder. Die Genossenschaft wurde sechs Jahre zuvor auf Initiative von Stanfilco gegründet, als sie ihre Mitglieder davon überzeugte, Bananen zu pflanzen. Sie ist keine Kooperative – jeder Pflanzer behält seine eigene Parzelle als Eigentum, und jeder hat einen eigenen Vertrag abgeschlossen, um Bananen an Dole zu verkaufen.“ (Bananenkrieg auf den Philippinen – gemeldet am 8. Juli 1998 von Melissa Moore auf www.foodfirst.com [37])
(9) „Dass die Emanzipation der Arbeiterklasse von der Arbeiterklasse selbst erkämpft werden muss, dass der Kampf für die Emanzipation der Arbeiterklasse nicht einen Kampf um Klassenprivilegien und Monopole bedeutet, sondern für gleiche Rechte und Pflichten sowie für die Abschaffung der Klassenherrschaft“ (Die Internationale Arbeiterassoziation, Allgemeine Regeln, Oktober 1864, unsere Hervorhebung, unsere Übersetzung)
Aktuelles und Laufendes:
- Hungerrevolten [30]
- Nahrungsmittelkrise [38]
Theoretische Fragen:
- Umwelt [16]
Stellungnahme der KRASS (Russland) zum Krieg in Georgien
- 3116 reads
Stellungnahme der KRASS (Russland) zum Krieg in Georgien
Wir veröffentlichen nachfolgend eine Stellungnahme, die schon zu Beginn der Zusammenstöße in Georgien im Sommer 2008 von den Genoss/Innen der KRASS, einer kleinen Gruppe aus der anarcho-syndikalistischen Bewegung, von denen die meisten Genoss/Innen hauptsächlich in Russland wohnen, verbreitet wurde. Obgleich unsere beiden Organisationen bei bestimmten Fragen nicht übereinstimmen, stehen wir in brüderlichen politischen Beziehungen mit der KRASS; diese Beziehungen werden durch die internationalistischen Positionen untermauert, welche wir teilen. Diese Stellungnahme verdeutlicht nach den früheren Stellungnahmen der KRASS, insbesondere gegenüber dem Konflikt in Tschetschenien, erneut die sehr internationalistische Haltung der KRASS: · sie entblößen die ausschließlich kapitalistischen und imperialistischen Ziele der nationalen Regierungen und prangern deren Habsucht an, insbesondere die der Großmächte; · sie unterstützen keine der beiden kriegführenden Seiten im kapitalistischen und imperialistischen Konflikt ; · sie rufen die Arbeiter der am Krieg beteiligten Länder dazu auf, ihre Klassensolidarität über alle Landesgrenzen zu zeigen und den Kampf gegen ihre jeweiligen Ausbeuter zu führen. Deshalb unterstützen wir voll und ganz die wesentlichen Aussagen dieser Stellungnahme. Wir möchten jedoch präzisieren, dass die am Ende des Dokumentes an die Soldaten gerichteten Aufrufe (Weigerung, den Befehlen der Vorgesetzten zu folgen, die Waffen gegen sie zu richten usw.) zwar aus historischer Perspektive richtig sind (und sie wurden auch während der russischen Revolution 1917 und der deutschen Revolution 191 angewandt), aber sie können nicht unmittelbar umgesetzt werden, solange weder in der Region noch international die Arbeiterkämpfe ausreichend stark und gereift sind. In der gegenwärtigen Lage würde eine solche Haltung der Soldaten sie der schlimmsten Repression ausliefern, ohne dabei auf die Unterstützung ihrer Klassenbrüder/schwestern rechnen zu können. Aber wir möchten hier die unnachgiebige Verteidigung des Internationalismus der KRASS begrüßen sowie ihren politischen Mut, den sie seit Jahren unter besonders schweren Bedingungen in Anbetracht der Polizeirepression und des Gewichtes der Mystifikationen, insbesondere der nationalistischen, gezeigt haben. Diese Mystifikationen lasten auf dem Bewusstsein der Arbeiterklasse aufgrund des Gewichtes der stalinistischen Konterrevolution, die in Russland jahrzehntelang herrschte. Die IKS (25.08.08)
Nein zum neuen Krieg im Kaukasus !
Der Ausbruch neuer militärischer Aktionen zwischen Georgien und Südossetien droht zu einem viel größeren Krieg zwischen dem von der Nato unterstützten Georgien und dem russischen Staat zu werden. Tausende von Menschen wurden schon getötet oder verletzt, meist friedliche Zivilisten. Ganze Städte und zahlreiche Infrastrukturanlagen wurden zerstört. Die Gesellschaft ist von dem schmutzigen Strom des Nationalismus und der chauvinistischen Hysterie mitgerissen worden.
Wie immer und überall bei Konflikten zwischen den Staaten gibt es und kann es nichts Gerechtes bei diesem neuen Krieg im Kaukasus zu verteidigen geben. Alle Krieg führenden Parteien sind mitschuldig. Nachdem man jahrelang den Krieg mit angefacht hat, ist es schließlich zum militärischen Konflikt gekommen. Das Regime Saakashwili hat zwei Drittel der georgischen Bevölkerung in eine tiefgreifende Misere gestürzt. Je mehr die Wut in Georgien gegen diese Lage zunahm, desto mehr suchte das Regime nach einem Ausweg mittels eines „kleinen siegreichen Krieges“ in der Hoffnung, dass dies dem Regime helfen würde. Die russische Regierung ist wild entschlossen, ihre Vorherrschaft im Kaukasus aufrechtzuerhalten. Heute behauptet sie, die Schwachen zu schützen, aber ihre Heuchelei ist unverkennbar: Tatsächlich wiederholen die Truppen Saakaswilis nur das, was die Truppen Putins seit neun Jahren in Tschetschenien betreiben. Die führenden Kreise Ossetiens und Abchasiens wollen ihre Rolle als exklusive Verbündete Russlands in der Region verstärken, und dabei gleichzeitig die verarmten Massen um die Flamme der ‚nationalen Idee’ und der ‚Hilfe für das Volk’ versammeln. Die Führer der USA, der europäischen Staaten und der Nato wollen im Gegenzug so stark wie möglich den Einfluss der russischen Rivalen im Kaukasus schwächen, um damit die Kontrolle über die Ölquellen und die Transportwege zu sichern. So werden wir zu Zeugen und Opfern des neuen Brennpunktes der weltweiten Zusammenstöße um Energie, Öl und Gas.
Diese Kämpfe werden den Arbeitern in Georgien, Ossetien, Abchasien und Russland, nichts anderes bringen als Blut und Tränen, unberechenbare Desaster und Entbehrungen. Wir möchten unsere tiefgreifende Sympathie all den Freunden und Eltern der Opfer zum Ausdruck bringen, denjenigen, die obdachlos geworden und denen die Subsistenzmittel im Krieg geraubt wurden. Wir dürfen nicht dem Einfluss der nationalistischen Demagogie verfallen, die von uns Einheit mit „unserer“ Regierung verlangt und dabei die Fahnen der „Verteidigung des Vaterlandes“ ausrollt. Der Hauptfeind der einfachen Leute ist nicht der Bruder oder die Schwester auf der anderen Seite der Grenze oder einer anderen Nationalität. Die Feinde - das sind die Führer, die Arbeitgeber, die Präsidenten und Minister, die Geschäftsleute und die Generäle; all diejenigen, welche Kriege verursachen um ihre Macht und ihren Reichtum zu bewahren. Wir rufen die Arbeiter Russlands, Ossetiens, Abchasiens und Georgiens dazu auf, die Geißel des Nationalismus und des Patriotismus zu verwerfen, um ihre Wut gegen die Führer und Reichen zu richten, egal hinter welcher Landesgrenze sie leben.
Russische, georgische, ossetische und abchasische Soldaten! Gehorcht nicht den Befehlen Eurer Vorgesetzten! Dreht die Waffen um gegen all diejenigen, die Euch in den Krieg schicken wollen. Schießt nicht auf die „Feindessoldaten“, verbrüdert Euch mit ihnen! Steckt die Bajonette in den Boden!
Arbeiter hinter der Front! Sabotiert die Militärmaschinerie, legt die Arbeit nieder und beteiligt euch an den Versammlungen und Demonstrationen gegen den Krieg, organisiert Euch und streikt!
Nein zum Krieg und dessen Organisatoren – die Reichen und die Führer! Ja zur Solidarität der Arbeiter über alle Landesgrenzen und Fronten hinweg!
Föderation Erziehungswesen, Bildung und Techniker – KRAS-IWA.
Aktuelles und Laufendes:
- Georgien [33]
- Kaukasuskrieg [39]
- Internationalismus Kaukasus [40]
- Arbeiterklasse und Kaukasus [41]
Theoretische Fragen:
- Internationalismus [36]
September 2008
- 758 reads
Interne Debatte der IKS: Die Gründe für das „Wirtschaftswunder" nach dem Zweiten Weltkrieg
- 3557 reads
Im Frühling 2005 eröffnete die IKS eine interne Debatte über die ökonomische Analyse der starken Aufschwungsperiode nach dem Zweiten Weltkrieg (oft auch als „Die 30 glorreichen Jahre" bezeichnet). Diese Periode stellte mit ihren spektakulären und einzigartigen Wachstumsraten der Weltwirtschaft eine Ausnahme in der Geschichte der Dekadenz des Kapitalismus dar1. Diese Debatte war schon in früheren Texten der IKS aufgetaucht, welche sich unterschiedlich zur Rolle des Krieges innerhalb der kapitalistischen Wirtschaft und angesichts der fehlenden zahlungskräftigen Märkte äusserten. Eine erste Frage, die sich unsere Organisation stellte, war folgende: Ermöglichen Kriegszerstörungen den Aufbau neuer Absatzmärkte? Wenn dies jedoch nicht so ist, dann taucht automatisch einen andere Frage auf: Durch welche anderen Faktoren als die Kriegszerstörungen lassen sich die „30 glorreichen Jahre" schlüssig erklären? Die Debatte in der IKS über diese Fragen ist im Gange und die verschiedenen hier vorgestellten Positionen sind nicht vollständig entwickelt. Dennoch sind sie aber eine ausreichende Grundlage zur Veröffentlichung dieser Debatte gegen aussen. Dies vor allem, um die Debatte im Milieu der Leute, die sich auf die Positionen der Kommunistischen Linken hinbewegen, zu bereichern.
Auch wenn die Realität und die Entwicklung der Krise seit dem Ende des „Wirtschaftswunders" deutlich gezeigt haben, dass diese Periode eine Ausnahmesituation im dekadenten Kapitalismus war, so ist die Wichtigkeit der aufgetauchten Fragen keinesfalls zu unterschätzen. Diese Fragen führen uns zurück zum Kern der marxistischen Analyse und lassen uns auch den historisch begrenzten Charakter der kapitalistischen Produktionsweise verstehen. Der Eintritt des Kapitalismus in seine Dekadenz und die Unüberwindbarkeit der heutigen Krise sind eine der objektiven Grundlagen für die revolutionäre Perspektive der Arbeiterklasse.
Der Hintergrund der Debatte: gewisse Widersprüche in unseren Analysen
Die erneute kritische Lektüre unserer Broschüre Die Dekadenz des Kapitalismus2, hat innerhalb unserer Organisation ein Nachdenken und eine Debatte mit verschiedenen Positionen ausgelöst. Fragen bezüglich der Auswirkungen des Krieges in der Dekadenz des Kapitalismus hat sich die Arbeiterbewegung - vor allem die Kommunistische Linke - in der Vergangenheit schon gestellt. Die Broschüre Die Dekadenz des Kapitalismus entwickelt die Idee, dass die Kriegszerstörungen im dekadenten Kapitalismus, vornehmlich die Weltkriege, einen Absatzmarkt für die kapitalistische Produktion erzeugen - den Wiederaufbau: „Aber gleichzeitig sind mit der erhöhten Nachfrage nach neuen Märkten die äusseren Märkte stark zurückgegangen. Deshalb musste der Kapitalismus auf Hilfsmittel wie Zerstörungen und die Produktion von Zerstörungsmitteln zurückgreifen, um die größten Verluste oder die Abnahme an „Lebensraum" auszugleichen zu versuchen." (Kapitel: „Das Wachstum seit dem Zweiten Weltkrieg", Seite 21, deutsche Ausgabe).
„In der massiven Zerstörung im Hinblick auf den Wiederaufbau entdeckte der Kapitalismus einen gefährlichen und vorübergehenden, aber wirkungsvollen Ausweg für seine neuen Absatzprobleme.
Die Zerstörungen des Ersten Weltkrieges haben nicht ausgereicht (...) Von 1929 an befand sich der Kapitalismus erneut in einer Krise.
Es sieht so aus, als ob diese Lehre gut verstanden worden sei: die Zerstörungen, welche durch den Zweiten Weltkrieg angerichtet wurden, waren grösser sowohl in ihrer Intensität, als auch in ihrer Ausdehnung (...) Russland, Deutschland, Japan, Grossbritannien, Frankreich und Belgien litten gewaltig unter den Auswirkungen des Krieges, der zum ersten Mal das Ziel verfolgte, das bestehende industrielle Potential systematisch zu zerstören. Der „Wohlstand" Europas und Japans nach dem Kriege schien schon kurz nach dem Kriege systematisch mit eingeplant gewesen zu sein (Marshallplan-Hilfe, usw.) (Kapitel: „Der Zyklus Krieg-Wiederaufbau", Seite 22)
Eine solche Idee findet sich auch in verschiedenen Texten der Organisation (vor allem in der Internationalen Revue), sowie bei unseren Vorgängern von Bilan, die in einem Artikel mit dem Titel „Krisen und Zyklen in der Wirtschaft des niedergehenden Kapitalismus" schrieben: „Das folgende Massaker bildete ein beträchtliches Ventil für die kapitalistische Produktion und eröffnete „großartige" Perspektiven. (...) Während der Krieg das große Ventil für die kapitalistische Produktion ist, ist es in „Friedenszeiten" der Militarismus (d.h. alle Aktivitäten die mit der Vorbereitung auf den Krieg zu tun haben), der den Mehrwert fundamentaler Bereiche der vom Finanzkapital kontrollierten Produktion realisiert." (Bilan, Nr. 11, 1934 - wiederveröffentlicht in der Internationalen Revue Nr. 28, deutsch, Seiten 19 und 21).
In anderen Texten der IKS jedoch, die sowohl vor als auch nach der Broschüre Die Dekadenz des Kapitalismus erschienen, wird eine andere Analyse über die Rolle des Krieges in der Dekadenz entwickelt. Sie stützt sich auf den „Rapport der Konferenz der Französischen Kommunistischen Linken vom Juli 1945", für die der Krieg: „Ein unabdingbares Mittel des Kapitalismus war, welches ihm Entwicklungsmöglichkeiten eröffnete, in einer Epoche als diese Möglichkeiten auch vorhanden waren, aber nur mit gewalttätigen Methoden eröffnet werden konnten. Der Niedergang der kapitalistischen Welt aber, der historisch alle Möglichkeiten zu einer Entwicklung beendet hat, findet im modernen Krieg, im imperialistischen Krieg, den Ausdruck dieses Niedergangs. Es besteht keine weitere Möglichkeit zur Entwicklung der Produktion. Die Produktivkräfte werden auf dem Scheiterhaufen landen und es werden in einem immer schnelleren Rhythmus Ruinen über Ruinen hinterlassen." (Hervorhebung durch uns).
Der Bericht über den Historischen Kurs vom 3. Kongress der IKS3 bezieht sich ausdrücklich auf diese Passage im Text der Französischen Kommunistischen Linken, sowie auch der Artikel „Krieg, Militarismus und imperialistische Blöcke in der Dekadenz des Kapitalismus", den wir 1988 veröffentlichten4. Dort steht: „Was all diese Kriege auszeichnet, wie die zwei Weltkriege, ist, dass sie anders als diejenigen im vorangegangenen Jahrhundert keinen Fortschritt in der Entwicklung der Produktivkräfte ermöglichten. Sie hatten lediglich massive Zerstörungen und die Ausblutung der Länder in denen sie stattfanden zur Folge (ganz abgesehen von den schrecklichen Massakern)."
Der Rahmen der Debatte
All diese Fragen sind wichtig, weil die darauf gegebenen Antworten die theoretische Grundlage für die generelle politische Orientierung einer revolutionären Organisation ausmachen. Sie unterscheiden sich in ihrer Natur aber deutlich von Fragen, die eine Klassengrenze zwischen der Arbeiterklasse und der Bourgeoisie darstellen, wie der Internationalismus, die arbeiterfeindliche Rolle der Gewerkschaften, die Beteiligung am parlamentarischen Zirkus, usw. Oder anders ausgedrückt: die verschiedenen Positionen sind vollumfänglich in Einklang mit der Plattform der IKS.
Wenn gewisse Ideen aus der Broschüre Die Dekadenz des Kapitalismus kritisiert oder gar in Frage gestellt werden, so geschieht dies mit derselben Methode und im gleichen allgemeinen Rahmen der schon zur Zeit der Niederschrift dieser Broschüre vorhanden war und sich seither vertiefte5. Wir wollen das Wichtigste in Erinnerung rufen:
1. Die Anerkennung des Eintritts des Kapitalismus in seine dekadente Phase durch das Ausbrechen des Ersten Weltkrieges und die Anerkennung des unüberwindbaren Charakters der Widersprüche dieses Systems. Es handelt sich hier um ein Verständnis über die Ausdrücke und politischen Konsequenzen eines Wechsels in der historischen Periode, welche die Arbeiterbewegung damals mit den Worten „Das Zeitalter der Kriege und Revolutionen" bezeichnete.
2. Wenn wir die Dynamik der kapitalistischen Produktionsweise über eine gewisse Periode betrachten, so müssen wir nicht mit einer Studie der einzelnen Sektoren (Nationen, Unternehmen, usw.) des Kapitalismus beginnen, sondern den Kapitalismus als ein weltweites Ganzes betrachten. Denn nur dies erlaubt ein Verständnis der verschiedenen Teile. Dies war auch die Methode von Marx als er die Reproduktion des Kapitals untersuchte und er festhielt: „Um den Gegenstand der Untersuchung in seiner Reinheit, frei von störenden Nebenumständen aufzufassen, müssen wir hier die gesamte Handelswelt als eine Nation ansehen und voraussetzen, dass die kapitalistische Produktion sich überall festgesetzt und sich aller Industriezweige bemächtigt hat." (Das Kapital, Band 1, Kapitel 22: „Verwandlung von Mehrwert in Kapital", Ges. Werke, S. 607).
3. „Im Gegenteil zu dem, was die Verehrer des Kapitals suggerieren, schafft die kapitalistische Produktion jedoch nicht automatisch und wunschgemäß die für ihr Wachstum notwendigen Märkte. Der Kapitalismus entwickelte sich zunächst in einer nichtkapitalistischen Welt, worin er die für seine Entfaltung notwendigen Märkte fand. Nachdem er aber seine Produktionsverhältnisse auf die ganze Erde ausgedehnt und in einem einzigen Weltmarkt vereinigt hatte, erreichte der Kapitalismus Anfang des 20. Jahrhunderts die Schwelle zur Sättigung derselben Märkte, die im 19. Jahrhundert noch seine ungeheure Ausdehnung ermöglicht hatten. Darüber hinaus wurde durch die wachsende Schwierigkeit des Kapitals, Märkte zu finden, wo sein Mehrwert realisiert werden kann, der Druck auf die Profitrate verstärkt und ihr tendenzieller Fall bewirkt. Dieser Druck wird durch den ständigen Anstieg des konstanten, "toten" Kapitals (Produktionsmittel) zu Lasten des variablen, lebendigen Kapitals, die menschliche Arbeitskraft, ausgedrückt. Anfangs nur als Tendenz wirkend, wird der Fall der Profitrate schließlich immer spürbarer und zu einer zusätzlichen Bremse für den Akkumulationsprozess des Kapitals, also für die Funktionsweise des gesamten Systems." (Plattform der IKS Punkt 3: „Die Dekadenz des Kapitalismus", Seite 3 der deutschen Ausgabe)
4. Es war die Aufgabe von Rosa Luxemburg, auf der Grundlage der Arbeiten von Marx und der Kritik einer gewissen Unvollständigkeit dieser Arbeiten die These aufzustellen, dass zentral für die Bereicherung des Kapitalismus als Ganzes der Verkauf von eigens produzierten Waren auf außerkapitalistischen Märkten ist; das heißt, in Ökonomien, welche zwar Warenhandel betrieben, aber noch nicht in die kapitalistische Produktionsweise integriert waren: „In Wirklichkeit sind die realen Bedingungen bei der Akkumulation des Gesamtkapitals ganz andere als bei dem Einzelkapital und als bei der einfachen Reproduktion. Das Problem beruht auf folgendem: Wie gestaltet sich die gesellschaftliche Reproduktion unter der Bedingung, dass ein wachsender Teil des Mehrwerts nicht von den Kapitalisten konsumiert, sondern zur Erweiterung der Produktion verwendet wird? Das Draufgehen des gesellschaftlichen Produkts, abgesehen von dem Ersatz des konstanten Kapitals, in der Konsumtion der Arbeiter und Kapitalisten ist hier von vornherein ausgeschlossen, und dieser Umstand ist das wesentlichste Moment des Problems. Damit ist aber auch ausgeschlossen, dass die Arbeiter und die Kapitalisten selbst das Gesamtprodukt realisieren können. Sie können stets nur das variable Kapital, den verbrauchten Teil des konstanten Kapitals und den konsumierten Teil des Mehrwerts selbst realisieren, auf diese Weise aber nur die Bedingungen für die Erneuerung der Produktion in früherem Umfang sichern. Der zu kapitalisierende Teil des Mehrwerts hingegen kann unmöglich von den Arbeitern und Kapitalisten selbst realisiert werden. Die Realisierung des Mehrwerts zu Zwecken der Akkumulation ist also in einer Gesellschaft, die nur aus Arbeitern und Kapitalisten besteht, eine unlösbare Aufgabe." (Rosa Luxemburg, Die Akkumulation des Kapitals, Kapitel 26: „Die Reproduktion des Kapitals und ihr Milieu", Ges. Werke, Bd. 5, S. 299).
Die IKS hat diese Analyse im Allgemeinen übernommen, was aber nicht heißt, dass innerhalb unserer Organisation nicht Positionen existieren können, welche die ökonomische Auffassung von Luxemburg kritisieren. Das werden wir im Speziellen noch bei einer der hier präsentierten Positionen sehen. Luxemburgs Analyse wurde zu ihrer Zeit nicht nur von den Reformisten bekämpft, welche nicht wahrhaben wollten, dass der Kapitalismus einer Katastrophe entgegen ging, sondern auch aus dem revolutionären Lager und dabei von nicht geringeren als Lenin und Pannekoek. Sie gingen zwar ebenfalls davon aus, dass der Kapitalismus eine historisch überlebte Produktionsweise geworden war, doch waren ihre Begründungen anders als die von Rosa Luxemburg.
5. Das Phänomen des Imperialismus rührt exakt von der Notwendigkeit der entwickelten Länder her, außerkapitalistische Märkte zu erobern: „Der Imperialismus ist der politische Ausdruck des Prozesses der Kapitalakkumulation in ihrem Konkurrenzkampf um die Reste des noch nicht mit Beschlag belegten nichtkapitalistischen Weltmilieus." (Rosa Luxemburg, Die Akkumulation des Kapitals, Kapitel 31: „Schutzzoll und Akkumulation", Ges. Werke Bd. 5 S. 391)
6. Der historisch begrenzte Charakter der außerkapitalistischen Märkte bildet die ökonomische Grundlage für die Dekadenz des Kapitalismus. Der Erste Weltkrieg war Ausdruck eines solchen Widerspruchs. Die Aufteilung der Welt unter den Großmächten war abgeschlossen und diejenigen, welche mit ihrem Besitz an Kolonien am schlechtesten dastanden, hatten keine andere Wahl, als eine Neuaufteilung mit militärischen Mitteln zu suchen. Der Eintritt des Kapitalismus in seine niedergehende Phase war Beweis für die Unlösbarkeit der Widersprüche dieses Systems.
7. Die Einführung von staatskapitalistischen Maßnahmen in der Dekadenz des Kapitalismus ist für die Bourgeoisie Hilfsmittel, um die Krise zu bremsen und ihre schlimmsten Auswirkungen abzuschwächen. Sie versuchen damit zu verhindern, dass sich die Krise erneut in einer dermaßen brutalen Form zeigt wie dies 1929 der Fall gewesen war.
8. In der Periode der Dekadenz ist der Kredit ein wesentliches Mittel, mit dem die herrschende Klasse versucht, dem Mangel an außerkapitalistischen Märkten entgegen zu wirken. Die Anhäufung von je länger je weniger kontrollierbaren Schulden, die wachsende Zahlungsunfähigkeit der verschiedenen kapitalistischen Sektoren und die sich steigernde Instabilität der Weltwirtschaft zeigen aber klar die Grenzen des Kredits.
9. Ein typischer Ausdruck der Dekadenz des Kapitalismus auf ökonomischer Ebene sind die wachsenden unproduktiven Ausgaben. Sie zeigen, wie die unüberwindbaren Widersprüche dieses Systems die Entwicklung der Produktivkräfte hemmt: die Militärausgaben (Waffen und Militäreinsätze) angesichts der weltweit sich verschärfenden imperialistischen Spannungen; die Ausgaben zur Aufrechterhaltung und Ausrüstung der Repressionsapparate, um letzten Endes gegen den Kampf der Arbeiterklasse vorzugehen; die Werbung, als Waffe des ökonomischen Wettkampfes auf dem übersättigten Markt; usw. Vom ökonomischen Standpunkt aus gesehen bilden solche Ausgaben einen totalen Verlust für das Kapital.
Die Positionen in der gegenwärtigen Debatte
Innerhalb der IKS existiert eine Position, die zwar mit unserer Plattform einverstanden ist, aber verschiedene Aspekte des Beitrags von Rosa Luxemburg zu den Gründen der ökonomischen Krise zurückweist6. Für diese Position liegen die Gründe der Krise in einem anderen Widerspruch, der von Marx hervorgehoben wurde: dem tendenziellen Fall der Profitrate. Während sie Konzepte zurückweist (die vor allem von den Bordigisten und Rätisten vertreten werden) die davon ausgehen, dass der Kapitalismus automatisch und für alle Ewigkeit die Ausdehnung seiner eigenen Märkte aufrechterhalten kann, solange nur die Profitrate genug hoch ist, hebt sie hervor, dass der Grundwiderspruch des Kapitalismus nicht in den Grenzen der Märkte liegt (also der Form in der sich die Krise manifestiert), sondern in der Barriere zur Ausdehnung der Produktion.
Das Wesentliche zur Debatte über diese Position haben wir schon in Polemiken mit anderen Organisationen beschrieben (auch wenn es Unterschiede dabei gibt), in denen die Sättigung der Märkte und der Fall der Profitrate beleuchtet werden7. Dennoch, und das werden wir später noch sehen, existiert eine gewisse Übereinstimmung dieser Auffassung mit einer Position in der gegenwärtigen Debatte, die sich „Keynesianisch-Fordistischer Staatskapitalismus" nennt und ebenfalls in diesem Text vorgestellt wird. Diese zwei Positionen gehen davon aus, dass es einen internen Markt innerhalb der kapitalistischen Produktionsverhältnisse gab, welcher ein Faktor der Prosperität des so genannten „Wirtschaftswunders" war. Sie analysieren das Ende dieser Periode als Produkt des „tendenziellen Falls der Profitrate".
Die anderen Positionen in der Debatte beziehen sich auf den Rahmen der Analyse Rosa Luxemburgs über die zentrale Rolle des Mangels an außerkapitalistischen Märkten für die Krisen und die Dekadenz des Kapitalismus.
Aufgrund dieser Analyse hat ein Teil der Organisation erkannt, dass in unserer Broschüre Die Dekadenz des Kapitalismus Widersprüche vorhanden sind. Die Broschüre bezieht sich auf denselben Rahmen, insofern sie die Akkumulation während des „Wirtschaftswunders" in der Entstehung eines Wiederaufbau-Marktes sieht, der nicht außerkapitalistisch ist.
Aufgrund dieser Kritik entstand innerhalb der IKS eine Position - sie ist hier unter dem Titel „Kriegswirtschaft und Staatskapitalismus" aufgeführt -, welche Kritiken an unserer Broschüre formuliert. Vor allem kritisiert sie eine fehlende Genauigkeit und die mangelnde Beachtung des Marshall-Plans in der Erklärung des Wiederaufbaus. Zudem bezieht sie sich grundsätzlich „auf die Idee, dass die Prosperität der 50er und 60er Jahre durch die globale Situation der imperialistischen Machtverhältnisse und die Installierung einer permanenten Kriegswirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg bestimmt ist".
Der Teil unserer Organisation, welcher die Analyse der Broschüre Die Dekadenz des Kapitalismus über das „Wirtschaftswunder" kritisiert, hat zwei verschiedene Interpretationen über die Prosperität dieser Periode formuliert. Die erste - hier unter dem Titel „Außerkapitalistische Märkte und Verschuldung" präsentiert - misst den beiden Faktoren, welche die IKS in ihrer Vergangenheit schon analysiert hat, eine grössere Bedeutung zu8. Laut dieser Position „sind diese zwei Faktoren ausreichend, um sich die Prosperität des Wirtschaftswunders zu erklären".
Die zweite Position - unter dem Titel „Keynesianisch-Fordistischer Staatskapitalismus" präsentiert - „geht vom selben Punkt aus, der in der Broschüre über die Dekadenz entwickelt ist: die relative Sättigung der Märkte 1914, verglichen mit dem Bedürfnis nach Akkumulation auf Weltebene. Sie entwickelt die Idee, dass nach 1945 das System mit der Einführung einer Variante des Staatskapitalismus antwortete, basierend auf einer Dreiteilung (Keynesianismus) der enorm gesteigerten Produktivität (Fordismus) in Profit, Staatsabgaben und Reallöhne".
Das Ziel dieses ersten Artikels zur Debatte über die „30 glorreichen Jahre" ist die nun erfolgte kurze Vorstellung dieser Positionen und im nachfolgenden Rest des Textes je eine zusammengefasste Präsentation der drei Positionen. Dies um die Debatte anzuregen9. Wir werden später ausführlichere Beiträge zu den verschiedenen Positionen publizieren oder auch andere, die im Laufe der Debatte auftauchen.
1. Kriegswirtschaft und Staatskapitalismus
Der Ausgangspunkt dieser Position ist schon 1945 von der Französischen Kommunistischen Linken entwickelt worden. Sie hielt fest, dass seit 1914 die außerkapitalistischen Märkte, welche das notwendige Ausdehnungsgebiet des Kapitalismus während seiner aufsteigenden Periode dargestellt hatten, nicht mehr ausreichten: „Die jetzige Periode ist die der Dekadenz des Kapitalismus. Was bedeutet dies? Die herrschende Klasse lebte vor dem ersten imperialistischen Krieg mit einer ständigen Ausdehnung der Produktion, und sie konnte auch nicht anders. Nun ist sie am Punkt ihrer Geschichte angekommen, an dem sie diese Ausdehnung nicht mehr in derselben Weise fortführen kann. (...) Heute ist die Bourgeoisie in allen Teilen - abgesehen von unbrauchbaren entfernten Gebieten, von zu vernachlässigenden Übrigbleibseln der nichtkapitalistischen Welt, die ungenügend sind, um die weltweite Produktion aufzunehmen - Herrin dieser Welt, doch hat sie keine außerkapitalistische Länder mehr vor sich, die für ihr System neue Märkte darstellen könnten: Und damit beginnt auch ihre Dekadenz."10
Die Geschichte der Weltwirtschaft seit 1914 ist der Versuch der herrschenden Klasse in den verschiedenen Ländern, dieses grundsätzliche Problem zu überwinden: wie den durch die kapitalistische Ökonomie produzierten Mehrwert akkumulieren, in einer Welt, die schon unter den großen imperialistischen Mächten aufgeteilt ist und in welcher der Markt die Gesamtheit des Mehrwertes nicht mehr aufnehmen kann? Und seit die imperialistischen Mächte nur noch auf Kosten ihrer Rivalen expandieren können, müssen sie sich nach der Beendigung eines Krieges schon wieder auf den nächsten vorbereiten. Die Kriegswirtschaft wird zum Überlebensprinzip der kapitalistischen Gesellschaft. „Die Kriegsproduktion hat nicht das Ziel, ein ökonomisches Problem zu lösen. Sie ist im Wesentlichen Ergebnis der Notwendigkeit des kapitalistischen Staates, sich einerseits gegen die enteigneten Klassen zu verteidigen und durch Gewalt deren Ausbeutung aufrecht zu erhalten und andererseits mit Gewalt ihre wirtschaftliche Position zu stärken und sie auf Kosten der anderen imperialistischen Staaten zu erweitern (...) Die Kriegsproduktion wird auch bestimmend für die industrielle Produktion und hauptsächliches ökonomisches Betätigungsfeld der Gesellschaft" (Internationalisme: „Bericht über die internationale Lage", Juli 1945).
Die Wiederaufbauperiode - das so genannte „Wirtschaftswunder" - ist ein Teil dieser Geschichte.
Drei ökonomische Charakteristiken der Welt nach 1945 sollen hier hervorgehoben werden:
- Erstens: Es gab eine gewaltige wirtschaftliche und militärische Vorherrschaft der USA, wie sie in der Geschichte des Kapitalismus noch nie vorgekommen war. Die USA stellten selbst die Hälfte der weltweiten Produktion und besaßen fast 80% der globalen Goldreserven. Sie waren der einzige kriegführende Staat, dessen Produktionsapparat unbeschädigt aus dem Krieg hervorkam. Ihr Bruttosozialprodukt verdoppelte sich zwischen 1940 und 1945. Sie absorbierten das gesamte, vom britischen Empire während all der Jahre der Kolonialherrschaft akkumulierte Kapital und dazu noch einen Teil desjenigen des französischen Kolonialreichs.
- Zweitens: In den Reihen der herrschenden Klasse der westlichen Länder existierte ein klares Bewusstsein darüber, dass der Lebensstandard der Arbeiterklasse notwendigerweise zu heben ist, um soziale Unruhen zu vermeiden, welche von den Stalinisten und dem gegnerischen russischen Block ausgenützt werden könnten. Die Kriegswirtschaft beinhaltete einen neuen Aspekt, dessen sich unsere Vorgänger der Französischen Kommunistischen Linken damals nicht vollständig bewusst waren: die verschiedenen sozialen Einrichtungen (Gesundheitswesen, Arbeitslosenversicherungen, Pensionen, usw.), welche die herrschende Klasse - vor allem die des westlichen Blocks - zu Beginn des Wiederaufbaus in den 1940er Jahren eingerichtet hatten.
- Drittens: Der Staatskapitalismus, der vor dem Zweiten Weltkrieg eine Tendenz hin zur Autarkie der verschiedenen nationalen Ökonomien eingenommen hatte, war jetzt in die Struktur von imperialistischen Blöcken integriert, welche die wirtschaftlichen Beziehungen unter den Staaten bestimmte (Bretton Woods für den amerikanischen Block, COMECON für den russischen Block).
Während des Wiederaufbaus erfuhr der Staatskapitalismus eine qualitative Entwicklung: Der Anteil des Staates in der nationalen Ökonomie wurde dominierend11. Selbst heute, nach 30 Jahren des so genannten „Liberalismus" bilden die Staatsausgaben einen Anteil zwischen 30-60% des Bruttoinlandproduktes der Industrieländer.
Dieses neue Gewicht des Staates war ein Übergang von Quantität in Qualität. Der Staat war nicht mehr nur „ausführendes Organ" der herrschende Klasse, er war auch der größte Arbeitgeber und stellte den größten Markt. In den USA zum Beispiel wurde das Pentagon der größte Arbeitgeber des Landes (mit 3 bis 4 Millionen zivilen und militärischen Beschäftigten). Dadurch spielte er eine gewichtige Rolle in der Wirtschaft und ermöglichte es, die bestehenden Märkte noch besser auszuschöpfen.
Die Inkraftsetzung des Bretton-Woods-Abkommens ermöglichte auch die Einführung eines verfeinerten und weniger anfälligen Kreditsystems im Vergleich zur Vergangenheit: Das Konsumkreditwesen wurde ausgebaut, und die ökonomischen Institutionen, die vom amerikanischen Block gegründet wurden (IWF, Weltbank, GATT) ermöglichten die Verhinderung von Finanz- und Bankenkrisen.
Die enorme wirtschaftliche Überlegenheit der USA erlaubte es der amerikanischen Bourgeoisie, schrankenlos Geld auszugeben, um ihre militärische Überlegenheit gegenüber dem russischen Block zu sichern: Sie unterstützten zwei blutige und kostspielige Kriege (Korea und Vietnam), Projekte à la Marshall-Plan und fremde Investitionen für den Wiederaufbau der ruinierten europäischen Wirtschaft Europas und Asiens (vor allem in Korea und Japan). Doch diese enorme Anstrengung - nicht durch die „klassische" Funktionsweise des Kapitalismus bestimmt, sondern durch die imperialistische Konfrontation, welche die Dekadenz dieses Systems kennzeichnet - endete im Ruin der amerikanischen Wirtschaft. 1958 befand sich der amerikanische Staatshaushalt bereits in einem Defizit, und 1970 besaßen die USA nur noch 16% der weltweiten Goldreserven. Das Bretton-Woods-System erlitt Schiffbruch, und die Welt stürzte in eine Krise, von der sie sich bis heute nicht erholt hat.
2. Außerkapitalistische Märkte und Verschuldung
Weit davon entfernt, die Produktivkräfte in einer vergleichbaren Art und Weise zu steigern, wie dies in der aufsteigenden Phase des Kapitalismus der Fall gewesen war, charakterisierte sich das „Wirtschaftswunder" durch eine enorme Verschwendung von Mehrwert. Dies war ein Zeichen für die Fesselung der Entwicklung der Produktivkräfte, welche die Dekadenz des Kapitalismus kennzeichnet.
Der Wiederaufbau nach dem Ersten Weltkrieg eröffnete eine Phase der Prosperität, die aber nur einige Jahre anhielt. Während dieser Zeit bildeten Verkäufe auf außerkapitalistischen Märkten die notwendige Grundlage für die Akkumulation, so wie es schon vor Ausbruch des Konfliktes der Fall gewesen war. Auch wenn die Welt damals schon unter den größten Industriestaaten aufgeteilt war, so war sie noch weit davon entfernt, von der kapitalistischen Produktionsweise gänzlich beherrscht zu werden. Trotzdem war die Aufnahmefähigkeit der außerkapitalistischen Märkte ungenügend, gemessen an der Menge der in den industrialisierten Ländern hergestellten Waren. Der Aufschwung brach deshalb durch der Krise von 1929 schnell an der Überproduktion zusammen.
Ganz anders dagegen war die Periode des auf den Zweiten Weltkrieg folgenden Wiederaufbaus, der die besten wirtschaftlichen Kennzahlen der aufsteigenden Phase des Kapitalismus in den Schatten stellte. Während mehr als zwei Jahrzehnten entwickelte sich ein anhaltendes Wachstum aufgrund der größten Produktivitätssteigerungen in der Geschichte des Kapitalismus. Dies war vor allem der Perfektionierung der Fließbandproduktion (Fordismus), der Automatisierung der Produktion und ihrer größtmöglichen Ausweitung geschuldet.
Doch genügt es nicht, nur Waren zu produzieren, man muss sie auch auf dem Markt verkaufen können. Der Erlös aus dem Verkauf von Waren, die im Kapitalismus produziert werden, dient der notwendigen Erneuerung der Produktionsmittel und dem Kauf der Arbeitskraft (Löhne der Arbeiter). Er dient also der einfachen Reproduktion des Kapitals (ohne Ausweitung der Produktionsmittel oder der Konsumtion), er muss aber auch die unproduktiven Kosten abdecken. Diese reichen von den Rüstungsausgaben bis hin zum Lebensunterhalt der Kapitalisten und beinhalten zahlreiche andere Kosten, auf die wir noch zurückkommen werden. Wenn nach all dem ein positiver Saldo übrig bleibt, kann dieser der Akkumulation des Kapitals zugeführt werden.
Bei den jährlich gemachten Verkäufen im Kapitalismus ist der Anteil, welcher der Akkumulation des Kapitals zufließt und der seine Besitzer somit bereichert, notwendigerweise beschränkt, weil er den Überschuss nach Abzug all der anderen notwendigen Ausgaben darstellt. Historisch gesehen stellt er nur einen kleinen Prozentsatz des jährlich produzierten Reichtums dar[12] und korrespondiert im Wesentlichen mit den Verkäufen auf außerkapitalistischen Märkten (interne und externe)13. Dies ist effektiv das einzige Mittel für den Kapitalismus, sich zu entwickeln (neben der Ausbeutung der außerkapitalistischen Ökonomien, ob legal oder illegal). Oder mit anderen Worten: um nicht in einer Situation zu sein, in der „die Kapitalisten ja selbst nur unter sich ihre Waren auszutauschen und aufzuessen haben" was, wie es Marx ausdrückte, „keineswegs eine Wertsteigerung des Kapitals erlaubt": „Wie könnte es sonst an Nachfrage für dieselben Waren fehlen, deren die Masse des Volks ermangelt, und wie wäre es möglich, diese Nachfrage im Ausland suchen zu müssen, auf fernern Märkten, um den Arbeitern zu Hause das Durchschnittsmaß der notwendigen Lebensmittel zahlen zu können? Weil nur in diesem spezifischen, kapitalistischen Zusammenhang das überschüssige Produkt eine Form erhält, worin sein Inhaber es nur dann der Konsumtion zur Verfügung stellen kann, sobald es sich für ihn in Kapital rückverwandelt. Wird endlich gesagt, dass die Kapitalisten ja selbst nur unter sich ihre Waren auszutauschen und aufzuessen haben, so wird der ganze Charakter der kapitalistischen Produktion vergessen und vergessen, dass es sich um die Verwertung des Kapitals handelt, nicht um seinen Verzehr".14
Mit dem Eintritt des Kapitalismus in seine Dekadenz wurden die außerkapitalistischen Märkte immer unzureichender, doch sie verschwanden nicht einfach und ihre Lebensfähigkeit hing, gleich wie in der aufsteigenden Phase, vom Fortschreiten der Industrialisierung ab. Die außerkapitalistischen Märkte wurden immer unfähiger, die wachsende Produktion an Gütern durch den Kapitalismus aufzunehmen. Das Resultat war eine Überproduktion und mit ihr die Vernichtung eines Teils der Produktion, außer wenn der Kapitalismus den Kredit einsetzte, um dieser Situation entgegen zu wirken. Doch je mehr sich die außerkapitalistischen Märkte verringern, desto weniger können die Kredite zurückbezahlt werden.
Das zahlungskräftige Feld für das Wachstum des fast 30 Jahre andauernden „Wirtschaftswunders" entstand aus einer Kombination von Ausbeutung dieser immer noch existierenden außerkapitalistischen Märkte und einer Verschuldung, weil erstere nicht fähig waren, die die Gesamtheit des Angebots aufzunehmen. Es gibt keinen anderen Weg (außer einmal mehr die Ausbeutung der außerkapitalistischen Reichtümer), der die Expansion des Kapitalismus in dieser Periode ermöglichte, so wie es auch in allen anderen Perioden der Fall ist. Deshalb leistete das „Wirtschafswunder" seinen eigenen kleinen Beitrag am heutigen Schuldenberg, der niemals zurückbezahlt werden kann und wie ein Damoklesschwert über dem Kapitalismus schwebt.
Ein anderes Charakteristikum des „Wirtschaftswunders" ist das Gewicht der unproduktiven Kosten in der Wirtschaft. Sie bilden einen bedeutenden Anteil der Staatsausgaben, die ab Ende der 1940er Jahre in den meisten industrialisierten Staaten beträchtlich anwuchsen. Dies war das geschichtliche Ergebnis der Entwicklung hin zum Staatskapitalismus und dabei vor allem des Gewichts des Militarismus in der Wirtschaft, welches nach dem Zweiten Weltkrieg sehr hoch war, und zugleich auch das Ergebnis einer keynesianischen Politik, die eine künstliche Nachfrage schaffte. Wenn eine Ware oder ein Angebot unproduktiv ist, bedeutet dies, dass deren Gebrauchswert nicht in den Produktionsprozess einfließen kann15, um so an der einfachen oder erweiterten Reproduktion des Kapitals teilzunehmen. Wir müssen also auch diejenigen Kosten als unproduktiv betrachten, welche im Zusammenhang mit einer Nachfrage innerhalb des Kapitalismus stehen, die aber für die einfache und erweiterte Reproduktion nicht notwendig sind. Dies war während des „Wirtschaftswunders" im Speziellen der Fall bei den schrittweisen Lohnerhöhungen in Anpassung an die Produktivitätssteigerung der Arbeit, von der gewisse Teile der Arbeiterklasse in bestimmten Ländern „profitiert" hatten und in denen eine keynesianische Doktrin vollzogen wurde. Die Ausbezahlung von Löhnen, welche höher sind als das strikt Notwendige zur Wiederherstellung der Arbeitskraft ist, genauso wie die miserablen Arbeitslosengelder oder die unproduktiven Ausgaben des Staates, im Grunde eine Verschwendung von Kapital, das nicht mehr an der Wertsteigerung des globalen Kapitals teilnehmen kann. Mit anderen Worten: Das Kapital welches in unproduktive Ausgaben gesteckt wird ist, wie auch immer sie aussehen, sterilisiert.
Die Bildung eines internen Marktes durch den Keynesianismus als eine unmittelbare Lösung zum Absatz der massiven industriellen Produktion hat Illusionen in eine dauerhafte Rückkehr des Wachstums wie zu Zeiten des aufsteigenden Kapitalismus geweckt. Doch seit der Markt komplett abgenabelt wurde von den Bedürfnissen der Wertsteigerung des Kapitals, hatte dies die Sterilisierung eines beträchtlichen Teils des Kapitals zur Folge. So weiterzufahren war nur durch eine Verbindung von verschiedenen und sehr außergewöhnlichen Faktoren möglich, die aber nicht dauerhaft sein konnten:
- ein Produktivitätsanstieg der Arbeit, welcher bei einer gleichzeitigen Finanzierung unproduktiver Ausgaben genügend groß war, um einen Überschuss abzuwerfen für die Weiterführung der Akkumulation;
- die Existenz von zahlungskräftigen Märkten - die entweder außerkapitalistisch oder das Resultat einer Verschuldung waren - und eine Realisierung des Überschusses ermöglichten.
Eine Steigerung der Produktivität wie zu Zeiten des „Wirtschaftswunders" ist seither nicht mehr erreicht worden. Auch wenn dies eintreffen würde, so zeigt das totale Verschwinden der außerkapitalistischen Märkte und die Tatsache, dass praktisch eine Grenze zur Wiederbelebung der Wirtschaft durch eine noch höhere weltweite Verschuldung (welche bereits gigantisch ist) erreicht ist, die Unmöglichkeit der Wiederholung einer solchen Wachstumsperiode.
Im Gegensatz zur Analyse in unserer Broschüre Die Dekadenz des Kapitalismus bildete der Markt des Wiederaufbaus keinen Faktor, der den Aufschwung während des „Wirtschaftswunders" nach dem Zweiten Weltkrieg erklären könnte. Am Ende des Zweiten Weltkrieges bildete der Wiederaufbau des Produktionsapparates an sich keinen außerkapitalistischen Markt und kreierte selbst keinen Wert. Er war großteils das Resultat eines Transfers von Reichtum, der bereits in den USA akkumuliert war, in diejenigen Länder, die den Wiederaufbau brauchten. Die Finanzierung wurde durch den Marshall-Plan übernommen, und somit war es im Wesentlichen ein Geschenk aus der staatlichen Schatztruhe der USA. Ein solcher Markt des Wiederaufbaus genügt auch nicht als Erklärung für die kurze Aufschwungsphase nach dem Ersten Weltkrieg. Dies ist der Grund, weshalb das Schema „Krieg-Wiederaufbau/Prosperität", das zwar empirisch der Realität des dekadenten Kapitalismus entspricht, kein ökonomisches Gesetz darstellt, nach dem es einen Markt des Wiederaufbaus gäbe, der den Kapitalismus bereichern könnte.
3. Keynesianisch-Fordistischer Staatskapitalismus
Unsere Analyse über die Triebkräfte hinter den Nachkriegsboom beruht auf einer Reihe von objektiven Feststellungen. Hier die Wichtigsten:
Die weltweite Pro-Kopf-Produktion verdoppelte sich während der aufsteigenden Periode des Kapitalismus16, und die industriellen Wachstumsraten stiegen kontinuierlich an, bis sie am Vorabend des Ersten Weltkrieges ihren Höhepunkt erreichten17. Zu diesem Zeitpunkt erreichten die Märkte, die dem Kapitalismus als Expansionsfeld gedient hatten, einen Grad relativer Sättigung, gemessen am weltweiten Bedürfnis zur Akkumulation. Dies war der Beginn der dekadenten Phase des Kapitalismus, welche durch zwei Weltkriege, die größte je erlebte Überproduktionskrise (1929-33) und einen massiven Einbruch im Wachstum der Produktivkräfte gekennzeichnet war (sowohl bei der industriellen Produktion als auch beim weltweiten Pro-Kopf-Produkt halbieren sich die Wachstumszahlen zwischen 1913 und 1945 fast auf die Hälfte: 2,8% bzw. 0,9% pro Jahr).
Doch dies hielt den Kapitalismus keineswegs davon ab, nach dem Zweiten Welzkrieg fast 30 Jahre lang eine Zeit des enormen Wachstums zu erleben. Das weltweite Pro-Kopf-Produkt verdreifachte sich, während sich die industrielle Produktion mehr als verdoppelte (2,9% bzw. 5,2% pro Jahr). Diese Zahlen sind nicht nur höher als die während der aufsteigenden Periode des Kapitalismus, auch die Reallöhne steigerten sich vier mal schneller (sie erhöhten sich um das Vierfache, während sie sich in der Zeit zwischen 1850 und 1913, die doppelt so lang war, nur knapp verdoppelt hatten)!
Wie konnte ein solches „Wirtschaftswunder" geschehen?
- nicht durch eine noch übrig gebliebene außerkapitalistische Nachfrage, da diese schon 1914 ungenügend war und sich danach noch verkleinerte18;
- nicht durch staatliche Verschuldung und defizitäre Budgets, da diese in der Zeit des „Wirtschaftswunders" stark zurückgingen19;
- nicht durch Kredite, da diese nach Rückkehr der Krise erst wirklich zum Zuge kamen und anwuchsen20;
- nicht durch die Kriegsproduktion, weil sie unproduktiv ist: die am meisten aufgerüsteten Länder waren am wenigsten leistungsfähig und umgekehrt;
- nicht durch den Marshall-Plan, da er in seiner Wirkung und Dauer begrenzt war21;
- nicht durch die Kriegszerstörungen, da diejenigen des Ersten Weltkrieges keinerlei Prosperität erzeugt hatten22;
- nicht durch ein Anwachsen des Gewichtes des Staates in der Wirtschaft, da es sich in der Zeit zwischen den Weltkriegen verdoppelt hatte, aber keine solche Wirkung erzeugte23, da sein Anteil 1960 geringer war (19%) als 1937 (21%) und es große unproduktive Ausgaben beinhaltete.
Die Erklärungen für das „Wirtschaftswunder" liegen woanders. Vor allem weil: (a) die Wirtschaft nach dem Krieg ausgeblutet war, (b) die Kaufkraft aller wirtschaftlichen Akteure auf einem Tiefststand war, (c) Letztere gewaltig verschuldet waren, (d) die enorme Macht der USA auf einer unproduktiven Kriegswirtschaft basierte, welche große Schwierigkeiten hatte, sich wieder in eine zivile Wirtschaft umzuwandeln, und (e) dieses „Wirtschaftswunder" eintrat, obwohl große Mehrwertmassen in die unproduktiven Ausgaben flossen!
In Wirklichkeit ist dieses Wunder keines mehr, wenn wir die Analysen von Marx über die Produktivitätssteigerungen24 und die Beiträge der Kommunistischen Linken zur Entwicklung des Staatskapitalismus in der Dekadenz des Kapitalismus miteinander verbinden. Diese Periode zeichnete sich im Wesentlichen durch folgendes aus:
a) Eine nie vorher in der Geschichte des Kapitalismus erlebte Produktivitätssteigerung. Eine Steigerung die sich auf die Verallgemeinerung und Entwicklung der Fließbandproduktion stützte (der Fordismus).
b) Ein kontinuierlicher Anstieg der Reallöhne, eine Vollbeschäftigung und die Einführung eines indirekten Lohnes mittels verschiedener Sozialleistungen. Überdies waren die Länder mit den größten Lohnsteigerungen auch die mit den stärksten Wachstumszahlen in der Gesamtwirtschaft, und umgekehrt.
c) Eine Übernahme der gesamten Produktion durch den Staat und starke Interventionen desselben in die Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit25.
d) All diese keynesianischen Maßnahmen wurden in hohem Masse auf internationalem Niveau organisiert durch OECD, GATT, IWF, Weltbank, usw.
e) Schlussendlich war im Gegensatz zu anderen Perioden das „Wirtschaftswunder" auf diejenigen Länder mit einer bereits entwickelten Wirtschaft konzentriert (und dies bei einem relativ geringen Austausch zwischen den Ländern der OECD und dem Rest der Welt), und es erfolgten keine bemerkenswerten Produktionsauslagerungen in Billiglohn-Länder trotz starkem Lohnanstieg und einer Vollbeschäftigung. Die „Globalisierung" und die Produktionsauslagerungen waren Phänomene, die erst in den 1980er und vor allem dann in den 1990er Jahren stattfanden.
Durch die zwangsmäßige und proportionale Dreiteilung der Produktivitätssteigerung zwischen dem Profit, den Steuern und den Löhnen war der keynesianisch-fordistische Staatskapitalismus fähig, die Vollendung des Akkumulationszyklus' mittels eines Angebots von Waren und Dienstleistungen zu gesenkten Kosten (Fordismus) und einer gesteigerten zahlungskräftigen Nachfrage, die ebenfalls auf dieser Produktivitätssteigerung beruhte (Keynesianismus), sicher zu stellen. So waren die Märkte garantiert; die Krise kehrte in der Form eines erneuten Falls der Profitrate zurück, der eine Folge der Erschöpfung der fordistischen Produktivitätssteigerungen war, die sich zwischen dem Ende der 1960er Jahre und 1982 um die Hälfte verringerten26. Dieser drastische Fall der Rentabilität des Kapitals führte zu einer Demontage der Nachkriegspolitik zugunsten eines deregulierten Staatskapitalismus zu Beginn der 1980er Jahre. Auch wenn diese Kehrtwende zu einem spektakulären Anstieg der Profitraten, als Folge der Lohnkürzungen, führte, so bedeutete die daraus resultierende Abnahme einer zahlungskräftigen Nachfrage, dass die Akkumulationsrate und das Wachstum zurückgingen27. Seither ist der Kapitalismus mit einer strukturellen Schwäche bei der Produktivitätssteigerung dazu gezwungen, vor allem Druck auf die Löhne und Arbeitsbedingungen auszuüben. Dies um noch zu einem Anstieg der Profite zu gelangen, was aber wiederum zu einem Rückgang zahlungskräftiger Märkte führt. Die Wurzeln dieser Entwicklung sind:
a) permanente Überkapazitäten und eine permanente Überproduktion;
b) ein zunehmender Rückgriff auf die Verschuldung, um der verringerten Nachfrage entgegenzuwirken;
c) Auslagerungen auf der Suche nach billigen Arbeitskräften;
d) eine Globalisierung um ein Maximum an Exporten zu erzielen;
e) eine sich ständig wiederholende finanzielle Instabilität durch spekulative Geschäfte, da Investitionen in sich ausdehnende Bereiche nicht mehr möglich sind.
Heute ist die Wachstumsrate auf das Niveau der Zeit zwischen den Weltkriegen gesunken, und eine Neuauflage der „30 glorreichen Jahre des Wirtschaftswunders" ist unmöglich. Der Kapitalismus ist dazu verdammt, in einer zunehmenden Barbarei zu versinken.
Die Wurzeln und Auswirkungen dieser Analyse, auf die hier nicht genauer eingegangen werden kann, werden wir später darlegen. Dies erfordert eine Rückkehr zu einigen unserer Analysen, damit wir zu einem breiteren und kohärenteren Verständnis der Funktionsweise und Grenzen der kapitalistischen Produktionsweise gelangen28.
Eine offene Debatte für das internationalistische Milieu
Wie unsere Vorgänger von Bilan und der Französischen Kommunistischen Linken behaupten wir nicht, „die Weisheit mit dem Löffel gegessen zu haben"29. Wir sind uns bewusst, dass die Debatten, die in den Reihen unserer Organisation geführt werden, von kritischen und konstruktiven Anregungen von außen nur profitieren können. Aus diesem Grunde begrüßen wir alle an uns gerichtete Beiträge und werden sie in unsere kollektive Reflexion einbeziehen.
IKS
1 Zwischen 1950 und 1973 hatte sich das weltweite pro Kopf Bruttosozialprodukt jährlich um 3% erhöht, während es zwischen 1870 und 1913 in einem Rhythmus von 1,3% gewachsen war (Angus Madison: „Die Weltwirtschaft", OECD, 2001, S. 284).
2 Sie ist im Wesentlichen eine Sammlung von Artikeln, die wir im Januar 1981 veröffentlicht haben.
3 Dritter Kongress der IKS, International Review Nr. 18, 1979, (engl./franz./span. Ausgabe)
4 International Review Nr. 52, 1988, (engl./franz./span. Ausgabe)
5 Siehe die Serie in der International Review „Die Dekadenz des Kapitalismus verstehen" und dabei vor allem den Artikel in Nr. 56 (engl./franz./span. Ausgabe), sowie auch die Präsentation der Resolution über die internationale Situation vom 8. Kongress der IKS, die sich auf die Frage des Gewichts der Verschuldung auf die Weltwirtschaft konzentriert, Internationale Revue Nr. 11, (deutsch).
6 Diese Minderheitsposition existiert schon seit langem in unserer Organisation - die Genossen, welche sie heute vertreten, taten dies schon zum Zeitpunkt ihres Eintritts in die IKS - und hat diese Genossen auch nicht daran gehindert, an allen unseren Aktivitäten teilzunehmen, an unseren Interventionen sowie der theoretisch-politischen Debatte.
7 Siehe dazu den zweiteiligen Artikel „Antwort an die CWO zum Krieg in der Dekadenz des Kapitalismus", International Review Nr. 127 und 128 (engl./franz./span. Ausgabe).
8 Die Ausbeutung der außerkapitalistischen Märkte ist schon in der Broschüre Die Dekadenz des Kapitalismus beschrieben. Sie wurde im 6. Artikel der Serie „Die Dekadenz des Kapitalismus verstehen" wieder aufgegriffen und unterstrichen (International Review Nr. 56, engl./franz./span. Ausgabe). Dort wird der Faktor der Verschuldung beschrieben, der „Wiederaufbau-Markt" ist jedoch nicht erwähnt.
9 Es gibt innerhalb dieser Positionen auch Nuancen, wie die Debatte bisher zeigte. Wir können aber im Rahmen dieses Artikels nicht darauf eingehen. Sie können in die zukünftigen Diskussionsbeiträge einfliessen.
10 Internationalisme, 1. Januar 1945: „Thesen über die internationale Lage".
11 Alleine in den USA waren die Ausgaben des Staates, welche 1930 noch 3% des Bruttoinlandproduktes ausgemacht hatten, während der 1950-60er Jahre auf fast 20% des BIP gestiegen.
[12] Als Beispiel: Während der Periode zwischen 1817-1913 betrugen die Verkäufe auf außerkapitalistischen Märkten im Jahresdurchschnitt 2,3% der weltweiten Produktion
(errechnet aufgrund der Entwicklung der weltweiten Produktion in derselben Zeit. Quelle: www.theworldeconomy.org/frenchpdf/MaddtabB18.pdf [42]).
Es handelt sich dabei um einen Durchschnitt, und dieser Wert ist somit geringer als in den Jahren des großen Wachstums, welches die Jahre unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg kennzeichnete.
13 Es ist hier nicht von großem Belang, ob die Verkäufe schlussendlich produktiv sind oder nicht, wie dies bei der Rüstungsproduktion der Fall ist.
14 Marx; „Das Kapital" Band 3, Kapitel 15, Überfluss an Kapital bei Überfluss an Bevölkerung, MEW Bd. 25 S.267/68.
15 Um dies zu illustrieren, genügt es, auf den Unterschied im Endgebrauch einer Waffe, eines Inserates oder eines gewerkschaftlichen Schulungskurses einerseits und andererseits eines Werkzeuges, von Lebensmitteln, Schul- und Universitätskursen, medizinischer Versorgung, usw. hinzuweisen.
16 Von 0,53% pro Jahr zwischen 1820-70 auf 1,3% zwischen 1870-1913 (Angus Maddison, L`économie mondiale, OECD S. 284)
17 Jährliche Wachstumsraten der weltweiten industriellen Produktion:
1786-1820: 2,5%
1820-1840: 2,9%
1840-1870: 3,3%
1870-1894: 3,3%
1894-1913: 4,7%
(aus W.W. Rostow, The World Economy, S. 662)
18 Während diese Kaufkraft zu Beginn der kapitalistischen Entwicklung wichtig war, betrug sie 1914 innerhalb der Grenzen der entwickelten Länder nur noch zwischen 5-20% 1914 und wurde 1945 mit 2-12% marginal (Peter Flora, State, Economy and Society in Western Europe 1815-1975, A Data Handbook, Vol. 2, Campus, 1987). Der Handel mit der Dritten Welt wurde um zwei Drittel reduziert durch den Rückzug Chinas, des Ostblocks, Indiens und anderer unterentwickelter Länder vom Weltmarkt. Der Handel mit dem übrig gebliebenen Drittel fiel zwischen 1952 und 1972 auf die Hälfte zurück (P. Bairoch, Le Tiers-Monde dans l`impasse, S. 391-392)!
19 Zahlen siehe in International Review 114, (engl./franz./span. Ausgabe)
20 Zahlen siehe in Internationale Revue 37 (deutsch)
21 Der Marshall-Plan hatte nur eine schwache Auswirkung auf die amerikanische Wirtschaft: „Nach dem Zweiten Weltkrieg (...) belief sich die Ausfuhr 1946 auf nur 4,9% der Produktion und 1947 auf 6,6%, machte also einen viel kleineren Prozentsatz aus als in den ersten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg. Der Marshall-Plan hat hier keine entscheidende Veränderungen gebracht". Fritz Sternberg, Kapitalismus und Sozialismus vor dem Weltgericht, Rohwolt, 1961, S. 398) Der Autor folgert daraus, dass der innere Handel ausschlaggebend war.
22 Die Fakten und Argumente dazu sind in einem Artikel in der International Review 128, (engl./franz./span. Ausgabe) zu finden. Wir werden aber darauf zurück kommen, weil laut Marx die Entwertung und Zerstörung von Kapital tatsächlich eine Regeneration des Akkumulationszykluses und die Eröffnung neuer Märkte erlaubt. Eine detaillierte Studie hat uns allerdings gezeigt, dass dieser Faktor, auch wenn er eine Rolle spielte, relativ gering war, begrenzt in der Zeit und auf Europa und Japan.
23 Der Anteil der totalen öffentlichen Ausgaben in den Ländern der OECD steigerte sich von 1913 bis 1937 von 9% auf 21% (International Review 114 (engl./franz./span. Ausgabe).
24 In der Realität ist die Produktivität nur ein anderer Ausdruck des Wertgesetzes - da sie das Umkehrte der Arbeitszeit bedeutet -, und sie ist die Grundlage der Auspressung des relativen Mehrwertes, die so charakteristisch für diese Periode war.
25 Der Anteil der öffentlichen Ausgaben in den Ländern der OECD verdoppelte sich zwischen 1960 und 1980 von 19% auf 45% (International Review 114, engl./franz./span. Ausgabe).
26 Grafiken dazu in International Review 115, 121 und 128 (engl./franz./span. Ausgabe)
27 Grafiken und Zahlen in der Internationalen Revue 37, sowie auch in unserer Analyse über das Wachstum in Südost-Asien: https://fr.internationalism.org/ICConline/2008/crise_economique_Asie_Sud... [43].
28 Der Leser findet verschieden Zahlenangaben sowie auch theoretische Analysen in unseren Artikeln, die in der International Review 114, 115, 121, 127, 128 erschienen sind, sowie in den Analysen über das Wachstum in Südostasien auf unserer Webseite.
29 „Keine Gruppe besitzt die absolute und ewige Wahrheit", wie es die Französische Kommunistische Linke ausdrückte. Siehe dazu unseren Artikel „Vor 60 Jahren: Eine Konferenz revolutionärer Internationalisten" in Internationale Revue Nr. 41 (deutsch).
Aktuelles und Laufendes:
Historische Ereignisse:
- Wirtschaftswunder [45]
Theoretische Fragen:
- Politische Ökonomie [46]
Erbe der kommunistischen Linke:
Oktober 2008
- 787 reads
1929- 2008: Der Kapitalismus ist ein bankrottes System – aber eine andere Welt ist möglich: der Kommunismus!
| Attachment | Size |
|---|---|
| 0 bytes |
- 4021 reads
Politiker und Ökonomen wissen nicht mehr, wie sie die Tragweite der Lage ausdrücken sollen: „Am Rande des Abgrunds“, „Ein ökonomisches Pearl Harbour“, „Ein Tsunami, der auf uns zurollt“ „Ein 11.September der Finanzen“ … nur die Anspielung auf den Untergang der Titanic fehlt noch! Was passiert wirklich? Jeder steht aufgrund der wirtschaftlichen Erschütterungen vor Angst erregenden Fragen. Stehen wir vor einem neuen Krach wie 1929? Wie ist es dazu gekommen? Was tun, damit wir uns verteidigen können? Und in welcher Welt leben wir heute?
Politiker und Ökonomen wissen nicht mehr, wie sie die Tragweite der Lage ausdrücken sollen: „Am Rande des Abgrunds“, „Ein ökonomisches Pearl Harbour“, „Ein Tsunami, der auf uns zurollt“ „Ein 11.September der Finanzen“ … nur die Anspielung auf den Untergang der Titanic fehlt noch! Was passiert wirklich? Jeder steht aufgrund der wirtschaftlichen Erschütterungen vor Angst erregenden Fragen. Stehen wir vor einem neuen Krach wie 1929? Wie ist es dazu gekommen? Was tun, damit wir uns verteidigen können? Und in welcher Welt leben wir heute?
Hin zu einer brutalen Verschlechterung unserer
Man darf keine Illusionen haben. Weltweit wird die ganze Menschheit in den kommenden Monaten unter der schrecklichen Verschlechterung der Lebensbedingungen zu leiden haben. Der Internationale Währungsfond (IWF) hat in seinem letzten Bericht angekündigt, dass sich „50 Länder bis Anfang 2009“ in die Reihe der Länder einreihen werden, die von Hungersnot betroffen sein werden. Unter ihnen viele Länder Afrikas, Lateinamerikas, der Karibik und selbst Asiens. In Äthiopien zum Beispiel stehen offiziellen Verlautbarungen zufolge schon 12 Millionen Menschen vor dem Hungertod. In Indien und China, diesen neuen kapitalistischen Eldorados, werden Hunderte Millionen Beschäftigte in große Armut gestürzt werden. Auch in den USA und in Europa wird ein Großteil der Bevölkerung in eine unerträgliche Armut absinken.
Alle Bereiche der Wirtschaft sind betroffen. In den Büros, Banken, Fabriken, Krankenhäusern, in der Automobilindustrie, im Bausektor, im Transportwesen – überall wird es millionenfach Entlassungen hageln. Die Arbeitslosigkeit wird explodieren! Seit Anfang 2008 sind allein in den USA schon ca. eine Million Beschäftigte auf die Straße geflogen. Und all das ist erst der Anfang. Diese Entlassungswelle bedeutet eine Wohnung zu bezahlen, medizinische Versorgung zu bekommen und sich zu ernähren, wird für immer mehr Arbeiterfamilien immer schwerer werden. Für die Jugendlichen heißt dies auch, dass diese kapitalistische Welt ihnen keine Zukunft mehr zu bieten hat!
Die uns gestern belogen haben, belügen uns auch heute!
Die Führer der kapitalistischen Welt, die Politiker, die im Dienst der herrschenden Klasse stehenden Journalisten, sie alle versuchen nicht mal diese katastrophale Perspektive zu vertuschen. Wie könnten sie das auch? Die größten Banken der Welt machen pleite. Sie haben nur überlebt dank der Rettungspakete von Hunderten von Milliarden Dollars und Euros, welche die Zentralbanken, sprich der Staat, ihnen zugeschachert haben. An den Börsen Amerikas, Asiens und Europas befinden sich die Kurse weiter im Sturzflug: Seit Januar 2008 haben sie mehr als 25.000 Milliarden Dollar verloren, sprich den Wert von zwei Jahren Gesamtproduktion der USA. All dies spiegelt die wahre Panik wider, die die herrschende Klasse überall auf der Welt ergriffen hat. Wenn heute die Börsen zusammenbrechen, dann geschieht dies nicht nur wegen der katastrophalen Lage der Banken, sondern auch weil sie einen schwindelerregenden Rückgang der Profite erwarten, was zurückzuführen ist auf das massive Schrumpfen der Wirtschaft, die explosive Zunahme von Firmenpleiten, eine zu erwartende Rezession, die noch viel schlimmer sein wird als alles, was wir während der letzten 40 Jahre gesehen haben.
Die Hauptführer der Welt, Bush, Merkel, Brown, Sarkozy, Hu Jintao halten ein Gipfeltreffen nach dem anderen ab (G4, G7, G8, G27, G 40), in der Hoffnung eine Schadensbegrenzung zu versuchen und das schlimmste zu verhindern. Für Mitte November ist ein neuer „Gipfel“ geplant, der einigen zufolge dazu dienen soll, „den Kapitalismus neu zu strukturieren“. Die Erregung der Führer der Welt ähnelt der der Journalisten und „Experten“: Fernsehen, Radio, Zeitungen usw. – überall wird über die Krise berichtet.
Warum solch ein großes Aufheben?
Während die herrschende Klasse nicht mehr den desaströsen Zustand ihrer Wirtschaft vertuschen kann, versucht sie uns dennoch glauben zu machen, dass trotz alledem das kapitalistische System nicht infragestellt werden muss; dass es einfach darum geht, gegen „Exzesse“ und „Fehlverhalten“ anzugehen. Schuld seien die Spekulanten! Schuld sei die Habgier der Spekulanten! Schuld seien die Steuerparadiese! Schuld der „Liberalismus“!
Um dieses Märchen zu schlucken, greift man auf all die professionellen Lügner zurück. Die gleichen „Spezialisten“, welche gestern noch behaupteten, der Wirtschaft ginge es gut, die Banken wären solide, verbreiten heute unaufhörlich in den Medien ihre neuen Lügen. Diejenigen, die uns früher weismachen wollten, der „Liberalismus“ sei DIE Lösung, der Staat dürfe nicht in die Wirtschaft eingreifen, rufen heute umso stärker den Staat zum Eingreifen auf. Mehr Staat und mehr „Moral“, dann könnte der Kapitalismus wieder voll funktionieren. Diese Lüge wollen sie uns nun einbläuen!
Kann der Kapitalismus die Krise überwinden?
Die Krise, die heute den Weltkapitalismus erschüttert, ist nicht erst im Sommer 2007 mit dem Beginn der Subprime-Krise in den USA entstanden. Seit mehr als 40 Jahren hat eine Rezession nach der anderen stattgefunden: 1967, 1974, 1981, 1991, 2001. Seit Jahrzehnten ist die Arbeitslosigkeit zu einem Dauerphänomen der Gesellschaft geworden, seit Jahrzehnten sehen sich die Ausgebeuteten wachsenden Angriffen gegen ihre Lebensbedingungen ausgesetzt. Warum?
Weil der Kapitalismus ein System ist, das nicht für die Bedürfnisse der Menschen produziert, sondern für den Markt und den Profit. Die nicht-befriedigten Bedürfnisse sind gewaltig, aber die Menschen sind nicht zahlungsfähig; d.h. die große Mehrheit der Weltbevölkerung verfügt nicht über die Kaufkraft, die produzierten Waren zu kaufen. Wenn der Kapitalismus in der Krise steckt, wenn Hunderte von Millionen Menschen, bald Milliarden in eine unerträgliche Armut abstürzen und mit Hunger konfrontiert werden, dann nicht weil dieses System nicht genügend produziert, sondern weil es mehr Waren produziert als es verkaufen kann. Jedes Mal gelang es der herrschenden Klasse, durch den massiven Rückgriff auf Kredite und die Schaffung von künstlichen Märkten sich zeitweilig Luft zu verschaffen. Deshalb führen diese „Wiederaufschwünge“ nur zu noch mehr Blut und Tränen, denn irgendwann muss die Rechnung, müssen all die Schulden beglichen werden. Genau das findet heute statt. Das ganze „traumhafte Wachstum“ der letzten Jahre stützte sich ausschließlich auf Verschuldung. Die Weltwirtschaft hat auf Pump gelebt, und nachdem jetzt der Zeitpunkt der Rückzahlung gekommen ist, bricht alles zusammen wie ein Kartenhaus. Die gegenwärtigen Erschütterungen der kapitalistischen Weltwirtschaft sind nicht auf eine „schlechte Verwaltung“ durch die politischen Führer, die Spekulationen der „Händler“ oder ein unverantwortliches Verhalten der Banker zurückzuführen. All diese Gestalten haben nur die Gesetze des Kapitalismus angewandt, und es sind gerade diese Gesetze, die dem System zum Verhängnis werden. Deshalb werden all die Tausenden von Milliarden, die von allen Staaten und den Zentralbanken in die Wirtschaft gepumpt werden, nichts an der Lage ändern. Sie werden den Schuldenberg nur noch vergrößern. Es ist, als ob man ein Feuer mit Öl zu löschen versuchte. Der Einsatz dieser verzweifelten und wirkungslosen Mittel belegt, dass die herrschende Klasse eigentlich hilflos ist. Alle Rettungspläne sind früher oder später zum Scheitern verurteilt. Es wird keine wirkliche Ankurbelung der kapitalistischen Wirtschaft geben. Keine Politik, weder die von links noch von rechts, wird den Kapitalismus retten können, denn dieses System ist von einer tödlichen und unheilbaren Krankheit befallen.
Gegen die Zuspitzung der Armut müssen wir durch unsere Kämpfe und unsere Solidarität reagieren
Überall werden Vergleiche mit dem Krach von 1929 und der großen Depression in den 1930er Jahren angestellt. Die Bilder der damaligen Zeit sind noch in den Köpfen haften geblieben: endlos lange Schlange von Arbeitslosen, Arme vor den Suppenküchen, pleite gegangene und geschlossene Fabriken…
Aber ist die Lage von heute wirklich die gleiche? Die Antwort lautet klar Nein! Sie ist viel schlimmer, selbst wenn der Kapitalismus aus dieser Erfahrung gelernt hat und einen brutalen Zusammenbruch dank des Eingreifens des Staats und einer besseren internationalen Koordinierung hat vermeiden können.
Aber es gibt noch einen anderen Unterschied. Die schreckliche Depression der 1930er Jahre führte zum 2. Weltkrieg. Wird die gegenwärtige Krise in einen 3. Weltkrieg münden? Die Flucht nach vorne in einen Krieg ist die einzig mögliche Antwort seitens der Herrschenden gegenüber der unüberwindbaren Krise des Kapitalismus.
Und die einzige Kraft, die sich dem entgegenstellen kann, ist ihr Erzfeind, die Weltarbeiterklasse. Die Arbeiterklasse hatte in den 1930er Jahren eine schreckliche Niederlage nach der Isolierung der Revolution 1917 in Russland erlitten und sich für das imperialistische Massaker einspannen lassen. Aber die heutige Arbeiterklasse hat seit den großen Kämpfen von 1968 bewiesen, dass sie nicht bereit ist, erneut ihr Leben zu lassen für die Ausbeuterklasse. Seit 40 Jahren hat die Arbeiterklasse oft schmerzhafte Niederlagen hinnehmen müssen, aber sie bleibt weiterhin ungeschlagen und vor allem seit 2003 hat sie sich immer mehr zur Wehr gesetzt. Die Beschleunigung der Wirtschaftskrise wird für Hunderte von Millionen von Arbeitern nicht nur in den unterentwickelten, sondern auch in den entwickelten Ländern ein schreckliches Leiden, Arbeitslosigkeit, Armut, Hunger usw. verursachen – aber sie wird ebenso notwendigerweise Abwehrkämpfe seitens der Ausgebeuteten hervorrufen.
Diese Kämpfe sind unabdingbar zur Begrenzung der wirtschaftlichen Angriffe seitens der Herrschenden, um sie daran zu hindern, die Ausgebeuteten in eine absolute Verarmung zu stürzen. Aber es ist klar, dass sie den Kapitalismus nicht daran hindern können, immer mehr in der Krise zu versinken. Sie ermöglicht es den Ausgebeuteten, ihre kollektive Stärke zu entwickeln, ihre Einheit, ihre Solidarität, ihr Bewusstsein im Hinblick auf die einzige Alternative, die der Menschheit eine Zukunft bieten kann: die Überwindung des kapitalistischen Systems und seine Ersetzung durch eine Gesellschaft, die auf ganz anderen Grundlagen fußt. Eine Gesellschaft, die nicht mehr auf Ausbeutung und Profit sowie der Produktion für einen Markt basiert, sondern die für die Bedürfnisse der Menschen produziert. Diese Gesellschaft wird von den Arbeitern selbst geleitet werden und nicht von einer privilegierten Minderheit: Es handelt sich um die kommunistische Gesellschaft.
Acht Jahrzehnte lang haben alle Teile der kapitalistischen Klasse, vom linken bis zum rechten Flügel, gemeinsam daran gewirkt, die seinerzeit in Osteuropa und China herrschenden Regime als "kommunistisch" darzustellen; in Wirklichkeit waren diese nur eine besonders barbarische Form des Staatskapitalismus. Sie wollten versuchen, die Ausgebeuteten davon zu überzeugen, dass es vergeblich wäre, von einer anderen Welt zu träumen, dass es keine andere Welt als den Kapitalismus geben könnte.
Nachdem heute der Kapitalismus seinen historischen Bankrott offenbart, muss die Perspektive der kommunistischen Gesellschaft immer mehr die Kämpfe der Arbeiter inspirieren.
Gegenüber den Angriffen des sich in äußerster Bedrängnis befindenden Kapitalismus,um die Ausbeutung, Armut, die kriegerische Barbarei zu überwinden brauchen wir die Entwicklung von Arbeiterkämpfen auf der ganzen Welt.
Proletarier, aller Länder vereinigt euch!
Internationale Kommunistische Strömung, 25.10.2008
Aktuelles und Laufendes:
Historische Ereignisse:
Dagonmei: Ein Blick hinter das chinesische Wirtschaftswunder
- 4727 reads
Pun Ngai ist Professorin am sozialwissenschaftlichen Zentrum der Pekinger Universität und der Hongkonger Polytechnischen Universität. Zurzeit befindet sie sich auf einer Tournee durch fünf europäische Länder, um das Buch „DAGONMEI - Arbeiterinnen aus Chinas Weltmarktfabriken erzählen“ vorzustellen, das sie zusammen mit ihrem Kollegen Li Wanwei vom Institut für industrielle Beziehungen in Hongkong herausgegeben hat. (1) Nicht zuletzt das Erscheinen dieses Buches auf Deutsch bot den Anlass zu dieser öffentlichen Gesprächsreihe.
Pun Ngai ist Professorin am sozialwissenschaftlichen Zentrum der Pekinger Universität und der Hongkonger Polytechnischen Universität. Zurzeit befindet sie sich auf einer Tournee durch fünf europäische Länder, um das Buch „DAGONMEI - Arbeiterinnen aus Chinas Weltmarktfabriken erzählen“ vorzustellen, das sie zusammen mit ihrem Kollegen Li Wanwei vom Institut für industrielle Beziehungen in Hongkong herausgegeben hat. (1) Nicht zuletzt das Erscheinen dieses Buches auf Deutsch bot den Anlass zu dieser öffentlichen Gesprächsreihe.
Am 10. Oktober 2008 stellte Pun Ngai dieses Buch in Köln vor. Eingedenk der Bedeutung des wirtschaftlichen und militärischen Aufstiegs Chinas in den letzten Jahrzehnten und der Fragen, die sich bezüglich der Zukunft dieses „Wirtschaftswunders“ im Lichte der gegenwärtigen Agonien des Weltkapitalismus stellen, war es keine Überraschung, dass das Kölner Treffen auf großes Interesse stieß.
Das Subjekt der Untersuchung von Pun Ngai sind die Arbeitsimmigranten innerhalb Chinas – die Proletarisierung von 120 Millionen Bauern im vergangenen Vierteljahrhundert – insbesondere die Bedingungen der „Dagongmei“, wörtlich: „Arbeitsschwestern“. Pun Ngai und Li Wanwei präsentierten eine Reihe von Interviews mit jungen Arbeiterinnen, die aus den ländlichen Gebieten in die Industriestadt Shenzen in Südchina gekommen waren, einer der ersten Sonderwirtschaftszonen, die von der chinesischen Regierung geschaffen worden waren, um ausländisches Kapital anzuziehen. In ihrer Präsentation gab Pun Ngai Beispiele aus den persönlichen Erfahrungen solcher Arbeiterinnen.
Doch vor allem war es ihr Anliegen, diese Erfahrungen in einen globaleren Zusammenhang zu setzen, um Bewegungen einen „Sinn abzugewinnen“, die zweifellos von weltweiter Bedeutung sind. Sie stellte zwei Hauptargumente vor, die im Zentrum ihrer Analyse der Entwicklungen in China stehen.
Produktion und Reproduktion derArbeitskraft
Das erste ist die Trennung zwischen der Produktionssphäre in den Städten und der Reproduktionssphäre auf dem Lande. Ein großer Teil der Arbeitskraft für die Weltmarktfabriken wird vom Lande rekrutiert. Die Reproduktionskosten dieser Arbeitskräfte werden von den Bauernfamilien selbst auf der Grundlage winziger Landparzellen auf Subsistenzbasis übernommen. Dies erklärt größtenteils, warum die Löhne in China so viel niedriger sein können als in den alten weiterentwickelten kapitalistischen Ländern des Westen oder in Japan, wo die Lohnarbeit zum großen Teil im Rahmen des Lohnarbeitssystems reproduziert wird (mit anderen Worten: wo die Löhne nicht nur die Reproduktionskosten der ArbeiterInnen selbst decken müssen, sondern auch die ihrer Kinder, der künftigen Generation von Proletariern).
Doch wie in der sich anschließenden Diskussion betont wurde, ist dieses „Geheimnis“ der kapitalistischen Entwicklung keine chinesische Besonderheit, sondern liefert die Basis für ähnliche Entwicklungen anderswo in Asien oder auf anderen Kontinenten. Viele Besucher dieses Treffens waren auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, warum China erfolgreicher in dieser Entwicklung ist als die meisten seiner Rivalen.
Schlafsaal Kapitalismus
Hier ist der zweite Gedanke, der von Pun Ngai vorgestellt wurde, von eminenter Bedeutung. Es ist, wie sie es nennt, das Schlafsaalsystem. Im maoistischen China (wie im stalinistischen Russland, möchten wir hinzufügen) war die freie Bewegung der Arbeit innerhalb des Landes nicht zugelassen. Insbesondere wurde die gesamte Bevölkerung entweder als Stadt- oder Landbewohner registriert. Ein Bauer benötigte eine Genehmigung, um in die Stadt zu ziehen, und umgekehrt. Trotz aller Wirtschafts“reformen“ von Deng wurde diese Einschränkung der Beweglichkeit der Arbeit beibehalten. Auf dem ersten Blick ist dies überraschend mit Blick auf die Notwendigkeit der Freizügigkeit der Arbeit für das Kapital. Doch die Beibehaltung dieser Regulierungen macht aus den Migranten in den Städten „Illegale“ im eigenen Land, ohne Versicherung, medizinische Versorgung oder Bildungsstätten. Auch haben sie nicht die Möglichkeit, Arbeiter-Communities für sich selbst in den urbanen Zentren zu bilden. Sie sind gezwungen, in Schlafsälen zu übernachten, die den Bossen gehören. Als solche sind sie ständig unter der Kontrolle ihrer Arbeitgeber. Wie Pun Ngai betonte, können sie sich nicht weigern, ihre Körper zu verkaufen, ohne von Räumung bedroht und zurück in ihre Dörfer geschickt zu werden. Sie sind jederzeit für die „Just in time“-Produktion, die der Weltmarkt erfordert, verfügbar. Wie die Opfer dieses Systems selbst sagen, sind sie „sofort verfügbare“ „Wegwerfarbeiter“, die zurück aufs Land geschickt werden können, sobald sie nicht mehr erforderlich sind oder ihre Gesundheit ruiniert ist.
Pun Ngai vergleicht diesen Proletarisierungsprozess mit dem ersten Industrieland in der Geschichte, Großbritannien, wie es von Friedrich Engels in seiner berühmten Untersuchung der Arbeiterklasse in England geschildert wurde. Während sie auf die Existenz einer Reihe von Ähnlichkeiten hinwies, unterstrich sie gleichzeitig zwei Unterschiede. Zunächst einmal war der Ausgangspunkt für den Aufstieg des modernen Kapitalismus die gewaltsame Trennung der Produzenten von den Produktionsmitteln, der Bauern von ihrem Land. In China ließen die Landreformen Maos der Bauernschaft eigene, winzige Landparzellen, zuviel, um zu verhungern, aber nicht genug, um davon zu leben. Aus diesem Grund ist die Migration der ländlichen Armen „freiwillig“, findet offiziell aber nur unter Verletzung staatlicher Gesetze statt. Darüber hinaus sind besonders junge Frauen durch kulturelle Faktoren (wie während der Diskussion betont wurde) motiviert, der rückständigen, patriarchalischen Welt des Dorfes zu entfliehen. Zweitens ist es, wie bereits unterstrichen worden war, die Besonderheit (Pun Ngai nannte sie eine Unvollständigkeit) dieser Proletarisierung, dass die ArbeiterInnen unter der Drohung gehalten werden, zurück aufs Land geschickt zu werden. Sie betonte die Traumata, die durch die Unsicherheit dieses „Zwischenstatus“, der auf die Dauer unerträglich ist.
In ihrer Antwort auf eine entsprechende Frage aus dem Publikum wies sie darauf hin, dass die chinesische Regierung gegenwärtig die Möglichkeiten einer Landreform in Erwägung zieht, die den Erwerb privaten Landes erleichtern soll. Doch der Sinn dieser „Reform“ wäre nicht, der Bauernschaft zu erlauben, ihre Parzellen zu vergrößern, was die Subsistenzwirtschaft überlebensfähiger machen und somit der Migration vom Lande Einhalt gebieten würde. Vorgesehen ist im Wesentlichen eine Ermunterung zum Kauf großer Landgüter, die im Gegenteil die Migration weiter anfachen und den Städten neue Reserven billiger Arbeitskräfte bescheren würden.
Eine neue Generation von Arbeitern
Bezüglich der Auswirkungen dieser historischen Entwicklungen auf die Arbeiterklasse unterschied Pun Ngai zwischen der ersten und der zweiten Generation von Migranten. Die erste Generation hatte noch die Hoffnung, Geld zu sparen und nach Hause zurückzukehren. Die Männer konnten darauf hoffen, ihre Parzellen zu modernisieren, die Frauen darauf, kleine Geschäfte zu eröffnen. Doch für die weit überwiegende Mehrheit realisierten sich solche Träume niemals, und viele, die es versuchten, endeten in finanziellem Ruin. Die erste Generation wurde durch diese Erfahrungen, die sich durch Verzweiflung und Verinnerlichung ihres Zorns auszeichneten, traumatisiert.
Im Gegensatz dazu ist das Motto der neuen Generation: „keine Trauer“ darüber, die Dörfer verlassen zu haben. Sie ist entschlossen, niemals zurückzugehen. Die Energie dieser ArbeiterInnen richtet sich auf die Zukunft und nach außen und drückt sich selbst in kollektiven Klassenaktionen aus. Laut offiziellen Zahlen stieg zwischen 1993 und 2005 die Zahl der jährlich registrierten „kollektiven Vorkommnisse“ von 10.000 auf 87.000. Besonders in den vergangenen drei Jahren haben nahezu alle Teile der Klasse einschlägige Erfahrungen gesammelt. Proteste und Petitionen werden nicht nur gegen bzw. an die Arbeitgeber gerichtet, sondern auch gegen die staatliche Verwaltung und den offiziellen Gewerkschaftsapparat. Pun Ngai berichtete von Diskussionen, wo militante Minderheiten von Arbeitern äußerten: „Wir müssen nach einem großen Ideal suchen! Wir brauchen neue innere Werte!“
Diese Ideen, sagt sie, verbreiten sich heute immer mehr. Sie berichtete ebenfalls, dass insbesondere die Arbeiterinnen in einigen Fällen begonnen haben, die Schlafsäle in Orte des Kontaktes, Dissens‘ und der Organisierung von ArbeiterInnen umzuwandeln.
Einige Besucher stellten auch allgemeinere politische Fragen. Jemand wollte wissen, wann China ihrer Meinung nach eine Demokratie werde. Sie antwortete, dass dies nicht wirklich ihr Anliegen sei und dass Demokratie etwas sei, was einer Definition bedarf. Ihr Anliegen sei die Entwicklung dessen, was sie Graswurzeldemokratie in der Klasse nannte. In ihrer Antwort auf die Frage, ob die ArbeiterInnen sich heute positiv darauf beziehen, was der Fragesteller den „Sozialismus“ von Mao nannte, und ob sie irgendetwas Positives aus dieser „sozialistischen“ Erziehung für ihren jetzigen Kämpfe gelernt haben, sagte sie, dass ArbeiterInnen gelegentlich Zitate von Mao benutzen, um bestimmte Forderungen gegenüber dem Staat legal zu rechtfertigen. Über die Versuche, patriotische Gefühle über die neue „Größe Chinas“ (zum Beispiel anlässlich der Olympischen Spiele) unter den ArbeiterInnen zu entfachen, sagte sie, dass sie sowohl durch den Westen (durch seinen aggressiven Diskurs) als auch von den chinesischen Herrschern selbst gefördert wurden und ein negativer Faktor gegen die Arbeiterklasse seien.
Natürlich wollten alle von Pun Ngai wissen, wie die aktuelle weltweite Finanzkrise China betreffen werde. Sie sagte, dass dies angesichts der Exportabhängigkeit des Landes wahrscheinlich weitverbreitete Arbeitslosigkeit und wachsende Armut verursachen werde. Nach etlichen Jahren steigender Löhne, nicht zuletzt unter dem Druck der Arbeitermilitanz, würde dies wahrscheinlich die „Verhandlungsmacht“ beträchtlicher Teile der Klasse beeinträchtigen.
Es wurden so viele Fragen gestellt, dass am Ende leider keine Zeit mehr war für die vorgesehene allgemeine Diskussion. Doch es wurde darauf hingewiesen, dass das System, Arbeitskräfte illegal, aber geduldet – und somit besonders billig und fügsam – zu machen, keine Besonderheit Chinas ist, sondern überall auf der Welt um sich greift, einschließlich in Europa und den Vereinigten Staaten. Die Besonderheit Chinas ist das Ausmaß, in dem dieses Mittel angewendet wird. Die Schlafsäle beherbergen regulär zwischen 5.000 und 10.000 ArbeiterInnen pro Einheit. Die Agglomerationen dieser Lager umfassen häufig Gebiete, die so groß wie eine durchschnittliche europäische Großstadt sind.
Als Schlussfolgerung können wir durchaus sagen, dass jene, die zu dem Treffen gekommen waren, sehr bewegt waren von der Präsenz, dem Kampfgeist und der Klarheit in den Analysen einer Repräsentantin der Arbeiterklasse aus China. (2)
Kapitalismus heißt Weltwirtschaft. Durch die weltweite Zusammenschaltung und die Entwicklung des Klassenkampfes schafft der Kapitalismus gegen seinen Willen die Bedingungen für die Vereinigung seiner eigenen Totengräber.
Geographisch:
- China [52]
Aktuelles und Laufendes:
- China [53]
- Lage der Arbeiter in China [54]
- Wirtschaftswunder China [55]
- Dagongmei [56]
Leute:
November 2008
- 791 reads
Die Welt am Rande einer Umweltkatastrophe /I
- 3993 reads
Die Frage der Umwelt ist immer schon in der Propaganda der Revolutionäre seit der Entblößung der unerträglichen Lebensbedingungen im London des 19. Jahrhunderts durch Marx und Engels bis zu Bordiga und seinen Schriften über die Umweltzerstörungen infolge des unverantwortlichen Handelns des Kapitalismus aufgegriffen worden. Heute ist diese Frage noch zentraler, und sie verlangt verstärkte Anstrengungen seitens der revolutionären Organisationen um aufzuzeigen, dass die historische Alternative, vor der die Menschheit steht – Sozialismus oder Barbarei –, die Perspektive des Sozialismus gegenüber der Barbarei nicht nur die Frage der lokalen oder generalisierten Kriege umfasst. Sondern diese Barbarei betrifft auch die Frage der Gefahr einer ökologischen und Umweltkatastrophe, die sich immer deutlicher abzeichnet.
Die Welt am Rande einer Umweltkatastrophe /I
„Die Hungersnöte dehnen sich in den Ländern der 3. Welt aus, und sie werden auch bald in den Ländern zu vermelden sein, die angeblich „sozialistisch“ waren. Gleichzeitig vernichtet man in Westeuropa und in Nordamerika die landwirtschaftlichen Güter massenweise, und bezahlt man den Bauern Gelder, damit weniger angebaut und geerntet wird. Sie werden bestraft, wenn sie mehr als die auferlegten Quoten produzieren. In Lateinamerika töten Epidemien wie die Cholera Tausende von Menschen, obgleich diese Geißel schon lange zuvor gebannt worden war. Zehntausende von Menschen fallen weiterhin innerhalb weniger Stunden Überschwemmungen und Erdbeben zum Opfer, obgleich die Gesellschaft eigentlich in der Lage ist, Deiche und erdbebensichere Häuser zu bauen. Man darf eigentlich gar nicht die Tücken oder „Fatalitäten“ der Natur erwähnen, wenn wie in Tschernobyl 1986 die Explosion eines AKW's Hunderte (eigentlich Tausende) Menschen tötet und noch vielmehr in vielen Provinzen radioaktiv verstrahlt. Typisch ist es, dass sich in den höchstentwickelten Ländern tödliche Unfälle häufen: 60 Tote in einem Pariser Bahnhof, 100 Tote bei einem Brand in der Londoner U-Bahn. Dieses System hat sich als unfähig erwiesen, der Zerstörung der Natur entgegenzutreten, den sauren Regen, die Verschmutzungen jeder Art und insbesondere die durch Atomkraftwerke, den Treibhauseffekt, die zunehmende Verwüstung zu bekämpfen; d.h. alles Faktoren, die das Überleben der Menschheit selber bedrohen“ (1991, Kommunistische Revolution oder Zerstörung der Menschheit“ Manifest des. 9. Kongresses der IKS 1991).
Die Frage der Umwelt ist immer schon in der Propaganda der Revolutionäre seit der Entblößung der unerträglichen Lebensbedingungen im London des 19. Jahrhunderts durch Marx und Engels bis zu Bordiga und seinen Schriften über die Umweltzerstörungen infolge des unverantwortlichen Handelns des Kapitalismus aufgegriffen worden. Heute ist diese Frage noch zentraler, und sie verlangt verstärkte Anstrengungen seitens der revolutionären Organisationen um aufzuzeigen, dass die historische Alternative, vor der die Menschheit steht – Sozialismus oder Barbarei –, die Perspektive des Sozialismus gegenüber der Barbarei nicht nur die Frage der lokalen oder generalisierten Kriege umfasst. Sondern diese Barbarei betrifft auch die Frage der Gefahr einer ökologischen und Umweltkatastrophe, die sich immer deutlicher abzeichnet.
Mit dieser Artikelserie möchte die IKS die Umweltfrage aufgreifen. Dabei werden wir auf die folgenden Aspekte eingehen:
Im ersten Artikel versuchen wir eine kurze Bestandsaufnahme der Lage heute zu machen und aufzuzeigen, vor welchem globalen Risiko die Menschheit heute steht, insbesondere die weltweit anzutreffenden zerstörerischsten Phänomene wie:
-
Zunahme des Treibhauseffektes
-
Müllentsorgung
-
Die grenzenlose Ausbreitung von Giftstoffen und die damit verbundenen biologischen Prozesse
-
Die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen und/oder ihre Umwandlung durch Giftstoffe
Im zweiten Artikel werden wir versuchen aufzuzeigen, warum die Umweltprobleme nicht auf die Verantwortlichkeit Einzelner zurückgeführt werden kann, obwohl es auch individuelle Verantwortlichkeiten gibt, weil der Kapitalismus und seine Logik des Strebens nach Höchstprofiten die wirklichen verantwortlichen Kräfte sind. So werden wir sehen, dass die Entwicklung der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Forschung keinem Zufall unterworfen ist, sondern den Zwangsgesetzen des Kapitalismus vom Höchstprofit unterliegt.
Im dritten Artikel werden wir auf die Lösungsansätze der verschiedenen Bewegungen der Grünen, Ökologen usw. eingehen, um aufzuzeigen, dass trotz ihrer guten Absichten und dem guten Willen vieler ihrer Aktivisten diese Lösungsansätze nicht nur völlig wirkungslos sind, sondern direkt die Illusionen hinsichtlich einer möglichen Lösung für diese Fragen innerhalb des Kapitalismus verstärken, während in Wirklichkeit die einzige Lösung die internationale kommunistische Revolution sein kann.
Die Vorboten der Katastrophe
Man spricht immer mehr von Umweltproblemen, allein schon weil in der jüngsten Zeit in verschiedenen Ländern der Welt Parteien entstanden sind, die sich den Umweltschutz auf die Fahnen geschrieben haben. Ist das beruhigend? Überhaupt nicht! Wenn jetzt ein großes Aufheben um diese Frage gemacht wird, geht es nur darum, uns noch mehr in dieser Frage zu verwirren. Deshalb haben wir beschlossen, an erster Stelle besondere Phänomene zu beschreiben, die alle zusammengenommen die Gesellschaft immer mehr an den Rand einer Umweltkatastrophe drängen. Wie wir aufzeigen werden, ist die Lage im Gegensatz zu all den Beteuerungen in den Medien und insbesondere in den auf Hochglanzpapier gedruckten Fachzeitschriften noch viel schwerwiegender und bedrohlicher, als man sagt. Nicht dieser oder jener profitgierige und unverantwortlich handelnde Einzelkapitalist; nicht dieser oder jener Mafioso oder dieses oder jenes Camorra Mitglied ist für die Lage verantwortlich, sondern das kapitalistische System insgesamt.
Die Auswirkungen des wachsenden Treibhauseffektes
Jedermann spricht von den Auswirkungen des Treibhauseffektes, aber meist beruht dies nicht auf einer wirklichen Sachkenntnis. Es ist wichtig hervorzuheben, dass der Treibhauseffekt für das Leben auf der Erde eine durchaus positive Funktion erfüllt - zumindest für die Art Leben, die wir kennen, weil er es ermöglicht, dass auf der Erdoberfläche eine Durchschnittstemperatur von ungefähr 15° herrscht (dieser Durchschnitt berücksichtigt die vier Jahreszeiten und die verschiedenen Breitengrade) statt minus17°C, d.h. der geschätzten Temperatur, wenn es den Treibhauseffekt nicht gäbe. Man muss sich vorstellen, wie die Welt aussehen würde, wenn die Temperaturen ständig unter Null lägen, Seen und Flüsse vereist… Worauf ist dieser 'Überschuss' von mehr als 32°C zurückzuführen? Auf den Treibhauseffekt: Das Sonnenlicht dringt durch die niedrigsten Schichten der Atmosphäre ohne absorbiert zu werden (die Sonne erwärmt nicht die Luft) und liefert die Energie auf der Erde. Die daraus entstehende Strahlung (wie die von jedem Himmelskörper) setzt sich hauptsächlich aus Infrarotstrahlen zusammen; sie wird durch einige Bestandteile der Luft aufgefangen und stark absorbiert wie Kohlenstoffanhydrid, Wasserdampf, Methan und andere zusammengesetzte Teile wie Fluorchlorkohlenwasserstoff (Abkürzung FCKW). Daraus geht hervor, dass die thermische Bilanz der Erde aus dieser Wärme, die in den unteren Schichten der Erdatmosphäre entsteht, Nutzen zieht, weil sie dazu dient, die Temperatur auf der Erdoberfläche um 32°C ansteigen zu lassen. Das Problem ist also nicht der Treibhauseffekt als solcher, sondern die Tatsache, dass mit der Entwicklung der Industriegesellschaft Substanzen in die Atmosphäre abgelassen wurden, die einen Treibhauseffekt bewirken und die bei zunehmender Konzentration eine deutliche Erderwärmung verursachen. Man hat zum Beispiel mit Hilfe von Untersuchungen der Luft durch Bohrungen im 650000 Jahre alten Polareis bewiesen, dass die gegenwärtige Konzentration von CO2 von 380 ppm (Milligramm pro Kubikdezimeter) die höchste je gemessene ist und vielleicht sogar die höchste seit den letzten 20 Millionen Jahren. Die im 20. Jahrhundert ermittelten Temperaturen sind die höchsten seit den vergangenen 20000 Jahren. Die wahnsinnige Verwendung fossiler Brennstoffe als Energiequelle und die wachsende Abholzung der Wälder auf der Erde haben seit dem Industriezeitalter das natürliche Gleichgewicht des Kohlenstoffs in der Erdatmosphäre durcheinander gebracht. Dieses Gleichgewicht ist das Ergebnis der Freisetzung von CO2 in der Atmosphäre einerseits durch die Verbrennung und den Abbau von organischen Stoffen, und andererseits der Fixierung dieses Kohlendioxids in der Atmosphäre durch die Photosynthese. Bei diesem Prozess wird es in Kohlenhydrat und damit in einen komplexen organischen Stoff umgewandelt. Das Gleichgewicht zwischen Freisetzung (Verbrennung) und Fixierung (Photosynthese) von CO2 zugunsten der Freisetzung ist die Grundlage für die gegenwärtige Zuspitzung des Treibhauseffektes.
Wie weiter oben aufgeführt spielt nicht nur das Kohlendioxyd sondern auch Wasserdampf und Methan eine Rolle. Der Wasserdampf ist sowohl Faktor als auch Ergebnis des Treibhauseffektes, denn es gibt umso mehr Wasserdampf je stärker die Temperatur steigt. Die Zunahme des Methans in der Atmosphäre ist wiederum auf eine ganze Reihe von natürlichen Ursachen zurückzuführen, aber sie ist auch Ergebnis der zunehmenden Verwendung dieses Gases als Brennstoff und aufgrund von undichten Stellen in den auf der ganzen Welt verstreuten Gasleitungen. Das Methan, das auch "Moorgas" genannt wird, ist eine Art Gas, das aus der Gärung der organischen Stoffe entsteht, falls kein Sauerstoff vorhanden ist. Die Flutung von bewaldeten Tälern für den Bau von Dämmen für hydroelektrische Kraftwerke ist eine Ursache für die Zunahme der Methankonzentration. Aber das Problem des Methans, das gegenwärtig für ein Drittel der Zunahme des Treibhauseffektes verantwortlich ist, ist sehr viel größer als es anhand der eben erwähnten Fakten erscheint. Zunächst kann das Methan 23-mal mehr Infrarotstrahlung aufnehmen als Kohlendioxyd. Und das ist beträchtlich. Aber schlimmer noch! All die gegenwärtigen, ohnehin schon katastrophalen Prognosen berücksichtigen nicht das mögliche Szenario infolge der Freisetzung von Methan durch die gewaltigen natürlichen Methanreserven der Erde. Dieses befindet sich in verschlossenen Gashüllen, bei ungefähr 0° C und einem geringen Atmosphärendruck in besonderen Eisformationen (hydratisierten Gasen). Ein Liter Eiskristall kann ca. 50 Liter Methangas binden. Solche Vorkommen findet man vor allem im Meer, entlang des Kontinentalabhangs und im Innern der Permafrostzone in verschiedenen Teilen Sibiriens, Alaskas und Nordeuropas. Experten in diesem Bereich meinten dazu folgendes: "Wenn die globale Erwärmung gewisse Grenzen überschreitet (3 - 4°C) und wenn die Temperatur der Küstengewässer und des Permafrostgebietes ansteigen würde, könnte eine gewaltige Emission innerhalb einer kurzen Zeit (innerhalb von einigen Jahrzehnten) von freigesetztem Methan durch instabil gewordene Hydrate stattfinden, und dies würde zu einer katastrophalen Zunahme des Treibhauseffektes führen […] Im letzten Jahr sind die Methanemissionen auf schwedischem Boden im Norden des Polarkreises um 60% gestiegen. Der Anstieg der Temperaturen während der letzten 15 Jahre ist im Durchschnitt relativ begrenzt geblieben, aber in dem nördlichen Teil Eurasiens und Amerikas war er sehr ausgeprägt (im Sommer ist die mythische Nord-Westpassage eisfrei, die eine Durchfahrt mit dem Schiff vom Atlantik zum Pazifik ermöglicht)" (3).
Aber selbst ohne diese besonders ernsthafte Warnung haben international anerkannte Prognosen wie die des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) der UNO und des MIT (Massachusetts Institute of Technology) in Boston schon für das gegenwärtige Jahrhundert eine durchschnittliche Temperaturerhöhung von mindestens 0,5°C bis höchstens 4,5°C prognostiziert, ausgehend von der Annahme, dass sich allem Anschein nach nichts Wesentliches verändern wird. Darüber hinaus berücksichtigen deren Prognosen nicht einmal die Umwälzungen, die sich aus dem Erscheinen der beiden neuen Industriemächte China und Indien ergeben, welche gefräßige Energieverbraucher sind.
Eine zusätzliche Erwärmung von wenigen Grad würde eine größere Verdampfung des Wassers der Weltmeere verursachen, aber die genauesten Untersuchungen deuten darauf hin, dass es immer größere Unterschiede bei der geographischen Verteilung der Niederschlagsmengen geben wird. „Trockene Gebiete werden immer größer und noch trockener. Meeresgebiete mit Oberflächentemperaturen über 27°C, ein kritischer Wert für das Entstehen von Zyklonen, werden weiter wachsen – um 30 - 40%. Dies würde katastrophale meteorologische Folgen haben - und zu Überschwemmungen und immer neuen Zerstörungen führen. Das Schmelzen eines Großteils der antarktischen Gletscher und der Gletscher Grönlands, der Anstieg der Meereswassertemperaturen lässt den Meeresspiegel ansteigen (…) damit dringt Salzwasser in immer mehr fruchtbare Küstengebiete vor und überflutet sie (teilweise Bangladesh, viele Inseln in den Ozeanen)" (4). (ebenda).
Aus Platzgründen können wir nicht näher auf dieses Thema eingehen, aber man muss dennoch die Tatsache unterstreichen, dass der Klimawandel, der durch den Treibhauseffekt hervorgerufen wird, auch wenn er nicht den Rückschlag haben wird, den die Freisetzung von Methan aus der Erde verursacht, katastrophale Folgen haben wird. Dazu gehören zum Beispiel:
-
eine größere Intensität der meteorologischen Ereignisse, das größere Auswaschen der Böden durch noch stärkere Regenfälle, die Böden werden weniger ertragreich und die Verwüstung wird auch in den weniger gemäßigten Klimazonen voranschreiten, wie zum Beispiel in Piemont (Italien).
-
Im Mittelmeer und in anderen einst mäßig warmen Meeren, entstehen Umweltbedingungen, die das Überleben von Lebewesen ermöglichen, welche bislang nur in tropischen Gewässern lebten. Damit wird es zur Wanderung von bislang nicht einheimischen Lebewesen kommen, was zu Störungen des ökologischen Gleichgewichts führt.
-
Das Wiederauftauchen alter, längst ausgerotteter Krankheiten wie Malaria aufgrund der Ausbreitung von Klimabedingungen, die das Wachstum und die Verbreitung der Träger dieser Krankheiten wie Mücken usw. begünstigen.
Das Problem der Produktion und der Umgang mit Abfall
Ein zweites Problem, das typisch ist für diese Phase der kapitalistischen Gesellschaft ist die exzessive Produktion von Abfällen und die daraus resultierende Schwierigkeit der Entsorgung derselben. Während in der letzten Zeit die Meldungen über Müllberge in den Straßen Neapels und in Kampanien international in den Nachrichten auftauchten, ist das mit darauf zurückzuführen, dass dieser Teil der Welt noch immer als ein Teil der Industriestaaten und damit als ein Teil der fortgeschrittenen Länder angesehen wird. Aber die Tatsache, dass die Peripherien vieler Großstädte der Dritten Welt zu offenen Müllhalden geworden sind, ist mittlerweile längst bekannt.
Diese unglaubliche Anhäufung von Müll ist der Logik der Funktionsweise des Kapitalismus selbst geschuldet. Während die Menschheit immer Müll produziert hat, wurde dieser in der Vergangenheit immer verwertet und neu verwendet. Nur mit dem Einzug des Kapitalismus wird der Müll erst zu einem Problem aufgrund der besonderen Funktionsweise dieser Gesellschaft. Deren Mechanismen stützen sich alle auf ein grundlegendes Prinzip: Jedes Produkt menschlicher Aktivität wird als Ware betrachtet, d.h. etwas, das verkauft werden muss, um ein Höchstmaß an Profit zu erzielen auf einem Markt, wo gnadenlose Konkurrenz herrscht. Dies musste eine Reihe von verheerenden Konsequenzen nach sich ziehen:
-
Warenproduktion kann in Raum und Zeit aufgrund der Konkurrenz unter den Kapitalisten nicht geplant werden. Sie unterliegt einer irrationalen Logik, die dazu führt, dass jeder einzelne Kapitalist seine Produktion ausdehnt, um mit möglichst niedrigen Kosten zu verkaufen und um seinen Profit zu realisieren. Dadurch stapeln sich Berge von unverkauften Waren. Gerade diese Notwendigkeit, den Konkurrenten zu besiegen und die Preise zu senken, zwingt die Produzenten dazu, die Qualität der hergestellten Waren zu senken. Dadurch sinkt ihre Haltbarkeit drastisch und die Produkte zerfallen viel schneller und müssen weggeschmissen werden.
-
Eine Wahnsinnsproduktion von Verpackungen und Aufmachung, oft unter Verwendung giftiger Substanzen, die nicht abbaubar sind und die irgendwo in der Natur einfach auf den Müll geschmissen werden. Diese Verpackungen, die oft keinen Nutzen haben außer die Produkte "ansehnlicher", für den Verkauf attraktiver zu machen, stellen häufig ein größeres Gewicht dar und nehmen größeren Raum ein als der Inhalt der verkauften Ware selbst. Man geht davon aus, dass gegenwärtig ein Müllsack, bei dem keine Abfalltrennung vorgenommen wurde, heute bis zur Hälfte mit Verpackungsmaterial voll gestopft ist.
-
Das Abfallaufkommen wird zudem noch durch die neuen "Lebensstilformen" verschärft, die dem "modernen Leben" innewohnen. Auswärts essen, in einem Selbstbedienungsrestaurant, auf Plastiktellern und Mineralwasser aus Plastikflaschen trinken, ist mittlerweile zu einer Alltagstätigkeit für Hunderte Millionen Menschen auf der ganzen Welt geworden. Auch die Verwendung von Plastiktüten zum Einkauf ist eine "praktische Annehmlichkeit", die von vielen benutzt wird. All das ist umweltgefährdend – und nützt nur dem Besitzer des Schnellrestaurants, der das Reinigungspersonal einsparen kann, welches nötig ist, wenn man andere Verpackungsarten verwendet. Der Besitzer des Supermarktes oder gar der Ladenbesitzer um die Ecke kommt dabei auf seine Kosten, denn der Kunde kann zu jedem Zeitpunkt das kaufen, was er will, auch wenn er das ursprünglich gar nicht geplant hatte, weil er immer eine Plastiktüte zum Tragen bekommt. All das bewirkt eine ungeheure Steigerung der Produktion von Abfall und Verpackungsmüll, so dass man pro Kopf fast mit einem Kilo Abfall & Verpackungen rechnen muss, d.h. Millionen Tonnen verschiedenster Abfälle pro Tag.
Man geht davon aus, dass allein in einem Land wie Italien die Abfallmenge sich während der letzten 25 Jahre bei gleich bleibender Bevölkerungszahl mehr als verdoppelt hat.
Die Frage des Mülls ist eine der Fragen, welche die Politiker meinen lösen zu können, aber im Kapitalismus stößt sie in Wirklichkeit auf unüberwindbare Hürden. Aber diese Hürden tauchen nicht aufgrund mangelnder Technologie auf, sondern im Gegenteil sie sind das Ergebnis der Mechanismen, die diese Gesellschaft beherrschen. Denn der Umgang mit Müll, sei es um ihn zu entsorgen oder seinen Umfang zu reduzieren, ist auch den Regeln der Profitwirtschaft unterworfen. Selbst wenn Recycling und die Wiederverwendung von Material durch Mülltrennung usw. möglich sind, erfordert dies Mittel und eine gewisse politische Koordinierungsfähigkeit, welche im Allgemeinen in den schwächeren Wirtschaften ohnehin fehlt. Deshalb stellt in den ärmeren Ländern oder dort, wo die Firmen in Anbetracht der Beschleunigung der Krise während der letzten Jahrzehnte vor größeren Schwierigkeiten stehen, die Abfallentsorgung mehr als einen zusätzlichen Kostenfaktor dar.
Aber manche mögen einwenden: Wenn in den fortgeschrittenen Ländern die Müllentsorgung funktioniert, heißt dies, dass es sich nur um eine Frage des guten Willens, des richtigen Bürgersinns und der Fähigkeit der ordentlichen Leitung einer Firma handelt. Das Problem sei, dass wie in allen Bereichen der Produktion die stärksten Länder einen Teil der Last der Abfallentsorgung auf die schwächeren Länder (oder innerhalb der stärksten Länder auf die schwächeren Regionen) abwälzen.
"Zwei amerikanische Umweltgruppen, Basel Action Network und Silicon Valley Toxics, haben neulich einen Bericht veröffentlicht, in dem behauptet wird, dass 50 - 80% der Elektronikabfälle der westlichen US-Bundesstaaten in Container auf Schiffe verladen werden, die Richtung Asien (vor allem Indien und China) fahren, wo die Kosten für ihre Beseitigung wesentlich niedriger sind und die Umweltschutzauflagen viel lockerer sind. Es handelt sich nicht um Hilfsprojekte, sondern um einen Handel mit giftigen Rückständen, die Verbraucher weggeschmissen haben. Der Bericht der beiden Umweltgruppen erwähnt zum Beispiel die Müllhalde von Guiyu, auf der vor allem Bildschirme und Drucker gelagert werden. Die Arbeiter von Guiyu benutzen nur sehr primitive Werkzeuge, um daraus die Teile auszubauen, welche weiter verkauft werden können. Eine enorme Menge an Elektronikschrott wird nicht recycelt, sondern liegt einfach auf den Feldern, an Flussufern, in Teichen und Sümpfen, Flüssen und Bewässerungskanälen herum. Ohne irgendwelchen Schutz arbeiten dort Frauen, Männer und Kinder" (4).
"In Italien (…) schätzt man, dass die Öko-Mafiosi einen Umsatz von 26 Milliarden Euro pro Jahr haben, davon 15 Mrd. für den illegalen Handel und die illegale Entsorgung von Müll (Bericht über die Ecomafia 2007, Umweltliga). (…) Der Zoll hat im Jahre 2006 ungefähr 286 Container beschlagnahmt mit mehr als 9000 Tonnen Müll. Die legale Entsorgung eines 15 Tonnen Containers mit gefährlichem Sondermüll kostet ungefähr 60000 Euro. Bei einer illegalen Entsorgung in Asien werden dafür nur 5000 Euro verlangt. Die Hauptabnehmer für illegalen Müllhandel sind asiatische Entwicklungsländer. Das dorthin exportierte Material wird zunächst verarbeitet, dann wieder nach Italien und andere Länder eingeführt, dieses Mal aber als ein Produkt, das aus dem Müll gewonnen wurde, und nun insbesondere Plastik verarbeitenden Fabriken zugeführt wird.
Im Juni 1992 hat die FAO (Food and Agricultural Organisation) angekündigt, dass die Entwicklungsländer, vor allem die afrikanischen Staaten, zu einer "Mülltonne" geworden sind, die dem Westen zur Verfügung stehen. Somalia scheint heute einer der am meisten gefährdeten afrikanischen Staaten zu sein, ein wahrer Dreh- und Angelpunkt für den Mülltourismus. In einem jüngsten Bericht der UNEP (United Nations Environment Programme) wird auf die ständig steigende Zahl von verschmutzten Grundwasservorkommen in Somalia hingewiesen, was unheilbare Erkrankungen verursacht. Der Hafen von Lagos, Nigeria, ist der wichtigste Umschlagplatz für den illegalen Handel von Technikschrott, der nach Afrika verschifft wird.
Jedes Jahr sammeln sich auf der Welt ca. 20 - 50 Millionen Tonnen "Elektroschrott" an. In Europa spricht man von 11 Millionen Tonnen, davon landen 80% auf dem Müll. Man geht davon aus, dass es 2008 mindestens eine Milliarde Computer (einen für sechs Erdbewohner) geben wird; gegen 2015 wird es mehr als zwei Milliarden PCs geben. Diese Zahlen bergen neue große Gefahren in sich, wenn es darum gehen wird, den alten Elektroschrott zu entsorgen" (5).
Wie oben erwähnt wird das Müllproblem aber auch auf die weniger entwickelten Regionen innerhalb eines Landes verlagert. Das trifft insbesondere für Kampanien, Italien, zu, was international von sich reden machte aufgrund ihrer Müllberge, die monatelang auf den Straßen herumlagen. Aber wenige wissen, dass Kampanien – so wie international China, Indien oder Nordafrika -, das 'Auffangbecken' für viel Giftmüll aus den Industriegebieten des Nordens ist. Dadurch wurden fruchtbare landwirtschaftliche Böden wie die um Caserta zu solchen der am meisten verschmutzten Böden der Erde. Trotz der eingeleiteten, wiederholten strafrechtlichen Verfolgungsmaßnahmen geht die Vernichtung der Böden weiter. Es sind aber nicht die Camorra, die Mafia, die Unterwelt usw., die diese Schäden verursachen, sondern die Logik des Kapitalismus ist dafür verantwortlich. Während für die vorschriftsmäßige Entsorgung von Giftmüll oft mehr als 60 Cent pro Kilo veranschlagt werden müssen, kostet die illegale Entsorgung nur etwas mehr als 10 Cent. So wird jedes Jahr jede verlassene Höhle zu einer offenen Müllkippe. In einem kleinen Dorf Kampaniens, wo eine Müllverbrennungsanlage gebaut werden soll, wurde giftiges Material zur Vertuschung des Giftbestandes mit Erde vermischt und dann beim Straßenbau verwendet. Dort hat man es als untere Schicht für eine lange Straße mit gestampftem Boden benutzt. Wie Saviano in seinem Buch, das mittlerweile in Italien zu einem Kultbuch geworden ist, schrieb: "wenn die illegalen Müllberge, die die Camorra "entsorgt" hat, auf einem Haufen zusammengetragen würden, würde dieser eine Höhe von 14600 Meter auf einer Fläche von 3 Hektar erreichen, das wäre höher als jeder Berg auf der Erde" (6).
Wie wir im nächsten Artikel näher ausführen werden, ist das Problem des Abfalls vor allem mit der Produktionsform verbunden, die die kapitalistische Gesellschaft auszeichnet. Abgesehen von dem Teil, der "weggeworfen" wird, sind die Probleme oft auf die Zusammensetzung und das Material zurückzuführen, die bei der Produktion verwendet werden. Die Verwendung von synthetischen Stoffen, insbesondere von Plastik, das praktisch unzerstörbar ist, bringt gewaltige Probleme für die zukünftigen Generationen mit sich. Und dieses Mal handelt es sich nicht mal um reiche oder arme Länder, weil Plastik nirgendwo auf der Welt abbaubar ist, wie der Auszug aus folgendem Artikel belegt: "Man nennt sie "Trash Vortex", die Müllinsel im Pazifischen Ozean, die einen Durchmesser von ca. 25000 km umfasst, ca. 30 m tief ist und zu ca. 80% aus Plastik besteht, die restlichen 20% sind anderer Müll, der dort gelandet ist. Es ist, als ob es inmitten des Pazifiks eine gigantische Insel gäbe, die nicht aus Felsen, sondern aus Müll besteht. In den letzten Wochen hat die Dichte dieses Materials solche Werte erreicht, dass das Gesamtgewicht dieser 'Müllinsel' ca. 3,5 Millionen Tonnen umfasst, erklärte Chris Parry von der Kalifornischen Küstenwacht in San Francisco (…) Diese unglaubliche, wenig bekannte Abfallmenge, ist seit den 1950er Jahren entstanden, aufgrund eines subtropischen Wirbels im Nordpazifik. Es handelt sich um eine langsame Strömung im Ozean, die sich im Uhrzeigersinn und spiralenförmig dreht, angetrieben von Hochdruckströmungen. (…). Der größte Teil dieses Plastiks, ca. 80%, wurde von den Kontinenten angeschwemmt. Nur der Rest stammt von Schiffen (private, Handels- oder Fischfangbooten). Jedes Jahr werden auf der Welt ca. 100 Milliarden Kilo Plastik produziert, davon landet ca. 10% im Meer. 70% dieses Plastiks versinkt auf den Meeresboden und schädigt somit die Lebewesen am Meeresgrund. Der Rest schwimmt an der Meeresoberfläche. Der Großteil dieses Plastiks ist wenig biologisch abbaubar und zerfällt letztendlich in winzige Partikel, die wiederum im Magen vieler Meerestiere landen und deren Tod verursachen. Was übrig bleibt, wird erst im Laufe von mehreren Hundert Jahren verfallen; solange wird es aber weiterhin großen Schaden in den Meeren anrichten" (7).
Solch eine Müllmenge auf einer Fläche, die zweimal größer ist als die USA soll wirklich erst jetzt entdeckt worden sein? In Wirklichkeit nein! Sie wurde 1997 von einem Kapitän eines Schiffs, welches der Meeresforschung dient, entdeckt. Der Kapitän befand sich auf der Rückkehr von einem Wettbewerb unter Yachten. Heute wird bekannt, dass die UNO in einem Bericht von 2006 davon ausgeht, „dass eine Million Meeresvögel und mehr als 100000 Fische und Meeressäugetiere jedes Jahr aufgrund des Plastikmülls sterben, und dass jede Meeresseemeile des Ozeans mindestens ungefähr 46000 Stücke schwimmenden Plastiks enthält“ (8).
Aber was wurde während der letzten 10 Jahre von denjenigen unternommen, die in der Gesellschaft am Hebel der Macht sitzen? Absolut gar nichts! Ähnliche Verhältnisse, auch wenn sie nicht so dramatisch sind, hat man auch im Mittelmeer beobachtet, in dessen Gewässer jedes Jahr 6.5 Mio. Abfall geschmissen werden, von denen 80% Plastik sind. Auf dem Boden des Mittelmeeres findet man stellenweise bis zu 2000 Stücke Plastik pro Quadratkilometer (9).
Und dabei gäbe es Lösungen. Wenn beispielsweise der Plastik aus mindestens 85% Maisstärke besteht, ist er vollständig biologisch abbaubar. Heute schon gibt es Tüten, Stifte und andere aus diesem Material bestehende Gegenstände. Aber im Kapitalismus schlägt die Industrie ungern einen Weg ein, der nicht höchste Profite verspricht. Und da Plastik auf der Grundlage von Maisstärke teurer ist, will niemand diese Kosten für die teurere Herstellung des biologisch abbaubaren Materials übernehmen, weil man sonst vom Markt verdrängt wird (10). Das Problem ist, dass die Kapitalisten die Gewohnheit haben, Wirtschaftsbilanzen zu erstellen, die systematisch all das ausschließen, was nicht zahlenmäßig erfasst werden kann, weil man es weder kaufen noch verkaufen kann, auch nicht, wenn es sich um die Gesundheit der Menschen und die Umwelt handelt. Jedes Mal, wenn ein Industrieller einen Stoff herstellen lässt, das am Ende seiner Lebensdauer zu Müll wird, werden die Kosten für die Entsorgung des Mülls praktisch nie einkalkuliert, und vor allem wird nie berücksichtigt, welche Kosten und Schäden daraus entstehen, dass dieses Material irgendwo auf der Erde nicht abgebaut liegen bleibt.
Man muss hinsichtlich des Müllproblems noch hinzufügen: Wenn man Müllhalden oder auch Verbrennungsanlagen verwendet, stellt das eine Verschwendung des ganzen Energiewertes und der nützlichen Bestandteile dieses Mülls dar. Es ist zum Beispiel bewiesen, dass die Herstellung bzw. Verarbeitung von Kupfer und Aluminium mit Hilfe von recyceltem Material Kostenersparnisse bis zu 90% ermöglichen kann. In den Ländern der Peripherie sind die Müllhalden zu einer wahren Quelle der Subsistenzmittel für Tausende von Menschen geworden, die vom Land gekommen sind, aber in der Stadt keine Arbeit finden. Müllsammler suchen auf den Müllhalden nach Wiederverwertbarem.
„Richtige „Müllstädte“ sind entstanden. In Afrika handelt es sich um Korogocha in Nairobi – Pater Zanotelli hat die Verhältnisse dort mehrmals beschrieben; weniger bekannt ist Kigali in Ruanda, aber die in Sambia sind auch berühmt. Dort wird 90% des Mülls nicht eingesammelt. Er verfault auf der Straße, während die Müllhalde von Olososua in Nigeria jeden Tag von mehr als 1000 LKW's angefahren wird. In Asien hat Payatas in Quezon City in der Nähe von Manila traurige Berühmtheit erlangt. Diese Slums, wo mehr als 25000 Menschen leben, sind am Abhang eines Müllbergs entstanden. Man nennt ihn den „stinkenden Berg“, wo sich Kinder und Erwachsene um das Material streiten, das sie weiterverkaufen können. Dann gibt es noch Paradise Village, das kein Touristendorf ist, sondern ein Slum, der auf einem Sumpfgebiet entstanden ist, wo es immer wieder zu Überschwemmungen und starken Monsunregenfällen kommt. Schließlich Dumpsite Catmon, die Müllhalde, auf der die Slums stehen, die Paradise Village überragen. In Beijing, China, leben Tausende von Menschen auf den Müllhalden, die verbotene, weil gefährliche Stoffe recyceln, während es in Indien die meisten „Überlebenden“ gibt, die sich dank der Müllhalden „ernähren“ können" (11).
Die Verbreitung der Giftstoffe
Giftstoffe sind natürliche oder synthetische Substanzen, die für den Menschen und/oder andere Lebewesen giftig sind. Neben Stoffen, die es immer schon auf unseren Planeten gegeben hat, und die von der industriellen Technologie auf verschiedenste Art verwendet werden – wie zum Beispiel Schwermetalle, Asbest, usw., hat die chemische Industrie Zehntausende anderer Stoffe massenweise produziert. Mangelnde Kenntnis der Gefahren einer Reihe von Stoffen, und vor allem der Zynismus des Kapitalismus haben unvorstellbare Schäden angerichtet. Dadurch sind Umweltzerstörungen entstanden, die man nur sehr schwer wieder beheben kann, nachdem die gegenwärtig herrschende Klasse gestürzt sein wird.
Eine der größten Katastrophen der chemischen Industrie ist sicherlich die von Bophal, Indien, die in dem Werk des amerikanischen Chemie-Multis Union Carbide zwischen dem 2. und 3. Dezember 1984 stattfand. Eine Giftwolke von 40 Tonnen Pestiziden hat entweder sofort oder in den darauf folgenden Jahren mindestens 16000 Menschen getötet. Millionen andere Menschen klagen seitdem über unheilbare körperliche Schäden. Später eingeleitete Untersuchungen haben zutage gebracht, dass im Gegensatz zu einem vergleichbaren Werk in Virginia, USA, das Werk in Bophal über keine drucktechnischen Überwachungsanlagen und Kühlsysteme verfügte. Der Kühlturm war vorübergehend außer Betrieb genommen worden; die Sicherheitssysteme entsprachen überhaupt nicht dem Ausmaß der Werksanlage. In Wirklichkeit stellte die indische Fabrik mit ihren billigen Arbeitskräften für die amerikanischen Besitzer eine sehr lukrative Einnahmequelle dar, die nur sehr geringe Investitionen in variables und fixes Kapital erforderte.
Ein anderes historisches Beispiel war dann der Vorfall in dem Atomkraftwerk von Tschernobyl 1986. „Man hat geschätzt, dass die radioaktiven Strahlen des Reaktors 4 von Tschernobyl ungefähr 200 mal höher lagen als die Explosionen der Atombomben von Hiroshima und Nagasaki zusammengenommen. Auf einem Gebiet zwischen Russland, der Ukraine und Weißrussland, in dem ungefähr 9 Millionen Menschen leben, hat man eine große Verseuchung festgestellt. 30% des Gebietes ist durch Cäsium 137 verseucht. In den 3 Ländern mussten ca. 400000 Menschen evakuiert werden, während weitere 270000 Menschen in Gebieten leben, wo der Konsum von örtlichen landwirtschaftlichen Produkten nur eingeschränkt erlaubt ist“ (12).
Es gibt natürlich noch unzählige andere Umweltkatastrophen aufgrund der miserablen Verwaltung von Betrieben oder aufgrund der vielen Meeresverschmutzungen durch Ölteppiche wie die, welcher der Öltanker Exxon Valdez am 24. März 1989 anrichtete, als bei seinem Untergang vor der Küste Alaskas mindestens 30000 Tonnen Öl ins Meer liefen, oder auch durch den ersten Golfkrieg, als viele Ölplattformen in Brand geschossen wurden und eine wahre Ökokatastrophe sich im Persischen Golf in einem bislang noch nie da gewesenen Ausmaß ausbreitete. Schätzungen der US-amerikanischen Nationalen Akademie der Wissenschaften zufolge werden jedes Jahr durchschnittlich zwischen 3 - 4 Millionen Tonnen Kohlenwasserstoff ins Meer eingeleitet. Tendenz steigend – trotz der verschiedenen Schutzmaßnahmen, denn die Nachfrage nach diesen Produkten wächst.
Neben den Auswirkungen dieser Verschmutzungen, die bei hoher Dosierung größere Vergiftungen hervorrufen, gibt es einen anderen Vergiftungsmechanismus, der langsamer, diskreter wirkt, die chronische Vergiftung. Wenn eine giftige Substanz langsam und in geringen Dosen aufgenommen wird und chemisch stabil ist, kann sie sich in den Organen und den Geweben der Lebewesen absetzen und soweit voranschreiten, dass tödliche Konzentrationen erreicht werden. Dies nennt man aus der Sicht der Ökotoxikologie Bioakkumulation. Ein anderer Mechanismus überträgt ebenso eine giftige Substanz, die in die Lebensmittelkette eindringt (das trophische Netz). Sie gelangt von einer niedrigen zu einer höheren Stufe der trophischen Stadien, mit jeweiliger Verdoppelung bzw. Verdreifachung der Konzentration. Um es deutlicher zu machen, nehmen wir ein konkretes Beispiel aus dem Jahre 1953 in Minamata in Japan. In der Minamata Bucht lebten viele arme Fischer, die sich im Wesentlichen aus ihrem Fischfang ernährten. In der Nähe dieser Bucht befand sich ein Industriekomplex, der Azetaldehyd, einen chemischen Stoff, eine Synthese, deren Zubereitung ein Quecksilberderivat erfordert, verwendete. Die ins Meer als Abfall eingeleiteten Stoffe waren leicht mit Quecksilber vergiftet. Die Konzentration betrug jedoch nur 0.1 Mikrogramm pro Liter Meerwasser, d.h. eine Konzentration, die selbst mit den heute verfügbaren genaueren Messgeräten immer noch schwierig aufzuspüren ist. Welche Konsequenzen zog man aus dieser kaum wahrnehmbaren Verschmutzung? 48 Menschen starben innerhalb weniger Tage, 156 litten unter Vergiftungen mit schwerwiegenden Folgen, und selbst die Katzen der Fischer, die sich ständig von Fischresten ernährten, wurden „irrsinnig“, "brachten sich schließlich selbst" im Meer um, ein für ein Raubtier völlig unübliches Verhalten. Was war passiert? Das im Meerwasser vorhandene Quecksilber war durch das Phytoplankton absorbiert und fixiert worden, war dann von diesem zum Zooplankton gewandert, schließlich zu den kleinen Mollusken (Weichtieren), und schlussendlich zu den kleineren und mittelgroßen Fischen. Der Vorgang erfasste die ganze trophische Kette. Dabei wurde der gleiche Schadstoff, der chemisch unzerstörbar ist, auf einen neuen ‚Gastgeber’ mit wachsender Konzentration übertragen und zwar umgekehrt proportional im Verhältnis zur Größe des Jägers und der Masse der während seines Lebens aufgenommenen Nahrung. So hat man festgestellt, dass bei Fischen das Metall eine Konzentration von 50 mg/Kilo erreicht hatte, was einer 500000 fachen Konzentration entspricht. Bei einigen Fischern mit dem „Minamata-Syndrom“ wurden erhöhte Metallwerte in ihren Organen, insbesondere in ihren Haaren, die mehr als ein halbes Gramm pro Kilo Körpergewicht betrugen.
Obgleich sich Anfang der 1960er Jahre die Wissenschaftler dessen bewusst waren, dass es bei giftigen Substanzen nicht ausreicht, Methoden der Auflösung in der Natur zu benutzen, weil erwiesenermaßen biologische Mechanismen dazu in der Lage sind, das zu konzentrieren, was der Mensch zerstreut, hat die chemische Industrie unseren Planeten weiterhin massiv verpestet – ohne dieses Mal den Vorwand auftischen zu können "wir haben nicht gewusst, dass so etwas eintreten kann". So ist es jüngst zu einem zweiten Minamata in Priolo (Sizilien) gekommen, wo auf einer Fläche von wenigen Quadratkilometern mindestens fünf Raffinerien, darunter Enichem, illegal Quecksilber aus einer Chlor- und Schwefelfabrik auf den Feldern entsorgen. Zwischen 1991 und 2001 sind ca. 1000 Kinder mit großen geistigen Behinderungen und ernsthaften Missbildungen sowohl am Herz als auch am Urogenitaltrakt geboren worden. Ganze Familien leiden unter Tumoren und viele verzweifelte Frauen sahen sich zu Abtreibungen gezwungen, weil sie verkrüppelte Kinder erwarteten. Dabei hatte der Vorfall von Minamata schon all die Risiken von Quecksilber für die menschliche Gesundheit aufgezeigt. Priolo ist also kein unvorhersehbares Ereignis, kein tragischer Fehler, sondern eine rein verbrecherische Tat, die von dem italienischen Kapitalismus und dabei noch von dem "Staatskapitalismus" verübt wurde, den viele Leute als "linker" als der "Privatsektor" darstellen wollen. In Wirklichkeit hat man feststellen müssen, dass die Führung von Enichem sich schlimmer als die Ökomafia verhalten hat: Um Kosten bei der "Dekontaminierung" (man spricht von mehreren Millionen eingesparten Euros) zu sparen, wurden die mit Quecksilber verseuchten Abfälle mit anderem Schutzwasser vermischt und im Meer entsorgt. Indem falsche Bescheinigungen ausgestellt wurden, benutzte man Tankwagen mit doppeltem Boden, um den Handel mit giftigen Substanzen zu verheimlichen – all das mit Übereinstimmung der verantwortlichen Stellen. Als die Justiz sich schließlich rührte und die führenden Köpfe der Industrie verhaftete, war die Verantwortung dermaßen unleugbar, dass Enichem ein Schmerzensgeld von 11000 Euro pro Familie beschloss, d.h. ein Betrag, den das Unternehmen bei einer rechtskräftigen Verurteilung durch ein Gericht hätte bezahlen müssen.
Neben den Ursachen für Verschmutzungen, die auf Unfälle zurückzuführen sind, produziert die ganze Gesellschaft aufgrund ihrer Funktionsweise ständig umweltgefährdende Stoffe, die sich in der Luft, im Wasser und am Boden sammeln – und wie schon erwähnt – in der Biosphäre, einschließlich bei den Menschen. Der massive Einsatz von Reinigungsmitteln und anderen Produkten dieser Art hat zum Phänomen der Eutrophierung (Nährstoffanreicherung in einem Gewässer) der Flüsse, Seen und Meere geführt. In den 1990er Jahren wurden in die Nordsee 6000 - 11000t Blei, 22 000 - 28 000t Zink, 4200t Chrom, 4000t Kupfer, 1450t Nickel, 530t Kadmium, 1,5 Millionen Tonnen Stickstoffe und ca. 100000t Phosphate eingeleitet. Dieser Giftmüll ist besonders gefährlich in den Meeren, die flächenmäßig groß (aber nicht sehr tief) sind, wie bei der Nordsee, der Ostsee, der südlichen Adria, dem Schwarzen Meer. Weil in diesen Meeren nicht soviel Tiefenwasser vorhanden ist, und die Vermischung zwischen Süßwasser aus den Flüssen und dichterem Salzwasser schwierig ist, können die Giftstoffe sich nicht zersetzen.
Synthetische Produkte wie das berühmt berüchtigte Pflanzenschutzmittel DDT, das seit 30 Jahren in den Industriestaaten verboten ist, oder auch PCB (chlorierte Biphenyle), welche zuvor in der elektrischen Industrie verwendet, aber mittlerweile ebenso wegen bekannt gewordener Gefahren verboten wurden, besitzen alle eine unbeschreibliche chemische Haltbarkeit. Sie sind in unveränderten Zustand überall vorhanden, im Wasser, in den Böden, in den Zellen der Lebewesen. Aufgrund der Bioakkumulation sind diese Stoffe in gefährlichen Konzentrationen in einigen Lebewesen zu finden, was zu deren Tod oder Störungen bei der Reproduktion führt und einen Rückgang der jeweiligen Populationen bewirkt. So richtet der Müllhandel, bei dem oft Giftmüll noch irgendwo ohne irgendwelche Schutzmaßnahmen zwischengelagert wird, unkalkulierbare Schäden im Ökosystem und für die ganze Bevölkerung an.
Bevor wir diesen Punkt hier abschließen – obwohl noch Hunderte von Beispielen aus der ganzen Welt geliefert werden könnten -, wollen wir noch daran erinnern, dass gerade diese Bodenverseuchung für ein neues und dramatisches Phänomen verantwortlich ist: die Entstehung von „Todeszonen“ – wie zum Beispiel das Dreieck Priolo, Mellili und Augusta in Sizilien – wo der Prozentsatz von Neugeborenen mit Fehlbildungen viermal höher ist als der nationale Durchschnitt, oder auch das andere Todesdreieck in der Nähe von Neapel zwischen Giuliano, Qualiano und Villaricca, wo die Zahl der Tumorerkrankungen weit über dem nationalen Durchschnitt liegt.
Die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen und/oder die Bedrohung durch die Umweltverschmutzung
Das letzte Beispiel des globalen Phänomens, das die Welt in eine Katastrophe führt, ist das der Verknappung und Erschöpfung der natürlichen Ressourcen oder deren Bedrohung durch Umweltverschmutzung. Bevor wir näher auf dieses Phänomen eingehen, wollen wir unterstreichen, dass die Menschengattung schon früher in einem geringeren Maße auf solche Probleme gestoßen ist, die schon damals katastrophale Konsequenzen hatten. Damals waren nur kleinere, beschränkte Teile der Erde davon betroffen. Wir wollen aus dem Buch von Jared Diamond, „Kollaps“, das sich mit der Geschichte Rapa Nui’s auf der Osterinsel befasst, zitieren, die wegen ihrer großen Steinstatuen bekannt ist. Man weiß, dass die Insel von dem holländischen Forscher Jacob Roggeveen Ostern 1772 entdeckt wurde (daher ihr Name), und es ist mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass die Insel „von einem dichten subtropischen Wald bedeckt war, der viele große Bäume aufwies“. Auch gab es dort viele Vögel und wilde Tiere. Aber bei Ankunft der Kolonisatoren hatte die Insel einen anderen Eindruck hinterlassen:
"so war es auch für Rogeveen ein Rätsel, wie die Inselbewohner ihre Statuen aufgerichtet hatten. Um noch einmal aus seinem Tagebuch zu zitieren: „Die steinernen Bildsäulen sorgten zuerst dafür, dass wir starr vor Erstaunen waren, denn wir konnten nicht verstehen, wie es möglich war, dass diese Menschen, die weder über dicke Holzbalken zur Herstellung irgendwelcher Maschinen noch über kräftige Seile verfügten, dennoch solche Bildsäulen aufrichten konnten, welche volle neun Meter hoch und in ihren Abmessungen sehr dick waren (...) Ursprünglich, aus größerer Entfernung, hatten wir besagte Osterinsel für sandig gehalten, und zwar aus dem Grund, dass wir das verwelkte Gras, Heu und andere versengte und verbrannte Vegetation als Sand angesehen hatten, weil ihr verwüstetes Aussehen uns keinen anderen Eindruck vermitteln konnte als den einer einzigartigen Armut und Öde. „Was war aus den vielen Bäumen geworden, die früher dort gestanden haben müssen?“ Um die Bearbeitung, den Transport und die Errichtung der Statuen zu organisieren, bedurfte es einer komplexen, vielköpfigen Gesellschaft, die von ihrer Umwelt leben konnte“. (Diamond, S. 105)
„Insgesamt ergibt sich für die Osterinsel ein Bild, das im gesamten Pazifikraum einen Extremfall der Waldzerstörung darstellt und in dieser Hinsicht auch in der ganzen Welt kaum seinesgleichen hat. Der Wald verschwand vollständig, und seine Baumarten starben ausnahmslos aus.“ (Diamond, S. 138)
"Dies alles lässt darauf schließen, dass die Abholzung der Wälder kurz nach dem Eintreffen der ersten Menschen begann, um 1400 ihren Höhepunkt erreichte und je nach Ort zwischen dem frühen 15. und dem 17. Jahrhundert praktisch abgeschlossen war. Für die Inselbewohner ergab sich daraus die unmittelbare Folge, dass Rohstoffe und wild wachsende Nahrungsmittel fehlten, und auch die Erträge der Nutzpflanzen gingen zurück (…) Da es auch keine seetüchtigen Kanus mehr gab, verschwanden die Knochen der Delphine, die in den ersten Jahrhunderten die wichtigsten Fleischlieferanten der Inselbewohner gewesen waren, um 1500 praktisch völlig aus den Abfallhaufen; und das Gleiche galt für Thunfische und andere Fischarten aus dem offenen Meer. (…) Weiter geschädigt wurde der Boden durch Austrocknung und Auswaschung von Nährstoffen, auch sie eine Folge der Waldzerstörung, die zu einem Rückgang des Pflanzenertrages führte. Darüber hinaus standen die Blätter, Früchte und Zweige wilder Pflanzen, die den Bauern zuvor als Kompost gedient hatten, nicht mehr zur Verfügung. (...) Im weitern Verlauf kam es dann zu einer Hungersnot, einem Zzusammenbruch der Bevölkerung und einem Niedergang bis hin zum Kannibalismus. (…) In der mündlichen Überlieferung der Inselbewohner nimmt der Kannibalismus breiten Raum ein; die schrecklichste Beschimpfung, die man einem Feind entgegenschleudern konnte, lautete: "Das Fleisch deiner Mutter hängt zwischen meinen Zähnen." (S. 138)
"Wegen ihrer isolierten Lage ist die Osterinsel das eindeutigste Beispiel für eine Gesellschaft, die sich durch übermäßige Ausbeutung ihrer eigenen Ressourcen selbst zerstört hat (...) Die Parallelen zwischen der Osterinsel und der ganzen heutigen Welt liegen beängstigend klar auf der Hand. Durch Globalisierung, internationalen Handel, Flugverkehr und Internet teilen sich heute alle Staaten der Erde die Ressourcen, und alle beeinflussen einander genau wie die zwölf Sippen auf der Osterinsel. Die Osterinsel war im Pazifik ebenso isoliert wie die Erde im Weltraum. Wenn ihre Bewohner in Schwierigkeiten gerieten, konnten sie nirgendwohin flüchten, und sie konnten niemanden um Hilfe bitten; ebenso können wir modernen Erdbewohner nirgendwo Unterschlupf finden, wenn unsere Probleme zunehmen. Aus diesen Gründen erkennen viele Menschen im Zusammenbruch der Osterinsel eine Metapher, ein schlimmstmögliches Szenario für das, was uns selbst in Zukunft vielleicht noch bevorsteht“ (S. 152). (15)
Diese Beobachtungen, die alle aus dem Buch von Diamond stammen, warnen uns davor zu glauben, dass das Ökosystem der Erde über keine Grenzen verfüge, und sie zeigen, dass das, was auf den Osterinseln passierte, auch die Menschheit insgesamt treffen kann, falls diese nicht entsprechend behutsam mit den Ressourcen des Planeten umgeht.
Man könnte natürlich sofort eine Parallele ziehen zum Abholzen der Wälder, das seit dem Beginn der Urgemeinschaften bis heute vor sich geht, und heute weiter systematisch betrieben wird, womit die letzten grünen Lungen der Erde wie der Regenwald des Amazonas zerstört werden.
Wie schon bei der Verseuchung durch Blei erwähnt, kennt die herrschende Klasse sehr wohl die bekannten Risiken, wie die edle Intervention eines Wissenschaftlers des 19. Jahrhundert, Rudolf Julius Emmanuel Clausius, belegt, der sich zur Frage der Energie und der Ressourcen schon ein Jahrhundert vor all den Reden zum Naturschutz sehr deutlich äußerte „In der Wirtschaft einer Nation ist ein Gesetz immer gültig: Man darf während eines gewissen Zeitraums nicht mehr konsumieren als das, was in diesem Zeitraum produziert wurde. Deshalb dürfen wir nur soviel Brennstoffe verbrauchen wie es möglich ist, diese dank des Wachstums der Bäume wiederherzustellen“ (16).
Aber wenn man die heutigen Verhältnisse betrachtet, muss man schlussfolgern, dass genau das Gegenteil passiert, was Clausius empfohlen hatte, und man schlägt direkt den gleichen fatalen Weg wie den der Osterinsel ein.
Um dem Problem der Ressourcen adäquat entgegenzutreten, muss man auch eine andere grundlegende Variable berücksichtigen: die Schwankungen der Weltbevölkerung.
„Bis 1600 war das Wachstum der Weltbevölkerung noch sehr langsam; sie nahm lediglich zwischen 2 - 3% pro Jahrhundert zu. 16 Jahrhunderte vergingen, bevor die Einwohnerzahl von ca. 250 Millionen Menschen zur Zeit des Beginns des Zeitalters von Jesus Christus die Zahl von 500 Millionen Menschen erreicht wurde. Von diesem Zeitpunkt an und danach nahm die Zeit zur Verdoppelung der Bevölkerung ständig ab, so dass in einigen Ländern der Welt heute die so genannte „biologische Grenze“ des Bevölkerungswachstums erreicht wird (3 - 4%). UNO-Schätzungen zufolge werden ca. 8 Milliarden Menschen um das Jahr 2025 leben. […] Es gibt große Unterschiede zwischen den entwickelten Ländern, die nahezu ein Nullwachstum erreicht haben, und den Entwicklungsländern, die bis zu 90% zum gegenwärtigen demographischen Wachstum beitragen. […] Im Jahre 2025 wird zum Beispiel Nigeria UN-Schätzungen zufolge eine größere Bevölkerungszahl als die USA haben und in Afrika werden dreimal so viel Menschen leben wie in Europa. Überbevölkerung, verbunden mit Rückständigkeit, Analphabetentum und ein Mangel an Hygiene und Gesundheitseinrichtungen stellen sicher ein großes Problem dar, das nicht nur Afrika bedroht, sondern die ganze Welt beeinflussen wird. Insofern scheint es ein großes Ungleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot an verfügbaren Ressourcen zu geben, das auch auf die Verwendung von ca. 80% der Energieressourcen der Welt durch die Industriestaaten zurückzuführen ist.
Die Überbevölkerung bringt einen starken Rückgang der Qualität der Lebensbedingungen mit sich, weil sie die Produktivität eines Arbeiters sinken und auch die Verfügbarkeit von Lebensmitteln, Trinkwasser, Gesundheitsleistungen und Medikamenten pro Kopf fallen lässt. Der starke, von Menschen gegenwärtig verursachte Druck führt zu einer Schädigung der Umwelt, die sich unvermeidbar auf die Gleichgewichte des Systems Erde auswirken wird.
Die Ungleichgewichte haben sich in den letzten Jahren verstärkt: die Bevölkerung wächst nicht nur in einem Maße, das keineswegs homogen ist, sondern sie nimmt vor allem in den städtischen Ballungsräumen sehr stark zu“ (17).
Das starke Bevölkerungswachstum verschärft das Problem der Erschöpfung der Ressourcen also nur noch mehr, zudem der Mangel an natürlichen Ressourcen vor allem da anzutreffen ist, wo die Bevölkerungsexplosion am stärksten ist, was für die Zukunft nur noch größere Probleme erahnen lässt, wovon immer mehr Menschen betroffen sein werden.
Untersuchen wir die erste Quelle der Natur, Wasser, ein auf der ganzen Welt notwendiges Gut, das heute durch das unverantwortliche Vorgehen des Kapitalismus stark bedroht ist.
Wasser ist ein Gut, das auf der Erdoberfläche in großen Mengen vorhanden ist (um nur von den Ozeanen, dem Grundwasser und den Polkappen zu sprechen), aber nur ein kleiner Teil davon ist als Trinkwasser nutzbar, d.h. der Teil, der in den Polkappen und in den wenigen noch nicht vergifteten Flüssen zur Verfügung steht. Die Entwicklung der industriellen Aktivitäten, die die Bedürfnisse der Umwelt völlig außer Acht lassen, und die völlig willkürliche Ablagerung und Entsorgung des städtischen Mülls haben einen Großteil des Grundwassers verseucht, das die natürliche Trinkwasserreserve des Gemeinwesens ist. Dies hat mit zur Verbreitung von Krebs und anderen Krankheiten der Bevölkerung beigetragen; andererseits ist das Wasser zu einem knappen und kostbaren Gut in vielen Ländern geworden.
„Mitte des 21. Jahrhunderts werden den pessimistischen Prognosen zufolge ca. 7 Milliarden Menschen in 60 Ländern nicht mehr über ausreichend Wasser verfügen. Im besten Fall aber würden „nur“ zwei Milliarden Menschen in 48 Ländern an Wassermangel leiden. (…) Aber die besorgniserregendsten Angaben in dem Dokument der UNO sind wahrscheinlich die aufgrund der Wasserschmutzung und der schlechten Hygienebedingungen zu erwartenden Toten: 2.2 Millionen pro Jahr. Darüber hinaus ist Wasser Träger zahlreicher Krankheiten, unter ihnen Malaria, durch welche jedes Jahr ca. eine Million Menschen sterben“ (18). (Das blaue Gold des dritten Jahrtausends)
Die englische Wissenschaftszeitung New Scientist schrieb in ihrer Schlussfolgerung anlässlich des Wassersymposiums im Sommer 2004 in Stockholm: „In der Vergangenheit wurden mehrere Millionen Brunnen errichtet, meistens ohne irgendwelche Kontrolle, und die Wassermengen, die durch gigantische elektrische Wasserpumpen gefördert werden, übersteigen bei weitem den Umfang der Regenwassermassen, die das Grundwasser wieder mit neuem Wasser versorgen. […] Wasser dem Erdreich zu entnehmen, ermöglicht vielen Ländern reichhaltige Reis- und Zuckerrohrernten (diese Pflanzen benötigen viel Wasser), aber der Boom wird nicht lange dauern. […] Indien ist ein Zentrum der Revolution des Bohrens nach unterirdischem Wasser. Indem beim Bohrvorgang Technologie Ölbohrungen benutzt wird, haben die kleinen Bauern 21 Millionen kleine Brunnen auf ihren Feldern errichtet, und jedes Jahr kommen noch mal eine Million Brunnen hinzu. […] In den nördlichen Ebenen Chinas, wo die meisten landwirtschaftlichen Produkte geerntet werden, entnehmen die Bauern der Erde jedes Jahr 30 Kubikkilometer Wasser mehr als durch den Regen zugeführt wird […]. In Vietnam wurde in den letzten Jahren die Zahl der Brunnen vervierfacht. […] In Punjab, wo 90% der Lebensmittel Pakistans herstammen, fangen die Grundwasserreserven langsam an auszutrocknen“ (19).
Während die Lage allgemein schlimm ist, sogar sehr schlimm, ist die Lage in den Schwellenländern Indien und China geradezu katastrophal und sie läuft Gefahr, in ein Desaster auszuarten.
„Die Dürre in der Provinz Sechuan und in Chongqing hat ca. 9,9 Milliarden Yuan Schäden verursacht. Einschränkungen beim Wasserverbrauch für mehr als 10 Millionen Menschen wurden veranlasst, während im ganzen Land ca. 18 Millionen Menschen an Wasserknappheit leiden“ (20).
„China wurde von den schlimmsten Überschwemmungen in den letzten Jahren heimgesucht, mit mehr als 60 Millionen betroffenen Menschen in Zentral- und Südchina, mindestens 360 Toten und großen ökonomischen Schäden, die schon 7,4 Milliarden Yuan übersteigen. 200000 Häuser sind zerstört oder beschädigt, 528000 Hektar landwirtschaftlich bebaute Fläche sind zerstört und 1,8 Million überflutet. Gleichzeitig schreitet die Verwüstung schnell voran. Bislang wurde ein Fünftel des Territoriums in Mitleidenschaft gezogen. Dies hat Sandstürme hervorgerufen, von denen manche gar bis Japan ziehen. […] Während Zentral- und Südchina unter Überschwemmungen leiden, dehnt sich die Wüste im Norden weiter aus. Mittlerweile ist davon mehr als ein Fünftel des Geländes entlang des Gelben Flusses, der Hochebene Qinghai-Tibets und eines Teils der Inneren Mongolei und Gansus betroffen. Die Bevölkerung Chinas umfasst ca. 20% der Weltbevölkerung, aber sie verfügt nur über 7% der verfügbaren landwirtschaftlichen Anbaufläche.
Wang Tao, dem Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Lanzhu, zufolge hat die Verwüstung in China während des letzten Jahrzehnts jedes Jahr um 950 Quadratkilometer zugenommen. Jedes Jahr im Frühjahr wird Beijing und ganz Nordchina von Sandstürmen heimgesucht, mit Auswirkungen bis nach Südkorea und in Japan“ (21).
All das muss uns zum Nachdenken über die so viel gepriesene starke Leistungskraft des chinesischen Kapitalismus zwingen. Die jüngste Entwicklung der chinesischen Wirtschaft kann dem niedergehenden Weltkapitalismus kein neues Leben einhauchen; stattdessen zeigt sie den ganzen Schrecken der Agonie dieses Systems auf: Städte im Smog (auch die jüngst stattgefundenen Olympischen Sommerspiele können nicht darüber hinwegtäuschen), austrocknende Flüsse und jedes Jahr Zehntausende Arbeiter, die bei Arbeitsunfällen in den Bergwerken oder in den Betrieben aufgrund der furchtbaren Arbeitsbedingungen und der mangelnden Sicherheitsbestimmungen sterben.
Viele andere Ressourcen werden natürlich immer knapper. Aus Platzgründen können wir hier am Ende dieses Artikels nur kurz auf zwei eingehen.
Die erste ist natürlich Öl. Es ist bekannt, dass man seit dem Ende der 1970er Jahre von der Erschöpfung der natürlichen Ölquellen spricht, aber in diesem Jahr, 2008, scheint man tatsächlich einen Höhepunkt der Förderung (er wird Hubbert Gipfel genannt) erreicht zu haben, d.h. der Moment, wo wir verschiedenen geologischen Hochrechnungen zufolge schon die Hälfte der natürlichen Ressourcen benutzt und erschöpft hätten. Öl stellt heute ca. 40% der Basisenergie dar und ungefähr 90% der im Verkehr eingesetzten Energie. Auch in der chemischen Industrie ist er ein wichtiger Grundstoff, insbesondere bei der Herstellung von Düngemitteln in der Landwirtschaft, Plastik, Klebstoffen und Lacken, Schmier- und Reinigungsmitteln. All das ist möglich, weil das Öl bislang ein relativ billiger Stoff und scheinbar grenzenlos verfügbar war. Weil diese Perspektiven sich nun geändert haben, trägt dies jetzt schon zu den Preiserhöhungen mit bei. Die kapitalistische Welt hört jetzt ebenso wenig auf die Empfehlung Clausius, innerhalb einer Generation nicht mehr zu verbrauchen als die Natur in dieser Zeit liefern kann. Stattdessen hat sich die kapitalistische Welt in eine verrückte Jagd des Energiekonsums gestürzt. Dabei sind China und Indien an führende Stellen getreten. Sie verbrennen alles, was man verbrennen kann. Man greift sogar auf giftige fossile Kohlenstoffe zur Energiegewinnung zurück und hat damit bislang nie da gewesene Umweltprobleme geschaffen.
Natürlich hat die „wunderbare“ Zuflucht in die sog. Biokraftstoffe sich als Flop, weil völlig unzureichend, erwiesen. Die Herstellung von Brennstoff auf der Grundlage der alkoholischen Gärung von Maisstärke oder von Pflanzenölen reicht keineswegs aus, um die gegenwärtigen Bedürfnisse des Marktes an Brennstoffen zu befriedigen. Im Gegenteil, dadurch werden die Preise für Nahrungsmittel nur noch mehr in die Höhe getrieben, wodurch der Hunger unter den ärmsten Bevölkerungsteilen nur noch zunimmt. Erneut werden dadurch kapitalistische Unternehmen wie die Nahrungsmittelhersteller begünstigt, die zu Verkäufern von Biokraftstoffen geworden sind. Aber für die einfachen Sterblichen bedeutet dies, dass große Waldgebiete abgeholzt werden, um dort Plantagen zu errichten (Millionen Hektar Wald sind geopfert worden). Die Herstellung von Biodiesel verlangt in der Tat den Einsatz von großen Flächen. Um sich eine konkretere Vorstellung davon zu machen: wenn man auf einem Hektar Raps oder Sonnenblumen anbaut oder andere Pflanzenöl erzeugende Pflanzen, kann man ungefähr 1000 Liter Biodiesel gewinnen, wodurch ein PKW ca. 10000km zurücklegen kann. Wenn man von der Hypothese ausgeht, dass Pkws durchschnittlich im Jahr ca. 10000km zurücklegen, wird jedes Fahrzeug den auf einem Hektar Anbaufläche erzeugten Biodiesel verbrauchen. Für ein Land wie Italien, wo ca. 34 Millionen PKWs angemeldet sind, würde dies bedeuten, dass man eine Anbaufläche von ca. 34 Millionen Hektar benötigen würde. Wenn man den PKWs noch die ca. 4 Millionen LKWs hinzufügt, deren Verbrauch noch höher liegt, würde sich der Verbrauch verdoppeln, und es würde eine Anbaufläche von mindestens 70 Millionen Hektar erforderlich machen. Dies entspricht dem Doppelten der Fläche Italiens, Berge, Städte usw. eingeschlossen.
Obgleich man nicht auf die gleiche Weise davon redet, stellt sich ein ähnliches Problem wie bei den fossilen Brennstoffen natürlich bei anderen Ressourcen mineralischer Art wie beispielsweise bei den Mineralien, aus denen Metall gewonnen wird. Es stimmt, dass in diesem Fall Metall nicht durch seine Verwendung zerstört wird wie im Fall des Öls oder des Methangases, aber die Nachlässigkeit der kapitalistischen Produktion läuft darauf hinaus, dass auf den Böden und auf den Müllhalden große Mengen Metalls gelagert werden, so dass die Versorgung mit Metall früher oder später auch nicht mehr ausreichen wird. Die Verwendung unter anderem bestimmter vielschichtiger Legierungen lässt den eventuellen Versuch der Rückgewinnung eines „reinen“ Materials als schwierig erscheinen.
Das Ausmaß des Problems wurde anhand von Schätzungen deutlich, denen zufolge innerhalb weniger Jahrzehnte die folgenden Ressourcen erschöpft sein werden: Uran, Platin, Gold, Silber, Kobalt, Blei, Mangan, Quecksilber, Molybdän, Nickel, Zinn, Wolfram und Zink. Dies sind natürlich für die moderne Industrie praktisch unabdingbare Stoffe, und ihr Mangel bzw. Erschöpfung wird eine sehr schwere Last in der Zukunft darstellen. Aber auch andere Stoffe sind nicht unerschöpflich. Man hat errechnet, dass noch ca. 30 Milliarden Tonnen Eisen, 220 Millionen Tonnen Kupfer, 85 Millionen Tonnen Zink zur Verfügung stehen werden (in dem Sinne, dass es noch wirtschaftlich möglich sein wird, sie zu fördern). Um sich auszumalen, um welche Mengen es sich handelt, muss man wissen, um die ärmsten Länder auf das Niveau der reichsten Länder zu bringen, bräuchte man 30 Milliarden Tonnen Eisen, 500 Millionen Tonnen Kupfer, 300 Millionen Tonnen Zink, d.h. viel mehr als der ganze Planet Erde anzubieten hat.
In Anbetracht dieser angekündigten Katastrophe muss man sich fragen, ob der Fortschritt und die Entwicklung notwendigerweise mit Umweltverschmutzung und der Zerstörung des Ökosystems verbunden sein müssen. Man muss sich fragen, ob solche Desaster auf unzureichende Bildung der Menschen oder auf etwas Anderes zurückzuführen sind. Das werden wir in dem nächsten Artikel untersuchen.
1 Manifest [59] des 9. Kongresses der IKS, im Juli 1991 verabschiedet.
2 G. Barone et al., Il metano e il futuro del clima, in Biologi Italiani, n° 8 de 2005. (“Methan und die Zukunft des Klimas”)
3 idem
4 G. Pellegri, Terzo mondo, nueva pattumiera creata dal buonismo tecnologico, siehe http:/www.caritas-ticino.ch/rivista/elenco%20rivista/riv_0203/08%20-%20Terzo%m... [60]
5 Vivere di rifiuti, (Von Abfällen leben) http:/www.scuolevi-net:scuolevi/valdagno [61] /marzotto/mediateca.nsf/9bc8ecfl790d17ffc1256f6f0065149d/7f0bceed3ddef3b4c12574620055b62d/Body/M2/Vivere%20di%rifiuti.pdf ?OpenElement
6 Roberto Saviano, Gomorra, Viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della camorra, (Reise in das Reich der Wirtschaft und in die Träume der Herrschaft der Camorra), Arnoldo Montaldi, 2006.
7 La Republica on-line, 29/10/2007
8 La Republica, 6/02/2008. allein in den USA werden mehr als 100 Milliarden Plastiktüten verwendet. 1.9 Milliarden Tonnen Öl sind für deren Herstellung erforderlich, wobei die meisten von ihnen auf dem Müll landen und Jahrzehnte bis zu ihrer Zersetzung brauchen. Für die Herstellung mehrerer Dutzend Milliarden Plastiktüten müssen allein 15 Millionen Bäume gefällt werden.
9 Siehe den Artikel “Das Mittelmeer, ein Plastikmeer” in La Republica du 19 Juli 2007.
10 Man kann natürlich nicht ausschließen, dass der schwindelerregende Preisanstieg des Öls zwischen 2007-2008 die Verwendung dieses Rohstoffs für die Produktion Kunststoffen infragestellt, wodurch es in absehbarer Zukunft zu einer Kehrtwende unter wachsamen Unternehmern kommen könnte, die aber nur auf die Verteidigung ihrer Interessen achten.
11 R. Troisi : la discarica del mondo luogo di miseria e di speranza nel ventunesimo secolo. (Die Müllentsorgung der Erde – Misere und Hoffnung des 21. Jahrhunderts) - villadelchancho.splinder.com/tag/discariche+del+mondo
12 Siehe den Artikel: „Einige Kollateralschäden der Industrie – Chemie, und Atomkraft” Alcuni effetti collaterali dell'industria, La chimica, la diga e il nucleare.
13 Jared Diamond, Collasso, edizione Einaudi – Kollaps
14 Aus den “Historischen Archiven der Neuen Linken” "Marco Pezzi", Nochmals zu Öl und Kapitalismus. diligander.libero.it/alterantiveinfo/petrolio_criticaeconflitto_giugno2006.pdf
15 Jared Diamond, Colasso, edizione Einaudi
16 R. J. E Clausius (1885), geboren 1822 in Koslin (damals Preußen, heute Polen) und 1888 gestorben in Bonn.
17 Vereinigung Geographielehrer Italiens – “Das Bevölkerungswachstum”, La crescita della popolazione.
www.aiig.it/Un%20quaderno%20per%l [62]'ambiente/offline/crescita-pop.htm
18 G. Carchella, Acqua : l'oro blu del terzo millenario, su "Lettera 22, associazione indipendente di giornalisti". www.lettera22.it/showart.php?id=296&rubrica=9 [63] Wasser – Das blaue Gold des 21. Jahrhunderts in Brief 22, Unabhängige Vereinigung der Journalisten
19 Newscientist, "Asian Farmers sucking the continent dry [64]" Asiatische Bauern trocknen den Kontinent aus, 28. August 2004
20 PB, Asianews, China: Noch 10 Millionen Menschen dursten nach Trockenheit "Cina: oltre 10 milioni di persone assetate dalla siccità [65]"
21, Asianews. "La Cina stretta tra le inondazioni e il deserto che avanza [66]" China – eingeklemmt zwischen Überschwemmungen und dem Vormarsch der Wüsten, 18/08/2006
Aktuelles und Laufendes:
- Umweltkatastrophe [67]
- Ökokatastrophe [68]
- Umweltverschmutzung [69]
Theoretische Fragen:
- Umwelt [16]
Dezember 2008
- 782 reads
Bewegung an den Universtäten in Italien: Wir zahlen nicht für die Krise
- 3463 reads
Wie vor genau 40 Jahren, seit die Bewegung des französischen Mai 68 nach Italien und in die ganze Welt getragen wurde, sind die Schüler und die Angestellten der Universitäten wieder auf den Strassen Italiens, um sich dem sogenannten Dekret Gelmini (Gelmini ist die Ministerin für Bildung, Hochschule und Erziehung) entgegenzustellen.
Wir zahlen nicht für die Krise[1]
„Wir zahlen nicht für die Krise.“ (1) Wie vor genau 40 Jahren, als die Bewegung des französischen Mai 68 nach Italien und in die ganze Welt getragen wurde, sind die SchülerInnen und die Angestellten der Universitäten wieder auf den Straßen Italiens, um sich dem so genannten Gelmini-Dekret (Gelmini ist die Ministerin für Bildung, Hochschulen und Erziehung) entgegenzustellen. Die Gründe sind bekannt, wir beschränken uns darauf, sie kurz zu wiederholen.
Auf der Ebene der Schule beinhaltet das Gelmini-Dekret - abgesehen vom Zwang, Schuluniformen zu tragen, was in der endgültigen Version des Dekrets nicht mehr erwähnt wurde, oder z. B. die Wiedereinführung der Kopfnote - vor allem Kürzungen, die den Bildungsbereich und die Qualität der Dienstleistung für die SchülerInnen und StudentInnen betreffen.
Die Einsparungen auf Kosten der SchülerInnen durchzusetzen beinhaltet:
- eine Einschränkung der Schulzeit in der Primärschule und im Kindergarten;
- eine drastische Einschränkung des Personals (DozentInnen, Verwaltung und technisches Personal), indem man den Zugang blockiert, restrukturiert und Arbeitszeiten reduziert: 87.000 DozentInnenen werden in eine prekäre Situation geraten (Zeitarbeitsverträge), und 45.000 Aushilfskräfte (Sekretärinnen und Hausmeister) werden nicht mehr zur Arbeit gerufen;
- Zunahme der SchülerInnen in den Klassen;
- Wegfall des technischen Unterrichts und der zweiten Fremdsprache in der Oberstufe;
- Reduzierung der Schulzeit in den technischen Schulen und Berufsschulen.
Auf der Ebene der Universitäten gibt es, jenseits der Märchen, die uns die Regierung erzählt:
- eine Kürzung der Budgets von über 500 Mio. Euro in den nächsten drei Jahren;
- eine Reduzierung des Personals der Universitäten in den Jahren 2010 und 2011, so dass auf fünf Pensionierungen nur eine Neuanstellung kommt;
- Vorbereitung für die Umwandlung der öffentlichen Universitäten in privatrechtliche Stiftungen.
Dies sind die wesentlichen Elemente des Regierungsmanövers. Wie man sieht, reicht dies, um die öffentliche Bildung in Italien verwahrlosen zu lassen, weil es sich nicht um Gesetze handelt, welche die öffentliche Bildung in Italien reorganisieren. Es geht vielmehr darum, die öffentliche Bildung teilweise stillzulegen sowie die Ressourcen und das Personal auf Null zu setzen. Genau das hat das betroffene Personal, das in diesen Bereichen arbeitet, zum Widerstand angestachelt, ganz besonders die Jungen und die ZeitarbeiterInnen, was personell fast identisch ist. Die Betroffenen im Studentenbereich sehen in der Gelmini-Reform, in den finanziellen Manövern der Berlusconi-Regierung berechtigterweise einen Angriff auf ihre eigene Zukunft. Bei einer weiteren Deklassierung der Bildung in Italien und der Umgestaltung von Universitäten in Stiftungsuniversitäten (ungeachtet der Diskussionen, ob nun das Private oder das Öffentliche besser ist) werden in Zukunft nur noch jene eine Chance haben, die sich den Zugang zu guter Bildung erkaufen können. „Es stellt ein eindeutiges Signal für das abnehmende Interesses des Staates an der Förderung des öffentlichen Bildungssystems dar, das für jeden den Zugang zu den höchsten Ebenen der Bildung garantiert.“ (2)
Dieses Gefühl der Zukunftslosigkeit erfasst die Bewegung der StudentInnen und ZeitarbeiterInnen umso mehr, weil dies vor dem Hintergrund einer noch nie dagewesenen Wirtschaftskrise geschieht, die außergewöhnlich besorgniserregend ist.
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass diese Bewegung nur schwach studentisch geprägt ist. Ihre größte Kraft gewinnt sie daraus, dass der Angriff der Berlusconi-Regierung ausgerechnet inmitten der Wirtschaftskrise stattfindet, die Italien und die ganze Welt betrifft. In diesem Sinn erinnert die Bewegung in Italien stark an die Bewegung der französischen StudentInnen 2006, die sich gegen das „CPE“-Gesetz (Vertrag zur Ersteinstellung) gewandt hatten. Ein Gesetz, das, wenn es angenommen worden wäre, die Arbeitsbedingungen der jungen ArbeiterInnen massiv verschlechtert hätte. Beide Bewegungen gingen bzw. gehen von den materiellen Bedingungen aus, welche die beruflichen und Lebensperspektiven der neuen Arbeitergenerationen betreffen, und stellen sich somit auf proletarisches Terrain. Es ist kein Zufall, dass die Parole der Studenten und ZeitarbeiterInnen heißt: „Wir zahlen nicht für die Krise!“
Dies drückt sich darin aus, dass dem Gerede darüber, „dem Land in Schwierigkeiten zur Hand zu gehen“ oder „in diesen schwierigen Zeiten Opfer auf sich zu nehmen“, kein Glauben geschenkt wird.
Die schwache studentische Ausprägung der Bewegung wird auch in dem Willen ersichtlich, sich für eine gemeinsame Zukunft in allen Lebensbereichen einzusetzen. Man sieht dies auch an anderen Faktoren, z.B. daran, dass es im Gegensatz besonders zu den 68er Bewegungen keinen Gegensatz zwischen den Generationen und auch keine Konfrontation zwischen StudentInnen und DozentInnen gibt. Es gibt hingegen eine Tendenz, zusammen zu kämpfen. Außerdem ist die Bewegung wenig ideologisch, was sich darin ausdrückt, dass sie sich weder als links noch als rechts charakterisiert und auch nicht von linken oder rechten Parteien benutzt werden kann. Jedoch hat die Bewegung ein klares Bewusstsein darüber, dass ihr Kampf den Sieg davontragen muss.
Die Fallen, die der Bewegung gestellt werden
Trotz allem hat die Bewegung, die sich auf den Straßen Italiens zeigt, auch eine Reihe von Schwächen, die die herrschende Klasse bewusst ausnutzt, um die Bewegung zum Scheitern zu bringen. Eine dieser Schwächen ist das Fehlen von klaren Zielen. Anders als in Frankreich, wo die Reife der StudentInnen durch einen frontalen Angriff der Regierung gefördert wurde, hat der indirekte Charakter des Angriffs in Italien weniger für Klarheit gesorgt. Wie gesagt, ist es richtig, dass ein wichtiger Faktor, der die Bewegung antreibt, die Wirtschaftskrise ist, in der sich Italien und der Rest der Welt befinden. Aber was bedeutet diese Krise genau? Eine Finanzkrise, welche von skrupellosen Spekulanten hervorgerufen wurde? Eine Krise, die dem ungezügelten Konsum oder der Überbevölkerung weltweit zuzuschreiben ist? Eine Krise, die von der Invasion des Weltmarktes durch die Chinesen verursacht wurde? Oder ist es nicht doch eine unlösbare Krise des Systems, in dem wir leben?
Es ist klar, dass die eine oder andere dieser Erklärungen dazu verleiten kann, sich den Wechsel zu den Obamas oder Veltronis (dem Oppositionsführer der Linken in Italien) zu wünschen, zur Linken allgemein, die als der gutgesinnte Teil der Gesellschaft hingestellt wird, als jener, der fähig ist, gut und gerecht zu regieren. Andernfalls müsste man die ganze Gesellschaftsordnung in Frage stellen, die Ausbeutung, die sich seit Jahrhunderten, ganz unabhängig von dieser oder jenem Regime, ständig fortgesetzt hat.
In dieser Hinsicht wird in den Medien viel Aufhebens über die Eigenschaften der Gelmini gemacht. Sie sei „eine dem verhassten Berlusconi würdige Ministerin“; sie wird dafür verantwortlich gemacht, „die öffentliche Schule in die Hände von Privaten zu legen“. Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Maßnahmen der Berlusconi-Regierung drakonisch sind und dass Schulen sowie Universitäten stark davon betroffen sind. Aber man muss sich von der Logik befreien, dass dies die rechte Regierung nur gemacht habe, um sich eines politisch gefährlichen Sektors zu entledigen, wie dies aus einer Rede von Calamandrei aus dem Jahre 1950 hervorgeht, in der er ausführt, wie man eine öffentliche Schule in eine parteihörige Schule umwandelt. Diese Rede wird im Moment bewusst lanciert, wobei behauptet wird, dass eine linke Regierung diesen Sektor nie angerührt hätte. (3)
„Wie etabliert man in einem Land parteihörige Schulen? Man kann es auf zwei Arten tun. Einerseits mit einem offenen Totalitarismus. Na ja, wir haben diese Erfahrung schon mit dem Faschismus gemacht. Aber es gibt weitere Formen, Schulen in partei- oder sektenhörige Schulen umzuwandeln. Nehmen wir einmal an, ganz abstrakt, es gäbe eine Partei an der Macht, eine dominierende Partei, die das Grundgesetz respektieren will. Sie will es nicht brechen, sie will nicht auf Rom marschieren und die Aula in eine Schaltzentrale der Macht verwandeln, aber sie will, ohne dass es so aussehen soll, eine Diktatur in versteckter Form durchsetzen. Also, was soll man tun, um sich eine Schule anzueignen und die öffentlichen Schulen in parteihörige Schulen umzuwandeln? Man stellt fest, dass die Schulen den Makel haben, unparteiisch zu sein. Es gibt einen gewissen Widerstand, auch während des Faschismus gab es ihn. Also folgt die dominierende Partei einem anderen Weg (um es klar zu sagen, all dies ist nur eine theoretische Überlegung). Man fängt damit an, die öffentlichen Schulen zu vernachlässigen, sie zu diskreditieren, sie verarmen zu lassen. Man lässt zu, dass sich die öffentlichen Schulen auflösen, und beginnt damit, die privaten Schulen zu bevorzugen. Nicht alle privaten Schulen, sondern nur die Schulen, die dieser Partei hörig sind. Dann fließt alle Fürsorge nur in diese Schulen. Fürsorge in Form von Geld und Privilegien. Dann rät man den Jungen, in diese Schulen zu gehen, weil sie im Grunde genommen besser als die staatlichen Schulen seien. Da die dominierende Partei nicht in der Lage ist, die öffentliche Schule offen in eine parteihörige Schule zu verwandeln, lässt sie einfach die öffentlichen Schulen vor die Hunde gehen, um so dann den privaten Schulen den Vorzug zu geben.“ (4)
Abgesehen von der Illusion, dass es in der kapitalistischen Gesellschaft eine unabhängige Schule geben könnte, eine Kultur, die über den Parteien steht, verhält es sich in der Realität so, dass, wer auch immer an der Regierungsspitze steht, nicht anders kann, als zu versuchen, die kapitalistische Ökonomie aus der Krise zu retten. Was zu nichts anderen führen kann als zu immer aggressiveren Angriffen gegen die Bevölkerung. Es spielt keine große Rolle, wenn die Kultur eines Landes darunter leidet. Es ist richtig, dass die Regierung Berlusconis in ihrer Rohheit einen harten Sparplan durchgesetzt hat. Man sollte aber nicht denken, dass dies bloß ein politisches Manöver ist; es ist notwendig für den Staat, den Gürtel enger zu schnallen. (5)
Aber dies sind noch nicht alle Fallen! Gerade weil sich eine kämpferische Dynamik an den Universitäten und Schulen verbreitet hat, beginnt sich die herrschende Klasse Sorgen zu machen und setzt weitere Hebel in Bewegung, um sich zu verteidigen. Zuerst hat Berlusconi davon gesprochen, dass es nötig sei, die Besetzung der Schulen und Universitäten zu verhindern, indem er Innenminister Maroni entsprechende Instruktionen erteilt hat. Später hat er dies quasi dementiert, um nachher vom Ex-Ministerpräsidenten Cossiga korrigiert zu werden. Dieser hat als „Weiser“ der Bourgeoisie mit großer Unverfrorenheit eine Reihe von Ratschlägen für den „Ehrenmann“ Berlusconi herausgearbeitet, die wir hier wegen ihrer Brisanz wiedergeben wollen, um zu verstehen, was auf den Straßen und Plätzen Italiens geschieht, und möglicherweise auch vorauszusehen, welche Maßnahmen die herrschenden Klasse gegen die Bewegung ergreifen wird:
„Präsident Cossiga, denken Sie dass man mit der Androhung von staatlicher Gewalt gegen die Studenten übertrieben hat?“
„Das hängt davon ab, ob der Ratspräsident (Berlusconi) sich für einen Präsidenten eines starken Staates hält. Nun, dann hat er richtig gehandelt. Aber weil Italien einen schwachen Staat hat und in der Opposition nicht die eiserne PCI (partito comunista italiano, die ehemalige stalinistische Partei Italiens) steht, sondern die in der Auflösung begriffene PD (partito democratico di sinistra; eine der Nachfolgeparteien des PCI), befürchte ich, dass den Worten keine Taten folgen werden und Berlusconi somit dumm dastehen wird.“
„Welche Taten sollten folgen?“
„An diesem Punkt sollte Maroni (Innenminister) das tun, was ich tat, als ich Innenminister war.“
„Das heißt?“
„Sie machen lassen, die Polizei aus den Straßen und den Universitäten abziehen, gleichzeitig die Bewegung mit Agents Provocateurs (Spitzeln) infiltrieren, die zu allem bereit sind, und die Demonstranten etwa zehn Tage lang Läden zerstören lassen, Autos in Brand stecken lassen und zuschauen, wie die Stadt in Schutt und Asche gelegt wird.“
„Danach?“
„Danach werden, unter Beifall der Bevölkerung, die Sirenen der Krankenwagen jene der Polizei übertönen.“
„In welchem Sinn?“
„In dem Sinne, dass die Ordnungskräfte die Demonstranten massakrieren, ohne Gnade alle spitalreif schlagen sollen. Man soll sie nicht verhaften, die Richter würden sie sowieso gleich wieder auf freien Fuß setzen, aber sie blutig schlagen und mit ihnen auch die Dozenten, die sie anstifteten.“
„Auch die Dozenten?“
„Vor allem die Dozenten. Nicht die alten, sicher, aber besonders die jungen Lehrerinnen, die schon. Sind Sie sich bewusst, was da vor sich geht? Es gibt Lehrkräfte, die Kinder indoktrinieren und sie dazu bringen, auf der Straße zu demonstrieren. Das ist ein kriminelles Verhalten.“ (6)
Wenn man dieses Interview liest, kommt man nicht umhin, einen Zusammenhang mit den Geschehnissen am 29. Oktober auf der Piazza Navona (Rom) herzustellen. Eine Gruppe Neofaschisten provozierte einen Zusammenstoß mit den Studenten, die an der Demonstration teilnahmen. Tatsächlich setzt der Staat mit seinen Medien und materiellen Möglichkeiten (Presse, TV, Polizei etc.) bereits den Entwurf von Cossiga um.
Die Provokation geht nicht nur von den infiltrierten Provokateuren aus, die es sicherlich gibt, sondern auch vom Antifaschismus, der durch eine ganze Reihe von Provokationen wiederbelebt wird. Vor und nach der Episode auf der Piazza Navona gab es unzählige Provokationen durch neofaschistische Banden, die die Konfrontation gewaltsam austragen wollen und so das Ganze auf einen Diskurs für die Verteidigung der Demokratie, des Respekts für die Legalität und der Ordnung lenken, wie es Ex-Präsident Cossiga vorhersagte. Doch zum Glück widersteht die Bewegung diesen Fallen sehr gut; bei vielen Gelegenheiten wird deutlich, was auch durch zahlreiche kürzlich erschienene Videos und Blogs belegt wird: dass die Bewegung sich bewusst nicht auf einen falschen Zusammenstoß mit den Faschisten einlässt, sondern weiterhin auf den bisherigen Grundlagen ihres Kampfes besteht.
Die Perspektive der Bewegung
Eine Bewegung, die auch nach der endgültigen Verabschiedung des Gesetzes, dem Ausgangspunkt der Bewegung, durch den Senat aktiv bleibt, demonstriert einen Willen, der nicht oberflächlich ist, sondern aus einem tiefen Leid gespeist wird. Auch wenn wir im Augenblick nicht in der Lage sind zu sagen, wie die nächste Zukunft dieser Bewegung aussehen wird, denken wir, dass Bewegungen dieser Art eine wichtige Rolle in der Zukunft spielen. Die ökonomische wie auch die politische und soziale Situation ist auf einem Tiefpunkt.
Die Bewegung in Italien hat noch nicht die politische Reife erlangt, wie sie die Studentenbewegung in Frankreich hatte, als diese gegen die CPE demonstrierte. Dies, weil die Bewegung keine klare Instanzen hervorgebracht hat, wie z. B. Vollversammlungen, auf denen die Delegationen gewählt und jederzeit wieder abgewählt werden können.
Wenn auch kein klares Bewusstsein über die Notwendigkeit einer Verbindung zu anderen Gesellschaftsschichten während des Kampfes bestand, so hat die Bewegung trotzdem Folgendes ausgedrückt:
- eine klare Unabhängigkeit gegenüber Parteien und Gewerkschaften, ohne dabei der Entpolitisierung anheimzufallen;
- das ausdrückliche Anliegen, der Bevölkerung die Gründe ihres Kampfes mitzuteilen, nicht nur durch Demonstrationen und Transparente, sondern auch durch die „Straßenlektionen“, die von Dozenten vor einer großen Anzahl von Studenten abgehalten wurden, die sogenannten „weißen Nächte“ usw.
Die Auseinandersetzung ist noch nicht vorbei. Die Demonstrationen in ganz Italien am Tag der Verabschiedung des Gelmini-Gesetzes (29.10), der Streik von einer Million Schülern am 30. Oktober und die emsigen Aktivitäten, die sich im Umfeld von Schulen und Universitäten entwickelten, führten am 14. November zu einer nationalen Demonstration. Sie war ein lebendiger Ausdruck des Kampfes und der Aktivitäten, die die Bewegung dazu bringen könnte, wie ein einheitlicher Körper agieren und zu anderen gesellschaftlichen Bereichen, die sich im Kampf befinden, eine Brücke zu schlagen.
4.11.2008 Ezechiele
[1] Parole, die die ganze italienische Studentenbewegung erobert hat.
[2] Aus dem Antrag der wissenschaftlichen Fakultät der Universität Federico II in Neapel 29.10.2008.
[3] Eigentlich wurde der erste Teil der Kürzungen - die Abschaffung von Schulklassen, Dozenten und technischem Personal - von der Prodi-Regierung durchgesetzt.
[4] Aus einer Rede von Piero Calamandrei am 11. Februar 1950 zur Verteidigung einer nationalen Schule.
[5] Es gibt eine weitere politische Mystifizierung, die dazu tendiert, alles auf die Kürzungen in der Grundlagenforschung zu fokussieren. Dabei wird beklagt, dass unsere „klugen Köpfe“ dazu gezwungen werden, auszuwandern, wie es in der TV-Sendung von Michele Santoro dargestellt wurde; es lief darauf hinaus, dass die Angelegenheit einer ganzen Generation so hingestellt wird, als betreffe sie nur eine kleine Minderheit.
[6] Interview von Andrea Cangini mit Cossiga vom 23. Oktober 2008 mit dem Titel: „Man muss sie aufhalten, auch der Terrorismus fing in den Universitäten an.“ (aus der Zeitung Quotidiano nationale, man kann das ganze Interview lesen unter:
Geographisch:
- Italien [71]
Aktuelles und Laufendes:
- Studentenbewegung Italien [72]
- 2008 [73]
- Klassenkampf [74]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Proletarischer Kampf [75]
Das Wachstum in Asien: ein Ausdruck der Krise und der Dekadenz des Kapitalismus
- 22754 reads
Bislang hat sich der Kapitalismus als unfähig erwiesen, zwei Drittel der Menschheit an seiner Entwicklung teilnehmen zu lassen. Nach dem gewaltigen Wirtschaftswachstum in Indien und China - und insgesamt in Ostasien - wird lauthals verkündet, dass er nun dazu in der Lage sei, der Hälfte der Menschheit eine Entwicklung anzubieten. Und er wäre dazu um so mehr in der Lage, wenn man ihn von all seinen Fesseln befreien würde. So verkündet man, dass mit Löhnen und Arbeitsbedingungen auf dem Niveau Chinas im Westen ebenfalls Wachstumsraten von 10% pro Jahr erreicht werden könnten.
Die theoretische und ideologische Herausforderung ist also ziemlich groß: Spiegelt die Entwicklung in Ostasien eine Erneuerung des Kapitalismus wider, oder handelt es sich nur um eine einfache Schwankung in seinem normalen Krisenverlauf? Auf diese wesentliche Frage versuchen wir eine Antwort zu geben. Während wir auf die gesamte Entwicklung im asiatischen Subkontinent eingehen wollen, werden wir jedoch insbesondere den Fall Chinas behandeln, da er am bekanntesten ist und in den Medien am meisten behandelt wird.
Wir werden auf diese Herausforderungen und Fragen in den folgenden Kapiteln eingehen.
Einige Fragen an die revolutionäre Theorie aufgrund der Entwicklung des asiatischen Subkontinentes
1. Während 25 Jahren Wirtschaftswachstum und ‚Globalisierung'[1] (1980-2005), während dessen Europa sein Bruttoinlandprodukt (BIP) auf das 1,7-Fache vergrößerte, die USA ihres auf das 2,2-Fache, die Welt auf das 2,5-Fache, konnte Indien sein BIP auf das Vierfache, das sich entwickelnde Asien auf das Sechsfache, China seins auf das Zehnfache erhöhen. Chinas Entwicklung war also viermal schneller als der Weltdurchschnitt - und das, während die Welt in einer Wirtschaftskrise steckt. Das bedeutet, dass das Wachstum im ostasiatischen Subkontinent den fortgesetzten Fall des weltweiten BIP-pro-Kopf-Wachstums seit Ende der 1960er Jahre abgefedert hat: 1960: 3,7% (1960-69); 2,1% (1970-79); 1,3% (1980-89); 1,1% (1990-1999) und 0,9% (2000-2004)[2]. Die erste Frage, vor der wir stehen, ist folgende: Kann diese Region der Krise entweichen, in welcher der Rest der Weltwirtschaft steckt?
2. Die USA brauchten 50 Jahre zur Verdoppelung ihres Prokopfeinkommens von 1865 und dem 1. Weltkrieg (1914); China gelang dies doppelt so schnell, zudem noch im Zeitraum der Dekadenz und der Krise des Kapitalismus! Während 1952 noch 84% der Bevölkerung Chinas auf dem Land lebte, beträgt heute die Zahl der in der Industrie beschäftigten Arbeiter (170 Millionen) 40%; sie übersteigt damit die Zahl aller Arbeiter in der OECD (123 Millionen Beschäftigte in der Industrie)! Das Land wurde zur Werkstatt der Welt und die Beschäftigung im Dienstleistungsbereich steigt enorm schnell an. Die Umwälzung der Beschäftigungsstrukturen ist eine der schnellsten in der ganzen Geschichte des Kapitalismus gewesen.[3] So ist China mittlerweile zur viertgrößten Wirtschaft der Erde aufgestiegen, wenn man sein BIP in Dollars berechnet und China steht an zweiter Stelle bei Kaufkraftparität.[4] All diese Faktoren verlangen eine Antwort auf die Frage, ob es in diesem Land nicht eine wahre ursprüngliche Akkumulation und eine industrielle Revolution gibt wie die, welche im 18. und 19. Jahrhundert in den entwickelten Ländern stattgefunden hat. Anders ausgedrückt: gibt es einen Raum für das Auftauchen von neuen Kapitaleinheiten und neuen Ländern im Zeitalter der Dekadenz? Wäre gar ein Aufholprozess denkbar, wie in seiner aufsteigenden Phase? Wenn die gegenwärtigen Wachstumszahlen anhalten, würde China zu einer der größten Wirtschaftsmächte innerhalb von weniger als zwei Jahrzehnten werden. Dies war im 19. Jahrhundert auch den USA und Deutschland gelungen, als diese England und Frankreich ein- und überholten, obwohl diese erst später ‚gestartet' waren.
3. Das Wachstum des BIP Chinas ist ebenfalls das höchste, das jemals in der Geschichte des Kapitalismus registriert wurde: Während der letzten 25 Jahre ist es im Jahresdurchschnitt um 8-10% gewachsen, trotz weltweiter Krise. Das Wachstum Chinas übertrifft sogar noch die Wachstumsrekorde Japans in der Blütephase nach dem 2. Weltkrieg. Damals wuchs die Wirtschaft Japans um 8.2% zwischen 1950-1973 und die Koreas um 7.6% zwischen 1962-1990. Darüber hinaus ist der Wachstumsrhythmus Chinas im Augenblick größer und stabiler als der seiner schon industrialisierten Nachbarn (Südkorea, Taiwan, Hongkong). Gibt es also ein Wirtschaftswunder in China?
4. Zudem begnügt sich China nicht mehr damit, Grundstoffe zu produzieren und zu exportieren oder Waren wieder auszuführen, die in Chinas Fabriken mit Billiglöhnen veredelt wurden. Immer mehr produziert und exportiert China hochwertige Güter wie z.B. Elektronikware und Transportmittel. Kommt es somit in China zum Aufbau neuer Industriezentren wie in den NIL (Neu industrialisierten Ländern) (Südkorea, Taiwan, Hongkong, Singapur)? Wird China es wie diese Länder schaffen, seine Exportabhängigkeit zu reduzieren und den Binnenmarkt zu entwickeln? Sind Indien und China nur Sternschnuppen, deren Licht irgendwann verlöschen wird, oder werden sie zu neuen global players auf Weltebene?
5. Die schnelle Herausbildung von großen Arbeiterkonzentrationen in Asien, von denen die meisten Beschäftigten noch sehr jung und unerfahren sind, wirft jedoch eine Reihe von Fragen hinsichtlich der Entwicklung des Klassenkampfes und des Einflusses auf das Kräfteverhältnis zwischen den Klassen auf Weltebene auf. Die Zunahme von Klassenkämpfen und das Auftauchen von politischen Minderheiten sind dafür eindeutige Zeichen.[5] Im Gegenzug werden die sehr niedrigen Löhne und die extrem prekären Beschäftigungsverhältnisse in Ostasien von der herrschenden Klasse der entwickelten Länder dazu benutzt, um die Beschäftigten mit Arbeitsplatzverlust (Verlagerung des Arbeitsplatzes usw.) und Lohnsenkungen und einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen zu erpressen.
Wir können nur auf all diese Fragen Antworten geben und die wahren Hintergründe, Widersprüche und Grenzen des Wachstums in Asien aufzeigen, wenn wir den ganzen Fragenkomplex in den weltweiten Kontext der Entwicklung des Kapitalismus auf historischer und internationaler Ebene einbetten. Nur indem man die gegenwärtige Entwicklung in Ostasien einerseits in den Zeitraum des Beginns der Dekadenzphase seit 1914 einordnet (dies werden wir im 1. Teil tun), und andererseits die internationale Krisenentwicklung seit Ende der 1950er Jahre berücksichtigt (dies geschieht im 2. Teil), kann man umfassend das Wachstum in Asien erklären (3. Teil). Diese Achsen werden wir in diesem Artikel aufgreifen.[6]
Teil 1
Ein für den dekadenten Kapitalismus typischer Verlauf
Der Werdegang Chinas, der geprägt wurde durch das Joch des Kolonialismus und seine nicht abgeschlossene, mehrfach abgewürgte bürgerliche Revolution, ist typisch für jene Länder, die während der aufsteigenden Phase des Kapitalismus keine industrielle Revolution mehr durchführen konnten. Während China mit seinem BIP, das ein Drittel aller produzierten Güter der Welt umfasste, noch bis 1820 die erste Wirtschaftsmacht der Ende war, betrug das chinesische BIP 1950 nur noch 4.5% der Weltproduktion; d.h. ein Siebtel des vorherigen Wertes.
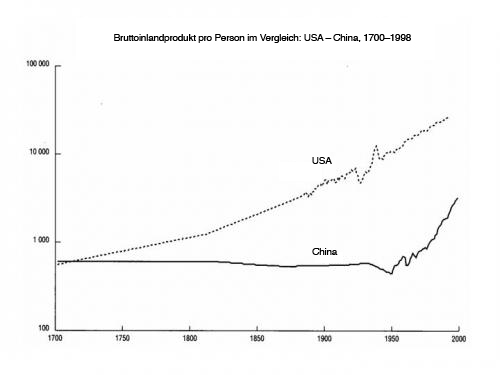
Grafik 1, Quelle Angus Maddison, Die Weltwirtschaft, OECD 2001: 45.
Die obige Statistik zeigt einen Rückgang des BIP Pro-Kopf in China von 8% während der gesamten aufsteigenden Phase des Kapitalismus. Es fiel von 600$ 1820 auf 552$ 1913. Dies verdeutlicht, dass eine richtige bürgerliche Revolution ausgeblieben ist, und dass das Land ständigen Konflikten zwischen Kriegsherren innerhalb einer geschwächten herrschenden Klasse ausgeliefert war, sowie unter dem furchtbaren Gewicht des kolonialen Jochs gelitten hat, der es nach der Niederlage im Opiumkrieg 1840 ausgesetzt wurde. Diese Niederlage stellte den Auftakt zu einer Reihe von demütigenden Verträgen dar, welche zur Aufteilung Chinas unter die Kolonialmächte führte. Derart geschwächt, war China schlecht gerüstet, um für die Bedingungen des einsetzenden Niedergangs des Kapitalismus gewappnet zu sein. Die relative Sättigung der Märkte und ihre Beherrschung durch die Großmächte, die während der gesamten Zeit des Niedergangs des Kapitalismus vorherrschen, haben China eine absolute Unterentwicklung während des größten Teils dieses Zeitraums aufgezwungen, da sein pro Kopf BIP zwischen 1913 (552$) und 1950 (439$) noch schneller zurückging (-20%).
All diese Fakten bestätigen vollauf die von der Kommunistischen Linken entwickelte Analyse, der zufolge es in der Dekadenz des Kapitalismus nicht mehr möglich ist, dass neue Länder und Mächte in einem Umfeld des global gesättigten Weltmarktes aufstreben[7]. Erst in den 1960er Jahren konnte China sein BIP wieder auf das Niveau von 1820 (600$) anheben. Danach stieg es beträchtlich an, aber erst während der letzten 30 Jahre ist das Wachstum förmlich explodiert und hat bislang in der Geschichte des Kapitalismus nie erreichte Werte erreicht[8]. Diese jüngste und außergewöhnliche Phase der Geschichte Chinas bedarf einer Erklärung, denn diese Phase scheint auf den ersten Blick viele Erkenntnisse über die Entwicklung des Kapitalismus zu widerlegen. Aber bevor wir die Wirklichkeit dieses gewaltigen Wachstums in Ostasien ergründen, müssen wir auf zwei andere Merkmale des dekadenten Kapitalismus eingehen, die von den Linkskommunisten aufgedeckt worden sind, und die den asiatischen Subkontinent stark geprägt haben: Die allgemeine Tendenz zum Staatskapitalismus einerseits, und die Eingliederung eines jeden Landes in einen imperialistischen Block mit jeweiligem Führer andererseits. Auch auf dieser Ebene scheint die jüngste Entwicklung Chinas diesen Merkmalen zu widersprechen, da China auf internationaler Ebene eher als "Einzelkämpfer" auftritt. Darüber hinaus werden ständig Reformen verabschiedet und Deregulierungen getroffen, die eher dem Manchesterkapitalismus gleichen, so wie Marx ihn in ‚Das Kapital' oder Engels in "Die Lage der arbeitenden Klasse in England" beschrieben haben. Wir wollen hier vorgreifend sagen, dass all dem nicht so ist. Einerseits werden all diese Reformen aufgrund staatlicher Initiativen und unter der strengen Kontrolle des Staates durchgeführt; andererseits hat die Implosion der beiden imperialistischen Blöcke, d.h. des US- und sowjetisch geführten, es nach 1989 ermöglicht, dass jedes Land eigenmächtig handelt. Wir wollen auf diese beiden Tatsachen näher eingehen, bevor wir den wirtschaftlichen Erfolg Ostasiens während des letzten Vierteljahrhunderts untersuchen.
Die allgemeine Infrastruktur des Staatskapitalismus im Zeitalter der Dekadenz
Wie wir 1974 in einer umfangreichen Untersuchung des Staatskapitalismus schrieben:
„Die Tendenz zur staatlichen Kontrolle ist der Ausdruck der permanenten Krise des Kapitalismus seit 1914. Es handelt sich um eine Art Anpassung des Systems, um in einem Zeitraum zu überleben, in welchem die wirtschaftliche Dynamik des Kapitalismus auf ihre historischen Grenzen stößt. Wenn die Widersprüche des Kapitalismus nur dazu führen können, dass die Welt durch eine Reihe von unvermeidbaren imperialistischen Rivalitäten und Kriegen erschüttert wird, ist der Staatskapitalismus der Ausdruck der Tendenz zur Autarkie, zur permanenten Kriegswirtschaft, der Bündelung der nationalen Kräfte, um das nationale Kapital zu schützen (...) Im Zeitalter des Niedergangs hat die permanente Krise aufgrund der relativen Sättigung der Märkte bestimmte Änderungen der Organisationsstruktur des Kapitalismus aufgezwungen (...) Weil es keine rein wirtschaftliche Lösung für diese Schwierigkeiten gibt, darf man es nicht zulassen, dass die Gesetze des Kapitalismus blind walten. Die Bourgeoisie versucht, deren Konsequenzen mit Hilfe des Staates zu beherrschen: Subventionen, Verstaatlichung von defizitären Bereichen, Kontrolle der Rohstoffe, Planung auf Landesebene, Eingriffe in die Wechselkurse usw." (Révolution Internationale, Alte Serie, Nr. 10, S. 13-14).
Diese Analyse ist nichts anderes als die Position, die die Kommunistische Internationale 1919 bezogen hatte: „Der nationale Staat, der der kapitalistischen Entwicklung einen mächtigen Impuls gegeben hat, ist für die Fortentwicklung der Produktivkräfte zu eng geworden" (Manifest der Komintern). Dieser Widerspruch zwischen den kapitalistischen Produktionsverhältnissen und der Bremswirkung, die sie seitdem auf die Entwicklung der Produktivkräfte ausüben, ist die Ursache für die allgemeine Tendenz zum Staatskapitalismus in der Niedergangsphase des Kapitalismus. Die erbarmungslose Konkurrenz auf einem mittlerweile global gesättigten und von den Großmächten kontrollierten Weltmarkt hat jeden Nationalstaat dazu gezwungen, für seine Interessen zu kämpfen, indem der Staat auf allen Ebenen eingreift: auf sozialer, politischer und ökonomischer. Im Allgemeinen spiegelt die Entwicklung des Staatskapitalismus in der Dekadenz den mittlerweile unüberwindbaren Widerspruch zwischen den immer mehr weltweiten Akkumulationsbedürfnissen des Kapitals und der engen nationalen Grundlage der bürgerlichen Eigentumsverhältnisse: „Die Verstaatlichung des wirtschaftlichen Lebens, gegen welche sich der kapitalistische Liberalismus so sträubte, ist zur Tatsache geworden. Nur zum freien Wettbewerb, sondern auch zur Herrschaft der Trusts, Syndikate und anderer wirtschaftlicher Ungetüme, gibt es keine Rückkehr", hob das Manifest der Kommunistischen Internationale ebenso hervor.
Diese Tendenzen, die nationalen Interessen des Staates in die Hände zu nehmen und sich auf den nationalen Rahmen zurückzuziehen, führten zu einer brutalen Stockung der Expansion und der Internationalisierung des Kapitals, welche die aufsteigende Phase geprägt hatten. So wuchs der Anteil der Exporte der entwickelten Länder in der aufsteigenden Phase ständig, bis er sich mehr als verdoppelte, denn von 5.5% 1830 war er 1914 auf 12.9% gestiegen (Tabelle 2). Dies verdeutlicht die frenetische Eroberung der Welt durch den Kapitalismus während der damaligen Phase.
Der Eintritt des Kapitalismus in seine Niedergangsphase sollte jedoch einen brutalen Stopp des kapitalistischen Vordringens auf der Welt bewirken. Die Stagnation des Welthandels zwischen 1914-1950 (siehe Tabelle 2), der um die Hälfte sinkende Anteil der Exporte der entwickelten Ländern an der weltweiten Produktion (von 12.9% 1913 auf 6.2% 1938 - Tabelle 2), und die Tatsache, dass das Wachstum des Welthandels oft unter dem der Produktion lag, zeigen jeweils den relativ starken Rückgang im Rahmen des Nationalstaates während der Dekadenzphase. Selbst in den ‚fettesten' Jahren des Wirtschaftswunders, in denen es zu einem starken Anstieg des internationalen Handels bis in den 1970er Jahren kam, blieb der Anteil der Exporte der entwickelten Länder (10.2%) immer noch unter dem Niveau von 1914 (12.9%) und selbst unter dem Niveau, das 1860 (10.9% - siehe Tabelle 2[9]) erreicht worden war. Erst mit dem Einzug der "Globalisierung" Mitte der 1980er Jahre überstieg der Exportanteil das ein Jahrhundert zuvor erreichte Niveau. Diese gleiche, entgegen gesetzte Dynamik zwischen aufsteigender und niedergehender Phase des Kapitalismus findet man auch auf der Ebene der Investitionsströme zwischen den Ländern. Der Anteil der direkten Auslandsinvestitionen stieg 1914 auf einen Prozentsatz von 2% des Weltbruttoindustrieproduktes, während sie trotz einer deutlichen Zunahme in der Zeit der Globalisierung 1995 nur die Hälfte des früheren Wertes (1%!) erreichten. Das Gleiche trifft für die Auslandsdirektinvestitionen der entwickelten Länder zu. Während diese von 6.6% 1980 auf 11.5% 1995 anstiegen, lag dieser Prozentsatz immer noch nicht über dem von 1914 (zwischen 12-15%). Diese ökonomische Ausrichtung auf den nationalen Rahmen und der entwickelten Länder im Zeitalter der Dekadenz kann auch noch durch folgende Tatsache verdeutlicht werden. „Am Anfang des Ersten Weltkriegs wurden 55-65% der direkten Auslandsinvestitionen in der Dritten Welt getätigt und nur 25-35% wurden in den entwickelten Ländern vorgenommen. Ende der 1960er Jahre hatte sich dieses Verhältnis umgekehrt, da 1967 nur 31% der direkten Auslandsinvestitionen der entwickelten Länder des Westens in der Dritten Welt getätigt worden waren und 61% in den entwickelten Staaten des Westens. Und seitdem hat sich diese Tendenz nur noch verstärkt (...) Gegen 1980 stieg dieser Anteil auf 78% der direkten Auslandsinvestitionen in den entwickelten Ländern und 22% in der Dritten Welt. (...) Der Umfang gegenüber dem Bruttoinlandsprodukt in den westlichen Industriestaaten betrug Mitte der 1990er Jahre zwischen 8.5% und 9%, gegen 3.5%-4% gegen 1913, d.h. mehr als das Doppelte"[10]
Während der aufsteigende Kapitalismus die Welt nach seinem Bild formte, indem immer mehr Staaten in seinen Bann gezogen wurden, sollte der Niedergang des Systems die Verhältnisse zum Zeitpunkt des Höhepunktes des Systems "einfrieren".
„Dass es unmöglich geworden ist, neue, große kapitalistische Einheiten zur Entstehung zu verhelfen, drückt sich unter anderem in der Tatsache aus, dass die sechs größten Industrieländer bereits am Vorabend des Ersten Weltkriegs die führenden Wirtschaftsmächte, wenn auch in einer anderen Reihenfolge, gestellt hatten". (Der Kampf des Proletariats im aufsteigenden und dekadenten Kapitalismus, in Internationale Revue Nr. 23, S. 25) All dies verdeutlicht den spektakulären Rückzug auf den nationalen Rahmen, welcher die ganze Niedergangsphase des Kapitalismus mittels eines massiven Rückgriffs auf die Politik staatskapitalistischer Maßnahmen prägte.
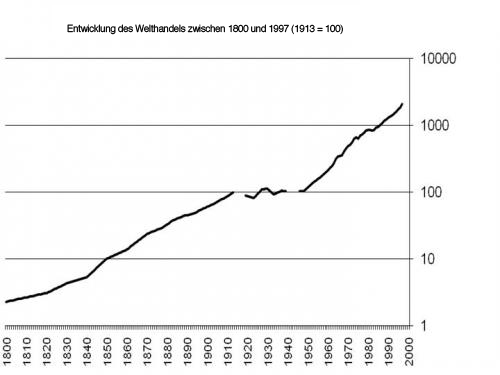
Grafik 2, Quelle: Rostow, The World Economy, History and Prospect, University of Texas Press 1978 : 662
Tabelle 2
|
Exportquote der entwickelten westlichen Staaten (% des BIP) |
|
|
1830 |
5,5 |
|
1860 |
10,9 |
|
1890 |
11,7 |
|
1913 |
12,9 |
|
1929 |
9,8 |
|
1938 |
6,2 |
|
1950 |
8 |
|
1960 |
8,6 |
|
1970 |
10,2 |
|
1980 |
15,3 |
|
1990 |
14,8 |
|
1996 |
15,9 |
|
Philippe Norel, L'invention du marché, Seuil, 2003 : 431. |
Ganz Ostasien sollte von dieser umfangreichen Rückzugsbewegung auf den Rahmen des Nationalstaates erfasst werden. Nach dem 2. Weltkrieg lebte fast die Hälfte der Weltbevölkerung außerhalb des Weltmarktes; sie war durch die Bipolarisierung der Welt zwischen zwei geostrategischen Blöcken "eingepfercht". Dieser Zustand wurde erst im Laufe der 1980er Jahre beendet. Davon betroffen waren die Ostblockstaaten, Indien, mehrere Staaten in der Dritten Welt wie Kuba, Vietnam, Kambodscha, Algerien, Ägypten usw. Diese brutale Abschottung der Hälfte der Welt vom Weltmarkt ist eine klare Verdeutlichung der relativen Sättigung des Weltmarktes. Diese Sättigung zwingt jedes nationale Kapital, direkt die Verteidigung seiner Interessen auf nationaler Ebene zu übernehmen und sich der Politik der beiden Blockführer zu unterwerfen, um in der Hölle der Dekadenz zu überleben. Diese Zwangspolitik musste allerdings scheitern. Dieser ganze Zeitraum bedeutete nur ein sehr mäßiges Wachstum für China und Indien. Vor allem im Falle Indiens lag dieses Wachstum noch unter dem Afrikas.
Tabelle 3:
|
BIP pro Kopf (Indiz 100 = 1950) |
||
|
|
1950 |
1973 |
|
Japan |
100 |
594 |
|
Westeuropa |
100 |
251 |
|
USA |
100 |
243 |
|
Welt |
100 |
194 |
|
China |
100 |
191 |
|
Afrika |
100 |
160 |
|
Indien |
100 |
138 |
|
Quelle : : Angus Maddison, L'économie mondiale, annexe C, OCDE, 2001. |
Es stimmt, dass das Wachstum Chinas das Wachstum der gesamten Dritten Welt zwischen 1950-73 übertroffen hat; aber dennoch blieb das Wachstum in diesem Zeitraum unter dem weltweiten Durchschnitt. Es war geprägt von einer schrecklichen Ausbeutung der Bauern und Arbeiter, und es war erst möglich geworden durch die intensive Unterstützung des Ostblocks bis Anfang der 1960er Jahre sowie durch die Eingliederung in den amerikanischen Einflussbereich. Zudem wurde sie geschwächt durch zwei bedeutende Rückgänge während des genannten Zeitraums - während des "Großen Sprungs nach vorne" (1958-61) und der "Kulturrevolution" (1966-70), die zum Tod von Dutzenden Millionen Bauern und Arbeitern aufgrund schrecklicher Hungersnöte und materiellen Leidens führten. Dieses globale Scheitern der Autarkiepolitik des Staates wurde von uns schon vor einem viertel Jahrhundert festgestellt: "Die protektionistische Politik hat im 20. Jahrhundert völlig ausgedient. Sie bietet der Wirtschaft in den unterentwickelten Ländern keine Gelegenheit mehr zum Luftholen, sondern führt im Gegenteil zu ihrer Strangulierung" Internationale Revue; Nr. 23, S. 27, engl./franz./span. Ausgabe). Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Staatskapitalismus keine Lösung für die Widersprüche des Kapitalismus darstellt, sondern nur ein Mittel, um Zeit zu gewinnen.
China in den jeweiligen Machtbereichen der beiden großen imperialistischen Blöcke
Da China der Konkurrenz des global gesättigten Weltmarktes, welcher von den Großmächten kontrolliert wurde, allein gegenüberstand, konnte China seine nationalen Interessen am besten vertreten, indem es sich zunächst bis Anfang der 1960er Jahre in den sowjetischen Block eingliederte, um dann später in den 1970er Jahren auf die amerikanische Seite zu wechseln. Seine Entwicklung fand auf einem Hintergrund statt, wo der Aufstieg neuer Mächte nicht mehr möglich war und diese ihre Verspätung nicht mehr aufholen konnten, wie das in der aufsteigenden Phase noch möglich gewesen war. Die Verteidigung nationalistischer Projekte der "Entwicklung" in der Dekadenz (das Projekt des Maoismus) war nur unter dieser Bedingung möglich. China bot sich dem meistbietendem in einer Zeit der bipolaren imperialistischen Blockkonfrontation in der Zeit des kalten Krieges (1945-89) an. Die Abschottung vom Weltmarkt, die Eingliederung in den sowjetischen Block und dessen massive Hilfe an China lieferten die Grundlagen für ein sicherlich sehr bescheidenes Wachstum - da es gerade unter dem Weltdurchschnitt lag - aber noch über dem Indiens und dem Rest der Dritten Welt. Tatsächlich hatte sich Indien nur teilweise vom Weltmarkt zurückgezogen. Es war gar eine Zeit lang als Führer der Blockfreien Staaten[11] aufgetreten und es musste dafür den Preis zahlen in Gestalt eines niedrigeren Wirtschaftswachstums als das Afrikas in der Zeit von 1950-73. Der Zusammenbruch der imperialistischen Blöcke nach dem Fall der Berliner Mauer (1989) und der fortgesetzte Verlust der US-Führungsrolle auf der Welt haben diesen Zwang zu einer internationalen Bipolarisierung überwunden, wodurch alle Staaten einen größeren Spielraum bei der Verfolgung ihrer eigenen Interessen erhalten haben.
Teil 2
Stellung und Entwicklung Ostasiens in der Geschichte der kapitalistischen Entwicklung
Die Scherenbewegung in Ostasien historisch betrachtet (1700-2006)
Nachdem wir die Entwicklung Ostasiens in den historischen Kontext der aufsteigenden und dekadenten Phase des Kapitalismus und in den Rahmen der Entwicklung des Staatskapitalismus und der Integration in die beiden imperialistischen Blöcke eingeordnet haben, müssen wir nun versuchen zu begreifen, warum diese Gegend der Erde die historische Tendenz zur Marginalisierung hat umkehren können. Die unten aufgeführte Tabelle zeigt, dass Indien und China 1820 mehr als die Hälfte der auf der Welt produzierten Güter (48.9%) umfassten, während ihr Anteil 1973 auf 7.7% abgefallen war. Das Gewicht der Geißel des Kolonialismus, schließlich der Eintritt des Kapitalismus in seine Niedergangsphase, führten zu einem Rückgang des Anteils Indiens und Chinas am Weltbruttosozialprodukt um das sechsfache. Oder anders ausgedrückt, als Europa und die neuen Länder sich entwickelten, kam es in Indien und China zu einem relativen Rückgang. Heute beobachten wir genau das Gegenteil. Seitdem die entwickelten Länder in die Krise geraten sind, hat sich Ostasien weiter entwickelt, so dass sein Anteil an der Weltproduktion 2006 auf 20% angestiegen ist. Wir beobachten hier also eine deutliche Scherenbewegung über die Jahre betrachtet. Als die Industriestaaten sich mächtig entwickelten, war die Entwicklung in Asien relativ rückläufig, und seitdem sich die Krise dauerhaft in den entwickelten Ländern niedergelassen hat, hat Asien angefangen, einen Boom zu durchlaufen.
Tabelle 4
|
Anteil der verschiedenen Gebiete der Welt in Prozent am weltweiten Bruttoinlandsprodukt |
||||||||
|
|
1700 |
1820 |
1870 |
1913 |
1950 |
1973 |
1998 |
2001 |
|
Europa und die neuen Länder (*) |
22,7 |
25,5 |
43,8 |
55,2 |
56,9 |
51 |
45,7 |
44,9 |
|
Rest der Welt |
19,7 |
18,3 |
20,2 |
22,9 |
27,6 |
32,6 |
24,8 |
(°) |
|
Asien |
57,6 |
56,2 |
36,0 |
21,9 |
15,5 |
16,4 |
29,5 |
|
|
Indien |
24,4 |
16,0 |
12,2 |
7,6 |
4,2 |
3,1 |
5,0 |
5,4 |
|
China |
22,3 |
32,9 |
17,2 |
8,9 |
4,5 |
4,6 |
11,5 |
12,3 |
|
Rest Asiens |
10,9 |
7,3 |
6,6 |
5,4 |
6,8 |
8,7 |
13,0 |
(°) |
|
(*) Neuen Länder = USA, Kanada, Australien, Neuseeland (°) = 37,4 : Rest der Welt und Rest Asiens |
||||||||
|
Quelle : Angus Maddison, L'économie mondiale, OCDE, 2001 : 280 |
Die Entwicklung Asiens nach dem 2. Weltkrieg
Diese Scherenbewegung wird auch anhand der Entwicklung der Wachstumszahlen in China im Vergleich zum Rest der Welt nach dem 2. Weltkrieg deutlich. Die Tabellen 3 (siehe oben) und 5 (siehe unten) zeigen, während in den entwickelten Ländern ein fortgesetztes Wachstums registriert wird, hinkten Indien und China hinterher: zwischen 1950 und 1973 erzielte Europa doppelt so hohe Werte wie Indien, Japans Wachstum war dreimal so hoch wie das Chinas und viermal so hoch wie das Indiens. Das Wachstum Indiens und Chinas lag unter dem Weltdurchschnitt. Aber danach trat genau das Gegenteil ein: zwischen 1978 und 2002 war der Jahresdurchschnitt des BIP Wachstums Chinas (pro Kopf) viermal so hoch (5.9%) wie der Weltdurchschnitt (1.4%) und Indien vervierfachte sein BIP, während dieses sich weltweit zwischen 1980 - 2005 nur um das 2.5-fache erhöhte.
Tabelle 5
|
Durchschnittliche Jahreswachstumsraten des BIP (pro Kopf) in %: |
||
|
|
1952-1978 |
1978-2002 |
|
China (bereinigte Zahlen) |
2,3 |
5,9 |
|
Welt |
2,6 |
1,4 |
|
Quelle : F. Lemoine, L'économie chinoise, La Découverte : 62. |
Erst als die zentralen Länder des Kapitalismus in die Krise gerieten, erlebten China und Indien ihren Aufschwung. Warum? Wie kann man diese Schwerenbewegung erklären? Warum kam es zu einem Wachstumsschub in Ostasien, während der Rest der Welt in die Krise abrutschte? Warum diese Kehrtwende? Wie konnte es in Ostasien zu dem starken Aufstieg kommen, während die Wirtschaftskrise sich international weiter ausdehnte. Wir werden versuchen darauf zu antworten.
Das Wiederauftauchen der Wirtschaftskrise offenbart das Scheitern all der nach dem 2. Weltkrieg eingesetzten Hilfsmittel
Als die Wirtschaftskrise Ende der 1960er Jahre wieder auftauchte, wurden all die Wachstumsmodelle, welche nach dem 2. Weltkrieg aufgeblüht waren, beiseite gefegt: das stalinistische Modell im Osten, das Keynessche Modell im Westen und das nationalistisch-militaristische Modell in der 3. Welt. Dadurch wurden die jeweiligen Ansprüche, sich als eine Lösung gegenüber den unüberwindbaren Widersprüchen des Kapitalismus zu preisen, zunichte gemacht. Die Zuspitzung derselben während der 1970er Jahre offenbarte das Scheitern der neo-keynesianischen Rezepte in allen Ländern der OECD, sie führte zum Zusammenbruch des Ostblocks während des nachfolgenden Jahrzehnts und zeigte die Machtlosigkeit all der "Alternativen" der 3. Welt (Algerien, Vietnam, Kambodscha, Iran, Kuba usw.). All diese Modelle, die während der "fetten" Jahre des Wirtschaftswunders viele Illusionen geschaffen hatten, sind später durch die darauf folgenden Rezessionen zusammengebrochen - dadurch wurde erkennbar, dass sie keineswegs eine Überwindung der inneren Widersprüche des Kapitalismus ermöglichen.
Die Konsequenzen und Reaktionen gegenüber dem Scheitern all dieser Formen waren ganz unterschiedlich. Von 1979-80 an vollzogen die westlichen Staaten eine Umkehr hin zu einem deregulierten Staatskapitalismus (der "neoliberalen" Wende, wie sie von den Medien und der Extremen Linke genannt wird). Aber weil sie durch einen ridigen Staatskapitalismus stalinistischer Art regiert wurden, sollten die Ländern Osteuropas erst nach dem Zusammenbruch des Ostblocks einen ähnlichen Weg antreten. Und es war auch der starke Druck durch die Wirtschaftskrise, welcher verschiedene Länder und Modelle in der 3. Welt dazu trieb, immer mehr in eine endlose Spirale der Barbarei hineinzurutschen (Algerien, Iran, Afghanistan, Sudan usw.), oder einfach in den Bankrott zu geraten (Argentinien, eine Vielzahl afrikanischer Staaten usw.), oder sie standen vor solch großen Schwierigkeiten, dass sie ihre Ansprüche, als Erfolgsmodelle aufzutreten, (die asiatischen Tiger und Drachen) herunterschrauben mussten. Dagegen gelang es einigen Ländern Ostasiens wie China und Vietnam, oder Indien Reformen durchzuführen, welche sie dem Weltmarkt zuführten und während der 1980er Jahre in den internationalen Akkumulationszyklus eingliederten.
Diese verschiedenen Reaktionen führten zu unterschiedlichen Ergebnissen. Wir wollen hier nur auf die westlichen Länder und Ostasien eingehen. Genau wie die Krise zunächst in den Industriezentren auftauchte, um anschließend auf die Länder der Peripherie überzuschwappen, sollte die wirtschaftliche Kehrtwende, die Anfang der 1980er Jahre in den entwickelten Ländern eintrat, die Stellung der Länder des ostasiatischen Subkontinentes im internationalen Akkumulationszyklus bestimmen.
Der Einzug des deregulierten Staatskapitalismus und einer pervertierten Globalisierung
All diesen neokeynesianischen Wiederankurbelungsmaßnahmen, welche während der 1970er Jahre angewandt wurden, gelang es nicht, eine zwischen den 1960er und 1980er Jahren um auf die Hälfte gesunkene Profitrate (siehe Tabelle unten)[12] zu erhöhen. Dieses ununterbrochene Abfallen der Rentabilität des Kapitals trieb eine Reihe von Betrieben an den Rand des Bankrotts. Die Staaten, welche sich zur Stützung ihrer Wirtschaft stark verschuldet hatten, standen praktisch vor der Zahlungsunfähigkeit. Dieser quasi-Bankrott Ende der 1970er Jahre war der Hauptgrund für den Wechsel zum deregulierten Staatskapitalismus - die pervertierte Globalisierung war die dazugehörige Begleiterscheinung. Die Hauptstoßrichtung dieser neuen Politik bestand in einem massiven und frontalen Angriff gegen die Arbeiterklasse mit dem Ziel der Wiederherstellung der Rentabilität des Kapitals. Zu Beginn der 1980er Jahre leitete die herrschende Klasse eine Reihe von massiven Angriffen gegen die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeiterklasse ein. Viele neokeynesianischen Rezepte wurden fallen gelassen. Die Arbeitskraft musste nunmehr international direkt miteinander durch Arbeitsplatzverlagerungen konkurrieren. Überall hielt international die Konkurrenz mit ihrer Deregulierung Einzug. Dieser massive gesellschaftliche Rückschritt ermöglichte eine spektakuläre Wiederherstellung der Profitraten auf einer Höhe, die heute sogar höher liegen als während des Wirtschaftswunders (siehe Tabelle 6 unten).
Die Grafik 3 weiter unten veranschaulicht diese gnadenlose Deregulierungspolitik. Mit ihrer Hilfe konnte die Bourgeoisie schon den Anteil der Lohnmasse am Bruttosozialprodukt international auf +/-10% senken. Diese Senkung ist nichts Anderes als die Umsetzung der spontanen Tendenz zur Erhöhung des Mehrwerts oder des Ausbeutungsgrades der Arbeiterklasse[13]. Diese Grafik zeigt uns auch die Stabilität der Mehrwertrate während der Zeit vor den 1970er Jahren. Diese Stabilität, die mit großen Produktivitätsfortschritten einherging, lieferte die Grundlagen für die Erfolge des Wirtschaftswunders. Diese Rate sank gar während der 1970er Jahre infolge des Drucks durch den Klassenkampf ab, welcher Ende der 1960er Jahre wieder massiv seinen Einzug hielt:
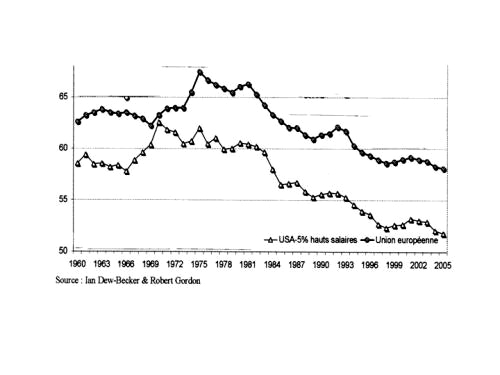
Grafik 3. Anteil der Löhne am Bruttoinlandsprodukt: USA und die Europäische Union 1960-2005.
Diese Senkung des Lohnanteils der Arbeiterklasse am Gesamtprodukt war in Wirklichkeit oft stärker als durch die Grafik deutlich wird, da diese Grafik alle Kategorien von Beschäftigten umfasst, auch beinhaltet die Grafik die Löhne, die sich die Bourgeoisie selber auszahlt[14]. Nachdem er zur Zeit des Wirtschaftswunders gesunken war, vergrößerte sich die Bandbreite der Einkommen. Der Rückgang des Lohnanteils war noch umfangreicher bei den Beschäftigten. Die Statistiken mit Unterscheidung der sozialen Kategorien belegen nämlich, dass für viele Beschäftigte - zumindest für die Qualifizierten - dieser Rückgang noch viel größeren Ausmaß war, da ihre Löhne auf das Niveau der 1960er Jahre sanken, wie dies schon in den USA bei den in der Produktion Beschäftigten der Fall war (Wochenverdienst). Während sich ihre Reallöhne zwischen 1945-1972 nahezu verdoppelt hatten, sind sie danach wieder auf das Niveau von 1960 gesunken.
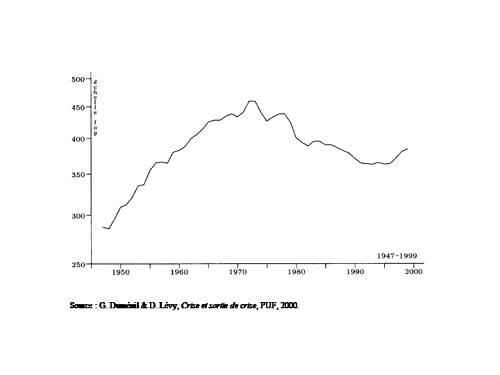
Grafik 4 - Wochenverdienst eines in der Produktion Beschäftigten (Dollarwerte von 1990): USA
Seit einem Vierteljahrhundert hat sich eine massive und breite Bewegung der absoluten Verarmung der Arbeiterklasse auf der ganzen Welt durchgesetzt. Der durchschnittliche Verlust des relativen Anteils am BIP betrug ca. +/-15-20%. Dies ist ein beträchtliches Ausmaß - zu dem auch noch die tiefgreifende Verschlechterung der Lebens- und Arbeitsbedingungen hinzugefügt werden muss. Wie Trotzki auf dem 3. Kongress der Kommunistischen Internationale sagte: SEQ CHAPTER \h \r 1"Die Theorie der Pauperisierung der Massen wurde unter den misstrauischen Pfiffen der Eunuchen, die die Tribünen der bürgerlichen Universitäten bevölkern und den Mandarinen des opportunistischen Sozialismus, begraben geglaubt. Jetzt zeigt sich nicht nur die soziale, sondern auch noch eine physiologische und biologische Pauperisierung, in ihrer ganzen Schrecklichkeit." (Eigene Übersetzung aus dem französischen)
Mit anderen Worten: die Konzessionen des Keynesschen Staatskapitalismus während des Wirtschaftswunders - die Reallöhne verdreifachten sich im Durchschnitt zwischen 1945-1980 - werden vom deregulierten Staatskapitalismus wieder zunichte gemacht. Abgesehen von diesem zeitlich begrenzten Zeitraum nach dem 2. Weltkrieg wird dadurch die Analyse der Kommunistischen Internationale und der Kommunistischen Linken vollauf bestätigt, denen zufolge in der Niedergangsphase des Systems keine wirklichen, vor allem dauerhaften Reformen mehr möglich sind.
Diese massive Senkung der Löhne führte zu zweierlei Konsequenzen. Einerseits konnte dadurch die Mehrwertrate gesteigert, damit wieder eine beträchtliche Profitrate sichergestellt werden. Diese hat nunmehr wieder das Niveau aus der Zeit des Wirtschaftswunders erreicht und dieses sogar übertroffen (siehe Grafik Nr. 6). Indem die Kaufkraft um +/-10 à 20% drastisch gesenkt wurde, sank das Volumen der aufnahmefähigen Märkte weltweit entsprechend. Damit sind direkt verbunden die schwerwiegende Zuspitzung der Überproduktionskrise auf internationaler Ebene und der Rückgang der Akkumulationsrate (das Wachstum des fixen Kapitals) auf ein historisch sehr niedriges Niveau (siehe Grafik 6). Diese doppelte Bewegung mit dem Ziel der Rentabilitätserhöhung zur Wiederherstellung der Profitrate, sowie die Notwendigkeit, neue Märkte für die Aufnahme von Waren zu finden, liegt an der Wurzel des Phänomens der Globalisierung, das in den 1980er Jahren auftauchte. Diese Globalisierung ist nicht zurückzuführen, wie uns die Vertreter der Extremen Linken und die anderen Globalisierungsgegner glauben machenwollen, auf die Dominierung durch das (bösartige) unproduktive Finanzkapital über das (gute) produktive industrielle Kapital. Einige Vertreter der Extremen Linken verlangen, das Finanzkapital müsse abgeschafft werden (oft berufen sie sich dabei unberechtigterweise auf Lenins "Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus"), andere verlangen die Besteuerung (Tobinsteuer) oder die Regulierung, je nach Antiglobalisierungscouleur oder linkssozialdemokratischer Orientierung usw.
Die historische Bedeutung der Globalisierung heute
Die ganze Literatur zur Globalisierung, ob aus linker oder rechter, aus Antiglobalisierungs- oder linksextremer Feder, stellt die Globalisierung als eine Wiederauflage der Eroberung der Welt durch kapitalistische Warenbeziehungen dar. Sehr oft stößt man dabei sogar auf berühmte Stellen aus dem Kommunistischen Manifest, wo Marx die fortschrittliche Rolle der Bourgeoisie und die Ausdehnung des Kapitalismus auf den ganzen Planeten beschrieb. Sie wird als ein umfassender Vorläufer der Herrschaft und der Herstellung der Warenbeziehung über alle Aspekte des Lebens durch kapitalistische Verhältnisse bezeichnet. Man behauptet sogar, dass es sich um die zweite Globalisierung nach der von 1875-1914 handele.
Gemäß dieser Darstellung der gegenwärtigen Globalisierung wäre der ganze Zeitraum seit dem 1. Weltkrieg bis zu den 1980er Jahren nur eine Zwischenphase isolationistischer (1914-45) oder regulierter Art (1945-1980). Während dieser Zeit hätte eine Sozialpolitik zugunsten der Arbeiterklasse (so die Vertreter der Extremen Linken) betrieben werden können, oder in dieser Zeit sei der Kapitalismus daran gehindert worden, sich grenzenlos zu entfalten (die liberale Variante). Kommen wir auf diese "glücklichen Tage" aus der Sicht der Ersten zurück oder derjenigen, die fordern "deregulieren" und "liberalisieren" wir so stark wie möglich, wie es die Letztgenannten wollen. Die Liberalen meinen, wenn man dem Markt seine ganze "Freiheit" und sein "Handlungsvermögen" ließe, würden überall auf der Welt gleich hohe Wachstumszahlen erzielt wie in China. Indem man die Arbeitsbedingungen und Löhne auf dem Niveau der Arbeiter Chinas akzeptiert, würde die Tür zu einem Paradies fulminanten Wachstums aufgestoßen! Nichts ist aber irreführender. Sowohl die linksextreme wie auch die liberale Darstellung täuschen darüber hinweg, dass die gegenwärtigen Wurzeln der Globalisierung nicht vergleichbar sind mit der Dynamik der Internationalisierung des Kapitalismus im 19. Jahrhundert:
1) Die erste Globalisierung (1880-1914) entsprach der Bildung des Weltmarktes und dem tiefen Eindringen der kapitalistischen Warenbeziehungen auf der ganzen Welt. Sie spiegelte die geographische Ausdehnung des Kapitalismus und seiner Herrschaft auf dem ganzen Planeten wider; durch die Lohn-und Nachfragesteigerungen weltweit wurde das Akkumulationsniveau angehoben Während die Dynamik des Kapitalismus im 19. Jahrhundert in eine nach oben gerichtete Spirale mündete, ist die gegenwärtige Globalisierung nur ein Phase der Entwicklung des Kapitalismus, dessen Akkumulations- und Wachstumsraten weltweit absinken. Die Lohnmasse und die kaufkraftfähige Nachfrage gingen zurück. Heute dagegen sind die Globalisierung und die grenzenlose Deregulierung nur Mittel, um den zerstörerischen Auswirkungen der historischen Krise des Kapitalismus entgegenzutreten. Die 'neoliberale' Politik der Globalisierung und Deregulierung sind eine von unzähligen Versuchen, das Scheitern früherer Mittel - Keynesianismus und Neokeynesianismus- auszugleichen. Heute befinden wir uns nicht in der Phase des triumphierenden Kapitalismus des 19. Jahrhunderts, sondern seit den 1970er Jahren stecken wir in der Phase der langsamen Agonie.
Dass das neue Ende des Akkumulationskreislaufs, der seit Ende der 1980er Jahre weltweit Einzug gehalten hat, durch eine örtlich beschränkte Entwicklung des asiatischen Subkontinentes geprägt ist, ändert nichts an dieser Charakterisierung der pervertierten Globalisierung, denn diese Entwicklung umfasst nur einen kleinen Teil der Erde. Sie ist nur möglich für eine kurze Zeit und entspricht in Wirklichkeit einem weit reichenden und massiven sozialen Rückschritt auf internationaler Ebene.
2) Während die erste Globalisierung der weltweiten Eroberung und dem Eindringen kapitalistischer Produktionsverhältnisse entsprach, und dabei immer mehr neue Nationen in diese Warenverhältnisse eingezogen wurden und die Vorherrschaft der alten Kolonialmächte noch verstärkt wurde, beschränkt sich diese heute hauptsächlich auf den südasiatischen Kontinent und lässt die Wirtschaft der entwickelten Länder und des Restes der Dritten Welt immer zerbrechlicher werden und gefährdet diese gar. Während die erste Globalisierung die geographische Ausdehnung und die Vertiefung der kapitalistischen Verhältnisse bedeutete, ist diese heute nur eine Schwankung des allgemeinen Prozesses der weltweiten Zuspitzung der Krise. Die Entwicklung beschränkt sich auf einen Teil der Welt- Ostasien- , während sich die Lage in anderen Teilen verschlechtert. Zudem kann dieser kurze Zeitraum der auf einige Gebiete beschränkten Entwicklung des asiatischen Subkontinentes nur solange dauern, wie die Rahmenbedingungen dafür bestehen. Aber diese Zeit läuft ab (siehe unten und die folgenden Teile dieses Artikels).
3) Während die erste Globalisierung mit einer allgemeinen Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiterklasse einherging, sich dabei die Reallöhne verdoppelten, bewirkt die gegenwärtige Globalisierung eine massive gesellschaftliche Regression: Druck zur Senkung der Löhne, absolute Verarmung von Dutzenden Millionen von Proletariern, massive Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, schwindelerregende Verschärfung des Ausbeutungsgrades usw. Während die erste Globalisierung einen Fortschritt für die Menschheit mit sich brachte, verbreitet die gegenwärtige Globalisierung die Barbarei auf Weltebene.
4) Während die erste Globalisierung eine Integration von immer mehr Arbeitern in die Lohnarbeitsverhältnisse der Produktion bedeutete, zerstört die gegenwärtige Globalisierung - auch wenn durch sie ein junges und unerfahrenes Proletariat in der Peripherie entsteht, die Arbeitsplätze und wälzt die Sozialstruktur der Länder um, in denen die erfahrensten Teile der Weltarbeiterklasse leben. Während die erste Globalisierung dazu neigte, die Bedingungen und das Gefühl der Solidarität zu vereinigen, verschärft die gegenwärtige Globalisierung die Konkurrenz und des "jeder für sich" im Rahmen des allgemeinen Zerfalls der gesellschaftlichen Beziehungen.
Aus all diesen Gründen ist es völlig falsch die gegenwärtige Globalisierung als eine Neuauflage des Zeitraums der aufsteigenden Phase des Kapitalismus zu bezeichnen, und zu diesem Zweck die berühmten Passagen des Kommunistischen Manifestes zu zitieren, in denen Marx die fortschrittliche Rolle der Bourgeoisie zum damaligen Zeitraum beschrieb. Heute gehört der Kapitalismus auf den Misthaufen der Geschichte. Das 20. Jahrhundert war das barbarischste Jahrhundert in der Menschheitsgeschichte. Seine Produktionsverhältnisse ermöglichen heute keinen Fortschritt mehr für die Menschheit, sondern treiben diese in eine immer größere Barbarei und erhöhen die Gefahr einer weltweiten Zerstörung der Umwelt. Die Bourgeoisie war eine fortschrittliche Klasse, welche im 19. Jahrhundert die Produktionsverhältnisse vorantrieb. Sie ist heute eine historisch überholte Klasse, welche den Planeten zerstört und nur noch Misere verbreitet, so dass die ganze Zukunft der Menschheit selbst in Frage gestellt wird. Deshalb darf man eigentlich nicht von Globalisierung reden, sondern von einer pervertieren Globalisierung.
Die politische Bedeutung der Deregulierung und der Globalisierung
Alle Medien und linken Kritiker der Globalisierung bezeichnen die neue Politik der Deregulierung und der Liberalisierung, welche von der Bourgeoisie seit den 1980er Jahren betrieben wird, als "neoliberale" Globalisierung. Diese Bezeichnungen werden ideologisch zu einem völlig verschleiernden Zweck eingesetzt. Einerseits wurde die sogenannte 'neoliberale' Deregulierung aufgrund einer Initiative und unter der Kontrolle des Staates eingeführt. Dies bedeutet bei weitem nicht, dass der 'Staat schwach' ist und die Regulierung nur durch den Markt erfolgte. Andererseits hat die heutige Globalisierung, wie wir weiter oben gesehen haben, nichts mit dem zu tun, was Marx in seinen Werken beschrieben hat. Sie spiegelt eine Etappe der Zuspitzung der Krise auf internationaler Ebene wider - und stellt keinesfalls eine wirkliche schrittweise Ausdehnung des Kapitalismus dar, wie dies in der aufsteigenden Phase des Kapitalismus im 19. Jahrhundert der Fall war; in Wirklichkeit handelt es sich um eine pervertierte Globalisierung. Dies schließt jedoch keineswegs aus, dass die Warenbeziehungen und die Lohnarbeit sich punktuell und örtlich begrenzt entwickeln (wie in Ostasien zum Beispiel), sondern der grundlegende Unterschied besteht darin, dass dieser Prozess in einem völlig unterschiedlichen Rahmen stattfand als jener während der aufsteigenden Phase des Kapitalismus.
Diese beiden Arten Politik (deregulierter Staatskapitalismus und die pervertierte Globalisierung) bringen keineswegs eine Erneuerung des Kapitalismus und auch nicht die Einführung eines neuen "Finanzkapitalismus" zum Ausdruck, wie uns die vulgären Linken und die Antiglobalisierungsbewegung weismachen wollen. Sie spiegeln vor allem die Zuspitzung der Weltwirtschaftskrise wider, da sie das Scheitern all der bislang benutzten klassischen staatskapitalistischen Maßnahmen verdeutlichen. Und die ständigen Aufrufe von gewissen Teilen der Bourgeoisie zur Erweiterung und Generalisierung dieser Politik belegen auch nichts Anderes als ein Scheitern dieser Politik. Zudem hat ein mehr als ein Viertel Jahrhundert deregularisierter und weltweit handelnder Kapitalismus die Wirtschaftskrise international nicht überwinden können. Nachdem diese Politik angewandt wurde, ist das pro-Kopf BIP seit Jahrzehnten gesunken; auch wenn es in bestimmten Regionen vorübergehend angestiegen ist (wie in Ostasien) und ein spektakuläres Wachstum stattgefunden hat.
Der Einzug des deregulierten Staatskapitalismus und die pervertierte Globalisierung sind ein klarer Ausdruck der Dekadenz des Kapitalismus
Die andauernde Krise und der fortdauernde Fall der Profitrate in den 1970er Jahren haben die Rentabilität des Kapitals und der Unternehmen angeschlagen. Ende der 1970er Jahre mussten diese sich sehr stark verschulden. Viele von ihnen standen am Rande des Bankrotts. Zusammen mit dem Scheitern der neo-keynesianischen Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft erzwang dieser Bankrott die Aufgabe der keynesianischen Rezepte zugunsten eines deregulierten Staatskapitalismus und einer pervertierten Globalisierung, deren Hauptziele in der Wiederherstellung der Profitrate, der Rentabilität der Unternehmen und der Öffnung der Märkte für den Weltmarkt liegen. Diese Umorientierung der Wirtschaftspolitik der Bourgeoisie stellte also vor allem eine Stufe der Zuspitzung der Krise auf internationaler Ebene dar. Sie bedeutete keineswegs eine neue Blütephase, die von der sogenannten "neuen Wirtschaft" getragen wurde, wie uns ständig die Medienpropaganda eintrichtern will. Die Krise hatte solche Ausmaße angenommen, dass die herrschende Klasse keine andere Möglichkeit hatte, als auf die "liberaleren" Maßnahmen zurückzugreifen, während diese die Krise und die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in Wirklichkeit nur noch weiter verschärft haben. 27 Jahre deregulierter Staatskapitalismus und die Globalisierung haben gar nichts gelöst, sondern tatsächlich die Wirtschaftskrise noch weiter zugespitzt.
Die beiden Hauptstützen der pervertierten Globalisierung, welche mit der Einführung des deregulierten Staatskapitalismus seit 1980 verbunden sind, stützten sich zum einen auf die frenetische Suche nach Standorten mit geringen Lohnkosten, um entsprechende Profitraten der Betriebe (Lieferanten usw. eingeschlossen) aufzutreiben. Andererseits suchte man unaufhörlich eine Nachfrage aus dem Ausland, um den massiven Einbruch der Binnennachfrage nach den Sparmaßnahmen mit dem Ziel der Wiederherstellung der Profitraten auszugleichen. Von dieser Politik profitierte direkt Ostasien, das sich auf diese Entwicklung entsprechend einstellte. Anstatt zur Erhöhung des internationalen Wirtschaftswachstums beizutragen, hat das sehr spektakuläre Wachstum in Ostasien zum Rückgang der Endnachfrage durch die Senkung der Lohnmasse auf Weltebene beigetragen. Deshalb haben diese beiden Formen der Politik wesentlich zur Zuspitzung der internationalen Krise des Kapitalismus geführt. Dies wird sehr deutlich anhand der unten folgenden Grafik, welche eine logische und konstante Parallele zwischen der Entwicklung der Produktion und dem Welthandel seit dem 2. Weltkrieg aufzeigt, mit Ausnahme des Zeitraums seit den 1990er Jahren, als zum ersten Mal seit 60 Jahren eine Abweichung auftauchte zwischen einem Welthandel, der an Geschwindigkeit gewann, und einer schlapp bleibenden Produktion:
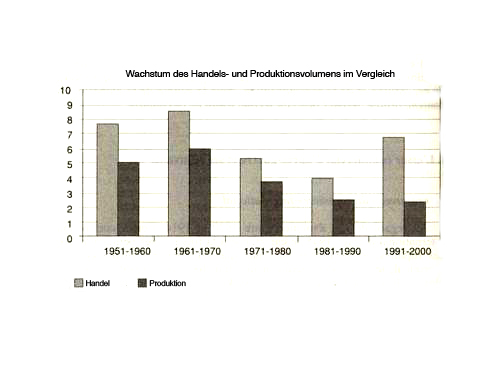
Grafik 5. Quelle: Die Erfindung des Marktes, Philippe Norel, Seuil, 2004, S.430.
Der Handel mit der Dritten Welt, welcher während des Wirtschaftswunders um mehr als die Hälfte gesunken war, stieg ab den 1990er Jahren infolge der Globalisierung wieder an. Aber davon profitierten nur einige Länder der Dritten Welt, d.h. genau diejenigen, welche sich seitdem zu den "Werkstätten" der Welt für Waren entwickelt haben, die mit Billiglöhnen hergestellt wurden[15]. Dass die Zunahme des Welthandels und der Exporte seit den 1980er Jahren nicht mit einem Anstieg des Wirtschaftswachstums einhergingen, belegt das, was wir vorhin aufgezeigt haben. Im Gegensatz zur ersten Globalisierung im 19. Jahrhundert, welche die Produktion und die Lohnmasse erweiterten, wird die heutige Globalisierung in dem Sinne pervertiert, da diese zu einem Schrumpfen der Lohnmasse führt und auch die Grundlagen der Akkumulation auf Weltebene begrenzt. Die gegenwärtige "Globalisierung" bedeutet letzten Endes nichts Anderes als ein gnadenloser Kampf zur Kürzung der Produktionskosten mittels einer massiven Reduzierung der Reallöhne. Sie offenbart, dass der Kapitalismus der Menschheit außer Verarmung und wachsender Barbarei nichts mehr anzubieten hat. Die sogenannte 'neoliberale Globalisierung' hat also nichts zu tun mit einer Rückkehr zur Eroberung der Welt durch einen triumphierenden Kapitalismus wie im 19. Jahrhundert, sondern sie bringt vor allem das Scheitern all der Hilfsmittel zum Ausdruck, um eine Wirtschaftkrise zu bekämpfen, die langsam aber unaufhörlich den Kapitalismus in den Abgrund führt.
Teil 3
Ostasien im weltweiten Akkumulationszyklus
Eine doppelte Bewegung ermöglichte somit Ostasien, sich von Beginn der 1990er Jahre an zu seinen Gunsten in den weltweiten Akkumulationszyklus einzubringen. Einerseits die Wirtschaftskrise, welche Indien und China zwang, ihre jeweiligen Modelle des stalinistischen und nationalistischen Staatskapitalismus fallen zu lassen; andererseits hat die Globalisierung Ostasien die Möglichkeit geboten, sich in den Weltmarkt einzugliedern, indem dort seitens der entwickelten Länder Investitionen getätigt und Arbeitsplätze verlagert wurden, um billige Arbeitskräfte für ihre Produktion aufzutreiben. Diese beiden Tendenzen erklären die Scherenbewegung, eines auf Weltebene rückläufigen, aber im asiatischen Subkontinent stark steigenden Wachstums.
Die Zuspitzung der Wirtschaftskrise ist somit die Ursache für diesen Abschluss des weltweiten Akkumulationszyklus, welcher Ostasien die Eingliederung als Werkstätte der Welt erlaubte. Dies geschah, indem dort Investitionen getätigt, Produktionsstätten und Zuliefererbetriebe aus den entwickelteren Ländern verlagert wurden, welche nur billige Arbeitskräfte suchten, indem die zu Billigstlöhnen produzierten Konsumgüter wieder exportiert wurden, und indem schließlich hochwertige, in Asien veredelte Waren sowie auch Luxusgüter an die neuen Reichen in Asien verkauft wurden, welche in den entwickelten Ländern hergestellt wurden.
Das Wachstum in Ostasien spiegelt keine Erneuerung des Kapitalismus sondern seine Krise wider
Das Scheitern der neokeynesianischen Maßnahmen während der 1970er Jahre in den zentralen Ländern stellte somit eine bedeutende Stufe der Zuspitzung der Wirtschaftskrise auf internationaler Ebene dar. Dieses Scheitern war die Ursache für die Aufgabe des keynesianischen Staatskapitalismus zugunsten einer mehr deregulierten Variante, deren wesentliche Achse in einem massiven und frontalen Angriff gegen die Arbeiterklasse mit dem Ziel bestand, eine seit Ende der 1960 Jahre um die Hälfte gesunkene Profitrate (siehe Grafik 6) wiederherzustellen. Dieser massive gesellschaftliche Rückschritt nahm vor allem die Form einer systematischen Politik der Verstärkung der weltweiten Konkurrenzverhältnisse unter den Lohnabhängigen an. Indem sie in die neue internationale Arbeits- und Lohnteilung eingegliedert wurden, konnten Indien und China daraus einen großen Nutzen ziehen. Während das Kapital die Entwicklungsländer in der Zeit des Wirtschaftswunders fast total vernachlässigte, wird heute massiv (fast ein Drittel) in diesen Ländern investiert. Dabei fließen die Investitionen hauptsächlich in einige asiatische Länder. Dadurch sind Indien und China zu einer Plattform für die Herstellung und den Neuexport von Waren geworden, die in ohnehin relativ produktiven Betrieben hergestellt werden, aber deren Arbeitsbedingungen mit denen der Gründerzeit des Kapitalismus vergleichbar sind. Dies ist im Wesentlichen die Erklärung für den Erfolg dieser Länder.
Ab den 1990er Jahren strömten große Kapitalmengen in diese Länder. Auch wurden viele Betriebe dorthin verlagert, um so zu den Werkstätten der Welt zu werden. Der Weltmarkt wurde mit dort zu Billiglöhnen hergestellten Waren überschwemmt. Im Gegensatz zu früher, als die Lohnunterschiede in den veralteten Betrieben und die protektionistische Politik es den Entwicklungsländern nicht gestatteten, auf den Märkten der zentralen Länder zu konkurrieren, ermöglicht heute die Liberalisierung die Produktion mit geringen Lohnkosten in den ausgelagerten Fabriken. Dadurch können viele Produkte vom Markt verdrängt werden, die in den westlichen Industriestaaten produziert werden. Das spektakuläre Wachstum Ostasiens stellt somit keine Erneuerung des Kapitalismus dar, sondern ein momentanes Aufbäumen bei seinem langsamen internationalen Abstieg. Während diese Schwankung einen beträchtlichen Teil der Welt (Indien und China) dynamisieren und gar zur Aufrechterhaltung des Weltwachstums beitragen konnte, handelt es sich in Wirklichkeit um ein Paradox, wenn man es in den Kontext der langsamen internationalen Entwicklung der Krise und der historischen Phase der Dekadenz einbettete.[16] Nur indem man mit Abstand und Überblick urteilt und all diese besondere Entwicklung in ihrem globaleren Kontext sieht, kann man ihre wirkliche Bedeutung verstehen und daraus etwas ableiten. Wenn man in der Biegung eines Mäanders steckt, kann man daraus nicht die Schlussfolgerung ziehen, dass der Fluss vom Meer in die Berge fließt.[17]
Die offensichtlich werdende Schlussfolgerung, welche mit Nachdruck betont werden muss, lautet, dass das Wachstum in Ostasien keinesfalls eine Erneuerung des Kapitalismus zum Ausdruck bringt. Dadurch kann die Vertiefung der Krise auf internationaler Ebene und vor allem in den zentralen Ländern nicht ausgemerzt werden. Das offensichtliche Paradox kann dadurch erklärt werden, dass Ostasien zu einem günstigen Zeitpunkt handeln konnte, um von einer Stufe der Zuspitzung der internationalen Krise zu profitieren, mit Hilfe derer es zur Werkstatt der Welt mit Niedrigstlöhnen werden konnte.
Das Wachstum Asiens beschleunigt die Depression weltweit
Dieser neue 'Abschluss' der Akkumulation auf Weltebene trägt zur Verschärfung der wirtschaftlichen Depression auf Weltebene bei, da sein Warenausstoß die Überproduktion nur noch weiter erhöht, indem die Endnachfrage aufgrund der relativen Senkung der weltweiten Kaufkraft und der Zerstörung einer Reihe von Gebieten oder Bereichen, die nicht mehr der weltweiten Konkurrenz standhalten können, sinkt.
Marx zeigte auf, dass es im Wesentlichen zwei Wege zur Wiederherstellung der Profitrate gibt: entweder "von oben", indem Produktivitätsgewinne erzielt werden durch die Investitionen in neue Maschinen und Produktionsverfahren, oder "von unten", indem die Löhne gesenkt werden. Da die Rückkehr der Krise Ende der 1960er Jahre sich durch einen quasi ununterbrochenen Rückgang der Produktivitätsgewinne äußerte, bestand der einzige Weg zur Wiederherstellung der Profite in einer massiven Kürzung der Löhne.[18] Die unten aufgeführte Grafik zeigte diese depressive Dynamik deutlich auf: Während des Wirtschaftswunders entwickelten sich Profitraten und die Akkumulation parallel auf einem hohen Niveau. Seit dem Ende der 1960er Jahre sind die Profitraten und die Akkumulation um die Hälfte gesunken. Nach der Einführung der Politik des deregulierten Staatskapitalismus seit den 1980er Jahren ist die Profitrate spektakulär angestiegen und sie hat sogar die Raten der Zeit des Wirtschaftswunders übertroffen. Aber trotz der Wiederherstellung der Profitraten ist die Akkumulationsrate nicht dem gleichen Rhythmus gefolgt und sie befindet sich weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau. Dies ist direkt auf die Schwäche der Endnachfrage zurückzuführen, welche durch die massive Kürzung der Lohnmasse herbeigeführt wurde, welche die Grundlage für die Wiederherstellung der Profitrate ist. Heute befindet sich der Kapitalismus in einer langsam wirkenden Rezessionsspirale: Seine Betriebe sind nunmehr rentabel, aber sie sie funktionieren auf einer immer eingeschränkteren Basis, da das Problem der Überproduktion akuter ist als je zuvor und dadurch die Akkumulationsgrundlagen begrenzt werden.
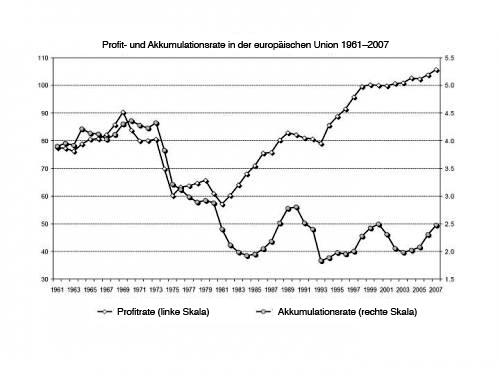
Grafik 6, Quelle: Michel Husson
Deshalb ist das gegenwärtige Wachstum in Ostasien keinesfalls ein asiatisches Wirtschaftswunder; auch handelt es sich nicht um eine Erneuerung des Kapitalismus auf Weltebene, sondern es handelt sich um eine Erscheinungsform des Versinkens in der Krise.
Schlussfolgerung
Der Ursprung, das Zentrum und die Dynamik der Krise rühren aus den zentralen Ländern. Die Verlangsamung des Wachstums, die Arbeitslosigkeit, die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen sind alles Erscheinungen, die vor dem Entwicklungsschub in Ostasien aufgetreten sind. Es waren gerade die Folgen der Krise in den entwickelten Ländern, die einen "Abschluss" der Akkumulation auf Weltebene und damit die Integration Asiens in den Weltmarkt als Werkstatt der Welt bewirkt haben. Dieser neue Abschluss verstärkt im Gegenzug die wirtschaftliche Depression in den zentralen Ländern, da auf internationaler Ebene die Überproduktion weiter zunimmt (das Angebot), während der zahlungskräftige Markt (Nachfrage ) schrumpft, nachdem die Löhne gesenkt wurden (ein für die Wirtschaft ausschlaggebender Faktor) und indem ein Großteil der weniger konkurrenzfähigen Wirtschaft in der Dritten Welt (ein marginaler Faktor auf ökonomischer, aber ein dramatischer Faktor auf menschlicher Ebene) zerstört wurde.
Die Rückkehr der historischen Krise des Kapitalismus Ende der 1960er Jahre, deren Zuspitzung in den 1970er Jahren sowie das Scheitern der seitdem eingesetzten neokeynesianischen Hilfsmittel haben den Weg bereitet für einen deregulierten Staatskapitalismus, welcher später eine pervertierte Globalisierung in den 1990er Jahren eingeleitet hat. Einige Länder konnten so zu Werkstätten mit Niedriglöhnen werden. Dies ist die Grundlage des spektakulären Wachstums in Ostasien, welches zusammen mit der Krise des stalinistischen und nationalistischen Modells der autarken Entwicklung, sich zu einem richtigen Zeitpunkt in den neuen weltweiten Akkumulationszyklus eingliedern konnte.
Frühjahr 2008, C.Mcl
[1] Siehe unseren Artikel: „Hinter der ‚Globalisierung' die Krise des Kapitalismus" in Internationale Revue 18
[2] Quellen: Weltbank: Indikatoren der Entwicklung auf der Welt 2003 (Online-Version) und Weltweite Wirtschaftsperspektiven 2004
[3] Tabelle 1: Strukturelle Verteilung als Prozent des produzierten Werts und Beschäftigung
|
Bereich |
Primärer (Landwirtschaft) |
Sekundärer (Industrie) |
Tertiärer (Dienstleistungen) |
|||
|
|
Wert |
Beschäftigung |
Wert |
Beschäftigung |
Wert |
Beschäftigung |
|
1952 |
51 |
84 |
21 |
7 |
29 |
9 |
|
1978 |
28 |
71 |
48 |
17 |
24 |
12 |
|
2001 |
15 |
50 |
51 |
22 |
34 |
28 |
|
Quelle: Statistisches Jahrbuch China 2002 |
[4] Diese Berechnungsweise ist deutlich zuverlässiger, da sie sich nicht auf die jeweiligen Werte stützt, die nur durch den Warentausch auf dem Weltmarkt entstanden sind, sondern auf den Vergleich der Preise eines Warenkorbs und Standarddienstleistungen in verschiedenen Ländern.
[5] Wir verweisen unsere Leser/Innen auf unseren Bericht zur Konferenz in Korea, auf der eine Reihe von Gruppen und Leuten zusammen kamen, die sich auf den proletarischen Internationalismus und die Kommunistische Linke berufen (siehe International Review - engl./franz./span. Ausgabe Nr. 129) sowie auf die Webseite einer neuen politischen internationalistischen Gruppe, die in den Philippinen entstanden ist und sich ebenfalls an die Kommunistische Linke anlehnt (siehe unsere Webseite).
[6] Auf unserem 17. Internationalen Kongress (siehe Internationale Revue Nr. 130; engl./franz./span. Ausgabe) hatten wir ausführlich über die Wirtschaftskrise im Kapitalismus diskutiert; dabei haben wir uns insbesondere mit dem gegenwärtigen Wachstum bestimmter ‚Schwellenländer' wie Indien oder China befasst, welches scheinbar die Analysen unserer Organisation und des Marxismus im Allgemeinen hinsichtlich des endgültigen Bankrotts der kapitalistischen Produktionsweise widerlegen. Wir haben beschlossen, in unserer Presse, insbesondere in der Internationalen Revue Vertiefungsartikel zu diesem Thema zu veröffentlichen. Dieser Artikel ist eine Konkretisierung dieser Orientierung. Wir meinen, dass er einen richtigen und nützlichen Beitrag zum Begreifen des Phänomens des chinesischen Wachstums im Rahmen der Dekadenz des Kapitalismus liefert. Die gegenwärtig in unserer Organisation stattfindende Debatte hinsichtlich der Analyse der Mechanismen, die dem Kapitalismus sein spektakulärstes Wachstum nach dem 2. Weltkrieg ermöglichten, spiegeln sich wider bei der Art und Weise, wie man die gegenwärtige Dynamik der Wirtschaft bestimmter ‚Schwellenländer', insbesondere Chinas, begreift. Gegenüber dem hier vorgelegten Artikel gibt es Differenzen, weil der Artikel die Auffassung vertritt, dass die Lohnmasse ausreichen würde, um einen aufnahmefähigen Absatzmarkt für die kapitalistische Produktion darzustellen, wenn sie nicht extrem stark "reduziert" wird. Dies spiegelt sich in der Formulierung einer Idee hinsichtlich der gegenwärtigen Globalisierung wider, die "pervertiert wird in dem Sinne, dass sie diese Lohnmasse relativ ‚komprimiert' und die Akkumulationsgrundlagen auf Weltebene um so mehr begrenzt". Die Mehrheit des Zentralorgans der Organisation vertritt diese Auffassung nicht. Sie geht stattdessen davon aus, wenn der Kapitalismus der Arbeiterklasse eine Kaufkraft ermöglicht (deren Gründe wir hier nicht näher erläutern können), die höher ist als das für die Reproduzierung der Arbeitskraft strikt Notwendige, und damit der Konsum der Arbeiter ansteigt, wird damit jedoch nicht dauerhaft die Akkumulation begünstigt.
[7] „Die Periode der kapitalistischen Dekadenz zeichnet sich dadurch aus, dass die Entstehung neuer Industrienationen unmöglich geworden ist. Jene Länder, die ihren industriellen Rückstand vor dem Ersten Weltkrieg nicht wettmachen konnten, waren dazu verdammt, in totaler Unterentwicklung zu stagnieren oder in eine chronische Abhängigkeit gegenüber den hoch industrialisierten Ländern zu geraten. So verhält es sich mit Nationen wie China oder Indien, in denen es trotz angeblicher „nationaler Unabhängigkeit" oder gar „Revolution" (d.h. die Einführung eines drakonischen Staatskapitalismus) nicht gelang, Unterentwicklung und Armut abzustreifen. (...) Die Unfähigkeit der unterentwickelten Länder, das Niveau der hoch entwickelten Mächte zu erreichen, lässt sich durch folgende Tatsachen erklären:
1) Die Märkte, die einst die außerkapitalistischen Sektoren für die Industrieländer verkörperten, sind durch die Kapitalisierung der Landwirtschaft und den fast vollständigen Niedergang des Handwerks gänzlich ausgeschöpft. (...) 3) Die außerkapitalistischen Territorien dieser Welt sind nahezu vollständig vom kapitalistischen Weltmarkt einverleibt worden. Trotz der ungeheuren Armut und der immensen Nachholbedürfnisse, trotz der völligen Unterentwicklung ihrer Wirtschaft stellen die Drittweltländer keinen zahlungsfähigen Markt dar, weil sie schlicht und einfach pleite sind. (4) Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage behindert jegliche Entstehung neuerer kapitalistischer Nationen. In einer Welt der gesättigten Märkte übertrifft das Angebot die Nachfrage bei weitem; die Preise werden durch die niedrigsten Produktionskosten bestimmt. Dadurch sind jene Länder mit den höchsten Produktionskosten gezwungen, ihre Waren für wenig Profit, wenn nicht gar mit Verlust, zu veräußern. Dies drückt ihre Akkumulationsrate auf ein niedriges Niveau. Selbst mit ihren billigen Arbeitskräften gelingt es ihnen nicht, die notwendigen Investitionen zur Anschaffung moderner Technologien zu tätigen. Das Ergebnis ist die ständige Vergrößerung des Abstandes zwischen ihnen und den Industrieländern. (...) 6) Die moderne Produktion von heute erfordert eine im Vergleich zum 19. Jahrhundert weitaus höher entwickelte Technologie und somit enorme Investitionen, die lediglich die Industriemächte zur Verfügung haben. So wirken sich auch rein technische Faktoren negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung aus." (Internationale Revue, Nr. 23, 1980, engl./franz./span. Ausgabe)
[8] Maddison, OCDE, 2001 : 283, 322.
[9] Der Welthandel entwickelte sich nach 1945 sehr schnell, sogar noch stärker als während der aufsteigenden Phase, da der Welthandel sich zwischen 1945-1971 im Laufe von 23 Jahren verfünffachte - während er zwischen 1890 und 1913 (ebenso 23 Jahre) nur um das 2.3 fache stieg. Der Anstieg des Welthandels war also doppelt so stark während des Wirtschaftswunders als während der stärksten Wachstumszeiten in der Aufstiegsphase (Quelle: Rostow, The World Economy, History and Prospect, University of Texas Press, 1978 : 662). Aber trotz dieses enormen Wachstums des Welthandels blieb der Anteil der Exporte an der Weltproduktion unterhalb des Niveaus von 1913 und selbst unterhalb des Niveaus von 1860: Die entwickelten Länder exportierten 1970 nicht mehr als ein Jahrhundert zuvor. Dies ist ein unverkennbares Zeichen eines auf sich selbst zentrierten Wachstums, das sich auf den nationalen Rahmen ausrichtet. Und zudem ist diese Beobachtung eines starken Anstiegs des Welthandels nach 1945 um so mehr zu relativieren, wenn man die Grafik genauer anschaut. Denn ein ständig wachsender Teil des Welthandels entsprach nicht wirklichen Verkäufen, sondern einem Austausch zwischen Filialen aufgrund der zunehmenden internationalen Arbeitsteilung. „Schätzungen der UNCTAD (Welthandelskonferenz) zufolge setzen allein die Multis zwei Drittel des Welthandels untereinander um. Und die Hälfte des Welthandels entspricht einem Transfer zwischen Filialen der gleichen Handelsgruppe" (Bairoch Paul, Victoires et déboires, III: 445). Diese Feststellung bekräftigt somit unsere allgemeine Schlussfolgerung, wonach die Dekadenz sich im Wesentlichen durch einen allgemeinen Rückzug eines jeden Landes auf seinen nationalen Rahmen auszeichnet und im Gegensatz zur aufsteigenden Phase nicht durch eine Ausdehnung und einen Wohlstand, der auf einer weiteren stürmischen Eroberung der Welt fußt.
[10] Alle Angaben der direkten Auslandsinvestitionen entstammen dem Buch von Bairoch Paul, 1997, Victoires et déboires, III : 436-443.
[11] Auf der indonesischen Insel Java fand zwischen dem 18.-24. April 1955 in Bandung die erste afroasiatische Konferenz statt, an der sich 29 Länder beteiligten, von denen die meisten erst kurz zuvor aus der kolonialen Abhängigkeit entlassen worden waren und die alle der Dritten Welt angehörten. Die Initiative für diesen Gipfel war von dem indischen Premierminister Nehru ausgegangen, der auf internationaler Ebene Staaten zusammenführen wollte, welche dem Griff der beiden Großmächte und der Logik des Kalten Kriegs entweichen wollten. Aber diese „blockfreien Staaten" konnten niemals wirklich unabhängig werden und der Dynamik der imperialistischen Zusammenstöße zwischen den beiden großen Blöcken (dem amerikanischen und sowjetischen) entziehen. So gehörten dieser Bewegung damals pro-westliche Staaten wie Pakistan oder die Türkei an, aber auch andere wie China und Nordvietnam, die pro-sowjetisch eingestellt waren.
[12] In der Nr. 128 unserer Internationalen Revue(engl./franz./span. Ausgabe) haben wir zwei Grafiken veröffentlicht, welche die Entwicklung der Profitrate während der letzten 150 Jahre in den USA und Frankreich widerspiegelten. Dort wird das Absinken um die Hälfte der Profitraten zwischen dem Ende der 1960er Jahre und 1980 deutlich. Es handelte sich um einen der spektakulärsten Rückgänge der Profitrate in der Geschichte des Kapitalismus weltweit.
[13] Die Mehrwertrate ist nichts anderes als die Ausbeutungsrate, welche den durch die Kapitalisten angeeigneten Mehrwert (m) ins Verhältnis setzt zur Lohnmasse (v, variables Kapital), den dieser den Beschäftigten zahlt. Ausbeutungsrate = Mehrwert/variables Kapital.
[14] Diese Grafik entstammt aus einer Untersuchung, die von Ian Dew-Becker & Robert Gordon verfasst wurde: Where did the Productivity Growth Go? Inflation Dynamics and the Distribution of Income, Washington DC, September 8-9, 2005, zugänglich im Internet auf folgender Webseite: https://zfacts.com/metaPage/lib/gordon-Dew-Becker.pdf [76].
[15] Diese niedrigen Herstellungskosten erklären die Stabilisierung auf hohem Niveau des Teils der Produktion, welche zwischen 1980 (15,3%) und 1996 15,9%) exportiert wurde. Dieser Anteil wird viel höher, wenn man ihn nicht nach seinem Wert, sondern nach Umfang misst: 19,1% im Jahre 1980 und 28,6% im Jahre 1996.
[16] Während das Weltbruttoinlandsprodukt pro Kopf jedes Jahrzehnt seit den 1960er Jahren gesunken ist: 3,7% (1960-69) ; 2,1% (1970-79), 1,3% (1980-89) ; 1,1% (1990-1999) und 0,9% für 2000-2004 kann man jetzt davon ausgehen - wenn nicht eine tiefe Rezession vor dem Ende des Jahrzehnts ausbricht, was sehr wahrscheinlich ist, dass der Durchschnitt für das Jahrzehnt 2000-2010 zum ersten Mal wesentlich höher liegen könnte als im Vergleich zum Jahrzehnt zuvor. Diese Steigerung ist vor allem auf die wirtschaftliche Dynamik in Ostasien zurückzuführen. Aber dieser Anstieg muss stark relativiert werden, denn wenn man deren Parameter untersucht, kann man feststellen, dass das Weltwachstum seit dem Crash der "New Economy" (2001-2002) sich hauptsächlich auf eine große Verschuldung der Haushalte und amerikanische Rekordhandelsdefizite stützte. Die US-Privathaushalte (wie auch die vieler anderer europäischer Länder) haben das Wachstum aufgrund einer starken Verschuldung nach einer Umschuldung ihrer Hypothekenkredite getragen (welche durch die Politik der Niedrigzinsen zur Ankurbelung des Wachstums betrieben wurde), so dass heute die Gefahren eines Immobiliencrashs erkennbar sind. Gleichzeitig haben die öffentliche Verschuldung, vor allem auch die Handelsdefizite, Rekordniveaus erreicht, welche ebenso stark das Wachstum auf der Welt mit getragen haben. Wenn man die Zahlen näher untersucht, wird diese wahrscheinliche Verbesserung während des ersten Jahrzehnts in diesem Jahrhundert erreicht worden sein, indem man viele Wechsel auf die Zukunft ausgestellt hat.
[17]Diese Art Anstieg ist keineswegs überraschend und sie traten auch im Verlauf der Dekadenz des Kapitalismus relativ häufig auf. Während dieser Phase bestand der Daseinsgrund der Politik der Bourgeoisie und insbesondere der staatskapitalistischen Politik darin, die wirtschaftlichen Gesetze und Regeln auszuhebeln, um ein System zu retten versuchen, welches unvermeidlich zum Bankrott neigt. Insbesondere während der 1930er Jahre wurden solche Maßnahmen schon ergriffen. Damals schon ließen viele staatskapitalistische Maßnahmen sowie massive Aufrüstungsprogramme viele vorübergehend glauben, dass man die Krise im Griff habe und es sogar wieder einen Aufschwung geben könnte: New Deal in den USA, Volksfront in Frankreich, DeMan-Plan in Belgien, Fünfjahrespläne in der UdSSR, Faschismus in Deutschland usw.
[18] Wir verweisen unsere Leser auf einen Artikel in unserer Internationale Revue Nr. 121, (engl./franz./span. Ausgabe) - in welcher wir auf diesen Prozess eingehen und empirische Angaben liefern.
Geographisch:
- Asien [77]
Aktuelles und Laufendes:
Theoretische Fragen:
- Politische Ökonomie [46]
Erbe der kommunistischen Linke:
Deutschland 1918 – 19, /1 Der Krieg und die Erneuerung der internationalistischen Prinzipien durch das Proletariat
- 6103 reads
Es ist 90 Jahre her, seitdem dieproletarische Revolution mit den Kämpfen von 1918 und 1919 in Deutschland ihrentragischen Höhepunkt erreicht hatte. Nach der heroischen Machtergreifung durchdas russische Proletariat im Oktober 1917 wechselte das Hauptschlachtfeld derWeltrevolution nach Deutschland. Dort wurde der entscheidende Kampf gefochtenund verloren. Die Weltbourgeoisie strebte stets an, diese Ereignisse historisch
Es ist 90 Jahre her, seitdem die proletarische Revolution mit den Kämpfen von 1918 und 1919 in Deutschland ihren tragischen Höhepunkt erreicht hatte. Nach der heroischen Machtergreifung durch das russische Proletariat im Oktober 1917 wechselte das Hauptschlachtfeld der Weltrevolution nach Deutschland. Dort wurde der entscheidende Kampf gefochten und verloren. Die Weltbourgeoisie strebte stets an, diese Ereignisse historisch in Vergessenheit geraten zu lassen. Das geht soweit, dass sie zwar nicht abstreiten kann, dass diese Kämpfe stattgefunden hatten, dass sie aber vorgibt, dass letztere nur auf „Frieden" und „Demokratie" abgezielt hätten - zu den glückseligen Bedingungen, die gegenwärtig im kapitalistischen Deutschland herrschen. Ziel dieser Artikelreihe, die wir hiermit beginnen, ist es aufzuzeigen, dass die revolutionäre Bewegung in Deutschland die Bourgeoisie in dem zentralen Land des europäischen Kapitalismus nahe an den Abgrund gerückt hatte, den Verlust ihrer Klassenherrschaft. Trotz ihrer Niederlage ist die Revolution in Deutschland wie jene in Russland ein Ansporn für uns heute. Sie erinnert uns daran, dass es nicht nur notwendig, sondern auch möglich ist, die Herrschaft des Weltkapitalismus zu stürzen.
Diese Reihe teilt sich in fünf Teile auf. Der erste Teil wird sich der Frage widmen, wie sich das revolutionäre Proletariat angesichts des I. Weltkrieges um sein Prinzip des proletarischen Internationalismus scharte. Teil 2 wird sich mit den revolutionären Kämpfen von 1918 beschäftigen. Teil 3 wird sich dem Drama der Formierung einer revolutionären Führung widmen, konkretisiert am Beispiel des Gründungskongresses der deutschen Kommunistischen Partei Ende 1918. Teil 4 wird die Niederlage von 1919 untersuchen. Der letzte Teil wird sich mit der historischen Bedeutung der Ermordung Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts sowie mit der Hinterlassenschaft dieser Revolutionäre für uns heute widmen.

I. Niederlage und Auflösung
Die internationale revolutionäre Welle, die gegen den I. Weltkrieg einsetzte, fand nur einige Jahre nach der größten politischen Niederlage statt, die die Arbeiterbewegung bis dahin erlitten hatte: der Zusammenbruch der sozialistischen Internationale im August 1914. Es ist daher wichtig zu begreifen, warum dieser Krieg stattfinden konnte und die Internationale versagte, um den Charakter und Verlauf der Revolutionen in Russland und besonders in Deutschland zu verstehen.
Der Marsch in den Krieg
Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts lag der Weltkrieg in der Luft. Hektisch begannen die imperialistischen Großmächte ihn vorzubereiten. Die Arbeiterbewegung hatte ihn vorausgesagt und vor ihm gewarnt. Doch zunächst wurde sein Ausbruch hinausgezögert - durch zwei Faktoren. Einer von ihnen war die unzureichende militärische Vorbereitung der wichtigsten Protagonisten. Deutschland beispielsweise war erst dabei, den Aufbau einer Kriegsflotte zu vervollständigen, die gegenüber Großbritannien, dem Beherrscher der Weltmeere, bestehen konnte. Es musste erst die Insel Helgoland in eine hochseetüchtige Marinebasis umwandeln und vollendete den Bau eines Kanals zwischen der Nordsee und dem Baltikum. Als das erste Jahrzehnt des Jahrhunderts sich dem Ende näherte, standen diese Vorbereitung kurz vor ihrem Abschluss. Dies rückte den zweiten Verzögerungsfaktor um so mehr in den Vordergrund: die Angst vor der Arbeiterklasse. Die Existenz dieser Furcht war keine bloße spekulative Hypothese der Arbeiterbewegung. Sie wurde offen von den Hauptrepräsentanten der Bourgeoisie ausgedrückt. Von Bülow, eine führende politische Figur im deutschen Staat, erklärte, dass es vornehmlich die Angst vor der Sozialdemokratie war, die die herrschende Klasse dazu veranlasste, den Krieg zu verschieben. Paul Rohrbach, der infame Propagandist der unverhohlen imperialistischen Kreise der Kriegsbefürworter in Berlin, schrieb: „... Zitat ..." General von Bernhard, ein prominenter Militärtheoretiker dieser Tage, warnte in seinem Buch „Über den zeitgenössischen Krieg", dass die moderne Kriegführung wegen der Notwendigkeit, Millionen von Menschen zu disziplinieren und zu mobilisieren, ein enormes Risiko sei. Solche Einsichten basierten nicht allein auf theoretischen Betrachtungen, sondern auch auf der praktischen Erfahrung aus dem ersten imperialistischen Krieg des 20. Jahrhunderts zwischen Großmächten. Dieser Krieg - zwischen Russland und Japan - verhalf der revolutionären Bewegung von 1905 in Russland zum Leben.
Solche Erwägungen nährten die Hoffnung innerhalb der Arbeiterbewegung, dass die herrschende Klasse es nicht wagen würde, in den Krieg zu ziehen. Diese Hoffnungen hatten ihren Anteil daran, dass die Divergenzen innerhalb der Sozialistischen Internationale just zu dem Zeitpunkt übertüncht wurden, als die Notwendigkeit einer proletarischen Klärung die offene Debatte erforderte. Die Tatsache, dass keine der verschiedenen Strömungen innerhalb der sozialistischen Bewegung den Krieg „wollte", schuf die Illusion der eigenen Stärke und Einheit. Doch der Reformismus und Opportunismuswaren prinzipiell nicht unvereinbar mit dem imperialistischen Krieg, sondern befürchteten lediglich den Verlust ihres juristischen und finanziellen Status im Falle seines Ausbruchs. Das „marxistische Zentrum" um Kautsky wiederum fürchtete den Krieg hauptsächlich deswegen, weil er die Illusion einer Einheit in der Arbeiterbewegung, die es um jeden Preis zu verteidigen entschlossen war, zerstören würde.
Was zugunsten der Fähigkeit der Arbeiterklasse sprach, den Ausbruch eines Weltkrieges zu verhindern, war vor allem die Intensität des Klassenkampfes in Russland. Dort hatten die Arbeiter nicht lange gebraucht, um sich von der Niederlage der 1905er Bewegung zu erholen. Am Vorabend des I. Weltkrieges gewann im zaristischen Herrschaftsbereich eine neue Welle von Massenstreiks an Fahrt. In einem gewissen Umfang ähnelte die damalige Lage der Arbeiterklasse in Russland jener im China von heute - eine Minderheit in der Gesamtbevölkerung zwar, aber dafür hochkonzentriert in modernen Fabriken, die vom internationalen Kapital finanziert wurden, brutal ausgebeutet in einem rückständigen Land, dem es an den politischen Kontrollmechanismen des bürgerlichen parlamentarischen Liberalismus mangelte. Mit einem gewichtigen Unterschied: das russische Proletariat wurde in den sozialistischen Traditionen des Internationalismus erzogen, während die chinesischen ArbeiterInnen heute immer noch unter dem Albtraum der nationalistisch-stalinistischen Konterrevolution leiden.
All dies machte Russland zu einer Bedrohung der kapitalistischen Stabilität.
Aber Russland war nicht typisch für das internationale Gleichgewicht der Klassenkräfte. Im Mittelpunkt des Kapitalismus und der imperialistischen Spannungen standen West- und Mitteleuropa. Der Schlüssel zur Weltlage befand sich nicht in Russland, sondern in Deutschland. Dies war das Land, das die Weltherrschaft der Kolonialmächte am meisten herausforderte. Und es war das Land mit der höchstkonzentrierten Arbeiterklasse, eine Klasse, deren sozialistische Erziehung am weitesten gediehen war. Die politische Rolle der deutschen Arbeiterklasse wurde von der Tatsache veranschaulicht, dass in Deutschland die Gewerkschaften von den sozialistischen Parteien gegründet worden waren, während in Großbritannien - der anderen führenden kapitalistischen Nation in Europa - die sozialistische Bewegung ein bloßes Anhängsel der Gewerkschaftsbewegung zu sein schien. In Deutschland standen die Tageskämpfe der ArbeiterInnen traditionell im Lichte des großen sozialistischen Endziels.
Ende des 19. Jahrhunderts begann jedoch ein Prozess der De-Politisierung der sozialdemokratischen Gewerkschaften in Deutschland, ihre „Emanzipation" von der sozialistischen Partei. Die Gewerkschaften zweifelten offen die Existenz einer Einheit zwischen Bewegung und Ziel an. Der Parteitheoretiker Eduard Bernstein verallgemeinerte dieses Bestreben mit seiner berühmten Formulierung: „Das Ziel ist mir nichts, die Bewegung alles". Diese Infragestellung der führenden Rolle der Sozialdemokratie in der Arbeiterbewegung, des Vorrangs des Ziels über die Bewegung brachte die sozialistische Partei in Konflikt mit ihren eigenen Gewerkschaften. Nach dem Massenstreik 1905 in Russland verschärfte sich dieser Konflikt. Er endete in einem Triumph der Gewerkschaften über die Partei. Unter dem Einfluss des„Zentrums" um Kautsky - der um jeden Preis die „Einheit" der Arbeiterbewegung aufrechterhalten wollte - beschloss die Partei, dass die Frage des Massenstreiks eine Angelegenheit der Gewerkschaften sei1.Doch der Massenstreik beinhaltete die ganzen Fragen der kommendenproletarischen Revolution! Auf diese Weise wurde die deutsche und die internationale Arbeiterklasse am Vorabend des I. Weltkrieges politisch entwaffnet.
Die Erklärung ihres nicht-politischen Charakters bereitete die Integration der Gewerkschaften in den kapitalistischen Staat vor. Somit hatte die herrschende Klasse, was sie benötigte, um die ArbeiterInnen für den Krieg zu mobilisieren. Diese Mobilisierung im Herzen des Kapitalismus würde ihrerseits ausreichend sein, um die ArbeiterInnen in Russland - für die Deutschland der Hauptbezugspunkt war - zu demoralisieren und desorientieren und somit die Stoßkraft der dortigen Massenstreiks zu brechen.
Das russische Proletariat, das sich seit 1911 in Massenbewegungen engagierte, hatte einschlägige Erfahrungen mit Wirtschaftskrisen, Kriegen und revolutionären Kämpfen. Nicht so in West- und Mitteleuropa. Dort brach der Weltkrieg am Ende einer langen Phase der wirtschaftlichen Entwicklung aus, der realen Verbesserungen der Lebensbedingungen der ArbeiterInnen, der steigenden Löhne und sinkenden Arbeitslosigkeit, der reformistischen Illusionen. Eine Phase, in der größere Kriege sich auf die Peripherie des Weltkapitalismus beschränkten. Die erste große Weltwirtschaftskrise des dekadenten Kapitalismus sollte erst 15 Jahre später ausbrechen - 1929. Die Epoche der Dekadenz begann nicht mit einer Wirtschaftskrise, wie die Arbeiterbewegung traditionell erwartete, sondern mit der Krise des Weltkrieges. Mit der Niederlage und der Isolierung des linken Flügels der Arbeiterbewegung in der Frage des Massenstreiks gab es keinen Grundmehr für die Bourgeoisie, den Sprung in den imperialistischen Krieg weiter hinauszuzögern. Im Gegenteil: jede weitere Verzögerung hätte sich als fatal für ihre Pläne erwiesen. Ein weiteres Abwarten konnte nur bedeuten: Warten auf die Wirtschaftskrise, auf den Klassenkampf, auf die Entwicklung eines revolutionären Bewusstseins ihrer Totengräber!
Der Zusammenbruch der Internationale
Somit war der Weg zum Weltkrieg frei. Sein Ausbruch führte zum Auseinanderplatzen der Sozialistischen Internationale. Am Vorabend des Krieges organisierte die Sozialdemokratie noch Massenprotestdemonstrationen und Versammlungen in ganz Europa. Die SPD-Führung in Deutschland sandte Friedrich Ebert (einem der künftigen Mörder der Deutschen Revolution) mit dem Parteivermögen nach Zürich in die Schweiz, um dessen Beschlagnahmung zu verhindern, und den stets wankelmütigen Hugo Haase nach Brüssel, um den internationalen Widerstand gegen den Krieg zu organisieren. Doch es war eine Sache, sich dem Krieg entgegenzustellen, bevor er ausgebrochen war. Eine ganz andere war es, Stellung gegen ihn zu beziehen, war er einmal ausgebrochen. Und hier stellten sich die Gelübde der proletarischen Solidarität, auf dem internationalen Kongress in Stuttgart 1907 einmütig geleistet und 1912 in Basel erneuert, als bloße Lippenbekenntnisse heraus. Selbst einige linke Befürworter scheinbar radikaler Sofortaktionen gegen den Krieg - Mussolini in Italien, Hervé in Frankreich - wechselten nun ins Lager des Chauvinismus.
Jeder wurde von dem Ausmaß des Fiaskos der Internationale überrascht. Es ist allgemein bekannt, dass Lenin zunächst annahm, die Pro-Kriegs-Deklarationen der deutschen Parteipresse seien Polizeifälschungen, die darauf abzielten, die ausländische sozialistische Bewegung zu destabilisieren. Auch die Bourgeoisie schien von dem Ausmaß überrascht zu sein, in dem die Sozialdemokratie ihre Prinzipien verraten hatte. Sie hatte hauptsächlich damit gerechnet, dass die Gewerkschaften die ArbeiterInnen mobilisieren, und sie hatte am Vorabend des Kriegs Geheimvereinbarungen mit deren Führung erreicht. In einigen Ländern widersetzten sich jedoch wichtige Teile der Sozialdemokratie dem Krieg. Dies zeigt, dass die politische Öffnung für den Weg zum Krieg nicht automatisch bedeutete, dass die politischen Organisationen der Klasse Verrat begehen mussten. Um so auffälliger war das Versagen der Sozialdemokratie in den führend am Krieg beteiligten Nationen. In Deutschland schafften es in einigen Fällen auch die entschlossensten Kriegsgegner nicht, ihre Stimme zu erheben. In der parlamentarischen Reichtagsfraktion, in der 14 Mitglieder gegen die Kriegskredite stimmten und 78 dafür, unterwarf sich selbst Karl Liebknecht zunächst der traditionellen Parteidisziplin.
Wie war das zu erklären?
Zu diesem Zweck müssen wir natürlich zunächst die Ereignissein ihren historischen Kontext setzen. Hier sind die Veränderungen in den fundamentalen Bedingungen des Klassenkampfes durch den Eintritt in eine neue Epoche der Kriege und Revolutionen, des historischen Niedergangs des Kapitalismus entscheidend. Erst durch diesen historischen Zusammenhang können wir vollständig erfassen, dass das Überwechseln der Gewerkschaften in das Lager der Bourgeoisie historisch unvermeidbar war. Da diese Organe, Ausdrücke eines spezifischen, unreifen Niveaus des Klassenkampfes, naturgemäß niemals revolutionär waren, konnten sie in einer Epoche, in der eine effektive Verteidigung der unmittelbaren Interessen jeglichen Teils des Proletariats notwendigerweise auf die Revolution hinausläuft, nicht mehr ihrer ursprünglichen Klasse dienen und nur überleben, indem sie zum feindlichen Lage überliefen.
Doch was die Rolle der Gewerkschaften so vollständig erklärt, erweist sich bereits bei der Untersuchung des Falles der sozialdemokratischen Parteien als unvollständig. Es trifft zu, dass mit dem I. Weltkrieg diese Parteien ihr Gravitätszentrum, nämlich die Mobilisierungen für die Wahlen, verloren hatten. Es trifft ebenfalls zu, dass die veränderten Bedingungen den politischen Massenparteien des Proletariats allgemeinhin die Basis genommen hatten. Angesichts der Kriege wie auch der Revolutionen musste eine proletarische Partei nun in der Lage sein, auch gegen den Strom zu schwimmen und sich selbst der herrschenden Stimmung in der Klasse insgesamt zu widersetzen. Doch die Hauptaufgabe einer politischen Organisation des Proletariats - die Verteidigung seines Programms und besonders des proletarischen Internationalismus - änderte sich nicht in der neuen Epoche. Im Gegenteil, sie wurde noch wichtiger. Obwohl es also eine historische Notwendigkeit war, dass die sozialistischen Parteien in eine Krise stürzten und dass sogar ganze Strömungen, die vom Reformismus und Opportunismus verseucht waren, Verrat begehen und in der Bourgeoisie aufgehen, erklärt dies nicht vollständig das, was Rosa Luxemburg die „Krise der Sozialdemokratie" nannte.
Es ist auch wahr, dass ein solch fundamentaler historischer Wechsel notwendigerweise eine programmatische Krise auslöst; alte und bewährte Taktiken und sogar Prinzipien werden plötzlich out of date, wie die Teilnahme an den parlamentarischen Wahlen, die Unterstützung nationaler Bewegungen oder der bürgerlichen Revolution. Doch sollten wir hier im Kopf behalten, dass viele damalige Revolutionäre nichtsdestotrotz in der Lage waren, dem proletarischen Internationalismus treu zu bleiben, obwohl sie noch nicht diese politischen und taktischen Implikationen begriffen.
Jeder Erklärungsansatz, der allein von der Grundlage der objektiven Bedingungen ausgeht, wird darin enden, alles, was in der Geschichtepassiert, als von Anfang an unvermeidlich zu betrachten. Diese Betrachtungsweise stellt die Möglichkeit in Frage, von der Geschichte zulernen, da wir wiederum ebenfalls das Produkt unserer eigenen „objektiven Bedingungen" sind. Kein Marxist wird bei vollem Verstand die Wichtigkeit dieser objektiven Bedingungen bestreiten. Doch wenn wir die Erklärung untersuchen, die die damaligen Revolutionäre selbst für die Katastrophe des Sozialismus 1914hatten, entdecken wir, dass sie vor allem die Bedeutung der subjektiven Faktoren betonten.
Einer der Hauptgründe für den Niedergang der sozialistischen Bewegung lag in ihrem illusorischen Gefühl der Unbezwingbarkeit, ihrer irrigen Überzeugung in der Gewissheit ihres eigenen künftigen Triumphes. In der Zweiten Internationale basierte diese Überzeugung auf drei Entwicklungsbedingungen des Kapitalismus, die bereits von Marx ausgemacht worden waren. Diese waren: die Konzentration von Kapital und Produktivkräften einerseits und des besitzlosen Proletariats andererseits; die Eliminierung der gesellschaftlichen Zwischenschichten, die den Hauptwiderspruch zwischen den Klassen verwischen; und die wachsende Anarchie der kapitalistischen Produktionsweise, insbesondere in Gestalt der Wirtschaftskrisen, die die Totengräber des Kapitalismus dazu treiben, das System in Frage zu stellen. Diese Einsichten waren in sich selbstvollkommen schlüssig. Da diese drei Vorbedingungen für den Sozialismus das Produkt objektiver Widersprüche sind, die sich unabhängig vom Willen jeglicher Gesellschaftsklassen entfalten und sich langfristig unvermeidlich durchsetzen, führen sie zu zwei sehr problematischen Schlussfolgerungen. Erstens, dass der Triumph des Sozialismus unvermeidbar sei. Zweitens, dass sein Sieg nur verhindert werden könne, wenn die Revolution zu früh ausbräche, wenn die Arbeiterbewegung auf Provokationen hereinfiele.
Diese Schlussfolgerungen waren um so gefährlicher, als sie durchaus, aber nur teilweise zutrafen. Der Kapitalismus produziert unvermeidlicherweise die materiellen Vorbedingungen für die Revolution und für den Sozialismus. Und die Gefahr, von der herrschenden Klasse zu vorzeitigen Konfrontationen provoziert zu werden, ist eine reale. Wir werden die ganze tragische Bedeutung dieser Frage im dritten und vierten Teil dieser Artikelreihe sehen.
Doch das Problem mit diesem Schema der sozialistischen Zukunft besteht darin, dass es keinen Platz für das neue Phänomen der imperialistischen Kriege zwischen den modernen kapitalistischen Mächten ließ. Die ganze Frage des Weltkrieges passte nicht in dieses Schema. Wir haben bereits gesehen, dass die Arbeiterbewegung das unvermeidliche Heranreifen eines Krieges erkannt hatte, lange bevor er tatsächlich ausbrach. Doch für die Sozialdemokratie in ihrer Gesamtheit führte diese Erkenntnis überhaupt nicht zu der Schlussfolgerung, dass der Triumph des Sozialismus nicht mehr unvermeidbar war. Diese beiden Seiten in der Analyse der Wirklichkeit blieben in einer Weisegetrennt voneinander, die nahezu schizophren anmutet. Solch eine Unkohärenz ist, auch wenn sie fatal sein kann, keinesfalls unüblich. Viele der großen Krisen und Desorientierungen in der Geschichte der Arbeiterbewegung resultierten aus diesem Problem, in den Schemata der Vergangenheit eingesperrt zu sein, aus einem Bewusstsein, das hinter der Realität hinterherhinkte. Wir können das Beispiel der Unterstützung für die provisorische Regierung und die Fortsetzung des Krieges durch die bolschewistische Partei nach der Februarrevolution in Russland 1917 erwähnen. Die Partei ist dem Schema einerbürgerlichen Revolution zum Opfer gefallen, das aus dem Jahre 1905 stammte und seine Unzulänglichkeit im neuen Kontext des Weltkrieges enthüllte. Erst Lenins Aprilthesen und Wochen intensiver Diskussionen öffneten den Weg aus dieser Krise.
Friedrich Engels war kurz vor seinem Tode 1895 der erste, der die notwendigen Schlussfolgerungen aus der Perspektive eines allgemeinen Krieges in Europa zog. Er erklärte, dass sie die historische Alternative zwischen Sozialismus und Barbarei bedingt. Doch nicht einmal Engels konnte sofort alle Schlussfolgerungen aus dieser Einsicht ziehen. So gelang ihm nicht zuerkennen, dass das Erscheinen der oppositionellen Strömung „Die Jungen" in der SPD ein wahrhafter Ausdruck der gerechtfertigten Unzufriedenheit mit einem Handlungsrahmen (der sich vornehmlich auf den Parlamentarismus orientierte)war, der größtenteils unzureichend geworden war. Engels warf angesichts der letzten Krise der deutschen Partei sein ganzes Gewicht für jene in die Waagschale, die im Namen der Geduld und der Notwendigkeit, sich nicht provozieren zu lassen, die Aufrechterhaltung des Status quo der Parteiverteidigten.
Es war Rosa Luxemburg, die in ihrer Polemik gegen Bernstein zur Jahrhundertwende den entscheidenden Schluss aus Engels‘ Vision des„Sozialismus oder Barbarei" zog: Obwohl die Geduld eine der höchsten Tugenden der Arbeiterbewegung bleibt und vorzeitige Konfrontationen vermieden werden müssen, besteht die Hauptgefahr historisch nicht mehr darin, dass die Revolution zu früh kommt, sondern dass sie zu spät kommen könnte. Diese Auffassung legt die ganze Betonung auf die aktive Vorbereitung der Revolution, auf die zentrale Bedeutung des subjektiven Faktors.
Dieser Schlag gegen den Fatalismus, der dabei war, die Zweite Internationale zu beherrschen, diese Restaurierung des revolutionären Marxismus sollte zu einem der Kennzeichen der gesamten revolutionären Linken vor und während des I. Weltkrieges werden.2
Wie Rosa Luxemburg in ihrer „Krise der Sozialdemokratie" schrieb: „Der wissenschaftliche Sozialismus hat uns gelehrt, die objektiven Gesetze der geschichtlichen Entwicklung zu begreifen. Die Menschen machen ihre Geschichte nicht aus freien Stücken, aber sie machen sie selbst. Das Proletariat ist in seiner Aktion von dem jeweiligen Reifegrad der gesellschaftlichen Entwicklung abhängig, aber die geschichtliche Entwicklung geht nicht jenseits des Proletariats vor sich, es ist in gleichem Maße ihre Triebfeder und Ursache, wie es ihr Produkt und ihre Folge ist."
Eben weil sie die objektiven Gesetze der Geschichte entdeckt hatte, kann zum ersten Mal in der Geschichte eine gesellschaftliche Kraft - das klassenbewusste Proletariat - ihren Willen bewusst einsetzen. Das Proletariat kann nicht nur Geschichte machen, sondern auch bewusst ihren Verlaufbeeinflussen.
„Der Sozialismus ist die erste Volksbewegung der Weltgeschichte, die sich zum Ziel setzt, und von der Geschichte berufen ist, in das gesellschaftliche Tun der Menschen einen bewußten Sinn, einen planmäßigen Gedanken und damit den freien Willen hineinzutragen. Darum nennt Friedrich Engels den endgültigen Sieg des sozialistischen Proletariats einen Sprung der Menschheit aus dem Tierreich in das Reich der Freiheit. Auch dieser „Sprung" ist an eherne Gesetze der Geschichte, an Tausend Sprossen einer vorherigenqualvollen und allzu langsamen Entwicklung gebunden. Aber er kann nimmermehr vollbracht werden, wenn aus all dem von der Entwicklung zusammengetragenen Stoff der materiellen Vorbedingungen nicht der zündende Funke des bewussten Willens der großen Volksmasse aufspringt. Der Sieg des Sozialismus wird nicht wie Fatum vom Himmel herabfallen. Er kann nur durch eine lange Kette gewaltiger Kraftproben zwischen den alten und den neuen Mächten erkämpft werden, Kraftproben, in denen das internationale Proletariat unter der Führung der Sozialdemokratie lernt und versucht, seine Geschicke in die eigene Hand zunehmen, sich des Steuers des gesellschaftlichen Lebens zu bemächtigen, au seinem willenlosen Spielball der eigenen Geschichte zu ihrem zielklaren Lenker zu werden."3
Für den Marxismus gehören die Anerkennung der Bedeutung der objektiven historischen Gesetze und ökonomischen Widersprüchen - vom Anarchismus geleugnet oder ignoriert - sowie die subjektiven Elemente zusammen.4
Sie sind unzertrennbar miteinander verknüpft und beeinflussen sich gegenseitig. Wir können dies im Verhältnis zu den wichtigsten Faktoren beider allmählichen Unterminierung des proletarischen Lebens in der Internationalesehen. Einer dieser Faktoren war die Untergrabung der Solidarität innerhalb der Arbeiterbewegung. Dies wurde natürlich erheblich von der wirtschaftlichen Expansion vor 1914 und den reformistischen Illusionen, die dadurch erzeugt wurden, begünstigt. Doch es resultierte auch aus der Fähigkeit des Klassenfeindes, aus seiner Erfahrung zu lernen. Bismarck führte (zusammen mit seinen Sozialistengesetzen) das System der Sozialversicherungen ein, um die Solidarität unter den ArbeiterInnen durch ihre individuelle Abhängigkeit von dem, was später zum „Wohlfahrtsstaat" werden sollte, zu ersetzen. Und als Bismarcks Versuch scheiterte, die Arbeiterbewegung durch ihre Illegalisierung zu besiegen, änderte die imperialistische Bourgeoisie, die Ende des 19.Jahrhunderts seine Regierung ersetzte, ihre Taktik. Nachdem sie realisiert hatte, dass die Arbeitersolidarität unter Bedingungen der Repression oftmals geradezu aufblüht, zog sie die Sozialistengesetze zurück und lud stattdessen wiederholt die Sozialdemokratie dazu ein, „konstruktiv (...) am politischen Leben (d.h. an der Leitung des Staates) teilzunehmen", ja beschuldigte sie der„sektiererischen" Entsagung der „allein praktischen Mittel", um wirkliche Verbesserungen für die ArbeiterInnen zu erreichen.
Lenin wies auf die Verknüpfung zwischen der objektiven und subjektiven Ebene im Verhältnis zu einem anderen entscheidenden Faktor beim Verfall der großen sozialistischen Parteien hin. Dies war die Degradierung des Kampfes für die Befreiung der Menschheit zu einer leeren, tagtäglichen Routine. Er identifizierte drei Strömungen innerhalb der Sozialdemokratie und beleuchtete die zweite unter ihnen - „die zweite Strömung - das sogenannte „Zentrum" -besteht aus Leuten, die zwischen den Sozialchauvinisten und den wirklichen Internationalisten schwanken" (...) „Das „Zentrum" - das sind Leute der Routine, zerfressen von der faulen Legalität, korrumpiert durch die Atmosphäre des Parlamentarismus usw., Beamte, gewöhnt an warme Pöstchen und an „ruhige" Arbeit. Historisch und ökonomisch gesehen vertreten sie keine besondere Schicht, sie sind lediglich eine Erscheinung des Übergangs von der hinter uns liegenden Periode der Arbeiterbewegung, der Periode von 1871 bis1914 - (...) zu einer neuen Periode, die seit dem ersten imperialistischen Weltkrieg, der die Ära der sozialen Revolution eingeleitet hat, objektiv unumgänglich geworden ist"5
Für damalige Marxisten war die „Krise der Sozialdemokratie" nicht etwas, was außerhalb ihres Aktionsradius stand. Sie fühlten sich persönlich verantwortlich für das, was passiert war. Für sie war das Versagen der damaligen Arbeiterbewegung auch ihr eigenes Scheitern. Wie Rosa Luxemburg formulierte: Die Opfer des Krieges liegen auf unserem Gewissen.
Was den Kollaps der sozialistischen Internationale so bemerkenswert macht, ist, dass er nicht in erster Linie das Ergebnis der programmatischen Unzulänglichkeit oder einer falschen Analyse der Weltlage war.
„Nicht an Postulaten, Programmen, Losungen fehlt es dem internationalen Proletariat, sondern an Taten, an wirksamem Widerstand, an der Fähigkeit, den Imperialismus im entscheidenden Moment gerade im Kriege anzugreifen (...)"6
Für Kautsky hatte das Versagen, den Internationalismusaufrechtzuhalten, die Unmöglichkeit bewiesen, ihn tatsächlich zu praktizieren. Seine Schlussfolgerung: die Internationale ist eigentlich ein Instrument des Friedens, die in Kriegszeiten beiseite treten müsse. Für Rosa Luxemburg wie für Lenin war das Fiasko vom August 1914 vor allem das Resultat der Erosion der Ethik einer proletarischen internationalen Solidarität innerhalb ihrer Führung.
„Und dann kam das Unerhörte, das Beispiellose, der 4. August1914. Ob es so kommen mußte? Ein Geschehnis von dieser Tragweite ist gewiß kein Spiel des Zufalls. Es müssen ihm tiefe und weitgreifende objektive Ursachenzugrunde liegen. Aber diese Ursachen können auch in Fehlern der Führerin des Proletariats, der Sozialdemokratie, im Versagen unseres Kampfwillens, unseres Muts, unserer Überzeugungstreue liegen." (ebenda, S. 61)
II. Der Gezeitenwechsel
Der Kollaps der sozialistischen Internationale war ein Ereignis von historischem Rang und eine schreckliche politische Niederlage. Doch es war nicht die entscheidende, d.h. irreversible Niederlage einer ganzen Generation. Ein erstes Anzeichen dafür: die am meisten politisierten Schichtendes Proletariats hielten treu zum proletarischen Internationalismus. Richard Müller, Führer der Gruppe der Revolutionären Obleute, der Fabrikdelegierten in der Metallindustrie, erinnerte sich: „Soweit diese breiten Volkskreise bereits vor dem Krieg unter dem Einfluss der sozialistischen und gewerkschaftlichen Presse zu bestimmten Grundanschauungen über Staat und Gesellschaft erzogen worden waren, zeigte sich, wenn auch zunächst nicht offen, eine direkte Ablehnung der Kriegspropaganda und des Krieges"7 Dies stand in starkem Gegensatz zur Lage in den 1930er Jahren, nach dem Sieg des Stalinismus in Russland und des Faschismus in Deutschland, als die fortgeschrittensten ArbeiterInnen auf das politische Terrain des Nationalismus und der Verteidigung des(imperialistischen) „antifaschistischen" oder „sozialistischen" Vaterlandes gezogen wurden.
Die Vollständigkeit der anfänglichen Kriegsmobilisierung war also kein Beweis für eine schwere Niederlage, sondern eine zeitweilige Überrumpelung der Massen. Diese Mobilisierung wurde von Szenen der Massenhysterie begleitet. Doch diese Ausdrücke dürfen nicht mit einem aktiven Engagement der Bevölkerung verwechselt werden, wie in den Nationalkriegen der revolutionären Bourgeoisien in den Niederlanden und in Frankreich. Die intensive öffentliche Agitation von 1914 wurde zunächst einmal vom Massencharakter der modernen bürgerlichen Gesellschaft und von den beispiellosen Mitteln der Propaganda und Manipulation verursacht, die dem kapitalistischen Staat zur Verfügung stehen. In diesem Sinne war die Hysterie von 1914 nicht ganz neu. In Deutschland wurde dies bereits zurzeit des Deutsch-Französischen Krieges von 1870 beobachtet. Doch durch die Entwicklungen im Charakter der modernen Kriegsführung erhielt sie eine neue Qualität.
Der Irrsinn des imperialistischen Krieges
Es scheint, als habe die Arbeiterbewegung die Kraft des gigantischen politischen, wirtschaftlichen, sozialen und psychologischen Erdbebens unterschätzt, das durch den Weltkrieg ausgelöst wurde. Ereignisse von solch kolossalem Umfang und Gewalt, fern jeder Kontrolle irgendeiner menschlichen Kraft, müssen zwangsläufig extreme Emotionen schüren. Einige Anthropologen glauben, dass der Krieg den Instinkt wecke, das eigene „Reservat" zu verteidigen, etwas, was die Menschheit mit anderen Arten gemeinsam habe. Dies mag der Fall sein oder auch nicht. Sicher ist jedenfalls, dass der moderne Krieg uralte Ängste schürt, die in unserem kollektiven Gedächtnis schlummern, durch Tradition und Kultur über viele Generationen, bewusst oder unbewusst, weitergereicht: die Angst vor dem Tod, dem Verhungern, der Vergewaltigung, Vertreibung, Entbehrung, Versklavung. Die Tatsache, dass die moderne allgemeine imperialistische Kriegführung sich nicht mehr auf Berufssoldaten beschränkt, sondern die gesamte Gesellschaft miteinbezieht und Waffen von beispielloser zerstörerischer Kraft einsetzt, kann die Panik und Instabilität, die sie verursacht, nur steigern. Hinzugefügt werden sollten die tiefen moralischen Folgen. Im Weltkrieg wird nicht nur eine kleine Kaste von Soldaten von der Armee eingezogen, sondern Millionen von Arbeitern, die dazu aufgerufen werden, sich gegenseitig zu töten. Die restliche Gesellschaft, die „Heimatfront", wird dazu angehalten, für denselben Zweck zu arbeiten. In solch einer Situation findet die moralische Grundlage, die jede menschliche Gesellschaft erst möglich macht, keine Anwendung mehr. Wie Rosa Luxemburg sagte: „wie wenn nicht jedes Volk, das zum organisierten Mord auszieht, sich in demselben Augenblick in eine Horde Barbaren verwandelte"8
All dies produzierte in dem Moment, wo der Krieg ausbrach, eine wahrhafte Massenpsychose und eine allgemeine Pogromstimmung. Rosa Luxemburg schilderte, wie sich die Bevölkerungen ganzer Städte in einen verrückt gewordenen Mob verwandelten. Der Keim all der Barbarei des 20.Jahrhunderts, Auschwitz und Hiroshima eingeschlossen, war bereits in diesem Krieg enthalten.
Wie hätte die Arbeiterpartei auf den Kriegsausbruchreagieren sollen? Indem sie den Massenstreik ausrief? Indem sie die Soldaten dazu aufforderte zu desertieren? Unsinn, antwortete Rosa Luxemburg. Die erste Aufgabe von Revolutionären sei es hier, dem zu widerstehen, was Wilhelm Liebknecht einst bezüglich der Erfahrungen aus dem Krieg von 1870 einen Orkan menschlicher Leidenschaften nannte. „...
„Solche Ausbrüche der ‚Volksseele' haben durch ihre ungeheure Elementarkraft etwas Verblüffendes, Betäubendes, Erdrückendes. Man fühlte sich machtlos einer höheren Macht gegenüber - einer richtigen, jeden Zweifel ausschließenden force majeure. Man hat keinen greifbaren Gegner. Es ist wie eine Epidemie - in den Menschen, in der Luft, überall. (...) Aber eine Kleinigkeit war's nicht, damals gegen den Strom zu schwimmen".
1870 schwamm die Sozialdemokratie gegen den Strom. Rosa Luxemburgs Kommentar: „Sie blieben auf dem Posten, und die deutsche Sozialdemokratie zehrte 40 Jahre lang von der moralischen Kraft, die sie damals gegen eine Welt von Feinden aufgeboten hatte." (ebenda, S. 151).9
Und hier kommt sie zum Punkt, zum Herzstück ihrer ganzen Argumentation. „So wäre es auch diesmal gegangen. Im ersten Moment wäre vielleicht nichts anderes erreicht, als dass die Ehre des deutschen Proletariats gerettet war, als dass Tausende und Abertausende Proletarier, die jetzt in den Schützengräben bei Nacht und Nebel umkommen, nicht in dumpfer seelischer Verwirrung, sondern mit dem Lichtfunken im Hirn sterben würden, dass das, was ihnen im Leben das Teuerste war: die Internationale, Völker befreiende Sozialdemokratie kein Trugbild sei. Aber schon als ein mächtiger Dämpfer auf den chauvinistischen Rausch und die Besinnungslosigkeit der Menge hätte die mutige Stimme unserer Partei gewirkt, sie hätte die aufgeklärteren Volkskreise vor dem Delirium bewahrt, hätte den Imperialisten das Geschäft der Volksvergiftung und Volksverdummung erschwert. Gerade der Kreuzzug gegen die Sozialdemokratie hätte die Volksmassen am raschesten ernüchtert. So dann im weiteren Verlaufe des Krieges (...) würde alles Lebendige, Ehrliche, Humane, Fortschrittliche sich um die Fahne der Sozialdemokratie scharen" (ebenda, S.151, 152).
Die Erlangung dieser „enormen moralischen Autorität" ist die erste Aufgabe von Revolutionären im Falle eines Krieges.
Unmöglich für solche wie Kautsky, diese Sorge um die letzten Gedanken der sterbenden Proletarier in Uniform nachzuvollziehen. Für ihn wäre die Provozierung des wütenden Mobs und der staatlichen Repression, sobald der Krieg einmal ausgebrochen war, nichts anderes als eine leere Geste gewesen. Der französische Sozialist Jaurès erklärte einst: Die Internationale verkörperte die ganze moralische Stärke auf der Welt. Nun auf einmal wussten viele ihrer einstigen Führer nicht mehr, dass der Internationalismus keine leere Geste ist, sondern eine Überlebensfrage des Weltsozialismus.
Der Wendepunkt und die Rolle der Revolutionäre
Das Scheitern der sozialistischen Partei führte zu einerwahrhaft dramatischen Situation. Sein erstes Resultat: es ermöglichte eine schier unendliche Fortsetzung des Krieges. Die militärische Strategie der deutschen Bourgeoisie basierte voll und ganz auf der Vermeidung eines Zweifrontenkrieges, auf der Erzielung eines schnellen Sieges über Frankreich, um daraufhin all ihre Kräfte gen Osten zu werfen, um Russland in die Knie zu zwingen. Ihre Strategie gegen die Arbeiterklasse hatte dieselbe Grundlage: sie zu überrumpeln und den Krieg für sich zu entscheiden, bevor Letztere die Zeit hatte, ihre Orientierung wiederzuerlangen.
Ab dem September 1914 (der ersten Schlacht an der Marne) war das Überrennen Frankreichs und damit die ganze Strategie des schnellen Siegesvollständig gescheitert. Nicht nur die deutsche, sondern auch die Weltbourgeoisie war nun in ein Dilemma getappt, dem sie weder ausweichen nochüberwinden konnte. Daraus ergaben sich beispiellose Massaker an Millionen von Soldaten, was selbst vom kapitalistischen Standpunkt aus irrsinnig ist. Das Proletariat selbst war gefangen, ohne jegliche sofortige Perspektive, den Krieg durch eigene Initiative zu beenden. Die Gefahr, die sich somit daraus ergab, war die Zerstörung der bedeutendsten materiellen und kulturellen Vorbedingungen für den Sozialismus: das Proletariat selbst. Revolutionäre verhalten sich zu ihrer Klasse, wie sich ein Teil zum Ganzen verhält. Minderheiten der Klassen können nie die Selbstaktivität und die Kreativität der Massen ersetzen. Doch gibt es Augenblicke in der Geschichte, in denen die Intervention von Revolutionären einen entscheidenden Einfluss haben können. Solche Momente entstehen in einem Prozess hin zur Revolution, wenn die Massen um den Siegkämpfen. Hier ist es entscheidend, der Klasse dabei zu helfen, den richtigen Weg zu finden, die Fallen ihres Feindes zu umgehen, zu vermeiden, zu früh oder zu spät auf ihrem Rendezvous mit der Geschichte zu erscheinen. Doch sie entstehen auch in Momenten der Niederlage, wenn es lebenswichtig ist, die richtigen Lehren zu ziehen. Wir müssen hier jedoch differenzieren. Im Angesichteiner verheerenden Niederlage ist diese Arbeit nur langfristig bedeutsam, indem diese Lehren an künftige Generationen weitergereicht werden. Im Falle der Niederlage von 1914 war der entscheidende Einfluss, den Revolutionäre haben konnten, so unmittelbar wie während der Revolution selbst. Dies nicht nur, weil die erlittene Niederlage keine definitive war, sondern auch aufgrund der Bedingungen eines Weltkrieges, welche, indem sie den Klassenkampf fastbuchstäblich zu einer Überlebensfrage machten, eine außerordentliche Beschleunigung der Politisierung provozierten.
Angesichts des Kriegselends war es unvermeidbar, dass der wirtschaftliche Klassenkampf sich weiterentwickelte und unvermittelt einen offenpolitischen Charakter annahm. Doch die Revolutionäre konnten sich nicht damit zufrieden geben, darauf zu warten, was passiert. Die Orientierung der Klasse war, wie wir gesehen haben, vor allen Dingen das Ergebnis der Unterlassung ihrer politischen Führung. Es lag somit in der Verantwortung aller verbliebenen Revolutionäre innerhalb der Arbeiterbewegung, den Gezeitenwechsel zuinitiieren. Noch vor den Streiks an der „Heimatfront", noch vor den Revolten der Soldaten in den Schützengräben mussten die Revolutionäre hinausgehen und das Prinzip der internationalen Solidarität des Proletariats bekräftigen.
Sie begannen mit dieser Arbeit im Parlament, wo sie den Krieg anprangerten und gegen die Kriegskredite stimmten. Dies war das letzte Mal, dass diese Tribüne für revolutionäre Anliegen benutzt werden konnte. Doch war dies von Anfang an von illegaler revolutionärer Propaganda und Agitation sowie von der Beteiligung an den ersten Brotdemonstrationen begleitet. Doch die alles überragende Aufgabe der Revolutionäre war es noch immer, sich selbst zuorganisieren, um ihren Standpunkt zu klären, und vor allem den Kontakt zu anderen Revolutionären im Ausland wiederherzustellen, um die Gründung einerneuen Internationale vorzubereiten. Am 1. Mai 1916 fühlte sich jedoch der Spartakusbund, der Kern der künftigen Kommunistischen Partei, erstmals stark genug, um auf den Straßen offene und massive Präsenz zu zeigen. Es war der Tag, an dem die Arbeiterbewegung traditionellerweise ihre internationale Solidarität feiert. Der Spartakusbund rief zu Demonstrationen in Dresden, Jena, Hanau, Brunswick und vor allem in Berlin auf. Dort erschienen 10.000 Menschen auf dem Potsdamer Platz, um Liebknecht zu hören, der den imperialistischen Krieg anprangerte. Bei dem vergeblichen Versuch, ihn vor einer Festnahme zu schützen, kam es zu einer Straßenschlacht.
Die Proteste am 1. Mai auf dem Potsdamer Platz raubten der internationalistischen Opposition ihren bekanntesten Führer. Andere Inhaftierungen folgten. Liebknecht wurde beschuldigt, unverantwortlich gehandelt zu haben, ja beabsichtigt zu haben, seine Person ins Rampenlicht zustellen. In Wahrheit wurde seine Aktion am Maitag kollektiv von der Führung des Spartakusbundes beschlossen. Es trifft zu, dass der Marxismus leere Gesten wie den Terrorismus oder das Abenteurertum kritisiert. Worauf es ankommt, ist die kollektive Tat der Massen. Doch die Geste von Liebknecht war mehr als ein Akt des individuellen Heldentums. Sie verkörperte die Hoffnungen und Bestrebungen von Millionen von ProletarierInnen angesichts des Irrsinns der bürgerlichen Gesellschaft. Wie Rosa Luxemburg später schreiben sollte:
„Vergessen wir aber nicht: Weltgeschichte wird nicht gemacht ohne geistige Größe, ohne sittliches Pathos, ohne edle Geste"10
Dieser großartige Geist breitete sich rasch vom Spartakusbund auf die Metallarbeiter aus. 27. Juni 1916, Berlin, Höhepunkt des Prozesses gegen Karl Liebknecht, der wegen öffentlicher Agitation gegen den Krieg festgenommen worden war. Ein Treffen von Fabrikdelegierten wurde verschoben, es sollte nun nach der illegalen Protestdemonstration, zu der der Spartakusbund auf gerufen hatte, stattfinden. Auf der Tagesordnung: Solidarität mit Liebknecht. Gegen den Widerstand von Georg Ledebour, der einzige Repräsentant der Oppositionsgruppe innerhalb der Sozialdemokratischen Partei, wurden für den nächsten Tag weitere Aktionen vorgeschlagen. Es gab keine Diskussion. Jeder stand auf und ging schweigend.
Am nächsten Morgen schalteten um neun Uhr früh die Dreher ihre Maschinen in den großen Waffenfabriken des deutschen Kapitals ab. 55.000 Arbeiter von Löwe, AEG, Borsig, Schwartzkopf legten ihr Werkzeug nieder und versammelten sich außerhalb der Fabriktore. Trotz Militärzensur verbreiteten sich die Neuigkeiten wie ein Lauffeuer überall im Reich: die Rüstungsarbeiter aus Solidarität mit Liebknecht auf der Straße! Wie sich herausstellte, nicht nur in Berlin, sondern auch in Brunswick, auf den Schiffswerften in Bremen, etc. Selbst in Russland gab es Solidaritätsaktionen.
Die Bourgeoisie schickte Tausende von Streikenden an die Front. Die Gewerkschaften starteten auf ihrer Suche nach den „Rädelsführern" eine Hexenjagd in den Fabriken. Doch kaum einer von ihnen wurden eingesperrt, so groß war die Solidarität der ArbeiterInnen. Internationalistische proletarische Solidarität gegen imperialistischen Krieg: dies war der Beginn der Weltrevolution, der erste politische Massenstreik in der Geschichte Deutschlands.
Doch noch schneller griff die Flamme, die auf dem Potsdamer Platz entzündet wurde, auf die revolutionäre Jugend über. Inspiriert vom Beispiel ihrer politischen Führer, löste diese Jugend noch vor den erfahrenen Metallarbeitern den ersten großen Streik gegen den Krieg aus. In Magdeburg und vor allem in Brunswick, das eine Bastion von Spartakus war, eskalierten die illegalen Maiproteste zu einer offenen Streikbewegung gegen die Entscheidung der Regierung, einen Teil der Löhne für die Auszubildenden und JungarbeiterInnen auf ein Zwangskonto zu überweisen, das zur Finanzierung der Kriegsanstrengungen benutzt werden sollte. Die erwachsenen ArbeiterInnen kamen zur Unterstützung heraus. Am 5. Mai bliesen die Militärführer diesen Angriff ab, um eine weitere Ausdehnung der Bewegung zu verhindern.
Nach der Schlacht von Jütland 1916, der ersten und einzigen wichtigen Konfrontation zwischen der britischen und der deutschen Marine im gesamten Krieg, plante eine kleine Gruppe von revolutionären Matrosen, das Schlachtschiff „Hyäne" zu übernehmen und nach Dänemark zu bringen, als eine„Demonstration für die gesamte Welt" gegen den Krieg.11 Obgleich diese Pläne denunziert und durchkreuzt wurden, kündigten sie die ersten offenen Revolten in der Kriegsmarine an, die Anfang August 1917 folgten. Sie entzündeten sich um Fragen, die die Behandlung und die Bedingungen der Mannschaften betrafen. Doch bald schickten die Matrosen ein Ultimatum an die Regierung: Entweder beendet diese den Krieg, oder wir treten in den Streik. Der Staat antwortete mit einer Welle der Repression. Zwei der revolutionären Anführer, Albin Köbis und Max Reichpietsch, wurden hingerichtet.
Doch schon Mitte April 1917 hatte eine Welle von Massenstreiks in Berlin, Leipzig, Magdeburg, Halle, Brunswick, Hannover, Dresden und in anderen Städten stattgefunden. Obwohl die Gewerkschaften und die SPD-Führung, die es nicht mehr wagten, sich der Bewegung offen entgegenzusetzen, versuchten, sie auf wirtschaftliche Fragen zu begrenzen, formulierten die ArbeiterInnen in Leipzig eine Reihe von politischen Forderungen - insbesondere die Forderung nach Beendigung des Krieges -, die in anderen Städten aufgenommen wurden.
Somit waren zu Beginn des Jahres 1918 die Zutaten einerbreiten revolutionären Bewegung gegeben. Die Streikwelle vom April 1917 war die erste Massenintervention von Hunderttausenden von ArbeiterInnen quer durchs ganze Land, die ihre materiellen Interessen auf einem Klassenterrainverteidigten und sich dem imperialistischen Krieg offen widersetzten. Gleichzeitig war diese Bewegung vom Beginn der russischen Februarrevolution1917 inspiriert worden und erklärte offen ihre Solidarität mit ihr. Der proletarische Internationalismus hatte die Herzen der Arbeiterklasse erfasst.
Andererseits hatte das Proletariat mit der Bewegung gegen den Krieg wieder begonnen, seine eigene revolutionäre Führung zu schaffen. Damit meinen wir nicht nur die politischen Gruppen wie den Spartakusbund oder die Bremer Linken, die dazu übergingen, Ende des Jahres 1918 die KPD zugründen. Wir meinen damit auch das Auftreten von hochpolitisierten Schichten und Zentren des Lebens und Kampfes der Klasse, die mit den Revolutionärenverknüpft waren und mit ihren Positionen sympathisierten. Eines dieser Zentren war in den Industriestädten, insbesondere im Metallsektor, anzutreffen, dass ich an dem Phänomen der Obleute, den Fabrikdelegierten, kristallisierte: „Innerhalb der Industriearbeiterschaft befand sich ein kleiner Kern von Proletariern, die den Krieg nicht nur als solchen ablehnten, sondern auch willens waren, seinen Ausbruch mit allen Mitteln zu verhindern; und als der Krieg zur Tatsache geworden, hielten sie es für ihre Pflicht, mit allen Mitteln sein Ende herbeizuführen. Die Zahl war klein, um so entschlossener und rühriger waren die Personen. Hier fand sich das Gegenstück zu jenen, die an die Front zogen, um für ihre Ideale das Leben zu opfern. Der Kampf gegen den Krieg in Fabriken und Büros war zwar nicht so ruhmreich, wie der Kampf an der Front, aber mit gleichen Gefahren verbunden. Die den Kampf aufnahmen und führten, suchten die höchsten Menschheitsideale zu verwirklichen"12
Ein anderes Zentrum fand sich in der neuen Generation von ArbeiterInnen an, den Lehrlingen und JungarbeiterInnen, die keine andere Perspektive vor sich sahen, als zum Sterben in die Schützengräben geschickt zu werden. Der Kern dieses Gärungsprozesses befand sich in den sozialistischen Jugendorganisationen, die sich bereits vor dem Krieg durch die Revolte gegen die „Routine" auszeichneten, welche im Begriff war, die ältere Generation zu kennzeichnen.
Auch innerhalb der bewaffneten Kräfte, wo die Revolte gegen den Krieg viel länger als an der „Heimatfront" benötigte, um sich zu entwickeln, war ein politischer Vorposten etabliert worden. Wie in Russland entstand dieses politische Widerstandszentrum unter den Matrosen, die eine direkte Verbindung zu den ArbeiterInnen und den politischen Organisationen in ihren Heimathäfen hatten und deren Jobs und Bedingungen in jeder Weise jenen der FabrikarbeiterInnen ähnelten, von denen sie im allgemeinen herstammten. Darüber hinaus wurden viele von ihnen aus der „zivilen" Handelsflotte rekrutiert, junge Männer, die die ganze Welt bereist haben und für welche die internationale Brüderlichkeit nicht eine Phrase, sondern eine Lebensweise war.
Ferner war das Aufkommen und die Vervielfältigung dieser Konzentrationen von politischem Leben von einer intensiven theoretischen Tätigkeit geprägt. Alle Augenzeugenberichte aus dieser Periode betonen das außerordentlich hohe Niveau der Debatten auf den verschiedenen illegalen Treffen und Konferenzen. Dieses theoretische Leben fand seinen Ausdruck in Rosa Luxemburgs „Krise der Sozialdemokratie", in Lenins Schriften gegen den Krieg, in den Artikeln der Zeitschrift Arbeiterpolitik in Bremen, aber auch in der großen Anzahl von Flugblättern und Deklarationen, die in strengster Illegalität zirkulierten und zu den scharfsinnigsten und mutigsten Produkten der menschlichen Kultur zählen, die das 20. Jahrhundert emporgebracht hat.
Die Bühne war frei für den revolutionären Ansturm gegen eine der stärksten und wichtigsten Bastionen des Weltkapitalismus.
Steinklopfer
1 Beschluss des Mannheimer Parteikongresses von 1906.
2 In seinen Memoiren über die proletarische Jugendbewegung rief Willi Münzenberg, der sich während des Krieges in Zürich aufhielt, Lenins Standpunkt in Erinnerung: „Durch Lenin lernten wir die Fehler des von Kautsky und seiner theoretischen Schule verfälschten Marxismus kennen, der alles von der historischen Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse und fast nichts von den subjektiven Kräften zur Beschleunigung der Revolution erwartete. Im Gegensatz dazu betonte Lenin die Bedeutung des Individuums und der Masse im historischen Prozess und stellte die marxistische These in den Vordergrund, dass die Menschen im Rahmen der wirtschaftlich gegebenen Verhältnisse ihre Geschichte selbst machen. Diese Betonung des persönlichen Wertes der einzelnen Menschen und Gruppen in den gesellschaftlichen Kämpfen machte auf uns den größten Eindruck und spornte uns zu den denkbar stärksten Leistungen an" (Münzenberg, Die dritte Front, S. 230).
3„Die Krise der Sozialdemokratie", Luxemburg-Werke Bd4, S. 61, 62.
4 Während sie gegen Bernstein richtigerweise die Realität der Tendenzen zum Verschwinden der Mittelschichten und zur Krise und Pauperisierung des Proletariats vertrat, scheiterte die Linke jedoch daran, das Ausmaß zu erkennen, in dem der Kapitalismus in den Jahren vor dem I. Weltkrieg diese Tendenzen zeitweilig abzuschwächen in der Lage gewesen war. Dieser Mangel an Klarheit drückte sich in Lenins Theorie der„Arbeiteraristokratie" aus, der gemäß nur eine privilegierte Minderheit substanzielle Lohnerhöhungen über einen längeren Zeitraum hinweg erlangt hatte, nicht aber die breiten Massen der Klasse. Dies führte zur Unterschätzung der Bedeutung der materiellen Grundlage für die reformistischen Illusionen, die der Bourgeoisie halfen, das Proletariat für den Krieg zu mobilisieren.
5 Lenin, Die Aufgaben des Proletariats in unserer Revolution, Lenin Bd. 24., S. 61,62
6 Luxemburg, Die Krise der Sozialdemokratie(Junius-Broschüre), Januar 1916, ebenda, S. 159.
7 Richard Müller, Vom Kaiserreich zur Republik, S.32, Teil 1 der Trilogie von Müller über die Geschichte der Deutschen Revolution.
8 Ebenda, S. 162.
9 Ebenda, S. 317f.
10 Rosa Luxemburg, Eine Ehrenpflicht, Bd. 4, S. 406,November 1918,
11 Dieter Nelles, Proletarische Demokratie und internationale Bruderschaft - Das abenteuerliche Leben des Hermann Knüfken, S.1, https://www [80]. Anarchismus.at/txt5/nellesknuefken.htm
12 Müller, ebenda, S. 33.
Aktuelles und Laufendes:
Leute:
- Liebknecht [82]
- Luxemburg [83]
- Jogiches [84]
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Historische Ereignisse:
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Theoretische Fragen:
- Internationalismus [36]
Erbe der kommunistischen Linke:
Deutschland 1918 – 19, Teil 2 Vom Krieg zur Revolution
- 3743 reads
Im ersten Teil dieser Artikelreihe zum 90. Jahrestag des revolutionären Anlaufs des deutschen Proletariats untersuchten wir den welthistorischen Kontext, in dem sich die Revolution entfaltete. Dieser Kontext war die Katastrophe des I. Weltkrieges und das Scheitern der Arbeiterklasse und ihrer politischen Führung, diesen Ausbruch zu verhindern. Obgleich die frühen Jahre des 20. Jahrhunderts von ersten Manifestationen einer allgemeinen Tendenz
Im ersten Teil dieser Artikelreihe zum 90. Jahrestag des revolutionären Anlaufs des deutschen Proletariats untersuchten wir den welthistorischen Kontext, in dem sich die Revolution entfaltete. Dieser Kontext war die Katastrophe des I. Weltkrieges und das Scheitern der Arbeiterklasse und ihrer politischen Führung, diesen Ausbruch zu verhindern. Obgleich die frühen Jahre des 20. Jahrhunderts von ersten Manifestationen einer allgemeinen Tendenz zur Entwicklung von Massenstreiks gekennzeichnet waren, waren diese Bewegungen, abgesehen von Russland, noch nicht mächtig genug, um das Gewicht der reformistischen Illusionen zu untergraben. Was die organisierte internationalistische Arbeiterbewegung angeht, so stellte sie sich als theoretisch, organisatorisch und moralisch unvorbereitet gegenüber dem Weltkrieg dar, den sie lange zuvor vorausgesagt hatte. Als Gefangene ihrer eigenen Schemata der Vergangenheit, denen zufolge die proletarische Revolution ein mehr oder weniger unvermeidbares Produkt der wirtschaftlichen Entwicklung des Kapitalismus sei, hatten sie sich als eine Art zweite Natur die Behauptung zu Eigen machen, dass es die vorrangige Aufgabe der Sozialisten sei, verfrühte Konfrontationen zu vermeiden und passiv die Reifung der objektiven Bedingungen abzuwarten. Abgesehen von ihrer revolutionären linken Opposition scheiterte – oder weigerte sich – die Sozialistische Internationale, die Konsequenzen aus der Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, dass der erste Akt in der Niedergangsepoche des Kapitalismus ein Weltkrieg statt einer Wirtschaftskrise ist. Vor allem unterschätzte die Internationale, indem sie die Zeichen der Zeit, die Dringlichkeit der sich nähernden Alternative zwischen Sozialismus oder Barbarei, ignorierte, vollkommen den subjektiven Faktor in der Geschichte, insbesondere ihre eigene Rolle und Verantwortung. Das Resultat war der Bankrott der Internationale im Angesicht des Kriegsausbruchs und die chauvinistische Ekstase von Teilen ihrer Führung, insbesondere der Gewerkschaften. Die Bedingungen für den ersten Versuch einer weltweiten proletarischen Revolution wurden also von dem relativ plötzlichen, handstreichartigen Abstieg des Kapitalismus in seine Dekadenzphase, in den imperialistischen Weltkrieg bestimmt, aber auch von einer beispiellosen, katastrophalen Krise der Arbeiterbewegung. Es wurde bald deutlich, dass es keine revolutionäre Antwort auf den Krieg geben konnte ohne die Wiederbelebung der Überzeugung, dass der proletarische Internationalismus keine taktische Frage ist, sondern das „heiligste“ Prinzip des Sozialismus, das einzige „Vaterland“ der Arbeiterklasse (wie Rosa Luxemburg sagte). Wir sahen im vorhergegangenen Artikel, dass Karl Liebknechts öffentliche Erklärung gegen den Krieg am 1. Mai 1916 in Berlin so wie auch die internationalistischen Konferenzen wie jene in Zimmerwald und Kienthal und die weitverbreiteten Gefühle der Solidarität, die sie weckten, unerlässliche Wendepunkte auf dem Weg zur Revolution waren. Angesichts der Schrecken des Krieges in den Schützengräben und der Verarmung und intensivierten Ausbeutung der Arbeitermassen an der „Heimatfront“, die mit einem Schlag all die Errungenschaften von Jahrzehnten des Arbeiterkampfes wegwischten, sahen wir die Entwicklung von Massenstreiks und die Reifung von politisierten Schichten und Zentren der Arbeiterklasse, die in der Lage waren, einen revolutionären Sturm anzuführen. Die Verantwortung des Proletariats, den Krieg zu beendenDie Ursachen für das Scheitern der sozialistischen Bewegung angesichts des Krieges zu verstehen war somit das Hauptanliegen des vorherigen Artikels und auch eine wichtige Beschäftigung der Revolutionäre während der ersten Kriegsphase. Dies wird deutlich in Die Krise der Sozialdemokratie ausgedrückt, der sog. Junius-Broschüre von Rosa Luxemburg. Im Mittelpunkt der Ereignisse, mit denen sich dieser zweite Artikel befasst, finden wir eine zweite entscheidende Frage, eine Konsequenz aus der ersten: Welche gesellschaftliche Kraft bringt den Krieg zu einem Ende und auf welche Weise? Richard Müller, eine der Führer der „revolutionären Obleute“ in Berlin und später ein wichtiger Historiker der Revolution in Deutschland, formulierte die Verantwortung der Revolution damit, was sie verhindern soll: „Es war der Untergang der Kultur, die Vernichtung des Proletariats und der sozialistischen Bewegung überhaupt.“ [1]Wie so oft war es Rosa Luxemburg, die die welthistorische Frage damals am deutlichsten stellte: „Was nach dem Kriege sein wird, welche Zustände und welche Rolle die Arbeiterklasse erwarten, das hängt ganz davon ab, in welcher Weise der Friede zustande kommt. Erfolgt er bloß aus schließlicher allseitiger Erschöpfung der Militärmächte oder gar – was das Schlimmste wäre – durch den militärischen Sieg einer der kämpfenden Parteien, erfolgt er mit einem Worte ohne Zutun des Proletariats, bei völliger Ruhe im Innern des Staates, dann bedeutet ein solcher Frieden nur die Besiegelung der weltgeschichtlichen Niederlage des Sozialismus im Krieg (...) Nach dem Bankrott des 4. August 1914 ist also jetzt die zweite entscheidende Probe für den historischen Beruf der Arbeiterklasse: ob sie verstehen wird, den Krieg, dessen Ausbruch sie nicht verhindert hat, zu beenden, den Frieden nicht aus den Händen der imperialistischen Bourgeoisie als Werk der Kabinettdiplomatie zu empfangen, sondern ihn der Bourgeoisie aufzuzwingen, ihn zu erkämpfen.“[2]Hier beschreibt Rosa Luxemburg drei mögliche Szenarien, wie der Krieg ein Ende findet. Das erste ist der Ruin und die Erschöpfung der kriegführenden imperialistischen Parteien auf beiden Seiten. Hier erkennt sie von Anfang an die potenzielle Sackgasse der kapitalistischen Konkurrenz in der Epoche ihres historischen Niedergangs, die zu einem Prozess der Verrottung und Auflösung führen kann – wenn das Proletariat nicht in der Lage sein sollte, seine eigene Lösung durchzusetzen. Diese Tendenz zum Zerfall der kapitalistischen Gesellschaft sollte sich nur einige Jahrzehnte später völlig manifestieren, mit der „Implosion“ des von Russland angeführten Blocks und der stalinistischen Regimes 1989 sowie dem darauffolgenden Niedergang der Führerschaft der verbleibenden US-amerikanischen Supermacht. Sie realisierte bereits, dass solch eine Dynamik für sich genommen nicht günstig ist für die Entwicklung einer revolutionären Alternative. Das zweite Szenario besteht darin, dass der Krieg bis zum bitteren Ende ausgefochten wird und in einer totalen Niederlage einer der beiden sich gegenüberstehenden Blöcke endet. In diesem Fall wäre das wichtigste Ergebnis die unvermeidliche Spaltung innerhalb des siegreichen Lagers, die eine neue Front für einen zweiten, noch zerstörerischen Weltkrieg eröffnen würde, dem sich die Arbeiterklasse noch weniger entgegenstellen könnte. In beiden Fällen wäre das Resultat nicht eine momentane, sondern eine welthistorische Niederlage des Sozialismus zumindest für eine Generation, die langfristig die eigentliche Möglichkeit einer proletarischen Alternative zur kapitalistischen Barbarei untergraben könnte. Die damaligen Revolutionäre verstanden bereits, dass der „Große Krieg“ einen Prozess eingeleitet hatte, der das Potenzial hat, das Vertrauen der Arbeiterklasse in ihre eigene historische Mission zu unterminieren. Als solches bildet die „Krise der Sozialdemokratie“ eine Krise der menschlichen Gattung an sich, da nur das Proletariat innerhalb des Kapitalismus Geburtshelfer einer alternativen Gesellschaft ist. Die Russische Revolution und der Massenstreik im Januar 1918Was heißt es, den imperialistischen Krieg durch revolutionäre Mittel zu beenden? Die Augen der wahren Sozialisten der ganzen Welt richteten sich auf Deutschland, um diese Frage zu beantworten. Deutschland war die größte Wirtschaftsmacht in Kontinentaleuropa, der Führer – tatsächlich die einzige Großmacht – des einen der beiden konkurrierenden imperialistischen Blöcke. Und es war das Land mit der größten Anzahl von gebildeten, sozialistisch trainierten, klassenbewussten Arbeitern, die sich im Verlaufe des Krieges in wachsendem Maße für die Sache der internationalistischen Solidarität einsetzten. Doch die proletarische Bewegung ist von ihrem Wesen her international. Die erste Antwort auf die o.g. Frage wurde nicht in Deutschland, sondern in Russland gegeben. Die Russische Revolution von 1917 war ein Wendepunkt in der Weltgeschichte. Sie half auch die Situation in Deutschland umzuwandeln. Bis Februar 1917, dem Beginn der Erhebung in Russland, war es das Ziel der klassenbewussten deutschen Arbeiter, den Kampf bis zu einem Umfang auszuweiten, der die Regierungen dazu zwingt, den Frieden herbeizuführen. Selbst innerhalb des Spartakusbundes[3] zum Zeitpunkt seiner Gründung am Neujahrstag 1916 hatte niemand an die Möglichkeit einer direkten Revolution geglaubt. Doch im Lichte der russischen Erfahrungen waren ab April 1917 die klandestinen revolutionären Zirkel in Berlin und Hamburg zur Schlussfolgerung gelangt, dass das Ziel nicht nur darin bestand, den Krieg zu beenden, sondern auch darin, dabei gleich auch das gesamte Regime zu stürzen. Bald klärte der Sieg der Revolution in Petrograd und Moskau im Oktober 1917 für diese Zirkel in Berlin und Hamburg weniger das Ziel als vielmehr die Mittel zu diesem Zweck: bewaffneter Aufstand, von den Arbeiterräten organisiert und angeführt. Paradoxerweise bewirkte der Rote Oktober in den breiten Massen in Deutschland unmittelbar so ziemlich das Gegenteil. Eine Art unschuldige Euphorie über das Nahen des Friedens brach aus, gestützt auf der Annahme, dass die deutsche Regierung nichts anderes machen könne, als in die Hand des „Friedens ohne Annexionen“ einzuschlagen, die vom Osten ausgestreckt wurde. Diese Reaktion zeigt, in welchem Umfang die Propaganda der zur „sozialistischen“ kriegstreiberischen Partei gewordenen SPD – dass der Krieg einem sich sträubenden Deutschland aufgehalst wurde -, immer noch Einfluss ausübte. Was die Volksmassen betraf, so kam der Wendepunkt in der Haltung gegenüber dem Krieg, der von der Russischen Revolution ausgelöst wurde, erst drei Monate später mit den Friedensverhandlungen zwischen Deutschland und Russland in Brest-Litowsk.[4] Diese Verhandlungen wurden von den Arbeitern in ganz Deutschland und im österreichisch-ungarischen Reich intensiv verfolgt. Das Resultat – das imperialistische Diktat Deutschlands und seine Besetzung großer Teile der westlichen Gebiete der späteren Sowjetrepublik, wobei es die dortigen im Gange befindlichen revolutionären Bewegungen grausam unterdrückte – überzeugte Millionen von der Richtigkeit des Schlachtrufs von Spartakus: Der Feind sitzt im „eigenen Land“, es ist das kapitalistische System selbst. Brest verhalf einem gigantischen Massenstreik zum Leben, der in Österreich-Ungarn begann, mit seinem Zentrum in Wien. Er breitete sich sofort auf Deutschland aus und lähmte das Wirtschaftsleben in über zwanzig größeren Städten, mit einer halben Million Streikenden in Berlin. Die Forderungen waren dieselben wie die der Sowjetdelegation in Brest: sofortige Beendigung des Krieges, keine Annexionen. Die Arbeiter organisierten sich selbst mittels eines Systems gewählter Delegationen, die größtenteils den konkreten Vorschlägen eines Flugblatts des Spartakusbundes folgten, welche die Lehren aus Russland zogen. Der Augenzeugenbericht der SPD-Tageszeitung Vorwärts, für die Ausgabe vom 28. Januar 1918 verfasst, schilderte, wie die Straßen an jenem Morgen erst wie ausgestorben wirkten und in Nebel gehüllt waren, so dass die Umrisse der Gebäude, ja der ganzen Welt vage und verzerrt erschienen. Als die Massen in stiller Entschlossenheit auf die Straßen gingen, kam die Sonne hervor und vertrieb den Nebel, schrieb der Reporter.
Spaltungen und Divergenzen innerhalb der Streikführung
This strike gave rise to a debate within the revolutionary leadership about the immediate goals of the movement, but which increasingly touched the very heart of the question of how the proletariat could end the war. The main centre of gravity of this leadership lay at the time within the left wing of the social-democracy which, after being excluded from the SPD[5] because of its opposition to the war, formed a new party, the USPD (the "Independent" SPD). This party, which brought together most of the well known opponents to the betrayal of internationalism by the SPD - including many hesitant and wavering, more petty bourgeois than proletarian elements - also included a radical revolutionary opposition of its own, the Spartakusbund: a fraction with its own structure and platform. Already in the summer and autumn of 1917 the Spartakusbund and other currents within the USPD began to call for protest demonstrations in response to mass discontent and growing enthusiasm for the revolution in Russia. This orientation was opposed by the Obleute, the "revolutionary delegates" in the factories, whose influence was particularly strong in the armaments industry in Berlin. Pointing to the masses' illusions about the "will for peace" of the German government, these circles wanted to wait until discontent became more intense and generalised, and then give it expression in a single, unified mass action. When, during the first days of 1918, calls for a mass strike from factories all over Germany were reaching Berlin, the Obleute decided not to invite the Spartakusbund to the meetings where this central mass action was prepared and decided on. They feared that what they called the "activism" and "precipitation" of Spartakus - which in their eyes had become dominant in this group since its main theoretical mind, Rosa Luxemburg, had been sent to prison - could constitute a danger to the launching of a unified action throughout Germany. When the Spartakists found out about this, they launched a summons to struggle of their own, without waiting for the decision of the Obleute.
This mutual distrust then intensified in relation to the attitude to be adopted towards the SPD. When the trade unions discovered that a secret strike leadership committee had been constituted, which did not contain a single member of the SPD, the latter immediately began to clamour for representation. On the eve of the January 28 strike action, the majority at a clandestine meeting of factory delegates in Berlin voted against this. Nevertheless, the Obleute, who dominated the strike committee, decided to admit delegates of the SPD, arguing that the social-democrats were no longer in a position to prevent the strike, but that their exclusion would create a note of discord and thus undermine the unity of the coming action. Spartakus strongly condemned this decision.
The debate then came to a head in the course of the strike itself. In face of the elementary might of this action, the Spartakusbund began to plead for the intensification of the movement in the direction of civil war. The group believed that the moment might already have come to end the war by revolutionary means. The Obleute strongly opposed this, preferring to take responsibility themselves for an organised ending of the movement, once it had reached what they considered to be its culmination point. Their main arguments were that an insurrectional movement, even were it to succeed, would remain restricted to Berlin, and that the soldiers had not yet been won over to the side of the revolution.
Der Platz Russlands und Deutschlands in der Weltrevolution
Hinter diesem Streit über die Taktik steckten zwei allgemeinere und tiefergehende Fragen. Eine von ihnen betraf die Kriterien, um über die Reife der Bedingungen für einen revolutionären Aufstand zu urteilen. Wir werden im Verlauf dieser Reihe auf die Frage zurückkommen. Die andere bezog sich auf die Rolle des russischen Proletariats in der Weltrevolution. Konnte der Sturz der bürgerlichen Herrschaft in Russland sofort eine revolutionäre Erhebung in Mittel- und Westeuropa anregen oder zumindest die imperialistischen Hauptprotagonisten dazu zwingen, den Krieg zu beenden? Genau dieselbe Diskussion fand auch in der bolschewistischen Partei in Russland statt, sowohl am Vorabend des Oktoberaufstandes als auch anlässlich der Friedensverhandlungen mit der deutschen Reichsregierung in Brest-Litowsk. Innerhalb der bolschewistischen Partei argumentierten die von Bucharin angeführten Gegner jeglicher Vertragsunterzeichnung mit Deutschland, dass das Hauptmotiv des Proletariats, im Oktober 1917 die Macht in Russland zu ergreifen, darin bestand, die Revolution in Deutschland und im Westen loszutreten, und dass die Unterzeichnung eines Vertrages mit Deutschland nun gleichbedeutend mit der Abkehr von dieser Orientierung sei. Trotzki nahm eine Zwischenposition ein, um Zeit zu schinden, was das Problem auch nicht wirklich löste. Die Befürworter der Notwendigkeit der Unterzeichnung eines Vertrages, wie Lenin, stellten keineswegs die internationalistische Motivierung des Oktoberaufstandes in Frage. Was sie bezweifelten, war, dass die Entscheidung, die Macht zu ergreifen, sich auf der Annahme stützte, dass die Revolution sofort auf Deutschland übergreifen werde. Im Gegenteil: die Befürworter des Aufstandes hatten damals darauf hingewiesen, dass die unmittelbare Ausdehnung der Revolution nicht gewiss war und dass das russische Proletariat somit Isolation und beispiellose Leiden riskiert, wenn es die Initiative ergreift und die Weltrevolution beginnt. Solch ein Risiko war jedoch, wie insbesondere Lenin argumentierte, gerechtfertigt, weil das, was auf dem Spiel stand, die Zukunft nicht nur des russischen, sondern auch des Weltproletariats war; die Zukunft nicht nur des Proletariats, sondern der gesamten Menschheit. Diese Entscheidung sollte daher in vollem Bewusstsein und in verantwortlichster Weise getroffen werden. Lenin wiederholte diese Argumente auch in Bezug auf Brest: Das russische Proletariat war moralisch berechtigt, selbst den ungünstigsten Vertrag mit der deutschen Bourgeoisie zu unterzeichnen, um Zeit zu gewinnen, da es nicht sicher war, ob die deutsche Revolution sofort beginnen wird. Isoliert in ihrer Gefängniszelle vom Rest der Welt, intervenierte Rosa Luxemburg in dieser Debatte mit drei Artikeln – „Die historische Verantwortung“, „In die Katastrophe“ und „Die russische Tragödie“; geschrieben im Januar, Juni und September in dieser Reihenfolge -, die drei der wichtigsten berühmten „Spartakusbriefe“ aus dem Untergrund. Hier macht sie klar, dass weder die Bolschewiki noch das russische Proletariat wegen der Tatsache angeklagt werden dürfen, dass sie gezwungen wurden, einen Vertrag mit dem deutschen Imperialismus zu unterzeichnen. Diese Situation war das Resultat der Abwesenheit der Revolution anderswo, besonders aber in Deutschland. Auf dieser Grundlage war sie in der Lage, das folgende tragische Paradoxon zu identifizieren: Obwohl die Russische Revolution der höchste Punkt war, den die Menschheit bis dahin jemals erklommen hatte, und als solcher ein historischer Wendepunkt war, bestanden ihre unmittelbaren Auswirkungen nicht darin, die Schrecken des Weltkrieges zu verkürzen, sondern zu verlängern. Und dies aus dem einfachen Grund, dass sie den deutschen Imperialismus von dem Zwang befreite, einen Zweifrontenkrieg zu führen. Wenn Trotzki an die Möglichkeit eines Sofortfriedens unter dem Druck der Massen im Westen glaubt, so schreibt sie im Januar 1918, „dann muss allerdings in Trotzkis schäumenden Wein viel Wasser gegossen werden.“ Und sie fährt fort: „Die nächste Wirkung des Waffenstillstandes im Osten wird nur die sein, daß deutsche Truppen vom Osten nach dem Westen dirigiert werden. Vielmehr, sie sind es schon.“[6] Im Juni zog sie eine zweite Schlussfolgerung aus dieser Dynamik: Deutschland war zum Gendarm der Konterrevolution in Osteuropa geworden und massakrierte die revolutionären Kräfte von Finnland bis zur Ukraine. Wie gelähmt durch diese Entwicklung, hatte sich das Proletariat „tot gestellt.“. Im September 1918 erläutert sie dann, dass die Welt damit droht, das revolutionäre Russland selbst zu verschlingen. „Der eherne Ring des Weltkrieges, der damit im Osten durchbrochen schien, schließt sich wieder um Rußland und um die Welt lückenlos: Die Entente rückt mit Tschechoslowakei und Japanern vom Norden und Osten her – eine natürliche, unvermeidliche Folge des Vorrückens Deutschland vom Westen und vom Süden aus. Die Flammen des Weltkrieges züngeln auf russischen Boden hinüber und werden im nächsten Augenblick über der russischen Revolution zusammenschlagen. Sich dem Weltkriege – und sei es um den Preis der größten Opfer – zu entziehen erweist sich letzten Endes für Rußland allein unmöglich.“[7]Rosa Luxemburg erkennt deutlich, dass der unmittelbare militärische Vorteil, den Deutschland durch die Russische Revolution erlangt hatte, einige Monate lang dazu beitragen werde, das Kräfteverhältnis zwischen den Klassenkräften in Deutschland zugunsten der Bourgeoisie zu kippen. Obwohl die Revolution in Russland die deutschen Arbeiter inspirierte, obwohl der „Raubfrieden“, der nach Brest vom deutschen Imperialismus durchgesetzt wurde, diesen Arbeitern viele ihrer Illusionen beraubte, dauerte es noch fast ein Jahr, bis dies zu einer offenen Rebellion gegen den Imperialismus reifte. Der Grund hat etwas mit dem spezifischen Charakter einer Revolution im Kontext eines Weltkrieges zu tun. Der „Große Krieg“ 1914 war nicht nur ein Gemetzel in einem Ausmaß, das bis dahin unbekannt war; er war auch die gigantischste organisierte ökonomische, materielle und menschliche Operation in der Geschichte bis dahin. Buchstäblich Millionen von Menschen wie auch alle Ressourcen der Gesellschaften waren Zahnräder in einer infernalischen Maschinerie, eine Größenordnung, die jegliche menschliche Vorstellung übertraf. All dies löste zwei intensive Gefühle innerhalb des Proletariats aus: Hass gegen den Krieg auf der einen Seite und ein Gefühl der Machtlosigkeit auf der anderen. Unter solchen Umständen erfordert es unermessliche Leiden und Opfer, ehe die Arbeiterklasse erkennen kann, dass sie allein die Kraft ist, die den Krieg beenden kann. Darüber hinaus erfordert dieser Prozess Zeit und entfaltet sich auf ungleichmäßige, heterogene Weise. Zwei der wichtigsten Aspekte dieses Prozesses sind die Erkenntnis über die wahren, räuberischen Motive der imperialistischen Kriegsanstrengungen sowie über die Tatsache, dass die Bourgeoisie selbst die Kriegsmaschinerie nicht kontrolliert, die als Produkt des Kapitalismus unabhängig vom menschlichen Willen geworden ist. In Russland 1917 wie auch in Deutschland und Österreich-Ungarn 1918 stellte sich die Erkenntnis, dass die Bourgeoisie nicht imstande war, den Krieg zu beenden, selbst wenn sie sich einer Niederlage gegenübersieht, als entscheidend heraus. Was Brest-Litowsk und die Grenzen des Massenstreiks in Deutschland und Österreich-Ungarn im Januar 1918 enthüllten, war vor allem dies: dass die Weltrevolution von Russland initiiert werden kann, dass jedoch nur eine entscheidende proletarische Aktion in einem der kriegführenden Hauptländer – Deutschland, Großbritannien oder Frankreich – den Krieg anhalten konnte. Der Wettlauf zur Beendigung des KriegesObwohl sich das deutsche Proletariat „tot stellte“, wie Rosa Luxemburg es nannte, setzte sich der Reifungsprozess seines Klassenbewusstseins während der ersten Hälfte des Jahres 1918 fort. Darüber hinaus begannen die Soldaten ab dem Sommer dieses Jahres zum erstenmal ernsthaft vom Bazillus der Revolution infiziert zu werden. Zwei Faktoren trugen besonders dazu bei. In Russland wurden die gefangenen deutschen Soldaten freigelassen und vor die Wahl gestellt, in Russland zu bleiben, um an der Revolution teilzunehmen, oder nach Deutschland zurückzukehren. Jene, die den zweiten Weg wählten, wurden selbstverständlich von der deutschen Armee sofort wieder als Kanonenfutter zurück an die Front geschickt. Doch sie trugen die Neuigkeiten von der Russischen Revolution mit sich. In Deutschland selbst wurden Tausende von Führern des Massenstreiks im Januar bestraft, indem sie an die Front geschickt wurden, wo sie die Nachrichten von der wachsenden Revolte der Arbeiterklasse gegen den Krieg weitergaben. Doch letztendlich war es die wachsende Erkenntnis von der Sinnlosigkeit des Krieges und der Unvermeidlichkeit der Niederlage Deutschlands, die sich als entscheidend für den Stimmungswechsel in der Armee erwies. Im Herbst jenes Jahres begann also etwas, was noch einige Monate zuvor als undenkbar erschien: ein Wettlauf gegen die Zeit zwischen den klassenbewussten Arbeitern einerseits und den Führern der deutschen Bourgeoisie auf der anderen, um zu bestimmen, welche von den beiden großen Klassen der modernen Gesellschaft dem Krieg ein Ende bereiten wird. Auf Seiten der herrschenden Klasse Deutschlands mussten zwei wichtige Probleme in ihren eigenen Reihen gleich zu Anfang gelöst werden. Eines von ihnen war die völlige Unfähigkeit vieler ihrer Repräsentanten, die Möglichkeit einer Niederlage, die ihnen ins Gesicht starrte, auch nur in Erwägung zu ziehen. Das andere war, wie man einen Frieden erwirken kann, ohne das eigentliche Zentrum ihres eigenen Staatsapparates irreparabel zu diskreditieren. Was die letzte Frage anbetrifft, so müssen wir uns vergegenwärtigen, dass in Deutschland die Bourgeoisie an die Macht getragen wurde und das Land nicht durch eine Revolution von unten, sondern durch das Militär, an erster Stell durch die königliche preußische Armee, vereint wurde. Wie konnte man die Niederlage eingestehen, ohne diesen Pfeiler, dieses Symbol der nationalen Stärke und Einheit in Frage zu stellen? 15. September: die westlichen Alliierten durchbrachen die österreichisch-ungarische Front auf dem Balkan. 27. September: Bulgarien, ein wichtiger Verbündeter Berlins, kapitulierte. 29. September: der Chef der deutschen Armee, Erich Ludendorff, informierte das Oberkommando, dass der Krieg verloren sei, dass es nur noch eine Frage von Tagen oder gar Stunden sei, ehe die gesamte militärische Front zusammenbrach. Tatsächlich war die Schilderung der unmittelbaren Frontlage durch Ludendorff etwas übertrieben. Wir wissen nicht, ob er selbst in Panik geriet oder ob er bewusst ein Bild zeichnete, das dunkler war als die Realität, um die deutsche Führung zu veranlassen, seine Vorschläge zu akzeptieren. Jedenfalls wurden seine Vorschläge angenommen: Kapitulation und Installierung einer parlamentarischen Regierung. Mit dieser Vorgehensweise wollte Ludendorff einer totalen deutschen Niederlage zuvorkommen und der Revolution den Wind aus den Segeln nehmen. Doch er hatte noch ein weiteres Ziel in den Augen. Er wollte, dass die Kapitulation von einer zivilen Regierung erklärt wird, so dass das Militär weiterhin seine Niederlage in der Öffentlichkeit leugnen konnte. Er bereitete das Terrain der Dolchstoßlegende vor, dem Mythos vom „Messer in den Rücken“, dem zufolge eine siegreiche deutsche Armee von einem verräterischen Feind hinter den Linien bezwungen wurde. Doch dieser Feind, das Proletariat, konnte natürlich nicht beim Namen genannt werden. Dies würde die wachsende Kluft, die Bourgeoisie und Proletariat trennt, zementieren. Aus diesem Grund musste ein Sündenbock gefunden werden, den man anklagen konnte, die Arbeiter „verleitet“ zu haben. Angesichts der spezifischen Geschichte der westlichen Zivilisation in den vergangenen zweitausend Jahren war das geeignetste Opfer dieser Sündenbock-Suche schnell an der Hand: die Juden. Es war also jener Antisemitismus, der bereits in den Jahren vor dem großen Krieg auf dem Aufstieg war, vor allem im Russischen Reich, und der auf die Hauptbühne der europäischen Politik zurückgekehrt war. Der Weg nach Auschwitz beginnt hier. Oktober 1918: Ludendorff und Hindenburg forderten ein sofortiges Friedensangebot an die Entente[8]. Zur gleichen Zeit rief eine nationale Konferenz der kompromisslosesten revolutionären Gruppierungen, der Spartakusbund und die Bremer Linken, zu einer forcierten Agitation unter den Soldaten und für die Bildung von Arbeiterräten auf. Zu dieser Zeit befanden sich Hunderttausende von desertierenden Soldaten auf der Flucht von der Front. Und, wie der Revolutionär Paul Frölich später schreiben sollte (in seiner Biographie von Rosa Luxemburg), es gab ein neues Verhalten der Massen, das an ihren Augen abgelesen werden konnte. Innerhalb des Lagers der Bourgeoisie wurden die Bemühungen, den Krieg zu beenden, von zwei neuen Faktoren aufrechterhalten. Keiner der unbarmherzigen Führer des deutschen Staates, die nie zögerten, Millionen ihrer eigenen „Subjekte“ in den sicheren wie sinnlosen Tod zu schicken, hatte den Mut, Kaiser Wilhelm II. darüber zu informieren, dass er von seinem Thron zurücktreten muss. Denn eine andere, opponierende Seite im imperialistischen Krieg dachte sich weiterhin neue Ausreden aus, um den Waffenstillstand zu verschieben, da sie noch nicht von der unmittelbaren Wahrscheinlichkeit der Revolution und der Gefahr, die dies für ihre eigene Herrschaft bedeutete, überzeugt war. Die Bourgeoisie verlor Zeit. Doch nichts davon hinderte sie daran, eine blutige Repression gegen die revolutionären Kräfte vorzubereiten. Insbesondere hatte sie bereits jene Teile der Armee auserwählt, die nach ihrer Rückkehr von der Front dazu benutzt werden konnten, die wichtigsten Städte zu besetzen. Innerhalb des Lagers des Proletariats bereiteten die Revolutionäre immer intensiver einen bewaffneten Aufstand vor, um den Krieg zu beenden. Die Obleute in Berlin setzten erst den 4. November, dann den 11. November als Tag des Aufstandes fest. Doch in der Zwischenzeit nahmen die Ereignisse eine Wendung, die weder die Bourgeoisie noch das Proletariat erwartet hatte und die einen großen Einfluss auf den Verlauf der Revolution ausübte. Meuterei in der Marine, Auflösung der ArmeeUm die Bedingungen für einen Waffenstillstand zu erfüllen, die mit ihren Kriegsgegnern vereinbart worden waren, stoppte die Regierung in Berlin am 20. Oktober alle Militäroperationen der Marine, insbesondere die Untersee-Kriegführung. Eine Woche später erklärte sie ihre Bereitschaft, einem Waffenstillstand ohne Bedingungen zuzustimmen. Angesichts dieses Beginns vom Ende drehten Offiziere der Kriegsflotte an der norddeutschen Küste durch. Oder vielmehr trat die Verrücktheit ihrer uralten Kaste – die Verteidigung der Ehre, der Tradition des Duells, der Forderung bzw. Gewährung von „Satisfaktion“ – durch den Irrsinn des modernen imperialistischen Krieges an die Oberfläche. Hinter dem Rücken ihrer eigenen Regierung beschlossen sie, mit der Kriegsflotte zu einer großen Seeschlacht gegen die britische Navy auszulaufen, auf die sie vergeblich während des Krieges gewartet hatte. Sie zogen es vor, in Ehre zu sterben, statt sich ohne Schlacht zu ergeben. Sie nahmen an, dass die Matrosen und die Mannschaften – 80.000 Leben zusammen – unter ihrem Kommando bereit wären, ihnen zu folge[9].Dies war jedoch nicht der Fall. Die Mannschaften meuterten gegen ihre Kommandierenden. Mindest einige von ihnen starben dabei. In einem dramatischen Moment richteten Schiffe, die von ihren Mannschaften übernommen worden waren, und Schiffe, auf denen dies (noch) nicht der Fall war, ihre Geschütze aufeinander. Schließlich ergaben sich die Meuterer, wahrscheinlich, um zu vermeiden, auf ihre eigenen Gefährten zu schießen. Doch dies war es noch nicht, was die Revolution in Deutschland ins Rollen brachte. Was entscheidend war, war, dass ein Teil der inhaftierten Matrosen als Häftlinge nach Kiel gebracht wurde, wo sie wahrscheinlich als Verräter zum Tode verurteilt werden sollten. Die anderen Matrosen, die nicht den Mut beessen hatten, sich der ursprünglichen Rebellion auf offener See anzuschließen, drückten nun furchtlos ihre Solidarität mit ihren Kameraden aus. Doch vor allem kam in Solidarität mit ihnen auch die Arbeiterklasse von Kiel heraus und verbrüderte sich mit den Matrosen. Der Sozialdemokrat Noske, der entsandt wurde, um die Erhebung gnadenlos niederzuschlagen, traf in Kiel am 4. November ein, um die Stadt in den Händen bewaffneter Arbeiter, Matrosen und Soldaten vorzufinden. Darüber hinaus hatten bereits Massendelegationen Kiel in alle Richtungen verlassen, um die Bevölkerung zur Revolution aufzufordern, wobei sie sehr gut wussten, dass sie eine Schwelle überschritten hatten, nach der es keinen Rückweg mehr gibt: Sieg oder sicherer Tod. Noske war völlig überrascht, sowohl von der Geschwindigkeit der Ereignisse als auch von der Tatsache, dass die Rebellen von Kiel ihn als einen Held begrüßten[10].Unter den Hammerschlägen dieser Ereignisse löste sich die mächtige deutsche Militärmaschinerie letztendlich auf. Die Divisionen, die aus Belgien zurückfluteten und mit denen die Regierung bei der „Wiederherstellung der Ordnung“ in Köln geplant hatte, desertierten. Am Abend des 8. November wandten sich alle Blicke nach Berlin, dem Sitz der Regierung und dem Ort, wo die bewaffneten Kräfte der Konterrevolution hauptsächlich konzentriert waren. Es ging das Gerücht herum, dass die Entscheidungsschlacht am nächsten Tag in der Hauptstadt ausgetragen werde. Richard Müller, Führer der Obleute in Berlin, erinnerte später daran. „Am 8. November abends stand ich am Halleschen Tor[11]. Schwer bewaffnete Infanteriekolonnen, Maschinengewehr-Kompanien und leichte Feldartillerie zogen in endlosen Zügen an mir vorüber, dem Inneren der Stadt zu. Das Menschenmaterial sah recht verwegen aus. Es war im Osten zum Niederschlagen der russischen Arbeiter und Bauern und gegen Finnland mit ‚Erfolg‘ verwendet worden. Kein Zweifel, es sollte in Berlin die Revolution des Volkes im Blute ersäufen.“ Müller fährt fort zu schildern, wie die SPD Botschaften zu all ihren Funktionären schickte, in denen letztere instruiert wurden, sich dem Ausbruch der Revolution mit allen Mitteln zu widersetzen. Er fährt fort: „Seit Kriegsausbruch stand ich an der Spitze der revolutionären Bewegung. Niemals, auch bei den ärgsten Rückschlägen nicht, hatte ich am Siege des Proletariats gezweifelt. Aber jetzt, wo die Stunde der Entscheidung nahte, erfaßte mich ein beklemmendes Gefühl, eine große Sorge um meine Klassengenossen, um das Proletariat. Ich selbst kam mir angesichts der Größe der Stunde beschämend klein und schwach vor.“[12]
Die Novemberrevolution: Das Proletariat beendet den Krieg
It has often been claimed that the German proletariat, on account of the culture of obedience and submission which, for historic reasons, dominated the culture in particular of the ruling classes of that country for several centuries, is incapable of revolution. The 9th of November 1918 disproves this. On the morning of that day, hundreds of thousands of demonstrators from the great working class districts which encircle the government and business quarters on three sides, moved towards the city centre. They planned their routes to pass the main military barracks on their way to try and win over the soldiers, and the main prisons, where they intended to liberate their comrades. They were armed with guns, rifles and hand grenades. And they were prepared to die for the cause of the revolution. Everything was planned on the spot and spontaneously.
That day, only 15 people were killed. The November Revolution in Germany was as bloodless as the October Revolution in Russia. But nobody knew or even expected this in advance. The proletariat of Berlin showed great courage and unswerving determination that day.
Midday. The SPD leaders Ebert and Scheidemann were sitting in the Reichstag, the seat of the German parliament, eating their soup. Friedrich Ebert was proud of himself, having just been summoned by the rich and the nobles to form a government to save capitalism. When they heard noises outside, Ebert, refusing to allow a mob to interrupt him, silently continued his meal. Scheidemann, accompanied by functionaries who were afraid the building was going to be stormed, stepped out on the balcony to see what was going on. What he saw was something like a million demonstrators on the lawns between the Reichstag and the Brandenburg Gate. A crowd which fell silent when it saw Scheidemann on the balcony, thinking he had come to make a speech. Obliged to improvise, he declared the "free German republic". When he got back to tell Ebert what he had done, the latter was furious, since he had been intending to save not only capitalism, but even the monarchy.[13]
Around the same moment the real socialist Karl Liebknecht was standing on the balcony of the palace of that very monarchy, declaring the socialist republic, and summoning the proletariat of all countries to world revolution. And a few hours later, the revolutionary Obleute occupied one of the main meeting rooms in the Reichstag. There, they formulated the appeals for delegates to be elected in mass assemblies the next day, to constitute revolutionary workers and soldiers councils.
The war had been brought to an end, the monarchy toppled. But the rule of the bourgeoisie was still far from being over.
Nach dem Krieg: der Bürgerkrieg
Zu Beginn dieses Artikels riefen wir in Erinnerung, was historisch auf dem Spiel stand, wie es von Rosa Luxemburg formuliert worden war, und dass dies sich in der Frage konzentriert: Welche Klasse wird den Krieg beenden? Wir erinnerten an die drei möglichen Szenarien, wie der Krieg enden könnte: durch das Proletariat, durch die Bourgeoisie oder durch gegenseitige Erschöpfung der kriegführenden Parteien. Die Ereignisse zeigen deutlich, dass es letztendlich das Proletariat war, das bei der Beendigung des „Großen Krieges“ die führende Rolle spielte. Diese Tatsache allein veranschaulicht die potenzielle Macht des revolutionären Proletariats. Sie erklärt, warum die Bourgeoisie sich bis zu dem heutigen Tag über die Novemberrevolution 1918 in Schweigen hüllt. Doch dies ist nicht die ganze Geschichte. Bis zu einem gewissen Umfang waren die Ereignisse im November 1918 die Kombination aller drei Szenarien, die von Rosa Luxemburg geschildert wurden. Bis zu einem gewissen Umfang waren diese Ereignisse auch das Produkt der militärischen Niederlage Deutschlands. Zu Beginn November 1918 stand Deutschland wirklich am Rande einer totalen militärischen Niederlage. Ironischerweise ersparte die proletarische Erhebung der deutschen Bourgeoisie das Schicksal einer militärischen Okkupation und zwang die Alliierten, den Krieg zu stoppen, um die Verbreitung der Revolution zu vermeiden. November 1918 enthüllte auch Elemente des „wechselseitigen Ruins“ und der Erschöpfung, vor allem in Deutschland, aber auch in Großbritannien und Frankreich. Tatsächlich war es erst die Intervention der Vereinigten Staaten auf Seiten der westlichen Alliierten ab 1917, die den Ausschlag zugunsten Letzterer gaben und den Weg aus der tödlichen Sackgasse öffneten, in welche die europäischen Großmächte hineingetappt waren.
Wenn wir die Rolle dieser anderen Faktoren erwähnen, dann nicht, um die Rolle des Proletariats zu minimieren. Sie sind jedoch zu wichtig, um unberücksichtigt zu bleiben, denn sie helfen den Charakter der Ereignisse zu erklären. Die Novemberrevolution errang den Erfolg als unwiderstehliche Kraft. Aber auch, weil der deutsche Imperialismus den Krieg bereits verloren hatte, weil seine Armeen sich in voller Auslösung befanden und weil nicht nur die Arbeiterklasse, sondern auch breite Sektoren des Kleinbürgertums und sogar der Bourgeoisie nun den Frieden wollten.
Am Tag nach dem großen Triumph wählte die Bevölkerung von Berlin Arbeiter- und Soldatenräte. Diese ernannten ihrerseits zusammen mit ihrer eigenen Organisation eine Art provisorische sozialistische Regierung, die von der SPD und der USPD unter der Führung von Friedrich Ebert gebildet wurde. Am gleichen Tag unterzeichnete Ebert ein Geheimabkommen mit der neuen militärischen Führung, um die Revolution niederzuschlagen. Im nächsten Artikel wollen wir die Kräfte der revolutionären Avantgarde im Kontext des beginnenden Bürgerkriegs und am Vorabend der entscheidenden Ereignisse der Weltrevolution untersuchen. Steinklopfer im Juli 2008
[12] Richard Müller, „Vom Kaiserreich zur Republik“, S. 143.
[13] Anekdoten dieser Art aus dem Innersten des Lagers der Konterrevolution können in den Memoiren führender Sozialdemokraten zur damaligen Zeit gefunden werden. Philipp Scheidemann („Memoiren eines Sozialdemokraten“), 1928. Gustav Noske: Von Kiel bis Kapp – Zur Geschichte der deutschen Revolution, 1920.
Aktuelles und Laufendes:
- Deutschland 1918 [88]
Leute:
- Liebknecht [82]
- Luxemburg [83]
- Jogiches [84]
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Historische Ereignisse:
- Novemberrevolution [89]
- Deutschland 1918- 1919 [85]
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Theoretische Fragen:
- Internationalismus [36]
Erbe der kommunistischen Linke:
Deutschland 1918 – Teil 3 Gründung der Partei, Abwesenheit der Internationale
- 3567 reads
Nachdem der I. Weltkrieg ausgebrochen war, trafen sich die Sozialisten am 4. August 1914, um den Kampf für den Internationalismus und gegen den Krieg aufzunehmen: Es waren sieben von ihnen in Rosa Luxemburgs Wohnung. Diese Reminiszenz, die uns daran erinnert, dass die Fähigkeit, gegen den Strom zu schwimmen, eine der wichtigsten revolutionären Qualitäten ist, darf uns nicht zur Schlussfolgerung verleiten, dass die Rolle der proletarischen Partei in den Ereignissen, die die damalige Welt erschütterten, peripher gewesen sei. Das Gegenteil war der Fall, wie wir in den ersten beiden Artikeln dieser Serie zum Gedenken des 90. Jahrestages der revolutionären Kämpfe in Deutschland aufzuzeigen versucht haben. Im ersten Artikel stellten wir die These vor, dass die Krise in der Sozialdemokratie, insbesondere in der deutschen SPD (1) – der führenden Partei der Zweiten Internationale -, einer der wichtigsten Faktoren gewesen war, die die Möglichkeit für den Imperialismus eröffnet haben, das Proletariat in den Krieg marschieren zu lassen. In Teil 2 argumentierten wir, dass die Intervention von Revolutionären entscheidend war, um die Arbeiterklasse in die Lage zu versetzen, inmitten des Krieges ihre internationalistischen Prinzipien wiederzuentdecken und so das Ende der imperialistischen Schlachterei durch revolutionäre Mittel (die Novemberrevolution von 1918) zu erwirken. Indem sie so verfuhren, legten sie die Fundamente für eine neue Partei und eine neue Internationale.
Und in beiden dieser Phasen, so haben wir hervorgehoben, war die Fähigkeit der Revolutionäre, die Prioritäten des Augenblicks zu begreifen, die Vorbedingung dafür, eine solch aktive und positive Rolle zu spielen. Nach dem Aufbrechen der Internationale angesichts des Krieges war es die Aufgabe der Stunde, die Ursachen dieses Fiaskos zu verstehen und die Lehren daraus zu ziehen. Im Kampf gegen den Krieg war es die Verantwortung wirklicher Sozialisten, die ersten zu sein, um das Banner des Internationalismus zu hissen, den Weg zur Revolution auszuleuchten.
Die Arbeiterräte und die Klassenpartei
Die Arbeitererhebung am 9. November 1918 brachte am Morgen des 10. Novembers 1918 den Krieg zu Ende. Der deutsche Kaiser und zahllose Fürsten waren niedergerungen – nun begann eine neue Phase der Revolution. Obwohl der Novemberaufstand von den Arbeitern angeführt wurde, nannte Rosa Luxemburg ihn eine „Revolution der Soldaten“. Dies darum, weil der Geist, der ihn beherrschte, der Geist einer tiefen Sehnsucht nach Frieden war. Ein Wunsch, den die Soldaten nach vier Jahren in den Schützengräben mehr als jede andere gesellschaftliche Gruppe verkörperten. Dies gab jenem unvergesslichen Tag seine spezifische Färbung, seinen Ruhm und nährte seine Illusionen. Da selbst Teile der Bourgeoisie erleichtert waren, dass der Krieg endlich vorbei war, beherrschte die allgemeine Verbrüderung die damalige Stimmung. Selbst die beiden Hauptprotagonisten des gesellschaftlichen Kampfes, die Bourgeoisie und das Proletariat, waren von den Illusionen des 9. November betroffen. Die Illusion der Bourgeoisie war, dass sie die von der Front heimkehrenden Soldaten noch immer gegen die Arbeiter benutzen könnte. In den folgenden Tagen verflüchtigte sich diese Illusion. Die „grauen Röcke“ (2) wollten nach Hause und nicht gegen die Arbeiter kämpfen. Das Proletariat hatte die Illusion, dass die Soldaten schon jetzt auf ihrer Seite waren und die Revolution wollten. Während der ersten Sitzungen der Arbeiter- und Soldatenräte, die in Berlin am 10. November gewählt worden waren, lynchten die Soldatendelegierten fast die Revolutionäre, die von der Notwendigkeit sprachen, den Klassenkampf fortzuführen, und die die neue sozialdemokratische Regierung als Volksfeind identifizierten.
Diese Arbeiter- und Soldatenräte waren im allgemeinen von der menschlichen Trägheit gekennzeichnet, die merkwürdigerweise den Beginn einer jeden großen sozialen Erhebung auszeichnet. Sehr oft wählten Soldaten ihre Offiziere als Delegierte, und Arbeiter ernannten dieselben sozialdemokratischen Kandidaten, für die sie schon vor dem Krieg gestimmt hatten. So hatten diese Räte nichts Besseres zu tun, als eine Regierung zu ernennen, die von den Kriegstreibern der SPD angeführt wurde, und ihren eigenen Selbstmord im Voraus zu beschließen, indem sie zu allgemeinen Wahlen für ein parlamentarisches System aufriefen.
Trotz der Hoffnungslosigkeit dieser ersten Maßnahmen waren die Arbeiterräte das Herz der Novemberrevolution. Wie Rosa Luxemburg hervorhob, war es vor allem das Auftreten dieser Organe, die den wesentlich proletarischen Charakter dieses Aufstandes bewiesen und verkörperten. Doch jetzt wurde eine neue Phase der Revolution eröffnet, in der die zentrale Frage nicht mehr die der Räte war, sondern die Frage der Klassenpartei. Die Phase der Illusionen kam zu ihrem Ende, der Augenblick der Wahrheit, des Ausbruchs des Bürgerkriegs rückte näher. Die Arbeiterräte waren durch ihre eigentliche Funktion und Struktur als Massenorgane in der Lage, sich selbst von einem Tag zum anderen zu erneuern und zu revolutionieren. Die zentrale Frage war jetzt: Würde die entschlossen revolutionäre, proletarische Auffassung innerhalb dieser Räte, innerhalb der Arbeiterklasse die Oberhand erlangen?
Um siegreich zu sein, bedarf die proletarische Revolution einer vereinten, zentralisierten politischen Avantgarde, in der die Klasse in ihrer Gesamtheit Vertrauen hat. Dies war die vielleicht wichtigste Lehre aus der Oktoberrevolution in Russland im Jahr zuvor. Die Aufgabe dieser Partei ist nicht mehr, wie Rosa Luxemburg 1906 in ihrem Pamphlet über den Massenstreik argumentiert hat, die Massen zu organisieren, sondern der Klasse eine politische Führung und ein wirkliches Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten zu geben.
Die Schwierigkeit bei der Umgruppierung der Revolutionäre
Doch Ende 1918 war in Deutschland eine solche Partei nicht in Sicht. Jene Sozialisten, die sich der Pro-Kriegs-Politik der SPD widersetzten, waren hauptsächlich in der USPD anzutreffen, der früheren Parteiopposition, die Zug um Zug aus der SPD ausgeschlossen worden war. Ein bunte Mix mit Zehntausenden von Mitgliedern, von den Pazifisten und jenen, die eine Versöhnung mit den Kriegstreibern wollten, bis zu den prinzipienfesten revolutionären Internationalisten. Die Hauptorganisation dieser Internationalisten, der Spartakusbund, war eine unabhängige Fraktion innerhalb der USPD. Andere, kleinere internationalistische Gruppen, wie die IKD (3) (die aus der linken Opposition in Bremen hervorkamen), waren außerhalb der USPD organisiert. Der Spartakusbund war unter den Arbeitern wohlbekannt und respektiert. Doch die anerkannten Führer der Streikbewegungen gegen den Krieg waren nicht diese politischen Gruppierungen, sondern die informelle Struktur der Fabrikdelegierten, die „revolutionären Obleute“. Ab Dezember 1918 spitzte sich die Lage zu. Die ersten Geplänkel, die zum offenen Bürgerkrieg führten, hatten bereits stattgefunden. Doch die verschiedenen Komponenten einer potenziellen revolutionären Klassenpartei – der Spartakusbund, die anderen linken Elemente in der USPD, die IKD, die Obleute waren noch immer getrennt und mehrheitlich zaudernd.
Unter dem Eindruck der Ereignisse begann sich die Frage der Parteigründung konkreter zu stellen. Schließlich wurde sie eilig in Angriff genommen.
Der erste nationale Kongress der Arbeiter- und Soldatenräte war am 16. Dezember in Berlin zusammengekommen. Während 250.000 radikale Arbeiter draußen demonstrierten, um Druck auf die 489 Delegierten (von denen nur zehn den Spartakusbund, zehn die IKD repräsentierten) auszuüben, wurde es Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht nicht gestattet, sich an das Treffen zu wenden (unter dem Vorwand, dass sie kein Mandat besäßen). Als dieser Kongress damit endete, dass er seine Macht an ein künftiges parlamentarisches System aushändigte, wurde klar, dass die Revolutionäre darauf mit vereinten Kräften antworten müssen.
Am 14. Dezember veröffentlichte der Spartakusbund eine programmatische Prinzipienerklärung: Was will der Spartakusbund?
Am 17. Dezember rief eine nationale Konferenz der IKD in Berlin zur Diktatur des Proletariats und zur Bildung einer Klassenpartei durch einen Prozess der Umgruppierung auf. Die Konferenz scheiterte dabei, eine Übereinstimmung in der Frage der Teilnahme an den kommenden Wahlen zur parlamentarischen Nationalversammlung zu erzielen.
Etwa zur gleichen Zeit begannen Führer innerhalb der USPD, wie Georg Ledebour, und unter den Fabrikdelegierten, wie Richard Müller, die Frage der Notwendigkeit einer vereinten Arbeiterpartei zu stellen.
Zum gleichen Zeitpunkt trafen sich Delegierte der internationalen Jugendbewegung in Berlin, wo sie ein Sekretariat einsetzten. Am 18. Dezember wurde eine internationale Jugendkonferenz abgehalten, der eine Massenversammlung in Berlin-Neukölln folgte, auf der Karl Liebknecht und Willi Münzenberg sprachen.
In diesem Kontext beschloss ein Treffen der Delegierten des Spartakusbundes am 29. Dezember in Berlin, mit der USPD zu brechen und eine separate Partei zu bilden. Drei Delegierte stimmten gegen diese Entscheidung. Dasselbe Treffen rief zu einer vereinten Konferenz von Spartakus und IKD auf, die am folgenden Tag in Berlin begann und auf der 127 Delegierte aus 56 Städten und Sektionen teilnahmen. Diese Konferenz wurde teilweise durch die Vermittlung von Karl Radek, dem Delegierten der Bolschewiki, möglich gemacht. Viele dieser Delegierten waren sich bis zu ihrer Ankunft nicht im Klaren, dass sie gerufen wurden, um eine neue Partei zu gründen (4). Die Fabrikdelegierten waren nicht eingeladen, da das Gefühl vorherrschte, dass es noch nicht möglich sei, sie mit den sehr entschlossenen revolutionären Positionen zu vereinen, die von der Mehrheit der oft noch jungen Mitglieder und Anhänger von Spartakus und IKD vertreten wurde. Stattdessen herrschte die Hoffnung vor, dass die Fabrikdelegierten der Partei beitreten werden, sobald diese gegründet worden war. (5)
Der Gründungskongress der KPD brachte führende Figuren aus der Bremer Linken (einschließlich Karl Radek, auch wenn er die Bolschewiki auf diesem Treffen vertrat), die meinten, dass die Gründung der Partei lange überfällig war, und des Spartakusbundes, wie Rosa Luxemburg und vor allem Leo Jogiches, zusammen, deren prinzipielle Sorge es war, dass diese Schritt voreilig sein könnte. Paradoxerweise hatten beide Seiten gute Argumente, um ihre Standpunkte zu rechtfertigen.
Die russische Kommunistische Partei (Bolschewiki) sandte sechs Delegierte zur Konferenz, von denen zwei von der deutschen Polizei an der Teilnahme gehindert wurden (6),
Der Gründungskongress: ein großer programmatischer Fortschritt
Zwei der Hauptdiskussionen auf dem Gründungskongress der KPD betrafen die Frage der parlamentarischen Wahlen und der Gewerkschaften. Dies waren Themen, die bereits in den Debatten vor 1914 eine wichtige Rolle gespielt hatten, die aber im Verlaufe des Krieges zweitrangig geworden waren. Nun kehrten sie in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zurück. Karl Liebknecht griff bereits in seiner einleitenden Präsentation über die „Krise in der USPD“ die parlamentarische Frage auf. Der erste nationale Kongress der Arbeiterräte in Berlin hatte bereits die Frage gestellt, die die USPD unvermeidlich spalten musste: Nationalversammlung oder Räterepublik? Es war die Verantwortung aller Revolutionäre, die bürgerlichen Wahlen und ihr parlamentarisches System als konterrevolutionär, als den Tod der Herrschaft der Arbeiterräte zu brandmarken. Doch die Führung der USPD hatte sich sowohl dem Aufruf des Spartakusbundes als auch dem Aufruf der Obleute in Berlin zu einem außerordentlichen Kongress verweigert, um diese Frage zu diskutieren und zu entscheiden.
Als Sprecher der russischen Delegation entwickelte Karl Radek das Verständnis weiter, dass es die historische Entwicklung selbst sei, die nicht nur die Notwendigkeit eines Gründungskongresses, sondern auch seine Tagesordnung bestimmte. Mit dem Ende des Krieges würde sich die Logik der Revolution in Deutschland notwendigerweise von jener in Russland unterscheiden. Die zentrale Frage sei nicht mehr der Frieden, sondern die Nahrungsmittelversorgung und ihre Preise sowie die Frage der Arbeitslosigkeit.
Indem sie die Frage der Nationalversammlung und der „ökonomischen Kämpfe“ auf die Tagesordnung der ersten beiden Tage des Kongresses setzte, hoffte die Führung des Spartakusbundes auf eine klare Position für die Arbeiterräte und gegen das parlamentarische System, gegen die überholte Gewerkschaftsform des Kampfes als solide programmatische Basis für die neue Partei. Doch die Debatten gingen noch darüber hinaus. Die Mehrheit der Delegierten sprach sich gegen jegliche Beteiligung an bürgerlichen Wahlen, selbst als ein Mittel der Agitation gegen sie, sowie gegen die Arbeit innerhalb der Gewerkschaften aus. Auf dieser Ebene war der Kongress einer der stärksten Augenblicke in der Geschichte der Arbeiterbewegung. Er half zum ersten Mal überhaupt, im Namen einer revolutionären Klassenpartei diese radikalen Positionen zu formulieren, die der neuen Epoche des dekadenten Kapitalismus entsprachen. Diese Ideen sollten die Formulierung des Manifestes der Kommunistischen Internationale stark beeinflussen, das einige Monate später von Trotzki verfasst wurde. Und sie sollten zu fundamentalen Positionen der Kommunistischen Linken werden – so wie sie es bis heute sind.
Die Interventionen der Delegierten, die diese Positionen definierten, waren oft von Ungeduld und einem gewissen Mangel an Argumenten gekennzeichnet und wurden von den erfahreneren Mitgliedern kritisiert, auch von Rosa Luxemburg, die nicht ihre radikalsten Schlussfolgerungen teilte. Doch die Protokolle des Treffens illustrieren gut, dass diese neuen Positionen nicht das Produkt von Individuen und ihrer Schwächen, sondern der Ausdruck einer tiefergehenden gesellschaftlichen Bewegung waren, die Hunderttausende von klassenbewussten Arbeitern umfasste (7). Gelwitzki, ein Delegierter aus Berlin, rief die Partei auf, statt der Beteiligung an den Wahlen zu den Kasernen zu gehen, um die Soldaten davon zu überzeugen, dass die Räteversammlung die „Regierung des Weltproletariats“ ist und die Nationalversammlung jene der Konterrevolution. Leviné, Delegierter aus Neukölln (Berlin) wies darauf hin, dass die Teilnahme an den Wahlen nichts anderes bewirke als die Verstärkung der Illusionen der Massen. (8) In den Debatten über die ökonomischen Kämpfe argumentierte Paul Frölich, Delegierter aus Hamburg, dass die alte gewerkschaftliche Form nun überholt sei, da sie auf einer Trennung zwischen den ökonomischen und politischen Dimensionen des Klassenkampfes beruhten. (9) Hammer, Delegierter aus Essen, berichtete, dass die Bergarbeiter vom Ruhrgebiet ihre Gewerkschaftsausweise weggeworfen hatten. Was Rosa Luxemburg selbst angeht, die noch immer für die Arbeit innerhalb der Gewerkschaften aus taktischen Gründen plädierte, so erklärte sie, dass der Kampf des Proletariats für seine Befreiung identisch mit dem Kampf für die Befreiung der Gewerkschaften sei.
Massenstreik und Aufstand
Die programmatischen Debatten auf dem Gründungskongress waren von großer historischer Bedeutung, besonders für die Zukunft.
Doch zum Zeitpunkt des Gründungskongresses selbst lag Rosa Luxemburg völlig richtig, als sie sagte, dass sowohl die Frage der parlamentarischen Wahlen als auch die Frage der Gewerkschaften zweitrangig waren. Einerseits war die Frage der Rolle dieser Institutionen in dem, was sich anschickte, zur Epoche des Imperialismus zu werden, noch zu neu für die Arbeiterbewegung. Sowohl die Debatten als auch die praktischen Erfahrungen waren noch nicht ausreichend, um diese Frage völlig zu klären. Für den Augenblick reichte es aus, zu wissen und zuzustimmen, dass die Masseneinheitsorgane der Klasse, die Arbeiterräte, und nicht das Parlament oder die Gewerkschaften die Mittel des Arbeiterkampfes und der proletarischen Diktatur sind.
Auf der anderen Seite neigten diese Debatten dazu, von der Hauptaufgabe des Kongresses abzulenken, die darin bestand, die nächsten Schritte der Klasse auf dem Weg zur Macht auszumachen. Tragischerweise scheiterte der Kongress darin, diese Frage zu klären. Die Schlüsseldiskussion über dieses Thema wurde von Rosa Luxemburgs Präsentation über „Unser Programm“ am Nachmittag des zweiten Tages (31. Dezember 1918) eingeleitet. Hier erkundete sie den Charakter dessen, was als zweite Phase der Revolution ausgerufen wurde. Die erste Phase, sagte sie, war sofort politisch gewesen, da sie gegen den Krieg gerichtet war. Während der Novemberrevolution wurde die Frage der spezifischen Klassenforderungen der Arbeiter hintangestellt. Dies half seinerseits das verhältnismäßig niedrige Niveau des Klassenbewusstseins zu erklären, welches diese Ereignisse begleitete und sich in dem Wunsch nach Wiederversöhnung und nach einer „Wiedervereinigung“ des „sozialistischen Lagers“ ausdrückte. Für Rosa Luxemburg war das Hauptkennzeichen der zweiten Phase der Revolution die Rückkehr der wirtschaftlichen Klassenforderungen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.
Sie hatte dabei keineswegs außer Acht gelassen, dass die Eroberung der Macht vor allem ein politischer Akt ist. Doch wollte sie einen anderen wichtigen Unterschied zwischen den revolutionären Prozess Russlands und Deutschlands beleuchten. 1917 kam das russische Proletariat ohne größeren Gebrauch der Streikwaffe an die Macht. Doch war dies, wie Rosa Luxemburg hervorhob, nur möglich, weil die Revolution in Russland nicht 1917, sondern 1905 begonnen hatte. Mit anderen Worten, das russische Proletariat hatte bereits vor 1917 die Erfahrung des Massenstreiks gemacht.
Auf dem Kongress wiederholte sie nicht die Hauptgedanken, die von der Linken der Sozialdemokratie über den Massenstreik von 1905 entwickelt worden waren. Sie konnte getrost davon ausgehen, dass sie noch immer in den Köpfen der Delegierten präsent waren. Wir möchten sie an dieser Stelle kurz in Erinnerung rufen: Der Massenstreik ist die Vorbedingung für die Machtergreifung, gerade weil er die Trennung zwischen wirtschaftlichen und politischen Kämpfen wegwischt. Und während die Gewerkschaften selbst in ihren stärksten Zeiten als Instrumente der Arbeiter nur Minderheiten der Klasse organisierten, aktiviert der Massenstreik die „zusammen geknäuelte Masse der Heloten“ des Proletariats, der unorganisierten Massen, die unberührt vom Licht der politischen Bildung sind. Der Arbeiterkampf richtet sich nicht nur gegen die materielle Armut. Er ist eine Erhebung gegen die existierende Arbeitsteilung selbst, angeführt von ihren Hauptopfern, den Lohnsklaven. Das Geheimnis des Massenstreiks ist das Streben der Proletarier nach vollständiger Menschwerdung. Last but not least: Der Massenstreik würde zur Wiederverjüngung der Arbeiterräte führen, indem der Klasse die organisatorischen Mittel verliehen werden, ihren Machtkampf zu zentralisieren.
Daher beharrte Rosa Luxemburg in ihrer Rede auf dem Kongress darauf, dass die bewaffnete Erhebung der letzte, nicht der erste Akt des Machtkampfes sei. Die Aufgabe der Stunde, sagte sie, sei es nicht, die Regierung zu stürzen, sondern sie zu untergraben. Der Hauptunterschied zur bürgerlichen Revolution sei, so argumentierte sie, ihr Massencharakter, indem sie von „unten“ komme. (10)
Die Unreife des Kongresses
Doch genau dies wurde auf dem Kongress nicht verstanden. Für viele Delegierten war die nächste Phase der Revolution nicht von Massenstreikbewegungen, sondern vom unmittelbaren Kampf um die Macht charakterisiert. Diese Konfusion wurde besonders deutlich von Otto Rühle (11) artikuliert, der behauptete, dass es möglich sei, innerhalb von vierzehn Tagen die Macht zu erobern. Selbst Karl Liebknecht wollte, obwohl er die Möglichkeit einer lang hingezogenen Revolution in Betracht zog, nicht die Möglichkeit einer „ganz rapiden Entwicklung“ ausschließen (12)
Wir haben jeden Grund, den Augenzeugenberichten Glauben zu schenken, denen zufolge insbesondere Rosa Luxemburg von den Resultaten dieses Kongresses schockiert und alarmiert war. Was Leo Jogiches anbelangt, soll seine erste Reaktion gewesen sein, Luxemburg und Liebknecht zu raten, Berlin zu verlassen und sich für eine Weile zu verstecken. (13) Er befürchtete, dass die Partei und das Proletariat sich auf eine Katastrophe zu bewegten.
Was Rosa Luxemburg am meisten alarmierte, waren nicht die verabschiedeten programmatischen Positionen, sondern die Blindheit der meisten Delegierten gegenüber der Gefahr, die die Konterrevolution darstellte, und die allgemeine Unreife, mit der die Debatten geführt wurden. Viele Interventionen zeichneten sich durch Wunschdenken aus und erweckten den Eindruck, dass eine Mehrheit der Klasse bereits hinter der neuen Partei stünde. Die Präsentation von Rosa Luxemburg wurde mit Jubel begrüßt. Einem Antrag von sechzehn Delegierten, sie so schnell wie möglich als „Agitationsbroschüre“ zu veröffentlichen, wurde sofort stattgegeben. Im Gegensatz dazu gelang es dem Kongress nicht, darüber ernsthaft zu diskutieren. Insbesondere griff kaum eine Intervention Rosas Hauptgedanken auf: dass der Kampf um die Macht noch nicht auf der Tagesordnung war. Eine löbliche Ausnahme war der Beitrag von Ernst Meyer, der über seinen jüngsten Besuch in den ostelbischen Provinzen sprach. Er berichtete, dass große Bereiche des Kleinbürgertums über der Notwendigkeit sprachen, Berlin eine Lektion zu erteilen. Er fuhr fort: „Fast noch erschrockener war ich darüber, dass auch die Arbeiter in den Städten selbst noch nicht das Verständnis dafür hatten, was in dieser Situation notwendig ist. Deshalb müssen wir die Agitation nicht nur auf dem flachen Lande, sondern auch in den Klein- und Mittelstädten mit aller Macht in die Wege leiten.“ Meyer antwortete auch aufs Frölichs Idee, zur Bildung lokaler Räterepubliken anzuspornen. „Es ist geradezu typisch für die konterrevolutionären Bestrebungen, dass sie die Möglichkeit von selbständigen Republiken propagieren, worin sich nichts anderes äußert als der Wunsch, Deutschland in verschiedene Bezirke zu zerteilen, die sozial voneinander abweichen, oder die sozial rückständigen Gebiete dem Einfluss der sozial fortgeschrittenen Gebiete zu entziehen“ (14)
Besonders bedeutsam war die Intervention von Fränkel, einem Delegierten aus Königsberg, der den Vorschlag machte, dass es überhaupt keine Diskussion über die Präsentation geben solle. „Ich bin der Ansicht, dass eine Diskussion die ausgezeichnete Rede der Genossin Luxemburg nur abschwächen kann,“ erklärte er. (15)
Diesem Beitrag folgte eine Intervention von Bäumer, der erklärte, dass die proletarische Position gegen jegliche Beteiligung an Wahlen so evident sei, dass er „auf das Bitterste“ bedauerte, dass es überhaupt eine Diskussion über das Thema gegeben habe. (16)
Rosa Luxemburg wurde vorgeschlagen, das Schlusswort zu dieser Diskussion zu sprechen. Der Vorsitzende verkündete: „Die Genossin Luxemburg ist leider nicht in der Lage, das Schlusswort zu halten, da sie körperlich unpässlich ist.“ (17)
Was Karl Radek später als die „jugendliche Unreife“ des Gründungskongresses beschrieb (18), war also gekennzeichnet von Ungeduld und Naivität, aber auch von einem Mangel an Diskussionskultur. Rosa Luxemburg hatte tags zuvor dieses Problem angesprochen. „Ich habe die Überzeugung, Ihr wollt Euch Euren Radikalismus ein bischen bequem und rasch machen, namentlich die Zurufe „Schnell abstimmen“ beweisen das. Es ist nicht die Reife und der Ernst, die in diesen Saal gehören. Es ist meine feste Überzeugung, es ist eine Sache, die ruhig überlegt und behandelt werden muss. Wir sind berufen, zu den größten Aufgaben der Weltgeschichte, und es kann nicht reif und gründlich genug überlegt werden, welche Schritte wir vor uns haben, damit wir sicher sind, dass wir zum Ziel gelangen. So schnell übers Knie brechen kann man nicht so wichtige Entscheidungen. Ich vermisse das Nachdenkliche, den Ernst, der durchaus den revolutionären Elan nicht ausschließt, sondern mit ihm gepaart werden soll.“ (19)
Die Verhandlungen mit den „Fabrikdelegierten“
Die revolutionären Obleute aus Berlin sandten eine Delegation zum Kongress, um über ihren möglichen Beitritt zur neuen Partei zu verhandeln. Eine Eigentümlichkeit dieser Verhandlungen war, dass die Mehrheit der sieben Delegierten sich selbst als Repräsentant der Fabriken ansah und ihre Stimme zu besonderen Fragen auf der Grundlage einer Art von Proportionalsystem, nur nach Konsultation mit „ihren“ Arbeitskollegen gab, die sich anscheinend bei Gelegenheit versammelten. Liebknecht, der die Verhandlungen für Spartakus leitete, berichtete dem Kongress, dass zum Beispiel in der Frage der Teilnahme an den Wahlen zur Nationalversammlung 26 Stimmen dafür abgegeben wurden und 16 Stimmen dagegen. Liebknecht fügte hinzu: „Aber unter der Minderheit befanden sich u.a. die Vertreter der äußerst wichtigen Spandauer Betriebe, die allein 60.000 Mann hinter sich haben“ Däumig und Ledebour, die Repräsentanten der Linken der USPD waren, nicht Obleute, nahmen nicht an der Abstimmung teil.
Ein weiterer Zankapfel war die Forderung der Obleute nach Parität in der Programm- und Organisationskommission, die vom Kongress nominiert wurde. Dies wurde aus dem Grunde abgelehnt, dass die Delegierten zwar einen großen Teil der Arbeiterklasse von Berlin repräsentierten, die KPD aber die Klasse im gesamten Land repräsentiere.
Doch der Hauptstreit, der die Atmosphäre der Verhandlungen, die sehr konstruktiv begonnen hatten, offensichtlich vergiftete, betraf die Strategie und Taktik für die kommende Periode, d.h. jene Frage, die eigentlich im Mittelpunkt der Kongressberatungen hätte stehen müssen. Richard Müller forderte, dass der Spartakusbund davon abkehrte, was er die „putschistische Taktik“ nannte. Er schien sich insbesondere auf die Taktik der täglichen bewaffneten Demonstrationen durch Berlin zu beziehen, die vom Spartakusbund angeführt wurden, und dies zu einem Moment, als, laut Müller, die Bourgeoisie versuchte, eine vorzeitige Konfrontation mit der politischen Vorhut in Berlin zu provozieren. Wie Liebknecht dem Kongress berichtete „Ich sagte dem Genossen Richard Müller, er scheine ein Sprachrohr des Vorwärts zu sein“ (20) (die konterrevolutionäre Zeitung der SPD).
Wie Liebknecht dem Kongress schilderte, schien dies der negative Wendepunkt der Verhandlungen gewesen zu sein. Die Obleute, die bis dahin sich damit zufrieden gaben, fünf Repräsentanten in den o.g. Kommissionen zu haben, zogen nun ihre Stimme zurück, um acht zu fordern etc. Die Fabrikdelegierten fingen sogar an, damit zu drohen, eine eigene Partei zu bilden.
Der Kongress seinerseits verabschiedete eine Resolution, die „einige scheinradikale Mitglieder der bankrotten USPD“ für das Scheitern der Verhandlungen verantwortlich machte. Unter verschiedenen „Vorwänden“ würden diese Elemente versuchen, „unter verschiedenen, zum Teil anmaßenden unzulässigen Vorwänden suchen diese Leute Kapital zu schlagen aus ihrem Einfluss unter den revolutionären Arbeitern“ (ebenda, S.281) (21)
Der Artikel über den Kongress, der in der Ausgabe der Roten Fahne vom 3. Januar 1919 erschien und von Rosa Luxemburg verfasst wurde, drückte einen anderen Geist aus. Dieser Artikel sprach vom Beginn der Verhandlungen zur Vereinigung mit den Obleuten und den Delegierten der großen Berliner Fabriken, von dem Beginn eines Prozesses, der „ganz selbstverständlichen, unaufhaltsamen Prozesses der Vereinigung aller wirklich proletarischen und revolutionären Elemente in einem organisatorischen Rahmen. Dass die revolutionären Obleute Großberlins, die moralischen Vertreter des Kerntrupps des Berliner Proletariats, mit dem Spartakusbund zusammengehen, hat die Zusammenwirkung beider Teile in allen bisherigen revolutionären Aktionen der Berliner Arbeiterschaft bewiesen“ (ebenda S. 302). (22)
Der angebliche „Luxemburgismus“ der jungen KPD
Wie kann man diese schweren Geburtsnarben der KPD erklären?
Nach der Niederlage der Revolution in Deutschland wurde eine Reihe von Erklärungen sowohl innerhalb der KPD als auch in der Kommunistischen Internationale vorgestellt, die die spezifischen Schwächen der Bewegung in Deutschland insbesondere im Vergleich mit Russland betonten. Der Spartakusbund wurde beschuldigt, eine „spontaneistische“ und so genannte Luxemburgistische Theorie der Parteibildung vertreten zu haben. Man suchte hier die Ursprünge von allem, von dem angeblichen Zögern der Spartakisten, sich von den Kriegstreibern der SPD zu trennen, bis zur so genannten Nachsicht Rosa Luxemburgs gegenüber den jungen „Radikalen“ in der Partei.
Die Ursprünge der angeblichen „spontaneistischen Theorie“ der Partei werden gewöhnlich auf Rosa Luxemburgs Broschüre über die Russische Revolution von 1905 – Der Massenstreik, die politische Partei und die Gewerkschaften – zurückgeführt, wo sie angeblich zur Intervention der Massen im Kampf gegen den Opportunismus und den Reformismus der Sozialdemokratie als Alternative zum politischen und organisatorischen Kampf innerhalb der Partei selbst aufruft. In Wahrheit war die Erkenntnis, dass der Fortschritt der Klassenpartei von einer Reihe „objektiver“ und „subjektiver“ Faktoren abhängt, von denen die Evolution des Klassenkampfes einer der wichtigsten ist, eine Grundthese der marxistischen Bewegung lange vor Rosa Luxemburg. (23)
Vor allem hatte Rosa Luxemburg sehr wohl einen sehr konkreten Kampf innerhalb der Partei vorgeschlagen: der Kampf zur Wiederherstellung der politischen Kontrolle der Partei über die sozialdemokratischen Gewerkschaften. Es ist allgemeiner Glaube, insbesondere unter Syndikalisten, dass die organisatorische Form der politischen Partei viel anfälliger ist, vor der Logik des Kapitalismus zu kapitulieren, als die Gewerkschaften, die die Arbeiter direkt im Kampf organisieren. Rosa Luxemburg verstand sehr gut, dass das Gegenteil der Fall war, da die Gewerkschaften die herrschende Arbeitsteilung widerspiegelten, die die tiefste Grundlage der Klassengesellschaft ist. Sie verstand, dass die Gewerkschaften, und nicht die SPD, die Hauptträger der opportunistischen und reformistischen Ideologie in der Vorkriegs-Sozialdemokratie waren. Unter dem Mantel der Parole ihrer „Autonomie“ waren die Gewerkschaften in Wirklichkeit dabei, die politische Arbeiterpartei zu übernehmen. Es ist wahr, dass die Strategie, die von Rosa Luxemburg vorgeschlagen wurde, sich als unzureichend erwies. Doch dies macht sie noch lange nicht „spontaneistisch“ oder syndikalistisch (!), wie manchmal behauptet wird! Genausowenig drückte die Orientierung von Spartakus während des Kriegs auf die Formierung einer Opposition zunächst in der SPD und schließlich in der USPD eine Unterschätzung der Partei aus, sondern eine unerschütterliche Entschlossenheit, für die Partei zu kämpfen, zu verhindern, dass ihre besten Elemente in die Hände der Bourgeoisie fielen.
In einer Intervention auf dem vierten Kongress der KPD im April 1920 behauptete Clara Zetkin, dass Rosa Luxemburg in ihrem letzten Brief an Zetkin geschrieben habe, dass der Gründungskongress einen Fehler gemacht habe, als er die Akzeptanz der Beteiligung an den Wahlen nicht zu einer Bedingung für die Mitgliedschaft in der neuen Partei machte. Es gibt keinen Grund, die Ehrlichkeit von Clara Zetkins Behauptung anzuzweifeln. Die Fähigkeit, zu lesen, was andere Leute wirklich schreiben, und nicht, was man selbst will oder von den anderen erwartet, ist wahrscheinlich seltener, als man allgemein annimmt. Der Brief von Luxemburg an Zetkin, datiert vom 11. Januar 1919, wurde später veröffentlicht. Was Rosa Luxemburg schrieb, ist folgendes: „Also vor allem, was die Frage der Nichtbeteiligung an den Wahlen betrifft: Du überschätzt enorm die Tragweite dieses Beschlusses. Es gibt gar keine „Rühlianer“, Rühle war gar kein „Führer“ auf der Konferenz. Unsere „Niederlage“ war nur der Triumph eines etwas kindischen, unausgegorenen, geradlinigen Radikalismus... Wir haben alle einstimmig beschlossen, den Casus nicht zur Kabinettsfrage zu machen und nicht tragisch zu nehmen. In Wirklichkeit wird die Frage der Nationalversammlung von den stürmischen Ereignissen ganz in den Hintergrund geschoben, und wenn die Dinge so weiter verlaufen, wie bisher, erscheint es recht fraglich, ob es überhaupt zu Wahlen und Nationalversammlung kommt“ (Brief Rosa Luxemburgs an C. Zetkin vom 11. Januar 1919). (24)
Die Tatsache, dass die radikalen Positionen häufig von jenen Delegierten vorgetragen wurden, die am deutlichsten die Ungeduld und Unreife jener Konferenz ausdrückten, trug mit zum Eindruck bei, dass diese Unreife das Produkt der Weigerung sei, sich an bürgerlichen Wahlen oder in Gewerkschaften zu beteiligen. Dieser Eindruck sollte ein Jahr tragische Konsequenzen haben, als die Führung auf dem Heidelberger Kongress die Mehrheit aufgrund ihrer Position zu den Wahlen und der Gewerkschaften ausschloss. (25) Dies war nicht die Haltung von Rosa Luxemburg, die wusste, dass es für die Revolutionäre keine Alternative zur Notwendigkeit gibt, ihre Erfahrungen zur nächsten Generation weiterzureichen, und dass eine Klassenpartei nicht ohne die Beteiligung der jüngeren Generation gegründet werden kann.
Der angeblich „deklassierte“ Charakter der „jungen Radikalen“
Nach dem Ausschluss der Radikalen aus der KPD und der KAPD aus der Kommunistischen Internationale gab es den Ansatz einer Theoretisierung der Rolle der „Radikalen“ innerhalb der jungen Partei als Ausdruck des Gewichtes der „entwurzelten“ und „deklassierten“ Elemente. Es trifft sicherlich zu, dass es unter den jungen Anhängern des Spartakusbundes während des Krieges und noch mehr innerhalb der Reihen von Gruppierungen wie die „Roten Soldaten“, die Kriegsdeserteure, die Invaliden, etc. Strömungen gab, die von der Zerstörung und dem „totalen revolutionären Terror“ träumten. Einige dieser Elemente waren hochgradig dubios, und die Obleute waren ihnen gegenüber zu Recht misstrauisch. Andere waren Hitzköpfe oder einfach junge Arbeiter, die vom Krieg politisiert wurden und es nicht gelernt hatten, ihre Gedanken anders als durch den Kampf mit der Waffe zu artikulieren, und die sich nach jener Art von „Guerrilla“-Kampagnen sehnten, wie sie bald von Max Hoelz praktiziert wurden. (26)
Diese Interpretation wurde erneut in den 1970er Jahren von Autoren wie Fähnders und Rector in ihrem Buch Linksradikalismus und Literatur aufgegriffen. (27) Sie versuchten, ihre These der Verbindung zwischen dem Linkskommunismus und der „Verlumpung“ durch das Beispiel der Biographien radikaler Künstler und Schriftsteller der Linken zu illustrieren, von Rebellen, die, wie Maxim Gorki oder Jack London, die herrschende Gesellschaft abgelehnt hatten, indem sie sich außerhalb ihrer setzten. Bezüglich eines der einflussreichsten Führer der KAPD schrieben sie: „Adam Scharrer war einer der radikalsten Vertreter dieses internationalen – auch in der Literatur international verbreiteten – Rebellentums, das ihn zu seiner so extrem starren Position des Linkskommunismus führte“ (28) (S. 262)
In Wirklichkeit wurden die meisten der jungen Militanten der KPD und der Kommunistischen Linken in der sozialistischen Jugendbewegung vor 1914 politisiert. Politisch waren sie nicht ein Produkt der durch den Krieg verursachten „Entwurzelung“ und „Verlumpung“. Doch ihre Politisierung kreiste sehr wohl um die Frage des Krieges. Im Gegensatz zur älteren Generation der sozialistischen Arbeiter, die unter dem Gewicht von Jahrzehnten der politischen Routine in der Epoche der relativen Stabilität des Kapitalismus gelitten hatte, wurde die sozialistische Jugend direkt durch das Gespenst des heraufziehenden Krieges mobilisiert und entwickelte eine starke „antimilitaristische“ Tradition. (29) Und während die marxistische Linke innerhalb der Sozialdemokratie zu einer isolierten Minderheit wurde, war ihr Einfluss innerhalb der radikalen Jugendorganisationen weitaus stärker. (30)
Was die Beschuldigungen angeht, dass die „Radikalen“ in ihrer Jugend Vagabunden gewesen seien, so lässt dies außer acht, dass diese „Wanderjahre“ eine typische Episode in proletarischen Biographien damals waren. Teils ein Überbleibsel aus der alten Tradition der wandernden Handwerksgesellen, die die ersten sozialistischen politischen Organisationen in Deutschland charakterisierten, wie den Bund der Kommunisten, war diese Tradition vor allem die Frucht des Arbeiterkampfes, um Kinderarbeit aus der Fabrik zu verbannen. Viele junge Arbeiter wollten eine Auszeit nehmen, um „die Welt zu sehen“, ehe sie sich dem Joch der Lohnsklaverei unterordneten. Zu Fuß unterwegs, wollten sie die deutschsprechenden Länder, Italien, den Balkan und gar den Nahen Osten erforschen. Jene, die mit der Arbeiterbewegung verknüpft waren, fanden freie oder billige Unterkunft in den Gewerkhäusern der großen Städte, politische und soziale Kontakte sowie Unterstützung in den örtlichen Jugendorganisationen. Auf diese Weise entstanden rund um politische, kulturelle, künstlerische und wissenschaftliche Entwicklungen Angelpunkte des internationalen Austausches. (31) Andere gingen zur See, lernten Sprachen und etablierten sozialistische Verbindungen rund um den Globus. Kein Wunder, dass diese Jugend zur Vorhut des proletarischen Internationalismus überall in Europa wurde! (32)
Wer waren die „revolutionären Obleute“?
Die Konterrevolution beschuldigte die Obleute, bezahlte Agenten ausländischer Regierungen - erst der Entente und dann des „Weltbolschewismus“ - zu sein. Im allgemeinen gingen sie in die Geschichte ein als eine Art Basisgewerkschafter, als eine lokalistische und fabrikorientierte Anti-Partei-Strömung. In „operaistischen“ Kreisen werden sie bewundernd als eine Art von revolutionärer Konspiration anerkannt, die den imperialistischen Krieg sabotiert habe. Wie kann man sonst die Art und Weise erklären, in der sie die Schlüsselsektoren und –fabriken der deutschen Waffenindustrie „infiltrierten“?
Bleiben wir bei den Tatsachen. Die Obleute begannen als ein kleiner Kreis von sozialdemokratischen Parteifunktionären und –mitgliedern, die durch ihre unerschütterliche Opposition gegen den Krieg das Vertrauen ihrer Kollegen erworben hatten. Sie hatten eine besonders starke Basis in der Hauptstadt Berlin und in der Metallindustrie, vor allem unter den Drehern. Sie gehörten zu den intelligentesten, gebildeten Arbeitern mit den höchsten Löhnen. Doch sie waren berühmt wegen ihres Sinnes für Unterstützung und Solidarität gegenüber anderen, schwächeren Bereichen der Klasse, wie die Frauen, die mobilisiert wurden, um die männlichen Arbeiter zu ersetzen, die an die Front geschickt wurden. Im Verlaufe des Krieges wuchs ein ganzes Netzwerk von politisierten Arbeitern um sie heran. Weit davon entfernt, eine Anti-Partei-Strömung zu sein, waren sie fast ausschließlich aus früheren Sozialdemokraten zusammengesetzt, die nun Mitglieder oder Sympathisanten des linken Flügels der USPD waren, einschließlich des Spartakusbundes. Sie beteiligten sich leidenschaftlich an allen politischen Debatten, die im revolutionären Untergrund während des gesamten Krieges stattfanden.
Die besondere Form dieser Politisierung war zu einem großen Teil durch die Bedingungen der klandestinen Aktivitäten bestimmt, die Massenversammlung rar und eine offene Diskussion unmöglich machten. In den Fabriken dagegen schützten die Arbeiter ihre Führer vor der Repression, häufig mit bemerkenswertem Erfolg. Das extensive Spitzelsystem der Gewerkschaften und der SPD scheiterte regelmäßig daran, auch nur die Namen der „Rädelsführer“ herauszufinden. Im Falle der Verhaftung hatte jeder dieser Delegierten einen Ersatz nominiert, der sofort die Lücke schloss.
Das „Geheimnis“ ihrer Fähigkeit, die Schlüsselsektoren der Industrie zu „infiltrieren“, war sehr einfach. Sie gehörten zu den „besten“ Arbeitern, so dass die Kapitalisten miteinander konkurrierten, um sie zu verpflichten. Auf diese Weise setzten die Arbeitgeber selbst, ohne es zu wissen, diese revolutionären Internationalisten in Schlüsselpositionen der Kriegswirtschaft.
Die Abwesenheit der Internationale
Es ist keine Eigentümlichkeit der Lage in Deutschland, dass die drei o.g. Kräfte innerhalb der Arbeiterklasse eine kreuzwichtige Rolle im Drama der Formierung der Partei spielten. Eines der Merkmale des Bolschewismus während der Revolution in Russland war die Weise, wie er im Grunde die gleichen Kräfte in der Arbeiterklasse vereint: die Vorkriegs-Partei, die das Programm und die organisatorische Erfahrung verkörperte; die fortgeschrittenen, klassenbewussten Arbeiter in den Fabriken und an den Arbeitsplätzen, die die Partei in der Klasse verankerten und eine entscheidende, positive Rolle bei der Lösung verschiedener Krisen in der Organisation spielten; und die revolutionäre Jugend, die durch den Kampf gegen den Krieg politisiert wurde.
Daran gemessen, fällt in Deutschland die Abwesenheit eines ähnlichen Grades an Einheit und gegenseitigem Vertrauen zwischen diesen wesentlichen Komponenten auf. Dies, und nicht irgendeine untergeordnete Qualität dieser Elemente selbst, war entscheidend. So besaßen die Bolschewiki die Mittel, um ihre Konfusionen zu klären und gleichzeitig ihre Einheit aufrechtzuerhalten und zu stärken. In Deutschland war dies nicht der Fall.
Die revolutionäre Avantgarde in Deutschland litt an einem tiefer verwurzelten Mangel an Einheit und Vertrauen in ihre eigene Mission.
Eine der Haupterklärungen dafür ist, dass die Deutsche Revolution sich einem mächtigeren Feind gegenübersah. Die Bourgeoisie in Deutschland war sicherlich grausamer als in Russland. Darüber hinaus hatte ihr die geschichtliche Phase, die durch den Weltkrieg eingeläutet worden war, eine neue und mächtige Waffe in ihre Hände gelegt. Deutschland vor 1914 war das Land mit den entwickeltsten Organisationen der Arbeiterbewegung weltweit gewesen. In der neuen Ära, in der die Gewerkschaften und die sozialdemokratischen Massenparteien nicht mehr der Sache des Proletariats dienen konnten, wurden diese Instrumente zu enormen Hindernissen. Hier war die Dialektik der Geschichte am Werk. Was einst eine Stärke der deutschen Arbeiterklasse gewesen war, wurde nun zu ihrer Schwäche.
Es bedarf Mut, um solch eine furchteinflößende Festung anzugreifen. Die Versuchung kann sehr stark sein, die Stärke des Feindes zu ignorieren, um sich selbst in Sicherheit zu wiegen.
Doch das Problem war nicht nur die Stärke der deutschen Bourgeoisie. Als das russische Proletariat 1917 den bürgerlichen Staat stürmte, war der Weltkapitalismus durch den imperialistischen Krieg noch immer gespalten. Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass das deutsche Militär tatsächlich Lenin und andere bolschewistische Führer zur Rückkehr nach Russland verhalf, da es hoffte, dass dies irgendwie den militärischen Widerstand seines Gegners an der Ostfront schwächen würde.
War der Krieg erst einmal vorbei, vereinigte sich die Weltbourgeoisie gegen das Proletariat. Einer der stärkeren Momente des ersten Kongresses der KPD war die Annahme einer Resolution, die die militärische Kollaboration der britischen und deutschen Militärs mit den lokalen Grundbesitzern in den baltischen Staaten beim Training konterrevolutionärer paramilitärischer Einheiten identifizierten und anprangerten, welche sich gegen „die russische Revolution heute“ und die „deutsche Revolution morgen“ richtete.
In solch einer Lage konnte nur eine neue Internationale den Revolutionären und dem gesamten Proletariat das notwendige Vertrauen und Selbstvertrauen geben. Die Revolution konnte in Russland noch erfolgreich sein ohne die Präsenz einer Weltpartei, weil die russische Bourgeoisie relativ schwach und isoliert war – aber dies traf nicht auf Deutschland zu. Die Kommunistische Internationale war noch nicht gegründet, als die entscheidende Konfrontation der Deutschen Revolution in Berlin stattfand. Nur eine solche Organisation hätte, indem sie die theoretischen Errungenschaften und die Erfahrungen des gesamten Proletariats zusammengebracht hätte, sich der Aufgabe, eine Weltrevolution anzuführen, als ebenbürtig erwiesen.
Erst bei Ausbruch des Großen Krieges dämmerte den Revolutionären die Notwendigkeit einer wirklich vereinten und zentralisierten internationalen linken Opposition. Doch unter den Bedingungen des Krieges war es äußerst schwer, sich organisatorisch zusammenzutun oder die politischen Divergenzen zu klären, die noch immer die beiden wichtigsten Strömungen in der Vorkriegs-Linken voneinander trennten: die Bolschewiki um Lenin und die deutsche und polnische Linke um Rosa Luxemburg. Dieser Mangel an Einheit vor dem Krieg machte es um so schwerer, die politischen Stärken von Strömungen in verschiedenen Ländern zum gemeinsamen Erbe aller zu machen und die Schwächen eines jeden zu vermindern.
In keinem Land saß der Schock nach dem Kollaps der Zweiten Internationale so tief wie in Deutschland. Hier wurde das Vertrauen in solche Qualitäten wie der theoretischen Bildung, der politischen Führung, der Zentralisierung oder der Parteidisziplin schwer erschüttert. Die Bedingungen des Krieges, der Krise der Arbeiterbewegung erschwerte die Wiederherstellung solch eines Vertrauens. (33)
Schlussfolgerung
In diesem Artikel haben wir uns auf die Schwächen konzentriert, die bei der Formierung der Partei auftauchten. Dies war notwendig, um die Niederlage Anfang 1919 zu verstehen, das Thema des nächsten Artikels. Doch trotz dieser Schwächen waren jene, die zur Gründung der KPD zusammenkamen, die besten Repräsentanten ihrer Klasse und verkörperten all das Edelmütige und Großherzige in der Menschheit, die wahren Repräsentanten einer besseren Zukunft. Wir werden auf dieses Thema am Ende dieser Serie zurückkommen.
Die Vereinigung der revolutionären Kräfte, die Bildung einer politischen Führung des Proletariats, die den Namen verdient, war zur zentralen Frage der Revolution geworden. Niemand verstand dies besser als jene Klasse, die von diesem Prozess direkt bedroht war. Vom 9. November an war die Hauptstoßrichtung des politischen Lebens der Bourgeoisie auf die Liquidierung des Spartakusbundes gerichtet. Die KPD war inmitten dieser Pogromatmosphäre gegründet worden, die die entscheidenden Schläge gegen die Revolution vorbereitete, die bald folgen sollten.
Dies wird das Thema des nächsten Artikels sein.
Steinklopfer
(1) Sozialdemokratische Partei Deutschlands
(2) Deutsche Soldaten in „feldgrauer“ Uniform.
(3) Internationale Kommunisten Deutschlands
(4) Die Tagesordnung, die im Einladungsschreiben angekündigt worden war, war: 1. Die Krise in der USPD; 2. Programm des Spartakusbundes; 3. Nationalversammlung; 4. Internationale Konferenz.
(5) Jogiches auf der anderen Seite wollte offensichtlich, dass die Obleute an der Gründung der Partei teilnehmen.
(6) Sechs der Militanten, die auf dieser Konferenz anwesend waren, sind in den darauf folgenden Monaten von den deutschen Behörden ermordet worden.
(7) Der Gründungsparteitag der KPD. Protokoll und Materialien. Herausgeber: Hermann Weber.
(8) Eugen Leviné wurde einige Monate später als einer der Führer der bayrischen Räterepublik hingerichtet.
(9) Frölich, ein prominenter Repräsentant der Bremer Linken, sollte später eine berühmte Biographie über Rosa Luxemburg schreiben.
(10) Protokoll und Materialien, S. 222.
(11) Obgleich er bald darauf jegliche Klassenpartei vollständig als bürgerlich ablehnte und eine eher individuelle Auffassung über die Entwicklung des Klassenbewusstseins entwickelte, blieb Otto Rühle dem Marxismus und der Sache der Arbeiterklasse treu verbunden. Schob auf dem Kongress war er Anhänger der „Einheitsorganisationen“ (politisch-ökonomische Gruppierungen), die nach seiner Auffassung sowohl die Partei als auch die Gewerkschaften ersetzen sollten. Luxemburg antwortete auf diese Auffassung, dass die Alternative zu den Gewerkschaften die Arbeiterräte und Massenorgane seien, nicht die Einheitsorganisationen.
(12) Protokoll und Materialien, S. 222.
(13) Laut Clara Zetkin wollte Jogiches in Reaktion auf die Diskussionen den Kongress scheitern lassen, d.h. die Parteigründung verschieben.
(14) Ebenda, S. 214.
(15) Ebenda, S. 206. Laut den Protokollen wurde dieser Vorschlag mit Rufen wie: „Ganz richtig!“ begrüßt. Glücklicherweise wurde Fränkels Antrag niedergestimmt.
(16) Ebenda, S. 209. Aus dem gleichen Grunde sagte Gelwitzki am Vortag, dass es eine Schande gewesen sei, die Frage überhaupt diskutiert zu haben. Und als Fritz Heckert, der nicht den gleichen revolutionären Ruf genoss wie Luxemburg oder Liebknecht versuchte, die Position des Zentralkomitees zur Beteiligung an den Parlamentswahlen zu verteidigen, wurde er durch einen Zwischenruf von Jakob unterbrochen, „hier spricht der Geist Noskes“ (S. 117). Noske, der sozialdemokratische Innenminister der damaligen bürgerlichen Regierung ging in die Geschichte ein als der „Bluthund der Konterrevolution“.
(17) Ebenda S. 224
(18) „Der Kongress verdeutlichte stark die Jugend und Unerfahrenheit der Partei. Die Verbindung zu den Massen war sehr schwach. Der Kongress bezog eine ironische Haltung gegenüber den linken Unabhängigen. Ich hatte nicht das Gefühl, schon eine Partei vor mir zu haben“.
(19) Ebenda S. 99-100
(20) Ebenda S. 271
(21) Ebenda S. 290
(22) Ebenda S. 302
(23) Siehe die Argumente Marxens und Engels im Bund der Kommunisten nach der Niederlage der Revolution 1848-1849.
(24) Protokolle und Materialien, S. 42, 43
(25) Ein Großteil der ausgeschlossenen Mehrheit gründete später die KAPD. Plötzlich gab es in Deutschland zwei kommunistische Parteien, eine wahrlich tragische Spaltung der revolutionären Kräfte!
(26) Max Hoelz, Sympathisant der KPD und der KAPD, dessen bewaffnete Unterstützer in Mitteldeutschland Anfang der 1920er Jahre aktiv waren.
(27) Walter Fähnders, Martin Rector: Linksradikalismus und Literatur, Untersuchungen zur Geschichte der sozialistischen Literatur in der Weimarer Republik.
(28) S. 262, Adam Scharrer, ein führender Kopf der KAPD, verteidigte bis zur Niederschlagung der linkskommunistischen Organisationen 1933weiterhin die Notwendigkeit einer revolutionären Klassenpartei.
(29) Die erste radikale sozialistische Jugendbewegung tauchte in Belgien in den 1860er Jahren auf, als junge Militante (mit einigermaßen Erfolg) unter den Soldaten in den Kasernen Agitation betrieben, um sie daran zu hindern, gegen streikende Arbeiter eingesetzt zu werden.
(30) Siehe Scharrers 1929 geschriebener Roman Vaterlandslose Gesellen sowie die Bibliographie und die Kommentare in „Arbeitskollektiv proletarisch-revolutionärer Romane“, veröffentlicht vom Oberbaumverlag Berlin.
(31) Einer der wichtigsten Zeitzeugen dieses Kapitels der Geschichte is Willi Münzenberg zum Beispiel in seinem Buch Die Dritte Front (Aufzeichnungen aus 15 Jahren proletarischer Jugendbewegung), zuerst 1930 veröffentlicht.
(32) Der anerkannte Führer der sozialistischen Vorkriegsjugend in Deutschland war Karl Liebknecht und in Italien Amadeo Bordiga.
(33) Das Beispiel der Reifung der sozialistischen Jugend in der Schweiz unter dem Einfluss regelmäßiger Diskussionen mit den Bolschewiki während des Krieges belegt, was unter günstigeren Bedingungen möglich war. „Mit großem psychologischem Geschick zog Lenin die Jugendlichen an sich heran, ging zu ihren Diskussionsabenden, lobte und kritisierte stets in offensichtlicher Teilnahme. Ferdy Böhny schrieb später: „Die Art, wie er mit uns diskutierte, glich dem sokratischen Gespräch.“ (Babette Gross, Willi Münzenberg, Eine politische Biografie, S. 93).
Leute:
- Liebknecht [82]
- Luxemburg [83]
- Jogiches [84]
- Richard Müller [90]
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Historische Ereignisse:
- Deutsche Revolution 1918 [91]
- 1919 [92]
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Theoretische Fragen:
- Internationalismus [36]
Erbe der kommunistischen Linke:
Griechenland: Gewerkschaftshausbesetzung: Bestimmen wir unsere Geschichte selbst, oder andere werden sie ohne uns bestimmen
- 4053 reads
Wir veröffentlichen eine Erklärung von kämpfenden Arbeitern aus Athen, die sich selbst als „aufständische Arbeiter" bezeichnen. Sie besetzen seit dem 17. Dezember den Sitz der GSEE (Allgemeiner Gewerkschaftsbund Griechenlands), welcher der Zentralsitz der Gewerkschaft ist und haben daraus einen Ort gemacht, wo man Vollversammlungen abhalten kann, Versammlungen die offen für alle sind.
Wir veröffentlichen eine Erklärung von kämpfenden ArbeiterInnen aus Athen, die sich selbst als „aufständische Arbeiter" bezeichnen. Sie halten seit dem 17. Dezember den Sitz der GSEE (Allgemeiner Gewerkschaftsbund Griechenlands) besetzt und haben daraus einen Ort gemacht, wo man Vollversammlungen abhalten kann, Versammlungen, die offen für alle sind.
Der Text auf dem Transparent, das fast eine ganze Fassadenseite der besetzten Gewerkschaftszentrale bedeckt, lautet:
* Angefangen von den so genannten Arbeitsunfällen bis hin zu den kaltblütigen Hinrichtungen - Staat und Kapital morden!
* Stoppt die Repression - sofortige Freilassung der Gefangenen!
* Generalstreik!
* Die Selbstorganisation der Arbeiter wird das Grab der Bosse sein!
Hervorzuheben gilt auch, dass ein fast identisches Szenario an der ökonomischen Fakultät der Athener Universität abläuft.
Wir werden später detaillierter auf die Ereignisse zurückkommen, die sich seit dem 6. Dezember in ganz Griechenland abspielen. Im Moment wollen wir die Schweigemaur durchbrechen, die von der verlogenen Berichterstattung der bürgerlichen Medien aufgebaut worden ist. Die Kämpfe werden lediglich als Krawalle einzelner jugendlicher Anarchisten dargestellt, die die Bevölkerung terrorisieren. Die Erklärung zeigt im Gegenteil, wie das solidarische Gefühl der Arbeiterklasse diese Bewegung auszeichnet und somit auch die verschiedenen Generationen der Proletarier verbindet.
***********
Wir, Handarbeiter, Angestellte, Erwerbslose, Zeitarbeiter, ob hier geboren oder eingewandert - wir sind keine passiven Fernsehkonsumenten. Seit dem Mord an Alexandros Grigoropoulos Samstagnacht nehmen wir an den Demonstrationen teil, an den Zusammenstößen mit der Polizei, den Besetzungen der Innenstadt oder der Wohnviertel. Immer wieder haben wir unsere Arbeit und unsere täglichen Verpflichtungen fallen gelassen, um mit den Schülern, Studenten und den anderen kämpfenden Proletariern auf die Straße zu gehen.
Wir haben entschieden, das Gebäude der GSEE zu besetzen:
* um es in einen Ort des freien Meinungsaustausches und in einen Treffpunkt für ArbeiterInnen zu verwandeln;
* um den von den Medien verbreiteten Irrglauben, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen nicht an den Zusammenstößen der letzten Tage beteiligt waren, dass die um sich greifende Wut die Sache von 500 „Vermummten“, „Hooligans“ sei, sowie andere Ammenmärchen, die verbreitet werden, zu widerlegen. Auf den Fernsehschirmen werden die ArbeiterInnen als Opfer der Unruhen dargestellt, während gleichzeitig die unzähligen Entlassungen infolge der kapitalistischen Krise in Griechenland und der restlichen Welt von den Medien und ihren Managern als „Naturereignisse“ betrachtet werden;
* um die Rolle der Gewerkschaftsbürokratie bei der Untergrabung des Aufstandes - und nicht nur dort - aufzudecken. Die GSEE und der ganze seit Jahrzehnten dahintersteckende gewerkschaftliche Apparat untergraben die Kämpfe, handeln Brosamen für unsere Arbeitskraft aus und verewigen das System der Ausbeutung und der Lohnsklaverei. Das Vorgehen der GSEE am letzten Mittwoch (dem Tag des Generalstreiks) ist ziemlich erhellend: Die GSEE sagte eine vorgesehene Demonstration der streikenden ArbeiterInnen ab, stattdessen gab es eine kurze Kundgebung am Syntagma-Platz, bei der Erstere aus Furcht davor, dass sie vom Virus des Aufstandes angesteckt werden, dafür sorgte, dass die Leute in aller Eile den Platz verließen;
* um diesen Ort, der durch unsere Beiträge errichtet wurde, von dem wir aber ausgeschlossen waren, zum ersten Mal zu einem offenen Ort zu machen. Einem offenen Ort, der die gesellschaftliche Öffnung, die der Aufstand hervorgebracht hat, fortsetzt. All die vielen Jahre haben wir schicksalhaft allen möglichen Heilsverkündern geglaubt und dabei unsere Würde verloren. Als Arbeiter und Arbeiterinnen müssen wir unsere Sache selbst in die Hand nehmen und Schluss damit machen, auf kluge Anführer oder „fähige“ Vertreter zu hoffen. Wir müssen unsere Stimme gegen die ständigen Angriffe erheben, uns treffen, miteinander reden, zusammen entscheiden und handeln. Gegen die allgemeinen Angriffe einen langen Kampf führen. Die Entwicklung eines kollektiven Widerstandes an der Basis ist der einzige Weg dazu;
* um die Idee der Selbstorganisation und Solidarität an den Arbeitsplätzen, der Kampfkomitees und des kollektiven Handelns der Basis zu verbreiten und dadurch die Gewerkschaftsbürokratien abzuschaffen.
All die Jahre haben wir das Elend hinuntergeschluckt, die Ausnutzung der Situation der Schwächeren, die Gewalt auf der Arbeit. Wir haben uns daran gewöhnt, die Verkrüppelten und die Toten - die sogenannten „Arbeitsunfälle“ - einfach nur noch zu zählen. Wir haben uns daran gewöhnt, zu ignorieren, dass die Migranten, unsere Klassenbrüder- und schwestern, getötet werden. Wir haben die Schnauze voll davon, mit der Angst um unseren Lohn und in Aussicht auf eine Rente zu leben, die sich mittlerweile wie ein in die Ferne entrückter Traum anfühlt.
So wie wir darum kämpfen, unser Leben nicht für die Bosse und die Gewerkschaftsvertreter zu vergeuden, so werden wir auch keinen der verhafteten Aufständischen allein lassen, die sich in den Händen des Staates und der Justizmaschine befinden.
Sofortige Freilassung der Festgenommenen!
Keine Strafe für die Verhafteten!
Selbstorganisation der Arbeiter und Arbeiterinnen!
Generalstreik!
Die Arbeiter-Versammlung im „befreiten“ Gebäude der GSEE
Mittwoch, 17. Dezember 2008, 18:00 Uhr.
Die Vollversammlung der aufständischen ArbeiterInnen
(Die Besetzung des GSEE-Gebäudes wurde am 21. Dezember beendet und ging am Polytechnischen Institut weiter...)
Geographisch:
- Griechenland [94]
Aktuelles und Laufendes:
- Griechenland [95]
- Studenten- und Arbeiterunruhen [96]
- Studentenbewegung [97]
Leute:
Theoretische Fragen:
- Arbeiterklasse [21]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Proletarischer Kampf [75]
Solidarität mit der Bewegung der Studenten in Griechenland!
- 4525 reads
Der Ausbruch der Wut und der Revolte der jungen Arbeitergenerationen in Griechenland ist kein isoliertes oder besonderes Phänomen. Ihre Wurzeln liegen in der Weltwirtschaftskrise des Kapitalismus. Der Zusammenstoß der Protestierenden mit dem gewalttätigen Unterdrückungsapparat entblößt das wahre Gesicht der bürgerlichen Herrschaft und des Staatsterrors. Es ist eine direkte Fortsetzung der Mobilisierung der Jugendlichen auf einem Klassenterrain wie in Frankreich im Zusammenhang mit dem CPE-Gesetz im Frühjahr 2006 und dem LRU 2007, als die Studenten und Gymnasiasten sich vor allem als zukünftige Beschäftigte sahen, die gegen ihre künftigen Ausbeutungsbedingungen protestierten. Alle Herrschenden der wichtigsten europäischen Länder haben dies auch so verstanden, denn sie haben ihre Besorgnis zum Ausdruck gebracht, dass ähnliche soziale Explosionen aus Widerstand gegen die Zuspitzung der Krise auch woanders ausbrechen. So hat bezeichnenderweise die herrschende Klasse in Frankreich einen Rückzieher gemacht, indem sie ganz überstürzt ihr Programm zur Reformierung der Gymnasien (siehe dazu den Artikel auf unserer französischsprachigen Website) vorläufig auf Eis gelegt hat. Der internationale Charakter der Proteste und die wachsende Kampfbereitschaft der Studenten und vor allem der Schüler ist schon deutlich zu spüren.
Der Ausbruch der Wut und der Revolte der jungen Arbeitergenerationen in Griechenland ist kein isoliertes oder besonderes Phänomen. Ihre Wurzeln liegen in der Weltwirtschaftskrise des Kapitalismus. Der Zusammenstoß der Protestierenden mit dem gewalttätigen Unterdrückungsapparat entblößt das wahre Gesicht der bürgerlichen Herrschaft und des Staatsterrors. Es ist eine direkte Fortsetzung der Mobilisierung der Jugendlichen auf einem Klassenterrain wie in Frankreich im Zusammenhang mit dem CPE-Gesetz im Frühjahr 2006 und dem LRU 2007, als die Studenten und Gymnasiasten sich vor allem als zukünftige Beschäftigte sahen, die gegen ihre künftigen Ausbeutungsbedingungen protestierten. Alle Herrschenden der wichtigsten europäischen Länder haben dies auch so verstanden, denn sie haben ihre Besorgnis zum Ausdruck gebracht, dass ähnliche soziale Explosionen aus Widerstand gegen die Zuspitzung der Krise auch woanders ausbrechen. So hat bezeichnenderweise die herrschende Klasse in Frankreich einen Rückzieher gemacht, indem sie ganz überstürzt ihr Programm zur Reformierung der Gymnasien (siehe dazu den Artikel auf unserer französischsprachigen Website) vorläufig auf Eis gelegt hat. Der internationale Charakter der Proteste und die wachsende Kampfbereitschaft der Studenten und vor allem der Schüler ist schon deutlich zu spüren.
In Italien fanden am 25. Oktober und am 14. November massive Demonstrationen unter dem Motto „Wir wollen nicht für die Krise blechen“ gegen die Regierungsverordnung von Gelmini statt, die zahlreiche Einschnitte im Erziehungswesen mit drastischen Konsequenzen anstrebt: So sollen zum Beispiel die Zeitverträge von 87.000 Lehrern und 45.000 anderen Beschäftigten des Erziehungswesens nicht verlängert werden. Gleichzeitig sollen umfangreiche Kürzungen in den Universitäten vorgenommen werden.
In Deutschland sind am 12. November ca. 120.000 Schüler in den meisten Großstädten des Landes auf die Straße gegangen und haben zum Teil Parolen gerufen wie „Der Kapitalismus ist die Krise“ (Berlin) oder das Landesparlament in Hannover belagert.
In Spanien sind am 13. November Hunderttausende Studenten in mehr als 70 Städten auf die Straße gegangen, um gegen die neuen, europaweit gültigen Bologna-Bestimmungen der Bildungsreform und der Universitäten zu protestieren, in denen u.a. die Privatisierung der Universitäten und immer mehr Praktika in den Unternehmen vorgesehen sind.
Viele von ihnen identifizieren sich mit dem Kampf der griechischen Studenten. In vielen Ländern sind zahlreiche Kundgebungen und Solidaritätsveranstaltungen gegen die Repression, unter der die griechischen Studenten leiden, organisiert worden, wobei die Polizei auch sehr oft gewaltsam dagegen vorgegangen ist.
Das Ausmaß der Mobilisierung gegen diese gleichen, staatlichen Maßnahmen überrascht keineswegs. Die europaweite Reform des Bildungswesens dient der Anpassung der jungen Arbeitergeneration an eine perspektivlose Zukunft und der Generalisierung prekärer Arbeitsbedingungen sowie der Arbeitslosigkeit.
Der Widerstand und die Revolte der neuen Generationen von Schülern, die die zukünftigen Beschäftigten stellen werden, gegen die Arbeitslosigkeit und dieses ganze Ausmaß an Prekarisierung lässt überall ein Gefühl der Sympathie unter den ArbeiterInnen aufkommen, das bei allen Generationen zu spüren ist.
Gewalt durch Minderheiten oder massiver Kampf gegen die Ausbeutung und den Staatsterror?
Die in den Diensten der Lügenpropaganda des Kapitals stehenden Medien haben permanent versucht, die Wirklichkeit der Ereignisse in Griechenland seit der Ermordung des 15jährigen Alexis Andreas Grigropoulos am 6. Dezember zu verzerren. Sie stellen die Zusammenstöße mit der Polizei entweder als das Werk einer Handvoll autonomer Anarchisten und linksextremer Studenten aus einem wohlbetuchten Milieu dar oder als das Vorgehen von Schlägern aus Randgruppen. Ständig werden in den Medien Bilder von gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei gesendet. Vor allem erscheinen Bilder von Jugendlichen, die Autos anstecken, Schaufenster von Geschäften und Banken zerschlagen, oder Bilder von Plünderungen von Geschäften.
Das ist die gleiche Fälschungsmethode, die 2006 gegen die Proteste gegen den CPE in Frankreich angewandt wurde, als die Proteste der Studenten mit den Aufständen in den Vorstädten von Paris im Herbst 2005 in den gleichen Topf geworfen wurden. Es ist das gleiche Vorgehen wie bei den Protesten gegen den LRU 2007 in Frankreich, als die Demonstranten als „Terroristen“ oder „Rote Khmer“ beschimpft wurden.
Aber auch wenn das Zentrum der Zusammenstöße im griechischen „Quartier Latin“, in Exarcia, lag, kann man heute solch Lügen nur viel schwerer verbreiten. Wie könnten diese aufständischen Erhebungen das Werk von Randalierern oder anarchistischen Aktivisten sein, da sie sich doch lawinenartig auf alle Städte das Landes und selbst bis auf die Inseln (Chios, Samos) und bis in die großen Touristenhochburgen wie Korfu oder Kreta oder Heraklion ausgedehnt haben?
Die Gründe für die Wut
Alle Ingredienzien waren vorhanden, damit die Unzufriedenheit eines Großteils der jungen Arbeitergeneration sich ein Ventil sucht. Diese Generation hat Angst vor der Zukunft, die ihnen der Kapitalismus bietet. Griechenland verdeutlicht die Sackgasse, in welcher der Kapitalismus steckt und die auf alle Jugendlichen zukommen wird. Wenn diejenigen, die die „Generation der 600 Euro-Jobber“ genannt wird, auf dem Arbeitsmarkt auftauchen, haben sie den Eindruck, verarscht zu werden. Die meisten Studenten können ihr Studium nur finanzieren und überleben, indem sie in zwei Jobs schuften. Sie müssen kleine Jobs, meist unterbezahlte Schwarzarbeit, annehmen. Selbst in besser bezahlten Jobs wird ein Großteil des Lohns nicht versteuert, wodurch der Anspruch auf Sozialleistungen geschmälert wird. Insbesondere gelangen sie nicht in den Genuss der Sozialversicherung. Überstunden werden ebensowenig bezahlt. Oft können sie bis Mitte 30 nicht von zu Hause ausziehen, weil sie keine Miete zahlen können. 23 Prozent der Arbeitslosen in Griechenland sind Jugendliche (die Jugendarbeitslosigkeit der 15 bis 24-Jährigen beträgt offiziell 25,2 Prozent). Wie eine französische Zeitung schrieb: „Diese Studenten fühlen sich durch niemanden mehr geschützt: Die Polizei schlägt auf sie ein bzw. schießt auf sie; durch das Bildungswesen stecken sie in einer Sackgasse, einen Job kriegen sie nicht, die Regierung belügt sie.“ (1) Die Jugendarbeitslosigkeit und ihre Schwierigkeiten in der Arbeitswelt haben somit ein Klima der allgemeinen Verunsicherung, der Wut und der Angst geschaffen. Die Weltwirtschaftskrise löst immer neue Wellen von Entlassungen aus. 2009 erwartet man allein in Griechenland den Abbau von mehr als 100.000 Arbeitsplätzen; dies allein würde fünf Prozent mehr Arbeitslose bedeuten. Gleichzeitig verdienen mehr als 40 Prozent der Beschäftigten weniger als 1100 Euro brutto im Monat. In Griechenland gibt es die meisten Niedriglöhner unter den 27 Staaten der EU: 14 Prozent.
Aber nicht nur die Jugendlichen sind auf die Straße gegangen, sondern auch die schlecht bezahlten Lehrer und viele Beschäftigte, die den gleichen Problemen, der gleichen Armut gegenüberstehen und von dem gleichen Gefühl der Revolte angetrieben werden. Die brutale Repression gegen die Bewegung, bei der der Mord an dem 15-jährigen Jugendlichen nur die dramatischste Episode war, hat dieses Gefühl der Solidarität nur noch gestärkt. Die soziale Unzufriedenheit bricht sich immer stärker Bahn. Wie ein Student berichtete, waren auch viele Eltern zutiefst schockiert über die Ereignisse: „Unsere Eltern haben festgestellt, dass ihre Kinder durch die Schüsse eines Polizisten ums Leben kommen“ (2). Sie haben den Fäulnisprozess einer Gesellschaft gerochen, in der ihre Kinder nicht den gleichen Lebensstandard erreichen werden wie sie. Auf zahlreichen Demonstrationen haben sie mit eigenen Augen das gewalttätige Vorgehen der Polizei, die brutalen Verhaftungen, den Einsatz von Schusswaffen durch die Ordnungskräfte und das harte Eingreifen der Bereitschaftspolizei (MAT) beobachten können.
Nicht nur die Besetzer der Polytechnischen Hochschule, das Zentrum der Studentenproteste, prangern den Staatsterror an. Diese Wut über die polizeiliche Repression trifft man auch auf allen Demonstrationen an, wo Parolen gerufen werden wie: „Kugeln gegen die Jugendlichen, Geld für die Banken“. Noch deutlicher war ein Teilnehmer der Bewegung, der erklärte: „Wir haben keine Arbeit, kein Geld; der Staat ist wegen der Krise pleite, und die einzige Reaktion, die wir sehen, ist, dass man der Polizei noch mehr Waffen gibt“ (3).
Diese Wut ist nicht neu. Schon im Juni 2006 waren die Studenten gegen die Universitätsreform auf die Straße gegangen, da die Privatisierung der Unis den weniger wohlhabenden Studenten den Zugang zur Uni verwehrte. Die Bevölkerung hat auch gegen die Schlamperei der Regierung während der Waldbrände im Sommer 2007 protestiert, als 67 Menschen zu Tode gekommen waren. Die Regierung hat bis heute noch nicht jene Menschen entschädigt, die ihre Häuser, ihr Hab und Gut verloren hatten. Aber vor allem die Beschäftigten waren massiv gegen die Regierungspläne einer „Rentenreform“ auf den Plan getreten; Anfang 2008 fand zweimal innerhalb von zwei Monaten ein Generalstreik mit hoher Beteiligung statt. Damals beteiligten sich mehr als eine Millionen Menschen an den Demonstrationen gegen die Abschaffung des Vorruhestands für Schwerabeiter und die Aufkündigung der Vorruhestandsregelung für über 50-jährige Arbeiterinnen.
Angesichts der Wut der Beschäftigten sollte der Generalstreik vom 10. Dezember, der von den Gewerkschaften kontrolliert wurde, als Ablenkungsmanöver gegen die Bewegung dienen. Die Gewerkschaften forderten, mit der SP und der KP an der Spitze, den Rücktritt der gegenwärtigen Regierung und vorgezogene Neuwahlen. Allerdings konnten die Wut und die Bewegung nicht eingedämmt werden - trotz der verschiedenen Manöver der Linksparteien und der Gewerkschaften, um die Dynamik bei der Ausdehnung des Kampfes zu hemmen, und trotz all der Anstrengungen der herrschenden Klasse und ihrer Medien zur Isolierung der Jugendlichen gegenüber den anderen Generationen und der gesamten Arbeiterklasse, indem man versuchte, diese in sinnlose Zusammenstöße mit der Polizei zu treiben. Die ganze Zeit über gab es immer wieder Zusammenstöße: gewaltsames Vorgehen der Polizei mit Gummiknüppel und Tränengaseinsätzen, Verhaftungen und Verprügeln von Dutzenden von Protestierenden.
Die jungen Arbeitergenerationen bringen am klarsten das Gefühl der Desillusionierung und der Abscheu gegenüber einem total korrupten politischen Apparat zum Ausdruck. Seit dem Krieg teilen sich drei Familien die Macht und seit mehr als 30 Jahren herrschen in ständigem Wechsel die beiden Dynastien Karamanlis (auf dem rechten Flügel) und Papandreou (auf dem linken Flügel) - begleitet jeweils von großen Bestechungsaffären und Skandalen. Die Konservativen haben 2004, nach großen Skandalen der Sozialisten in den Jahren zuvor, die Macht übernommen. Viele lehnen mittlerweile den ganzen politischen und gewerkschaftlichen Apparat ab, der immer mehr an Glaubwürdigkeit verliert. „Der Geldfetisch beherrscht die Gesellschaft immer mehr. Die Jugendlichen wollen mit dieser seelenlosen und visionslosen Gesellschaft brechen.“ (4) Vor dem Hintergrund der Krise hat diese Generation von Arbeitern nicht nur ihr Bewusstsein über eine kapitalistische Ausbeutung weiterentwickelt, die sie an ihrem eigenen Leib spürt, sondern sie bringt auch das Bewusstsein für die Notwendigkeit eines gemeinsamen Kampfes zum Ausdruck, indem sie spontan die Methoden der Arbeiterklasse anwendet und ihre Solidarität sucht. Anstatt der Hoffnungslosigkeit zu verfallen, gewinnt sie ihr Selbstvertrauen aus der Tatsache, dass sie die Trägerin einer neuen Zukunft ist; sie setzt sich mit aller Macht gegen den Fäulnisprozess der Gesellschaft zu Wehr, in der sie lebt. So haben die Demonstranten ihren Stolz zum Ausdruck gebracht, als sie riefen: „Wir stellen ein Bild der Zukunft gegenüber einer sehr düsteren Vergangenheit dar“.
Die Lage erinnert an die Verhältnisse im Mai 1968, aber das Bewusstsein dessen, was heute auf dem Spiel steht, geht viel weiter.
Die Radikalisierung der Bewegung
Am 16. Dezember besetzten Studenten wenige Minuten lang die Studios des Regierungsenders NET und rollten vor den Kameras ein Spruchband aus: „Hört auf, Fernsehen zu sehen. Kommt alle auf die Straße!“. Und sie riefen dazu auf: „Der Staat tötet. Euer Schweigen ist seine Waffe. Besetzen wir alle öffentlichen Gebäude!“ Der Sitz der Bürgerkriegspolizei Athens wurde angegriffen und ein Fahrzeug dieser Polizeitruppen angezündet. Diese Aktionen wurden daraufhin sofort von der Regierung als „Versuch des Umsturzes der Demokratie“ gebrandmarkt und auch von der KP Griechenlands (KKE) verurteilt. Am 17. Dezember wurde das Gebäude der größten Gewerkschaft Griechenlands GSEE (Allgemeiner Gewerkschaftsbund Griechenlands) in Athen von Beschäftigten besetzt, die die ArbeiterInnen dazu aufriefen, an diesem Ort zusammenzukommen, um Vollversammlungen abzuhalten, die allen Beschäftigten, allen StudentInnen und den Arbeitslosen offen stehen (siehe dazu die auf unserer Website und in dieser Zeitung veröffentlichte Erklärung). Vor der Akropolis wurden Spruchbänder angebracht, die zu einer Massenkundgebung am folgenden Tag aufriefen. Am Abend versuchten ca. 50 Gewerkschaftsbonzen und deren Führer, die Gewerkschaftszentrale zurückzuerobern, mussten aber vor den Studenten, die schnell Verstärkung erhielten, die Flucht ergreifen. Diese Verstärkung kam vor allem von meist anarchistischen Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, die ebenfalls besetzt und in einen Ort der Versammlungen und Diskussionen umgewandelt worden war, der auch allen Beschäftigen offen stand. Man eilte den Besetzern zur Hilfe und rief: „Solidarität“. Der Verband albanischer Migranten verbreitete u.a. einen Text, in dem er seine Solidarität mit der Bewegung bekundete: „Diese Tage sind auch unsere Tage“! Immer lauter wurde zu einem unbefristeten Generalstreik aufgerufen. Die Gewerkschaften sahen sich gezwungen, am 18. Dezember zu einem dreistündigen Generalstreik im öffentlichen Dienst aufzurufen.
Am Morgen des 18. Dezember wurde ein weiterer Schüler, 16 Jahre alt, der sich an einem Sit-in in der Nähe seiner Schule in einem Athener Vorort beteiligte, von einer Kugel verletzt. Am gleichen Tag wurden mehrere Radio- und Fernsehstudios durch Demonstranten besetzt, insbesondere in Tripoli, Chania und Thessaloniki. Das Gebäude der Handelskammer in Patras wurde besetzt, wo es erneut zu Zusammenstößen mit der Polizei kam. Die gigantische Demonstration in Athen wurde gewaltsam angegriffen. Dabei setzte die Bürgerkriegspolizei neue Waffen ein: lähmende Gase und ohrenbetäubende Granaten. Ein Flugblatt, das sich gegen den Staatsterror richtete, wurde von „revoltierenden Schülerinnen“ unterzeichnet und in der Wirtschaftswissenschaftlichen Universität verteilt. Die Bewegung spürte ganz vage ihre eigenen geographischen Grenzen. Deshalb nahm sie mit Enthusiasmus die internationalen Solidaritätsdemonstrationen in Frankreich, Berlin, Rom, Moskau, Montreal oder in New York auf. Die Rückmeldung lautete: „Diese Unterstützung ist für uns sehr wichtig“. Die Besetzer der Polytechnischen Hochschule riefen zu einem „internationalen Aktionstag gegen die staatlichen Tötungen“ am 20. Dezember auf. Der einzige Weg, die Isolierung dieses proletarischen Widerstandes in Griechenland zu überwinden, besteht darin, die Solidarität und den Klassenkampf, die heute als Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise immer deutlicher in Erscheinung treten, international zu entfalten.
Iannis, 19.12.08
(1) Marianne Nr. 608, 13. Dezember 2008 : „Grèce : les leçons d'une émeute“.
(2) Libération, 12. Dezember 2008.
(3) Le Monde , 10. Dezember 2008.
(4) Marianne, s.o.
