Internationale Revue 43
- 2896 reads
Dekadenz des Kapitalismus (2)
- 3465 reads
Welche wissenschaftliche Methode benötigen wir, um die gegenwärtige gesellschaftliche Ordnung und die Bedingungen und Mittel ihrer Aufhebung zu verstehen?
Im ersten Teil dieser Serie untersuchten wir die Abfolge der Weltkriege, Revolutionen und globalen Wirtschaftskrisen, die den Eintritt des Kapitalismus in seine Niedergangsepoche im frühen 20. Jahrhundert ankündeten und die die Menschheit vor die historische Alternative stellen: Errichtung einer höheren Produktionsweise oder Rückfall in die Barbarei. Aber das Verständnis der Ursprünge und Ursachen der Krisen, denen sich die Menschheit gegenübersieht, bedarf einer Theorie, die die gesamte Bewegung der Geschichte umfasst. Allgemeine Geschichtstheorien sind nicht mehr angesagt unter den offiziellen Historikern, die mit Fortdauer der Niedergangsepoche des Kapitalismus zunehmend in Verlegenheit gerieten, irgendeinen Über- und einen wirklichen Einblick in die Quellen der Spirale von Katastrophen anzubieten, die diese Periode gekennzeichnet haben. Große historische Visionen sind nicht mehr in Mode; sie werden abgetan als Abkömmlinge des idealistischen deutschen Philosophen Hegel oder der allzu optimistischen englischen Liberalen, die auf dem gleichen Gebiet die Idee eines stetigen Fortschritts der Geschichte aus der Dunkelheit und Tyrannei zur wunderbaren Freiheit der Bürger im modernen Verfassungsstaat entwickelten.
In der Tat ist diese Unfähigkeit, die historische Bewegung in ihrer Gesamtheit zu sehen, kennzeichnend für eine Klasse, die nicht mehr für den historischen Fortschritt steht und deren Gesellschaftssystem der Menschheit keine Zukunft mehr anbieten kann. Als die Bourgeoisie noch davon überzeugt war, dass ihre Produktionsweise im Vergleich zu früheren Gesellschaftsformen einen fundamentalen Fortschritt für die Menschheit darstellte und als sie die Zukunft mit dem wachsenden Selbstvertrauen einer im Aufstieg befindlichen Klasse betrachten konnte, da konnte sie noch einen längeren Blick zurück, aber auch nach vorn wagen. Die Schrecken in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts versetzten diesem Vertrauen den Todesstoß. Nicht nur dass symbolische Ortsnamen wie die Somme oder Passchendaele, wo Zehntausende von jungen Eingezogenen im I. Weltkrieg abgeschlachtet wurden, oder Auschwitz und Hiroshima, synonym für den Massenmord an Zivilisten durch den Staat, oder gleichermaßen symbolische Daten wie 1914, 1929 und 1939 alle früheren Behauptungen über den Fortschritt in Frage stellen; sie legen auch auf alarmierende Weise nahe, dass die gegenwärtige Gesellschaftsordnung nicht so ewig sein wird, wie es einst schien. Insgesamt ziehen es die bürgerlichen Geschichtsschreiber angesichts der Aussicht auf ihr eigenes Dahinscheiden - entweder durch den Kollaps ihrer Ordnung in eine Anarchie oder, was für die Bourgeoisie auf dasselbe hinausläuft, durch ihren Sturz durch die revolutionäre Arbeiterklasse - vor, Scheuklappen aufzusetzen und sich selbst in einem engstirnigen Kurzzeit-Empirismus zu verlieren - kurzzeitig und lokal - oder Theorien wie den Relativismus und Postmodernismus zu entwickeln, die jeglichen Begriff einer fortschrittlichen Bewegung von einer Epoche zur nächsten und jeglichen Versuch ablehnen, ein Entwicklungsmuster in der menschlichen Geschichte auszumachen. Darüber hinaus wird diese Unterdrückung des historischen Bewusstseins täglich im Bereich der Massenkultur verstärkt, intensiviert durch die verzweifelten Bedürfnisse des Marktes: Alles von Wert muss jetzt und neu sein, von nirgendwo kommend, ins Nirgendwo gehend.
Angesichts der Kleingeistigkeit eines großen Teils der etablierten Gelehrtheit ist es kein Wunder, dass so viele, die noch immer danach streben, den allgemeinen Sinn der Geschichte insgesamt zu verstehen, von den Verkäufern des Schlangengifts der Religion und des Okkultismus betört werden. Der Nazismus war eine frühe Manifestation dieses Trends - ein Kunterbunt von okkultistischen Theosophien, Pseudo-Darwinismus und rassistischen Verschwörungstheorien, die eine einfache Lösung all der Probleme der Welt anbieten und jede weitere Notwendigkeit des Denkens wirksam annullieren. Der islamische und christliche Fundamentalismus oder die zahllosen Verschwörungstheorien über die Geheimgesellschaften, die die Geschichte manipulieren, spielen heute dieselbe Rolle. Die offizielle bürgerliche Vernunft versagt nicht nur darin, auch nur eine bescheidene Antwort auf die Probleme im gesellschaftlichen Bereich anzubieten - sie hat es größtenteils aufgegeben, diese Fragen erst zu stellen, und überlässt somit der Unvernunft das Feld, die an ihren eigenen mythologischen Lösungen bastelt.
Die herrschende Weisheit ist sich in einem gewissen Sinn all dessen bewusst. Sie ist bereit, anzuerkennen, dass sie in der Tat einen Verlust ihres Selbstvertrauens erlitten hat. Statt positiv die Lobpreisungen des liberalen Kapitalismus als die feinsten Errungenschaften des menschlichen Geistes nachzubeten, neigt sie nun dazu, ihn als die beste unter den schlechten Lösungen zu porträtieren, sicherlich verunstaltet, aber allemal all den Formen des Fanatismus vorzuziehen, die allem Anschein gegen sie aufgeboten werden. Im Lager der Fanatiker äußert sich dies nicht nur im Faschismus oder im islamischen Terrorismus, sondern betrifft auch den Marxismus, der nun endgültig als ein Markenzeichen für utopischen Messianismus zurückgewiesen wird. Wie oft ist uns erzählt worden, üblicherweise von drittklassigen Denkern, die die Allüren haben, etwas Neues zu sagen: Die marxistische Geschichtsanschauung sei eine bloße Umkehrung des judäisch-christlichen Mythos von der Geschichte als eine Erlösungsgeschichte; der Urkommunismus sei der Garten Eden, der künftige Kommunismus das kommende Paradies; das Proletariat sei das auserwählte Volk oder der leidende Knecht Gottes, die Kommunisten seien die Propheten. Doch uns wird ebenfalls erzählt, dass diese religiösen Projektionen alles andere als harmlos seien: Die Realität der „marxistischen Herrschaft" habe gezeigt, wo solche Versuche, den Himmel auf Erden zu verwirklichen, enden müssten - in der Tyrannei und in Arbeitslagern, in dem irrsinnigen Projekt, die unvollkommene Menschheit nach seiner Vision von Perfektion zu modellieren.
Und in der Tat wird diese Analyse vom Werdegang des Marxismus im 20. Jahrhundert allem Anschein nach bestätigt. Wer kann leugnen, dass Stalins GPU an die Heilige Inquisition erinnert oder dass Lenin, Stalin, Mao und andere Große Führer zu den neuen Göttern auserkoren wurden? Doch dieser Beweis ist zutiefst unsolide. Er beruht auf der größten Lüge des Jahrhunderts: dass Stalinismus gleich Kommunismus gewesen sei, wo er tatsächlich dessen totale Negation war. Wenn der Stalinismus in der Tat eine Form der kapitalistischen Konterrevolution war, wie wirklich revolutionäre Marxisten meinen, dann muss das Argument, dass die marxistische Theorie unvermeidlich zum Gulag führen musste, in Frage gestellt werden.
Und wir können auch so antworten, wie Engels dies in seinen Schriften über die Frühgeschichte des Christentums getan hatte, nämlich dass die Ähnlichkeiten zwischen den Ideen der modernen Arbeiterbewegung und den Worten der biblischen Propheten oder der frühen Christen nicht befremdlich sind, da auch Letztere das Streben der unterdrückten und ausgebeuteten Klassen und ihre Hoffnungen auf eine Welt, die auf menschlicher Solidarität statt auf Klassenherrschaft beruht, repräsentierten. Wegen der Einschränkungen, die von den Gesellschaftssystemen erzwungen wurden, in welchen sie auftraten, konnten diese frühen Kommunisten nicht über die religiöse oder mystische Vision einer klassenlosen Gesellschaft hinausgehen. Heute ist dies nicht mehr der Fall, weil die historische Entwicklung die kommunistische Gesellschaft zu einer rationalen Möglichkeit sowie zu einer dringenden Notwendigkeit gemacht hat. Nur indem wir den modernen Kommunismus nicht im Lichte alter Mythen betrachten, können wir die alten Mythen im Lichte des modernen Kommunismus begreifen.
Für uns ist der Marxismus, der historische Materialismus nichts, wenn nicht der theoretische Ausblick einer Klasse, die eine neue und höhere gesellschaftliche Form in sich trägt. Ihre Bemühungen, ja ihr Bedürfnis, die Geschichte der Vergangenheit und die Perspektiven für die Zukunft zu untersuchen, sind somit nicht überschattet von den Vorurteilen einer herrschenden Klasse, die letztendlich stets dazu gezwungen ist, die Realität im Interesse ihres Ausbeutungssystems zu leugnen und zu vernebeln. Die marxistische Theorie basiert auch, im Gegensatz zu den romantischen Bestrebungen früherer ausgebeuteter Klassen, auf einer wissenschaftlichen Methode. Sie mag zwar keine exakte Wissenschaft im Sinne der Naturwissenschaften sein, da sie die Menschheit und ihre höchst komplexe Geschichte nicht auf eine Reihe reproduzierbarer Laborexperimente reduzieren kann - aber diesen Gesetzmäßigkeiten ist auch die Evolutionstheorie unterworfen. Der Punkt ist, dass allein der Marxismus in der Lage ist, die wissenschaftliche Methode auf die Untersuchung der herrschenden Gesellschaftsordnung und auf die Gesellschaftsordnungen anzuwenden, die ihr vorausgingen, indem er rigoros die beste geisteswissenschaftliche Forschung nutzt, die die herrschende Klasse anbieten kann, und über sie hinausgeht sowie eine höhere Synthese skizziert.
Vorwort zur Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie
1859 schrieb Marx, der über bis beide Ohren tief n der Arbeit zum späteren Kapital steckte, eine kurze Schrift, dei eine meisterhafte Zusammenfassung seiner gesamten historischen Methode wiedergibt. Es war die Schrift, die „Zur Kritik der politischen Ökonomie" genannt wurde, ein Text, der größtenteils verdrängt und überschattet wurde vom Erscheinen des Kapitals. Nachdem er uns einen komprimierten Bericht über seine Gedankengänge von seinen ersten Wertstudien bis zu seiner damaligen Hauptbeschäftigung, der politischen Ökonomie, gegeben hat, kommt Marx zum springenden Punkt - dem „Das allgemeine Resultat...meine(r) Studien zum Leitfaden diente". Hier wird die marxistische Geschichtstheorie mit meisterhafter Präzision und Klarheit zusammengefasst. Wir beabsichtigen daher, diese Zeilen so getreu wie möglich zu studieren, um die Grundlage für ein wirkliches Verständnis der Epoche zu legen, in der wir leben.
Wir haben die wichtigste Passage aus diesem Text in einem Anhang am Schluss dieses Artikels zusammengefasst, aber hier beabsichtigen wir, jeden seiner Bestandteile im Detail zu betrachten.
Produktionsverhältnisse und Produktivkräfte
„In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt, und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozess überhaupt."
Der Marxismus wird häufig von seinen Kritikern, bürgerlich-konvertionell oder pseudoradikal, als eine mechanistische, „objektivistische" Theorie karikiert, die danach trachte, die Komplexität des historischen Prozesses auf eine Serie von ehernen Gesetzen zu reduzieren, über die die menschlichen Subjekte keine Kontrolle hätten und die sie wie ein Moloch zu einem schicksalhaften, determinierten äußersten Resultat trieben. Wenn uns nicht gar erzählt wird, dass er eine andere Form der Religion sei, dann wird zumindest gesagt, dass das marxistische Gedankengut ein typisches Produkt der unkritischen Anbetung der Wissenschaft im 19. Jahrhundert und ihrer Illusionen in den Fortschritt sei, das danach strebe, die vorhersagbaren, verifizierbaren Gesetze der natürlichen Welt - physikalisch, chemisch, biologisch - auf die im wesentlichen unvorhersehbaren Muster im gesellschaftlichen Leben anzuwenden. Marx wird schließlich als Autor einer Theorie der unvermeidlichen und linearen Evolution von einer Produktionsweise zur nächsten porträtiert, die unaufhaltsam von der primitiven Gesellschaft über die Sklaverei, den Feudalismus und Kapitalismus zum Kommunismus führe. Und dieser ganze Prozess sei umso mehr vorbestimmt, als er angeblich von einer rein technischen Entwicklung der Produktivkräfte verursacht werde.
Wie alle Karikaturen enthält auch dieses Bild ein Körnchen Wahrheit. Es ist zum Beispiel wahr, dass es in der Periode der Zweiten Internationale, als es eine wachsende Tendenz zur „Institutionalisierung" der Arbeiterparteien gegeben hatte, einen äquivalenten Prozess auf der theoretischen Ebene gab, eine Widerstandslosigkeit gegenüber den vorherrschenden Fortschrittskonzeptionen und eine gewisse Neigung, „Wissenschaft" als ein Ding an sich zu betrachten, losgetrennt von den realen Klassenverhältnissen in der Gesellschaft. Kautskys Idee vom wissenschaftlichen Sozialismus, der durch die Intervention der Intellektuellen in die proletarischen Massen injiziert werden müsse, war ein Ausdruck dieser Tendenz. Dies war umso mehr der Fall, als im 20. Jahrhundert, nachdem so vieles von dem, was einst den Marxismus ausgemacht hatte, nun zu einer offenen Rechtfertigung für die kapitalistische Ordnung geworden war, mechanistische Visionen des historischen Fortschritts nun offiziell kodifiziert wurden. Es gibt keine deutlichere Demonstration dafür als Stalins Fibel des „Marxismus-Leninismus", die Geschichte der KPdSU (Kurzfassung), wo die Theorie des Primats der Produktivkräfte als die materialistische Geschichtsauffassung schlechthin vorgestellt wird:
„Die zweite Besonderheit der Produktion besteht darin, dass ihre Veränderungen und ihre Entwicklung mit Veränderungen und Entwicklungen der Produktivkräfte und vor allem der Produktionsmittel beginnen. Die Produktivkräfte sind deshalb das dynamischste und revolutionärste Element der Produktion. Zunächst verändern sich die Produktivkräfte der Gesellschaft selber und entwickeln sich; dann verändern sich im Verhältnis zu ihnen und in Übereinstimmung mit dieser Veränderung die Produktionsverhältnisse zwischen den Menschen, die wirtschaftlichen Verhältnisse."
Diese Konzeption des Primats der Produktivkräfte fiel nahtlos mit dem fundamentalen Projekt des Stalinismus zusammen: die „Entwicklung der Produktivkräfte" der UdSSR auf Kosten des Proletariats mit dem Ziel, Russland zu einer Hauptmacht auf der Welt zu machen. Es war vollkommen im Interesse des Stalinismus, die Anhäufung von Schwerindustriebetrieben in den 1930er Jahren als Einzelschritte zum Kommunismus darzustellen und jede Untersuchung der hinter dieser „Entwicklung" befindlichen gesellschaftlichen Verhältnisse zu verhindern - die brutale Ausbeutung der Klasse der LohnarbeiterInnen, mit anderen Worten: die Extraktion von Mehrwert mit dem Ziel der Akkumulation des Kapitals.
Marx hat diese ganze Herangehensweise in den ersten Zeilen des Kommunistischen Manifestes widerlegt, die den Klassenkampf als die dynamische Kraft in der historischen Evolution darstellen, mit anderen Worten: den Kampf zwischen verschiedenen Gesellschaftsklassen („Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigener") um die Aneignung der Mehrarbeit. Sie wird nicht minder entschieden von den einleitenden Zeilen unseres Zitats aus dem Vorwort widerlegt: „In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein..." Es sind menschliche Wesen aus Fleisch und Blut, die „bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse" eingehen, die Geschichte machen, nicht „Produktivkräfte", nicht Maschinen, auch wenn es notwendigerweise eine enge Verknüpfung zwischen den Produktionsverhältnissen und den Produktivkräften, die sich für sie „eignen", gibt. Wie Marx es in einer anderen berühmten Stelle im 18. Brumaire des Louis Bonaparte formulierte: „Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen."
Man beachte dabei: unter Bedingungen, die sie nicht selbst gewählt haben; die Menschen treten in „von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse". Bisher zumindest. Unter den Bedingungen, die in allen bis dahin existierenden Gesellschaftsformen vorgeherrscht hatten, waren die gesellschaftlichen Verhältnisse, die die Menschen unter sich bilden, mehr oder weniger unklar für sie, mehr oder weniger überschattet von mythologischen und ideologischen Darstellungen; aus dem gleichen Grunde tendieren mit dem Aufkommen der Klassengesellschaft die Formen des Reichtums, den die Menschen durch diese Verhältnisse erzeugen, dazu, sich ihnen zu entziehen, zu einer fremden Kraft zu werden, die über ihnen steht. In dieser Sichtweise sind die Menschen keine passiven Produkte ihrer Umwelt oder die Werkzeuge, die sie produzieren, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen, sie sind stattdessen noch nicht Meister ihrer eigenen gesellschaftlichen Kräfte oder der Produkte ihrer eigenen Arbeit.
Gesellschaftliches Sein und gesellschaftliches Bewusstsein
„Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt (...) In der Betrachtung solcher Umwälzungen muss man stets unterscheiden zwischen der materiellen, naturwissenschaftlich treu zu konstatierenden Umwälzung in den ökonomischen Produktionsbedingungen und den juristischen, politischen, religiösen, künstlerischen oder philosophischen, kurz, ideologischen Formen, worin sich die Menschen dieses Konflikts bewusst werden und ihn ausfechten. Sowenig man das, was ein Individuum ist, nach dem beurteilt, was es sich selbst dünkt, ebenso wenig kann man eine solche Umwälzungsepoche aus ihrem Bewusstsein beurteilen, sondern muss vielmehr dies Bewusstsein aus den Widersprüchen des materiellen Lebens, aus dem vorhandenen Konflikt zwischen gesellschaftlichen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen erklären."
Mit einem Wort, die Menschen machen Geschichte, aber noch nicht in vollem Bewusstsein dessen, was sie tun. Von nun an können wir uns, wenn wir den historischen Wandel untersuchen, nicht damit zufrieden geben, das Gedankengut und den Glauben einer Epoche zu studieren oder die Modifizierungen in den Regierungssystemen und Gesetzen zu prüfen. Um zu begreifen, wie diese Ideen und Systeme entstehen, ist es notwendig, auf die fundamentalen gesellschaftlichen Konflikte, die dahinter liegen, zurück zu gehen.
Noch einmal: diese Herangehensweise an die Geschichte missachtet nicht die aktive Rolle des Bewusstseins, des Glaubens und der legal-politischen Formationen, ihren realen Einfluss auf die Gesellschaftsverhältnisse und die Entwicklung der Produktivkräfte. Zum Beispiel war die Ideologie der Sklavenhalterklasse in der Antike eine Ideologie, die der Arbeit äußerste Geringschätzung entgegenbrachte. Diese Haltung spielte eine wichtige Rolle dabei, dass die Umsetzung der sehr beachtlichen wissenschaftlichen Fortschritte, die von den griechischen Denkern erzielt wurden, in eine praktische Entwicklung der Wissenschaft, in allgemeine Werkzeuge und Techniken, verhindert wurde, was die Arbeitsproduktivität erhöht hätte. Doch die zugrundeliegende Realität hinter dieser Barriere war die sklavische Produktionsweise an sich: Es war die Existenz der Sklaverei im Zentrum der Wohlstandsmehrung der klassischen Gesellschaft, die die Quelle der Geringschätzung der Arbeit durch die Sklavenhalter und ihrer Überzeugung war, dass man, wollte man das Mehrprodukt erhöhen, sich mehr Sklaven verschaffen musste.
In späteren Schriften mussten Marx und Engels ihre theoretische Herangehensweise sowohl gegen Kritiker als auch gegen fehlgeleitete Anhänger verteidigen, die das Diktum, dass es das gesellschaftliche Sein ist, welches das gesellschaftliche Bewusstsein bestimmt, auf die einfachst mögliche Art interpretierten, indem sie beispielsweise vorgaben, dass dies bedeute, dass alle Mitglieder der Bourgeoisie unvermeidlich dazu bestimmt seien, wegen ihrer ökonomischen Gesellschaftsstellung nur in eine Richtung denken, oder, noch absurder, dass alle Mitglieder des Proletariats unweigerlich ein klares Bewusstsein über ihre Klasseninteressen hätten, weil sie der Ausbeutung unterworfen seien. Es war genau solch eine reduktionistische Haltung, die Marx dazu veranlasste zu behaupten: „Ich bin kein Marxist." Es gibt zahllose Gründe, warum in der Arbeiterklasse, so wie sie existiert in der „Normalität" des Kapitalismus, lediglich eine Minderheit ihre reale Klassensituation erkennt: nicht nur Unterschiede in den individuellen Lebensgeschichten und Psychologien, sondern auch und besonders die aktive Rolle, die von der herrschenden Ideologie gespielt wird, um zu verhindern, dass die Beherrschten ihre eigenen Klasseninteressen begreifen - eine herrschende Ideologie, die eine viel längere Geschichte und Auswirkung hat als die unmittelbare Propaganda der herrschenden Klasse, da sie in den Köpfen der Unterdrückten tief verinnerlicht ist. „Die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alp auf dem Gehirne der Lebenden", wie Marx es gleich nach der Passage aus dem 18. Brumaire über die Menschen formulierte, die Geschichte unter Bedingungen machen, die nicht ihre Wahl sind.
In der Tat zeigt Marx‘ Vergleich zwischen der Ideologie einer Epoche und dem, was ein Individuum über sich selbst denkt, weit entfernt davon, reduktionistisch zu sein, psychologische Tiefe: Es wäre ein schlechter Psychoanalytiker, der kein Interesse daran zeigt, was ein Patient ihm über seine Gefühle und Überzeugungen mitteilt, aber es wäre ein gleichfalls schlechter Analytiker, der kurz vor der Selbstbewusstwerdung des Patienten stoppt und die Komplexität der versteckten und unbewussten Elemente in seinem psychologischen Gesamtprofil ignoriert. Dasselbe trifft auch auf die Geschichte der Ideen und auf die „politische" Geschichte zu. Sie können uns viel darüber erzählen, was in einer vergangenen Epoche geschah, doch für sich genommen, geben sie nur eine verzerrte Widerspiegelung der Realität wider. Daher Marx‘ Ablehnung aller historischen Vorgehensweisen, die an der Oberfläche der Ereignisse bleiben:
„Die ganze bisherige Geschichtsauffassung hat diese wirkliche Basis der Geschichte entweder ganz und gar unberücksichtigt gelassen oder sie nur als eine Nebensache betrachtet, die mit dem geschichtlichen Verlauf außer allem Zusammenhang steht. Die Geschichte muss daher immer nach einem außer ihr liegenden Maßstab beschrieben werden; die wirkliche Lebensproduktion erscheint als Urgeschichtlich, während das Geschichtliche als das vom gemeinen Leben Getrennte, Extra-Überweltliche erscheint. Das Verhältnis der Menschen zur Natur ist hiermit von der Geschichte ausgeschlossen, wodurch der Gegensatz von Natur und Geschichte erzeugt wird. Sie hat daher in der Geschichte nur politische Haupt- und Staatsaktionen und religiöse und überhaupt theoretische Kämpfe sehen können und speziell bei jeder geschichtlichen Epoche die Illusion dieser Epoche teilen müssen. Z.B. bildet sich eine Epoche ein, durch rein ‚politische‘ oder ‚religiöse‘ Motive bestimmt zu werden, obgleich ‚Religion‘ und ‚Politik‘ nur Formen ihrer wirklichen Motive sind, so akzeptiert ihr Geschichtsschreiber diese Meinung. Die ‚Einbildung‘, die ‚Vorstellung‘ dieser bestimmten Menschen über ihre wirkliche Praxis wird in die einzig bestimmende und aktive Macht verwandelt, welche die Praxis dieser Menschen beherrscht und bestimmt. Wenn die rohe Praxis, in der die Teilung der Arbeit bei den Indern und Ägyptern vorkommt, das Kastenwesen bei diesen Völkern in ihrem Staat und ihrer Religion hervorruft, so glaubt der Historiker, das Kastenwesen sei die Macht, welche die rohe gesellschaftliche Form erzeugt habe."[1]
Epochen der sozialen Revolution
Wir kommen jetzt zur Passage aus dem Vorwort, die am deutlichsten zu einem Verständnis der gegenwärtigen historischen Phase im Leben des Kapitalismus führt: „Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein."
Auch hier zeigt Marx, dass das aktive Element im historischen Prozess die gesellschaftlichen Verhältnisse sind, in die sich die Menschen begeben, um das Lebensnotwendige herzustellen. Wenn wir zurückblicken auf die Bewegung von einer Gesellschaftsformation zur nächsten, wird es offensichtlich, dass es eine ständige Dialektik zwischen Perioden, in denen diese Verhältnisse zu einer wirklichen Weiterentwicklung der Produktivkräfte verhelfen, und jenen Perioden gibt, in denen dieselben Verhältnisse zu einer Barriere gegen die Weiterentwicklung werden. Im Kommunistischen Manifest zeigten Marx und Engels auf, dass die kapitalistischen Produktionsverhältnisse, die aus der zerfallenden feudalen Gesellschaft aufgetaucht waren, als eine zutiefst revolutionäre Kraft agierten, indem sie alle stagnierenden, statischen Formen des gesellschaftlichen und ökonomischen Lebens hinwegfegten, die ihnen im Weg standen. Die Notwendigkeit, miteinander zu konkurrieren und so billig wie möglich zu produzieren, zwang die Bourgeoisie, die Produktivkräfte ständig zu revolutionieren. Die unaufhörliche Notwendigkeit, neue Märkte für ihre Waren zu finden, zwang sie, den gesamten Erdball einzunehmen und eine Welt nach ihrem eigenen Bilde zu schaffen.
1848 waren die kapitalistischen Gesellschaftsverhältnisse eindeutig eine „Entwicklungsform" und hatten sich erst in einem oder zwei Ländern fest etabliert. Jedoch veranlasste die Gewaltsamkeit der Wirtschaftskrisen im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts die Autoren des Manifests anfangs zur Schlussfolgerung, dass der Kapitalismus bereits zu einer Fessel der Produktivkräfte geworden sei und die kommunistische Revolution (oder zumindest der schnelle Übergang von der bürgerlichen zur proletarischen Revolution) auf der unmittelbaren Tagesordnung stünde.
„In den Handelskrisen wird ein großer Teil nicht nur der erzeugten Produkte, sondern der bereits geschaffenen Produktivkräfte regelmäßig vernichtet. In den Krisen bricht eine gesellschaftliche Epidemie aus, welche allen früheren Epochen als ein Widersinn erschienen wäre - die Epidemie der Überproduktion. Die Gesellschaft findet sich plötzlich in einen Zustand momentaner Barbarei zurückversetzt; eine Hungersnot, ein allgemeiner Vernichtungskrieg scheinen ihr alle Lebensmittel abgeschnitten zu haben; die Industrie, der Handel scheinen vernichtet, und warum? Weil sie zuviel Zivilisation, zuviel Lebensmittel, zuviel Industrie, zuviel Handel besitzt. Die Produktivkräfte, die ihr zur Verfügung stehen, dienen nicht mehr zur Beförderung der bürgerlichen Zivilisation und der bürgerlichen Eigentumsverhältnisse; im Gegenteil, sie sind zu gewaltig für diese Verhältnisse geworden, sie werden von ihnen gehemmt; und sobald sie dies Hemmnis überwinden, bringen sie die ganze bürgerliche Gesellschaft in Unordnung, gefährden sie die Existenz des bürgerlichen Eigentums. Die bürgerlichen Verhältnisse sind zu eng geworden, um den von ihnen erzeugten Reichtum zu fassen."[2]
Mit der Niederlage der Revolutionen von 1848 und der enormen Expansion des Weltkapitalismus, die in der folgenden Periode stattfand, sollten sie diese Ansicht revidieren, auch wenn sie noch immer ungeduldig auf die Ankunft des langersehnten Zeitalters der sozialen Revolution warteten, auf den Tag der Abrechnung mit der arroganten Herrschaft des Weltkapitals. Doch der Kern dieser Herangehensweise ist die grundlegende Methode: die Erkenntnis, dass eine Gesellschaftsordnung nicht weggefegt werden kann, ehe sie endgültig in Konflikt mit der Weiterentwicklung der Produktivkräfte getreten ist und die gesamte Gesellschaft in eine Krise gestürzt hat, die keine zeitweilige, keine Jugendkrise ist, sondern ein ganzes „Zeitalter" von Krisen, Erschütterungen, der sozialen Revolution, in einem Wort: eine Krise der Dekadenz.
1858 kehrte Marx erneut zu dieser Frage zurück: „Die eigentliche Aufgabe der bürgerlichen Gesellschaft ist die Herstellung des Weltmarkts, wenigstens seinen Umrissen nach, und einer auf seiner Basis ruhenden Produktion. Da die Welt rund ist, scheint dies mit der Kolonisation von Kalifornien und Australien und dem Aufschluss von China und Japan zum Abschluss gebracht. Die schwierige Frage für uns ist die: auf dem Kontinent ist die Revolution imminent und wird sofort einen sozialistischen Charakter annehmen. Wird sie in diesem kleinen Winkel nicht notwendig unterdrückt werden, da auf viel größerem Terrain die Bewegung der bürgerlichen Gesellschaft noch aufsteigend ist."[3]
Was an diesen Zeilen so interessant ist, das sind genau die Fragen, die sie stellen: Worin bestehen die historischen Kriterien zur Bestimmung des Wechsels zu einer Periode der Revolution im Kapitalismus? Kann es eine erfolgreiche kommunistische Revolution geben, solange der Kapitalismus noch immer ein global expandierendes System ist? Marx war voreilig, als er dachte, dass die Revolution in Europa anstünde. Tatsächlich schien er in einem Brief an Vera Sassulitsch über das russische Problem, 1881 geschrieben, auch hier seine Auffassung modifiziert zu haben, als er im zweiten Entwurf dazu meinte, dass „das kapitalistische System im Westen im Verblühen ist, und sich die Zeit nähert, da es nur noch eine „archaische" Formation sein wird"[4]. 20 Jahre nach 1858 „näherte" sich das System selbst in den fortgeschrittenen Ländern erst seinem „Verblühen". Erneut drückte dies die Schwierigkeiten aus, denen sich Marx angesichts der historischen Lage, in der er lebte, gegenübersah. Wie sich herausstellte, hatte der Kapitalismus noch eine letzte Phase realer globaler Entwicklung vor sich, die Phase des Imperialismus, die in eine Epoche der Erschütterungen auf Weltebene hineinführen sollte und der Indikator für die Tatsache war, dass das System in seiner Gesamtheit, und nicht nur ein Teil von ihm, in seine Senilitätskrise stürzte. Jedoch zeigen Marx‘ Äußerungen in diesen Briefen, wie ernst er das Problem nahm, eine revolutionäre Perspektive von der Entscheidung abhängig zu machen, ob der Kapitalismus diese Stufe erreicht hat oder nicht.
Weg mit den überholten Werkzeugen: die Notwendigkeit von Dekadenzphasen
„Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist, und neue höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben im Schoß der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind. Daher stellt sich die Menschheit immer nur Aufgaben, die sie lösen kann, denn genauer betrachtet wird sich stets finden, dass die Aufgabe selbst nur entspringt, wo die materiellen Bedingungen ihrer Lösung schon vorhanden oder wenigstens im Prozess ihres Werdens begriffen sind."
In der nächsten Passage betont Marx weiterhin, wie wichtig es ist, eine Perspektive der sozialen Revolution nicht auf die rein moralische Abscheu zu basieren, die von einem Ausbeutungssystem ausgelöst wird, sondern auf dessen Unfähigkeit, die Arbeitsproduktivität und allgemein die Kapazitäten des menschlichen Wesens weiterzuentwickeln, seine materiellen Bedürfnisse zu befriedigen.
Das Argument, dass eine Gesellschaft niemals ihr Leben aushaucht, ehe sie nicht alle Entwicklungskapazitäten ausgeschöpft hat, ist benutzt worden, um gegen die Idee zu argumentieren, dass der Kapitalismus seine Dekadenzperiode erreicht hat: Der Kapitalismus sei seit 1914 deutlich gewachsen; man könne nicht sagen, dass er dekadent sei, solange nicht sämtliches Wachstum stoppe. Es ist richtig, dass ein großer Teil der Konfusionen durch Theorien wie jene von Trotzki aus dem Jahr 1930 verursacht worden war. Eingedenk dessen, dass der Kapitalismus sich in den heftigsten Kämpfen seiner bis damals größten Depression befand, schien diese Ansicht plausibel; darüber hinaus kann der Gedanke, dass die Dekadenz durch einen vollständigen Stopp in der Entwicklung der Produktivkräfte gekennzeichnet sei, ja sogar durch eine Rückbildung, in einem gewissen Sinn auf die früheren Klassengesellschaften angewendet werden, wo die Krise stets das Resultat der Unterproduktion war, eine absolute Unfähigkeit, genug zu produzieren, um den Grundbedürfnissen der Gesellschaft nachzukommen (und selbst in jenen Gesellschaften lief der Prozess des „Abstiegs" niemals ohne Phasen der scheinbaren Wiedererholung und gar eines kräftigen Wachstums ab). Doch das Grundproblem dieser Ansicht ist, dass sie die fundamentale Realität des Kapitalismus ignoriert - die Notwendigkeit des Wachstums, der Akkumulation, der erweiterten Reproduktion von Werten. Wie wir sehen werden, kann dieser Notwendigkeit in der Dekadenz des Systems dadurch nachgekommen werden, indem immer mehr an den eigentlichen Gesetzen der kapitalistischen Produktion herumgepfuscht wird. Doch wie wir ebenfalls sehen werden, wird dieser Punkt, an dem die kapitalistische Akkumulation absolut unmöglich wird, wahrscheinlich niemals erreicht werden. Wie Rosa Luxemburg in der Antikritik hervorhob, war ein solcher Punkt „eine theoretische Fiktion, gerade weil die Akkumulation des Kapitals nicht bloß ökonomischer, sondern politischer Prozess ist"[5]. Darüber hinaus hatte Marx bereits den Begriff des Wachstums als Rückgang postuliert: „Die höchste Entwicklung dieser Basis selbst (die Blüte, worin sie sich verwandelt; es ist aber doch immer diese Basis, diese Pflanze als Blüte; daher Verwelken nach der Blüte und als Folge der Blüte) ist der Punkt, worin sie selbst zu der Form ausgearbeitet ist, worin sie mit der höchsten Entwicklung der Produktivkräfte vereinbar, daher auch der reichsten Entwicklung der Individuen. Sobald dieser Punkt erreicht ist, erscheint die weitre Entwicklung als Verfall und die neue Entwicklung beginnt von einer neuen Basis."
Der Kapitalismus hat sicherlich genügend Produktivkräfte für die Entstehung einer neuen und höheren Produktionsweise entwickelt. In der Tat tritt das System in dem Augenblick in den Niedergang, wenn die materiellen Bedingungen für den Kommunismus entwickelt sind. Durch die Schaffung einer Weltwirtschaft - für den Kommunismus fundamental - erreicht der Kapitalismus auch die Grenzen seiner gesunden Entwicklung. Die Dekadenz des Kapitalismus ist also nicht an einer kompletten Aussetzung der Produktion festzumachen, sondern zeichnet sich durch eine wachsende Reihe von Erschütterungen und Katastrophen aus, die die absolute Notwendigkeit für seine Überwindung demonstrieren.
Marx‘ Hauptpunkt ist hier die Notwendigkeit einer Dekadenzperiode. Die Menschen machen keine Revolution, weil es ihnen gefällt, sondern weil sie von der Notwendigkeit gezwungen werden, von dem unerträglichen Leid, das von der Krise eines Systems hervorgerufen wird. Aus dem gleichen Grund ist die Anhänglichkeit am Status quo tief in ihrem Bewusstsein verwurzelt, und es kann nur der wachsende Konflikt zwischen jener Ideologie und der materiellen Wirklichkeit, der sie sich gegenübersehen, sein, der die Menschen dazu bringt, das herrschende System herauszufordern. Dies trifft vor allem auf die proletarische Revolution zu, die das erste Mal in der Geschichte eine bewusste Umwandlung jedes Aspektes des Gesellschaftslebens erfordert.
Die Revolutionäre werden gelegentlich beschuldigt, der Idee: „Je schlechter, desto besser" anzuhängen, der Idee, dass je mehr die Massen leiden, desto wahrscheinlicher sie revolutionär werden. Doch es gibt keine mechanische Beziehung zwischen dem Leid und dem revolutionären Bewusstsein. Das Leid enthält eine Dynamik zum Nachdenken und zur Revolte, aber es enthält auch eine Dynamik zur Abnutzung und Erschöpfung der Fähigkeit zur Revolte. Es kann außerdem leicht zur Praktizierung völlig falscher Formen der Rebellion führen, wie das gegenwärtige Wachstum des islamischen Fundamentalismus zeigt. Die Dekadenzperiode ist notwendig, um die Arbeiterklasse davon zu überzeugen, dass sie eine neue Gesellschaft aufbauen muss, dass aber andererseits eine auf unbestimmte Zeit verlängerte Epoche der Dekadenz die eigentliche Möglichkeit der Revolution gefährden kann, indem sie die Welt in eine Spirale der Katastrophen drängt, die nur dazu dienen, die angehäuften Produktivkräfte und insbesondere die wichtigsten aller Produktivkräfte, das Proletariat, zu zerstören. Dies ist in der Tat die Gefahr, die sich in der finalen Phase der Dekadenz stellt, der Phase, die wir die Zerfallsphase nennen und die unserer Meinung nach bereits begonnen hat.
Dieses Problem einer am lebendigen Leib verfaulenden Gesellschaft ist im Kapitalismus besonders akut, weil im Gegensatz zu früheren Systemen die Reifung der materiellen Bedingungen für die neue Gesellschaft - den Kommunismus - nicht mit der Entwicklung neuer Wirtschaftsformen innerhalb der Hülle der alten Gesellschaftsordnung zusammenfällt. Im Niedergang der römischen Sklaverei war die Entwicklung feudaler Stände oftmals das Werk von Mitgliedern der alten sklavenhaltenden Klasse, die sich selbst vom Zentralstaat distanziert hatten, um den niederschmetternden Lasten ihrer Steuern zu entgehen. In der Periode der feudalen Dekadenz wuchs die neue Bourgeoisie in den Städten - die immer die kommerziellen Zentren des alten Systems gewesen waren - heran und nahm sich vor, die Fundamente einer neuen Wirtschaft zu legen, die auf den Manufakturen und dem Handel basierte. Das Aufkommen dieser neuen Formen war sowohl eine Antwort auf die Krise der alten Ordnung als auch ein Faktor, der sie mehr und mehr zu ihrem endgültigen Ableben trieb.
Mit dem Niedergang des Kapitalismus treten die Produktivkräfte, die er in Bewegung gesetzt hat, ganz sicher mit den Gesellschaftsverhältnissen, in denen sie wirken, in wachsendem Konflikt. Dies wird besonders durch den Kontrast zwischen den enormen Produktionskapazitäten des Kapitalismus und seiner Unfähigkeit, alle Waren, die sie produzieren, zu absorbieren, ausgedrückt - kurz: durch die Überproduktionskrise. Doch während diese Krise die Abschaffung der Warenverhältnisse immer dringender macht und das Wirken der Gesetze der Warenproduktion immer mehr entstellt, resultiert dies nicht in einem spontanen Auftreten kommunistischer Wirtschaftsformen. Anders als frühere revolutionäre Klassen ist die Arbeiterklasse eine eigentumslose, ausgebeutete Klasse und kann nicht ihre eigene Wirtschaftsordnung innerhalb des Rahmens der alten aufbauen. Der Kommunismus kann nur das Resultat eines allzeit bewussteren Kampfes gegen die alte Ordnung sein, der zur politischen Überwindung der Bourgeoisie als Voraussetzung für die kommunistische Transformation des wirtschaftlichen und sozialen Lebens führt. Wenn das Proletariat unfähig ist, seinen Kampf auf die notwendige Höhe des Bewusstseins und der Selbstorganisation zu heben, dann werden die Widersprüche des Kapitalismus nicht zur Ankunft einer höheren gesellschaftlichen Ordnung führen, sondern zum „gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen".
Gerrard
Zur Kritik der politischen Ökonomie, Vorwort
Im Folgenden die vollständige Stelle aus dem Vorwort:
Das allgemeine Resultat, das sich mir ergab und, einmal gewonnen, meinen Studien zum Leitfaden diente, kann kurz so formuliert werden: In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozess überhaupt. Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt. Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein. Mit der Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt sich der ganze ungeheure Überbau langsamer oder rascher um. In der Betrachtung solcher Umwälzungen muss man stets unterscheiden zwischen der materiellen, naturwissenschaftlich treu zu konstatierenden Umwälzung in den ökonomischen Produktionsbedingungen und den juristischen, politischen, religiösen, künstlerischen oder philosophischen, kurz, ideologischen Formen, worin sich die Menschen dieses Konflikts bewusst werden und ihn ausfechten. Sowenig man das, was ein Individuum ist, nach dem beurteilt, was es sich selbst dünkt, ebenso wenig kann man eine solche Umwälzungsepoche aus ihrem Bewusstsein beurteilen, sondern muss vielmehr dies Bewusstsein aus den Widersprüchen des materiellen Lebens, aus dem vorhandenen Konflikt zwischen gesellschaftlichen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen erklären. Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist, und neue höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben im Schoß der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind. Daher stellt sich die Menschheit immer nur Aufgaben, die sie lösen kann, denn genauer betrachtet wird sich stets finden, dass die Aufgabe selbst nur entspringt, wo die materiellen Bedingungen ihrer Lösung schon vorhanden oder wenigstens im Prozess ihres Werdens begriffen sind. In großen Umrissen können asiatische, antike, feudale und modern bürgerliche Produktionsweisen als progressive Epochen der ökonomischen Gesellschaftsformation bezeichnet werden. Die bürgerlichen Produktionsverhältnisse sind die letzte antagonistische Form des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, antagonistisch nicht im Sinn von individuellem Antagonismus, sondern eines aus den gesellschaftlichen Lebensbedingungen der Individuen hervor wachsenden Antagonismus, aber die im Schoß der bürgerlichen Gesellschaft sich entwickelnden Produktivkräfte schaffen zugleich die materiellen Bedingungen zur Lösung dieses Antagonismus. Mit dieser Gesellschaftsformation schließt daher die Vorgeschichte der menschlichen Gesellschaft ab.
[1] Kommunistisches Manifest, Kapitel 1, „Bourgeois und Proletarier". In: MEW, Bd. 4, S. 462 ff.
[2] Marx an Engels, 8. Oktober 1858. In: MEW, Bd. 29, S. 359
[3] K. Marx, Brief an V. I. Sassulitsch. Zweiter Entwurf. In: MEW, Bd. 19, S. 398.
[4] R. Luxemburg, Antikritik, Gesammelte Werke Bd. 5 S. 519
[5] Grundrisse, S. 439
Aktuelles und Laufendes:
Erbe der kommunistischen Linke:
Der G20 Gipfel in London: eine neue kapitalistische Welt ist nicht möglich
- 2851 reads
Natürlich sieht die Wirklichkeit ganz anders aus.
Der einzige Erfolg des Gipfeltreffens der G20 ist, dass es stattgefunden hat!
In den letzten Monaten hat die Wirtschaftskrise die internationalen Spannungen stark angefacht. Zunächst ist die Versuchung des Protektionismus gestiegen. Jeder Staat neigt zunehmend dazu, einen Teil seiner Wirtschaft durch Subventionen und die Gewährung von Privilegien für einheimische Unternehmen gegen die ausländische Konkurrenz zu retten. Das war zum Beispiel beim Unterstützungsplan für die französische Automobilindustrie der Fall, der von Nicolas Sarkozy beschlossen wurde und der von seinen europäischen „Freunden" scharf kritisiert wurde. Schließlich gibt es eine wachsende Tendenz, ohne gemeinsame Absprachen Ankurbelungsprogramme zu verabschieden, insbesondere um den Finanzsektor zu retten. Dabei versuchen viele Konkurrenten, die missliche Lage der USA, dem Epizentrum des Finanzbebens und Schauplatz einer schlimmen Rezession, auszunutzen, um die wirtschaftliche Führungsrolle der USA weiter zu untergraben. Dies ist jedenfalls das Anliegen hinter den Aufrufen Frankreichs, Deutschlands, Chinas, der südamerikanischen Staaten zum „Multilateralismus" ...
Der Gipfel von London war von Spannungen überschattet, die Debatten müssen in der Tat sehr erregt gewesen sein. Aber man hat den Schein bewahren können. Die Herrschenden konnten das katastrophale Bild eines chaotischen Gipfels vermeiden. Die herrschende Klasse hat nicht vergessen, in welchem Maße mangelnde internationale Abstimmung und die Tendenz des „Jeder für sich" zum Desaster von 1929 beigetragen haben. Damals wurde der Kapitalismus von der ersten großen Wirtschaftskrise im Zeitalter seines Niedergangs erfasst[4]; die herrschende Klasse wusste noch nicht, wie sie reagieren sollte. Und so reagierten die Staaten zunächst überhaupt nicht. Von 1929 bis 1933 wurde fast keine Maßnahme ergriffen, während Tausende von Banken der Reihe nach Bankrott gingen. Der Welthandel brach buchstäblich zusammen. 1933 zeichneten sich erste Reaktionen ab - der New Deal Roosevelts[5] wurde beschlossen. Dieser Ankurbelungsplan umfasste eine Politik der großen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und der staatlichen Verschuldung, aber auch ein protektionistisches Gesetz, den „Buy American Act"[6]. Damals stürzten sich alle Länder in ein protektionistisches Wettrennen. Der Welthandel, der bereits sehr stark geschrumpft war, erlitt einen weiteren Schock. So hat die herrschende Klasse in den 1930er Jahren durch ihre eigenen Maßnahmen die Weltwirtschaftskrise noch verschärft.
Heute also wollen alle Teile der herrschenden Klasse eine Wiederholung dieses Teufelskreises von Krise und Protektionismus verhindern. Sie sind sich dessen bewusst, dass sie alles unternehmen müssen, um die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen. Es war unbedingt erforderlich, dass dieser Gipfel der G20 die Einheit der Großmächte gegenüber der Krise zur Schau stellt, insbesondere um das internationale Finanzsystem zu stützen. Der IWF hat dazu gar einen besonderen Punkt in seinem „Arbeitsdokument" zur Vorbereitung des Gipfels formuliert, um gegen diese Gefahr des „Jeder für sich" zu warnen.[7] Es handelt sich um den Punkt 13: „Das Gespenst des Handels- und Finanzprotektionismus stellt eine wachsende Sorge dar": „Ungeachtet der von den G20-Ländern (im November 2008) eingegangenen Verpflichtungen, nicht auf protektionistische Maßnahmen zurückzugreifen, ist es zu besorgniserregenden Entgleisungen gekommen. Es ist schwer, zwischen dem öffentlichen Eingreifen, das darauf abzielt, die Auswirkungen der Finanzkrise auf die in Schwierigkeiten geratenen Bereiche einzudämmen, und den nicht angebrachten Subventionen für die Industrien zu unterscheiden, deren langfristige Überlebensfähigkeit infrage gestellt werden muss. Bestimmte Unterstützungsmaßnahmen für den Finanzbereich verleiten auch die Banken dazu, Kredite in ihre Länder zu lenken. Gleichzeitig gibt es wachsende Risiken, dass bestimmte Schwellenländer, die mit einem von Außen kommenden Druck auf ihre Konten konfrontiert sind, danach streben, Kapitalkontrollen aufzuerlegen." Und der IWF war nicht der einzige, der solche Warnungen äußerte: „Ich befürchte, dass eine allgemeine Rückkehr des Protektionismus wahrscheinlich ist. Denn die defizitären Länder wie die USA glauben damit ein Mittel gefunden zu haben, die Binnennachfrage und die Beschäftigung anzukurbeln. [...] Wir befinden uns in einem entscheidenden Moment. Wir müssen eine Wahl treffen zwischen einer Öffnung nach Außen oder einem Rückzug auf Lösungen ‚innerhalb‘ eines Landes. Wir haben diesen zweiten Lösungsansatz in den 1930er Jahren versucht. Dieses Mal müssen wir den ersten versuchen." (Martin Wolf, vor der Kommission auswärtiger Angelegenheit des US-Senats, am 25. 6.2009)[8].
Der Gipfel hat die Botschaft vernommen: Die Führer der Welt konnten das Bild einer scheinbaren Einheit bewahren und dieses in ihrer Abschlusserklärung schriftlich festhalten: „Wir werden die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen". Die Welt atmete auf. Wie die französische Wirtschaftszeitung „Les Echos" am 3. April schrieb: „Die erste Schlussfolgerung, die man nach dem gestrigen G20 von London ziehen kann, ist, dass er nicht gescheitert ist, und das ist schon viel wert. Nach den Spannungen der letzten Wochen haben die 20 größten Länder ihre Einheit gegenüber der Krise gezeigt."
Konkret haben sich die Länder verpflichtet, keine Handelsschranken zu errichten, auch nicht gegen Finanzströme. Die Welthandelsorganisation wurde beauftragt, sorgfältig darauf zu achten, dass diese Verpflichtungen eingehalten werden. Darüber hinaus wurden 250 Milliarden Dollar für die Unterstützung des Exports oder von Investitionen zugesagt, um den internationalen Handel wieder anzukurbeln. Aber vor allem haben die gestiegenen Spannungen die Atmosphäre auf diesem Gipfel nicht vergiften können, der sonst in einen offenen Faustkampf ausgeartet wäre. Der Schein bleibt also gewahrt. Dies ist der Erfolg des Gipfels der G20. Und dieser Erfolg ist sicherlich zeitlich beschränkt, denn der Stachel der Krise wird die internationalen Divergenzen und Spannungen weiter verschärfen.
Die Verschuldung von heute bereitet die Krisen von morgen vor
Seit dem Sommer 2008 und der berühmten „Subprime"-Krise verabschiedeten die Regierungen wie entfesselt ein Konjunkturprogramm nach dem anderen. Nach der ersten Ankündigung von massiven Kapitalspritzen im Milliardenumfang kam vorübergehend Optimismus auf. Doch da sich die Krise unbeirrt weiter zuspitzte, wuchs mit jedem neuen Programm auch die Skepsis. Paul Jorion, ein auf den Wirtschaftsbereich spezialisierter Soziologe (er war zudem einer der ersten, die die gegenwärtige Krise ankündigten) macht sich lustig über dieses wiederholte Scheitern: „Wir sind unbemerkt von den kleinen Anschüben des Jahres 2007 im Umfang von einigen Milliarden Euro oder Dollar zu den großen Paketen von Anfang 2008 übergegangen, dann kamen schließlich die gewaltigen Pakete von Ende 2008, die mittlerweile Hunderte von Milliarden Euro oder Dollar umfassen. 2009 ist das Jahr der ‚kolossalen‘ Anschübe, die diesmal Summen von ‚Trillionen‘ Euro oder Dollar beinhalten. Und trotz pharaonischer Ambitionen gibt es noch immer nicht das geringste Licht am Ende des Tunnels"[9].
Und was schlägt der Gipfel vor? Man überbietet sich mit einer Reihe von Maßnahmen, von denen die eine noch unwirksamer ist als die andere! Bis Ende 2010 sollen 5.000 Milliarden Dollar in die Weltwirtschaft gepumpt werden[10]. Die Bourgeoisie verfügt über keine andere „Lösung"; sie offenbart damit ihre eigene Machtlosigkeit[11]. Die internationale Presse hat sich in dieser Hinsicht nicht geirrt. „Die Krise ist noch lange nicht vorüber, man muss naiv sein zu glauben, dass die Beschlüsse des G20 alles ändern werden" (La Libre Belgique), „Sie sind zu einem Zeitpunkt gescheitert, als die Weltwirtschaft dabei war zu implodieren" (New York Times).
Die Vorhersagen der OECD, die normalweise ziemlich optimistisch sind, lassen für 2009 keinen Zweifel daran aufkommen, was auf die Menschheit in den nächsten Monaten zukommen wird. Ihnen zufolge wird die Rezession in den USA zu einer Schrumpfung des Bruttoinlandprodukts von vier Prozent, in der Euro-Zone von 4.1 Prozent und in Japan von 6.6 Prozent führen. Die Weltbank prognostizierte am 30. März für das Jahr 2009 „einen Rückgang des Welt-BIP von 1.7 Prozent, was den stärksten, je registrierten Rückgang der globalen Produktion bedeutet". Die Lage wird sich also in den nächsten Monaten noch weiter zuspitzen, wobei die Krise bereits heute verheerendere Ausmaße als 1929 angenommen hat. Die Ökonomen Barry Eichengreen und Kevin O'Rourke haben errechnet, dass der Rückgang der Weltindustrieproduktion allein in den letzten neun Monaten schon so stark war wie 1929, die Aktienwerte zweimal so schnell verfielen und auch der Welthandel schneller schrumpft[12].
All diese Zahlen entsprechen einer sehr konkreten und dramatischen Wirklichkeit für Millionen von ArbeiterInnen auf der Welt. In den USA, der größten Wirtschaftsmacht der Erde, wurden allein im März 2009 663.000 Arbeitsplätze vernichtet, womit sich die Zahl der vernichteten Arbeitsplätze innerhalb der letzten beiden Jahre auf 5.1 Millionen erhöht hat. Heute werden alle Länder von der Krise brutal erfasst. So erwartet Spanien 2009 einen Anstieg der Arbeitslosigkeit auf über 17 Prozent.
Aber diese Politik ist heute nicht nur einfach unwirksam; sie bereitet auch noch gewaltigere Krisen in der Zukunft vor. Denn all diese Milliardenbeträge können nur dank massiver Verschuldung zur Verfügung gestellt werden. Doch eines Tages (und dieser Tag liegt nicht in der fernen Zukunft) müssen diese Schulden zurückgezahlt werden. Selbst die Bourgeois sagen: „Es liegt auf der Hand, die Folgen dieser Krise sind mit hohen Kosten verbunden. Die Menschen werden Reichtümer, Erbgüter, Einkommen, Ersparnisse, Arbeitsplätze verlieren. Es wäre demagogisch zu denken, dass irgendjemand davon verschont werden wird, alles oder einen Teil dieser Rechnung zu bezahlen" (Henri Guaino, Sonderberater des französischen Staatspräsidenten, 3.04.2009).[13] Durch die Anhäufung dieses Schuldenbergs ist letzten Endes die wirtschaftliche Zukunft des Kapitalismus mit einer gewaltigen Hypothek belastet.
Und was soll man zu all den Journalisten sagen, die sich darüber freuen, dass der IWF eine viel größere Bedeutung erlangt hat? Seine Finanzmittel sind in der Tat vom Gipfel verdreifacht worden; er verfügt nun über 750 Milliarden Dollar Mittel, hinzu kommen 250 Milliarden Dollar Sonderziehungsrechte.[14] IWF-Präsident Dominique Strauss-Kahn erklärte, dass es sich um den größten „jemals in der Geschichte beschlossenen koordinierten Ankurbelungsplan" handelt. Er wurde beauftragt, „den Schwächsten zu helfen", insbesondere den am Rande der Pleite stehenden osteuropäischen Staaten. Aber der IWF ist eine seltsame letzte Rettung. Denn diese Organisation ist zu Recht verrufen wegen der drakonischen Sparmaßnahmen, die sie in der Vergangenheit stets dann erzwungen hat, wenn ihre „Hilfe" gefordert wurde. Umstrukturierungen, Entlassungen, Arbeitslosigkeit, Abschaffung bzw. Kürzung von medizinischen Leistungen, Renten usw.- all das sind die Folgen der „Hilfe" des IWF. Diese Organisation hat - um nur ein Beispiel zu nennen - am vehementesten jene Maßnahmen vertreten, die Argentinien in den 1990er Jahren auferlegt wurden, bis dessen Wirtschaft 2001 kollabierte!
Der Gipfel der G20 hat also nicht nur den kapitalistischen Horizont nicht aufgehellt, sondern im Gegenteil bewirkt, dass noch dunklere Wolken aufziehen werden.
Der große Bluff eines moralischeren Kapitalismus
In Anbetracht der sattsam bekannten Unfähigkeit der G20, wirkliche Lösungen für die Zukunft anzubieten, fiel es den Bourgeois schwer, eine schnelle Rückkehr zum Wachstum und zu einer strahlenden Zukunft zu versprechen. Unter den Arbeitern breitet sich eine tiefe Verachtung gegen den Kapitalismus aus; immer mehr machen sich Gedanken über die Zukunft. Die herrschende Klasse ihrerseits ist eifrig darum bemüht, auf ihre Art auf diese Infragestellungen einzugehen. So hat denn auch dieser Gipfel mit großem Tamtam einen neuen Kapitalismus versprochen, der besser reguliert, moralischer, ökologischer sein werde...
Aber dieses Manöver ist so auffällig wie lächerlich. Um zu beweisen, wie ernst sie es mit einem „moralischeren" Kapitalismus meinen, haben die G20-Staaten ihren Zeigefinger gegen einige „Steuerparadiese" erhoben und mit eventuellen Sanktionen gedroht, über die man bis zum Ende des Jahres nachdenken werde (sic!), falls diese Länder keine Anstrengungen um größere „Transparenz" unternehmen. Insbesondere wurde auf vier Länder verwiesen, die nunmehr die berühmte „schwarze Liste" anführten: Costa Rica, Malaysia, die Philippinen, Uruguay. Auch anderen Ländern wurden Vorhaltungen gemacht; sie wurden auf eine „graue Liste" gesetzt. Unter anderem gehören Österreich, Belgien, Chile, Luxemburg, Singapur und die Schweiz dazu.
Die großen „Steuerparadiese" dagegen kommen allem Anschein nach ihren Pflichten nach. Die Kaiman-Inseln und ihre Hedgefonds, die von der britischen Krone abhängigen Territorien (Guernsey, Jersey, Ilse of Man), die Londoner City, die US-Bundesstaaten wie Delaware, Nevada oder Wyoming - all diese Gebiete sind offiziell weiß wie Schnee und gehören der weißen Liste an. Diese Klassifizierung der Steuerparadiese durch den Gipfel der G20 bedeutet, den Bock zum Gärtner zu machen.
Als Gipfel der Heuchelei kündigte nur wenige Tage nach dem Gipfel in London die OECD, die für diese Einstufungen verantwortlich ist, die Streichung der vier oben genannten Länder von der schwarzen Liste an, nachdem diese Anstrengungen zu mehr Transparenz angekündigt hatten!
All dies kann nicht überraschen. Wie könnte man von all diesen Verantwortlichen des Kapitalismus, die in Wirklichkeit Gangster ohne Gesetz und Glauben sind, eine „moralischere Haltung" erwarten?[15] Und wie kann ein System, das auf Ausbeutung und Profitstreben beruht, „moralischer" werden? Niemand erwartete übrigens von diesem Gipfel einen „menschlicheren Kapitalismus". Dieser existiert nicht, auch wenn die politischen Führer davon reden, wie Eltern ihren Kindern vom Weihnachtsmann erzählen. Diese Krisenzeiten enthüllen im Gegenteil noch deutlicher die unmenschliche Fratze dieses Systems. Vor fast 130 Jahren schrieb Paul Lafargue: „Die kapitalistische Moral [...] belegt das Fleisch des Arbeiters mit einem feierlichen Bannfluch: Ihr Ideal besteht darin, die Bedürfnisse des Produzenten (das heißt des wirklich Produzierenden) auf das geringste Minimum zu reduzieren, seine Genüsse und Leidenschaften zu ersticken und ihn zur Rolle einer Maschine zu verurteilen, aus der man ohne Rast und ohne Dank Arbeit nach Belieben herausschindet" (Paul Lafargue, Das Recht auf Faulheit, Vorwort). Wir könnten hinzufügen: Die einzig mögliche „Ruhe" ist die Arbeitslosigkeit und das Elend. Wenn die Krise zuschlägt, werden Beschäftigte entlassen und fliegen auf die Straße wie Ausschuss. Der Kapitalismus ist und bleibt stets ein brutales und barbarisches Ausbeutungssystem.
Aber das Manöver ist so offensichtlich wie entlarvend. Es zeigt, dass der Kapitalismus der Menschheit keinen Ausweg mehr anzubieten hat, außer noch mehr Verarmung und Leid. Die Aussichten auf einen „ökologischen" oder „moralischen" Kapitalismus sind genauso groß wie die Aussichten eines Alchimsten, Blei in Gold zu verwandeln.
Der Londoner Gipfel belegt jedenfalls eins: Eine andere kapitalistische Welt ist nicht möglich. Es ist wahrscheinlich, dass der Krisenverlauf Höhen und Tiefen durchschreiten wird, wobei es zeitweise auch zu einem Wachstum kommen kann. Aber im Wesentlichen wird der Kapitalismus weiter in der Krise versinken, noch mehr Armut und Kriege hervorrufen.
Von diesem System kann man nichts erwarten. Mit ihren internationalen Gipfeln und Konjunkturprogrammen stellt die herrschende Klasse keinen Teil der Lösung dar, sondern sie selbst ist das Problem. Nur die Arbeiterklasse kann die Welt umwälzen, dazu muss sie aber Vertrauen in die Gesellschaft entwickeln, die sie aufbauen muss: den Kommunismus!
Mehdi, 16.04.09
[1] Déclaration de Pascal Lamy, Erklärung des Generaldirektors der Welthandelsorganisation.
[2] Rapport intermédiaire - Zwischenbericht der OECD
[3] Der
G20 besteht aus den Mitgliedsländern des G8 (Deutschland, Frankreich, USA,
Japan, Kanada, Italien, Großbritannien, Russland), zu dem jetzt Südafrika,
Saudi-Arabien, Argentinien, Australien, Brasilien, China, Südkorea, Indien,
Indonesien, Mexiko, Türkei und schließlich die Europäische Union dazu gekommen
sind. Ein erster Gipfel hatte im November 2008 inmitten der
Finanzerschütterungen stattgefunden.
[4] Siehe unsere Artikelserie „Die Dekadenz des Kapitalismus begreifen"
[5] Weit verbreitet ist heute der Mythos, dass der New Deal von 1933 es der Weltwirtschaft ermöglicht habe, aus dem wirtschaftlichen Schlamassel herauszukommen. Daher die logische Schlussfolgerung, heute zu einem neuen „New Deal" aufzurufen. Aber in Wirklichkeit blieb die US-Wirtschaft zwischen 1933-38 besonders kraftlos. Erst der zweite New Deal, der 1938 beschlossen wurde, ermöglichte die Ankurbelung der Wirtschaft. Doch dieser zweite New Deal war nichts anderes als der Beginn der Kriegswirtschaft (die den 2. Weltkrieg vorbereitete). Es ist verständlich, dass diese Tatsache weitestgehend verschwiegen wird!
[6] Mit diesem Gesetz verpflichteten die US-Behörden zum Kauf von auf US-Märkten hergestellten Produktionsgütern.
[7] Quelle:
https://contreinfo.info/prnart.php3?id_article=2612 [5]
[8] Martin Wolf ist ein britischer Wirtschaftsjournalist. Er war assoziierter freischaffender Redakteur und Chef-Kommentator im Bereich Wirtschaftsfragen bei der Financial Times.
[9] „L'ère des ‘Kolossal' coups de pouce" (Die Ära der „kolossalen" Anschübe), veröffentlicht am 7 April 2009.
[10] Tatsächlich handelt es sich um 4.000 Milliarden Dollar, die von den USA als Rettungsmaßnahmen während der letzten Monate angekündigt wurden.
[11] In Japan wurde jüngst ein neues Konjunkturprogramm im Umfang von 15.400 Milliarden Yen (116 Milliarden Euro) beschlossen. Dies ist das vierte Programm, das innerhalb eines Jahres von Tokio beschlossen wurde!
[12] Quelle: www.voxeu.org [6]
[13] Zur Rolle der Verschuldung im Kapitalismus und zu seinen Krisen siehe den Artikel in dieser Ausgabe der Internationalen Revue Nr. 43, „Die schlimmste Wirtschaftskrise in der Geschichte des Kapitalismus".
[14] Die Sonderziehungsrechte sind ein Währungskorb, der aus Dollar, Euro, Yen und britischen Pfund-Sterling besteht.
Insbesondere China hat auf diesen Sonderziehungsrechten bestanden. In den letzten Wochen hat das Reich der Mitte mehrere offizielle Erklärungen abgegeben und zur Schaffung einer internationalen Währung aufgerufen, die den Dollar ablösen soll. Zahlreiche Ökonomen auf der Welt haben diese Forderung aufgegriffen und vor dem unaufhaltsamen Verfall der US-Währung und den wirtschaftlichen Erschütterungen gewarnt, die daraus resultieren würden.
Es stimmt, dass die Schwächung des Dollars mit jedem weiteren Versinken der US-Wirtschaft in der Rezession eine echte Bedrohung für die Weltwirtschaft darstellt. Kurz vor Ende des II. Weltkrieges als internationale Leitwährung eingeführt, fungierte der Dollar seither als ein Stützpfeiler für die kapitalistische Stabilität. Dagegen ist die Einführung einer neuen Leitwährung (ob Euro, Yen, Britisches Pfund oder die Sonderziehungsrechte des IWF) vollkommen illusorisch. Keine Macht wird die USA ersetzen können, keine wird deren Rolle als internationaler ökonomischer Stabilitätsanker übernehmen können. Die Schwächung der US-Wirtschaft und ihrer Währung bedeutet somit wachsendes monetäres Chaos.
[15] Lenin bezeichnete den Völkerbund, eine andere internationale Institution, als „Räuberbande".
Aktuelles und Laufendes:
Theoretische Fragen:
Erbe der kommunistischen Linke:
Die Welt am Rande einer Umweltkatastrophe
- 7292 reads
„In den Ländern der Dritten Welt dehnen sich die Hungersnöte aus, und sie werden auch bald aus den Ländern zu vermelden sein, die angeblich „sozialistisch" waren. Gleichzeitig vernichtet man in Westeuropa und in Nordamerika die landwirtschaftlichen Güter massenweise, und bezahlt den Bauern Gelder, damit weniger angebaut und geerntet wird. Sie werden bestraft, wenn sie mehr als die auferlegten Quoten produzieren. In Lateinamerika töten Epidemien wie die Cholera Tausende von Menschen, obgleich diese Geißel schon seit langem gebannt schien. Auch weiterhin fallen Zehntausende von Menschen binnen kürzester Zeit Überschwemmungen und Erdbeben zum Opfer, obgleich die Gesellschaft in der Lage wäre, Deiche und erdbebensichere Häuser zu bauen. Ganz zu schweigen von den Tücken oder „Fatalitäten" der Natur, wenn - wie in Tschernobyl 1986 - die Explosion eines AKW Hunderte (wenn nicht Tausende) Menschen tötet und noch viele mehr in anderen Regionen radioaktiv verstrahlt. Es ist bezeichnend, dass sich in den höchstentwickel-ten Ländern tödliche Unfälle häufen: 60 Tote in einem Pariser Bahnhof, 100 Tote bei einem Brand in der Londoner U-Bahn. Dieses System hat sich als unfähig erwiesen, der Zerstörung der Natur Einhalt zu gebieten, den sauren Regen, die Verschmutzungen jeder Art und insbeson-dere durch die Atomkraftwerke, den Treibhauseffekt, die zunehmende Verwüstung zu bekämpfen; d.h. alle Faktoren, die das Über-leben der Menschheit selbst bedrohen" (1991, Kommunistische Revolution oder Zerstörung der Menschheit" Manifest des 9. Kongresses der IKS 1991).
Die Frage der Umwelt ist schon immer von der Propaganda der Revolutionäre aufgegriffen worden, von Marx und Engels, die die unerträglichen Lebensbedingungen im London des 19. Jahrhunderts bloßlegten, bis hin zu Bordiga und seinen Schriften über die Umweltzerstörungen infolge des unverantwortlichen Handelns des Kapitalismus. Heute ist diese Frage noch zentraler, und sie verlangt verstärkte Anstrengungen seitens der revolutionären Organisationen, um aufzuzeigen, dass die historische Alternative, vor der die Menschheit steht, die Perspektive des Sozialismus gegenüber einer Barbarei ist, die sich nicht nur in den lokalen und allgemeinen Kriegen ausdrückt, sondern auch die Gefahr einer ökologischen und Umweltkatastrophe heraufbeschwört, die sich immer deutlicher abzeichnet.
Mit dieser Artikelserie, möchte die IKS die Umweltfrage aufgreifen. Dabei werden wir auf die folgenden Aspekte eingehen:
Im ersten Artikel versuchen wir eine kurze Bestandsaufnahme der heutigen Lage zu machen und aufzuzeigen, vor welchem globalen Risiko die Menschheit heute steht, indem wir insbesondere auf die destruktivsten der weltweit anzutreffenden Phänomene eingehen wie:
- die Zunahme des Treibhauseffektes;
- die Müllentsorgung;
- die grenzenlose Ausbreitung von Giftstoffen und die damit verbundenen biologischen Prozesse;
- die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen und/oder ihre Umwandlung durch Giftstoffe.
Im zweiten Artikel werden wir versuchen aufzuzeigen, dass die Umweltprobleme nicht auf die Verantwortlichkeit Einzelner zurückgeführt werden können (wenngleich es auch individuelle Verantwortung gibt), weil es der Kapitalismus an sich und seine Logik des Profitstrebens sind, die tatsächlich dafür verantwortlich zeichnen. So werden wir sehen, dass die Entwicklung der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Forschung keinem Zufall unterworfen ist, sondern den kapitalistischen Zwangsgesetzen des Höchstprofits unterliegt.
Im dritten Artikel werden wir auf die Lösungsansätze der verschiedenen Bewegungen der Grünen, Ökologen usw. eingehen, um aufzuzeigen, dass trotz ihren guten Absichten und dem guten Willen vieler ihrer Aktivisten diese Lösungsansätze nicht nur völlig wirkungslos sind, sondern die Illusionen über eine mögliche Lösung dieser Fragen innerhalb des Kapitalismus direkt verstärken, wo in Wirklichkeit die einzige Lösung in der internationalen kommunistischen Revolution besteht.
Die Vorboten der Katastrophe
Man spricht immer häufiger über die Umweltprobleme, allein schon weil in der jüngsten Zeit in verschiedenen Ländern der Welt Parteien entstanden sind, die sich den Umweltschutz auf die Fahnen geschrieben haben. Ist das beruhigend? Überhaupt nicht! Wenn jetzt großes Aufheben um diese Frage gemacht wird, geht es nur darum, unsere Köpfe zu verwirren. Deshalb haben wir beschlossen, zunächst jene besonderen Phänomene zu beschreiben, die alle zusammengenommen die Gesellschaft immer mehr an den Rand einer Umweltkatastrophe drängen. Wie wir zeigen werden, ist die Lage im Gegensatz zu all den Beteuerungen in den Medien und insbesondere in den auf Hochglanzpapier gedruckten Fachzeitschriften noch viel schwerwiegender und bedrohlicher, als man sagt. Nicht dieser oder jener profitgierige und unverantwortliche Einzelkapitalist, nicht die Mafia oder Camorra ist für die Lage verantwortlich, sondern das kapitalistische System insgesamt.
Die Auswirkungen des wachsenden Treibhauseffektes
Jedermann spricht von den Auswirkungen des Treibhauseffektes, aber meist beruht dies nicht auf einer wirklichen Sachkenntnis. Es ist wichtig hervorzuheben, dass der Treibhauseffekt für das Leben auf der Erde eine durchaus positive Funktion erfüllt - zumindest für die Art Leben, die wir kennen, weil er es ermöglicht, dass auf der Erdoberfläche eine Durchschnittstemperatur von ungefähr 15°C herrscht (dieser Durchschnitt berücksichtigt die vier Jahreszeiten und die verschiedenen Breitengrade) statt minus 17°C, d.h. der geschätzten Temperatur, wenn es den Treibhauseffekt nicht gäbe. Man stelle sich vor, wie die Welt aussehen würde, wenn die Temperaturen ständig unter Null lägen, Seen und Flüsse vereist wären... Worauf ist dieser „Überschuss" von mehr als 32°C zurückzuführen? Auf den Treibhauseffekt. Das Sonnenlicht dringt durch die niedrigsten Schichten der Atmosphäre, ohne absorbiert zu werden (die Sonne erwärmt nicht die Luft), und liefert der Erde die Energie. Die dabei entstehende Strahlung setzt sich (wie die von jedem Himmelskörper) hauptsächlich aus Infrarotstrahlen zusammen; sie wird durch einige Bestandteile der Luft, wie Kohlenstoffanhydrid, Wasserdampf, Methan und andere zusammengesetzte Teile wie Fluorchlorkohlenwasserstoff (Abkürzung FCKW), aufgefangen und absorbiert. Die in den unteren Schichten der Atmosphäre dabei entstehende Wärme kommt wiederum der thermischen Bilanz der Erde zugute, weil sie bewirkt, dass die Durchschnittstemperaturen auf der Erde um eben jene besagten 32°C höher ausfallen. Das Problem ist also nicht der Treibhauseffekt als solcher, sondern die Tatsache, dass mit der Entwicklung der Industriegesellschaft Substanzen in die Atmosphäre gelassen wurden, die einen zusätzlichen Treibhauseffekt bewirken und die bei zunehmender Konzentration eine deutliche Erderwärmung verursachen. Bei Untersuchungen von Bohrkernen aus 65.000 Jahre altem Polareis wurde nachgewiesen, dass die gegenwärtige Konzentration von Kohlendioxid (CO2) von 380 ppm (Milligramm pro Kubikdezimeter) in der Luft die höchste je gemessene und vielleicht sogar die höchste seit den letzten 20 Millionen Jahren ist. Die im 20. Jahrhundert ermittelten Temperaturen sind die höchsten seit den vergangenen 20.000 Jahren. Die wahnwitzige Verschwendung fossiler Brennstoffe als Energiequelle und die wachsende Abholzung der Wälder auf der Erde haben seit dem Industriezeitalter das natürliche Gleichgewicht und den Kohlenstoffhaushalt der Erdatmosphäre durcheinander gebracht. Dieses Gleichgewicht ist das Ergebnis der Freisetzung von CO2 in der Atmosphäre einerseits durch die Verbrennung und den Abbau organischer Stoffen, andererseits durch die Fixierung dieses CO2 in der Atmosphäre durch die Photosynthese. Bei diesem Prozess wird das CO2 in Kohlenhydrat und damit in einen komplexen organischen Stoff umgewandelt. Die Veränderung dieses Gleichgewichts zwischen Freisetzung (Verbrennung) und Fixierung (Photosynthese) von CO2 zugunsten der Freisetzung ist der Grund für die gegenwärtige Zuspitzung des Treibhauseffektes.
Wie oben angeführt, spielt nicht nur das Kohlendioxid, sondern auch Wasserdampf und Methan eine Rolle. Der Wasserdampf ist sowohl treibender Faktor als auch Ergebnis des Treibhauseffektes, denn je stärker die Temperatur steigt, desto mehr Wasserdampf entsteht. Die Zunahme von Methan in der Atmosphäre ist wiederum auf eine ganze Reihe von natürlichen Ursachen zurückzuführen, aber sie ist auch Ergebnis der zunehmenden Verwendung dieses Gases als Brennstoff und von Lecks in auf der ganzen Welt verlegten Gaspipelines. Methan, das auch „Moorgas" genannt wird, ist ein Gas, das aus der Gärung organischer Stoffe unter Ausschluss von Sauerstoff entsteht. Die Flutung von bewaldeten Tälern für den Bau von Dämmen für hydroelektrische Kraftwerke ist eine Ursache für die Zunahme der Methankonzentration. Aber das Problem des Methans, das gegenwärtig für ein Drittel der Zunahme des Treibhauseffektes verantwortlich ist, ist sehr viel größer, als es anhand der eben erwähnten Fakten erscheint. Zunächst kann das Methan 23-mal mehr Infrarotstrahlung aufnehmen als Kohlendioxid. Und das ist beträchtlich. Schlimmer noch! All die gegenwärtigen, ohnehin schon katastrophalen Prognosen berücksichtigen nicht das mögliche Szenario infolge der Freisetzung von Methan aus den gewaltigen natürlichen Methanreserven der Erde. Diese befinden sich in abgeschlossenen Gashüllen, bei ungefähr 0° C und einem geringen Atmosphärendruck in besonderen Eisformationen (hydratisierten Gasen). Ein Liter Eiskristall kann ca. 50 Liter Methangas binden. Solche Vorkommen findet man vor allem im Meer, entlang des Kontinentalabhangs und im Innern der Permafrostzone in verschiedenen Teilen Sibiriens, Alaskas und Nordeuropas. Experten in diesem Bereich meinen dazu Folgendes: „Wenn die globale Erwärmung gewisse Grenzen überschreitet (3 - 4°C) und wenn die Temperatur der Küstengewässer und des Permafrostgebietes ansteigen würde, könnte binnen kurzer Zeit (innerhalb von einigen Jahrzehnten) eine gewaltige Emission von freigesetztem Methan durch instabil gewordene Hydrate stattfinden, was zu einer katastrophalen Zunahme des Treibhauseffektes führen würde (...) Im letzten Jahr sind die Methanemissionen auf schwedischem Boden im Norden des Polarkreises um 60 Prozent gestiegen. Der Anstieg der Temperaturen während der letzten 15 Jahre ist im Durchschnitt relativ begrenzt geblieben, aber in dem nördlichen Teil Eurasiens und Amerikas war er sehr ausgeprägt (im Sommer ist die sagenumwobene Nord-Westpassage eisfrei, was eine Durchfahrt vom Atlantik zum Pazifik mit dem Schiff ermöglicht)" [1].
Aber selbst wenn wir diese besonders ernste Warnung einmal übergehen - international anerkannte Prognosen wie die des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) der UNO und des MIT (Massachusetts Institute of Technology) in Boston haben bereits für dieses Jahrhundert eine durchschnittliche Temperaturerhöhung von mindestens 0,5°C bis zu 4,5°C prognostiziert, ausgehend von der Annahme, dass sich nichts Wesentliches ändern wird. Dabei berücksichtigen solche Prognosen nicht einmal die Umwälzungen, die sich aus dem Auftauchen der beiden neuen Industriemächte China und Indien ergeben, die gefräßige Energieverbraucher sind.
Eine zusätzliche Erwärmung von wenigen Grad würde eine größere Verdampfung des Wassers der Weltmeere verursachen, doch exaktere Untersuchungen deuten darauf hin, dass es immer größere Unterschiede bei der geographischen Verteilung der Niederschlagsmengen geben wird. „Trockene Gebiete werden immer größer und noch trockener. Meeresgebiete mit Oberflächentemperaturen über 27°C, ein kritischer Wert für das Entstehen von Zyklonen, werden um 30 bis 40 Prozent weiter wachsen. Dies würde katastrophale meteorologische Folgen haben - und zu Überschwemmungen und immer neuen Zerstörungen führen. Das Schmelzen eines Großteils der antarktischen Gletscher und der Gletscher Grönlands, der Anstieg der Meereswassertemperaturen lässt den Meeresspiegel ansteigen () damit dringt Salzwasser in immer mehr fruchtbare Küstengebiete vor und überflutet sie (teilweise Bangladesh, viele Inseln in den Ozeanen)" [2].
Aus Platzgründen können wir nicht in die Details gehen, doch wollen wir an dieser Stelle wenigstens auf die katastrophalen Folgen hinweisen, die der durch den Treibhauseffekt bedingte Klimawandel auslösen wird. Um nur einige Beispiele zu nennen:
- Die meteorologischen Extreme werden sich intensivieren; fruchtbare Böden werden von immer stärkeren Regenfällen ausgewaschen, was dazu führt, dass die Erträge der Böden sinken. Auch in den gemäßigteren Klimazonen, wie zum Beispiel in Piemont (Italien), schreitet die Versteppung der Böden voran.
- Im Mittelmeer und in anderen einst mäßig warmen Meeren entstehen Bedingungen, die das Überleben von Lebewesen ermöglichen, die bislang nur in tropischen Gewässern existierten. Damit wird es zur „Einwanderung" von bislang nicht einheimischen Lebewesen kommen, was zu Störungen im ökologischen Gleichgewicht führt.
- Aufgrund der Ausbreitung von Klimabedingungen, die das Wachstum und die Verbreitung von Krankheitsträgern wie Mücken usw. begünstigen, kommt es zu einem Wiederaufleben alter, längst ausge-rotteter Krankheiten wie Malaria.
Das Problem der Produktion und der Umgang mit Abfall
Ein zweites Problem, das typisch ist für diese Phase der kapitalistischen Gesellschaft, ist die exzessive Produktion von Abfällen und die daraus resultierende Schwierigkeit ihrer Entsorgung. Wenn in der letzten Zeit Meldungen über Müllberge in den Straßen Neapels und in Kampanien in den internationalen Medien auftauchten, ist das auch darauf zurückzuführen, dass dieser Teil der Welt noch immer als ein Teil der Industrieländer und damit als ein Teil der fortgeschrittenen Länder betrachtet wird. Dass die Peripherien vieler Großstädte in der Dritten Welt zu offenen Müllhalden geworden sind, ist mittlerweile sattsam bekannt und keine Rede mehr wert.
Diese unglaubliche Anhäufung von Müll ist der Logik der Funktionsweise des Kapitalismus geschuldet. Die Menschheit hat immer Unrat produziert, doch wurde dieser in der Vergangenheit stets verwertet und neu verwendet. Erst nach dem Einzug des Kapitalismus wird der Müll aufgrund der besonderen Funktionsweise dieser Gesellschaft zu einem Problem. Deren Mechanismen stützen sich sämtlichst auf ein grundlegendes Prinzip: Jedes Produkt menschlicher Aktivität wird als Ware betrachtet, d.h. als etwas, das verkauft werden muss, um auf einem Markt, auf dem gnadenlose Konkurrenz herrscht, ein Höchstmaß an Profit zu erzielen. Dies musste eine Reihe von verheerenden Konsequenzen nach sich ziehen:
1. Warenproduktion kann aufgrund der Konkurrenz unter den Kapitalisten weder mengenmäßig noch zeitlich geplant werden. Sie unterliegt einer irrationalen Logik, die dazu führt, dass jeder einzelne Kapitalist seine Produktion ausdehnt, um mit möglichst niedrigen Kosten zu verkaufen und seinen Profit zu realisieren. Dadurch stapeln sich Berge von unverkauften Waren. Gerade diese Notwendigkeit, den Konkurrenten niederzuringen und die Preise zu senken, zwingt die Produzenten dazu, die Qualität der hergestellten Waren zu senken. Dadurch sinkt ihre Haltbarkeit drastisch. Folge: die Produkte verschleißen viel schneller und wandern früher in die Mülltonne.
2. Es gibt eine irrsinnige Produktion von Verpackungen und Aufmachung aller Art, oft unter Verwendung giftiger Substanzen, die, obwohl sie nicht abbaubar sind, einfach auf den Müll landen und letztendlich in den natürlichen Kreislauf gelangen. Diese Verpackungen, die oft keinen Nutzen haben, außer die Produkte „ansehnlicher", für den Verkauf attraktiver zu machen, sind häufig schwerer und platzraubender als der Inhalt der verkauften Ware selbst. Man geht davon aus, dass gegenwärtig ein Müllsack, bei dem keine Abfalltrennung vorgenommen wurde, bis zur Hälfte mit Verpackungsmaterial vollgestopft ist.
3. Das Abfallaufkommen wird zudem noch durch die neuen Formen des „Lifestyle" verschärft, die dem „modernen Leben" innewohnen. In einem Selbstbedienungsrestaurant auf Plastiktellern essen und Mineralwasser aus Plastikflaschen trinken ist mittlerweile zum Alltag für Abermillionen Menschen auf der ganzen Welt geworden. Auch die Verwendung von Plastiktüten zum Einkauf ist eine „praktische Annehmlichkeit", die von vielen genutzt wird. All das ist umweltgefährdend - und nützt nur dem Besitzer des Schnellrestaurants, der das Reinigungspersonal einsparen kann, welches nötig ist, wenn man andere Verpackungsarten verwendet. Auch dem Betreiber des Supermarktes und gar dem Ladenbesitzer um die Ecke kommt dies zupass; der Kunde kann jederzeit spontan einkaufen und erhält für seine Waren eine Tragetüte. All das bewirkt eine ungeheure Steigerung der Produktion von Abfall und Verpackungsmüll; pro Kopf fällt fast ein Kilo Abfall und Verpackungen täglich an, d.h. insgesamt Millionen Tonnen verschiedenster Abfälle Tag für Tag.
Man geht davon aus, dass sich allein in einem Land wie Italien die Abfallmenge während der letzten 25 Jahre bei gleich bleibender Bevölkerungszahl mehr als verdoppelt hat.
Die Müllfrage ist eine der Fragen, welche die Politiker meinen lösen zu können, aber in Wirklichkeit stößt sie im Kapitalismus auf unüberwindbare Hürden. Diese Hürden sind nicht mangelnder Technologie geschuldet, sondern sind im Gegenteil das Ergebnis der Mechanismen, die diese Gesellschaft beherrschen. Denn auch der Umgang mit Müll, sei es um ihn zu entsorgen oder seinen Umfang zu reduzieren, ist den Regeln der Profitwirtschaft unterworfen. Selbst wenn Recycling und die Wiederverwendung von Material durch Mülltrennung usw. möglich sind, erfordert dies Mittel und eine gewisse politische Koordinierungsfähigkeit, welche im Allgemeinen in den schwächeren Wirtschaften fehlt. Deshalb stellt die Abfallentsorgung in den ärmeren Ländern oder dort, wo die Firmen in Anbetracht der sich beschleunigenden Krise während der letzten Jahrzehnte vor größeren Schwierigkeiten stehen, mehr als einen zusätzlichen Kostenfaktor dar.
Man mag einwenden, dass, wenn in den fortgeschrittenen Ländern die Müllentsorgung funktioniert, dies mithin bedeutet, dass es sich nur um eine Frage des guten Willens, des richtigen Bürgersinns und der rechten Betriebsleitung handelt. Das Problem sei, dass, wie in allen Bereichen der Produktion, die stärksten Länder einen Teil der Last der Abfallentsorgung auf die schwächeren Länder (oder innerhalb der stärksten Länder auf die schwächeren Regionen) abwälzen.
„Zwei amerikanische Umweltgruppen, Basel Action Network und Silicon Valley Toxics, haben neulich einen Bericht veröffentlicht, in dem behauptet wird, dass 50 - 80 Prozent der Elektronikabfälle der westlichen US-Bundesstaaten in Containern auf Schiffe verladen werden, die Richtung Asien (vor allem Indien und China) fahren, wo die Kosten für ihre Beseitigung wesentlich niedriger sind und die Umweltschutzauflagen viel lockerer. Es handelt sich nicht um Hilfsprojekte, sondern um einen Handel mit giftigen Rückständen, die Verbraucher weggeworfen haben. Der Bericht der beiden Umweltgruppen erwähnt zum Beispiel die Müllhalde von Guiyu, auf der vor allem Bildschirme und Drucker gelagert werden. Die Arbeiter von Guiyu benutzen nur sehr primitive Werkzeuge, um daraus Teile auszubauen, die weiter verkauft werden können. Eine enorme Menge an Elektronikschrott wird nicht recycelt, sondern liegt einfach auf den Feldern, an Flussufern, in Teichen und Sümpfen, Flüssen und Bewässerungskanälen herum. Ohne irgendwelchen Schutz arbeiten dort Frauen, Männer und Kinder" [3].
„In Italien (...) schätzt man, dass die Öko-Mafia einen Umsatz von 26 Milliarden Euro pro Jahr macht, davon 15 Mrd. für den illegalen Handel und die illegale Entsorgung von Müll (Bericht über die Ecomafia 2007, Umweltliga). (...) Der Zoll hat im Jahre 2006 286 Container mit mehr als 9000 Tonnen Müll beschlagnahmt. Die legale Entsorgung eines 15-Tonnen-Containers mit gefährlichem Sondermüll kostet ungefähr 60.000 Euro. Bei einer illegalen Entsorgung in Asien werden dafür nur 5000 Euro verlangt. Die Hauptabnehmer für illegalen Müllhandel sind asiatische Entwicklungsländer. Das dorthin exportierte Material wird zunächst verarbeitet, dann wieder nach Italien und andere Länder eingeführt, dieses Mal aber als ein Produkt, das aus dem Müll gewonnen wurde und nun insbesondere Kunststoff verarbeitenden Fabriken zugeführt wird.
Im Juni 1992 hat die FAO (Food and Agricultural Organisation) angekündigt, dass die Entwicklungsländer, vor allem die afrikanischen Staaten, zu einer „Mülltonne" geworden sind, die dem Westen zur Verfügung steht. Somalia scheint heute einer der am meisten gefährdeten afrikanischen Staaten zu sein, ein wahrer Dreh- und Angelpunkt für den Mülltourismus. Im jüngsten Bericht der UNEP (United Nations Environment Programme) wird auf die ständig steigende Zahl von verschmutzten Grundwasservorkommen in Somalia hingewiesen, was unheilbare Erkrankungen verursacht. Der Hafen von Lagos, Nigeria, ist der wichtigste Umschlagplatz für den illegalen Handel von Technikschrott, der nach Afrika verschifft wird.
Jedes Jahr sammeln sich auf der Welt ca. 20 - 50 Millionen Tonnen „Elektroschrott" an. In Europa spricht man von elf Millionen Tonnen, davon landen 80 Prozent auf dem Müll. Man geht davon aus, dass es 2008 mindestens eine Milliarde Computer (einen für jeden sechsten Erdbewohner) geben wird; gegen 2015 wird es mehr als zwei Milliarden PCs geben. Diese Zahlen bergen neue große Gefahren in sich, wenn es darum gehen wird, den alten Elektroschrott zu entsorgen" [4].
Wie oben erwähnt, wird das Müllproblem aber auch auf die weniger entwickelten Regionen innerhalb eines Landes verlagert. Das trifft in Italien insbesondere auf Kampanien zu, das aufgrund seiner Müllberge, die monatelang auf den Straßen herumlagen, international von sich reden machte. Aber wenige wissen, dass Kampanien - so wie international China, Indien oder Nordafrika -, das „Auffangbecken" für reichlich Giftmüll aus den Industriegebieten des Nordens ist. Dadurch wurden fruchtbare landwirtschaftliche Böden wie die um Caserta zu den am meisten verschmutzten Böden der Erde. Trotz wiederholt eingeleiteter strafrechtlichen Verfolgungsmaßnahmen geht die Vernichtung der Böden weiter. Es sind aber nicht die Camorra, die Mafia, die Unterwelt, die diese Schäden verursachen, die Logik des Kapitalismus ist dafür verantwortlich. Während für die vorschriftsmäßige Entsorgung von Giftmüll oft mehr als 60 Cent pro Kilo veranschlagt werden müssen, kostet die illegale Entsorgung nur etwas mehr als zehn Cent. So wird jedes Jahr jede verlassene Höhle zu einer offenen Müllkippe. In einem kleinen Dorf Kampaniens, wo eine Müllverbrennungsanlage gebaut werden soll, wurde giftiges Material zur Vertuschung des Giftbestandes mit Erde vermischt und dann beim Straßenbau verwendet. Dort hat man es als untere Schicht für eine lange Straße mit gestampftem Boden benutzt. Wie Saviano in seinem Buch, das mittlerweile in Italien zu einem Kultbuch geworden ist, schrieb: „Wenn die illegalen Müllberge, die die Camorra „entsorgt" hat, auf einem Haufen zusammengetragen werden würden, würde dieser eine Höhe von 14.600 Meter auf einer Fläche von drei Hektar erreichen, das wäre höher als jeder Berg auf der Erde" [5].
Wie wir im nächsten Artikel näher ausführen werden, ist das Problem des Abfalls vor allem mit der Produktionsform verbunden, die die kapitalistische Gesellschaft auszeichnet. Abgesehen von dem Teil, der „weggeworfen" wird, sind die Probleme oft auf die Zusammensetzung und das Material zurückzuführen, die bei der Produktion verwendet werden. Die Verwendung von synthetischen Stoffen, insbesondere von Kunststoffen, die praktisch unzerstörbar sind, birgt gewaltige Probleme für die zukünftigen Generationen. Und hier geht es nicht um reiche oder arme Länder, weil Kunststoff nirgendwo auf der Welt abbaubar ist, wie der Auszug aus folgendem Artikel belegt: „Man nennt sie „Trash Vortex", die Müllinsel im Pazifischen Ozean, die einen Durchmesser von ca. 25.000 km umfasst, ca. 30 Meter tief ist und zu ca. 80 Prozent aus Plastik besteht, die restlichen 20 Prozent sind anderer Müll, der dort gelandet ist. Es ist, als ob es inmitten des Pazifiks eine gigantische Insel gäbe, die nicht aus Felsen, sondern aus Müll besteht. In den letzten Wochen hat die Dichte dieses Materials solche Werte erreicht, dass das Gesamtgewicht dieser ‘Müllinsel' ca. 3,5 Millionen Tonnen umfasst, erklärte Chris Parry von der Kalifornischen Küstenwacht in San Francisco (...) Diese unglaubliche, wenig bekannte Abfallmenge, ist seit den 1950er Jahren entstanden, aufgrund eines subtropischen Wirbels im Nordpazifik. Es handelt sich um eine langsame Strömung im Ozean, die sich im Uhrzeigersinn und spiralenförmig dreht, angetrieben von Hochdruckströmungen. (...) Der größte Teil dieses Plastiks, ca. 80 Prozent, wurde von den Kontinenten angeschwemmt. Nur der Rest stammt von Schiffen (private, Handels- oder Fischfangbooten). Jedes Jahr werden auf der Welt ca. 100 Milliarden Kilo Kunststoffe produziert, davon landet ca. 10 Prozent im Meer. 70 Prozent dieser Kunststoffe versinkt auf den Meeresboden und schädigt somit die Lebewesen am Meeresgrund. Der Rest schwimmt an der Meeresoberfläche. Der Großteil dieser Kunststoffe ist wenig biologisch abbaubar und zerfällt letztendlich in winzige Partikel, die wiederum im Magen vieler Meerestiere landen und deren Tod verursachen. Was übrig bleibt, wird erst im Laufe von mehreren hundert Jahren verfallen; solange wird es aber weiterhin großen Schaden in den Meeren anrichten" [6].
Solch eine Müllmenge auf einer Fläche, die zweimal größer ist als die USA, soll wirklich erst jetzt entdeckt worden sein? Mitnichten! Sie wurde 1997 von einem Kapitän eines Schiffs, das im Dienste der Meeresforschung steht, erstmals gesichtet. Der Kapitän befand sich auf der Rückkehr von einem Segelwettbewerb. Heute ist bekannt, dass die UNO in einem Bericht von 2006 davon ausging, „dass eine Million Meeresvögel und mehr als 100.000 Fische und Meeressäugetiere jedes Jahr aufgrund des Plastikmülls sterben und dass jede Seemeile des Ozeans mindestens ungefähr 46.000 Stücke schwimmenden Plastiks enthält[7].
Aber was wurde während der letzten zehn Jahre von jenen unternommen, die am Hebel der Macht sitzen? Absolut gar nichts! Ähnliche Verhältnisse, auch wenn sie nicht so dramatisch sind, sind auch im Mittelmeer zu beobachten, in dessen Gewässer jedes Jahr 6,5 Millionen Tonnen. Abfall geschmissen werden, von denen 80 Prozent Kunststoffe sind. Auf dem Boden des Mittelmeeres findet man stellenweise bis zu 2.000 Kunststoffpartikel pro Quadratkilometer [8].
Und dabei gäbe es Lösungen. Kunststoff, der aus mindestens 85 Prozent Maisstärke besteht, ist vollständig biologisch abbaubar. Heute schon gibt es Tüten, Stifte und andere aus diesem Material bestehende Gegenstände. Aber im Kapitalismus schlägt die Industrie ungern einen Weg ein, der nicht höchste Profite verspricht. Und da Kunststoff auf der Grundlage von Maisstärke teurer ist, will niemand diese Kosten für die teurere Herstellung des biologisch abbaubaren Materials übernehmen, ohne vom Markt verdrängt zu werden [9]. Das Problem ist, dass die Kapitalisten die Gewohnheit haben, Wirtschaftsbilanzen zu erstellen, die systematisch all das ausschließen, was nicht zahlenmäßig erfasst werden kann, weil man es weder kaufen noch verkaufen kann, auch nicht, wenn es sich um die Gesundheit der Menschen und die Umwelt handelt. Jedes Mal, wenn ein Industrieller einen Stoff herstellen lässt, der am Ende seiner Lebensdauer zu Müll wird, werden die Kosten für die Entsorgung des Mülls praktisch nie einkalkuliert; vor allem wird nie berücksichtigt, welche Kosten und Schäden daraus entstehen, dass dieses Material irgendwo auf der Erde unabgebaut liegen bleibt.
Man muss hinsichtlich des Müllproblems noch hinzufügen: Der Unterhalt von Müllhalden oder auch von Verbrennungsanlagen stellt eine Verschwendung des ganzen Energiewertes und der nützlichen Bestandteile dieses Mülls dar. Es ist beispielsweise Fakt, dass die Herstellung bzw. Verarbeitung von Kupfer und Aluminium mit Hilfe von recyceltem Material Kostenersparnisse bis zu 90 Prozent ermöglichen könnte. In den peripheren Ländern sind die Müllhalden zu einer wahren Quelle von Subsistenzmitteln für Abertausende von Menschen geworden, die, vom Land gekommen, in der Stadt keine Arbeit finden. Müllsammler suchen auf den Müllhalden nach Wiederverwertbarem.
„Richtige „Müllstädte" sind entstanden. In Afrika handelt es sich um Korogocha in Nairobi. Pater Zanotelli hat die Verhältnisse dort mehrmals beschrieben; weniger bekannt ist Kigali in Ruanda, aber die in Sambia sind auch berühmt. Dort wird 90 Prozent des Mülls nicht eingesammelt. Er verfault auf der Straße, während die Müllhalde von Olososua in Nigeria jeden Tag von mehr als 1.000 LKW angefahren wird. In Asien hat Payatas in Quezon City in der Nähe von Manila traurige Berühmtheit erlangt. Diese Slums, wo mehr als 25.000 Menschen leben, sind am Abhang eines Müllbergs entstanden. Man nennt ihn den „stinkenden Berg", wo sich Kinder und Erwachsene um das Material streiten, das sie weiterverkaufen können. Dann gibt es noch Paradise Village, das kein Touristendorf ist, sondern ein Slum, der auf einem Sumpfgebiet entstanden ist, wo es immer wieder zu Überschwemmungen und starken Monsunregenfällen kommt. Schließlich Dumpsite Catmon, die Müllhalde, auf der die Slums stehen, die Paradise Village überragen. In Peking, China, leben Tausende von Menschen auf den Müllhalden, die verbotene, weil gefährliche Stoffe recyceln, während es in Indien die meisten „Überlebenden" unter jenen gibt, die sich dank der Müllhalden „ernähren" können."[10]
Die Verbreitung der Giftstoffe
Giftstoffe sind natürliche oder synthetische Substanzen, die für den Menschen und/oder andere Lebewesen giftig sind. Neben Stoffen, die es immer schon auf unserem Planeten gegeben hat und die von der industriellen Technologie auf verschiedenste Art verwendet werden - wie zum Beispiel Schwermetalle, Asbest usw., hat die chemische Industrie Zehntausende anderer Stoffe massenweise produziert. Mangelnde Kenntnis der Gefahren einer Reihe von Stoffen und vor allem der Zynismus des Kapitalismus haben unvorstellbare Schäden angerichtet. Es sind dadurch Umweltzerstörungen ausgelöst worden, die man nur sehr schwer wieder beheben kann, wenn einst die gegenwärtig herrschende Klasse gestürzt sein wird.
Eine der größten Katastrophen der chemischen Industrie ist sicherlich die von Bophal, Indien, die am 2. und 3. Dezember 1984 in dem Werk des amerikanischen Chemie-Multis Union Carbide stattfand. Eine Giftwolke von 40 Tonnen Pestiziden tötete entweder sofort oder in den darauffolgenden Jahren mindestens 16.000 Menschen. Überlebende klagen seitdem über unheilbare körperliche Schäden. Später eingeleitete Untersuchungen haben zutage gebracht, dass im Gegensatz zu einem vergleichbaren Werk in Virginia, USA, das Werk in Bophal über keine drucktechnischen Überwachungsanlagen und Kühlsysteme verfügte. Der Kühlturm war vorübergehend außer Betrieb genommen worden; die Sicherheitssysteme entsprachen überhaupt nicht dem Ausmaß der Werksanlage. In Wirklichkeit stellte die indische Fabrik mit ihren billigen Arbeitskräften für die amerikanischen Besitzer eine sehr lukrative Einnahmequelle dar, die nur sehr geringe Investitionen in variables und fixes Kapital erforderte.
Ein anderes historisches Beispiel war schließlich der Vorfall im Atomkraftwerk von Tschernobyl 1986. „Man hat geschätzt, dass die radioaktiven Strahlen des Reaktors 4 von Tschernobyl ungefähr 200-mal höher lagen als die Explosionen der Atombomben von Hiroshima und Nagasaki zusammengenommen. Auf einem Gebiet zwischen Russland, der Ukraine und Weißrussland, in dem ungefähr neun Millionen Menschen leben, hat man eine große Verseuchung festgestellt. 30 Prozent des Gebietes ist durch Cäsium 137 verseucht. In den drei Ländern mussten ca. 400.000 Menschen evakuiert werden, während weitere 270.000 Menschen in Gebieten leben, in denen der Konsum von örtlichen landwirtschaftlichen Produkten nur eingeschränkt erlaubt ist." [11]
Es gibt natürlich noch unzählige andere Umweltkatastrophen infolge schlampiger Betriebsleitung oder der vielen Meeresverschmutzungen durch Ölteppiche wie jenen, den der Öltanker Exxon Valdez am 24. März 1989 anrichtete, als bei seinem Untergang vor der Küste Alaskas mindestens 30.000 Tonnen Öl ins Meer liefen, oder auch infolge des ersten Golfkriegs, als viele Ölplattformen in Brand geschossen wurden und sich eine Ökokatastrophe in einem bislang noch nie da gewesenen Ausmaß im Persischen Golf abspielte. Schätzungen der US-amerikanischen Nationalen Akademie der Wissenschaften zufolge werden jedes Jahr durchschnittlich zwischen drei bis vier Millionen Tonnen Kohlenwasserstoffe ins Meer geleitet, Tendenz steigend - trotz der verschiedenen Schutzmaßnahmen, denn die Nachfrage nach diesen Produkten wächst.
Neben den Auswirkungen dieser Verschmutzungen, die bei hoher Dosierung größere Vergiftungen hervorrufen, gibt es einen anderen Vergiftungsmechanismus, der langsamer, diskreter wirkt - die chronische Vergiftung. Wenn eine giftige Substanz langsam und in geringen Dosen aufgenommen wird und chemisch stabil ist, kann sie sich in den Organen und den Geweben der Lebewesen absetzen und soweit anhäufen, bis tödliche Konzentrationen erreicht werden. Dies nennt man aus der Sicht der Ökotoxikologie Bioakkumulation. Ein weiterer Mechanismus betrifft giftige Substanzen, die in die Lebensmittelkette eindringen (das trophische Netz). Sie gelangen von einer niedrigen zu einer höheren Stufe der trophischen Stadien, mit jeweiliger Verdoppelung bzw. Verdreifachung der Konzentration. Um es deutlicher zu machen, nehmen wir ein konkretes Beispiel aus dem Jahre 1953 in Minamata in Japan. In der Bucht Minamata lebten viele arme Fischer, die sich im Wesentlichen von ihrem Fischfang ernährten. In der Nähe dieser Bucht befand sich ein Industriekomplex, der Acetaldehyd verwendete, einen chemischen Stoff, eine Synthese, deren Zubereitung ein Quecksilberderivat erfordert. Die ins Meer als Abfall eingeleiteten Stoffe waren leicht mit Quecksilber vergiftet. Die Konzentration betrug jedoch nur 0.1 Mikrogramm pro Liter Meerwasser, d.h. eine Konzentration, die selbst mit den heute verfügbaren genaueren Messgeräten immer noch schwierig zu ermitteln ist. Welche Konsequenzen ergaben sich aus dieser kaum wahrnehmbaren Verschmutzung? 48 Menschen starben innerhalb weniger Tage, 156 litten unter Vergiftungen mit schwerwiegenden Folgen, und selbst die Katzen der Fischer, die sich ständig von Fischresten ernährten, wurden „irrsinnig", brachten sich schließlich selbst im Meer um, ein für ein Raubtier völlig unübliches Verhalten. Was war passiert? Das im Meerwasser vorhandene Quecksilber war durch das Phytoplankton aufgenommen und fixiert worden, war dann von diesem zum Zooplankton gewandert, schließlich zu den kleinen Mollusken (Weichtieren), und schlussendlich zu den kleineren und mittelgroßen Fischen. Der Vorgang erfasste die ganze trophische Kette. Dabei wurde der gleiche Schadstoff, der chemisch unzerstörbar ist, auf einen neuen ‚Gastgeber' übertragen, und zwar mit wachsender Konzentration, d.h. umgekehrt proportional im Verhältnis zur Größe des Jägers und der Masse der während seines Lebens aufgenommenen Nahrung. So hat man festgestellt, dass bei Fischen das Metall eine Konzentration von 50 mg/Kilo erreicht hatte, was einer 500.000-fachen Konzentration entspricht. Bei einigen Fischern mit dem „Minamata-Syndrom" wurden erhöhte Metallwerte in ihren Organen, insbesondere in ihren Haaren nachgewiesen, die mehr als ein halbes Gramm pro Kilo Körpergewicht betrugen.
Obgleich sich Anfang der 1960er Jahre die Wissenschaftler dessen bewusst waren, dass es bei giftigen Substanzen nicht ausreicht, Methoden der natürlichen Auflösung zu benutzen, da biologische Mechanismen in der Lage sind, das zu konzentrieren, was der Mensch verstreut, hat die chemische Industrie unseren Planeten weiterhin massiv verpestet - ohne dieses Mal den Vorwand auftischen zu können, von nichts gewusst zu haben. So ist es jüngst zu einem zweiten Minamata in Priolo (Sizilien) gekommen, wo auf einer Fläche von wenigen Quadratkilometern mindestens fünf Raffinerien, darunter Enichem, illegal Quecksilber aus einer Chlor- und Schwefelfabrik auf den Feldern entsorgten. Zwischen 1991 und 2001 sind ca. 1.000 Kinder mit großen geistigen Behinderungen und ernsthaften Missbildungen sowohl am Herzen als auch am Genitaltrakt geboren worden. Ganze Familien leiden unter Tumoren, und viele verzweifelte Frauen sahen sich zu Abtreibungen gezwungen, weil sie verkrüppelten Nachwuchs erwarteten. Dabei hatte der Vorfall von Minamata schon all die Risiken von Quecksilber für die menschliche Gesundheit aufgezeigt. Priolo ist also kein unvorhersehbares Ereignis, kein tragischer Fehler, sondern eine pure verbrecherische Tat, die vom italienischen Kapitalismus und noch dazu von seinem staatskapitalistischen Regime, das viele Leute als „links" vom „privaten Sektor" betrachten, verübt wurde. In Wirklichkeit hat man feststellen müssen, dass die Führung von Enichem sich schlimmer als die Ökomafia verhalten hat: Um Kosten bei der „Dekontaminierung" (man spricht von mehreren Millionen eingesparten Euros) zu sparen, wurden die mit Quecksilber verseuchten Abfälle mit anderem Schmutzwasser vermischt und im Meer entsorgt. Es wurden falsche Bescheinigungen ausgestellt, Tankwagen mit doppeltem Boden benutzt, um den Handel mit giftigen Substanzen zu verheimlichen - all das in Übereinstimmung mit den verantwortlichen Behörden. Als die Justiz sich schließlich rührte und die führenden Köpfe der Industrie verhaftete, war die Verantwortung dermaßen unleugbar, dass Enichem die Auszahlung eines Schmerzensgeldes von 11.000 Euro pro Familie beschloss, d.h. einen Betrag, den das Unternehmen auch im Falle einer rechtskräftigen Verurteilung durch das Gericht hätte bezahlen müssen.
Neben den Ursachen für Umweltverschmutzungen, die auf Unfälle zurückzuführen sind, produziert die ganze Gesellschaft aufgrund ihrer Funktionsweise ständig umweltgefährdende Stoffe, die sich in der Luft, im Wasser und am Boden sammeln - und wie schon erwähnt - in der Biosphäre, einschließlich des Menschen. Der massive Einsatz von Reinigungsmitteln und anderen Produkten dieser Art hat zum Phänomen der Eutrophierung (Nährstoffanreicherung) der Flüsse, Seen und Meere geführt. In den 1990er Jahren wurden 6.000 - 11.000 Tonnen Blei, 22.000 - 28.000 Tonnen Zink, 4200 Tonnen Chrom, 4.000 Tonnen Kupfer, 1450 Tonnen Nickel, 530 Tonnen Kadmium, 1,5 Millionen Tonnen Stickstoffe und ca. 100.000 Tonnen Phosphate in die Nordsee eingeleitet. Dieser Giftmüll ist besonders gefährlich für jene Meere, die flächenmäßig groß, aber nicht sehr tief sind, wie die Nordsee, die Ostsee, die südliche Adria, das Schwarze Meer. Weil in diesen Meeren nicht soviel Tiefenwasser vorhanden und die Vermischung zwischen Süßwasser aus den Flüssen und dichterem Salzwasser schwierig ist, können die Giftstoffe sich nicht zersetzen.
Synthetische Produkte wie das berühmt-berüchtigte Pflanzenschutzmittel DDT, das seit 30 Jahren in den Industriestaaten verboten ist, oder auch PCB (chlorierte Biphenyle), die einst in der elektrischen Industrie verwendet, aber mittlerweile wegen bekannt gewordener Gefahren ebenfalls verboten wurden, besitzen alle eine unbeschreibliche chemische Haltbarkeit. Sie sind in unveränderten Zustand überall vorhanden, im Wasser, in den Böden, in den Zellen der Lebewesen. Aufgrund der Bioakkumulation sind diese Stoffe in einigen Lebewesen in gefährlichen Konzentrationen zu finden, was zu deren Tod oder zu Störungen bei der Reproduktion führt und einen Rückgang der jeweiligen Populationen bewirkt. So richtet der Müllhandel, bei dem oft Giftmüll noch irgendwo ohne irgendwelche Schutzmaßnahmen zwischengelagert wird, unkalkulierbare Schäden im Ökosystem und für die ganze Bevölkerung an.
Bevor wir diesen Punkt hier abschließen - obwohl noch Hunderte von Beispielen aus der ganzen Welt geliefert werden könnten -, wollen wir noch daran erinnern, dass gerade diese Bodenverseuchung für ein neues und dramatisches Phänomen verantwortlich ist: die Entstehung von „Todeszonen" - wie zum Beispiel das Dreieck Priolo, Mellili und Augusta in Sizilien - wo der Prozentsatz von Neugeborenen mit Fehlbildungen viermal höher ist als im nationalen Durchschnitt, oder auch das andere Todesdreieck in der Nähe von Neapel zwischen Giuliano, Qualiano und Villaricca, wo die Zahl der Tumorerkrankungen weit über dem nationalen Durchschnitt liegt.
Die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen und/oder die Bedrohung durch die Umweltverschmutzung
Das letzte Beispiel des globalen Phänomens, das die Welt in eine Katastrophe führt, ist die Verknappung und Erschöpfung der natürlichen Ressourcen oder deren Bedrohung durch Umweltverschmutzung. Bevor wir näher auf dieses Phänomen eingehen, wollen wir darauf hinweisen, dass die Menschengattung schon früher - wenn auch in einem geringeren Maße - mit solchen Problemen zu tun hatte, Probleme, die schon damals katastrophale Konsequenzen hatten. Damals waren jedoch nur kleinere, beschränkte Regionen der Erde betroffen. Wir wollen aus dem Buch von Jared Diamond, „Kollaps" zitieren, das sich mit der Geschichte Rapa Nui's auf der Osterinsel befasst, die wegen ihrer großen Steinstatuen bekannt ist. Man weiß, dass die Insel vom holländischen Forscher Jacob Roggeveen Ostern 1772 entdeckt wurde (daher ihr Name), und es ist mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass die Insel „von einem dichten subtropischen Wald bedeckt war, der viele große Bäume aufwies". Auch gab es dort viele Vögel und wilde Tiere. Doch bei Ankunft der Kolonisatoren verbreitete die Insel einen anderen Eindruck:
„So war es auch für Rogeveen ein Rätsel, wie die Inselbewohner ihre Statuen aufgerichtet hatten. Um noch einmal aus seinem Tagebuch zu zitieren: ‚Die steinernen Bildsäulen sorgten zuerst dafür, dass wir starr vor Erstaunen waren, denn wir konnten nicht verstehen, wie es möglich war, dass diese Menschen, die weder über dicke Holzbalken zur Herstellung irgendwelcher Maschinen noch über kräftige Seile verfügten, dennoch solche Bildsäulen aufrichten konnten, welche volle neun Meter hoch und in ihren Abmessungen sehr dick waren (...). Ursprünglich, aus größerer Entfernung, hatten wir besagte Osterinsel für sandig gehalten, und zwar aus dem Grund, dass wir das verwelkte Gras, Heu und andere versengte und verbrannte Vegetation als Sand angesehen hatten, weil ihr verwüstetes Aussehen uns keinen anderen Eindruck vermitteln konnte als den einer einzigartigen Armut und Öde. Was war aus den vielen Bäumen geworden, die früher dort gestanden haben müssen? Um die Bearbeitung, den Transport und die Errichtung der Statuen zu organisieren, bedurfte es einer komplexen, vielköpfigen Gesellschaft, die von ihrer Umwelt leben konnte". (Diamond, S. 105) [12]‘ "
„Insgesamt ergibt sich für die Osterinsel ein Bild, das im gesamten Pazifikraum einen Extremfall der Waldzerstörung darstellt und in dieser Hinsicht auch in der ganzen Welt kaum seinesgleichen hat. Der Wald verschwand vollständig, und seine Baumarten starben ausnahmslos aus." (Diamond, S. 138)
„Dies alles lässt darauf schließen, dass die Abholzung der Wälder kurz nach dem Eintreffen der ersten Menschen begann, um 1400 ihren Höhepunkt erreichte und je nach Ort zwischen dem frühen 15. und dem 17. Jahrhundert praktisch abgeschlossen war. Für die Inselbewohner ergab sich daraus die unmittelbare Folge, dass Rohstoffe und wild wachsende Nahrungsmittel fehlten, und auch die Erträge der Nutzpflanzen gingen zurück (...) Da es auch keine seetüchtigen Kanus mehr gab, verschwanden die Knochen der Delphine, die in den ersten Jahrhunderten die wichtigsten Fleischlieferanten der Inselbewohner gewesen waren, um 1500 praktisch völlig aus den Abfallhaufen; und das Gleiche galt für Thunfische und andere Fischarten aus dem offenen Meer. (...) Weiter geschädigt wurde der Boden durch Austrocknung und Auswaschung von Nährstoffen, auch sie eine Folge der Waldzerstörung, die zu einem Rückgang des Pflanzenertrages führte. Darüber hinaus standen die Blätter, Früchte und Zweige wilder Pflanzen, die den Bauern zuvor als Kompost gedient hatten, nicht mehr zur Verfügung. (...) Im weiteren Verlauf kam es dann zu einer Hungersnot, einem Zusammenbruch der Bevölkerung und einem Niedergang bis hin zum Kannibalismus (...) In der mündlichen Überlieferung der Inselbewohner nimmt der Kannibalismus breiten Raum ein; die schrecklichste Beschimpfung, die man einem Feind entgegenschleudern konnte, lautete: „Das Fleisch deiner Mutter hängt zwischen meinen Zähnen." (S. 138)
„Wegen ihrer isolierten Lage ist die Osterinsel das eindeutigste Beispiel für eine Gesellschaft, die sich durch übermäßige Ausbeutung ihrer eigenen Ressourcen selbst zerstört hat (...) Die Parallelen zwischen der Osterinsel und der ganzen heutigen Welt liegen beängstigend klar auf der Hand. Durch Globalisierung, internationalen Handel, Flugverkehr und Internet teilen sich heute alle Staaten der Erde die Ressourcen, und alle beeinflussen einander genau wie die zwölf Sippen auf der Osterinsel. Die Osterinsel war im Pazifik ebenso isoliert wie die Erde im Weltraum. Wenn ihre Bewohner in Schwierigkeiten gerieten, konnten sie nirgendwohin flüchten, und sie konnten niemanden um Hilfe bitten; ebenso können wir modernen Erdbewohner nirgendwo Unterschlupf finden, wenn unsere Probleme zunehmen. Aus diesen Gründen erkennen viele Menschen im Zusammenbruch der Osterinsel eine Metapher, ein schlimmstmögliches Szenario für das, was uns selbst in Zukunft vielleicht noch bevorsteht." (S. 152) [13]
Diese Beobachtungen, die alle aus dem Buch von Diamond stammen, warnen uns davor zu glauben, dass das Ökosystem der Erde grenzenlos ist, und sie zeigen, dass das, was auf der Osterinsel passierte, auch die Menschheit insgesamt treffen kann, falls diese nicht entsprechend behutsam mit den Ressourcen des Planeten umgeht.
Man ist versucht, eine Parallele zum Abholzen der Wälder zu ziehen, das seit dem Anfang der Urhorde bis heute vor sich geht und heute so systematisch weiterbetrieben wird, dass auch die letzten grünen Lungen der Erde wie der Regenwald des Amazonas zerstört werden.
Wie schon erwähnt, kennt die herrschende Klasse sehr wohl die Risiken, wie die edle Intervention eines Wissenschaftlers des 19. Jahrhunderts, Rudolf Julius Emmanuel Clausius, belegt, der sich zur Frage der Energie und der Ressourcen schon lange vor all den Sonntagsreden zum Naturschutz sehr deutlich äußerte: „In der Wirtschaft einer Nation ist ein Gesetz immer gültig: Man darf während eines gewissen Zeitraums nicht mehr konsumieren als das, was in diesem Zeitraum produziert wurde. Deshalb dürfen wir nur soviel Brennstoffe verbrauchen, wie es möglich ist, diese dank des Wachstums der Bäume wiederherzustellen." [14]
Doch wenn man die heutigen Verhältnisse betrachtet, muss man schlussfolgern, dass genau das Gegenteil passiert, was Clausius empfohlen hatte. Man schlägt direkt den gleichen fatalen Weg ein wie die Osterinsulaner.
Um dem Problem der Ressourcen adäquat entgegenzutreten, muss man auch eine andere grundlegende Variable berücksichtigen: die Schwankungen der Weltbevölkerung.
„Bis 1600 war das Wachstum der Weltbevölkerung noch sehr langsam; sie nahm lediglich zwischen zwei bis drei Prozent pro Jahrhundert zu. 16 Jahrhunderte vergingen, bevor die Einwohnerzahl von ca. 250 Millionen Menschen zur Zeit des Beginns des christlichen Zeitalters auf 500 Millionen Menschen gestiegen war. Von diesem Zeitpunkt an nahm der Zeitraum bis zur nächsten Verdoppelung der Bevölkerung ständig ab, so dass in einigen Ländern der Welt heute die so genannte ‘biologische Grenze' des Bevölkerungswachstums erreicht wird (drei bis vier Prozent). UNO-Schätzungen zufolge werden im Jahr 2025 ca. acht Milliarden Menschen leben. (...) Es gibt große Unterschiede zwischen den entwickelten Ländern, die nahezu ein Nullwachstum erreicht haben, und den Entwicklungsländern, die bis zu 90 Prozent zum gegenwärtigen demographischen Wachstum beitragen. (...) Im Jahre 2025 wird zum Beispiel Nigeria UN-Schätzungen zufolge eine größere Bevölkerungszahl als die USA haben, und in Afrika werden dreimal so viel Menschen leben wie in Europa. Überbevölkerung, verbunden mit Rückständigkeit, Analphabetentum und ein Mangel an Hygiene und Gesundheitseinrichtungen stellen sicher ein großes Problem dar, das nicht nur Afrika bedroht, sondern die ganze Welt beeinflussen wird. Insofern scheint es ein großes Ungleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot an verfügbaren Ressourcen zu geben, das auch auf die Verwendung von ca. 80 Prozent der Energieressourcen der Welt durch die Industriestaaten zurückzuführen ist.
Die Überbevölkerung bringt einen starken Rückgang der Qualität der Lebensbedingungen mit sich, weil sie die Produktivität eines Arbeiters senkt und auch die Verfügbarkeit von Lebensmitteln, Trinkwasser, Gesundheitsleistungen und Medikamenten pro Kopf einschränkt. Der starke, von Menschen gegenwärtig verursachte Druck führt zu einer Schädigung der Umwelt, die sich unvermeidbar auf die Gleichgewichte des Systems Erde auswirken wird.
Die Ungleichgewichte haben sich in den letzten Jahren verstärkt: Die Bevölkerung wächst nicht nur in einem Maße, das keineswegs homogen ist, sondern sie nimmt vor allem in den städtischen Ballungsräumen sehr stark zu." [15]
Das starke Bevölkerungswachstum verschärft das Problem der Erschöpfung der Ressourcen also noch mehr, zumal der Mangel an natürlichen Ressourcen vor allem da anzutreffen ist, wo die Bevölkerungsexplosion am stärksten ist, was für die Zukunft noch größere Probleme erahnen lässt, von denen immer mehr Menschen betroffen sein werden.
Untersuchen wir die erste Quelle der Natur, Wasser, ein auf der ganzen Welt notwendiges Gut, das heute durch das unverantwortliche Vorgehen des Kapitalismus stark bedroht ist.
Wasser ist ein Gut, das auf der Erdoberfläche in großen Mengen vorhanden ist (die Ozeane, Grundwasser und die Polkappen), aber nur ein kleiner Teil davon ist als Trinkwasser nutzbar, d.h. jener Teil, der in den Polkappen und in den wenigen noch nicht vergifteten Flüssen zur Verfügung steht. Die Entwicklung der industriellen Aktivitäten, die die Bedürfnisse der Umwelt völlig außer Acht lässt, und die völlig willkürliche Ablagerung und Entsorgung des städtischen Mülls haben einen Großteil des Grundwassers verseucht, das die natürliche Trinkwasserreserve des Gemeinwesens ist. Dies hat mit zur Verbreitung von Krebs und anderen Krankheiten in der Bevölkerung beigetragen; andererseits ist das Wasser zu einem knappen und kostbaren Gut in vielen Ländern geworden.
„Mitte des 21. Jahrhunderts werden den pessimistischen Prognosen zufolge ca. sieben Milliarden Menschen in 60 Ländern nicht mehr über ausreichend Wasser verfügen. Im besten Fall würden „nur" zwei Milliarden Menschen in 48 Ländern an Wassermangel leiden (...) Aber die besorgniserregendsten Angaben in dem Dokument der UNO ist die aufgrund der Wasserschmutzung und der schlechten Hygienebedingungen prognostizierte Zahl der Todesopfer: 2,2 Millionen pro Jahr. Darüber hinaus ist Wasser Träger zahlreicher Krankheiten, unter ihnen Malaria, wodurch jedes Jahr ca. eine Million Menschen sterben" [16]. (Das blaue Gold des dritten Jahrtausends)
Die englische Wissenschaftszeitung New Scientist schrieb in ihrer Schlussfolgerung anlässlich des Wassersymposiums im Sommer 2004 in Stockholm: „In der Vergangenheit wurden mehrere Millionen Brunnen errichtet, meistens ohne irgendwelche Kontrolle, und die Wassermengen, die durch gigantische elektrische Wasserpumpen gefördert werden, übersteigen bei weitem den Umfang der Regenwassermengen, die das Grundwasser wieder mit neuem Wasser versorgen (...) Wasser dem Erdreich zu entnehmen, ermöglicht vielen Ländern reichhaltige Reis- und Zuckerrohrernten (diese Pflanzen benötigen viel Wasser), doch lange wird der Boom nicht dauern. (...) Indien ist ein Zentrum der Revolution des Bohrens nach unterirdischem Wasser. Mithilfe von Technologien aus der Ölindustrie haben die kleinen Bauern 21 Millionen kleine Brunnen auf ihren Feldern errichtet, und jedes Jahr kommen noch mal eine Million Brunnen hinzu. (...) In den nördlichen Ebenen Chinas, wo die meisten landwirtschaftlichen Produkte geerntet werden, entnehmen die Bauern der Erde jedes Jahr 30 Kubikkilometer Wasser mehr, als durch den Regen zugeführt wird (...). In Vietnam wurde in den letzten Jahren die Zahl der Brunnen vervierfacht (...) In Punjab, wo 90 Prozent der Lebensmittel Pakistans herstammen, fangen die Grundwasserreserven langsam an auszutrocknen" [17].
Während die Lage allgemein schon schlimm genug ist, ist die Situation in den Schwellenländern Indien und China geradezu katastrophal.
„Die Dürre in der Provinz Sechuan und in Chongqing hat ca. 9,9 Milliarden Yuan Schäden verursacht. Einschränkungen beim Wasserverbrauch für mehr als zehn Millionen Menschen wurden veranlasst, während im ganzen Land ca. 18 Millionen Menschen an Wasserknappheit leiden." [18]
„China wurde von den schlimmsten Überschwemmungen in den letzten Jahren heimgesucht, mit mehr als 60 Millionen betroffenen Menschen in Zentral- und Südchina, mindestens 360 Toten und großen ökonomischen Schäden, die schon 7,4 Milliarden Yuan übersteigen. 200.000 Häuser sind zerstört oder beschädigt, 528.000 Hektar landwirtschaftlich bebaute Fläche sind zerstört und 1,8 Million überflutet. Gleichzeitig schreitet die Verwüstung schnell voran. Bislang wurde ein Fünftel des Territoriums in Mitleidenschaft gezogen. Dies hat Sandstürme hervorgerufen, von denen manche gar bis Japan ziehen (...) Während Zentral- und Südchina unter Überschwemmungen leidet, dehnt sich die Wüste im Norden weiter aus. Mittlerweile ist davon mehr als ein Fünftel des Gebietes entlang des Gelben Flusses, der Hochebene Qinghai-Tibets und eines Teils der Inneren Mongolei und Gansus betroffen. Die Bevölkerung Chinas umfasst ca. 20 Prozent der Weltbevölkerung, aber sie verfügt nur über sieben Prozent der verfügbaren landwirtschaftlichen Anbaufläche.
Wang Tao, Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Lanzhu, zufolge hat die Desertifikation in China während des letzten Jahrzehnts jedes Jahr um 950 Quadratkilometer zugenommen. Alljährlich im Frühjahr wird Peking und ganz Nordchina von Sandstürmen heimgesucht, mit Auswirkungen bis nach Südkorea und in Japan" [19].
All das muss uns zum Nachdenken über die so viel gepriesene starke Leistungsfähigkeit des chinesischen Kapitalismus veranlassen. Die jüngste Entwicklung der chinesischen Wirtschaft kann dem niedergehenden Weltkapitalismus kein neues Leben einhauchen; stattdessen zeigt sie den ganzen Schrecken der Agonie dieses Systems auf: Städte im Smog (auch die jüngst stattgefundenen Olympischen Sommerspiele können nicht darüber hinwegtäuschen), austrocknende Flüsse und jedes Jahr Zehntausende Arbeiter, die bei Arbeitsunfällen in den Bergwerken oder anderswo aufgrund der furchtbaren Arbeitsbedingungen und der mangelnden Sicherheitsbestimmungen sterben.
Natürlich werden auch viele andere Ressourcen immer knapper. Aus Platzgründen können wir hier nur kurz auf zwei eingehen.
Die erste Ressource ist natürlich das Erdöl. Bekanntlich spricht man seit dem Ende der 1970er Jahre von der Erschöpfung der natürlichen Ölquellen, doch in diesem Jahr, 2008, scheint man tatsächlich den Gipfelpunkt der Förderung (er wird Hubbert-Gipfel genannt) erreicht zu haben, d.h. jenen Punkt, an dem verschiedenen geologischen Hochrechnungen zufolge die Hälfte der natürlichen Ressourcen bereits erschöpft ist. Öl stellt heute ca. 40 Prozent der Basisenergie dar und ungefähr 90 Prozent der im Verkehr eingesetzten Energie. Auch in der chemischen Industrie ist es ein wichtiger Grundstoff, insbesondere bei der Herstellung von Düngemitteln in der Landwirtschaft, Kunststoffen, Klebstoffen und Lacken, Schmier- und Reinigungsmitteln. All das ist möglich, weil das Öl bislang ein relativ billiger Stoff und scheinbar grenzenlos verfügbar war. Allein dass diese Perspektiven sich nun geändert haben, trägt schon jetzt zu Preiserhöhungen bei. Die kapitalistische Welt hört auch heute nicht auf die Empfehlung Clausius, innerhalb einer Generation nicht mehr zu verbrauchen, als die Natur in dieser Zeit liefern kann. Stattdessen hat sich die kapitalistische Welt in eine verrückte Jagd nach Energie gestürzt. Dabei sind China und Indien an die führende Stelle getreten, was den Energiekonsum betrifft. Sie verbrennen alles, was man verbrennen kann, greifen sogar auf giftige fossile Kohlenstoffe zur Energiegewinnung zurück und haben damit bislang nie da gewesene Umweltprobleme geschaffen.
Natürlich hat sich der wundersame Ausweg mittels der sog. Biokraftstoffe als Flop, weil völlig unzureichend, erwiesen. Die Herstellung von Brennstoff auf der Grundlage der alkoholischen Gärung von Maisstärke oder von Pflanzenölen reicht keineswegs aus, um die gegenwärtigen Bedürfnisse des Marktes nach Brennstoffen zu befriedigen. Im Gegenteil, auf diese Weise werden die Preise für Nahrungsmittel nur weiter in die Höhe getrieben, wodurch der Hunger unter den ärmsten Bevölkerungsteilen zunimmt. Auch hier werden kapitalistische Unternehmen wie die Nahrungsmittelhersteller begünstigt, die zu Verkäufern von Biokraftstoffen geworden sind. Aber für die einfachen Sterblichen bedeutet dies, dass große Waldgebiete abgeholzt werden, um dort Plantagen zu errichten (Millionen Hektar Wald sind geopfert worden). Die Herstellung von Biodiesel verlangt in der Tat den Einsatz von großen Flächen. Um sich eine konkretere Vorstellung davon zu machen: ein Hektar Raps, Sonnenblumen oder andere Ölpflanzen entspricht etwa 1.000 Liter Biodiesel, womit ein PKW ca. 10.000 Kilometer zurücklegen kann. Wenn man davon ausgeht, dass ein PKW durchschnittlich im Jahr ca. 10.000 Kilometer zurücklegen, verbraucht jedes Fahrzeug also Biodiesel in Höhe eines Hektars Anbaufläche. Für ein Land wie Italien, wo ca. 34 Millionen PKW angemeldet sind, würde dies bedeuten, dass man eine Anbaufläche von ca. 34 Millionen Hektar benötigen würde. Wenn man den PKW noch die ca. vier Millionen LKW hinzufügt, deren Verbrauch noch höher liegt, würde sich der Verbrauch verdoppeln, und es würde eine Anbaufläche von mindestens 70 Millionen Hektar erforderlich machen. Dies entspricht dem Doppelten der Fläche Italiens, Berge, Städte usw. eingeschlossen.
Obgleich davon kaum die Rede ist, stellt sich ein ähnliches Problem wie bei den fossilen Brennstoffen natürlich auch bei anderen Ressourcen mineralischer Art, wie beispielsweise bei den Mineralien, aus denen Metall gewonnen wird. Es trifft sicherlich zu, dass Metall nicht durch seine eigentliche Verwendung zerstört wird wie im Fall des Öls oder des Methangases, aber die Nachlässigkeit der kapitalistischen Produktion läuft darauf hinaus, dass große Mengen Metall auf Müllhalden und anderswo verrotten, so dass die Versorgung mit Metall früher oder später auch nicht mehr ausreichen wird. Die Verwendung bestimmter vielschichtiger Legierungen lässt den eventuellen Versuch der Rückgewinnung eines „reinen" Materials als schwierig erscheinen.
Das Ausmaß des Problems wurde anhand von Schätzungen deutlich, denen zufolge innerhalb weniger Jahrzehnte folgende Rohstoffe erschöpft sein werden: Uran, Platin, Gold, Silber, Kobalt, Blei, Mangan, Quecksilber, Molybdän, Nickel, Zinn, Wolfram und Zink. Dies sind für die moderne Industrie praktisch unabdingbare Stoffe, und ihr Mangel bzw. ihre Erschöpfung wird eine sehr schwere Last in der Zukunft darstellen. Aber auch andere Stoffe sind nicht unerschöpflich. Man hat errechnet, dass noch ca. 30 Milliarden Tonnen Eisen, 220 Millionen Tonnen Kupfer, 85 Millionen Tonnen Zink zur Verfügung stehen (in dem Sinne, dass es noch wirtschaftlich möglich sein wird, sie zu fördern). Um sich auszumalen, um welche Mengen es sich handelt, muss man wissen, dass, um die ärmsten Länder auf das Niveau der reichsten Länder zu bringen, man 30 Milliarden Tonnen Eisen, 500 Millionen Tonnen Kupfer, 300 Millionen Tonnen Zink benötigt, d.h. viel mehr, als der ganze Planet Erde anzubieten hat.
In Anbetracht dieser angekündigten Katastrophe muss man sich fragen, ob Fortschritt und Entwicklung notwendigerweise mit Umweltverschmutzung und Zerstörung des Ökosystems verbunden sein müssen. Man muss sich fragen, ob solche Desaster auf die unzureichende Bildung der Menschen oder auf etwas Anderes zurückzuführen sind. Das werden wir im nächsten Artikel untersuchen.
Ezechiele, August 2008
[1] G. Barone et al., Il metano e il futuro del clima, in Biologi Italiani, n° 8 de 2005. („Methan und die Zukunft des Klimas").
[2] Ebenda.
[3] G. Pellegri, Terzo mondo, nuova pattumiera creata dal buonismo tecnologico, siehe http:/www.caritas-ticino.ch/rivista/elenco%20rivista/riv_0203/08%20-%20Terzo%m... [10]
[4] Vivere di rifiuti, (Von Abfällen leben) http:/www.scuolevi-net:scuolevi/valdagno [11] /marzotto/mediateca.nsf/9bc8ecfl790d17ffc1256f6f0065149d/7f0bceed3ddef3b4c12574620055b62d/Body/M2/Vivere%20di%rifiuti.pdf ?OpenElement
[5] Roberto Saviano, Gomorra, Viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della camorra, (Reise in das Reich der Wirtschaft und in die Träume der Herrschaft der Camorra), Arnoldo Montaldi, 2006.
[6] La Republica on-line, 29/10/2007
[7] La Republica, 6/02/2008. Allein in den USA werden mehr als 100 Milliarden Plastiktüten verwendet. 1.9 Milliarden Tonnen Öl sind für deren Herstellung erforderlich, wobei die meisten von ihnen auf dem Müll landen und Jahrzehnte bis zu ihrer Zersetzung brauchen. Für die Herstellung mehrerer Dutzend Milliarden Plastiktüten müssen allein 15 Millionen Bäume gefällt werden.
[8] Siehe den Artikel „Das Mittelmeer, ein Plastikmeer" in La Republica du 19 Juli 2007.
[9] Man kann natürlich nicht ausschließen, dass der schwindelerregende Preisanstieg des Öls zwischen 2007-2008 die Verwendung dieses Rohstoffs für die Produktion von Kunststoffen infragestellt, wodurch es in absehbarer Zukunft zu einer Kehrtwende unter wachsamen Unternehmern kommen könnte, die aber nur auf die Verteidigung ihrer Interessen achten.
[10] R. Troisi : la discarica del mondo luogo di miseria e di speranza nel ventunesimo secolo. (Die Müllentsorgung der Erde - Misere und Hoffnung des 21. Jahrhunderts) - https://villadelchancho.splinder.com/tag/discariche+del+mondo [12]
[11] Siehe den Artikel: „Einige Kollateralschäden der Industrie - Chemie, und Atomkraft" Alcuni effetti collaterali dell'industria, La chimica, la diga e il nucleare.
[12] Jared Diamond, Collasso, edizione Einaudi.
[13] ebenda.
[14] R. J. E Clausius (1885), geboren 1822 in Koslin (damals Preußen, heute Polen) und 1888 gestorben in Bonn.
[15]
Vereinigung Geographielehrer Italiens - „Das Bevölkerungswachstum", La crescita
della popolazione.
https://www.aiig.it/UnProzent20quadernoProzent20perProzentl'ambiente/off... [13]
[16] G. Carchella, Acqua : l'oro blu del terzo millenario, su „Lettera 22, associazione indipendente di giornalisti". https://www.lettera22.it/showart.php?id=296&rubrica=9 [14] Wasser - Das blaue Gold des 21. Jahrhunderts in Brief 22, Unabhängige Vereinigung der Journalisten
[17] Asian Farmers sucking the continent dry, Newscientist, https://www.newscientist.com/article/dn6321-asian [15] farmers-sucking the continent-dry.html Asiatische Bauern trocknen den Kontinent aus, 28. August 2004
[18]
PB, Asianews, China: Noch 10 Millionen Menschen dursten nach Trockenheit
https://www.asianews.it/index.php?l=it&art=6977 [16]
[19] Asianews, China - eingeklemmt zwischen Überschwemmungen und dem Vormarsch der Wüsten https://www.asiannews.it/index.php?l=it&art=9807 [17]
, Asianews, La Cina stretta tra le inondazioni e il deserto che avanza, 18/08/2006
Aktuelles und Laufendes:
- Umweltkatastrophe [18]
- Treibhauseffekt [19]
- Müllprobleme [20]
- Abfallentsorgung [21]
- Abfallprobleme [22]
Theoretische Fragen:
- Umwelt [23]
Die schlimmste Wirtschaftskrise der Geschichte des Kapitalismus
- 7404 reads
Die herrschende Klasse ist in Angst und Schrecken versetzt worden. Von August bis Oktober gab es eine richtige Panik in der Weltwirtschaft. Die Aufsehen erregenden Erklärungen von Politikern und Ökonomen verdeutlichen dies: „Die Welt am Rand des Abgrunds". „Ein ökonomisches Pearl Harbour", ein „auf uns zurollender Tsunami", „ein 11. September der Finanzen".[1] Nur der Anspielung auf die Titanic fehlte noch. Die herrschende Klasse ist in Angst und Schrecken versetzt worden. Von August bis Oktober gab es eine richtige Panik in der Weltwirtschaft. Die Aufsehen erregenden Erklärungen von Politikern und Ökonomen verdeutlichen dies: „Die Welt am Rand des Abgrunds". „Ein ökonomisches Pearl Harbour", ein „auf uns zurollender Tsunami", „ein 11. September der Finanzen".[1] Nur die Anspielung auf die Titanic fehlte noch.
Es stimmt, die größten Banken der Welt gerieten eine nach der anderen in Konkurs, die Börse stürzte in den Keller. Seit Januar 2008 wurden 32.000 Milliarden Dollar verbraten, d.h. soviel wie zwei Jahre Gesamtproduktion der USA. Die Börse Islands fiel um 94%, die Moskaus um 71%.
Schließlich ist es den Herrschenden gelungen, mit Hilfe eines „Rettungsplans" und eines „Ankurbelungsplans" nach dem anderen die totale Erstarrung der Wirtschaft zu vermeiden. Heißt dies aber, das Schlimmste sei jetzt hinter uns? Sicher nicht! Die Rezession, die gerade erst angefangen hat, wird wohl die zerstörerischste sein seit der Großen Depression von 1929.
Die Ökonomen gestehen es offen sein: „die gegenwärtige Konjunktur ist seit Jahrzehnten nicht mehr so angeschlagen", meldet die HSBC, „die größte Bank der Welt" am 4. August 2008.[2] « Wir befinden uns in einem ökonomischen und politisch-monetären Umfeld, das noch nie so schwierig war », legte der Präsident der US-FED am 22.8. noch einen drauf.[3]
Die internationale Presse täuschte sich nicht, als sie die gegenwärtige Zeit mit der Wirtschaftskrise der 1930er Jahre verglich, wie z.B. das Titelblatt von Time ankündigte: „The New Hard Times" (neue harte Zeiten) mit einem Photo von Arbeitern, die 1929 für eine kostenlose Suppe in einer Armenküche anstanden. Tatsächlich sieht man solche Bilder heute immer mehr. Die Wohltätigkeitsorganisationen, die Essen verteilen, sind völlig überfordert, während gleichzeitig die Warteschlagen Hunderttausender neuer Arbeitsloser vor den Arbeitsämtern jeden Tag länger werden.
Am 24. September verkündete der damalige US-Präsident George W. Bush noch : „Wir stecken mitten in einer schweren Finanzkrise (...) Unsere ganze Wirtschaft ist in Gefahr. (...) Schlüsselbereiche des Finanzsystems stehen vor der Gefahr des Zusammenbruchs. (...) Amerika könnte einer Finanzpanik verfallen, und das würde uns in ein eine furchtbare Lage treiben. Weitere Banken würden Pleite machen (...) Die Börse würde noch mehr zusammenbrechen, wodurch Ihre Anlagen noch mehr schrumpfen würden. Der Wert Ihrer Häuser würde sinken, noch mehr Zwangsversteigerungen. (...) Zahlreiche Betriebe müssten schließen, und Millionen Amerikaner würden ihre Stelle verlieren. (...) Schlussendlich würde unser Land in einer langen und schmerzhaften Rezession versinken."
Nun wird die „lange und schmerzhafte Rezession" Wirklichkeit; nicht nur « das amerikanische Volk », sondern die Arbeiter auf der ganzen Welt sind nun betroffen.
Eine brutale Rezession...
Seit der nunmehr berühmt gewordenen 'subprime' Krise vom Sommer 2007 hört man jeden Tag mehr schlechte Nachrichten aus der Wirtschaft.
Allein das ‚Blutbad' im Bankensektor im Jahre 2008 war beeindruckend. Entweder wurden durch einen Konkurrenten aufgekauft oder durch eine Zentralbank gestützt oder einfach verstaatlicht: Northern Rock (die achtgrößte englische Bank), Bear Stearns (die fünfte Bank an der Wall Street), Freddie Mac und Fannie Mae (zwei Finanzinstitute zur Finanzierung von US-Hypotheken mit einem Geschäftsvolumen von ca. 850 Milliarden Dollar), Merrill Lynch (eine einstige weitere US-Großbank), HBOS (zweitgrößte Bank Schottlands), AIG (American International Group, einer der größten Versicherer der Welt) und Dexia (Finanzinstitut aus Luxemburg, Belgien und Frankreich). Des Weiteren kam es auch zu historischen und Aufsehen erregenden Pleiten. Im Juni wurde Indymac, einer der größten US-Hypothekenfinanzierer unter US-Staatsaufsicht gestellt. Dies war der größte Bankrott im US-Bankenwesen seit 24 Jahren. Aber dieser Rekord hielt nicht lange. Nur wenige Tage später musste die viertgrößte US-Bank, Lehman Brothers, Bankrott anmelden. Die Gesamtsumme ihrer Schulden betrug 613 Milliarden Dollar. Ein weiterer Rekord gebrochen. Bei dem größten Bankenbankrott bis zum damaligen Zeitpunkt war 1984 die Continental Illinois mit 40 Milliarden Dollar Pleite gegangen (d.h. eine 16 mal geringere Summe). Aber nur zwei Wochen später ein neuer Rekord. Die Washington Mutual (WaMu), die größte Sparkasse der USA, meldete ihrerseits Insolvenz an.
Nach dieser Art Infarkt des Herzens des kapitalistischen Systems, dem Bankenwesen, ist jetzt der gesamte Körper in Mitleidenschaft gezogen und geht danieder. „Die reale Wirtschaft" wird nun brutal erfasst. Dem NBER (National Bureau of Economic Research) stecken die USA seit Dezember 2007 offiziell in einer Rezession. Der am meisten anerkannte Ökonom an der Wall Street, Nouriel Roubini, geht gar davon aus, dass eine Schrumpfung der US-Wirtschaft um 5% im Jahre 2009 und erneut um 5% in 2010 wahrscheinlich sei![4] Wir können nicht wissen, ob dies tatsächlich der Fall sein wird, aber die Tatsache, dass einer der berühmtesten Ökonomen der Welt solch ein katastrophales Szenario ins Auge fassen kann, zeigt die wirkliche Besorgnis der Herrschenden. Die OECD erwartet eine Rezession für die gesamte Europäische Union in 2009. Die Deutsche Bank erwartet für Deutschland ein Schrumpfen des BIP um bis zu 4%![5] Um sich ein Bild davon zu machen, wie weitreichend solch eine Rezession sein könnte, muss man wissen, dass das schlimmste Jahr seit dem 2. Weltkrieg bislang 1975 war, als das deutsche BIP „nur" um 0.9% geschrumpft war. Kein Kontinent bleibt ausgespart. Japan steckt schon in der Rezession, und selbst in China, diesem ‚kapitalistischen Wunderland', verlangsamt sich das Wachstum brutal. Die Folge: Die Nachfrage ist dermaßen zusammengebrochen, dass alle Preise, auch die Ölpreise, sinken. Kurzum - der Weltwirtschaft geht es sehr schlecht.
... und eine seit den 1930er Jahren nicht mehr da gewesene Verarmung
Das erste Opfer dieser Krise ist natürlich die Arbeiterklasse. In den USA ist die Verschlechterung der Lebensbedingungen besonders spektakulär. Seit dem Sommer 2007 sind ca. 2.8 Mio. Arbeiter auf der Straße gelandet, weil sie nicht mehr ihre Schulden zurückzahlen können. Dem Verband der Hypothekenbanken MBA zufolge ist heute jeder Zehnte Schuldner in den USA von Zwangsräumung bedroht. Und dieser Trend erfasst nunmehr auch Europa, insbesondere Spanien und Großbritannien.
Auch die Massenentlassungen nehmen zu. In Japan hat Sony einen Plan bislang nie da gewesenen Ausmaßes verkündet: 16.000 Stellen sollen gestrichen werden, darunter 8.000 Beschäftigte der Stammbelegschaft. Dieser japanische Standartenträger hatte zuvor nie Beschäftigten der Stammbelegschaft gekündigt. In Anbetracht der Immobilienkrise leidet die Bauwirtschaft schwer. In Spanien wird bis 2010 mit einer Zunahme der Zahl der Arbeitslosen um 900.000 gerechnet. In den Banken brechen die Arbeitsplätze reihenweise weg. Citigroup, eine der größten Banken der Welt, wird ca. 50.000 Stellen streichen, nachdem die Gruppe seit Anfang 2008 schon 23.000 Stellen gestrichen hatte. 2008 sind alleine 260.000 Jobs im Bankensektor in den USA und in Großbritannien weggefallen. Dabei sollen an einer Stelle im Bankenwesen im Durchschnitt vier weitere Stellen hängen. Der Zusammenbruch der Finanzinstitutionen wird somit Arbeitslosigkeit für Hunderttausende Arbeiterfamilien mit sich bringen. Auch der Automobilsektor ist besonders hart getroffen. Um mehr als 30% sind die Autoverkäufe seit dem letzten Herbst zurückgegangen. Seit Mitte November hat z.B. Renault, der größte Autohersteller Frankreichs, seine Automobilproduktion eingestellt. Kein Auto ist mehr vom Band gelaufen; dabei betrug die Kapazitätsauslastung seit Monaten nur ca. 54%. Toyota wird ca. 3.000 Zeitarbeiter von 6.000 (d.h. 50%) in seinen japanischen Werken entlassen. Aber erneut kommen die besorgniserregendsten Zahlen aus den USA: die berühmten großen Drei aus Detroit (General Motors, Ford und Chrysler) stehen am Rande des Bankrotts. Das erste Rettungspaket des US-Staates von 15 Mrd. Dollar wird ihnen nicht dauerhaft weiterhelfen [6] (die Big Three forderten übrigens mindestens 34 Mrd. Dollar). In den nächsten Monaten ist mit großen Umstrukturierungen zu rechnen. Zwischen 2.3 und 3 Millionen Jobs stehen auf der Abschussliste. Und damit werden die entlassenen Arbeiter nicht nur ihre Arbeit verlieren, sondern auch ihre Krankenversicherung und ihre Rente!
Die unvermeidbare Konsequenz dieses massiven Arbeitsplatzverlustes ist natürlich die explosive Zunahme der Arbeitslosigkeit. In Irland, dem „Wirtschaftsmodell des letzten Jahrzehnts" hat sich die Zahl der Arbeitslosen innerhalb eines Jahres verdoppelt; dies ist der stärkste je registrierte Anstieg. In Spanien gab es Ende 2008 mehr als 3.13 Mio. Arbeitslose, d.h. ca. eine Million mehr als 2007.[7] In den USA wurden 2008 2.6 Mio. Stellen gestrichen - ein Rekord seit 1945.[8] Das Jahresende war besonders verheerend, da allein im November und Dezember mehr als 1.1 Millionen Beschäftigte ihre Stelle verloren. Wenn die Dinge so weitergehen, könnte es noch mehr als 3-4 Millionen zusätzliche Arbeitslose bis zum Sommeranfang 2009 geben.
Und diejenigen, die noch ihren Job behalten haben, werden damit konfrontiert, „viel mehr arbeiten zu müssen, um viel weniger zu verdienen".[9] So berichtete der letzte Bericht des Bureau international du Travail (BIT) in seinem « Bericht über die Löhne auf der Welt 2008/09", „Auf die 1.5 Milliarden Beschäftigten auf der Welt kommen schwierige Zeiten zu", „die Weltwirtschaftskrise wird zu schwerwiegenden und schmerzhaften Lohneinbußen führen".
Natürlich wird es infolge all dieser Angriffe zu einer enormen Zunahme der Verarmung kommen. Von Europa bis zu den USA haben alle karitativen Organisationen in den letzten Monaten mindestens 10% mehr Empfänger von Armensuppen registriert. Diese Welle von Verarmung bedeutet, dass es immer schwieriger sein wird, eine Wohnung zu finden, medizinische Versorgung zu erhalten und sich zu ernähren. Und für die Jugend von heute heißt dies auch, dass der Kapitalismus ihnen keine Zukunft mehr anzubieten hat.
Wie die Bourgeoisie diese Krise erklärt
Die wirtschaftlichen Mechanismen, welche die gegenwärtige Rezession hervorgerufen haben, sind mittlerweile gut bekannt. In Fernsehsendungen wurde immer wieder über die so genannten Hintergründe der Entwicklung berichtet. Vereinfacht gesagt, wurden die Ausgaben der „amerikanischen Haushalte" (m.a. W. die Arbeiterfamilien) künstlich durch alle möglichen Kreditformen aufrechterhalten, insbesondere durch einen Kredit mit tollem Erfolg: risikobehaftete oder „subprime" Immobilienkredite. Die Banken, Finanzinstitute, Pensionsfonds ... sie alle bewilligten Kredite ohne auf die wirkliche Zahlungsfähigkeit dieser Beschäftigten zu achten (daher ‚risikobehaftet'), da man ihnen unbedingt eine Immobilie verkaufen wollte. Im schlimmsten Fall, meinten sie, würden sie entschädigt durch den Verkauf der Häuser, welche die Schuldner ihnen bei Zahlungsunfähigkeit als Pfand hinterlassen müssten. Dies sorgte für einen Schneeballeffekt: Je mehr die Beschäftigten Schulden machten, insbesondere zum Erwerb einer Immobilie, umso mehr stieg der Wert einer Immobilie. Je teurer eine Immobilie wurde, desto mehr konnten die Beschäftigten sich verschulden. Alle Spekulanten auf der Erde haben sich an diesem Treiben beteiligt: Auch sie haben Immobilien erworben, um sie wieder teurer zu verkaufen; und vor allem haben sie sich gegenseitig diese berühmten subprimes mittels Finanztiteln verkauft (d.h. die Umwandlung von Schuldscheinen in Immobilienwerte, die auf dem Weltmarkt wie jede andere Aktie oder Obligation veräußert werden konnte). Innerhalb eines Jahrzehnts ist die Spekulationsblase enorm angewachsen. Alle Finanzinstitute der Welt haben sich an diesen Transaktionen in Milliardenumfang beteiligt. Mit anderen Worten, Haushalte, von denen man wusste, dass sie nicht zahlungsfähig waren, wurde zu Hühnern, die für die Weltwirtschaft goldene Eier legten.
Natürlich hat die ‘wirkliche Wirtschaft' diese Traumwelt auf den harten Boden der Realität zurückgeholt. Im ‚wahren Leben' mussten all diese hoch verschuldeten Beschäftigten auch die Folgen der Preisseigerungen und der Lohnstops, der Entlassungen, der Kürzungen der Arbeitslosengelder usw. erleben. Kurzum, auf der einen Seite kam es zu einer beträchtlichen Verarmung, auf der anderen Seite konnten immer weniger ihre Schulden begleichen. Die Kapitalisten haben daraufhin die zahlungsunfähigen Immobilienbesitzer vor die Tür gesetzt, aber die Zahl der so auf die Verkaufsliste gesetzten Häuser war so groß,[10] dass die Preise purzelten und ...bums... schmolz im Sommer 2007 der größte Schneeball der Welt schnell dahin. Die Banken standen vor Hunderttausenden zahlungsunfähiger Schuldner; der Wertverfall der Häuser war ungeheuerlich. Es kam zum Krach.
All das mag absurd erscheinen. Leuten Geld zu leihen, die nicht dazu in der Lage sind, zurückzuzahlen, richtet sich eigentlich gegen den kapitalistischen ‚Menschenverstand'. Und dennoch hat sich der größte Anteil des Wachstums der Weltwirtschaft während des letzten Jahrzehnts auf solch einen Schwindel gestützt. Die Frage steht im Raum, warum dies geschah? Warum solch ein Wahnsinn? Die Antwort der Journalisten, Politiker, Ökonomen ist einfach und einstimmig: „Die Spekulanten sind schuld". „Die Habsucht der Abzocker", die „unverantwortlichen Banker". Heute stimmen alle in den Chor der traditionellen Beschuldigung der Linken und der extremen Linken hinsichtlich der Auswirkungen der „Deregulierung" und des „Neoliberalismus" (eine Art grenzenloser Liberalismus), und rufen zu einer Rückkehr des Staates auf, was übrigens das wahre Wesen der „antikapitalistischen" Forderungen der Linken und extremen Linken offenbart. So forderte der französische Präsident Sarkozy „der Kapitalismus muss auf ethischen Grundlagen neu gegründet werden". Frau Merkel beschimpfte Spekulanten. Der spanische Premier Zapatero wiederum klagte die „Fundamentalisten des Marktes" an. Und Chavez, der illustre Paladin des « Sozialismus des 21. Jahrhunderts » kommentierte die in Windeseile beschlossenen Verstaatlichungen durch die Bush-Regierung: „Genosse Bush ist dabei, einige Maßnahmen zu ergreifen, die für den Genossen Lenin typisch waren".[11] Alle versichern uns, unsere Hoffnung müsse sich auf einen « anderen Kapitalismus » richten, welcher menschlicher, moralischer sein müsse und ... mehr Staat bedeute. All das sind Lügen! All das, was diese Politiker sagen, ist falsch; angefangen mit ihrer angeblichen Erklärung der Rezession.
Die gegenwärtige wirtschaftliche Katastrophe ist die Folge von 100 Jahren Dekadenz
In Wirklichkeit hat der Staat selbst als allererster diese generalisierte Verschuldung der Haushalte organisiert. Um die Wirtschaftlich künstlich zu stützen, haben die Staaten überall die Kredithähne geöffnet, indem sie die Leitzinsen der Zentralbanken senkten. Indem diese Staatsbanken Kredite zu Niedrigstzinsen, manchmal zu weniger als 1% Zinsen, anboten, wurde massenhaft Geld in Umlauf gebracht. Die weltweite Verschuldung war also das Ergebnis einer freien Entscheidung der Herrschenden und nicht das Ergebnis irgendeiner „Deregulierung". Wie kann man sonst die Erklärung von G.W. Bush nach dem 11. September 2001 verstehen, der damals zu Beginn der Rezession die Beschäftigten dazu aufrief: „Seid gute Patrioten, konsumiert, kauft!" Der amerikanische Präsident lieferte somit der ganzen Finanzwelt eine klare Botschaft: multipliziert die Verbraucherkredite, sonst wird die Wirtschaft zusammenbrechen![12]
Tatsächlich überlebt der Kapitalismus seit Jahrzehnten mit Hilfe des Kredites. Die nachfolgende Grafik (Grafik 1),[13] stellt die Entwicklung der gesamten US-Verschuldung seit 1920 dar (d.h. der Staatsverschuldung, Verschuldung der Unternehmen und Haushalte). Sie ist selbstredend. Um die Wurzel dieses Phänomens zu begreifen und über die vereinfachenden und verfälschenden des „Wahnsinns der Banker, Spekulanten und Unternehmer" zu entblößen, muss man das „große Geheimnis der modernen Gesellschaft, die Mehrwertproduktion",[14] so Marx, gelüftet werden.
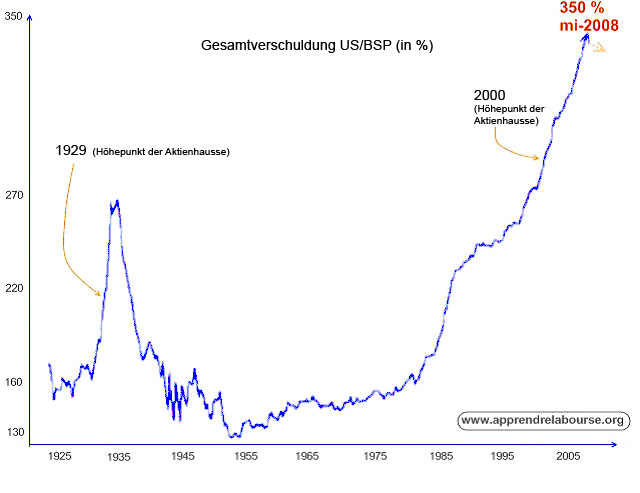 Grafik 1: Entwicklung der US-Gesamverschuldung seit 1920
Grafik 1: Entwicklung der US-Gesamverschuldung seit 1920Der Kapitalismus leidet seit seiner Entstehung an einer angeborenen Krankheit. Er bringt ständig einen Giftstoff hervor, den sein Körper nicht eliminieren kann - die „Überproduktion". Er stellt mehr Waren her als sein Markt aufnehmen kann. Warum? Nehmen wir ein theoretisches Beispiel: ein Fließbandarbeiter oder ein Beschäftigter, der mit einem Computer arbeitet, erhält am Ende des Monats einen Lohn von 800 Euro. Er hat aber nicht für den Wert von 800 Euro produziert (sein Lohn), sondern für den Wert von 1.200 Euro. Er hat unbezahlte Arbeit geleistet, mit anderen Worten einen Mehrwert geschaffen. Was macht der Kapitalist mit den 400 Euro, die er dem Arbeiter gestohlen hat (vorausgesetzt, es gelingt ihm die Waren abzusetzen)? Er steckt davon einen Teil in seine Tasche, nehmen wir an 150 Euro, und die verbleibenden 250 Euro investiert er wiederum in das Kapital seines Unternehmens, meistens indem er neue, modernere Maschinen kauft usw. Aber warum macht der Kapitalist dies? Weil er keine andere Wahl hat. Der Kapitalismus ist ein Konkurrenzsystem. Die Kapitalisten müssen die Waren billiger verkaufen als die Konkurrenten, welche die gleichen Waren anbieten. Deshalb muss der Unternehmer nicht nur seine Herstellungskosten senken, d.h. die Löhne,[15] sondern er muss auch einen wachsenden Teil der unbezahlten Arbeit dazu verwenden, prioritär in leistungsfähigere Maschinen zu investieren, um die Produktivität zu erhöhen.[16] Wenn er dies nicht tut, kann er nicht modernisieren, und früher oder später wird sein Konkurrent günstiger verkaufen und den Markt beherrschen können. Somit wird das kapitalistische System durch ein widersprüchliches Phänomen beherrscht: Indem die Arbeiter nicht für das entlohnt werden, was sie tatsächlich hergestellt haben, und indem die Unternehmer gezwungen werden, darauf zu verzichten, einen größeren Teil des so erzielten Profites zu verbrauchen, stellt das System mehr her als es absetzen kann. Niemals können Arbeiter und Kapitalisten zusammengenommen allein alle hergestellten Waren konsumieren. Wer wird aber den Warenüberschuss verbrauchen? Dazu muss das System zwangsweise neue Märkte außerhalb des Rahmens der kapitalistischen Produktionsweise finden. Diese nennt man außerkapitalistische Märkte (d.h. außerhalb des Kapitalismus, wo nicht nach kapitalistischen Prinzipien produziert wird).
Deshalb trat der Kapitalismus im 18. und 19. Jahrhundert die Eroberung der Welt an. Er musste ständig neue Märkte in Asien, Afrika, Südamerika finden, um dort seine überschüssigen Waren profitabel abzusetzen, wenn er nicht der Gefahr ausgesetzt sein wollte, gelähmt zu werden. Aber dies trat übrigens regelmäßig ein, als es ihm nicht gelang, möglichst schnell neue Märkte zu erobern. Das Kommunistische Manifest von 1848 beschrieb diesen Krisentyp sehr anschaulich und bestechend. „In den Krisen bricht eine gesellschaftliche Epidemie aus, welche allen früheren Epochen als ein Widersinn erschienen wäre - die Epidemie der Überproduktion. Die Gesellschaft findet sich plötzlich in einen Zustand momentaner Barbarei zurückversetzt; eine Hungersnot, ein allgemeiner Vernichtungskrieg scheinen ihr alle Lebensmittel abgeschnitten zu haben; die Industrie, der Handel scheinen vernichtet, und warum? Weil sie zuviel Zivilisation, zuviel Lebensmittel, zuviel Industrie, zuviel Handel besitzt." [Marx/Engels: Manifest der kommunistischen Partei, S. 50. Digitale Bibliothek Band 11: Marx/Engels, S. 2628 (vgl. MEW Bd. 4, S. 468)]
Weil der Kapitalismus noch in seiner Wachstumsphase steckte, konnte dieser damals jedoch noch neue Territorien erobern; jede Krise mündete danach in eine neue Phase des blühenden Wachstums. „Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre Produkte jagt die Bourgeoisie über die ganze Erdkugel. Überall muß sie sich einnisten, überall anbauen, überall Verbindungen herstellen...Die wohlfeilen Preise ihrer Waren sind die schwere Artillerie, mit der sie alle chinesischen Mauern in den Grund schießt, mit der sie den hartnäckigsten Fremdenhaß der Barbaren zur Kapitulation zwingt. Sie zwingt alle Nationen, die Produktionsweise der Bourgeoisie sich anzueignen, wenn sie nicht zugrunde gehn wollen; sie zwingt sie, die sogenannte Zivilisation bei sich selbsteinzuführen, d.h. Bourgeois zu werden. Mit einem Wort, sie schafft sich eine Welt nach ihrem eigenen Bilde." [Marx/Engels: Manifest der kommunistischen Partei, S. 47. Digitale Bibliothek Band 11: Marx/Engels, S. 2625 (vgl. MEW Bd. 4, S. 466)]
Aber damals schon erkannte Marx in diesen periodischen Krisen etwas mehr als nur einen einfach ewigen Zyklus, der immer wieder zu einer neuen Blütephase führen würde. Er entdeckte viel mehr die tiefgreifenden Widersprüche des Kapitalismus. „...durch die Eroberung neuer Märkte [und] Dadurch, daß sie allseitigere und gewaltigere Krisen vorbereitet und die Mittel, den Krisen vorzubeugen, vermindert." [Marx/Engels: Manifest der kommunistischen Partei, S. 50. Digitale Bibliothek Band 11: Marx/Engels, S. 2628 (vgl. MEW Bd. 4, S. 468)] Und zu den Krisen meinte Marx in „Lohnarbeit und Kapital": „Sie werden häufiger und heftiger schon deswegen, weil in demselben Maß, worin die Produktenmasse, also das Bedürfnis nach ausgedehnten Märkten wächst, der Weltmarkt immer mehr sich zusammenzieht, immer weniger Märkte zur Exploitation übrigbleiben, da jede vorhergehende Krise einen bisher uneroberten oder vom Handel nur oberflächlich ausgebeuteten Markt dem Welthandel unterworfen hat." [Marx: Lohnarbeit und Kapital, S. 52. Digitale Bibliothek Band 11: Marx/Engels, S. 2739 (vgl. MEW Bd. 6, S. 423)]
Im 18. und 19. Jahrhundert lieferten sich die größten kapitalistischen Mächte einen wahren Wettlauf bei der Eroberung der Welt. Sie teilten schrittweise den Erdball untereinander auf und bildeten richtige Reiche. Von Zeit zu Zeit traten sie sich gegenüber und schielten gemeinsam auf dasselbe Territorium; ein kurzer Krieg wurde ausgelöst, und der Unterlegene begab sich schnell auf die Suche nach einem anderen zu erobernden Teil der Erde. Aber nachdem sich Anfang des 20. Jahrhunderts die Großmächte die Herrschaft über die Welt aufgeteilt hatten, ging es nun nicht mehr darum, in Afrika, Asien oder Amerika auf Jagd nach Kolonien zu gehen, sondern in einen unnachgiebigen Krieg zur Verteidigung ihrer Einflussgebiete einzutreten und sich mit Waffengewalt der Einflussgebiete der imperialistischen Konkurrenten zu bemächtigen. Dabei handelte sich es um einen wahren Überlebenskampf für die kapitalistischen Nationen. Sie mussten unbedingt ihre Überproduktion auf den nicht-kapitalistischen Märkten absetzen. Es war also kein Zufall, dass Deutschland, das über sehr wenig Kolonien verfügte und von der Zustimmung des britischen Reiches zum Handel auf seinen Territorien abhing (für eine nationale Bourgeoisie eine unhaltbare Situation), am aggressivsten vorging und 1914 den Ersten Weltkrieg auslöste. In diesem Krieg kamen mehr als 11 Millionen Menschen um; er rief ungeheure Leiden hervor sowie ein moralisches und psychologisches Trauma für ganze Generationen. Dieser Horror kündigte den Anbruch einer neuen Epoche an, die die barbarischste Epoche in der Geschichte wurde. Der Kapitalismus hatte seinen Höhepunkt überschritten; er trat in seine Niedergangsphase ein. Der Krach von 1929 war ein schlagender Beweis dafür.
Und dennoch, nach mehr als einhundert Jahren langsamer Agonie hält sich das System noch immer aufrecht, schwankend, angeschlagen, aber immer noch aufrecht. Wie konnte es überleben? Warum ist sein Körper noch nicht völlig durch das Gift der Überproduktion gelähmt? Hier kommt der Rückgriff auf die Verschuldung ins Spiel. Der Weltwirtschaft ist es gelungen, einen spektakulären Zusammenbruch zu vermeiden, indem immer massiver auf die Verschuldung zurückgegriffen wurde.
Wie die Grafik 1 zeigt, nahm die US-Gesamtverschuldung seit Anfang des 20. Jahrhunderts enorm zu, um förmlich in den 1920er Jahren zu explodieren. Die Haushalte, Unternehmen und Banken erstickten geradezu unter dem Gewicht der Schulden. Und der rapide Rückgang der Verschuldungskurve in den 1930er und 1940er Jahren war in Wirklichkeit irreführend. Die große Depression der 1930er Jahre stellte die erste große Wirtschaftskrise in der Dekadenz dar. Die herrschende Klasse war damals noch nicht auf solchen Schock vorbereitet. Zunächst reagierte sie nicht oder schlecht. Indem die Grenzen dicht gemacht wurden (Protektionismus), wurde die Überproduktion nur noch verschärft. Das Gift wirkte verheerend. Zwischen 1929-1933 sank die US-amerikanische Industrieproduktion um die Hälfte;[17] 13 Millionen Arbeitslose wurden registriert. Zwei Millionen Amerikaner waren obdachlos, eine gewaltige Verarmung breitete sich aus.[18] Anfangs eilte die herrschende Klasse dem Finanzsektor nicht zu Hilfe: von den 29.000 Banken, die 1921 gezählt worden waren, blieben Ende März 1933 nur 12.000 übrig. Und dieses ‚Bankengemetzel' ging noch bis 1939 weiter.[19] All diese Bankrotte bedeuteten einfach das Verschwinden eines gigantischen Schuldenberges.[20] Aber in der Grafik erscheint nicht das Wachstum der öffentlichen Verschuldung. Nach vier Jahren des Abwartens ergriff der US-amerikanische Staat schließlich Maßnahmen: Roosevelts New Deal wurde beschlossen. Aber woraus bestand dieser Plan, von dem man heute so viel spricht? Es handelt sich um eine Politik der Großprojekte, die sich auf eine massive und nie da gewesene Verschuldung des Staates stützte (1929 betrug die öffentliche Verschuldung 17 Milliarden Dollar, 1939 erreichte sie 40 Milliarden Dollar).[21]
Später hat die bürgerliche Klasse die Lehren aus diesem gescheiterten Erlebnis gezogen. Am Ende des 2. Weltkriegs schuft sie auf internationale Ebene Währungs- und Finanzinstanzen (mit Hilfe des Bretton Wood Abkommens), und vor allem erfolgte nunmehr systematisch der Rückgriff auf Kredite. Nachdem ein Tiefstand 1953-54 erreicht wurde und trotz der kurzen Beruhigung in den 1950er und 1960er Jahren,[22] nahm die US-Gesamtverschuldung langsam aber unwiderruflich von Mitte der 1950er Jahre an zu. Und als die Krise 1967 wieder ausbrach, wartete die herrschende Klasse dieses mal keine vier Jahre um zu reagieren. Sie griff sofort wieder zu Krediten. Die letzten 40 Jahre können in der Tat zusammengefasst werden als eine einzige Abfolge von Krisen und eine unglaubliche Steigerung des weltweiten Schuldenbergs. In den USA gab es offiziell in den Jahren 1969, 1973, 1980, 1981, 1990 und 2001 eine Rezession.[23] Der von der bürgerlichen Klasse in den USA eingeschlagene Weg zur Überwindung dieser Schwierigkeiten wird anhand der Grafik ersichtlich: Die Verschuldung stieg stark ab 1973 und erhöhte sich über alle Maßen in den 1990er Jahren. Die ganze bürgerliche Klasse hat überall auf der Welt so reagiert.
Aber die Verschuldung ist keine magische Lösung. Die 2. Statistik [24] zeigt, dass seit 1966 die Verschuldung immer weniger wirksam ist, um das Wachstum anzukurbeln.[25] Es handelt sich hier um einen Teufelskreis. Die Kapitalisten produzieren mehr Waren als der Markt normalerweise aufsaugen kann. Dann schafft der Kredit einen künstlichen Markt. Die Kapitalisten verkaufen somit ihre Waren und investieren ihren Profit in der Produktion .... Womit wir wieder beim Ausgangspunkt sind, denn neue Kredite werden benötigt, um die neuen Waren zu verkaufen. Nicht nur häufen sich jeweils die Schuldenberge, sondern bei jedem neuen Zyklus müssen die Schuldenberge weit höher sein, um die gleiche Wachstumsrate zu erhalten (da die Produktion erweitert werden muss). Zudem wird ein immer größerer Teil der Kredite nie dem Produktionsprozess zugeführt, sondern er verschwindet alsbald in dem Abgrund der Defizite. Überschuldete Haushalte nehmen oft neue Kredite auf, um ihre Altschulden zu begleichen. Die Staaten, Unternehmen und Banken funktionieren auf die gleiche Art und Weise. Schließlich haben während der letzten 20 Jahre, als die ‚reelle Wirtschaft' ständig in der Krise steckte, große, wachsende Mengen von Geld, das in dieser Form geschaffen wurde, nur die Spekulationsblasen mit angefacht (Internet, Telekom, Immobilienblase usw.).[26] Es war in der Tat rentabler und schließlich weniger risikoreich an der Börse zu spekulieren als in die Produktion von Waren zu investieren, die auf große Absatzschwierigkeiten stoßen. Heute gibt es 50 mal mehr Geld im Umlauf an den Börsen als in der Produktion.[27]
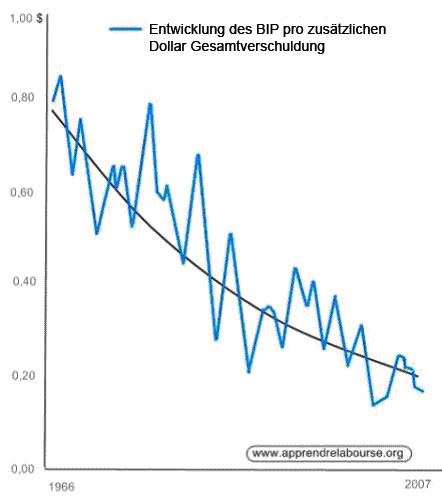 Grafik 2: Immer schwächere Wirkungen der zusätzlichen Verschuldung auf das BIP
Grafik 2: Immer schwächere Wirkungen der zusätzlichen Verschuldung auf das BIPAber diese Flucht nach vorn in die Verschuldung ist nicht nur immer weniger wirksam, sie verschärft vor allem unausweichlich und systematisch die verheerende Wirtschaftskrise. Das Kapital kann nicht endlos lange Geld aus seinem Hut zaubern. Das ABC der Wirtschaft besagt, dass jede Schuld eines Tages zurückgezahlt werden muss, weil sonst für den Gläubiger große Schwierigkeiten entstehen können, die bis hin zum Bankrott reichen. Wir kommen also gewissermaßen zum Ausgangspunkt zurück. Eigentlich hat das Kapital gegenüber seiner historischen Krise nur Zeit gewonnen. Schlimmer noch. Indem so die Auswirkungen der Krise auf morgen verschoben werden, werden dadurch nur noch heftigere wirtschaftliche Erschütterungen vorbereitet. Und genau das passiert im Kapitalismus heute!
Kann der Staat die kapitalistische Wirtschaft retten?
Wenn ein Einzelner Pleite geht, verliert er alles und fliegt auf die Straße. Ein Unternehmer muss Konkurs anmelden. Aber ein Staat? Kann ein Staat bankrott gehen? Bislang haben wir noch nie gesehen, dass ein Staat « Konkurs anmeldet ». Aber das stimmt nicht genau. Zahlungsunfähig werden, ja das kann er!
1982 mussten 14 hochverschuldete afrikanische Staaten offiziell Zahlungsunfähigkeit anmelden. In den 1990er Jahren wurden südamerikanische Staaten und Russland zahlungsunfähig. Und neulich ist Argentinien 2001 unter dem Schuldenberg zusammengebrochen. Konkret haben diese Staaten nicht zu existieren aufgehört, und die jeweilige Volkswirtschaft ist nicht zum Stillstand gekommen. Aber jedes Mal ist eine Art ökonomisches Beben eingetreten: Der Wert der Landeswährung ist gesunken, die Geldgeber (in der Regel andere Staaten) haben alles oder einen Teil ihrer Investitionen verloren, und vor allem hat der Staat seine Ausgaben drastisch gekürzt, indem ein Großteil seiner Beamten entlassen wurde und eine Zeitlang den verbliebenen Beschäftigen kein Gehalt gezahlt wurde.
Heute steht eine Vielzahl von Ländern am Rand des Abgrundes: Ecuador, Island, Ukraine, Serbien, Estland... Aber wie steht es um die Großmächte? Der Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger, erklärte Ende Dezember, sein Bundesstaat müsse den „finanziellen Notstand" ausrufen. Der reichste US-Bundessstaat, der „Golden State", schickt sich an, einen großen Teil seiner 235.000 Beschäftigten (die Verbleibenden müssen ab dem 1. Februar 2009 pro Monat zwei Tage unbezahlten ‚Urlaub' nehmen) zu entlassen! Bei der Vorstellung des neuen Jahreshaushaltes warnte der ehemalige Hollywood-Star, „jeder müsse Zugeständnisse machen". Dies ist ein klares Symbol der tiefgreifenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten der ersten Weltmacht. Wir sind noch weit von einer Zahlungsunfähigkeit des US-Staates entfernt, aber das Beispiel zeigt deutlich, dass die finanziellen Spielräume gegenwärtig bei allen Großmächten sehr eng geworden sind. Die weltweite Verschuldung scheint an ihre Grenzen zu stoßen (sie betrug 2007 60.000 Milliarden Dollar und ist seitdem um mehrere Tausende Milliarden Dollar weiter angewachsen). Weil sie gezwungen ist, diesen Weg weiter zu beschreiten, wird die bürgerliche Klasse nur noch weitere verheerende wirtschaftliche Erschütterungen verursachen. Die amerikanische FED hat zum ersten Mal seit ihrer Gründung im Jahre 1913 ihre Leitzinsen für das Jahr 2009 auf 0.25% gesenkt. Der amerikanische Staat verleiht also nahezu kostenlos Geld (und dies geschieht eigentlich sogar mit Verlust, wenn man die Inflation mit berücksichtigt). Alle Ökonomen der Welt rufen nach einem „neuen New Deal". Sie träumen davon, in Obama einen neuen Roosevelt zu sehen, der dazu in der Lage wäre, die Wirtschaft wie 1933 durch einen gewaltigen Plan öffentlicher Arbeiten, die durch ... Schulden finanziert wurden, wieder anzukurbeln.[28] Aber die Herrschenden haben seit 1967 regelmäßig die Staatsverschuldung in einem noch viel größeren Umfang als zur Zeit des New Deal erhöht, bislang jedoch ohne wirklichen Erfolg. Das Problem ist, dass solch eine Politik der Flucht nach vorn den Zusammenbruch des Dollars herbeiführen kann. Immer mehr Länder zweifeln mittlerweile die Fähigkeit der USA an, ihre Schulden zurückzuzahlen und sie sind deshalb geneigt, ihre Investitionen zurückzuziehen. Das trifft z.B. auf China zu, das Ende 2008 in diplomatischer Sprache Uncle Sam drohte, die Unterstützung der US-Wirtschaft durch den Kauf von Staatsanleihen einzustellen: „Jeder Fehler hinsichtlich der Tragweite der Krise wird sowohl für die Gläubiger als auch für die Schuldner Schwierigkeiten verursachen. Der scheinbar wachsende Appetit des Landes für US-amerikanische Staatsanleihen bedeutet nicht, dass diese langfristig eine rentable Investitionen bleiben werden oder dass die amerikanische Regierung weiterhin von ausländischem Kapital abhängig sein wird." So droht also China dem amerikanischen Staat, die seit Jahren betriebene Unterstützung der US-Wirtschaft einzustellen. Wenn China seine Drohung wahr machen würde,[29] würde das daraus entstehende internationale währungspolitische Chaos apokalyptische Ausmaße annehmen und die Auswirkungen für die Arbeiterklasse wären gewaltig. Aber nicht nur das Reich der Mitte hat angefangen, Zweifel zu äußern. Am Mittwoch, den 10. Dezember 2008, hatte der US-Staat zum ersten Mal in der Geschichte große Schwierigkeiten, für eine Staatsanleihe von 28 Milliarden Dollar Käufer zu finden. Und weil bei allen Großmächten die Kassen leer sind, und sich überall die Rechnungen für die riesigen Schuldenberge anhäufen und die Wirtschaft sich in einem schlechteren Zustand befindet, musste der deutsche Staat am gleichen Tag das gleiche erleben: Auch er hatte zum ersten Mal seit den 1920er Jahren Schwierigkeiten Käufer für seine Staatsanleihen im Umfang von 7 Milliarden Euro zu finden.
Offensichtlich ist die Verschuldung, ob die der Privathaushalte, der Unternehmen oder der Staaten, nur ein ‚Schmerzmittel'. Sie kann die Krankheit des Kapitalismus - die Überproduktion - nicht heilen. Dadurch kann allerhöchstens nur vorübergehend eine Erleichterung verschafft werden, aber gleichzeitig werden dadurch nur noch größere Beben vorbereitet. Und dennoch muss die herrschende Klasse diese verzweifelte Politik fortführen, denn sie hat keine andere Wahl, wie die Erklärung Angela Merkels am 8. November 2008 auf der Internationalen Konferenz in Paris belegt: „Es gibt keine andere Möglichkeit des Kampfes gegen die Krise als die Anhäufung von Schuldenbergen", oder auch die Wortmeldung des Chefökonomen des IWF, Olivier Blanchard: „Wir stehen vor einer Krise mit einem außergewöhnlichen Ausmaß, deren Hauptcharakteristik ein Zusammenbruch der Nachfrage ist (...) Wir müssen unbedingt die private Nachfrage wieder ankurbeln, wenn wir vermeiden wollen, dass die Rezession in eine große Depression mündet. Wie? - Durch die Erhöhung der öffentlichen Ausgaben".
Aber abgesehen von den Konjunkturprogrammen kann der Staat nicht wenigsten DER Retter sein, indem er einen Großteil der Wirtschaft verstaatlicht, insbesondere die Banken und die Automobilbranche? Nein, auch das wirkt nicht! Im Gegensatz zu den traditionellen Lügen der Linken und der Extremen Linken brachten die Verstaatlichungen nie eine Verbesserung für die Arbeiterklasse. Nach dem 2. Weltkrieg diente die große Verstaatlichungswelle dazu, einen zerstörten Produktionsapparat wieder auf die Beine zu stellen, indem der Arbeitsrhythmus intensiviert wurde. Wir dürfen nicht vergessen, was damals Thorez, der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Frankreichs und damals Vizepräsident der von De Gaulle geführten Regierung war, insbesondere an die Adresse der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sagte: „Wenn ein Arbeiter bei der Arbeit stirbt, müssen die Frauen ihn ersetzen", oder „Krempelt die Ärmel auf für den nationalen Wiederaufbau" oder „Streiks sind die Waffen der Trusts". Willkommen in der wunderbaren Welt der verstaatlichten Betriebe. Das verwundert alles nicht. Die revolutionären Kommunisten haben immer seit der Gründung der Pariser Kommune 1871 die arbeiterfeindliche Rolle des Staates aufgezeigt: „Der moderne Staat, was auch seine Form, ist eine wesentlich kapitalistische Maschine, Staat der Kapitalisten, der Ideelle Gesamtkapitalist. Je mehr Produktivkräfte er in sein Eigentum übernimmt, desto mehr wird er wirklicher Gesamtkapitalist, desto mehr Staatsbürger beutet er aus. Die Arbeiter bleiben Lohnarbeiter, Proletarier. Das Kapitalverhältnis wird nicht aufgehoben, es wird vielmehr auf die Spitze getrieben."[Engels: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, S. 506. Digitale Bibliothek Band 11: Marx/Engels, S. 8142 (vgl. MEW Bd. 20, S. 260)] [30]
Die neue Welle von Verstaatlichungen wird also der Arbeiterklasse nichts Gutes bringen. Und sie wird es den Herrschenden auch nicht ermöglichen, ein dauerhaftes Wachstum anzustoßen. Im Gegenteil! Diese Verstaatlichungen kündigen noch gewalttätigere wirtschaftliche Stürme an. 1929 haben die pleite gegangenen US-Banken die Guthaben eines Großteils der US-Bevölkerung mit vernichtet und damit Millionen Arbeiter in die Armut gestürzt. Um die Wiederholung solch eines Debakels zu verhindern, war das Bankensystem in zwei Teile aufgeteilt worden: einerseits die Geschäftsbanken, die Unternehmen finanzieren und in allen möglichen Finanzbereichen tätig sind; anderseits Gläubigerbanken, die das Geld von den Einlegern bekommen und es für relativ sichere Anlagen benutzen. Aber von der Pleitewelle im Jahre 2008 weggespült, gibt es nun diese amerikanischen Geschäftsbanken nicht mehr. Das amerikanische Finanzsystem befindet sich jetzt wieder in dem gleichen Zustand wie vor dem 24. Oktober 1929. Beim nächsten Sturm laufen alle bislang dank der völligen oder teilweisen Verstaatlichung „geretteten" Banken ihrerseits Gefahr zu verschwinden, aber dabei werden sie die knappen Ersparnisse und die Löhne von zahlreichen Arbeiterfamilien mit zerstören. Wenn die Herrschenden heute Verstaatlichungen vornehmen, wollen sie damit nicht irgendein Konjunkturprogramm anleiern, sondern es geht darum, die unmittelbare Zahlungsunfähigkeit der großen Finanzhäuser oder Industriekonzerne zu vermeiden. Es geht darum, das Schlimmste zu vermeiden.[31]
Der in den letzten vier Jahrzehnten angehäufte Schuldenberg ist zu einem wahren Mount Everest geworden, und niemand kann heute den Bergrutsch verhindern. Der Zustand der Wirtschaft ist wirklich katastrophal. Aber man darf deshalb nicht glauben, dass der Kapitalismus durch einen Schlag verschwinden wird. Die Bürgerlichen werden IHRE Welt nicht untergehen lassen ohne zu reagieren. Sie werden verzweifelt und mit allen Mitteln versuchen, die Agonie ihres Systems zu verlängern, ohne dabei auf die furchtbaren Konsequenzen, die sich dabei für die Menschheit ergeben, zu achten. Ihre wahnsinnige Flucht nach vorne in noch mehr Verschuldung wird weitergehen. Selbst wenn es in Zukunft hier und da kurze Augenblicke von Wachstum geben wird, steht fest, dass die historische Krise des Kapitalismus jetzt ihren Rhythmus geändert hat. Nach 40 Jahren langsamen Abstiegs in die Hölle, stehen wir jetzt vor gewalttätigen Erschütterungen, mit immer wieder auftretenden ökonomischen Beben, die nicht nur die Staaten der Dritten Welt sondern auch die USA, Europa, Asien erfassen werden.[32]
Die Devise der Kommunistischen Internationale 1919 « Damit die Menschheit überleben kann, muss der Kapitalismus überwunden werden/sterben » ist mehr denn je aktuell.
Mehdi, 10.01.2009
[1] Jeweils : Paul Krugman (letzter Nobelpreis für Wirtschaft), Warren Buffet (US-Investor, genannt das ‘Orakel von Omaha', so stark wird die Meinung des Milliardärs der kleinen US-Stadt in Nebraska in der Finanzwelt geachtet), Jacques Attali (Ökonom und Berater von Mitterrand und Sarkozy) und Laurence Parisot (Präsidentin des französischen Unternehmerverbandes).
[2] Libération, 4.08.08
[3] Le Monde, 22.08.08.
[4] Quelle : www.contreinfo.info [25]
[5] Les Echos, 05.12.08
[6] Dieses Geld wurde in den Kassen des Paulson Plans gefunden, welcher schon nicht für den Bankensektor ausreicht. Die herrschende Klasse in den USA muss „Paul ausziehen, um Jack anzuziehen", was ein entsprechendes Licht auf den desaströsen Zustand der Finanzen der ersten Macht der Erde wirft.
[7] Les Echos, 08.01.09
[8] nach dem Bericht, der am 9.01.09 vom US-Arbeitsministerium veröffentlicht wurde (Les Echos, 09.01.09)
[9] In Frankreich hatte Präsident Nicolas Sarkozy gar 2007 eine Kampagne 2007 mit dem Hauptslogan „Mehr arbeiten, um mehr zu verdienen" (sic !) betrieben.
[10] 2007 waren mehr als drei Millionen US-Haushalte zahlungsunfähig (in Subprime Mortgage Foreclosures by the Numbers). www.americanprogress.org/issues/2007/03/foreclosures_numbers.html [26].
[11] In diesem Fall stimmen wir mit Chavez überein. Bush ist in der Tat sein Genosse. Auch wenn sie sich bei dem Kampf zwischen zwei imperialistischen Nationen gegenüberstehen, sind sie dennoch Kampfgefährten bei der Verteidigung des Kapitalismus und der Privilegien ihrer Klasse ... die Bourgeoisie.
[12] Heute wird Alan Greenspan, der ehemalige Präsident der FED und der Orchesterchef dieser Schuldenwirtschaft wird heute von allen Ökonomen und anderen Doktoren der Ökonomie gelyncht. All diese Leute haben ein kurzes Gedächtnis, sie vergessen, dass sie ihn vor kurzem noch in den Himmel lobten. Er wurde gar als der « Finanzguru » gepriesen.
[13] Quelle : eco.rue89.com/explicateur/2008/10/09/lendettement-peut-il-financer-leconomie-americaine
[14] Le Capital, Livre 1, p725, La Pléiade.
[15] oder anders gesagt das variable Kapital
[16] das fixe Kapital.
[17] A. Kaspi, Franklin Roosevelt, Paris, Fayard, 1988, p.20
[18] Diese Zahlen sind umso wichtiger, da die US-Bevölkerung damals nur 120 Mio. betrug. Quelle : Lester V. Chandler, America's Greatest Depression 1929-1941, New York, Harper and Row, 1970, p.24. et sq.
[19] Gemäß Frédéric Valloire, in Valeurs Actuelles 15.02.2008.
[20] Der Vollständigkeit halber soll ergänz werden, dass dieser Rückgang der Gesamtschuld auch durch einen komplexen ökonomischen Mechanismus erklärt wird: die Geldschöpfung. Der New Deal wurde nicht ganz durch Schulden finanziert, sondern auch durch reine Geldschöpfung. So wurde am 12. Mai 1933 der US-Präsident dazu ermächtigt, die Schulden der Zentralbank um 3 Milliarden Dollar zu erhöhen und Geldnoten im Umfang von 3 Milliarden $ ohne Gegenwert zu drucken Am 22. Oktober desselben Jahres wurde der Dollar gegenüber dem Gold um 50% abgewertet. All dies erklärt die relative Beschränkung der Verschuldungsquoten.
[21] Quelle : www.treasurydirect.gov/govt/reports/pd/histdebt/histdebt_histo3.htm [27]
[22] Von 1950 bis 1967 durchlief der Kapitalismus eine Wachstumsphase, die « 30 glorreiche Jahre » oder « goldene Jahre » genannt wurden. Das Ziel dieses Artikels besteht nicht darin, die Ursachen dieses kurzen Zeitraums innerhalb der wirtschaftlichen Flaute des 20. Jahrhunderts zu untersuchen. In der IKS findet gegenwärtig eine Debatte statt, um besser den Hintergrund dieses kurzen Zeitraums zu begreifen. Wir haben angefangen, diese Debatte in unserer Presse zu veröffentlichen (siehe dazu « Interne Debatte der IKS : Die Ursachen der Blütephase nach dem 2. Weltkrieg", Internationale Revue Nr. 42). Wir ermuntern alle unsere Leser/Innen sich an diesen Debatten in unseren Veranstaltungen oder auch per Post oder per E-mail zu beteiligen
[23] Quelle : www.nber.org/research/business-cycle-dating [28].
[24] Quelle : eco.rue89.com/explicateur/2008/10/09/lendettement-peut-il-financer-leconomie-americaine
[25] 1996 schuft ein Dollar zusätzlicher Verschuldung 0.80 Dollar zusätzlichen Reichtum, während 2007 ein Dollar zusätzlicher Verschuldung lediglich 0.20 Dollar BIP schuf.
[26] Aktiva und Immobilien werden im BIP nicht aufgeführt.
[27] Im Gegensatz zu all dem, was uns Journalisten, Ökonomen und andere Lügenverbreiter sagen, ist dieser „spekulative Wahnsinn" doch das Ergebnis der Krise und nicht umgekehrt.
[28] Nach Beendigung dieses Artikels hat Obama seinen lang erwarteten Ankurbelungsplan vorgestellt, der selbst den Ökonomen zufolge « ziemlich enttäuschend » ist. 775 Milliarden Dollar werden locker gemacht, um den US-Haushalten 1000 Dollar zusätzliche Kaufkraft « zur Anregung des Konsums » zur Verfügung zu stellen (in diesen Genuss werden 75% der Haushalte kommen). Gleichzeitig soll ein Programm öffentlicher Ausgaben im Bereich Energie, Infrastruktur und Bildung erfolgen. Dieser Plan sollte Obama zufolge drei Millionen Arbeitsplätze « in den nächsten Jahren » schaffen. Gegenwärtig verlieren monatlich ca. 500.000 Beschäftigte ihren Job ; dieser neue New Deal (selbst wenn er die erhoffte Wirkung zeigen würde, was wenig wahrscheinlich ist) wird also bei weitem nicht reichen.
[29] Diese Bedrohung zeigt gleichzeitig die Sackgasse und die Widersprüche, in welcher die US-Wirtschaft steckt. Wenn China massiv Dollars verkaufen würde, hieße dies, sich den Ast abzusägen, auf dem es selbst sitzt, da die USA Hauptabsatzmarkt seiner Waren sind. Deshalb hat China bislang meist die US-Wirtschaft unterstützt. Aber gleichzeitig weiß China, dass dieser Ast morsch, von Würmern zerfressen ist, und es will dann nicht mehr auf dem Ast sitzen, wenn er abbricht.
[30] In « Anti-Dühring », Ed.Sociales 1963, p.318.
[31] Damit schafft er aber einen günstigeren Boden für die Entwicklung der Kämpfe. Indem der Staat wieder ihr offizieller Arbeitgeber werden wird, werden die Beschäftigten bei ihren Kämpfen alle direkt dem Staat gegenüberstehen. In den 1980er Jahren hatte die große Privatisierungswelle (z.B. unter Thatcher in England) eine zusätzliche Schwierigkeit im Klassenkampf bedeutet. Nicht nur wurden die Arbeiter durch die Gewerkschaften dazu aufgerufen, um die Betriebe des öffentlichen Dienstes zu retten, oder um anders gesagt, eher durch einen Arbeitgeber (den Staat) als durch einen anderen (privaten) ausgebeutet zu werden. So standen sie nicht mehr lediglich dem gleichen Arbeitgeber (dem Staat), sondern eine Reihe verschiedener privater Arbeitgeber gegenüber. Ihre Kämpfe wurden dadurch oft zerstreut und somit machtlos. In der Zukunft werden dagegen günstigere Bedingungen für einen einheitlichen Kampf gegen den Staat vorhanden sein.
[32] Die Wirtschaft ist sozusagen ein „besonders stark vermintes Gelände", deshalb ist es schwierig vorherzusagen, welche Mine als nächstes hochgehen wird. Aber in den Publikationen der Wirtschaftswissenschaftlicher taucht immer mehr ein Name auf, der den Experten Angst macht: die CDS. Ein CDS (credit default swap) ist eine Art Versicherung, mit Hilfe dessen ein Finanzinstitut sich gegen Zahlungsausfälle durch die Zahlung einer Prämie versichert. Der Gesamtumfang der CDS wurde für das Jahr 2008 auf 60 000 Milliarden Dollars hochgerechnet. D.h. wenn eine Krise der CDS ähnlich verlaufen würde wie die Krise der subprimes wäre dies unglaublich verheerend. Damit würden die ganzen amerikanischen Rentenfonds und damit die Renten der US-Arbeitnehmer überhaupt dahinschmelzen.
Politische Strömungen und Verweise:
- Antiglobalisierung [29]
Theoretische Fragen:
Griechenland: Der Aufstand der Jugend in Griechenland bestätigt die Entwicklung des Klassenkampfs
- 3964 reads
Der Ausbruch der Wut und der Revolte der jungen Arbeitergenerationen in Griechenland ist kein isoliertes oder besonderes Phänomen. Ihre Wurzeln liegen in der Weltwirtschaftskrise des Kapitalismus. Der Zusammenstoß der Protestierenden mit dem gewalttätigen Unterdrückungsapparat entblößt das wahre Gesicht der bürgerlichen Herrschaft und des Staatsterrors. Es ist eine direkte Fortsetzung der Mobilisierung der Jugendlichen auf einem Klassenterrain wie in Frankreich im Zusammenhang mit dem CPE-Gesetz im Frühjahr 2006 und dem LRU 2007, als die Studenten und Gymnasiasten sich vor allem als zukünftige Beschäftigte sahen, die gegen ihre künftigen Ausbeutungsbedingungen protestierten. Alle Herrschenden der wichtigsten europäischen Länder haben dies auch so verstanden, denn sie haben ihre Besorgnis zum Ausdruck gebracht, dass ähnliche soziale Explosionen aus Widerstand gegen die Zuspitzung der Krise auch woanders ausbrechen. So hat bezeichnenderweise die herrschende Klasse in Frankreich einen Rückzieher gemacht, indem sie ganz überstürzt ihr Programm zur Reformierung der Gymnasien (siehe dazu den Artikel auf unserer französischsprachigen Website) vorläufig auf Eis gelegt hat. Der internationale Charakter der Proteste und die wachsende Kampfbereitschaft der Studenten und vor allem der Schüler ist schon deutlich zu spüren.
In Italien fanden am 25. Oktober und am 14. November massive Demonstrationen unter dem Motto „Wir wollen nicht für die Krise blechen" gegen die Regierungsverordnung von Gelmini statt, die zahlreiche Einschnitte im Erziehungswesen mit drastischen Konsequenzen anstrebt: So sollen zum Beispiel die Zeitverträge von 87.000 Lehrern und 45.000 anderen Beschäftigten des Erziehungswesens nicht verlängert werden. Gleichzeitig sollen umfangreiche Kürzungen in den Universitäten vorgenommen werden.
In Deutschland sind am 12. November ca. 120.000 Schüler in den meisten Großstädten des Landes auf die Straße gegangen und haben zum Teil Parolen gerufen wie „Der Kapitalismus ist die Krise" (Berlin) oder das Landesparlament in Hannover belagert.
In Spanien sind am 13. November Hunderttausende Studenten in mehr als 70 Städten auf die Straße gegangen, um gegen die neuen, europaweit gültigen Bologna-Bestimmungen der Bildungsreform und der Universitäten zu protestieren, in denen u.a. die Privatisierung der Universitäten und immer mehr Praktika in den Unternehmen vorgesehen sind.
Die Revolte der Jugend gegen die Krise und die Verschlechterung der Lebensbedingungen breitete sich auf andere Länder aus: alleine im Januar 2009 brachen Bewegungen und Konfrontationen in Vilnius (Litauen), Riga (Lettland) und Sofia (Bulgarien) aus. Sie wurden mit einer harten Polizeirepression konfrontiert. In Kegoudou, 700 Kilometer südöstlich von Dakar in Senegal, ereigneten sich im Dezember 2008 gewalttätige Konfrontationen während Demonstrationen gegen die Armut. Die Demonstranten hatten mehr Lohn bei der Arbeit in den Minen von ArcelorMittal gefordert. 2 Personen wurden dabei getötet. Schon Anfangs Mai 2008 gab es einen Aufstand von 4000 Studenten in Marrakesch (Marokko), nachdem 22 von ihnen durch das Essen in der Universitätskantine eine Vergiftung erlitten hatten. Die Bewegung wurde brutal niedergeknüppelt und es folgten Festnahmen, lange Gefängnisstrafen und Folter.
Viele von ihnen identifizieren sich mit dem Kampf der griechischen Studenten. In vielen Ländern sind zahlreiche Kundgebungen und Solidaritätsveranstaltungen gegen die Repression, unter der die griechischen Studenten leiden, organisiert worden, wobei die Polizei auch sehr oft gewaltsam dagegen vorgegangen ist.
Das Ausmaß der Mobilisierung gegen diese gleichen, staatlichen Maßnahmen überrascht keineswegs. Die europaweite Reform des Bildungswesens dient der Anpassung der jungen Arbeitergeneration an eine perspektivlose Zukunft und die Generalisierung prekärer Arbeitsbedingungen sowie der Arbeitslosigkeit.
Der Widerstand und die Revolte der neuen Generationen von Schülern, die die zukünftigen Beschäftigten stellen werden, gegen die Arbeitslosigkeit und dieses ganze Ausmaß an Prekarisierung lässt überall ein Gefühl der Sympathie unter den ArbeiterInnen aufkommen, das bei allen Generationen zu spüren ist.
Gewalt durch Minderheiten oder massiver Kampf gegen die Ausbeutung und den Staatsterror?
Die in den Diensten der Lügenpropaganda des Kapitals stehenden Medien haben permanent versucht, die Wirklichkeit der Ereignisse in Griechenland seit der Ermordung des 15jährigen Alexis Andreas Grigoropoulos am 6. Dezember zu verzerren. Sie stellen die Zusammenstöße mit der Polizei entweder als das Werk einer Handvoll autonomer Anarchisten und linksextremer Studenten aus einem wohlbetuchten Milieu dar oder als das Vorgehen von Schlägern aus Randgruppen. Ständig werden in den Medien Bilder von gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei gesendet. Vor allem erscheinen Bilder von Jugendlichen, die Autos anstecken, Schaufenster von Geschäften und Banken zerschlagen, oder Bilder von Plünderungen von Geschäften.
Das ist die gleiche Fälschungsmethode, die 2006 gegen die Proteste gegen den CPE in Frankreich angewandt wurde, als die Proteste der Studenten mit den Aufständen in den Vorstädten von Paris im Herbst 2005 in den gleichen Topf geworfen wurden. Es ist das gleiche Vorgehen wie bei den Protesten gegen den LRU 2007 in Frankreich, als die Demonstranten als „Terroristen" oder „Rote Khmer" beschimpft wurden.
Aber auch wenn das Zentrum der Zusammenstöße im griechischen „Quartier Latin", in Exarchia, lag, kann man heute solche Lügen nur viel schwerer verbreiten. Wie könnten diese aufständischen Erhebungen das Werk von Randalierern oder anarchistischen Aktivisten sein, da sie sich doch lawinenartig auf alle Städte das Landes und selbst bis auf die Inseln (Chios, Samos) und bis in die großen Touristenhochburgen wie Korfu oder Kreta oder Heraklion ausgedehnt haben?
Die Gründe für die Wut
Alle Ingredienzien waren vorhanden, damit die Unzufriedenheit eines Großteils der jungen Arbeitergeneration sich ein Ventil sucht. Diese Generation hat Angst vor der Zukunft, die ihnen der Kapitalismus bietet. Griechenland verdeut-licht die Sackgasse, in welcher der Kapitalismus steckt und die auf alle Jugendlichen zukommen wird. Wenn diejenigen, die die „Generation der 600 Euro-Jobber" genannt werden
, auf dem Arbeitsmarkt auftauchen, haben sie den Eindruck, verarscht zu werden. Die meisten Studenten können ihr Studium nur finanzieren und überleben, indem sie in zwei Jobs schuften. Sie müssen kleine Jobs, meist unterbezahlte Schwarzarbeit, annehmen. Selbst in besser bezahlten Jobs wird ein Großteil des Lohns nicht versteuert, wodurch der Anspruch auf Sozialleistungen geschmälert wird. Insbesondere gelangen sie nicht in den Genuss der Sozialversicherung. Überstunden werden ebensowenig bezahlt. Oft können sie bis Mitte 30 nicht von zu Hause ausziehen, weil sie keine Miete zahlen können. 23 Prozent der Arbeitslosen in Griechenland sind Jugendliche (die Jugendarbeitslosigkeit der 15- bis 24-jährigen beträgt offiziell 25,2 Prozent). Wie eine französische Zeitung schrieb: „Diese Studenten fühlen sich durch niemanden mehr geschützt: Die Polizei schlägt auf sie ein bzw. schießt auf sie; durch das Bildungswesen stecken sie in einer Sackgasse, einen Job kriegen sie nicht, die Regierung belügt sie."[1] Die Jugendarbeitslosigkeit und ihre Schwierigkeiten in der Arbeitswelt haben somit ein Klima der allgemeinen Verunsicherung, der Wut und der Angst geschaffen. Die Weltwirtschaftskrise löst immer neue Wellen von Entlassungen aus. 2009 erwartet man allein in Griechenland den Abbau von mehr als 100.000 Arbeitsplätzen; dies allein würde fünf Prozent mehr Arbeitslose bedeuten. Gleichzeitig verdienen mehr als 40 Prozent der Beschäftigten weniger als 1100 Euro brutto im Monat. In Griechenland gibt es die meisten Niedriglöhner unter den 27 Staaten der EU: 14 Prozent.
Aber nicht nur die Jugendlichen sind auf die Straße gegangen, sondern auch die schlecht bezahlten Lehrer und viele Beschäftigte, die den gleichen Problemen, der gleichen Armut gegenüberstehen und von dem gleichen Gefühl der Revolte angetrieben werden. Die brutale Repression gegen die Bewegung, bei der der Mord an dem 15-jährigen Jugendlichen nur die dramatischste Episode war, hat dieses Gefühl der Solidarität nur noch gestärkt. Die soziale Unzufriedenheit bricht sich immer stärker Bahn. Wie ein Student berichtete, waren auch viele Eltern zutiefst schockiert über die Ereignisse: „Unsere Eltern haben festgestellt, dass ihre Kinder durch die Schüsse eines Polizisten ums Leben kommen"[2]. Sie haben den Fäulnisprozess einer Gesellschaft gerochen, in der ihre Kinder nicht den gleichen Lebensstandard erreichen werden wie sie. Auf zahlreichen Demonstrationen haben sie mit eigenen Augen das gewalttätige Vorgehen der Polizei, die brutalen Verhaftungen, den Einsatz von Schusswaffen durch die Ordnungskräfte und das harte Eingreifen der Bereitschaftspolizei (MAT) beobachten können.
Nicht nur die Besetzer der Polytechnischen Hochschule, das Zentrum der Studentenproteste, prangern den Staatsterror an. Diese Wut über die polizeiliche Repression trifft man auch auf allen Demonstrationen an, wo Parolen gerufen werden wie: „Kugeln gegen die Jugendlichen, Geld für die Banken". Noch deutlicher war ein Teilnehmer der Bewegung, der erklärte: „Wir haben keine Arbeit, kein Geld; der Staat ist wegen der Krise pleite, und die einzige Reaktion, die wir sehen, ist, dass man der Polizei noch mehr Waffen gibt"[3].
Diese Wut ist nicht neu. Schon im Juni 2006 waren die Studenten gegen die Universitätsreform auf die Straße gegangen, da die Privatisierung der Unis den weniger wohlhabenden Studenten den Zugang zur Uni verwehrte. Die Bevölkerung hat auch gegen die Schlamperei der Regierung während der Waldbrände im Sommer 2007 protestiert, als 67 Menschen zu Tode gekommen waren. Die Regierung hat bis heute noch nicht jene Menschen entschädigt, die ihre Häuser, ihr Hab und Gut verloren hatten. Aber vor allem die Beschäftigten waren massiv gegen die Regierungspläne einer „Rentenreform" auf den Plan getreten; Anfang 2008 fand zweimal innerhalb von zwei Monaten ein Generalstreik mit hoher Beteiligung statt. Damals beteiligten sich mehr als eine Millionen Menschen an den Demonstrationen gegen die Abschaffung des Vorruhestands für Schwerabeiter und die Aufkündigung der Vorruhestandsregelung für über 50-jährige Arbeiterinnen.
Angesichts der Wut der Beschäftigten sollte der Generalstreik vom 10. Dezember, der von den Gewerkschaften kontrolliert wurde, als Ablenkungsmanöver gegen die Bewegung dienen. Die Gewerkschaften forderten, mit der SP und der KP an der Spitze, den Rücktritt der gegenwärtigen Regierung und vorgezogene Neuwahlen. Allerdings konnten die Wut und die Bewegung nicht eingedämmt werden - trotz der verschiedenen Manöver der Linksparteien und der Gewerkschaften, um die Dynamik bei der Ausdehnung des Kampfes zu hemmen, und trotz all der Anstrengungen der herrschenden Klasse und ihrer Medien zur Isolierung der Jugendlichen gegenüber den anderen Generationen und der gesamten Arbeiterklasse, indem man versuchte, diese in sinnlose Zusammenstöße mit der Polizei zu treiben. Die ganze Zeit über gab es immer wieder Zusammenstöße: gewaltsames Vorgehen der Polizei mit Gummiknüppel und Tränengaseinsätzen, Verhaftungen und Verprügeln von Dutzenden von Protestierenden.
Die jungen Arbeitergenerationen bringen am klarsten das Gefühl der Desillusionierung und der Abscheu gegenüber einem total korrupten politischen Apparat zum Ausdruck. Seit dem Krieg teilen sich drei Familien die Macht und seit mehr als 30 Jahren herrschen in ständigem Wechsel die beiden Dynastien Karamanlis (auf dem rechten Flügel) und Papandreou (auf dem linken Flügel) - begleitet jeweils von großen Bestechungsaffären und Skandalen. Die Konservativen haben 2004, nach großen Skandalen der Sozialisten in den Jahren zuvor, die Macht übernommen. Viele lehnen mittlerweile den ganzen politischen und gewerkschaftlichen Apparat ab, der immer mehr an Glaubwürdigkeit verliert. „Der Geldfetisch beherrscht die Gesellschaft immer mehr. Die Jugendlichen wollen mit dieser seelenlosen und visionslosen Gesellschaft brechen."[4] Vor dem Hintergrund der Krise hat diese Generation von Arbeitern nicht nur ihr Bewusstsein über eine kapitalistische Ausbeutung weiterentwickelt, die sie an ihrem eigenen Leib spürt, sondern sie bringt auch das Bewusstsein für die Notwendigkeit eines gemeinsamen Kampfes zum Ausdruck, indem sie spontan die Methoden der Arbeiterklasse anwendet und ihre Solidarität sucht. Anstatt der Hoffnungslosigkeit zu verfallen, gewinnt sie ihr Selbstvertrauen aus der Tatsache, dass sie die Trägerin einer neuen Zukunft ist; sie setzt sich mit aller Macht gegen den Fäulnisprozess der Gesellschaft zu Wehr, in der sie lebt. So haben die Demonstranten ihren Stolz zum Ausdruck gebracht, als sie riefen: „Wir stellen ein Bild der Zukunft gegenüber einer sehr düsteren Vergangenheit dar".
Die Lage erinnert an die Verhältnisse im Mai 1968, aber das Bewusstsein dessen, was heute auf dem Spiel steht, geht viel weiter.
Die Radikalisierung der Bewegung
Am 16. Dezember besetzten Studenten wenige Minuten lang die Studios des Regierungsenders NET und rollten vor den Kameras ein Spruchband aus: „Hört auf, fern zu sehen. Kommt alle auf die Straße!". Und sie riefen dazu auf: „Der Staat tötet. Euer Schweigen ist seine Waffe. Besetzen wir alle öffentlichen Gebäude!" Der Sitz der Bürgerkriegspolizei Athens wurde angegriffen und ein Fahrzeug dieser Polizeitruppen angezündet. Diese Aktionen wurden daraufhin sofort von der Regierung als „Versuch des Umsturzes der Demokratie" gebrandmarkt und auch von der KP Griechenlands (KKE) verurteilt.
In Thessaloniki versuchten die lokalen Strukturen der Gewerkschaften GSEE und ADEDY (die Vereinigung der Staatsangestellten) die Streikenden mit einer Versammlung vor dem Arbeitsamt festzubinden. Doch Gymnasiasten und Studenten luden die Streikenden mit Erfolg dazu ein sich ihrer Demonstration anzuschliessen: 4000 Arbeiter und Studenten formierten einen Demonstrationszug durch die Straßen den Stadt. Am 11. Dezember versuchten Mitglieder der stalinistischen Sudentenorganisation PKS Versammlungen zu blockieren, um Besetzungen zu verhindern (an der Pantheon Universität, der Schule für Philosophie der Athener Uni). Doch ihr Plan scheiterte und die Bestzungen fanden statt. Im Ayios Dimitrios Quartier wurde die Stadthalle besetzt, um eine Vollversammlung abzuhalten, an der mehr als 300 Leute aller Generationen teilnahmen.
Am 17. Dezember wurde das Gebäude der größten Gewerkschaft Griechenlands GSEE (Allgemeiner Gewerkschaftsbund Griechenlands) in Athen von Beschäftigten besetzt, die die ArbeiterInnen dazu aufriefen, an diesem Ort zusammenzukommen, um Vollversammlungen abzuhalten, die allen Beschäftigten, allen StudentInnen und den Arbeitslosen offen stehen.
Eine ähnliche Situation mit Vollversammlungen und Besetzungen, die für alle offen waren, ereignete sich an der Athener Wirtschaftsuniversität und der Polytechnischen Schule.
Wir veröffentlichen hier ihre Erklärung, um das Schweigen und Verfälschen der Medien zu brechen, welche die Ereignisse als Straßenschlachten präsentierten, die von einigen Anarchisten zur Terrorisierung der Bevölkerung verursacht worden seien. Die Erklärung zeigt im Gegenteil, wie das solidarische Gefühl der Arbeiterklasse diese Bewegung auszeichnet und somit auch die verschiedenen Generationen der Proletarier verbindet:
Wir werden entweder unsere Geschichte selber bestimmen oder dann wird sie ohne uns bestimmt.
Wir, Handarbeiter, Angestellte, Erwerbslose, Zeitarbeiter, ob hier geboren oder eingewandert - wir sind keine passiven Fernsehkonsumenten. Seit dem Mord an Alexandros Grigoropoulos Samstagnacht nehmen wir an den Demonstrationen teil, an den Zusammenstößen mit der Polizei, den Besetzungen der Innenstadt oder der Wohnviertel. Immer wieder haben wir unsere Arbeit und unsere täglichen Verpflichtungen fallen gelassen, um mit den Schülern, Studenten und den anderen kämpfenden Proletariern auf die Straße zu gehen.
Wir haben entschieden, das Gebäude der GSEE zu besetzen:
- um es in einen Ort des freien Meinungsaustausches und in einen Treffpunkt für ArbeiterInnen zu verwandeln;
- um den von den Medien verbreiteten Irrglauben, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen nicht an den Zusammenstößen der letzten Tage beteiligt waren, dass die um sich greifende Wut die Sache von 500 „Vermummten", „Hooligans" sei, sowie andere Ammenmärchen, die verbreitet werden, zu widerlegen. Auf den Fernsehschirmen werden die ArbeiterInnen als Opfer der Unruhen dargestellt, während gleichzeitig die unzähligen Entlassungen infolge der kapitalistischen Krise in Griechenland und der restlichen Welt von den Medien und ihren Managern als „Naturereignisse" betrachtet werden;
- um die Rolle der Gewerkschaftsbürokratie bei der Untergrabung des Aufstandes - und nicht nur dort - aufzudecken. Die GSEE und der ganze seit Jahrzehnten dahintersteckende gewerkschaftliche Apparat untergraben die Kämpfe, handeln Brosamen für unsere Arbeitskraft aus und verewigen das System der Ausbeutung und der Lohnsklaverei. Das Vorgehen der GSEE am letzten Mittwoch (dem Tag des Generalstreiks) ist ziemlich erhellend: Die GSEE sagte eine vorgesehene Demonstration der streikenden ArbeiterInnen ab, stattdessen gab es eine kurze Kundgebung am Syntagma-Platz, bei der Erstere aus Furcht davor, dass sie vom Virus des Aufstandes angesteckt werden, dafür sorgte, dass die Leute in aller Eile den Platz verließen;
- um diesen Ort, der durch unsere Beiträge errichtet wurde, von dem wir aber ausgeschlossen waren, zum ersten Mal zu einem offenen Ort zu machen. Einem offenen Ort, der die gesellschaftliche Öffnung, die der Aufstand hervorgebracht hat, fortsetzt. All die vielen Jahre haben wir schicksalhaft allen möglichen Heilsverkündern geglaubt und dabei unsere Würde verloren. Als Arbeiter und Arbeiterinnen müssen wir unsere Sache selbst in die Hand nehmen und Schluss damit machen, auf kluge Anführer oder „fähige" Vertreter zu hoffen. Wir müssen unsere Stimme gegen die ständigen Angriffe erheben, uns treffen, miteinander reden, zusammen entscheiden und handeln. Gegen die allgemeinen Angriffe einen langen Kampf führen. Die Entwicklung eines kollektiven Widerstandes an der Basis ist der einzige Weg dazu;
- um die Idee der Selbstorganisation und Solidarität an den Arbeitsplätzen, der Kampfkomitees und des kollektiven Handelns der Basis zu verbreiten und dadurch die Gewerkschaftsbürokratien abzuschaffen.
All die Jahre haben wir das Elend hinuntergeschluckt, die Ausnutzung der Situation der Schwächeren, die Gewalt auf der Arbeit. Wir haben uns daran gewöhnt, die Verkrüppelten und die Toten - die so genannten „Arbeitsunfälle" - einfach nur noch zu zählen. Wir haben uns daran gewöhnt, zu ignorieren, dass die Migranten, unsere Klassenbrüder- und Schwestern, getötet werden. Wir haben die Schnauze voll davon, mit der Angst um unseren Lohn und in Aussicht auf eine Rente zu leben, die sich mittlerweile wie ein in die Ferne entrückter Traum anfühlt.
So wie wir darum kämpfen, unser Leben nicht für die Bosse und die Gewerkschaftsvertreter zu vergeuden, so werden wir auch keinen der verhafteten Aufständischen allein lassen, die sich in den Händen des Staates und der Justizmaschine befinden.
Sofortige Freilassung der Festgenommenen!
Keine Strafe für die Verhafteten!
Selbstorganisation der Arbeiter und Arbeiterinnen!w
Generalstreik!
Die Arbeiter-Versammlung im „befreiten" Gebäude der GSEE
Mittwoch, 17. Dezember 2008, 18:00 Uhr.
Die Vollversammlung der aufständischen ArbeiterInnen
Am Abend versuchten ca. 50 Gewerkschaftsbon-zen und deren Führer, die Gewerkschaftszentrale zurückzuerobern, mussten aber vor den Studenten, die schnell Verstärkung erhielten, die Flucht ergreifen. Diese Verstärkung kam vor allem von meist anarchistischen Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, die ebenfalls besetzt und in einen Ort der Versammlungen und Diskussionen umgewandelt worden war, der auch allen Beschäftigen offen stand. Man eilte den Besetzern zur Hilfe und rief: „Solidarität". Der Verband albanischer Migranten verbreitete u.a. einen Text, in dem er seine Solidarität mit der Bewegung bekundete: „Diese Tage sind auch unsere Tage"!
Bezeichnenderweise veröffentlichte eine kleine Minderheit der Besetzer des Gewerkschaftshauptsitzes folgende Erklärung:
Panagopoulos, der Generalsekretär der GSEE, hat erklärt wir seien nicht Arbeiter, denn Arbeiter seine an der Arbeit. Unter Anderem verrät dies viel über die Wirklichkeit der „Arbeit" von Panagopoulos. Seine „Arbeit" besteht darin zu garantieren, dass die Arbeiter wirklich an der Arbeit sind und alles zu tun, um sie zur Arbeit zu bewegen. Doch in den letzten zehn Tagen waren die Arbeiter nicht an der Arbeit, sie waren draussen auf der Straße. Dies ist die Realität, die kein Panagopoulos auf der ganzen Welt verschweigen kann... Wir sind Leute, die arbeiten, wir sind auch Arbeitslose (die mit dem Verlust unserer Arbeitsplätze für die Beteiligung an den Streiks, welche von der GSEE ausgerufen werden gestraft werden, währen die Vertreter der Gewerkschaften mit Beförderungen belohnt werden), wir arbeiten mit unsicheren Arbeitverträgen in einem Job nach dem anderen, wir arbeiten ohne Sicherheiten in Trainingskursen und Arbeitslosenprogrammen, um die offiziellen Arbeitslosenzahlen tief zu halten. Wir sind ein Teil dieser Welt und wir sind hier.
Wir sind aufrührerische Arbeiter. Unsere Löhne haben wir mit unserem Blut und Schweiss bezahlt, mit Gewalt am Arbeitsplatz, mit Köpfen, Knien, Händen die durch Arbeitsunfälle gebrochen wurden.
Die ganze Welt ist von uns Arbeitern gemacht worden...
Arbeiter des befreiten Gebäudes der GSEE
Immer lauter wurde zu einem unbefristeten Generalstreik aufgerufen. Die Gewerkschaften sahen sich gezwungen, am 18. Dezember zu einem dreistündigen Generalstreik im öffentlichen Dienst aufzurufen.
Am Morgen des 18. Dezember wurde ein weiterer Schüler, 16 Jahre alt, der sich an einem Sit-in in der Nähe seiner Schule in einem Athener Vorort beteiligte, von einer Kugel verletzt. Am gleichen Tag wurden mehrere Radio- und Fernsehstudios durch Demonstranten besetzt, insbesondere in Tripoli, Chania und Thessaloniki. Das Gebäude der Handelskammer in Patras wurde besetzt, wo es erneut zu Zusammenstößen mit der Polizei kam. Die gigantische Demonstration in Athen wurde gewaltsam angegriffen. Dabei setzte die Aufstandsbekämpfungspolizei neue Waffen ein: lähmende Gase und ohrenbetäubende Granaten. Ein Flugblatt, das sich gegen den Staatsterror richtete, wurde von „revoltierenden Schülerinnen" unterzeichnet und in der Wirtschaftswissenschaftlichen Universität verteilt. Die Bewegung spürte ganz vage ihre eigenen geographischen Grenzen. Deshalb nahm sie mit Enthusiasmus die internationalen Solidaritätsdemonstrationen in Frankreich, Berlin, Rom, Moskau, Montreal oder in New York auf. Die Rückmeldung lautete: „Diese Unterstützung ist für uns sehr wichtig". Die Besetzer der Polytechnischen Hochschule riefen zu einem „internationalen Aktionstag gegen die staatlichen Tötungen" am 20. Dezember auf. Der einzige Weg, die Isolierung dieses proletarischen Widerstandes in Griechenland zu überwinden, besteht darin, die Solidarität und den Klassenkampf, die heute als Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise immer deutlicher in Erscheinung treten, international zu entfalten.
Eine Entwicklung in die Zukunft
Am 20. Dezember kam es zu heftigen Zusammenstössen auf der Straße. Sie konzentrierten sich vor allem um die von der Polizei belagerte Polytechnische Hochschule, welche die Polizei stürmen wollte. Das besetzte Gebäude der Gewerkschaft GSEE wurde dieser am 21. Dezember in Folge eines Entscheides des Besetzungskomitees, über den in der Vollversammlung abgestimmt wurde, zurückgegeben. Das Besetzungskomitee der Athener Polytechnischen Hochschule veröffentlichte am 22. Dezember folgende Stellungnahme: „Wir sind für die Emanzipation, die menschliche Würde und die Freiheit. Es ist nicht nötig, uns mit Tränengas zu bekämpfen, wir weinen schon selber genug."
Mit viel Reife und einem Beschluss der Vollversammlung an der Ökonomischen Universität folgend, benutzten die Besetzer dieser Universität den Aufruf zu einer Demonstration am 24. Dezember gegen die polizeiliche Repression und für die Solidarität mit gefangenen Mitstreitern als günstigen Moment zur sicheren und gemeinsamen Evakuierung der Gebäudes: „Es scheint einen Konsens über die Notwendigkeit des Verlassens der Universität zu geben und die Anliegen der Revolte in der ganzen Gesellschaft zu verbreiten." Diesem Beispiel folgten Vollversammlungen an anderen besetzten Universitäten, um nicht in die Falle der Isolierung und direkten Konfrontation mit der Polizei zu geraten. Ein Blutbad und eine noch gewalttätigere Repression wurden damit verhindert. Gleichzeitig verurteilten die Vollversammlungen den Gebrauch von Handfeuerwaffen einer angeblichen Gruppe „Volksaktion" gegen ein Polizeiauto als Provokationsversuch der Polizei.
Das Besetzungskomitee der Polytechnischen Hochschule räumte die letzte Bastion in Athen symbolisch am 24. Dezember um Mitternacht. „Die Vollversammlung, und nur diese alleine, entscheidet, ob und wann wir die Universität verlassen werden (...) Der entscheidende Punkt ist, dass es die Leute sind, die das Gebäude besetzen, die über die Räumung entscheiden, und nicht die Polizei."
Zuvor hatte das Besetzungskomitee eine Erklärung veröffentlicht: „Indem wir unsere Besetzung der Polytechnischen Hochschule nach 18 Tagen beenden, senden wir allen Leuten, die an dieser Bewegung in irgendeiner Art teilgenommen haben, unsere herzlichste „Solidaritätsgrüße". Dies nicht nur in Griechenland, sondern auch in anderen Ländern Europas, Amerikas, Asiens und Australiens. Für Alle, die wir angetroffen haben und mit denen wir weitergehen werden im Kampf für die Befreiung der Gefangenen dieser Bewegung und für deren Weiterführung bis zur sozialen Befreiung der Welt."
In einigen Quartieren hatten sich Einwohner der Lautsprecheranlagen die von der Verwaltung für das Abspielen von Weihnachtsleidern installiert worden waren, bemächtigt um darüber die sofortige Freilassung der Gefangenen, die Entwaffnung der Polizei, die Auflösung der Aufstandbekämpfungs-Sondereinheiten und die Abschaffung der Antiterrorgesetze zu fordern. In Volos wurden die Sendestation des lokalen Radios und die Büros der Lokalzeitung besetzt, um darin über die Ereignisse und ihre Auswirkungen zu berichten. In Lesvos hatten Demonstranten Lautsprecher im Stadtzentrum aufgestellt und darüber Nachrichten verbreitet. In Ptolemaida und Ioannina wurde ein Weihnachtsbaum mit Fotos des ermordeten Schülers und der Demonstrationen und mit Forderungen der Bewegung dekoriert.
Das Gefühl der Solidarität drückte sich spontan und mächtig am 23. Dezember erneut aus, nachdem eine Angestellte der Reinigungsfirma Oikomet, die für die Athener Metro arbeitet, attackiert worden war. Auf ihrem Nachhauseweg von der Arbeit war ihr Essigsäure ins Gesicht geschüttet worden. Solidaritätsdemonstrationen fanden statt und das Verwaltungsgebäude der Athener Metro wurde am 27. Dezember besetzt. In Thessaloniki wurde das Hauptquartier der Gewerkschaft GSEE besetzt. Aus diesen zwei Besetzungen wurden mehrere Demonstrationen, Solidaritätskonzerte und „Gegeninformations"-Veranstaltungen organisiert (so wurden z.B. die Lautsprecher der Metro verwendet, um Erklärungen zu verlesen).
Die Vollversammlung in Athen erklärte in einem Text: „Wenn sie einen von uns angreifen, dann greifen sie uns alle an!
Heute haben wir die Büros der ISAP (Metro von Athen) besetzt, als eine erste Antwort auf die mörderische Essigsäureattacke gegen Konstantina Kuneva, als sie am 23. Dezember von der Arbeite nach Hause ging. Konstantina befindet sich auf der Intensivpflegestation des Spitals. In der vorangegangnen Woche befand sie sich in einem Streit mit der Firma, um eine volle Entlöhnung der Weihnachtstage für sich und ihre Arbeitskollegen zu erhalten und sie denunzierte dabei die illegalen Praktiken der Bosse. Zuvor wurde ihre Mutter von derselben Firma entlassen. Sie selbst wurde an einen weit weg gelegenen Arbeitsplatz versetzt. Das sind sehr verbreitete Praktiken in den Reinigungsunternehmen, die sehr prekäre Arbeitsplätze haben. Der Besitzer von Oikomet ist ein Mitglied der PASOK (der Griechischen Sozialistischen Partei). Sie beschäftigen offiziell 800 Angestellte (doch die Angestellten sagten, es sei das Doppelte, denn während der letzten 3 Jahre hatten dort mehr als 3000 Leute gearbeitet). Das illegale mafiöse Vorgehen der Bosse dieser Firma ist Alltag. So sind die Angestellten gezwungen, illegale Verträge zu unterschreiben (bei denen die Bedingungen erst nachher von den Bossen eingetragen werden) und sie haben keine Möglichkeit, dies zu widerrufen. Sie arbeiten 6 Stunden, werden aber nur für 4.5 Stunden bezahlt (Nettolohn), so dass sie niemals 30 Stunden pro Woche überschreiten (denn sonst müssten sie in einer höheren Risikoklasse eingestuft werden). Die Bosse terrorisieren sie, versetzen sie, schmeissen sie raus oder drängen sie zu Kündigungen. Der Kampf um die WÜRDE und SOLIDARITÄT ist UNSER Kampf."
Parallel dazu veröffentlichte die Vollversammlung der Besetzer der GSEE in Thessaloniki folgenden Text: „Heute haben wir den Hauptsitz der Gewerkschaften in Thessaloniki besetzt, um gegen die Unterdrückung zu protestieren, die die Form von Mord und Terrorismus gegen die Arbeiter annimmt (...) Wir rufen alle Arbeiter auf, sich diesem gemeinsamen Kampf anzuschließen (...) Die offene Versammlung derjenigen, die den Hauptsitz der Gewerkschaft besetzen, Leute von verschiedenen politischen Richtungen, Mitglieder der Gewerkschaften, Studenten, Immigranten und Freunde die vom Ausland kommen und hinter diesen gemeinsamen Forderungen stehen, haben einen Beschluss gefasst:
- Fortführung der Besetzung;
- Die Organisierung einer Vollversammlung in Solidarität mit Konstantina Kuneva;
- Das Organisieren von Aktionen, um Informationen und Aufmerksamkeit in der Stadt zu verbreiten;
- Das Durchführen eines Konzertes im Stadtzentrum, um Geld für Konstantina zu sammeln."
Diese Versammlung erklärte ebenfalls: „In den Grundsatzpapieren der Gewerkschaften werden nirgends die Ungleichheit, Armut und die hierarchischen Strukturen der Gesellschaft in Frage gestellt (...) Die Gewerkschaftsbünde und Führungen der Gewerkschaften in Griechenland sind ein fester Bestandteil des Regimes, welches an der Macht ist. Ihre Basismitglieder sollten ihnen den Rücken kehren (...) und für einen selbständigen Pol des Kampfes, den sie selber bestimmen, eintreten (...) Wenn die Arbeiter ihren Kampf in die eigenen Hände nehmen und mit der Logik brechen, sich von den Komplizen der Bosse vertreten zu lassen, dann werden sie ihr Selbstbewusstsein wieder finden und Tausende werden in den nächsten Streiks auf die Straßen strömen. Der Staat und seine Handlanger sind Mörder.
Selbstorganisierung! Kampf zur Verteidigung der sozialen Interessen! Solidarität mit den Immigranten und mit Konstantina Kuneva!"
Anfangs Januar 2009 fanden immer noch Demonstrationen im ganzen Land statt, um die Solidarität mit den Gefangenen auszudrücken. 246 Leute waren verhaftet worden und 66 wurden in Präventivhaft genommen. In Athen wurden in den ersten drei Tagen der Bewegung 50 Immigranten festgenommen, in Prozessen ohne Anwalt bis zu maximal 18 Monaten Haft verurteilt und alle mit der Ausweisung bestraft.
Am 9. Januar ereigneten sich nach einem Protestmarsch von 3000 Lehrern, Studenten und Kindern erneut Zusammenstöße zwischen Jugendlichen und der Polizei. Sie trugen Slogans mit sich wie: „Geld für die Ausbildung, nicht für die Banker", „Nieder mit der Regierung der Mörder und der Armut". Polizei-Sondereinheiten versuchten, sie immer wieder zu verjagen, und machten zahlreiche Festnahmen.
In Griechenland, wie überall sonst auch, hat der kapitalistische Staat angesichts der Prekarisierung, Arbeitslosigkeit und Armut, die durch die weltweite Krise verstärkt werden, nur mehr Polizei und Repression anzubieten. Nur die internationale Entwicklung des Kampfes, die Solidarität zwischen Industriearbeitern und Büroangestellten, zwischen Voll- und Teilzeitbeschäftigten, Schülern, Studenten, Arbeitslosen, Rentnern - über alle Generationen hinweg - kann den Weg zur Überwindung dieses Ausbeutungssystems und zu einer neuen Perspektive öffnen.
W., 18.1. 2009
[1] Marianne Nr. 608, 13. Dezember 2008 : „Grèce : les leçons d'une émeute".
[2] Libération, 12. Dezember 2008.
[3] Le Monde , 10. Dezember 2008.
[4] Marianne, s.o.
Geographisch:
- Griechenland [30]
Aktuelles und Laufendes:
Theoretische Fragen:
- Arbeiterklasse [35]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Proletarischer Kampf [36]
Interne Debatte in der IKS (II): Die Ursachen für die Aufschwungperiode nach dem Zweiten Weltkrieg
- 6282 reads
Dieser Beitrag unterstützt die in Nr. 42 vorgestellte These unter dem Titel „keynesianisch-fordistischer Staatskapitalismus" und schreibt die Schaffung einer zahlungsfähigen Nachfrage während des Nachkriegsbooms im wesentlichen den keynesianischen Mechanismen zu, die von der Bourgeoisie installiert worden waren. In den folgenden Ausgaben der Revue werden wir Artikel veröffentlichen, die andere Positionen in der Debatte vertreten und auf diese Position antworten, insbesondere bezüglich des Charakters der kapitalistischen Akkumulation und der Faktoren, die den Eintritt des Kapitalismus in seine dekadente Phase bestimmen.
Die Ursprünge, Dynamiken und Grenzen des keynesianisch-fordistischen Staatskapitalismus
1952 beendeten unsere Vorgänger in der GCI[1] die Aktivitäten ihrer Gruppe, weil das „Verschwinden der außerkapitalistischen Märkte (...) zu einer permanenten Krise des Kapitalismus führt (...) Wir können hier die ins Auge fallende Bestätigung von Rosa Luxemburgs Theorie sehen (...) In der Tat sind die Kolonien nicht mehr ein außerkapitalistischer Markt für das koloniale Mutterland (...) Wir leben in einem Zustand des drohenden Krieges..."[2] Geschrieben am Vorabend des Nachkriegsbooms, enthüllen diese wiederholten Fehler die Notwendigkeit, über die „ins Auge fallende Bestätigung von Rosa Luxemburgs Theorie" hinauszugehen und zu einem kohärenteren Verständnis der Funktionsweise und Grenzen des Kapitalismus zurückzukehren. Dies ist das Ziel dieses Artikels.
I. Die Triebkräfte und inneren Widersprüche des Kapitalismus
1) Die Zwänge einer erweiterten Reproduktion und ihre Grenzen
Die Aneignung von Mehrarbeit ist fundamental für das Überleben des Kapitalismus.[3] Anders als die vorhergehenden Gesellschaften besitzt die kapitalistische Aneignung ihre eigene, eingebaute, permanente Dynamik in Richtung Expansion des Produktionsumfangs, die weit über die einfache Reproduktion hinausgeht. Sie erzeugt eine wachsende gesellschaftliche Nachfrage durch die Beschäftigung von neuen Arbeitern und die Investition in zusätzliche Produktions- und Konsumtionsmittel: „Diese Grenzen der Konsumtion werden erweitert durch die Anspannung des Reproduktionsprozesses selbst; einerseits vermehrt sie den Verzehr von Revenue durch Arbeiter und Kapitalisten, andrerseits ist sie identisch mit Anspannung der produktiven Konsumtion."[4] Diese Ausbreitungsdynamik nimmt die Form einer Abfolge von Zyklen an, in denen, grob gesagt alle zehn Jahre die periodische Zunahme des fixen Kapitals dazu tendiert, die Profitrate zu verringern und Krisen hervorzurufen.[5] Während dieser Krisen schaffen Bankrotte und Wertminderung des Kapitals die Bedingungen für eine Erholung, die die Märkte und das Produktionspotenzial erweitert: „Die Krisen sind immer nur momentane gewaltsame Lösungen der vorhandnen Widersprüche, gewaltsame Eruptionen, die das gestörte Gleichgewicht für den Augenblick wiederherstellen (...) Die eingetretne Stockung der Produktion hätte eine spätere Erweiterung der Produktion - innerhalb der kapitalistischen Grenzen - vorbereitet. Und so würde der Zirkel von neuem durchlaufen. Ein Teil des Kapitals, das durch Funktionsstockung entwertet war, würde seinen alten Wert wiedergewinnen. Im übrigen würde mit erweiterten Produktionsbedingungen, mit einem erweitertem Markt und mit erhöhter Produktivkraft derselbe fehlerhafte Kreislauf wieder durchgemacht werden."[6] Die Graphik Nr. 1 veranschaulicht treffend all die Elemente dieses theoretischen Rahmens, der von Marx herausgearbeitet worden war: Alle zehn Zyklen der steigenden und fallenden Profitrate enden in einer Krise (Rezession):
Die kapitalistische Akkumulation in den mehr als zwei Jahrhunderten fand im Rhythmus von gut dreißig Zyklen und Krisen statt. Marx identifizierte sieben zeit seines Lebens, die Dritte Internationale sechzehn[7], und die Linke in der Internationale vervollständigte das Bild in der Zwischenkriegsphase.[8] Dies ist die immer wiederkehrende materielle Grundlage für die Zyklen der Überproduktion, deren Ursprünge wir nun untersuchen werden.[9]
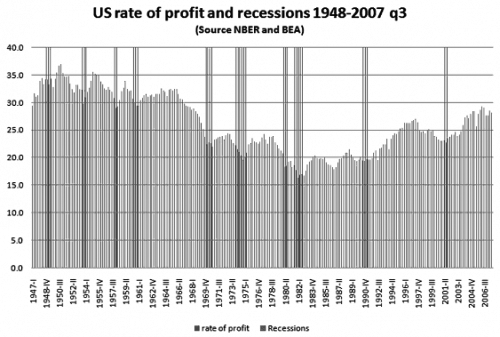
Grafik 1: Quartalsweise die Profitraten und Rezessionen in den USA von 1948 bis 2007.
2) Der Kreislauf der Akkumulation - ein Spiel in zwei Akten: die Produktion von Profit und die Realisierung von Waren
Die Abpressung eines Maximums an Mehrarbeit, kristallisiert in einer wachsenden Warenmenge, bildet das, was Marx den „ersten Akt des kapitalistischen Produktionsprozesses" nannte. Diese Waren mussten anschließend verkauft werden, um die im Mehrwert materialisierte Mehrarbeit in die Form von Geld zur Neuinvestition umzuwandeln: Dies ist der „zweite Akt des Prozesses". Jeder dieser beiden Akte enthält seine eigenen Widersprüche und Grenzen. Obwohl sie sich gegenseitig beeinflussen, wird der erste Akt vor allem durch die Profitrate angetrieben, während der zweite eine Funktion der mannigfaltigen Tendenzen ist, die den Markt begrenzen.[10] Diese beiden Einschränkungen erzeugen periodisch eine Nachfrage, die unfähig ist, die gesamte Produktion zu absorbieren: „Die Überproduktion speziell hat das allgemeine Produktionsgesetz des Kapitals zur Bedingung, zu produzieren im Maße der Produktivkräfte (d.h. der Möglichkeit, mit gegebner Masse Kapitals größtmöglichste Masse Arbeit auszubeuten) ohne Rücksicht auf die vorhandnen Schranken des Marktes oder der zahlungsfähigen Bedürfnisse...."[11]
Wo liegt der Ursprung dieser unzureichenden zahlungsfähigen Nachfrage?
In der eingeschränkten Konsumtionsfähigkeit der Gesellschaft, die durch die antagonistischen Verhältnisse bei der Aufteilung der Mehrarbeit (Klassenkampf) begrenzt wird: „Der letzte Grund aller wirklichen Krisen bleibt immer die Armut und Konsumtionsbeschränkung der Massen gegenüber dem Trieb der kapitalistischen Produktion, die Produktivkräfte so zu entwickeln, als ob nur die absolute Konsumtionsfähigkeit der Gesellschaft ihre Grenze bilde."[12]
In den Grenzen, die aus dem Akkumulationsprozess resultieren, der den Konsum reduziert, sobald die Profitrate fällt: Der im Verhältnis zum investierten Kapital unzureichende Mehrwert, der extrahiert wurde, bremst die Investitionen und die Beschäftigung neuer Arbeitskräfte: „Die Schranke der kapitalistischen Produktionsweise tritt hervor: 1. Darin, daß die Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit im Fall der Profitrate ein Gesetz erzeugt, das ihrer eignen Entwicklung auf einen gewissen Punkt feindlichst gegenübertritt und daher beständig durch Krisen überwunden werden muß..."[13]
In einer unvollständigen Realisierung des Gesamtprodukts, wenn die Proportionen zwischen den Produktionssektoren nicht beachtet werden.[14]
3) Eine dreifache Schlussfolgerung über die inneren Widersprüche und die Dynamik des Kapitalismus
In seinem gesamten Werk unterstreicht Marx konstant diese zweifach geartete Ursache von Krisen, deren Bestimmungen im Grunde unabhängig sind: „Die moderne Überproduktion beruht einerseits auf der absoluten Entwicklung der Produktivkräfte und folglich der massenhaften Produktion durch Produzenten, die im Kreislauf der notwendigen Lebensmittel eingeschlossen sind, und andererseits der Begrenzung durch den Profit der Kapitalisten."[15] In der Tat: auch wenn das Niveau und der wiederkehrende Fall der Profitrate wechselseitig die Weise beeinflussen, in welcher der Mehrwert verteilt wird, besteht Marx nichtsdestotrotz darauf, dass diese beiden Grundursachen fundamental „unabhängig", „begrifflich auseinanderfallend", „nicht identisch" sind.[16] Warum das? Einfach weil die Profitproduktion und die Märkte zum größten Teil unterschiedlichen Bedingungen ausgesetzt sind. Daher lehnt Marx kategorisch jede Theorie ab, die die Krisen auf eine einzige Ursache zurückführt.[17] Es ist also ein theoretischer Fehler, die Entwicklung der Profitrate strikte vom Umfang des Marktes abhängig zu machen oder umgekehrt. Daraus folgt, dass diese beiden Hauptursachen je ihre eigene zeitliche Logik haben. Der erste Widerspruch (die Profitrate) hat seine Wurzeln in der Notwendigkeit, das konstante Kapital auf Kosten des variablen Kapitals zu erhöhen, und sein zeitlicher Ablauf ist somit im Wesentlichen an die Zyklen gebunden, in denen das fixe Kapital rotiert. Da der zweite Widerspruch sich um die Verteilung von Mehrarbeit dreht, wird seine Zeitebene durch das Kräfteverhältnis zwischen den Klassen bestimmt, das sich über längere Perioden erstreckt.[18] Auch wenn diese beiden Zeitebenen zusammenfallen können (der Akkumulationsprozess beeinflusst das Kräfteverhältnis zwischen den Klassen und umgekehrt), sind sie dennoch fundamental „unabhängig", „begrifflich auseinanderfallend", „nicht identisch", denn der Klassenkampf ist nicht strikt an die Zehnjahreszyklen gebunden, und Letztere sind nicht mit dem Kräfteverhältnis zwischen den Klassen verknüpft.
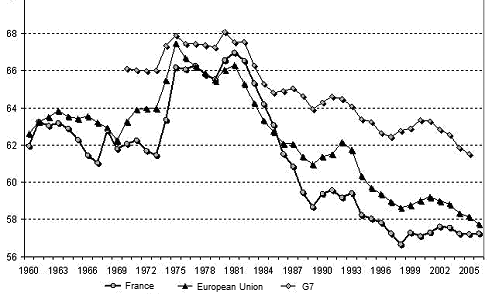
Grafik 2: Die Löhne im Verhältnis zum gesammten Vermögen in den G7, EU und Frankreich.
II. Eine empirische Bestätigung der marxistischen Theorie der Überproduktionskrisen
Die Zeit seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges bis heute ist ein gutes Beispiel, um die Marxsche Analyse der Überproduktionskrisen und ihrer drei Implikationen zu bestätigen. Insbesondere erlaubt sie uns, die Unrichtigkeit aller wKrisentheorien zu beweisen, die sich auf eine einzige Ursache berufen, ob es nun um die Theorie geht, die sich allein auf die fallende Profitrate stützt und die nicht in der Lage ist zu erklären, warum Akkumulation und Wachstum nicht wieder anspringen trotz der Tatsache, dass die Profitrate ein Vierteljahr lang gestiegen ist, oder jene Theorie, die auf der Sättigung der zahlungsfähigen Nachfrage basiert und die nicht den Anstieg der Profitrate erklären kann, da die Märkte völlig ausgezehrt sind (was sich eigentlich in einer Nullprofitrate ausdrücken müsste). All dies kann leicht aus den beiden Graphiken (Nr. 1 und Nr. 3) ersehen werden, die die Entwicklung der Profitrate zeigen.
Die Ermüdung des Nachkriegsboom und das sich verschlechternde wirtschaftliche Klima zwischen 1969-82 sind im Wesentlichen eine Folge des Rückganges der Profitrate[19], trotz der Tatsache, dass der Konsum durch die Indexierung der Löhne und durch Maßnahmen zur Stützung der Nachfrage aufrecht gehalten wurde[20]. Die Produktivitätssteigerungen sanken ab Ende der 60er Jahre[21] und halbierten die Profitrate ab 1982 (s. Graphik Nr. 3). Seither ist eine Erholung der Profitrate nur noch durch die Steigerung der Mehrwertrate (sinkende Löhne und wachsende Ausbeutung) möglich gewesen. Dies implizierte eine unvermeidliche Deregulierung der Schlüsselmechanismen, die das Wachstum in der Endnachfrage während des Nachkriegsbooms gesichert hatten (siehe unten). Dieser Prozess begann Anfang der 1980er Jahre und kann insbesondere im konstanten Fall der Löhne im Verhältnis zum gesamten hergestellten Reichtum betrachtet werden.
Überall lastete schließlich in den 70er Jahren der „Profitraten"-Widerspruch auf dem Kapitalismus, während die Endnachfrage aufrechterhalten wurde. Die Situation kehrte sich ab 1982 in ihr Gegenteil um: Die Profitrate hatte sich spektakulär erholt, aber zum Preis einer drastischen Zusammenpressung der Endnachfrage (des Marktes): im Wesentlichen der Lohnempfänger (siehe Graphik Nr. 2), aber auch (in einem geringeren Umfang) der Investitionen, da die Akkumulationsrate auf ihrem niedrigen Stand verblieben war (siehe Graphik Nr. 3).
Dadurch können wir nun verstehen, warum der wirtschaftliche Niedergang sich trotz einer wiederhergestellten Profitrate fortsetzt: Das Unvermögen von Wachstum und Akkumulation, wieder an Schwung zu gewinnen, trotz einer spektakulären Verbesserung in der Betriebsrentabilität, erklärt sich aus der Zusammenpressung der Endnachfrage (Löhne und Investitionen). Diese drastische Reduzierung der Endnachfrage führt zu einer lustlosen Investition in die erweiterte Akkumulation, zu fortgesetzter Rationalisierung durch Konzernübernahmen und -verschmelzungen, ungenutztem Kapital, das in die Finanzspekulation strömt, Verlagerung von Industrien auf der Suche nach billiger Arbeitskraft - was die allgemeine Nachfrage noch weiter drückt.
Was die Wiederherstellung der Endnachfrage angeht, so ist sie unter den gegenwärtigen Bedingungen kaum möglich, da das Wachstum der Profitrate davon abhängt, sie niedrig zu halten! Seit 1982 ist es also im Rahmen verbesserter Betriebsrentabilität die „Begrenzung der zahlungsfähigen Märkte" bzw. ihre Zeitebene, die die wesentliche Rolle bei der Erklärung der fortgesetzten Lustlosigkeit der Akkumulation und des Wachstums spielen, selbst wenn Fluktuationen in der Profitrate kurzfristig durchaus einen wichtigen Anteil bei der Auslösung von Rezessionen haben können, wie wir unschwer aus den Graphiken N. 1 und Nr. 3 ersehen können.
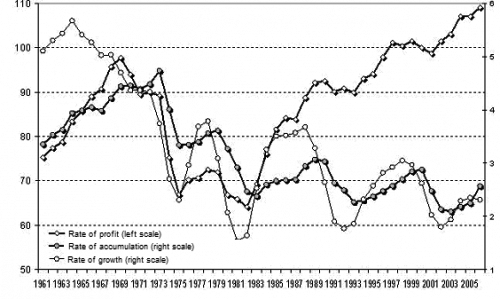
Grafik 3: Profitrate, Akkumulationsrate und ökonomisches Wachstum in den USA, Europa und Japan zwischen 1961 und 2006.
III. Der Kapitalismus und seine Umgebung
Die Dynamik des Kapitalismus zur Vergrößerung verleiht ihm notwendigerweise einen fundamental expansiven Charakter: „Der Markt muß daher beständig ausgedehnt werden, so daß seine Zusammenhänge und die sie regelnden Bedingungen immer mehr die Gestalt eines von den Produzenten unabhängigen Naturgesetzes annehmen, immer unkontrollierbarer werden. Der innere Widerspruch sucht sich auszugleichen durch Ausdehnung des äußern Feldes der Produktion. Je mehr sich aber die Produktivkraft entwickelt, um so mehr gerät sie in Widerstreit mit der engen Basis, worauf die Konsumtionsverhältnisse beruhen."[22] Als Marx all die Dynamiken und Grenzen des Kapitalismus aufzeigte, tat er dies, indem er von den Beziehungen des Kapitalismus zur äußeren (nicht-kapitalistischen) Sphäre abstrahierte. Wir müssen nun verstehen, worin die Rolle und Bedeutung Letzterer in der Entwicklung des Kapitalismus liegen. Der Kapitalismus kam zur Welt und entwickelte sich innerhalb des Rahmens feudaler, dann merkantiler gesellschaftlicher Verhältnisse, zu denen er unvermeidlicherweise wichtige Bande unterhielt, um an die Mittel seiner eigenen Akkumulation zu gelangen (Import von kostbaren Metallen, Ausplünderungen, etc.), um seine eigenen Waren abzusetzen (Direktverkauf, Atlantischer Dreieckshandel, etc.) und als Quelle der Ware Arbeitskraft.
Auch nachdem die Fundamente des Kapitalismus nach drei Jahrhunderten der ursprünglichen Akkumulation (1500-1825) gesichert waren, im Grunde in der gesamten aufsteigenden Periode, bot dieses Milieu weiterhin eine ganze Reihe von Gelegenheiten als Profitquelle, als Ventil für den Verkauf von Waren aus der Überproduktion und als zusätzliche Quelle von Arbeitskräften. All diese Gründe erklären die imperialistische Jagd nach Kolonien zwischen 1880 und 1914.[23] Jedoch bedeutet die Existenz einer externen Regulierung eines Teils der internen Widersprüche des Kapitalismus weder, dass jene für seine Entwicklung die wirksamsten gewesen wäre, noch, dass der Kapitalismus absolut außerstande wäre, interne Regulierungsmethoden zu schaffen. Es ist zuallererst die Ausweitung und Herrschaft der Lohnarbeit auf seinen eigenen Fundamenten, die es dem Kapitalismus fortschreitend ermöglichen, sein Wachstum dynamischer zu gestalten. Und auch wenn die vielfältigen Beziehungen zwischen dem Kapitalismus und der außerkapitalistischen Sphäre ihm eine ganze Reihe von Gelegenheiten verschafften, so war die Größe dieses Milieus und die allgemeine Bilanz seines Austausches mit dieser Sphäre nichtsdestotrotz eine Bremse für sein Wachstum.[24]
IV. Die historische Überlebtheit der kapitalistischen Produktionsweise und die Grundlage ihrer Aufhebung
Diese gewaltige Dynamik der internen und externen Expansion des Kapitalismus ist dennoch nicht ewig. Wie jede Produktionsweise in der Geschichte durchläuft auch der Kapitalismus eine Phase der Veraltung, in der seine gesellschaftlichen Verhältnisse die Entwicklung seiner Produktivkräfte bremsen.[25]
Wir müssen daher nach den historischen Grenzen der kapitalistischen Produktionsweise innerhalb der Umwandlung und Generalisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse der Lohnarbeitsproduktion suchen. Auf einer bestimmten Stufe bilden die Ausweitung der Lohnarbeit und ihre durch die Herstellung des Weltmarktes erreichte allgemeine Herrschaft den Kulminationspunkt des Kapitalismus. Statt fortzufahren, alte gesellschaftliche Verhältnisse auszurotten und die Produktivkräfte weiterzuentwickeln, neigt der nun obsolete Charakter des Lohnarbeitsverhältnisses dazu, jene einzufrieren und diese zu bremsen: Er bleibt unfähig, die ganze Menschheit in sein Verhältnis zu integrieren (große Teile werden nicht integriert), er erzeugt Krisen, Kriege und Katastrophen von immer größeren Ausmaßen, und dies bis zu dem Punkt, wo er die Menschheit mit der Auslöschung bedroht.
1) Die Überlebtheit des Kapitalismus
Die fortschreitende Verallgemeinerung der Lohnarbeit bedeutet nicht, dass sie überall Wurzeln gefasst hat, weit entfernt davon, aber sie bedeutet, dass ihre Vorherrschaft auf der Welt eine wachsende Instabilität schafft, in der sämtliche Widersprüche des Kapitalismus ihren höchsten Ausdruck finden. Der Erste Weltkrieg eröffnete dieses Zeitalter großer Krisen, deren vorherrschender Ausdruck darin besteht, dass die Krisen weltweit und in den Lohnarbeitsverhältnissen verankert sind: a) Der nationale Rahmen ist zu eng geworden, um den Ansturm der Widersprüche des Kapitalismus aufzufangen; b) die Welt bietet nicht mehr genug Gelegenheiten und Stoßdämpfer, die den Kapitalismus mit einer äußeren Regulierung seiner inneren Widersprüche versorgen; c) nachträglich betrachtet enthüllt das Scheitern der Regulierung, die während des Nachkriegsbooms eingeführt wurde, die historische Unfähigkeit des Kapitalismus, auf lange Frist seine eigenen Widersprüche in Ordnung zu bringen, die folglich mit immer barbarischerer Gewalt ausbrechen.
In dem Sinne, dass er ein Weltkonflikt war, nicht zur Eroberung neuer Einflusssphären, Investitionszonen und Märkte, sondern zur Umverteilung jener, die bereits existierten, markierte der Erste Weltkrieg den endgültigen Eintritt der kapitalistischen Produktionsweise in die Phase ihrer Überalterung. Die beiden zunehmend zerstörerischen Weltkriege, die größte je auftretende Überproduktionskrise (1929-1933), die starke Einschränkung des Wachstums der Produktivkräfte zwischen 1914 und 1945, die Unfähigkeit des Kapitalismus, einen großen Teil der Menschheit zu integrieren, die Entwicklung des Militarismus und Staatskapitalismus über den gesamten Planeten, das zunehmende Wachstum der unproduktiven Ausgaben und die historische Unfähigkeit des Kapitalismus, seine eigenen Widersprüche intern zu stabilisieren - all diese Phänomene sind materielle Ausdrücke dieser historischen Überlebtheit der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse, die auf der Lohnarbeit fußen und die der Menschheit nichts anderes anzubieten haben als eine Perspektive der wachsenden Barbarei.
2) Katastrophaler Zusammenbruch oder eine historische, materialistische und dialektische Sichtweise der Geschichte?
Die Überlebtheit des Kapitalismus impliziert nicht, dass er zu einem katastrophalen Zusammenbruch verdammt ist. Es gibt keine vordefinierten, quantitativen Grenzen innerhalb der Produktionsverhältnisse des Kapitalismus (ob es die Profitrate ist oder eine gegebene Menge an außerkapitalistischen Märkten), die den ominösen Punkt bestimmen, jenseits dessen die kapitalistische Produktion stirbt. Die Grenzen der Produktionsverhältnisse sind vor allem gesellschaftlich, das Produkt ihrer inneren Widersprüche und dem Zusammenstoss zwischen diesen nun obsoleten Verhältnissen und den Produktivkräften. Von nun an ist es das Proletariat, das den Kapitalismus abschaffen wird, der Kapitalismus wird nicht von selbst als Resultat seiner ‚objektiven‘ Grenzen sterben. Während der Überalterung des Kapitalismus wirken dieselben Tendenzen und Dynamiken, die Marx analysierte, fort, aber sie tun dies in einem völlig veränderten allgemeinen Kontext. All die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Widersprüche erscheinen unvermeidlich auf einer höheren Stufe, ob in den sozialen Kämpfen, die regelmäßig die Frage der Revolution stellen, oder in imperialistischen Konflikten, die die eigentliche Zukunft der Menschheit bedrohen. Mit anderen Worten: Die Welt hat das „Zeitalter der Kriege und Revolutionen" betreten, das von der Dritten Internationale angekündigt worden war.
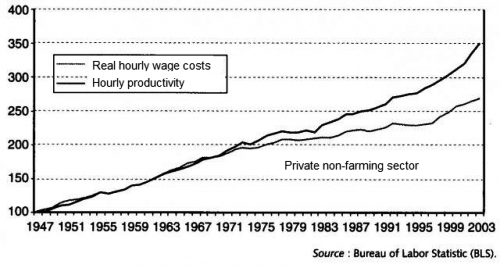
Grafik 4: Löhne und Produkitivtät in den Vereinigten Staaten.
Kommentar zu dieser Grafik: Der Anstieg der Produktivität und der Löhne stieg in gleicher Dynamik nach
dem Zweiten Weltkrieg. Nach 1980 gab es Unterschiede im Wachstum von Produktivität und dem Lohn. Seit
der Kapitalismus begann, war dieses unterschiedliche Wachstum die Regel und die Parallelität während dem
Nachkriegsboom die Ausnahme. In der Tat, diese Unterschiedlichkeit ist ein realer Ausdruck der Tendenz im
Kapitalismus, dass die Produkitivtät (obere Linie), über die Steigerung der Kaufkraft steigt (untere Linie).
V. Keynesianisch-fordistischer Staatskapitalismus: das Fundament des Nachkriegsbooms
Marxisten haben keinen Anlass, angesichts von Erholungsphasen, die in einer Überlebtheit der Produktionsweise durchaus stattfinden, irritiert zu sein: Wir können dies zum Beispiel bei der Rekonstituierung des Römischen Reiches unter Karl dem Großen sehen oder bei der Formierung der großen Monarchien während des Ancien Régime. Wenn ein Fluss mäandriert, bedeutet dies noch nicht, dass er aufwärts und weg vom Meer fließt! Dasselbe trifft auf den Nachkriegsboom zu: Die Bourgeoisie erwies sich als fähig, eine kurze Phase starken Wachstums im allgemeinen Verlauf der Überlebtheit zu kreieren.
Die Große Depression von 1929 in den Vereinigten Staaten zeigte, wie gewaltsam die Widersprüche des Kapitalismus in einer Wirtschaft ausbrechen, die von der Lohnarbeit bestimmt wird. Man mag daher erwartet haben, dass ihr immer gewaltsamere und häufigere Wirtschaftskrisen folgen werden, aber dies war nicht der Fall. Die Situation hat sich beträchtlich weiterentwickelt, sowohl im Produktionsprozess (Fordismus) als auch im Kräfteverhältnis zwischen den Klassen (und innerhalb derselben). Darüber hinaus hat die Bourgeoisie gewisse Lehren gezogen. Den Jahren der Krise und der Barbarei des Zweiten Weltkrieges folgten somit gute dreißig Jahre eines starken Wachstums, eine Vervierfachung der Reallöhne, Vollbeschäftigung, die Schaffung eines Soziallohns und die Fähigkeit des Systems, die zyklischen Krisen zwar nicht zu vermeiden, aber auf sie zu reagieren. Wie war dies alles möglich?
1) Die Fundamente des keynesianisch-fordistischen Staatskapitalismus
Von nun an musste der Kapitalismus mangels adäquater Ventile für seine Widersprüche eine interne Lösung für seine zweifache Beschränkung auf der Ebene der Profite und der Märkte zu finden. Die hohe Profitrate wurde durch die großen Steigerungen in der Arbeitsproduktivität dank des industriellen Fordismus (Fließband kombiniert mit Schichtarbeit) ermöglicht. Und die Märkte, auf denen diese enormen Warenmengen verkauft werden sollten, wurden durch die Ausweitung der Produktion, durch Staatsinterventionen und vielfältige Systeme zur Koppelung der Reallöhne an die Produktivität garantiert. Dies ermöglichte es, die Nachfrage parallel zur Produktion zu steigern (s. Graphik Nr. 4). Durch die Stabilisierung des Lohnanteils am Gesamtvermögen war der Kapitalismus somit eine Zeitlang in der Lage die Überproduktion zu vermeiden, die „(...) grade daraus hervor[geht], dass die Masse des Volks nie mehr als die average quantity of necessaries [durchschnittliche Menge der lebenswichtigen Güter] konsumieren kann, ihre Konsumtion also nicht entsprechend wächst mit der Produktivität der Arbeit."[26]
Diese Analyse wurde von Paul Mattick und anderen Revolutionären damals übernommen, um die Nachkriegsprosperität zu analysieren: „Es ist unleugbar, dass die Löhne in der modernen Epoche gestiegen sind. Aber nur im Rahmen der Kapitalexpansion, die voraussetzt, dass das Verhältnis der Löhne zu den Profiten im Allgemeinen konstant bleibt. Die Arbeitsproduktivität sollte daher mit einer Schnelligkeit wachsen, die es ermöglichen würde, sowohl Kapital zu akkumulieren und den Lebensstandard der Arbeiter anzuheben."[27] Dies ist der wirtschaftliche Hauptmechanismus des keynesianisch-fordistischen Staatskapitalismus. Er wird von der parallelen Entwicklung der Löhne und der Arbeitsproduktivität während dieser Periode empirisch bestätigt.
Den spontanen Dynamiken des Kapitalismus entsprechend (Konkurrenz, Lohndruck, etc.), kann ein solches System nur in der Zwangsjacke eines Staatskapitalismus lebensfähig sein, der vertraglich eine Dreiteilung der Resultate der gestiegenen Produktivität zwischen den Profiten, Löhnen und Staatseinkünften garantiert. Eine Gesellschaft, die vom Lohnarbeitsverhältnis beherrscht wird, zwingt der gesamten Politik de facto eine gesellschaftliche Dimension auf, die von der herrschenden Klasse angenommen wurde. Dies setzt die Errichtung von vielfältigen sozialen und wirtschaftlichen Kontrollen, von gesellschaftlichen Stoßdämpfern, etc. voraus. Zweck dieser beispiellosen Aufblähung des Staatskapitalismus war es, die explosiven gesellschaftlichen Widersprüche des Systems innerhalb der Grenzen der kapitalistischen Ordnung aufzufangen: Vorherrschaft der Exekutive über die Legislative, bedeutsame Steigerung der Staatsinterventionen in der Wirtschaft (fast die Hälfte des BSP in den OECD-Ländern), gesellschaftliche Kontrolle der Arbeiterklasse, etc.
2) Ursprünge, Widersprüche und Grenzen des keynesianisch-fordistischen Staatskapitalismus
Nach der deutschen Niederlage in Stalingrad (Januar 1943) begannen die politischen, gewerkschaftlichen und Arbeitgeberrepräsentanten im Londoner Exil intensive Diskussionen über die Reorganisation der Gesellschaft nach dem nun unvermeidbaren Zusammenbruch der Achsenmächte. Die Erinnerung an die Jahre der Depression und die Furcht vor sozialen Bewegungen am Ende des Krieges, die aus der Krise von 1929 gezogenen Lehren, die immer breitere Akzeptanz der Notwendigkeit von Staatsinterventionen und die durch den Kalten Krieg geschaffene Bipolarität sollten die Elemente sein, die die Bourgeoisie dazu veranlassten, die Spielregeln zu modifizieren und mehr oder weniger bewusst diesen keynesianisch-fordistischen Staatskapitalismus auszuarbeiten, der sich als praktikabel erwies und nach und nach in allen entwickelten Ländern (OECD) eingepflanzt wurde. Die Verteilung der Produktivitätssteigerungen wurde von allen um so leichter akzeptiert, als: a) sie stark anstiegen, b) diese Neuverteilung die Steigerung der zahlungsfähigen Nachfrage parallel zur Produktion garantierte, c) sie den sozialen Frieden bot, d) der soziale Frieden umso leichter erhalten werden konnte, als das Proletariat in Wahrheit besiegt aus dem Zweiten Weltkrieg heraustrat, unter der Kontrolle von Parteien und Gewerkschaften zugunsten des Wiederaufbaus innerhalb dieses Systems, e) sie aber gleichzeitig die langfristige Rentabilität der Investitionen garantierten, f) wie auch eine hohe Profitrate.
Das System war also zeitweise imstande, die Quadratur des Kreises, die parallele Steigerung der Profitproduktion und der Märkte, zu bewerkstelligen, in einer Welt, in der die Nachfrage fortan größtenteils von jener bestimmt wurde, die aus der Lohnarbeit herrührt. Die garantierte Steigerung der Profite, der Staatsausgaben und der Anstieg der Löhne waren in der Lage, die Endnachfrage zu gewährleisten, die so entscheidend ist, wenn das Kapital seine Akkumulation fortsetzen will. Der keynesianisch-fordistische Staatskapitalismus ist die Antwort, die das System zeitweise auf die Krisen der Senilitätsphase des Kapitalismus geben konnte, die wesentlich weltweite, durch das Lohnarbeitsverhältnis bestimmte Krisen sind. Er ermöglichte momentan ein auf sich selbst beruhendes Funktionieren des Kapitalismus, ohne die Notwendigkeit, Zuflucht in Produktionsverlagerungen zu suchen, trotz hohen Löhnen und Vollbeschäftigung, während er es ihm gleichzeitig ermöglichte, seine Kolonien loszuwerden, die künftig nur einen geringen Nutzen hatten, und die innere außerkapitalistische Bauernwirtschaft zu eliminieren, deren Aktivitäten fortan subventioniert werden mussten.
Vom Ende der 1960er Jahre bis 1982 verschlechterten sich sämtliche Bedingungen, die den Erfolg dieser Maßnahmen ermöglicht hatten, beginnend mit einer fortschreitenden Verlangsamung im Produktivitätsanstieg, der überall um ein Drittel gekürzt wurde, und zogen alle anderen ökonomischen Variablen mit sich hinunter. Die innere Regulierung, die zeitweilig vom keynesianisch-fordistischen Staatskapitalismus entdeckt worden war, hatte also kein dauerhaftes Fundament.
Jedoch waren die Gründe, die die Schaffung dieses Systems erfordert hatten, immer noch da: Die Lohnarbeit ist in der arbeitenden Bevölkerung vorherrschend, und daher war der Kapitalismus gezwungen, ein Mittel zur Stabilisierung der Endnachfrage zu finden, um ihren Zerfall zu vermeiden, der andernfalls zu einer Depression führen würde. Da Betriebsinvestitionen durch die Nachfrage bedingt sind, war es notwendig, andere Mittel zur Aufrechterhaltung des Konsums zu finden. Die Antwort wurde unvermeidlicherweise in den Zwillingsfaktoren der abnehmenden Ersparnisse und der steigenden Schulden gefunden. Dies schuf den Anreiz zur Spekulation und zur Produktion von Finanzblasen. Die konstante Erschwerung der Ausbalancierung des Systems ist somit nicht das Resultat von Irrtümern bei der Ausübung der Wirtschaftspolitik; sie ist ein integraler Bestandteil des Modells.
3) Schlussfolgerung: und morgen?
Dieser Abstieg in die Hölle ist in der gegenwärtigen Situation umso unvermeidlicher, als die Bedingungen für eine Wiedererholung der Produktivitätssteigerungen und eine Rückkehr zu ihrer dreiseitigen Verteilung gesellschaftlich nicht mehr vorhanden sind. Es gibt nichts Greifbares in den wirtschaftlichen Bedingungen, im gegenwärtigen Kräfteverhältnis zwischen den Klassen und in der imperialistischen Konkurrenz auf der internationalen Ebene, das irgendeinen Ausweg offen lässt: Alle Bedingungen sind gegeben für einen unerbittlichen Abstieg in die Hölle. Es liegt an den Revolutionären, zum Bewusstsein der Klassenkämpfe beizutragen, die unvermeidlich aus den sich vertiefenden Widersprüchen des Kapitalismus entstehen werden.
C. Mcl
[1] Gauche Communiste de France (Französische Kommunistische Linke)
[2] Internationalisme, Nr. 46, 1952.
[3] „Sie ist ferner beschränkt durch den Akkumulationstrieb, den Trieb nach Vergrößerung des Kapitals und nach Produktion von Mehrwert auf erweiterter Stufenleiter. Dies ist das Gesetz für die kapitalistische Produktion, gegeben durch die beständigen Revolutionen in den Produktionsmethoden selbst, die damit beständig verknüpfte Entwertung von vorhandnem Kapital, den allgemeinen Konkurrenzkampf und die Notwendigkeit, die Produktion zu verbessern und ihre Stufenleiter auszudehnen, bloß als Erhaltungsmittel und bei Strafe des Untergangs." (Marx, Das Kapital, Bd. 3, III. Abschnitt, S. 254, MEW)
[4] Marx, Das Kapital, Bd. 3, V. Abschnitt, S. 499, MEW.
[5] „In demselben Maße also, worin sich mit der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise der Wertumfang und die Lebensdauer des angewandten fixen Kapitals entwickelt, entwickelte sich das Leben der Industrie und des industriellen Kapitals in jeder besondren Anlage zu einem vieljährigen, sage im Durchschnitt zehnjährigen Zyklus (...) Durch diesen eine Reihe von Jahren umfassenden Zyklus von zusammenhängenden Umschlägen, in welchen das Kapital durch seinen fixen Bestandteil gebannt ist, ergibt sich eine materielle Grundlage der periodischen Krisen..." (Marx, Das Kapital, Bd. 2, II. Abschnitt, S. 185, MEW)
[6] Marx, das Kapital, Bd. 3, III. Abschnitt, S. 259 und 265, MEW.
[7] „Wenn wir einen aufwärts sich entwickelnden Kapitalismus betrachten, so finden wir dieselben Schwankungen, nur geht die Kurve nach oben. Wenn wir eine verfallende kapitalistische Gesellschaft beobachten, so geht die Kurve nach unten, die Entwicklung bewegt sich aber immer in diesen Schwankungen.
Aus der Tabelle der Januarnummer der „Times" ersehen wir die Epoche von 138 Jahren, von der Zeit der Kriege für die Unabhängigkeit Nordamerikas bis zum heutigen Tage. Im Laufe dieser Zeit hatten wir, wenn ich nicht irre, 16 Zyklen, das heißt 16 Krisen und 16 Hochkonjunkturen. Auf jeden Zyklus entfallen ungefähr 8 ½ Jahre, fast 9 Jahre." (Trotzki, Die wirtschaftliche Krise und die neuen Aufgaben der Kommunistischen Internationale, Protokolle der Komintern-Kongresse, 23. Juni 1921)
[8] „...Das erstrangige Ziel des Kapitalisten ist ein neuer Produktionszyklus, der ihm neuen Mehrwert einbringt (...) Die mit beinahe mathematischer Regelmäßigkeit wiederkehrenden Krisen bilden einer der spezifischen Züge der kapitalistischen Produktionsweise." (Mitchell, Bilan, Nr. 10, „Krisen und Zyklen in der Wirtschaft des niedergehenden Kapitalismus")
[9] In Graphik Nr. 1 sind die neun Rezessionen, die die zehn Zyklen interpunktieren, durch die von oben nach unten durchlaufenden Liniengruppen dargestellt: 1949, 1954, 1958, 1960, 1970-71, 1974, 1980-81, 1991, 2001.
[10] „Sobald das auspreßbare Quantum Mehrarbeit in Waren vergegenständlicht ist, ist der Mehrwert produziert. Aber mit dieser Produktion des Mehrwerts ist nur der erste Akt des kapitalistischen Produktionsprozesses, der unmittelbare Produktionsprozeß beendet. Das Kapital hat soundsoviel unbezahlte Arbeit eingesaugt. Mit dieser Entwicklung des Prozesses, der sich im Fall der Profitrate ausdrückt, schwillt die Masse des so produzierten Mehrwerts ins Ungeheure. Nun kommt der zweite Akt des Prozesses. Die gesamte Warenmasse, das Gesamtprodukt, sowohl der Teil, der das konstante und variable Kapital ersetzt, wieder den Mehrwert darstellt, muß verkauft werden. Geschieht das nicht oder nur zum Teil oder nur zu Preisen, die unter den Produktionspreisen stehn, so ist der Arbeiter zwar exploitiert, aber seine Exploitation realisiert sich nicht als solche für den Kapitalisten, kann mit gar keiner oder nur teilweiser Realisation des abgepreßten Mehrwerts, ja mit teilweisem oder ganzem Verlust seines Kapital verbunden sein." (Marx, Das Kapital, Bd. 3, III. Abschnitt, S. 254, MEW)
[11] Marx, Theorien über den Mehrwert, MEW, Bd. 26.2, XVII. Kapitel, S. 535)
[12] Marx, Das Kapital, Bd. 3, V. Abschnitt. S. 501 MEW. Diese Analyse von Marx hat selbstverständlich nichts mit der Theorie der Unterkonsumtion als Krisenursache zu tun - eine Theorie, die er tatsächlich kritisierte: „Es ist reine Tautologie zu sagen, daß die Krisen aus Mangel an zahlungsfähiger Konsumtion oder an zahlungsfähigen Konsumenten hervorgehn. Andere Konsumarten als zahlende kennt das kapitalistische System nicht, ausgenommen die sub forma pauperis oder die des ‚Spitzbuben‘. Daß Waren unverkäuflich sind, heißt nichts, als daß sich keine zahlungsfähigen Käufer für sie fanden, also Konsumenten (sei es nun, daß die Waren in letzter Instanz zum Behuf produktiver oder individueller Konsumtion gekauft werden). Will man aber dieser Tautologie einen Schein tiefrer Begründung dadurch geben, daß man sagt, die Arbeiterklasse erhalte einen zu geringen Teil ihres eignen Produkts, und dem Übelstand werde mithin abgeholfen, sobald sie größern Anteil davon empfängt, ihr Arbeitslohn folglich wächst, so ist nur zu vermerken, daß die Krisen jedesmal vorbereitet werden durch eine Periode, worin der Arbeitslohn allgemein steigt und die Arbeiterklasse realiter größern Anteil an dem für Konsumtion bestimmten Teil des jährlichen Produkts erhält." (Marx, Das Kapital, Bd. 2, III. Abschnitt, MEW, S. 409)
[13] Marx, Das Kapital, Bd. 3, III. Abschnitt, S. 268, MEW.
[14] Jeder dieser drei Faktoren wird von Marx in der folgenden Passage identifiziert: „Die Bedingungen der unmittelbaren Exploitation und die ihrer Realisation sind nicht identisch. Sie fallen nicht nur nach Zeit und Ort, sondern auch begrifflich auseinander. Die einen sind nur beschränkt durch die Produktivkraft der Gesellschaft, die andren durch die Proportionalität der verschiednen Produktionszweige und durch die Konsumtionskraft der Gesellschaft. Diese letztre aber ist bestimmt weder durch die absolute Produktionskraft noch durch die absolute Konsumtionskraft; sondern durch Konsumtionskraft auf Basis antagonistischer Distributionsverhältnisse, welche die Konsumtion der großen Masse der Gesellschaft auf ein nur innerhalb mehr oder minder enge Grenzen veränderliches Minimum reduziert. Sie ist ferner beschränkt durch den Akkumulationstrieb, den Trieb nach Vergrößerung des Kapitals und nach Produktion von Mehrwert auf erweiterter Stufenleiter." (Marx, Das Kapital, Bd. 3, III. Abschnitt, S. 254, MEW)
[15] Marx, Theorien über den Mehrwert, von uns rückübersetzt aus dem Französischen.
[16] „Da die Märkte und die Produktion unabhängige Faktoren sind, muss die Ausweitung des einen nicht unbedingt dem Wachstum des anderen entsprechen" (unsere Übersetzung aus der französischen Version der Grundrisse von Marx, La Pléiade, Economie II, S. 489). Oder noch einmal: „Die Bedingungen der unmittelbaren Exploitation und die ihrer Realisation sind nicht identisch. Sie fallen nicht nur nach Zeit und Ort, sondern auch begrifflich auseinander." (Marx, Kapital, Bd. 3)
[17] Es ist umso wichtiger, die Idee abzulehnen, dass die Überproduktionskrisen eine einzige Ursache haben, als ihre Ursachen sowohl für Marx als auch in der Realität weitaus komplexer sind: die Anarchie der Produktion, die Disproportionalität zwischen den beiden Hauptsektoren der Wirtschaft, der Gegensatz zwischen „geliehenem Kapital" und „Produktivkapital", die Trennung zwischen Kauf und Verkauf nach Schatzbildung etc. Dennoch sind die beiden Hauptursachen, die von Marx am vollständigsten analysiert worden sind, und auch die wichtigsten in der Realität die beiden, auf die wir hier stets bestanden haben: der Fall der Profitrate und die Gesetze, die die Verteilung des Mehrwerts bestimmen.
[18] Wie zum Beispiel die lange Periode der steigenden Reallöhne in der zweiten Hälfte des Aufstiegs des Kapitalismus (1870-1914), während des Nachkriegsbooms (1945-82) oder ihr relativer und gar absoluter Fall seitdem (1982-2008).
[19] Es ist selbstverständlich, dass eine Rentabilitätskrise unweigerlich zu einem endemischen Zustand der Überproduktion sowohl des Kapitals als auch der Waren führt. Jedoch tauchten diese Phänomene der Überproduktion nach der Rentabilitätskrise auf und wurden dann Gegenstand einer Auffangpolitik sowohl des Staates (Produktionsquoten, Umstrukturierungen, etc.) als auch von Privaten (Fusionen, Rationalisierung, Übernahmen, etc.).
[20] In den 1970er Jahren litt die Arbeiterklasse in der Krise im Wesentlichen unter einem Verfall der Arbeitsbedingungen, Umstrukturierungen und Entlassungen und seither unter einem spektakulären Anstieg der Arbeitslosigkeit. Jedoch führte, anders als in der Krise von 1929, diese Arbeitslosigkeit nicht zu einer Spirale der Rezession dank dem Einsatz von keynesianischen sozialen Stoßdämpfern: Arbeitslosenunterstützung, Auffangmaßnahmen, planmäßige Entlassungen, etc.
[21] Für Marx ist die Arbeitsproduktivität der wahre Schlüssel der Entfaltung des Kapitalismus, da sie nichts anderes ist als das umgekehrte Verhältnis des Wertgesetzes, mit anderen Worten: der gesellschaftlich notwendigen durchschnittlichen Arbeitszeit für die Warenproduktion. Unser Artikel über die Krise in der Internationalen Revue, Nr. 33 enthält eine Graphik, die die Arbeitsproduktivität für die G6-Staaten (USA, Japan, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien) von 1961 bis 2003 zeigt. Sie zeigt deutlich, dass der Fall der Arbeitsproduktivität allen anderen Variablen vorausgeht und dass sie seither auf einem tiefen Niveau geblieben ist.
[22] Marx, Das Kapital, Bd. 3, III. Abschnitt, S. 255, MEW.
[23] Jedes Akkumulationsregime, das die historische Entwicklung des Kapitalismus ausgezeichnet hat, hat spezifische Beziehungen mit seiner äußeren Sphäre erzeugt: vom Merkantilismus der Länder der Iberischen Halbinsel über den Kolonialismus des viktorianischen Britannien zum selbst-zentrierten Kapitalismus des Nachkriegsbooms - es gibt keine Uniformität in den Beziehungen zwischen dem Herzen des Kapitalismus und der Peripherie, wie Rosa Luxemburg annahm, sondern eine gemischte Abfolge von Beziehungen, die alle von diesen unterschiedlichen inneren Bedürfnissen der Kapitalakkumulation angetrieben werden.
[24] Im 19. Jahrhundert, als die Kolonialmärkte am wichtigsten waren, wuchsen ALLE NICHT-kolonialen Länder schneller als die Kolonialländer (71% schneller im Durchschnitt). Diese Beobachtung ist in der gesamten Geschichte des Kapitalismus zutreffend. Verkäufe außerhalb des reinen Kapitalismus ermöglichten es sicherlich individuellen Kapitalisten, ihre Waren zu realisieren, doch behinderten sie eine globale Akkumulation des Kapitalismus, da sie, wie die Waffen, materiellen Mitteln entsprechen, die den Kreislauf der Akkumulation verlassen.
[25] „...das Kapitalverhältnis wird zu einer Schranke für die Entwicklung der Produktivkräfte der Arbeit. Wenn dieser Punkt erreicht ist, tritt das Kapital, d.h. die Lohnarbeit, in dasselbe Verhältnis gegenüber der Entwicklung gesellschaftlichen Reichtums und der Produktivkräfte wie das Zunftsystem, Leibeigenschaft, Sklaverei, und es wird als Fessel abgestreift" (Marx, Grundrisse, Das Kapitel vom Kapital, Heft VII, eigene Rückübersetzung aus dem Englischen)
[26] Marx, Theorien über den Mehrwert, Sechzehntes Kapitel, S. 469, MEW Bd. 26.2
[27] Paul Mattick, Intégration capitaliste et rupture ouvrière, EDI, S. 151, unsere Übersetzung.
Aktuelles und Laufendes:
- Keynesianismus [37]
- Fordismus [38]
- Wirtschaftswunder [39]
