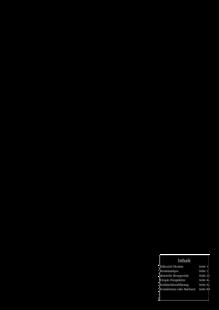Weltrevolution - 2014
- 1952 reads
Weltrevolution Nr. 179
- 1560 reads
Der Kapitalismus ist verantwortlich!
- 1306 reads
Mehr als 300 Tote und Dutzende von Schwerverletzten: die Explosion, die das Bergwerk von Soma im Westen der Türkei erschütterte, ist die opferreichste Industriekatastrophe in der Geschichte des Landes. Sie ist keineswegs ein „Unfall“, ein Produkt schieren Pechs, das wir gottgegeben hinnehmen müssen. Sie ist ein Verbrechen – ein Verbrechen des Kapitals.
Nach dem Zusammenbruch der Mine gingen Tausende von ArbeiterInnen und StudentInnen nicht nur in Soma und Izmir (einer Hafenstadt nahe Soma), sondern auch in den Großstädten der Türkei, in Ankara und Istanbul, und in den kurdischen Regionen auf die Straße. Mutig der brutalen Repression, dem Tränengas und der Schlagstöcke trotzend, nahmen – fast ein Jahr nach der großen sozialen Bewegung, die von der Verteidigung des Gezi-Parks in Istanbul ausgegangen war – die Demonstrationen täglich an Umfang zu.
Die Bourgeoisie und ihre gefügigen Medien blieben sehr einsilbig gegenüber diesem Zorn. Alle Fernsehsender konzentrierten sich darauf, trauernde Familien, die um ihre Toten weinen, zu zeigen, und Reden von Erdogan und vom Energieminister einzustreuen, in denen diese Ausgleichszahlungen versprachen – als ob dies den Schmerz der Angehörigen lindern oder die Toten wieder lebendig machen könnte. Um die sozialen Spannungen abzubauen und dem Zorn der Bergarbeiter ein Ende zu bereiten, versprach man ihnen andere Jobs nach der Schließung des Bergwerks.
Das Stillschweigen der Medien über die Straßendemonstrationen und die Versammlungen von StudentInnen, die die Universitäten besetzten, ging einher mit vermehrten Polizeikontrollen gegen die Bevölkerung. Es drangen nur wenige Informationen darüber durch, was tatsächlich in Soma geschehen war. Die Regierung mobilisierte ihre Imame, um die ArbeiterInnen mit religiösem Opium zu narkotisieren, um sie dazu zu bringen, sich mit ihrem Schicksal abzufinden, sich der kapitalistischen Ordnung zu fügen.
Auf den Demonstrationen trafen die Solidarität mit den Familien der Opfer und die Empörung über die Gleichgültigkeit der Regierung und der Bosse auf die brutale Repression eines Polizeistaates. Das Foto, das eine junge Frau zeigt, die ein Plakat hochhält, auf dem geschrieben steht: „Dies war kein Unfall, dies ist Mord. Die Regierung ist verantwortlich!“, spricht für sich, was das Ausmaß der Wut und die gesellschaftliche Unzufriedenheit angeht.
Zum Zeitpunkt, als diese Zeilen geschrieben wurden, wurden nach den Polizeiattacken gegen die Demonstrationen Generalversammlungen in den Universitäten von Istanbul und Ankara abgehalten.
Wahlen sind eine Falle für die Arbeiterklasse!
Neben den Imamen mobilisierte die türkische Bourgeoisie auch all ihre demokratischen Kräfte, ihre „Opposition“, um die Gefahr einer sozialen Explosion niederzuhalten. Alle demokratischen Kräfte, die in den Demonstrationen involviert sind, stimmen in den Schlachtruf ein: „Die Regierung muss zurücktreten!“ Die Kräfte des demokratischen „Fortschritts“ (die linken und linksextremen Parteien, die Gewerkschaften, etc.) tragen so ihren eigenen Part zum Schutz der kapitalistischen Ordnung und der nationalen Einheit bei. Ihre „radikalen“ Reden gegen die Erdogan-Regierung haben nur ein Ziel: die soziale Zeitbombe zu entschärfen und den Zorn der ArbeiterInnen und StudentInnen in die Falle der Wahlen zu lenken. Die Imame rufen die ArbeiterInnen dazu auf, Trost im Gebet zu suchen; die Oppositionskräfte rufen sie dazu auf, isoliert voneinander ihr Heil an der Wahlurne zu suchen und ein besseres Management des nationalen Kapitals durch eine „kompetentere“ bürgerliche Clique zu fordern.
Es fügt sich, dass die Präsidentschaftswahlen im August stattfinden, und das zum ersten Mal auf der Grundlage des allgemeinen Wahlrechts. Alle Sirenen der Demokratie werden die Ausgebeuteten dazu aufzurufen, als bloße „Bürger“ zu handeln. Es ist kein Zufall, dass Erdogans Opponenten so sehr die „mangelnde Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gegenüber den Arbeitsbedingungen“, insbesondere in den Bergwerken, anprangern. Und es ist ebenfalls kein Zufall, dass die Gewerkschaften einen eintägigen Generalstreik angekündigt haben, um „gegen die Versäumnisse der Regierung“ zu protestieren. Die Gewerkschaften und die Oppositionsparteien versuchen, die Aufmerksamkeit auf Erdogan zu fokussieren, um die Illusion zu verbreiten, dass eine andere Clique von Ausbeutern die Ausbeutung der Proletarier humaner gestalten könnte, so jegliches Nachdenken über die wahren Ursachen dieser Katastrophe, die kapitalistische Produktionsweise, verhindernd.
Die provokanten Erklärungen des Ministerpräsidenten können offenkundig nur dazu führen, dieses Gefühl der Abscheu über den grenzenlosen Zynismus Erdogans zu steigern. Als er kaltherzig gegenüber den betroffenen Familien behauptete: „In solchen Minen passieren immer wieder solche Unfälle“, konnte dies den Zorn nur noch weiter steigern. Und schließlich sind wir Zeuge eines noch provokanteren Auftretens der Bullen und sogar Erdogans und seiner Leibwächter, die auf Demonstranten einschlagen.
Erdogans Brutalität und Arroganz zeigt uns das wahre Gesicht der gesamten Bourgeoisie, einer globalen Klasse von Ausbeutern und Mördern. Der Kapitalismus „mit einem humanen Antlitz“ ist eine reine Mystifikation, weil die Bourgeoisie, welche Clique auch immer an der Regierung sein mag, ob rechts oder links, sich nicht einen Deut um Menschenleben schert. Ihre einzige Sorge gilt dem Profit. Und ob er nun säkular oder religiös geprägt ist, der Staat ist stets ein Polizeistaat, wie wir in den meist entwickelten demokratischen Ländern sehen können, wo Demonstrationen stets gut von Kräften der Opposition und den Basisgewerkschaftern auf der einen und von den Repressionskräften auf der anderen Seite kontrolliert werden.
Der Kapitalismus ist ein System, das den Tod verbreitet
Akin Celik, der Direktor des Soma-Bergwerks, teilte im Jahr 2012 einer türkischen Zeitung mit, dass es gelungen war, die Produktionskosten auf 24 Dollar die Tonne zu reduzieren, im Vergleich zu den 130 Dollar vor der Privatisierung des Bergwerks. Wie konnte es zu einer solchen Meisterleistung kommen? Natürlich durch Kürzungen an allen Ecken und Enden, soweit möglich, besonders auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit. Sie wurden mit dem Segen der Gewerkschaften erzielt, die jetzt die Versäumnisse der Regierung anprangern. Man kann es nicht deutlicher ausdrücken, wie dieser Kumpel aus Soma: „Es gibt keinerlei Sicherheiten in diesem Bergwerk. Die Gewerkschaften sind nur Marionetten und die Bosse denken nur ans Geld.“[1]
Doch die Gier der Bosse ist nicht die wesentliche Ursache von Industriekatastrophen und Arbeitsunfällen. Wenn die Kosten ständig gedrückt werden müssen, geschieht dies, um die Produktivität des Unternehmens, seine Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Mit anderen Worten, es ist die eigentliche Produktionsweise des Kapitalismus – eine Produktionsweise, die auf die Konkurrenz, auf den Weltmarkt, auf die profitorientierte Produktion basiert -, die die Bosse, selbst die „humansten“ unter ihnen, unerbittlich dazu treibt, das Leben jener zu gefährden, die sie ausbeuten. Für die bürgerliche Klasse ist der/die LohnarbeiterIn lediglich die Quelle einer Ware, deren Arbeitskraft zu einem möglichst niedrigen Preis gekauft wird. Und um die Produktionskosten zu senken, hat die Bourgeoisie keine andere Wahl, als die Sicherheit auf dem Arbeitsplatz einzusparen. Die Ausbeuter können sich nicht allzu viele Sorgen um das Leben, die Sicherheit und die Gesundheit der Ausgebeuteten machen. Das einzige, was zählt, ist das Auftragsbuch, die Profitmarge, die Mehrwertrate.
Laut einem 2003 veröffentlichten Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation werden alljährlich weltweit 270 Millionen LohnarbeiterInnen Opfer von Arbeitsunfällen; 160 Millionen leiden an „Berufskrankheiten“. Die Untersuchung enthüllt, dass jedes Jahr zwei Millionen Menschen bei der Verrichtung ihrer Arbeit zu Tode kommen. Das sind 5.000 pro Tag!
Und dieser Horror beschränkt sich nicht auf die Dritte Welt. In Frankeich kommen laut der CNAM (Caisse National d’Assurance-Maladie – die nationale Krankenversicherungsorganisation) pro Jahr 780 Beschäftigte bei Arbeitsunfällen ums Leben, mehr als zwei pro Tag. Es gibt etwa 1.350000 Arbeitsunfälle im Jahr, das heißt 3.700 Opfer jeden Tag oder, bei einem Achtstunden-Arbeitstag, acht Verletzte jede Minute.
Wenn wir zurückblicken, so hat der Kapitalismus stets Tod verbreitet. Wie Engels 1845 in seiner Untersuchung über Die Bedingungen der Arbeiterklasse in England aufzeigt:
„Die Kohlengrube ist der Schauplatz einer Menge der schreckenerregendsten Unfälle, und gerade diese kommen direkt auf die Rechnung des Bourgeoisie-Eigennutzes. Das Kohlenwasserstoffgas, das sich so häufig in ihnen entwickelt, bildet durch seine Vermischung mit atmosphärischer Luft eine explosible Luftart, die sich durch die Berührung mit einer Flamme entzündet und jeden tötet, der sich in ihrem Bereich befindet. Solche Explosionen fallen fast alle Tage hier oder dort vor; am 28. September 1844 war eine in Haswell Colliery (Durham), welche 96 Menschen tötete. Das kohlensaure Gas, das sich ebenfalls in Menge entwickelt, lagert sich an den tiefern Stellen der Gruben oft über Mannshöhe und erstickt jeden, der hineingerät (…) Durch eine gute Ventilation der Gruben vermittels Luftschachten wäre die nachteilige Wirkung beider Gase gänzlich zu vermeiden, aber dazu gibt der Bourgeois sein Geld nicht her und befiehlt lieber den Arbeitern, nur von der Davyschen Lampe Gebrauch zu machen, die ihm wegen ihres düstern Scheins oft ganz nutzlos ist und die er deshalb lieber mit der einfachen Kerze vertauscht. Kommt dann eine Explosion, so war es die Nachlässigkeit der Arbeiter, wo doch der Bourgeois durch gute Ventilation jede Explosion hätte fast unmöglich machen können. Ferner fällt alle Augenblicke ein Stollen ganz oder teilweise ein und begräbt die Arbeiter oder zerquetscht sie; es ist das Interesse des Bourgeois, daß die Flöze soviel irgend möglich ausgegraben werden, und daher auch diese Art Unglücksfälle.“ (Kapitel über „Das Bergwerksproletariat“)
Der Kapitalismus – das ist der Mörder, das ist der Feind!
Die Toten von Soma sind auch unsere Toten. Es sind unsere Klassenbrüder, die durch den Kapitalismus getötet worden sind. Es sind unsere Klassenbrüder und -schwestern, die auf den Demonstrationen in der Türkei zusammengeschlagen wurden. Die Ausgebeuteten der gesamten Welt müssen sich von dieser Katastrophe mit betroffen fühlen, weil das gesamte System eine Katastrophe für die Menschheit ist.
Angesichts der Barbarei dieser Gesellschaftsordnung, die nicht nur in militärischen Konflikten, sondern auch immer häufiger auf dem Arbeitsplatz Tote produziert, müssen sich die Ausgebeuteten weigern, irgendeine gemeinsame Sache mit ihren Ausbeutern zu machen. Die einzige Solidarität, die sie mit den Familien der Opfer von Soma zeigen können, ist der Kampf auf ihrem eigenen Klassenterrain. Überall, auf den Arbeitsplätzen, in den Hochschulen und Universitäten, auf Versammlungen und Treffen müssen wir die wahren Ursachen dieser Tragödie diskutieren. Wir müssen über die Fallen der reformistischen Wächter der bürgerlichen Ordnung hinwegspringen, die mit der Vogelscheuche Erdogan herumfuchteln, um die wahre Verantwortung des Weltkapitals zu verschleiern.
Auf die Trauerreden der Imame – „Kämpft nicht, sondern betet!“ –, auf die Slogans der demokratischen Opposition – „Kämpft nicht, sondern geht wählen!“ – müssen wir entgegnen:
Solidarität mit unseren Klassenbrüdern und -schwestern in der Türkei! Kampf den Ausbeutern in aller Herren Länder!
Révolution Internationale, 16.5.14
Aktuelles und Laufendes:
- Soma [3]
- Solidarität [4]
- Grubenunglück [5]
Rubric:
Die Ukraine gleitet in die militärische Barbarei ab
- 2747 reads
Die Krise in der Ukraine ist die gefährlichste in Europa seit der Auflösung Jugoslawiens ein Vierteljahrhundert zuvor, da Russlands Versuche, seine Interessen gegen das Streben der westeuropäischen Mächte nach mehr Einfluss in dieser Region zu verteidigen, einen Bürgerkrieg und die Destabilisierung der Region heraufbeschwören.
Das Land hat einen neuen Präsidenten, Petro Poroschenko, der von einer Mehrheit in der ersten Wahlrunde gewählt wurde und sogleich versprach, die „separatistischen Terroristen“ im Osten des Landes binnen Stunden zu bezwingen. Eine neue Hoffnung ist er beileibe nicht. Er begann seine politische Karriere in der Vereinten Sozialdemokratischen Partei der Ukraine und anschließend in der Partei der Regionen, die Kutschma, einem Verbündeten Russlands, treu war, ehe er 2001 zu Juschtschenkos Block „Unsere Ukraine“ wechselte. Er war Minister sowohl in der Juschtschenko- als auch in der Janukowitsch-Regierung gewesen. Der Schokoladen-Milliardär wurde 2005 der Korruption beschuldigt; er bestritt die Präsidentschaftswahlen mit der Unterstützung des Ex-Boxers Witali Klitschko, der zur gleichen Zeit zum Bürgermeister von Kiew gewählt wurde, und seiner korrupten Helfer Lewoschkin und Firtasch. In der Ukraine hat damit nun ein weiterer korrupter Oligarch das Sagen, um die einzige Perspektive, die dieses verrottete kapitalistische System für die Menschheit parat hat, Militarismus und Austerität, durchzusetzen.
Weit davon entfernt, eine neue Ära der demokratischen Stabilität und des Wachstums einzuleiten, waren die Präsidentschaftswahlen am 24. Mai wie auch die Referenden, die von Separatisten auf der Krim im März und in Donezk und Luhansk im Mai abgehalten wurden, ein weiterer Schritt der Ukraine bei ihrem Abgleiten in einen blutigen Bürgerkrieg. Was wir nun sehen, ist eine Ausweitung der inneren Spaltungen in diesem bankrotten, künstlichen Gebilde, beschleunigt von den imperialistischen Manövern von außen. Es besteht die Gefahr, dass das Land von einem Bürgerkrieg, von ethnischen Säuberungen, Pogromen, Massakern zerrissen wird und die imperialistischen Konflikte sowie die Instabilität in der Region verschärft werden.
Die „angeborene“ Instabilität der Ukraine
Die Ukraine ist Europas zweitgrößtes Land, ein künstliches Konstrukt, in dem 78 Prozent der Bevölkerung Ukrainisch sprechen und 17 Prozent Russisch; Letztere bilden die Mehrheit in der Donbas-Region. Hinzu kommen noch etliche andere Nationalitäten, einschließlich der Krimtartaren. Die wirtschaftlichen Spaltungen folgen den gleichen Linien, mit der Kohle und dem Stahl im russisch sprechenden Osten, die nach Russland exportiert werden und sich auf 25 Prozent der Exporte des Landes belaufen, und mit dem westlichen Teil des Landes, der die Bühne für die orangenen Proteste 2004 und den Maidan-Protesten im vergangenen Winter gebildet hatte und in der EU sein Heil sucht.
Die Wirtschaft ist eine Katastrophe. Seit 1999 ist ihr Ausstoß auf 40 Prozent des Standes von 1991 gefallen, als das Land unabhängig wurde. Nach einer relativen Wiederbelebung schrumpfte er auf 15 Prozent im Jahr 2009. Die Industrie im Osten ist veraltet, hoch gefährlich und eine Umweltbelastung. Die Tatsache, dass die Flöze immer weniger hergeben, hat zu noch gefährlicheren Arbeiten in Tiefen von 1200 Metern geführt, mit der Gefahr von Methan- und Kohlenstaubexplosionen wie auch von Gebirgsschlägen (ein Risiko, das erst kürzlich in Soma in der Türkei über 3000 Tote verursachte). Die Verschmutzung aus dem Abwasser der Bergwerke zieht die Trinkwasserversorgung in Mitleidenschaft, während antiquierte Kokereien und Stahlhütten sichtbar Luftverschmutzung und Abraumhalden Bergrutsche verursachen.[1] Hinzu kommt die radioaktive Belastung, ein Vermächtnis aus der sowjetischen Ära des nuklearen Rohstoffabbaus. Diese Industrien sind nicht mittelfristig und schon gar nicht kurzfristig wettbewerbsfähig angesichts der EU-Konkurrenz. Es ist kaum ersichtlich, wer die notwendigen Investitionen stemmen soll. Nicht die Oligarchen, die sehr, sehr reich wurden, während die Wirtschaft den Bach hinunterging. Nicht Russland, das selbst veraltete Industrien aus den Sowjetzeiten hat, mit denen es fertig werden muss. Und mit Sicherheit nicht das westeuropäische Kapital, das die Regie bei der Schließung der meisten seiner eigenen Bergbau- und Stahlindustrie in der 1970er und 1980er Jahre geführt hatte. Die Idee, dass Russland aus der wirtschaftlichen Katastrophe, der Verarmung und Arbeitslosigkeit, die immer weiter fortschreiten, während die Oligarchen immer reicher werden, einen Ausweg anbieten könnte – eine Art von Nostalgie des Stalinismus und seiner versteckten Arbeitslosigkeit -, ist eine gefährliche Illusion, die die Fähigkeit zur Selbstverteidigung der Arbeiterklasse nur untergraben kann.
Hoffnungen auf Gelder aus dem Westen sind gleichermaßen gefährlich. Der IWF-Rettungsfond im März, 14-18 Milliarden Dollar schwer, der die 15 Milliarden Dollar ersetzen soll, die von Russland gestrichen wurden, als Janukowitsch fiel, ist nur unter der Bedingung einer strikten Austerität, eines 40%igen Anstiegs der Brennstoffpreise und eines Abbaus von zehn Prozent der öffentlichen Arbeitsplätze, rund 24.000 Jobs, zugesagt worden. Die Arbeitslosenzahlen sind wenig verlässlich, da viele Menschen nicht registriert oder unterbeschäftigt sind.
Als die Ukraine noch Teil der UdSSR und an seinen westlichen Grenzen von russischen Satelliten umgeben war, bedrohte die Zweiteilung nicht die Integrität des Landes. Dies heißt nicht, dass solche Spaltungen nicht benutzt und missbraucht wurden. Beispielsweise wurden vor 70 Jahren die Krimtartaren vertrieben, von denen erst vor kurzem einige wieder zurückkehrten. Die Spaltungen wurden von allen Seiten auf widerlichste und blutigste Weise ausgespielt. Es ist nicht nur die ultrarechte Svoboda oder die Rehabilitierung von Stephan Bandera, einem ukrainischen Nazi aus Kriegszeiten, durch die Interimsregierung: Auch Julia Timoschenko bedient sich einer martialischen Sprache gegen russische Führer und gegen die russische Bevölkerung, und Poroschenko setzt dies in die Praxis um. Die russische Seite ist genauso widerlich und mörderisch. Beide Seiten haben paramilitärische Einheiten gebildet. Auch Kiew verlässt sich nicht allein auf die reguläre Armee. Diese irregulären Kräfte umfassen die gefährlichsten Fanatiker, Söldner, Terroristen, Killer; sie üben Terror gegenüber der Zivilbevölkerung aus, wenn sie sich nicht gegenseitig umbringen. Wenn diese Kräfte erst einmal von der Leine gelassen worden sind, werden sie dazu neigen, autonom zu werden, außer Kontrolle zu geraten, was zu Opferzahlen führen wird, wie wir sie aus dem Irak, aus Afghanistan, Libyen oder Syrien kennen.
Russland verteidigt seine strategischen Interessen auf der Krim
Der russische Imperialismus braucht die Krim für seine Schwarzmeerflotte. Ohne seine Basen auf der Krim könnte Russland nicht mehr Operationen im Mittelmeer oder im Indischen Ozean durchführen. Seine strategische Position hängt von der Krim ab. Die Ukraine wird auch zur Verteidigung der South Stream-Gaspipeline benötigt, sobald sie fertig gestellt ist. Dies war ein ständiges Anliegen seit der ukrainischen Unabhängigkeit gewesen. Russland kann einfach nicht eine pro-westliche ukrainische Regierung, die für die Krim verantwortlich zeichnet, dulden, entsprechend seine Antwort auf jegliches Abkommen mit der EU. 2010 gewährte Russland einen Preisnachlass für Erdgas im Austausch für eine Verlängerung der Pacht für seine Schiffsbasen auf der Krim. Als die Janukowitsch-Regierung die Unterzeichnung des Assoziationsabkommens mit der EU vergangenen November aussetzte, antwortete Russland mit einem 15 Milliarden Dollar schweren Unterstützungspaket, das annulliert wurde, als Janukowitsch angeklagt wurde und aus der Ukraine floh. Kurz danach übernahm es die Krim und organisierte ein Referendum für den Anschluss an Russland, das es in seiner Kriegspropaganda für ihre Annexion benutzen konnte, ungeachtet der Tatsache, dass diese Annexion international nicht anerkannt wurde.
So hatte Russland im März die Krim de facto in seiner Tasche. Doch die Krim ist für Russland noch längst nicht sicher, da sie von der Ukraine umzingelt ist, einem Land, das im Begriff ist, ein Assoziationsabkommen mit der EU zu unterzeichnen und sich folglich sich mit Russlands Feinden zu verbünden, und das versucht, sich Russlands Erpressung zu entziehen, indem es neue Geldgeber in Westeuropa findet. Aus strategischen Gründen, d.h. um einen Landweg zur Krim zu haben, muss Russland den östlichen Teil der Ukraine unter seine Kontrolle bringen. Die Ostukraine ist jedoch ein ganz anderes Kaliber als die Krim, trotz des Gewichts der russisch-sprechenden Bevölkerung, die für Russlands Schachzüge das Alibi liefert. Ohne militärischen Stützpunkt in der Ostukraine können die separatistischen Referenden in Donezk und Luhansk diese Regionen nicht für Russland sichern, sondern sie allenfalls destabilisieren. Nicht einmal die Kontrolle dieser lokalen, separatistischen Banden kann als sicher gelten.
Russland kann eine weitere Karte bei der möglichen Destabilisierung dieses Gebietes ausspielen: Transnistrien, das von Moldawien an der südwestlichen Grenze der Ukraine wegbrach und ebenfalls einen großen Teil russisch sprechender Bevölkerung hat.
Kein neuer Kalter Krieg, aber eine weitere Drehung der Spirale der militärischen Barbarei
Es handelt sich hier keinesfalls um die Rückkehr zum Kalten Krieg. Dieser war eine Periode von Jahrzehnten militärischer Spannungen zwischen zwei imperialistischen Blöcken, die Europa spalteten. Doch 1989 ist Russland so sehr geschwächt worden, dass es nicht länger die Kontrolle über seine Satelliten, nicht einmal über die alte UdSSR ausüben konnte, trotz seiner Anstrengungen wie sein Krieg in Tschetschenien. Mittlerweile sind viele osteuropäische Länder in der Nato, deren Operationsbasis nun bis an die russischen Grenzen reicht. Aber Russland besitzt noch immer sein Nukleararsenal, und es hat noch immer dieselben imperialistischen Interessen. Der drohende Einfluss jeglichen Einflusses in der Ukraine ist eine weitere Schwächung, die es nicht tolerieren darf und die es zur entsprechenden Reaktion gezwungen hat.
Die USA sind die einzig verbliebene Supermacht, doch sie haben nicht mehr die Autorität eines Blockführers über ihre „Verbündeten“ und Konkurrenten in Europa. Dies wird anhand der Tatsache deutlich, dass sie diese Mächte nicht mehr – wie im ersten Golfkrieg - zur Unterstützung des zweiten Golfkriegs mobilisieren konnten. Die USA sind dadurch geschwächt worden, dass sie mehr als 20 Jahre lang im Sumpf der Kriege im Irak und in Afghanistan versunken waren. Und nun sehen sie sich dem Aufstieg eines neuen Rivalen gegenüber, der Südostasien und den Fernen Osten destabilisiert: China. Infolgedessen sind die USA trotz ihrer Absicht, ihre Militärausgaben zu kürzen, gezwungen, ihre Aufmerksamkeit auf jene Weltregion zu richten. Obama hat gesagt: „Einige unserer kostspieligsten Fehler entstanden nicht aus unserer Zurückhaltung, sondern aus unserer Bereitschaft, uns in militärische Abenteuer zu stürzen, ohne über die Konsequenzen nachzudenken.“[2] Dies bedeutet nicht, dass sie nicht versuchen werden, durch Diplomatie, Propaganda und verdeckte Operationen ein Stück vom ukrainischen Kuchen zu ergattern, doch sie besitzen keine unmittelbare Perspektive einer militärischen Intervention. Russland sieht sich nicht einem vereinten Westen gegenüber, sondern einer Reihe von unterschiedlichen Ländern, die alle ihre eigenen imperialistischen Interessen verfolgen, wie sehr sie seine Züge in der Ukraine verbal auch verurteilen mögen. Großbritannien will keine Sanktionen, die russische Investitionen in der City beeinträchtigen könnten; Deutschland ist vorsichtig wegen seiner gegenwärtigen Abhängigkeit vom russischen Gas, auch wenn es nach anderen Energieversorgern Ausschau hält. Die baltischen Staaten sind für die schärfste Verurteilung und für harte Maßnahmen, da sie sich angesichts eines großen Anteils an russisch sprechender Bevölkerung ebenfalls bedroht fühlen. So hat der Ukraine-Konflikt eine weitere Spirale militärischer Spannungen in Osteuropa ausgelöst; er zeigt, dass Letztere ein unheilbares Krebsgeschwür sind.
Zurzeit hat Russland es mit Sanktionen zu tun, die potenziell sehr abträglich sind, da Russland stark auf seine Öl- und Gasexporte angewiesen ist. Sein jüngster Deal, der Verkauf von Erdgas an China, wird eine große Hilfe sein. China enthielt sich bei der Verurteilung der russischen Annexion der Krim durch die UN. Hinsichtlich der Propaganda beansprucht China Taiwan auf der Grundlage derselben Prinzipien, auf die Russland bezüglich der Krim pocht, nämlich die Einheit des chinesisch sprechenden Volkes. Dagegen möchte es nicht das Prinzip der Selbstbestimmung zulassen, hat es doch selbst viele Minderheiten in seinen Grenzen.
Alle Fraktionen der Bourgeoisie, sowohl die ukrainische als auch jene Aufwiegler von außen, sehen sich einer Situation gegenüber, in der jeder Zug die Dinge noch weiter verschlimmert. Dies ist wie der Zugzwang beim Schach, ein Spiel, das in Russland und in der Ukraine sehr beliebt ist: eine Situation, in der jeder Mitspieler seine Position nur verschlechtern kann, trotzdem er einen Zug machen muss – oder aufgeben muss. Beispielsweise wollen Kiew und die EU eine engere Assoziation, was nur zu Konflikten mit Russland und zum Separatismus im Osten führen kann; Russland möchte seine Kontrolle über die Krim sichern, doch statt die Kontrolle über die Ukraine oder ihre östliche Region zu übernehmen, ist alles, was es tun kann, zum Separatismus und zur Instabilität aufzuwiegeln. Je mehr sie versuchen, ihre Interessen zu verteidigen, desto chaotischer wird die Situation, desto mehr rutscht das Land in den offenen Bürgerkrieg – wie Jugoslawien in den 1990er Jahren. Dies ist ein Merkmal des Zerfalls des Kapitalismus, in dem die herrschende Klasse nicht mehr in der Lage ist, auch nur eine Perspektive für die Gesellschaft vorzubringen, und in dem die Arbeiterklasse noch nicht im Stande ist, ihre eigene Perspektive vorzustellen.
Die Gefahr für die Arbeiterklasse
Die Gefahr für die Arbeiterklasse in dieser Lage besteht darin, dass sie von allen möglichen nationalistischen Fraktionen rekrutiert wird. Diese Gefahr ist umso größer, da sich die reale Barbarei auf die historische Feindschaft stützt, die von allen Fraktionen im 20. Jahrhundert praktiziert wurde: Die ukrainische Bourgeoisie kann die Bevölkerung und besonders die Arbeiterklasse an die Hungersnot erinnern, die in Folge der Zwangskollektivierung im stalinistischen Russland Millionen von Menschen das Leben kostete; die Russen können ihre Bevölkerung an die ukrainische Unterstützung Deutschlands im Zweiten Weltkrieg erinnern; und die Tartaren haben nicht ihre Vertreibung von der Krim und das Sterben von 200.000 Menschen vergessen. Es gibt zudem die Gefahr, dass ArbeiterInnen dazu verleitet werden, die eine oder andere Fraktion für ihr wachsendes Elend verantwortlich zu machen, und auf dieser Grundlage in die Unterstützung der einen oder anderen von ihnen getrieben werden. Keine dieser Fraktionen hat der Arbeiterklasse etwas anderes anzubieten als eine sich verschlimmernde Austerität und blutige Konflikte.
Sicherlich werden sich einige ArbeiterInnen von pro- oder antirussischen Gefühlen hinreißen lassen[3], doch kennen wir die Situation vor Ort nicht. Die Tatsache jedoch, dass der Donbass zu einem Schlachtfeld für nationalistische Kräfte geworden ist, unterstreicht die Schwäche der Arbeiterklasse in dieser Region. Angesichts von Arbeitslosigkeit und Armut war sie nicht imstande gewesen, zusammen mit ihren Klassenbrüdern und –schwestern in der Westukraine Kämpfe für ihre eigenen Interessen zu entwickeln, und ist mit der Gefahr der Spaltung konfrontiert.
Es gibt eine winzige, aber gleichwohl bedeutende Minderheit von Internationalisten in der Ukraine und in Russland, die KRAS und andere, deren mutiges Statement: „Krieg dem Krieg! Nicht einen einzigen Blutstropfen für die ‚Nation‘!“[4] die Position der Arbeiterklasse vertritt. Auch wenn sie noch nicht mit ihrer eigenen revolutionären Perspektive aufwarten kann, bleibt die Arbeiterklasse international ungeschlagen, und dies ist die einzige Hoffnung auf eine Alternative zum Kapitalismus, der kopfüber in die Barbarei und Selbstzerstörung stürzt.
Alex, 8.6.2014
[1] Niemand, der 1966 in Großbritannien lebte, kann an einer solchen Schlammlawine denken, ohne sich an die Katastrophe von Aberfan zu erinnern, in der eine Abraumhalde eine Grundschule unter sich begrub und dabei 116 Kinder und 28 Erwachsene tötete.
[2] The Economist, 31.5.2014
[3] Beispielsweise versammelten sich 300 Bergarbeiter, eine nicht unbedeutende Zahl, um die Separatisten zu unterstützen (www.theguardian.com/world/2014/may/28/miners-russia-rally-donetsk [6]).
Aktuelles und Laufendes:
- Imperialismus [8]
- Zerfall [9]
Theoretische Fragen:
- Krieg [10]
Rubric:
Die Utopie bringt den Kampf nicht voran
- 1614 reads
Der folgende Artikel wurde das erste Mal im Frühjahr 2014 in Wereldrevolutie, der Zeitung der IKS in den Niederlanden, publiziert. Er ist eine Antwort auf Betrachtungen der Kritischen Studenten Utrecht (KSU), die auf ein breites Echo in der Gesellschaft stießen. In September 2013 widmete die KSU eine Ausgabe ihrer Zeitung Krantje Boordje dem Thema Utopie.
In den letzten Jahren wurden immer mehr Stimmen laut, die radikalere Ansprüche stellen und die Lösung in einer grundlegenden Umwälzung der Gesellschaft suchen. Die Kämpfe der vergangenen Jahre (Occupy, Indignados, usw.) haben deutlich gemacht, dass Teilforderungen allein, Forderungen in bestimmten Bereichen der Gesellschaft, durchaus ein Ausgangspunkt für den Kampf sein können, aber, sofern sie nicht durchgesetzt und nicht im und durch den Kampf selbst weiter entwickelt werden können, ab einem bestimmten Moment dem Kampf in die Parade fahren. Es ist der Text Sanders von den KSU, der versucht, die Frage zu beantworten.
„Der Kampf um Reformen scheint realistischer zu sein, aber es lohnt sich trotzdem, für ein Zusammenleben zu kämpfen, das genau so ist, wie du es dir vorstellst. Mit dem Einfordern von Reformen riskierst du, dass der Kampf geschwächt wird, sobald die Forderungen einmal erfüllt sind. […] Die grundlegenden Ursachen […] sind leicht durch die gemäßigten Parteien, die den Widerstand kanalisieren, zu übergehen. Wenn du allerdings für ein ganz anderes Zusammenleben kämpfst, […] dann kannst du darauf weiter aufbauen, weil dein Endziel von Anfang an ein ganz anderes Zusammenleben ist, und so kannst du dazu übergehen, was du wirklich vor Augen hast.“ (Sander van Lanen, „Onpraktisch denken als praktische oplossing“, Krantje Boordje, Nr. 18, 2013)
Und Sander ist nicht der einzige, der findet, dass das Aufstellen von „realistischen Forderungen“ den Kampf nicht weiter bringt. Auch andere plädieren dafür, weitergehende Forderungen zu stellen:
„Wer die Kunst vermarktet, schafft das Versprechen auf die Zukunft ab. Wahre Kunst steckt voller Möglichkeiten und Fantasie, und das ist es, wo die Veränderung beginnt. Auch der Künstler und der Kulturliebhaber müssen es hinsichtlich der Kulturpolitik wagen, über radikale Änderungen nachzudenken.“ (Robrecht Vanderbeeken, „De verbeelding aan de macht! (Ook in het cultuurbeleid)”, De Wereld Morgen, 2013)
„Die letzten Jahre haben mich gelehrt, dass viele Menschen inzwischen wissen, dass radikale Veränderungen unvermeidlich sind. Die soziale, ökologische und wirtschaftliche Krise ist nicht mit der ‚üblichen Praxis‘ zu überwinden, mit business as usual. Bestehende Konzepte haben zu den Krisen geführt und können nicht für deren Lösung benutzt werden.“ (Martijn Jeroen van der Linden, „Radicale verandering“, Economie, Filosofie en Kunst, 2013)
Aber wie kann man radikalere Forderungen stellen als die, für die man schon immer gekämpft hat, nämlich für die Abschaffung des Kapitalismus? Etwas orientierungslos, aber nicht entmutigt und geschlagen ziehen sich die kämpferischen Genossen der KSU zurück, um die Wunden zu lecken und die Lehren zu ziehen auf der Suche nach einem anderen Weg, um eine breitere Bresche in die Mauer des kapitalistischen Staates zu schlagen. Auf der Webseite der Kritischen Studenten aus Utrecht sind verschiedene Artikel erschienen, die einen Ansatz für ein neues strategisches Konzept für den kommenden Kampf zu finden versuchen.
Allerlei Gruppierungen, vornehmlich anarchistische, bewegen sich schon seit Jahren auf ausgetretenen Pfaden. Die KSU ist eine der wenigen Gruppen des politischen Milieus, in denen noch Leben steckt; sie scheint die Fähigkeit zu besitzen, einen anderen Weg zu gehen, um zu versuchen, aus der Sackgasse herauszukommen, worin sie sich wegen ihres eigenen Aktivismus zeitweise befand. Die KSU ist eine Gruppierung, die schon seit etlichen Jahren besteht. Sie ist keine klassische Aktivistengruppe. Obwohl nichts darauf hinweist, dass viele Diskussionen innerhalb der Gruppe stattfinden, sind die Teilnehmenden doch an Theorie interessiert. Regelmäßig erscheinen Texte, meistens übernommene, die das eine oder andere Thema vertiefen. Die Gruppe ist ziemlich heterogen. Sie hat kein festes ideologisches Konzept (anarchistisch, situationistisch, modernistisch, usw.) und entwickelt hauptsächlich Aktivitäten im Rahmen von Hochschulbildung und Wissenschaft. Auch wenn der Kern von Leuten schon seit einigen Jahren derselbe geblieben ist, werden doch regelmäßig neue, junge Leute angezogen, die dieser Gruppierung mit neuen Ideen neues Leben einhauchen. Wie erst kürzlich mit der Veröffentlichung von Beiträgen zu einer utopistischen Strategie, die dem antikapitalistischen Kampf möglicherweise wieder etwas Perspektive geben kann.
Nehmen wir z. B. den Artikel „Ökotopia“ aus der jüngsten Ausgabe, in dem die Anstrengung unternommen wird, gegen das dauernde Streben nach Wachstum und den endlosen Konsum, wozu die kapitalistische Produktionsweise führt, eine utopische Alternative einer Gesellschaft zu skizzieren, in der die Natur an erster Stelle steht. In einem zweiten Artikel auf dieser Webseite mit dem Titel „Realität über Träume und Fantasie“ steht geschrieben: „Träume von einer besseren Welt. Unrealistisch! Unpraktisch! Zeitverschwendung! Gefährlich? Wir haben den Wert des Idealismus vergessen.“ In einem dritten Artikel („Unpraktisch denken als praktische Losung“) kann man lesen: „Andere wählen sofort das Endziel und stellen utopische Forderungen. […] Indem man sich ein weitreichendes Ziel steckt, wird man mehr Menschen für dieses Ziel finden […] Es scheint utopisch, aber es ist vielleicht die praktischste Vorgehensweise.“
Dass die gerade genannten Artikel nicht das Bedürfnis einer zufälligen Gruppe zum Ausdruck bringen, sondern eine Reaktion auf ein allgemeines Bedürfnis der nicht ausbeutenden Schichten der Gesellschaft sind, zeigt sich in der Tatsache, dass im letzten Jahr verschiedene Bücher über die Utopie erschienen sind, so:
- „Die neue Kooperation zwischen Realität und Utopie“ von Walter Lotens;
- „Von der Krise zu einer machbaren Utopie“ von Jan Bossuy;
- „Die neue Demokratie und andere Formen der Politik“ von Willem Schinkel.
Und dabei ist es nicht geblieben. Die Zeitschrift „Konfrontation“ hat den Hauptteil einer Ausgabe der Frage der Utopie gewidmet. Ein Jahr zuvor fanden drei Radiosendungen über utopische Ideen statt. Und unlängst hat in Leiden eine Podiumsdiskussion über dasselbe Thema stattgefunden.
Antikapitalismus ist nicht genug; das haben die Leute von der KSU inzwischen wahrscheinlich wohl begriffen. Das war übrigens schon einmal in einem früheren Beitrag auf der Webseite der KSU unterstrichen worden.[1] Es muss auch einen Ausblick auf eine reelle Perspektive einer anderen Gesellschaft geben. Diese Perspektive stellt eine andere Zukunft dar, bildet eine Anziehungskraft, die dem heutigen Kampf eine Richtung und Inspiration geben kann. Nach Willem Schinkel haben auch wir mehr utopische Fantasie nötig, stellt sie doch ein Mittel dar, um über das reine Problemmanagement hinauszugehen. Um den rein antikapitalistischen Charakter des Kampfes zu übersteigen, legen manche die Betonung auf die Bedeutung von Träumen, denn das utopische Denken ist die Kunst des Traums von einer Alternative. Um unserer Wirklichkeit zu entrinnen, müssen wir tatsächlich lernen, über den Horizont des Kapitalismus hinauszuschauen und die Vision einer Alternative und einer besseren Welt mit Inhalt zu füllen. Um den Gedanken eine Form, Struktur einer solchen Gesellschaft zu geben, müssen wir uns einlassen auf eine Idealvorstellung, auch wenn diese eine materielle Grundlage hat. Befreit von der Notwendigkeit, nach einer praktischen Lösung für das tägliche Elend im Kapitalismus zu suchen, entsteht ein Freiraum, um in unseren Gedanken eine ideale Vorstellung zu schaffen.
„Die Fantasie an die Macht“ lautete die berühmte Losung der Mairevolte 1968 in Frankreich. Nicht dass die Fantasie genügen würde, um eine andere Gesellschaft zu verwirklichen, aber Fantasie kann eine wichtige Aufgabe erfüllen. „Wir müssen zu träumen wagen. Denn von einer besseren Welt zu träumen bedeutet, über die heutige Welt nachzudenken. Wenn man nämlich über Dinge nachdenkt, die unmöglich erscheinen, wird man in die Lage versetzt, über den vorgegebenen Rahmen hinaus zu denken, ungeachtet dessen, ob die Idee ‚realisierbar‘ ist oder nicht.“ (Ying Que, Realität über Träume und Fantasie, Krantje Boordje, Nr. 18, 2013)
Die kulturelle Komponente im Kampf gegen den Kapitalismus
Der Kampf gegen den Kapitalismus besteht aus drei Teilen:
- aus dem Kampf gegen die Angriffe auf unsere Lebensbedingungen: auf unsere Einkommen, auf die Bildung, auf die Gesundheitsversorgung usw.;
- aus dem Kampf um die politische Macht: die Ersetzung des Systems des Privateigentums durch gemeinschaftliches Eigentum;
- aus dem Kampf gegen Entfremdung, gegen die Verengung des Bewusstseins, gegen die Abstumpfung durch die maschinenartige Lebensweise als bedeutsame Aspekte der kulturellen Komponente des Kampfes.
Diese dritte Komponente, die kulturelle Komponente des Kampfes, ist gekennzeichnet durch grundlegende menschliche Eigenschaften, wie moralische Verpflichtungen (der inneren Stimme) und künstlerische Empfindungen (das Gefühl für die Schönheit), aber auch durch Aspekte der Einbildungskraft und Fantasie, der Schöpferkraft und Intuition. „Die Fantasie umfasst alles, sie entscheidet über Schönheit, Rechtschaffenheit und Glück, die alles bedeuten in der Welt.“ (Blaise Pascal[2], Pensées, 1669) Der Kampf „für den Sozialismus ist nicht eine Messer-und-Gabelfrage, sondern eine Kulturbewegung […]“ (Rosa Luxemburg an Franz Mehring, 1919)
In den Augen von Henriette Roland-Holst[3] bekommt der Kampf erst seine Bedeutung, wenn Vernunft, Intuition und Eingebung zusammenfließen. Es ging ihr darum, „auf die innere Stimme zu hören“, wobei Wahrhaftigkeit und Mitgefühl die zwei vornehmsten seelischen Kräfte sind. Nach Roland-Holst erkennt man die Welt nicht in ihrer Gänze, wenn man sie allein durch die Brille der Vernunft betrachtet. Die Intuition, das Gefühl, die Wahrnehmung und ihre Zusammenfassung in der Fantasie sind die anderen unverzichtbaren Momente. (Roland-Holst, „Kommunismus und Moral“, 1925)
„Indem man sich ein weitreichendes Ziel steckt, wird man mehr Menschen für dieses Ziel finden und werden sich mehr Menschen in diesem Ziel wiederfinden. […] Es scheint utopisch […]“ Das Voranstellen einer Utopie im Rahmen des Kampfes um Forderungen hat jedoch in der heutigen Periode noch nie zu einer allgemeinen Mobilisierung von Arbeitern, Studenten und Arbeitslosen geführt. Die „utopische“ Forderung nach einem Grundeinkommen für jeden, die von der extremen Linken propagiert wird, führt zum Gegenteil einer Vereinigung im Kampf. Die vergleichbare Forderung nach „freier Bildung“ [ohne Staatsaufsicht], welche die KSU unlängst als eine „utopische“ Forderung propagiert hat, hat nichts gebracht. Dies deshalb, weil diese „Utopie“ sich nicht auf der Ebene des materiellen Kampfes bewegt, sondern etwas Typisches für den rein geistigen Kampf ist. Natürlich ist und bleibt der Kampf für die Verteidigung der materiellen Lebensbedingungen unter den heutigen Umständen die allererste Sorge im Klassenkampf. Denn ohne ein Minimum an Lebensmöglichkeiten ist das Leben sowieso nicht wert, gelebt zu werden. Aber der Kampf gegen den Kapitalismus und seine engstirnige und beschränkte Ideologie macht hier nicht Halt. Das Streben nach einem tieferen Bewusstsein, nach Wahrheit wird nicht allein durch materielle Dinge motiviert, wie z. B. ein menschenwürdiges Einkommen für jedermann, sondern auch durch das Vorbild eines Ideals. „Wir haben den Wert des Idealismus vergessen.“ Ohne uns als Idealisten einzuschätzen, liegt der höchste Wert des Kampfes für eine andere Gesellschaft letztendlich nicht auf der Ebene des Materiellen, sondern auf der Ebene des Bewusstseins, des geistigen Kampfes. Und wir können hier nur ansetzen, wenn wir begreifen, dass der schöpferische Gedanke dabei ein unverzichtbares Moment bildet. Das Übersteigen der Grenzen des bestehenden Systems im Kopf, in der idealen Vorstellung ist nicht möglich ohne Intuition und Fantasie. Die Erschaffung von Idealen in unserem Geist ist eine mächtige Kraft, die den Kampf entscheidend stimulieren kann.
Es mag deutlich geworden sein, dass es kurzsichtig ist, uns hier auf die Quelle der Inspiration zu beschränken, die durch die oben genannten Gruppen und Kropotkin entwickelt wurden. Wir müssen uns den Wert der Fantasie, die schöpferischen Gedanken, die die ganze Geschichte der Menschheit hindurch schon immer ein wesentliche Kraft für den Fortschritt waren, in einem weitergehenden Rahmen ansehen. Die Menschen leben nämlich auch in einer Welt von Ideen und Idealen, nach denen zu streben in bestimmten Momenten wichtiger sein kann als der Trieb zum Erhalt der unmittelbaren materiellen Lebensumstände. So wurden beispielsweise die sozialdemokratischen Revolutionäre vom revolutionären Aufschwung in Russland 1905 überrascht, überflügelt, hinter sich gelassen und waren verblüfft über das Ungestüme der Bewegung, über ihre neuen Formen und ihre schöpferische Fantasie.
Ein Vorbild für das beharrliche Bemühen, das von Fantasie und Inspiration geleitet wurde, ist das Leben von Leo Tolstoi. Die Quelle seiner Kraft kam aus der Tiefe seiner Persönlichkeit, die ihm den Mut gab, sich unbeirrt auf die Suche nach Wahrheit zu begeben. So wie Rosa Luxemburg 1908 in der Leipziger Volkszeitung schrieb: „… sein ganzes Leben und Schaffen war zugleich ein unermüdliches Grübeln über die ‚Wahrheit‘ im Menschenleben.“ (Tolstoi als sozialer Denker in Luxemburg Werke, Band 2, Seite 246) Tolstoi war ein Forscher und Kämpfer, aber keineswegs ein revolutionärer Sozialist. Trotzdem erfasste er mit seiner Kunst sehr wohl das ganze menschliche Leid und Elend und die ganze menschliche Leidenschaft, alle Schwächen und Gemütslagen, was ihn in die Lage versetzte, bis zum letzten Atemzug mit offenen Augen den sozialen Problemen gegenüberzutreten.
Zyart, 15.01.2014
[1]Arjan de Goede, „Reine Antikapitalisten? Das sind wir vielleicht doch nicht alle“, 2013
[2]Blaise Pascal (1623-1662, Frankreich) war ein Mathematiker, Naturwissenschaftler und Philosoph. In seinem philosophischen Werk Pensées (Gedanken) verteidigt er eine christliche Weltanschauung und thematisiert den menschlichen Geist, die Rede, Moral, Religion und Politik.
[3]Henriette Roland-Holst (1869-1952) war eine bekannte Poetin und Sozialistin/Kommunistin in den Niederlanden zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Siehe auch das Buch und die Artikel der IKS über die Deutsch-Holländische Kommunistische Linke.
Aktuelles und Laufendes:
- Utopie [11]
Rubric:
Im Dilemma: Die deutsche Bourgeoisie und der Ukraine-Konflikt
- 2126 reads
Der Konflikt in und um die Ukraine stellt die deutsche Bourgeoisie vor besondere Herausforderungen. Wir möchten dieses Thema hier aus der Sicht der Arbeiterklasse aufgreifen. Es gibt gute Argumente für die Annahme, dass sich für Deutschland und allgemeiner für Westeuropa gegenwärtig eine Veränderung abspielt, die für die zukünftige Konstellation der Kräfte des Klassengegners wichtig wird.
In den letzten Monaten hat es in den Reihen der herrschenden Klasse in Deutschland ungewohnt viel Aufregung um das Verhältnis zu den USA einerseits und zu Russland andererseits gegeben. Während sich Regierung und Opposition in der Außenpolitik der letzten 25 Jahre in den wesentlichen Zügen immer einig gewesen sind – in Jugoslawien, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien – tauchen heute angesichts der Offensive Russlands in der Ukraine Dissonanzen auf, die selbst die Regierungskoalition erfassen. Außenminister Steinmeier bemüht sich, die Wogen im Osten zu glätten wie umgekehrt Bundeskanzlerin Merkel diejenigen im Westen – beide sind in der Defensive und dies mit unterschiedlichen Ausrichtungen. Steinmeier versucht, in der Tradition Schröders die begonnene wirtschaftliche Allianz zwischen Deutschland und Russland trotz der politischen und militärischen Offensive Putins weiter zu verfolgen, während Merkel die alte „Freundschaft“ mit den USA trotz wiederholten Geheimdienstskandalen nicht aufgeben will.
Wir haben im Artikel zur Lage in der Ukraine vom Dezember 2013[1] die Einschätzung vertreten, dass die gegenwärtige Entwicklung der Ereignisse auf einer Offensive Russlands beruht – ein Versuch Russlands, die Niederlage und Demütigung der „Orangenen Revolution“ 2004/05 rückgängig zu machen. Ein halbes Jahr später finden wir diese These bestätigt. Dabei möchten wir insbesondere einige Fragen zu den Konsequenzen für die imperialistischen Gelüste Deutschlands aufwerfen.
Der geschichtliche Rahmen – die Zäsur von 1989
Um die heutige Lage zu verstehen, müssen wir uns zunächst den größeren Rahmen in Erinnerung rufen: Der Zusammenbruch des Ostblocks 1989 führte zu einer qualitativen Veränderung bei den imperialistischen Konflikten. Die NATO blieb zwar als Militärbündnis unter us-amerikanischer Vorherrschaft bestehen, von einem Block im alten Sinn konnte man aber auch im Westen nicht mehr sprechen. Gerade auf dieser Ebene war der vollzogene Übertritt in ein neues Zeitalter des Kapitalismus (dasjenige des Zerfalls) besonders handgreiflich. Die Zentrifugalkräfte dieser dekadenten Gesellschaftsordnung nahmen Überhand. Die Staaten, die sich vorher einer Blockdisziplin unterwerfen mussten, namentlich Deutschland, konnten nun offener ihre eigenen und im Vergleich zum früheren Blockführer divergierenden Interessen verfolgen. Die Kriege auf dem Balkan und die Aufteilung Jugoslawiens gehörten in den 1990er Jahren zu den ersten unmittelbaren Resultaten dieser neuen Ära.
Die ehemaligen Blockführer USA und Russland wurden geschwächt und reagierten beide – mit roher Gewalt. Die USA blieben alleinige Supermacht und Weltpolizist. Im Bemühen darum, diese Rolle nicht in Frage gestellt zu sehen, traten sie ständig aggressiv auf. Aber ihre militärischen Feldzüge, insbesondere in Afghanistan und im Irak bewirkten das Gegenteil von dem, was angeblich beabsichtigt war: mehr Chaos statt Stabilität und Sicherheit (vgl. dazu Obamas eigene Bilanz: „Einige unserer kostspieligsten Fehler entstanden nicht aus unserer Zurückhaltung, sondern aus unserer Bereitschaft, uns in militärische Abenteuer zu stürzen, ohne über die Konsequenzen nachzudenken.“ – im Artikel „Die Ukraine gleitet in die militärische Barbarei ab“ in dieser Nummer der Zeitung zitiert[2]). Russland umgekehrt musste als Koloss auf tönernen Füßen zuschauen, wie zuerst die Sowjetunion demontiert und dann auch noch die Pufferzonen im Westen (ehemalige Ostblockstaaten, Baltikum) abfielen. Im Nordkaukasus, namentlich in Tschetschenien, stellte sich Russland dem weiteren Auflösungsprozess mit einer Politik der verbrannten Erde entgegen. Die 1990er Jahre waren für den russischen Imperialismus ein Jahrzehnt der Gebietsverluste und der Defensivkämpfe. – Die beiden ehemaligen Blockführer befinden sich also seit 1989 im Sinkflug, wenn auch auf unterschiedlicher Höhe und auf andere Art.
Mit den Kriegen im Irak und in Afghanistan verfolgten die USA eine Umzingelungsstrategie gegenüber Russland. Gleichzeitig versuchten die USA, ihre ehemaligen „Partner“ im westlichen Block durch die Fortsetzung der Militärbündnisse unter Kontrolle zu halten. Gegenüber Deutschland spielt dabei die NATO die wesentliche Rolle. Deutschland ist militärisch zu schwach, um sich von den USA zu emanzipieren. Umso wichtiger ist für die deutsche Außenpolitik die EU und die enge Anlehnung an Frankreich, das zwar längst nicht mehr die „Grande Nation“, aber doch noch eine Atomstreitmacht ist.
Die neue imperialistische Konstellation in Europa führte aber auch dazu, dass deutsche Politiker und Wirtschaftskapitäne die Hände nach Russland ausstreckten, und zwar in langfristigem Kalkül. Aus deutscher Sicht gibt es gute Gründe, gemeinsame Interessen mit Russland auf wirtschaftlichem Gebiet zu verfolgen. Russland verfügt über die nötigen Rohstoffe für die deutsche Industrie und ist ein Absatzmarkt für die von ihr produzierten Waren. Der Export deutscher Güter nach Russland ist zwar vom Umfang her nicht bedeutend, er beträgt weniger als 5% des gesamten Exportgeschäftes des Landes; aber der Handel zwischen den beiden Ländern begünstigt – wie immer im Kapitalismus – auf lange Sicht den wirtschaftlich Stärkeren, und das ist Deutschland. Die deutsche Industrie exportiert Fertigprodukte, namentlich Maschinen; Russland verkauft in umgekehrter Richtung Rohstoffe, vor allem Erdöl und Erdgas.
Auch militärisch-strategisch gibt es gemeinsame Interessen zwischen Deutschland und Russland. Moskau ist militärisch an seiner Westgrenze durch die NATO bedroht. Da die NATO in erster Linie ein Herrschaftsmittel der USA ist und Deutschland seine Vormachtstellung in Europa nur ausbauen kann, wenn der Einfluss der USA eingeschränkt wird, gibt es ein gemeinsames Anliegen für Deutschland und Russland – dass nämlich die NATO nicht noch weiter nach Osten greift. Russland und Deutschland wollen den US-Einfluss möglichst zurückbinden.
In der Außenpolitik spielt auch die Geographie eine wichtige Rolle. Marx hat im 19. Jahrhundert einen Aspekt beleuchtet, der selbst nach allen Katastrophen des 20. Jahrhunderts gerade in Osteuropa immer noch gilt: Russland ist aufgrund seiner geographischen Lage dazu verurteilt, eine Politik in Bezug auf die Mächte Westeuropas zu führen, also eine Europapolitik zu betreiben – obwohl ihm zu einer erfolgreichen Strategie im 19. Jahrhundert die Kräfte fehlten.
Die Triebkräfte in der aktuellen Konstellation
Deutschland verfügt über eine konkurrenzfähige Industrie und hat mittels der EU einen Wirtschaftsraum erhalten und mitgeschaffen, der ihm Zugang zu einem großen, bevölkerungsreichen Absatzmarkt gibt. Der deutsche Imperialismus kann seine Stellung am besten ausbauen, wenn eine von Deutschland dominierte EU gegenüber den USA an Autonomie gewinnt, ohne in neue Abhängigkeiten, z.B. gegenüber Russland, zu geraten.
Russland hat umgekehrt mit dem eingeleiteten Abfall der Ukraine vor 10 Jahren eine Demütigung, einen Eingriff in seine Einflusssphäre hinnehmen müssen, auf den es so bald wie möglich zurück kommen musste. Die Ukraine ist für Deutschland seit dem Ersten Weltkrieg ein immer wieder kehrendes Ziel der Machtgelüste gewesen – der Drang nach Osten, die beiden Weltkriege sind brutale Belege dafür. Trotz veränderter Verhältnisse ist die Kornkammer Ukraine auch heute noch ein wichtiger Faktor im Ringen um Einfluss. Dazu kommt ein etwas veraltetes, aus der Sowjetära stammendes Inventar mit dem entsprechenden Know-how auf dem Gebiet der Weltraum- und Luftfahrttechnologie.
Deutschland will das Dilemma vermeiden, sich in seinen Allianzen entweder für die Ukraine oder für Russland zu entscheiden – aber wenn es sich entscheiden müsste, hat Moskau mehr zu bieten als Kiew. Auf der Erscheinungsebene der aktuellen politischen Praxis sieht man folgende Allianzen: Zur Geburtstagsparty des früheren Bundeskanzlers Schröder im April 2014 war auch Putin eingeladen. Die Party war organisiert von der Pipeline Gesellschaft North-Stream. Diese gehört zu 51 Prozent dem russischen Gasriesen Gazprom (wo Schröder sich verdingt). Die anderen 49 Prozent aber liegen in deutschen, niederländischen und französischen Händen. Der deutsche Energiekonzern E.ON aus Düsseldorf und die zur BASF-Gruppe gehörende Wintershall Holding mit Sitz in Kassel teilen sich zusammen 31 Prozent der Anteile. Die Schlüsselpositionen in dem Unternehmen sind zu einem Großteil mit Deutschen besetzt. Unter den Gästen der Feier waren nach Angaben aus der North-Stream-Zentrale in Berlin unter anderen Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) (in Mecklenburg-Vorpommern erreicht die Pipeline deutschen Boden), der deutsche Botschafter in Moskau, Rüdiger Freiherr von Fritsch, der E.ON-Vertriebsvorstand Bernhard Reutersberg und weitere Manager der Nord-Stream-Anteilseigner Wintershall und E.ON. Für Aufregung sorgte die Teilnahme des außenpolitischen Sprechers der CDU und langjährigen JU-Vorsitzender Philipp Mißfelder.
Ebenfalls waren der Siemens-Chef Joe Kaeser und der Bahn-Chef Rüdiger Grube bereits Ende März mit Putin zusammengetroffen.
Hier treffen wir also auf einen potenten Ausdruck vorsichtiger und langjähriger deutsch-russischer Zusammenarbeit, die zu einem Großteil auf politisch-strategische Bemühungen aus der SPD und den Konzernzentralen von systemrelevanten Unternehmen (E.ON, BASF, Siemens, Deutsche Bahn sind rein juristisch gesehen keine Staatsunternehmen) basieren. Der rein politische Ausdruck dieser Tendenz der deutschen Bourgeoisie scheint derzeit eher schwach zu sein, worauf die Anwesenheit des widerlichen Pogromisten Mißfelder auf Schröders Geburtstagsparty hindeutet (bekannt oder besser berüchtigt geworden ist er als JU-Vorsitzender mit der Parole: „alte Leute brauchen keine künstliche Hüfte, sie sind auch früher an Krücken gelaufen“), und dennoch darf diese Tendenz nicht ignoriert werden.
Destabilisierungspolitik Russlands
Diese Fakten und die Entwicklung des Krieges in der Ukraine lassen den folgenden Schluss zu: Russland versucht zielstrebig, die NATO und letztlich auch die EU zu destabilisieren. Dabei geht es augenscheinlich darum, einen Keil in die transatlantische Allianz zwischen Deutschland und die USA zu treiben. Auf dem Hintergrund der Geschichte des 20. Jahrhunderts, unter Berücksichtigung der strategischen Bedeutung Deutschlands auf dem Kontinent, muss Russland die deutschen gegen die us-amerikanischen Interessen ausspielen. Im Kalten Krieg war die DDR eine zuverlässige Stütze des stalinistischen Imperialismus; die Büros in Berlin mussten zwar geräumt, aber alte Freundschaften können weiter gepflegt oder neue geknüpft werden. Deutschland spielt auf der anderen Seite für das transatlantische Bündnis unter amerikanischer Vorherrschaft eine Schlüsselrolle. Ohne seine Mitgliedschaft in der NATO verliert dieses Militärbündnis strategisch entscheidendes Terrain: In Europa bräche der zentrale Pfeiler ein, das Bollwerk der amerikanischen Militärpräsenz auf diesem (Sub-)Kontinent.
Man kann darüber spekulieren, ob hinter den peinlichen Leaks, welche die westliche Allianz seit Edwards Snowdens Kündigung beim NSA torpedieren, Russland steckt. Obwohl sonst nicht gerade als Asylland bekannt, gewährte Russland in zynischem Kalkül Snowden Gastrecht. Die Spezialisten der russischen Geheimdienste – Putin gehörte zu deren Personal, ist durch diese Schule gegangen – dürften den Fundus des NSA-Überläufers auswerten, auch zur Planung der jeweiligen Schachzüge. Gewisse Details darüber, wie die NSA & Co. deutsche Politiker_innen ausspioniert haben, sind willkommenes Salz in der medialen Suppe. Snowden ist so gesehen ein Trumpf in den Händen Russlands. Allerdings ist zu vermuten, dass beim ganzen Hype um ihn seine Rolle im Sinne der demokratisch üblichen Personalisierung gesellschaftlicher Beziehungen überbewertet wird. Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass die russische Spionage ohne Snowden wesentlich schwächer wäre.
Militärisch ist Russland ebenfalls am Drücker. Die Arsenale im Südwesten Russlands stehen für all diejenigen offen, die Waffen, auch grobes Geschütz, brauchen, um in den Krieg zu ziehen, in Donezk und Luhansk. Die Proletarier_innen im Osten der Ukraine sind unsäglichem Leid ausgesetzt – fliehen oder versuchen, trotz Pogromstimmung einen Alltag in diesem Sommer zu leben, als sei nichts geschehen. Eine Fliegerabwehrrakete trifft ein Linienflugzeug auf 10‘000 Metern Höhe – mit 298 Menschen an Bord.
Nicht nur beim menschlichen Grauen, sondern auch auf dem strategischen Schachbrett sind neue Tatsachen geschaffen worden. Die Krim als Brückenkopf zu den Weltmeeren ist annektiert – und die Ukraine für die NATO als potentielles Mitglied entwertet. Diese Prozesse finden auf einer materiellen Grundlage statt, die Russland in doppelter Hinsicht in die Hände spielt:
- Die herrschende Tendenz des Jeder gegen Jeden – Ausdruck der entfesselten Zentrifugalkräfte in der Zerfallsphase des Kapitalismus – ist die Welle, die die regierende Klasse um Putin reiten kann. Zersetzend zu wirken ist heutzutage einfach – im Kleinen wie im Großen. (Dass es umgekehrt mit „konstruktiven“ Projekten nicht so einfach ist, beweist Putins Eurasische Union.)
- Russland – ein Koloss auf tönernen Füßen? – Nicht ganz, denn die Bodenschätze, über deren Ausbeutung es das Monopol hat, werden zwar die Rückständigkeit des produktiven Apparats in Russland nicht aufheben, sind aber viel wert: Die Rohstoffe werden sowohl hüben, wo noch produziert, als auch drüben, wo nur noch im Krieg zerstört wird, gebraucht und nachgefragt. Und weil Russland das Monopol über einen so großen Teil der Welt hat wie sonst kein Land, wird die daraus sich ergebende Verfügungsmacht über Erdöl, Gas und andere strategisch wichtige Rohstoffe Sonderprofite durch den Verkauf dieser Waren in die Schatullen des Kremls spülen.
Oder anders gesagt: Da Russland gegenüber Europa nur Ziele verfolgt, die der zersetzenden Logik folgen, hat es heute im Gegensatz zum 19. Jahrhundert die Möglichkeiten, seine Europapolitik, zu der es aufgrund seiner geographischen Lage gezwungen ist, auch tatsächlich umzusetzen. Die Kriegskasse ist voll und wird weiterhin gespiesen.
Deutscher Imperialismus in der Zwickmühle
Der Krieg in der Ukraine läuft den Interessen des deutschen Imperialismus zuwider. Dabei geht es nicht in erster Linie um die wirtschaftlichen Geschäfte, die zu ihrer Entfaltung stabile und „befriedete“ Verhältnisse bräuchten, sondern um die geostrategische Lage für Deutschland: Es kann militärisch weder Russland noch den USA die Stirn bieten. Deutschland braucht zum Ausbau seiner Macht in Europa (und der Welt) eine von ihm kontrollierte Zone zwischen den USA und Russland, eine Art Grauzone, in der es seinen Einfluss vor allem dank der wirtschaftlichen Stärke konsolidieren kann. Der Vorstoß Deutschlands nach Osten ist zwar strategisch konzipiert, beruht aber einstweilen im Wesentlichen auf seiner wirtschaftlichen Konkurrenzfähigkeit. Mit dem Krieg in der Ukraine stehen sich aber Russland und die USA (mittels der NATO) in Osteuropa gegenüber – in einem Gebiet, das eigentlich Deutschland als seine Einflusssphäre aufbauen will, jedoch militärisch nicht verteidigen kann.
Die deutsche Bourgeoisie sieht sich also mit einer Situation konfrontiert, die nicht sie geschaffen hat und nicht von ihr kontrolliert werden kann. Die USA arbeiten dabei ebenso bewusst gegen die deutschen imperialistischen Interessen wie Russland. Beide wollen nicht mit verschränkten Armen zuschauen, wie Deutschland „friedlich“ nach Osten vorstößt. In der Ukraine führt Russland der Welt vor Augen, was ein Land zu erwarten hat, das zu seiner Einflusssphäre gehört und sich nach einem neuen Patenonkel umschaut. Die USA auf der anderen Seite schicken Soldaten und Kriegsmaterial nach Polen – bauen ihre Militärpräsenz in Osteuropa aus, ohne das Deutschland etwas dagegen unternehmen kann.
Auf diesem Hintergrund erstaunt es nicht, dass Berlin sowohl gegenüber Washington als auch gegenüber Moskau zurückhaltend ist. Ins Feuer zu blasen, ist aus deutscher imperialistischer Sicht nicht ratsam. Vielmehr sollte der Brand im eigenen Vorgarten möglichst bald wieder gelöscht werden.
Zwei Modelle – beide auf der gleichen Grundlage
Die internationalistische Gruppe Barikád Kollektíva in Ungarn beschreibt in einem Artikel vom Frühjahr 2014 die politische Ausrichtung der herrschenden Klasse in Russland wie folgt:
“Seit Beginn des neuen Jahrtausends hat sich Russland langsam aber sicher zu einer eigenständigen imperialistischen Kraft in der kapitalistischen Weltordnung errichtet. Die „freie Konkurrenz“ der Jelzin-Ära (Privatisierung, Bandenkriege, wirtschaftliche Zersetzung), in welcher die „aufgeklärte“ Bourgeoisie, die erst gerade dem Ei des Sowjetsystems entschlüpft war, sich wie an einer Party fühlte, entlarvte sich als ihr Totentanz. Die feinen bürgerlichen Ideen Chodorkowskis über die Freiheit – welche die vollkommene Unsicherheit für die Existenz der Massen der Arbeiterklasse bedeutete – wurden schnell durch eine viel prosaischere, seit Urzeiten bestens bekannte und somit kalkulierbare Diktatur der Organe der Staatssicherheit beseitigt. Angesichts der harten ökonomischen Tatsachen von steigenden Ölpreisen konnten die Vertreter der Ideologie der formalen Demokratie wählen: entweder Kniefall vor einer staatlich zentralisierten Wirtschaft oder Auswanderung oder in den Knast.“ (April 2014, barricade.hol.es/kialtvanyok/haborut_a_haborunak-en.html, unsere Übersetzung)
Zwei Herrschaftsmodelle stehen sich gegenüber, wobei Russland unter Putin für das eine der beiden steht: „russischer“ Kollektivismus, offener nationaler Chauvinismus, Populismus, plumpe Propaganda, unverschleierte Repression, militärische Logik. Das Gegenmodell ist das des westlichen Liberalismus: Individualismus, Demokratie, Heuchelei, wirtschaftliche Performance – und verschleierte Repression.
Das „russische“ Modell ist in vielen Ländern wegleitend: bei Großen wie China oder bei Kleineren wie Iran, Venezuela, Ecuador, Kuba. Dieses Modell hat auch im Westen seine Anhänger und Parteien, nämlich die Populisten von Rechts bis Links - von Blochers SVP in der Schweiz bis zur Linken in Deutschland. Unterstützer dieser Tendenz sind in Deutschland auch in wirtschaftlich maßgebenden Kreisen zu finden. Es ist auffällig, zu welcher Ambivalenz gegenüber der sogenannten Werteordnung der Westbindung zum ehemaligen Blockführer USA diese Tendenz fähig ist. So wurde beim China-Besuch von Kanzlerin Merkel Anfang Juli 2014 eine Schrift des Deutsch-Chinesischen Beratenden Wirtschaftsausschusses in der Presse lanciert, darin wurde gefordert, dass die deutsche Presse doch wohlwollender über China berichten und nicht so sehr über mangelnde Menschenrechte jammern solle. Auf deutscher Seite sind neben Joe Kaeser (Siemens) auch Martin Brudermüller (BASF), Martin Winderkorn (VW), Martin Blessing (Commerzbank), Thomas Enders (Airbus), Frank Appel (Post), Jürgen Fitschen (Deutsche Bank), Heinrich Hiesinger (Thyssen-Krupp), Carsten Spohr (Lufthansa) und der BDI-Chef Ulrich Grillo in diesem Ausschuss vertreten. Auch wenn einige Tage später behauptet wurde, dies sei ein Arbeitsentwurf, kann man davon ausgehen, dass die Vertreter der versammelten deutschen (Groß-)Bourgeoisie diese Botschaft bewusst lanciert haben.
Die beiden Herrschaftsmodelle schließen sich keineswegs gegenseitig aus. Geschäfte machen lässt sich mit beiden Seiten, auch über die scheinbaren ideologischen Gräben hinweg – Hauptsache, der „Partner“, sei er liberal-global oder autoritär-korporatistisch, ist zahlungsfähig und –willig. Für das Proletariat ist keine Seite besser, denn letztlich gibt es für die Unangepassten hier wie dort nur die harte Hand der Repression (mit ihrem verlängerten Arm der Psychiatrisierung). Die Logik der Profitmaximierung und Entmenschlichung ist gemeinsame Grundlage beider Modelle – für die liberale Variante muss die Anpassung des Menschen an die Maschine aus innerer Überzeugung – nach calvinistischem Vorbild – gelingen, die autoritär-kollektivistische Variante setzt auf die Zurichtung durch äußere Gewalt.
KH, 02.08.14
[1] Russlands Offensive gegen seine Großmachtrivalen, https://de.internationalism.org/weltrevolution/201402/2432/russlands-off... [12]
[2] Dieses Dilemma der USA haben wir bereits vor dem zweiten Irak-Krieg analysiert, vgl. „Die Barbarei des Krieges im Irak: die bürgerliche Gesellschaft in ihren wahren, nackten Gestalt“, Internationale Revue Nr. 31, Frühjahr 2003
Rubric:
Russlands Offensive gegen seine Großmachtrivalen
- 3055 reads
Seit dem 21. November vergangenen Jahres erlebt die Ukraine eine politische Krise, die wie die so genannte „Orangene Revolution“ von 2004 ausschaut. Wie 2004 liegt sich die pro-russische Fraktion mit der Opposition, den ausgewiesenen Anhängern einer „Öffnung zum Westen“, in den Haaren. Wie damals verschärfen sich die diplomatischen Spannungen zwischen Russland und den Ländern der Europäischen Union sowie den USA.
Dennoch ist dieses Remake keine simple Kopie. 2004 entzündete die Ablehnung von offensichtlich manipulierten Wahlen die Lunte; heute ist es die Ablehnung des Assoziationsabkommens, das von der EU unterbreitet wurde, durch Präsident Janukowitsch, die am Anfang der Krise stand. Dieser Streitfall mit der EU eine Woche vor dem geplanten Datum für die Unterzeichnung des Abkommens provozierte eine gewaltsame Anti-Regierungs-Offensive der verschiedenen pro-europäischen Fraktionen der ukrainischen Bourgeoisie, die von „Hochverrat“ sprachen und den Rücktritt des Präsidenten forderten. Nach dem Aufruf an „das gesamte Volk, darauf zu antworten, als sei es ein Staatsstreich, d.h. auf die Straße zu gehen“[1], besetzten die Demonstranten das Stadtzentrum von Kiew und zelteten auf dem Unabhängigkeitsplatz, dem symbolischen Zentrum der orangenen Revolution. Die brutale Repression, die Konfrontationen mit ihrer großen Anzahl von Verletzten veranlassten den Premierminister Mykola Asarow zur Erklärung, dass „das, was sich derzeit ereignet, alle Anzeichen eines Staatsstreichs hat“, und zur Organisierung von Gegendemonstrationen. Wie 2004 veranstalteten die Medien in den großen demokratischen Ländern eine Menge Lärm über den Willen des ukrainischen Volkes, sich selbst von der Moskau-gestützten Clique, die sich derzeit an der Macht befindet, zu befreien. Die Fotos und Berichte stellen nicht so sehr die Perspektive der Demokratie in den Vordergrund, sondern die gewaltsame Unterdrückung durch die pro-russische Fraktion, die Lügen Russlands und das Diktat Putins. Die Hoffnung auf ein besseres, freieres Leben wird nicht mehr mit der Perspektive eines Wahlsiegs durch die Opposition verknüpft, die sich heute in der Minderheit befindet, anders als 2004, als Viktor Juschtschenkos Wahlsieg eine todsichere Wette war.
Ukraine: ein imperialistischer Preis
2005 schrieben wir in Bezug auf die Orangene Revolution:
„Hinter den Kulissen dreht sich die wesentliche Frage nicht um den Kampf für Demokratie. Der wirkliche Streitpunkt ist die stetig zunehmende Konfrontation unter den Großmächten, insbesondere die gegenwärtige US-Offensive gegen Russland, die darauf abzielt, die Ukraine aus der russischen Einflusssphäre herauszubrechen. Es ist bemerkenswert, dass Putin seinen Zorn im Wesentlichen gegen die USA richtete. In der Tat sind es die USA, die versuchen, ‚die Vielfalt der Zivilisation durch die Prinzipien einer unipolaren Welt, dem Äquivalent eines Erziehungslagers, umzugestalten‘, und ‚eine Diktatur in den internationalen Angelegenheiten (durchzusetzen), die sich mit hübsch klingendem, pseudo-demokratischen Wortgeklingel schmückt‘. Putin schreckte nicht davor zurück, den USA die Realität ihrer eigenen Lage im Irak ins Gesicht zu schleudern, als er am 7. Dezember in Moskau gegenüber dem irakischen Premierminister darauf hinwies, dass es ihm rätselhaft sei, ‚wie es möglich ist, Wahlen im Kontext einer totalen Okkupation durch ausländische Truppen zu organisieren‘! Mit derselben Logik widersetzte sich der russische Präsident der Erklärung der 55 Länder der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa), mit der der derzeit stattfindende Prozess in der Ukraine unterstützt und die Rolle der Organisation bei der Überwachung des Prozederes der dritten Runde in den Präsidentschaftswahlen am 26. Dezember bestätigt wurde. Die Demütigung, die die ‚internationale Gemeinschaft‘ Putin zufügte, indem sie sich weigerte, seinen eigenen Hinterhof anzuerkennen, wird von der Tatsache verschlimmert, dass etliche Hundert Beobachter nicht nur aus den USA, sondern auch aus Großbritannien und Deutschland entsendet werden.
Spätestens seit dem Zusammenbruch der UdSSR und der katastrophalen Konstituierung der Gemeinschaft unabhängiger Staaten (die die Krümel seines Ex-Imperiums retten sollte) standen Russlands Grenzen pausenlos unter Beschuss, sowohl wegen des Drucks aus Deutschland und den USA als auch wegen der ihm inhärenten zentrifugalen Tendenzen. Die Entfesselung des ersten Tschetschenien-Krieges 1992, schließlich der zweite 1996 unter dem Vorwand des Kampfes gegen den Terrorismus drücken die Brutalität einer Großmacht im Niedergang aus, die versucht, ihre strategisch wichtigen Positionen im Kaukasus koste-es-was-es-wolle abzusichern. Für Moskau war der Krieg eine Gelegenheit, sich Washingtons Plänen, die auf die Destabilisierung Russlands abzielen, und jenen Berlins zu widersetzen, das eine unleugbare imperialistische Aggressivität an den Tag legt, wie wir im Frühjahr 1991 sehen konnten, als Deutschland eine Hauptrolle bei der Explosion des Jugoslawien-Konfliktes spielte.
Die Kaukasus-Frage ist also alles andere als gelöst, weil die USA entschlossen damit fortfahren, ihre eigenen Interessen in diesem Gebiet zu fördern. In diesem Zusammenhang ist auch die Vertreibung Schewardnadses aus dem Präsidentenamt im Jahr 2003 verstehen, der von einer pro-amerikanischen Clique ersetzt wurde. Dies erlaubte den USA, ihre Truppen in diesem Land zu stationieren, zusätzlich zu jenen, die bereits in Kirgisistan und Usbekistan im Norden von Afghanistan stationiert worden waren. Dies stärkt die militärische Präsenz der USA im Süden von Russland und bedroht es mit einer Einkreisung durch die USA. Die ukrainische Frage war immer eine Schlüsselfrage gewesen, ob in der Zeit des zaristischen Russland oder in Sowjetrussland, doch heute stellen sich die Probleme auf eine weitaus kritischere Weise.
Auf der wirtschaftlichen Ebene ist die Partnerschaft zwischen der Ukraine und Russland von großer Bedeutung für Moskau, doch vor allem auf militärstrategischer Ebene ist die Kontrolle der Ukraine von noch größerer Bedeutung als der Kaukasus. Dies daher, weil die Ukraine zunächst einmal die drittgrößte Nuklearmacht auf der Welt ist, dank der militärischen Atombasen, die sie aus der Zeit des Ostblocks geerbt hatte. Moskau braucht sie, um im Kontext der interimperialistischen Erpressungen seine Fähigkeit zu demonstrieren, die Kontrolle über solch eine große Nuklearmacht auszuüben. Zweitens, neben dem Verlust jeglichen direkten Zugangs zum Mittelmeerraum würde der Verlust der Ukraine auch die Möglichkeit eines Zugangs zum Schwarzen Meer für Moskau schmälern. Mit dem Verlust des Zugangs zum Schwarzen Meer einschließlich Sewastopol, wo Russland Nuklearbasen unterhält und ein Teil seiner Flotte stationiert hat, steht die Verbindung zur Türkei und nach Asien zu auf dem Spiel. Hinzu kommt, dass der Verlust der Ukraine die russische Position gegenüber den europäischen Mächten und insbesondere gegenüber Deutschland dramatisch schwächen würde, während es gleichzeitig seine Fähigkeit einschränken würde, eine Rolle in Europas künftigem Schicksal und jenem der osteuropäischen Länder zu spielen, von denen die Mehrheit bereits pro-amerikanisch ist. Es gilt als gewiss, dass eine Ukraine, die sich dem Westen zuwendet und daher von ihm und insbesondere von den USA kontrolliert wird, ein Licht auf das völlige Unvermögen Russlands werfen und eine Beschleunigung der Zerfallserscheinungen in der GUS anregen würde, mit all ihren schrecklichen Folgen. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass solch eine Situation ganze Gebiete Russlands selbst nur dazu drängen würde, ihrerseits, und ermutigt von den Großmächten, die Unabhängigkeit zu erklären.“[2]
Der große Unterschied zwischen heute und 2004 ist das Resultat aus der Schwächung der USA, die durch ihre fortlaufenden militärischen Abenteuer besonders im Nahen und Mittleren Osten beschleunigt wurde. Der Rückzug Russlands von der internationalen Bühne ist andererseits besonders durch den russisch-georgischen Krieg 2008 verlangsamt worden. Dieser Konflikt kehrte die Tendenz zu einer Annäherung zwischen Georgien und der EU um, was auch die Ukraine anstrebt. Während also die erste „Revolution“ eine Offensive der USA gegen Russland gewesen war, ist die zweite allem Anschein nach eine Gegenoffensive Russlands. Es war Präsident Janukowitsch, der durch die Annullierung des Assoziationsabkommens mit der EU zugunsten einer „Dreierkommission“ einschließlich sowohl der EU als auch Russlands die Feindseligkeiten entfachte. Das anfangs angestrebte Abkommen hätte die Etablierung einer Freihandelszone ermöglicht, die am Ende den Beitritt der Ukraine in die EU durch die Hintertür und somit ihre Annäherung an die NATO bedeutet hätte. Diese Versuche einer Annäherung an die EU wurden von Moskau als eine Provokation betrachtet, deren Ziel es war, die Ukraine seinem Einfluss zu entziehen. Die Lage in der Ukraine wurde im Wesentlichen von diesen imperialistischen Konflikten bestimmt.
Der unmittelbare Ursprung dieser neuen Krise kann auf den Druck zurückgeführt werden, der von Russland und den Westmächten auf die ukrainische Bourgeoisie ausgeübt wurde, nachdem die pro-russische Fraktion in den Wahlen von 2010 an die Macht gelangt war. Seither bot sich Angela Merkel als Vermittlerin in den Verhandlungen über die Gasverträge an, die von der früheren Ministerpräsidentin Julia Timoschenko in Moskau 2009 unterzeichnet worden waren. Doch Moskau lehnte umgehend dieses Angebot ab und hinderte so die Europäer daran, ihre Nase in die russisch-ukrainischen Angelegenheiten zu stecken.
Drei Monate vor dem Wilna-Gipfel, der seinen Höhepunkt in der Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Ukraine und der EU finden sollte, setzte Russland eine erste Warnung in den Umlauf, indem es seine Grenzen gegenüber ukrainischen Exporte schloss. Eine Reihe von Sektoren, einschließlich der Stahlindustrie und des Turbinenbaus, wurden in Folge dessen in Mitleidenschaft gezogen. Die Ukraine verlor fünf Milliarden Dollar in diesem Geschäft; 400.000 Arbeitsplätze standen auf dem Spiel, zusammen mit zahllosen Unternehmen, die allein für den russischen Markt produzieren. Moskau griff auch zu folgender Erpressung: Wenn die Ukraine nicht der Gemeinsamen Union rund um Russland beitritt, würde der Kreml die anderen Mitglieder dieser Union dazu aufrufen, ebenfalls ihre Grenzen zu schließen.[3]
Die mannigfaltigen Cliquen der ukrainischen Bourgeoisie sind unter diesem Druck tief gespalten worden. Gewisse Oligarchen, wie Rinat Achmetow, haben sich gegen eine Unterzeichnung des Wilna-Abkommens gewandt. Im Augenblick wartet jedermann das Ergebnis ab. Die Pro-EU-Oligarchen, aber auch jene, die Russland nahestehen, fürchten sich vor exklusiven Beziehungen zu Moskau. Sie möchten so lange wie möglich an der „neutralen“ Position der Ukraine festhalten und die Stabilität der Ukraine bis zu den nächsten Wahlen gewährleisten, um eine Konfrontation mit Russland hinauszuschieben. Der Anschluss der Ukraine an die imperialistische Politik Russlands wird also nicht akzeptiert, auch nicht von der pro-russischen Fraktion.
Auf der anderen Seite ist der Druck aus der EU nicht ohne eigene Widersprüche. Das Hauptabsatzgebiet der ukrainischen Industrie und Landwirtschaft sind die Länder der früheren Sowjetunion. Die Ukraine exportiert so gut wie nichts in die EU-Länder, die dabei sind, ein Freihandelsabkommen für Waren zu unterzeichnen, die schlicht nicht existieren! Für ukrainische Waren, die mit dem europäischen Standard mithalten können, müsste die Industrie rund 160 Milliarden Dollar in den Produktionsapparat investieren.
Für die westlichen Mächte ist die Ukraine hauptsächlich als zusätzliche Einflusssphäre von Interesse. Zwischen der Ukraine und Russland gibt es praktisch keine Zollschranken – es gibt lediglich einige wenige Zollabgaben. Somit wird sowohl aus Sicht Moskaus als auch aus Sicht des Westens das Abkommen auf die Öffnung Russlands für westliche Waren hinauslaufen. Natürlich ist dies für Russland nicht akzeptabel.
Die Arbeiterklasse darf nicht auf die demokratische Lüge hereinfallen
Die Ukraine ist von den Widersprüchen zwischen seinen ökonomischen Interessen und dem imperialistischen Druck betroffen. Diese Sackgasse untergräbt den Zusammenhalt zwischen ihren mannigfaltigen bürgerlichen Fraktionen und drängt Letztere, insbesondere aber die Opposition zu einem irrationalen Verhalten. Während die Regierungspartei mehr oder weniger für die „Neutralität“ der Ukraine ist, versucht die Opposition der Bevölkerung die Illusion eines Lebensstandards zu verkaufen, der mit dem der Europäer vergleichbar wäre, wenn die Ukraine das Abkommen mit der EU unterzeichnete. Doch ihre heterogene Zusammensetzung hat jeglicher politischen Perspektive ihren Stempel aufgedrückt. Die klarste Analyse[4], die grundsätzlich zugunsten einer europäischen Orientierung der Ukraine ist, macht daraus keinen Hehl:
„Falls diese Opposition die Macht übernähme, sehe ich durchaus nicht, wie dies für eine Opposition ausgeht, die von einem Boxer angeführt wird, der zwar leutselig genug sein wird, aber nicht in der Lage ist, eine Regierung zu führen. Dann gibt es als nächste Persönlichkeit die Timoschenko und ihr Team, und jeder weiß, dass dies ein Mafia-Team von der Pike auf ist. Es gibt in der Tat große Fragen über die finanzielle Integrität dieses Teams – deshalb befindet sie sich im Gefängnis. Schließlich gibt es als dritte Komponente die Nazis.[5] Also Nazis plus inkompetente Leute – es wäre eine Katastrophe. Es wäre eine Regierung wie in gewissen Staaten Afrikas.“ Hier wird die Tatsache bestätigt, dass das „Gebiet, wo sich der Zerfall der kapitalistischen Gesellschaft am spektakulärsten ausdrückt, (…) das der militärischen Konflikte und der internationalen Beziehungen im Allgemeinen“ ist.[6]
Der ideologische Einfluss der verschiedenen Fraktionen des politischen Apparates wird von den Widersprüchlichkeiten der Lage unterminiert. Die Arbeitsteilung, wie sie in den entwickelteren demokratischen Ländern üblich ist, funktioniert hier nicht sehr gut. Doch dies heißt nicht, dass die demokratische Mystifikation nicht gegen die Arbeiterklasse in der Ukraine wie auch auf internationaler Ebene benutzt wird. Auch hier haben wir es mit einem angeblichen Kampf zwischen Demokratie und Diktatur zu tun. Die Bourgeoisie ist auch sehr wohl in der Lage, auf der nationalistischen Klaviatur zu spielen, die in der Ukraine so gepriesen wird. Die Appelle zugunsten der Interessen der „ukrainischen Nation“, mit der die pro-russische Fraktion hausieren geht, treffen angesichts der vielen Nationalflaggen auf ein Echo in den Demonstrationen.
Die „orangene Welle“ von 2004 war das Resultat aus den Spaltungen innerhalb der herrschenden Klasse, die die Position von Viktor Janukowitsch schwächte.[7] Ihm entglitt zunehmend die Kontrolle über den Staatsapparat. Der Erfolg seines Rivalen, Juschtschenko, war zu einem großen Umfang aufgrund der Paralyse der zentralstaatlichen Autorität, aber auch wegen Juschtschenkos Fähigkeit zustande gekommen, sich die offiziellen Werte des Regimes von Leonid Kutschma zunutze zu machen: Nationalismus, Demokratie, den Markt und die so genannte „europäische Option“. Juschtschenko wurde zum „Retter der Nation“ und Subjekt eines Personenkultes. Die Ideologie der „orangenen“ Bewegung unterschied sich in keiner Weise von den Mystifikationen, die die Bourgeoisie benutzt hatte, um der Bevölkerung 14 Jahre lang das Gehirn zu waschen. Die Massen, die Viktor Juschtschenko unterstützten oder Janukowitsch stützten, waren nur die Bauern auf dem Schachbrett, die von unterschiedlichen bürgerlichen Fraktionen im Interesse dieser oder jener imperialistischen Option manipuliert wurden. Heute ist die Situation in dieser Frage nicht anders, die „demokratische Wahl“ ist nur eine Falle.
Aber dieselbe Timoschenko, Heldin der Demokratie und der Orangenen Revolution, zeichnet für einen 15-Milliarden-Dollar-Kredit des IWF verantwortlich, der nach „harten“, dreimonatigen Verhandlungen zustande kam. Im Anhang dieses Abkommens steht, was sie für die Arbeiterklasse in der Ukraine „herausgeschlagen“ hat: Anhebung des Renteneintrittsalters, die Erhöhung von Kommunalsteuern, der Strom- und Wasserpreise, etc.
Trotz ihrer Uneinigkeit über die imperialistischen Optionen haben die unterschiedlichen politischen Fraktionen der Bourgeoisie, von der Rechten bis zur Linken, keine andere Perspektive, als die Arbeiterklasse in die Armut zu treiben. Zugunsten dieses oder jenen politischen Clans an den Wahlen teilzunehmen führt zu keinem Nachlassen in den Angriffen. Vor allem werden die ArbeiterInnen, wenn sie sich hinter einer politischen Fraktion der Bourgeoisie und hinter demokratischen Slogans einordnen, ihre Fähigkeit verlieren, auf ihrem eigenen Klassenterrain zu kämpfen.
Die Ukraine und all die Haie, die um sie herum schwimmen, sind ein Ausdruck der Realität eines kapitalistischen Systems, das am Ende seines Lateins ist. Die Arbeiterklasse ist die einzige Klasse, die sich diesem System radikal widersetzen kann. Sie muss vor allem ihre eigene historische Perspektive vertreten und gegen all die Kampagnen kämpfen, die darauf abzielen, sie für die Auseinandersetzungen zwischen den rivalisierenden bürgerlichen Cliquen, eine auswegloser als die andere, zu mobilisieren. Die proletarische Revolution stellt sich nicht einer spezifischen bürgerlichen Clique zugunsten einer anderen entgegen, sondern ist gegen das gesamte System - den Kapitalismus.
Sam, 22.12.13
[1]Appell von Julia Timoschenko, Oberhaupt des zwischen 2005 und 2009 an der Macht befindlichen Clans, aus dem Gefängnis.
[3]Kasachstan, Weißrussland und Armenien, die zusammen mit Russland den größten Absatzmarkt bilden.
[4]Siehe das Interview mit Iwan Blot mit The Voice of Russia über die ukrainische Opposition.
[5]Die Svoboda-Partei (Freiheitspartei) wird formell National-Sozialistische Partei der Ukraine genannt, historisch stammt sie von der Organisation der ukrainischen Nationalisten ab, deren bewaffneter Arm (die UPA) während des Zweiten Weltkrieges aktiv mit den Nazis kollaborierte und die Juden Galiziens in der Westukraine massakrierte.
[6]Resolution zur internationalen Lage vom 20. Kongress der IKS: https://en.internationalism.org/ir/126_authoritarian_democracy [14].
[7]Siehe ”Ukraine, the authoritarian prison and the trap of democracy”:
Aktuelles und Laufendes:
Theoretische Fragen:
- Imperialismus [16]
Rubric:
Sozialismus oder Barbarei! Vor 100 Jahren: Ausbruch des Ersten Weltkrieges
- 1688 reads
Der Ausbruch des Krieges am 4. August 1914 war für die Bevölkerung Europas und vor allem für die Arbeiterklasse keine Überraschung. Schon seit Jahren, seit Beginn des Jahrhunderts, hatten sich Spannungen und Krisen einander abgelöst: die Marokkokrisen von 1905 und 1911, die Balkankriege 1912-13, um nur die gravierendsten zu nennen. Hinter diesen Krisen standen als Akteure die Großmächte, welche alle dem Aufrüstungswahn verfallen waren: Deutschland startete ein gigantisches Kriegsschiff-Bauprogramm, auf das Großbritannien antworten musste. Frankreich führte den dreijährigen Militärdienst ein und finanzierte mit enormen Krediten die Modernisierung der Eisenbahnen Russlands zum Transport von Truppen an die deutsche Grenze sowie die Modernisierung der serbischen Armee. Russland lancierte nach dem Debakel des russisch-japanischen Krieges von 1905 ein Reformprogramm für seine Armee. Im Gegenteil zu dem, was die heutige Propaganda über die Kriegsursachen behauptet, wurde der Erste Weltkrieg emsig vorbereitet, ja die herrschende Klasse in allen großen Staaten dürstete geradezu danach.
Auch wenn er keine Überraschung war, für die Arbeiterklasse war er dennoch ein furchtbarer Schock. Zweimal, in Stuttgart 1907 und Basel 1912, hatten die sozialistischen Bruderparteien der Zweiten Internationale sich feierlich zu den internationalistischen Prinzipien, zur Verweigerung der Kriegsmobilisierung der Arbeiter für den Krieg und zum Widerstand mit allen Mitteln bekannt. Der Kongress von Stuttgart nahm einen Änderungsantrag - der von der Linken um Lenin und Luxemburg vorgeschlagen wurde – als Entwurf einer Resolution über die imperialistische Politik an: „Falls der Krieg dennoch ausbrechen sollte, sind sie (die sozialistischen Parteien) verpflichtet, für dessen rasche Beendigung einzutreten und mit allen Kräften dahin zu streben, um die durch den Krieg herbeigeführte wirtschaftliche und politische Krise zur politischen Aufrüttelung der Volksschichten und zur Beschleunigung des Sturzes der kapitalistischen Klassenherrschaft auszunutzen.“ Jean Jaurès, der große Redner des französischen Sozialismus, sagte auf demselben Kongress: „Die parlamentarische Aktion ist in keiner Weise genügend (…) Unsere Gegner werden vor den unberechenbaren Kräften des Proletariats zurückschrecken. Wir, die wir mit Stolz den Bankrott der Bourgeoisie ausgerufen haben, werden es nicht zulassen, dass sie vom Bankrott der Internationale sprechen.“ Auf dem Kongress der französischen Sozialistischen Partei in Paris im Juli 914 trat Jaurès für die Annahme einer Resolution ein, in der stand: „Der Kongress erachtet als besonders wirksames Mittel den Generalstreik, gleichzeitig und international in den betroffenen Ländern organisiert, sowie die Agitation und öffentliche Aktion zur Verhinderung des Krieges in der aktivsten Form und mit allen Mitteln.“
Doch im August 1914 brach die Internationale zusammen, oder genauer gesagt, sie löste sich auf, indem alle Parteien, die sie gebildet hatten (mit der löblichen Ausnahme der russischen und serbischen Parteien) den proletarischen Internationalismus - ihr raison d‘etre – verrieten, dies alles im Namen der Verteidigung des „bedrohten Vaterlandes“ und - der „Kultur“. Bereit, Millionen von Menschenleben auf den Schlachtfeldern zu opfern, präsentierten sich alle Bourgeoisien als Verteidiger der Zivilisation und Hochkultur, während der Gegner die blutdurstige Bestie war, verantwortlich für alle Gräueltaten.
Wie war eine solche Katastrophe möglich geworden? Wie konnten sich jene, die noch Tage zuvor gegen den Krieg aufgetreten waren, den die Bourgeoisie zur Aufrechterhaltung ihrer Herrschaft sucht, widerstandslos in den Heiligen Bund mit dem Klassenfeind, in die Politik des Burgfriedens fügen?
Von allen Parteien der Internationale trug die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) die gewichtigste Verantwortung. Dies zu sagen bedeutet aber keineswegs eine Entschuldigung für alle anderen Parteien, insbesondere nicht für die französische sozialistische Partei. Dennoch: die SPD galt als das Kronjuwel der Internationalen, erschaffen vom Proletariat. Mit mehr als einer Million Mitgliedern und mehr als 90 regelmäßigen Publikationen war die SPD mit Abstand die stärkste und bestorganisierte Partei der Internationalen. Die Artikel, die in ihrem theoretischen Organ Neue Zeit erschienen, waren zentraler Bezugspunkt für die marxistische Theorie, und Karl Kautsky, Chefredakteur des SPD-Organs Neue Zeit, war der allseits anerkannte „Papst des Marxismus“. Rosa Luxemburg hatte dazu geschrieben: “Sie hat durch zahllose Opfer der unermüdlichen Kleinarbeit die stärkste und mustergültige Organisation ausgebaut, die größte Presse geschaffen, die wirksamsten Bildungs- und Aufklärungsmittel ins Leben gerufen, die gewaltigsten Wählermassen um sich geschart, die zahlreichsten Parlamentsvertretungen errungen. Die deutsche Sozialdemokratie galt als die reinste Verkörperung des marxistischen Sozialismus. Sie hatte und beanspruchte eine Sonderstellung als die Lehrmeisterin und Führerin der zweiten Internationale“ (Die Krise der Sozialdemokratie – auch als Junius-Broschüre bekannt).
Die SPD war Modell, an dem sich all die Anderen orientierten, sogar die Bolschewiki in Russland. „In der zweiten Internationale spielte der deutsche ‚Gewalthaufen‘ die ausschlaggebende Rolle. Auf den Kongressen, in den Sitzungen des Internationalen Sozialistischen Büros wartete alles auf die deutsche Meinung. Ja, gerade in den Fragen des Kampfes gegen den Militarismus und den Krieg trat die deutsche Sozialdemokratie stets entscheidend auf. ‚Für uns Deutsche ist dies unannehmbar‘, genügte regelmäßig, um die Orientierung der Internationale zu bestimmen. Mit blindem Vertrauen ergab sie sich der Führung der bewunderten mächtigen deutschen Sozialdemokratie: diese war der Stolz jedes Sozialisten und der Schrecken der herrschenden Klassen in allen Ländern.“ (ebenda).
Es oblag also der deutschen Partei, die Beschlüsse von Stuttgart zum Widerstand gegen den Krieg in die Tat umzusetzen.
Doch an diesem Schicksalstag des 4. August 1914 reihte sich die SPD ein in die Parade der bürgerlichen Parteien im Reichstag, die den Kriegskrediten zustimmten. Von einem Tag auf den anderen sah sich die Arbeiterklasse in allen Krieg führenden Ländern entwaffnet, d.h. ohne Organisation, denn ihre Parteien und Gewerkschaften waren zur Bourgeoisie übergelaufen und von nun an die wichtigsten Organisatoren nicht des Widerstands gegen den Krieg, sondern umgekehrt der Militarisierung der Gesellschaft für den Krieg.
Ein Bestandteil der heutigen Legendenbildung ist die Aussage, dass die ArbeiterInnen in einer gewaltigen Welle des Patriotismus vom Rest der Bevölkerung mitgerissen worden seien. Die Medien verbreiten gerne die Bilder der zur Front aufbrechenden Truppen, in deren Gewehrläufe Blumen steckten. Wie viele andere Legenden hat auch diese nur wenig mit der Wirklichkeit zu tun. Unbestreitbar gab es Demonstrationen nationalistischer Hysterie, doch diese waren in erster Linie getragen vom kleinbürgerlichen und studentischen Milieu der kriegstrunkenen Jugend. Immerhin demonstrierten in Frankreich und Deutschland im Juli 1914 Hundertausende von ArbeiterInnen gegen den Krieg – erst der Verrat ihrer Organisationen machte sie kraft- und machtlos.
In Tat und Wahrheit vollzog sich der Verrat der SPD nicht über Nacht, vielmehr wurde er schon länger vorbereitet. Die Stärke der SPD bei den Wahlen verschleierte ihre politische Schwäche, oder besser gesagt: eben jene Stärke der SPD an den Wahlurnen und die organisatorische Macht der deutschen Gewerkschaften bewirkten die Schwäche der SPD als revolutionäre Partei. Die lange Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs und der relativen politischen Freiheit, die auf die Abschaffung des Sozialistengesetzes und die Legalisierung der sozialistischen Parteien in Deutschland 1890 folgte, überzeugte schließlich die parlamentarischen und gewerkschaftlichen Anführer von der Idee, dass der Kapitalismus in ein ruhigeres Fahrwasser gelangt sei, wo die inneren Widersprüche aufgehoben seien und der Sozialismus nicht mehr durch eine revolutionäre Massenerhebung, sondern durch einen allmählichen Prozess parlamentarischer Reformen erreicht werden könne. Wahlen zu gewinnen wurde in dieser Logik das Hauptziel der politischen Tätigkeit der SPD, und dementsprechend erhielt die parlamentarische Fraktion ein immer größeres Gewicht in der Gesamtpartei. Das Problem bestand darin, dass die ArbeiterInnen selbst, trotz aller Versammlungen und Demonstrationen während der Wahlkampagnen, nicht als Klasse teilnahmen, sondern als voneinander isolierte Individuen, Seite an Seite mit den Individuen anderer Klassen – deren Vorurteile demokratisch zu akzeptieren sind. So führte die Reichsregierung unter dem Kaiser anlässlich der Wahlen 1907 eine Kampagne für eine aggressive Kolonialpolitik, und die SPD, die sich bis dahin militärischen Abenteuer entgegengestellt hatte, erlitt empfindliche Sitzverluste im Reichstag. Die Führer des SPD und insbesondere die Parlamentsfraktion zogen daraus den Schluss, dass man die patriotischen Gefühle nicht offen verletzen dürfe, und so widersetzte sich die SPD (insbesondere auf dem Kongress 1910 in Kopenhagen) gegen jeden Versuch innerhalb der Zweiten Internationalen, konkrete Maßnahmen zu diskutieren, die im Falle eines Kriegsausbruchs zu ergreifen wären.
Die Führer und der Apparat der SPD entwickelten sich inmitten einer bürgerlichen Welt und übernahmen von dieser immer mehr die Geisteshaltung. Der revolutionäre Elan, der ihre Vorfahren 1870 zur Anprangerung des französisch-preußischen Kriegs verpflichtet hatte, war bei den Parteiführern in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg verflogen – oder schlimmer noch: er war als gefährlich verpönt, da er die Partei ja der Repression aussetzen könnte. Im Jahr 1914 schließlich verbarg sich hinter der eindrücklichen Fassade der SPD nur noch „eine radikale Partei wie die anderen“. Die Partei übernahm den Blickwinkel der Bourgeoisie, sie stimmte den Kriegskrediten zu, und nur noch eine kleine linke Minderheit hielt am Widerstand gegen das Debakel fest. Diese gejagte, eingesperrte, verfolgte Minderheit war der Keim der späteren Gruppe Spartakus, die 1919 an der Spitze der Deutschen Revolution stand und als KPD deutsche Sektion der neuen Internationalen wurde.
Es ist beinahe banal zu sagen, dass wir immer noch im Schatten des Krieges von 1914-18 leben. Dieser Krieg stellt den Zeitpunkt dar, in dem der Kapitalismus den Planeten eingenommen und unterworfen hat, mit der Vereinnahmung der ganzen Menschheit in einen einzigen Weltmarkt, welcher das Objekt der Begierde der verschiedenen Mächte war und ist. Ab 1914 beherrschten Imperialismus und Militarismus die Produktion; der Krieg wurde zu einer weltweiten und dauerhaften Erscheinung. Seither droht der Kapitalismus die ganze Menschheit in den Abgrund zu stürzen!
Die Entfachung des Ersten Weltkrieges war nicht unvermeidlich. Wenn die Internationale ihre Pflicht erfüllt hätte, hätte sie zwar vielleicht nicht den Krieg verhindern, aber dafür den Arbeiterwiderstand dagegen beleben können, der wenig später tatsächlich stattfand. Sie hätte ihm eine politische und revolutionäre Richtung geben und so den Weg eröffnen können, zum ersten Mal in der Geschichte eine Weltgemeinschaft ohne Klassen und Ausbeutung zu schaffen sowie dem Elend und den Grausamkeiten ein Ende zu bereiten, die der imperialistische und dekadente Kapitalismus dem Menschengeschlecht aufoktroyiert hat. Dabei handelt es sich nicht um einen frommen und abstrakten Wunsch; vielmehr beweist die Russische Revolution, dass die Revolution nicht bloß notwendig, sondern auch möglich ist. Denn es war in der Tat diese außergewöhnliche Erstürmung des Himmels durch die Massen, dieser gewaltige proletarische Elan, der die internationale Bourgeoisie erschauern ließ und sie zur vorzeitigen Beendigung des Krieges zwang. Krieg oder Revolution, Barbarei oder Sozialismus, 1914 oder 1917: die Wahl, vor der die Menschheit stand, konnte nicht deutlicher sein!
Die Skeptiker werden einwenden, dass die Russische Revolution isoliert geblieben und schließlich unter der stalinistischen Konterrevolution erstickt worden sei. Sie werden hinzufügen, dass auf 1914-18 1939-45 gefolgt sei. Das trifft absolut zu. Aber wenn man falsche Schlussfolgerungen vermeiden will, muss man die Ursachen verstehen, sich fragen, warum es geschehen ist, und nicht einfach die offizielle Dauerpropaganda schlucken. Die revolutionäre Welle begann 1917 zu einem Zeitpunkt, als die Gräben des Krieges noch tief waren. Diese Schwierigkeiten führten zu einer Heterogenität im Proletariat, die durch die herrschende Klasse ausgenutzt wurde, um die Arbeiterklasse zu schlagen. Konfus und orientierungslos, konnte sich das Proletariat nicht in einer breiten internationalen Bewegung vereinen. Es blieb gespalten in die beiden Lager der „Sieger“ und „Verlierer“. Die heroischen revolutionären Aufstände, wie jener in Deutschland 1919, konnten in der Folge niedergeschlagen und in ihrem Blut ertränkt werden, insbesondere dank der Judasdienste der großen Arbeiterpartei, der Sozialdemokratie. Diese Isolierung erlaubte es der internationalen Bourgeoisie, ihr Verbrechen zu vollenden, die Russische Revolution zu vernichten, um ein zweites weltweites Abschlachten vorzubereiten – und uns daran zu erinnern, dass die einzige geschichtliche Alternative immer noch gültig ist: „Sozialismus oder Barbarei“!
Jens, 30. Juni 2014
Rubric:
Stellungnahme zu Eurem Kommuniqué, die „IGKL“ betreffend
- 1408 reads
Einerseits ist man zunächst einmal überrascht, dass ausgerechnet die IKS von subversiven Kräften angegriffen wird. Aber: man sollte sich über die Realität des bürgerlichen Systems, das uns ja umgibt, auch nicht täuschen lassen
Denn andererseits - falls diese unselige IGKL tatsächlich als "Agent Provocateur" fungiert, wofür nach Eurer Darstellung einiges spricht, passt das genau zu den markanten Eigenarten dieses kapitalistischen Systems, nämlich der Umgang mit Kritikern, Andersdenkenden, schlicht mit der "echten" Opposition, den bewussten Vertretern der Arbeiterklasse! Das System bekämpft diese Tendenzen immer radikal und erbarmungslos, man darf sich in dieser Hinsicht einfach nichts vormachen... So gesehen ist es leider doch nur folgerichtig, dass die IKS Ziel von Angriffen des Systems wird. IHR seid es doch, die durch schonungslose Analysen und ungeschminkte Berichterstattung der Bourgeoisie den Spiegel vorhaltet und ihre Lügen entlarvt.
Dazu kommt im Falle der IGKL neben kriminellen Beweggründen wohl noch eine gehörige Portion Reputationsgehabe, welches jene zum willigen, perfekten Instrument der kapitalistischen Interessen macht. Dieses Reputationsgehabe entspringt dem Individualismus der kapitalistischen Gesellschaft. "Jeder gegen jeden" schimmert auch hier durch. Die grenzenlose Gier nach Anerkennung, eben Reputation, führt doch dazu, die eigene Person selbst ins rechte Licht zu rücken, ohne Rücksicht auf andere Meinungen. Sehr schnell wird dabei vergessen, dass erst das Einbringen von Ideen, Meinungen, Anregungen in die Gemeinschaft einen Prozess in Gang setzt, der, bedingt durch gegenseitigen Respekt und auch Solidarität, neue Denkansätze entstehen lässt. Aber das erfordert die Einhaltung einer proletarischen Moral. Diese umfasst genau eine Solidarität, in der Klasse verankert, mit der Verpflichtung der Einordnung in die Werte der Arbeiterklasse. Aber unsere derzeitige Gesellschaft ist sehr weit entfernt, auch nur ansatzweise Werte zu vermitteln; ganz im Gegenteil: der Werteverfall ist drastisch! Umso wichtiger ist die Funktion der IKS einzustufen: Sie ist verpflichtet, nicht nur ein revolutionäres Bewusstsein zu vermitteln, sondern auch für eine proletarische Moral einzutreten.
Da das Verhalten, Denken und Handeln dieser IGKL rein gar nichts mit irgendwelchen Moralgrundsätzen der Klasse zu tun hat sowie auch keinen revolutionären Inhalt besitzt, kann man mit Fug und Recht von sehr niedrigen Beweggründen dieser Gruppierung sprechen, für die es keinerlei Rechtfertigung geben kann.
Erstaunlich erscheint mir, dass diese Kriminellen trotz der Trennung von der IKS vor über zehn Jahren einen derartigen Hass schüren, der durch nichts erklärbar oder gar begründet ist. Das spricht in der Tat Bände über deren Geisteszustand. Folgerichtig ist es auch meiner Ansicht nach, hart mit diesen separatistischen Elementen zu verfahren und alles zu versuchen, die IKS frei davon zu halten. Es kann keinesfalls hingenommen werden, dass ein Zersetzungsprozess eingeleitet wird, der die Kapitalistenklasse frohlocken ließe!
In diesem Sinne wünsche ich, dass Ihr den eingeschlagenen Weg unbeirrt fortsetzt, ohne Euch durch solche „Störungen“ aufhalten zu lassen, um einen Bewusstseinswandel in der Arbeiterklasse herbeizuführen.
Aktuelles und Laufendes:
Politische Strömungen und Verweise:
- Parasitismus [18]