Internationale Revue – 2014/2015
- 1610 Aufrufe
Internationale Revue 52
- 1670 Aufrufe
100 Jahre Dekadenz des Kapitalismus
- 3463 Aufrufe
Seit 100 Jahren stehen wir an einem weiteren Scheidepunkt in der Menschheitsgeschichte. Die revolutionäre Klasse hat dieser Epoche mit klarer Zuspitzung schon früh ihre Parole eingeschrieben: „Sozialismus oder Barbarei“. Die Klarsichtigkeit der marxistischen Analyse, die sich hinter dieser Parole verbirgt und in ihr ausgedrückt wird, darf jedoch nicht zu einer platten Floskel verkommen. Deshalb möchten wir die historische Bedeutung und ihre existenzielle Tiefe im Folgenden kurz hervorheben. Werfen wir einen Blick zurück in die dunklen und verborgenen Ursprünge der Gattung Menschen, müssen wir verblüfft und beeindruckt sein, mit welch mächtigen Schritten der Mensch seinen Gang aus der Tierwelt hinaus genommen hat: Sprachen, Schriften, Tänze, Gebäude, Güterfülle, die auf die Vielfalt und Tiefe moralischer, kultureller, intellektueller Bedürfnisse und Wert verweisen, spiegeln einen kulturellen Reichtum und eine Beschleunigung in der Geschichte wieder, die uns erschauern lässt. Doch fokussieren wir den Blick auf einzelne Epochen, müssen wir ebenfalls erkennen, dass es keine stete fortschrittliche Entwicklung gab und gibt. Ja noch dramatischer, nach dem Aufkommen der Klassengesellschaften und dem Entstehen der großen „Kulturen“, müssen wir resümieren, dass fast alle großen „Kulturen“ unwiederbringlich untergegangen sind und nur die wenigsten zu etwas neuem transformierten. Wir finden viele Epochen des kulturellen Rückschritts und Vergessens, in der Regel begleitet von einer moralischen Verrohung der Menschen und einer enormen Brutalisierung der menschlichen Verhältnisse. Den erreichten Fortschritten zugrunde liegt die Fähigkeit der Gattung Mensch, die Natur im Hinblick auf die Befriedigung ihrer Bedürfnisse – in erster Linie der materiellen – zu verändern, und ihre Fähigkeit, die Mittel und Techniken zur Produktion – was Marx die „Produktivkräfte“ nennt – zu verbessern und zu entwickeln. Der Entwicklungsgrad dieser Produktivkräfte und die Arbeitsteilung, die damit zusammenhängt, bestimmen grundsätzlich die Art und Weise, wie sich die Gesellschaft organisiert, um sie in Bewegung zu setzen, – die „Produktionsverhältnisse“. Wenn diese den vorteilhaftesten Rahmen zur Entwicklung der Produktivkräfte darstellen, blüht die Gesellschaft auf – nicht nur auf materieller, sondern auch auf kultureller und moralischer Ebene. Doch wenn die Produktionsverhältnisse zu einem Hemmnis der Weiterentwicklung der Produktivkräfte werden, gerät die Gesellschaft in immer größere Krämpfe, und es droht die Barbarei. Um ein Beispiel aus der Geschichte zu nehmen: Einer der Pfeiler des Römischen Reiches war die Ausbeutung der Sklav_innen, insbesondere für die Arbeiten in der Landwirtschaft, aber als neue landwirtschaftliche Techniken auftauchten, konnten diese nicht durch Produzent_innen angewandt werden, die den Status von Vieh hatten, was eine der Ursachen des Niedergangs und des Zusammenbruchs dieses Reiches war.
Wir können noch heute das Leuchten der großen kulturellen Sprünge sehen[1] [2], von der neolithischen Revolution bis zur Renaissance, dem Humanismus und zur Russischen Revolution als Auftakt zur Weltrevolution. Diese kulturellen Sprünge waren jeweils das Ergebnis von langen Kampfepochen, in denen die neuen Verhältnisse sich gegen die alten durchsetzen mussten. Diese großen kulturellen Sprünge bemächtigen uns zum nächsten Sprung: der ersten bewussten Weltvergesellschaftung, dem Sozialismus! Der Marxismus – die Theorie, die sich das Proletariat in seinem Kampf gegen den Kapitalismus gegeben hat – hat die Fähigkeit, geschult die lebendige Geschichte und die großen Tendenzen in ihr zu erkennen. Dies darf nicht verwechselt werden mit dem Blick in die Glaskugel. Wir können nicht weissagen, wann und ob überhaupt es zur Weltrevolution kommen wird. Wir müssen jedoch gegen alle Widerstände und jedes Unverständnis, von denen selbst gewisse Revolutionäre befallen sind, die enorme historische Bedeutung des Eintritts des Kapitalismus in die Dekadenz herausarbeiten und verteidigen. Die historische Weichenstellung, vor der wir seit 100 Jahren stehen ist: nächster kultureller Sprung, Sozialismus – oder Barbarei. Die Zuspitzung ist dramatischer als in jeder bisher gekannten Weltepoche, da die entfalteten Widersprüche zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen nicht nur einen kulturellen Niedergang, sondern gar die gesamte Zerstörung der Gattung Mensch (und seiner Natur) möglich machen. Erstmals verschränkt sich die Frage einer untergehenden Produktionsweise mit der Existenzfrage der Gattung Mensch. Dem entgegen stehen gewaltige historische Möglichkeiten für eine Weiterentwicklung: der Eintritt in die bewusste, die „wirkliche“ Menschheitsgeschichte. Das kapitalistische Modell der Vergesellschaftung ist das bisher erfolgreichste in der Menschheitsgeschichte. Der Kapitalismus hat alle Kulturkreise in sich aufgehoben (soweit er sie nicht vernichtet hat) und erstmals eine Weltgesellschaft hergestellt. Seine zentrale Ausbeutungsform ist die Lohnarbeit, sie ermöglicht die Aneignung und Akkumulation der Mehrarbeit und darüber hinaus die kostenfreie Aneignung der enorm produktiven gemeinschaftlichen Arbeit, der assoziierten, der gesellschaftlichen Arbeit. Dies erklärt die unvergleichliche technische und wissenschaftliche Explosion, die mit der Geschichte des aufsteigenden Kapitalismus verbunden ist. Doch zu den Eigenheiten der kapitalistischen Vergesellschaftung gehört, dass sie unbewusst geschieht, bestimmt durch Gesetze, die zwar Ausdruck von bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen, vom Tausch der Arbeitskraft gegen Lohn zwischen Produzent_innen und Inhabern der Produktionsmittel sind, die aber als „natürlich“, „unveränderbar“ und somit als jedem menschlichen Willen äußerlich erscheinen. In dieser Sicht der verhexten, verdinglichten Wirklichkeit, wo die Menschen und die Verhältnisse zwischen ihnen zu „Sachen“ werden, erscheint das enorme Ansteigen der materiellen Möglichkeiten, der Produktivkräfte als Ergebnis des Kapitals, und nicht als Produkt der menschlichen Arbeit. Doch mit der Eroberung der Welt, stellt sich heraus, dass die Erde rund und endlich ist. Der Weltmarkt ist hergestellt (nach der Zerstörung alternativer Produktionsformen, wie der chinesischen, indischen und osmanischen Textilproduktion). Doch der kulturelle Sprung der industriellen Revolution bedeutet für den Großteil der Bevölkerung im kapitalistischen Zentrum Zerstörung der bisherigen Lebensformen und Hyperausbeutung, in großen Teilen der übrigen Welt Epidemien, Hunger und Versklavung. Der Kapitalismus ist zwar das modernste Ausbeutungsverhältnis, er ist jedoch letztendlich ähnlich parasitär wie seine Vorgänger. Um die Maschine der Verwertung am Laufen zu halten, benötigt die kapitalistischen Vergesellschaftung ständig mehr Rohstoffe und Märkte, wie ihm auch eine größere Reserve an Menschen zur Verfügung stehen muss, die zu ihrem Überleben gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Deshalb führte sein Sieg über die anderen Produktionsweisen zum Ruin und Hunger der früheren Produzent_innen.
Der Kapitalismus stellt sich als Ziel und Höhepunkt der menschlichen Entwicklung dar, nach seiner Ideologie gibt es kein außerhalb mehr. Die zwei größten Tabus sind: dass er im höchsten Maße auf außerkapitalistische Verhältnisse und Milieus angewiesen ist und dass die kapitalistische Vergesellschaftung, wie jede in der Menschheitsgeschichte, eine Etappe in der Bewusstwerdung der Menschheit ist. Seine innere Triebkraft der Akkumulation produziert permanent Widersprüche in ihren einzelnen Elementen, die sich eruptiv in Krisen entladen. In der aufsteigenden Phase des Kapitalismus wurden diese Krisen überwunden durch die Vernichtung des überschüssigen Kapitals und durch die Eroberung neuer Märkte. Das neue Gleichgewicht wurde begleitet durch eine neue Ausdehnung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse, doch mit der Aufteilung des Weltmarkts durch die zentralen Mächte des Kapitalismus kommt der Kapitalismus als Weltverhältnis an eine Grenze. An dieser Grenze können die führenden Nationalstaaten ihre Eroberung der Welt nur fortsetzen, indem sie sich gegenüber stehen; da der Kuchen ganz aufgeteilt ist, kann jeder sein Stück nur vergrößern, indem er dasjenige der anderen verkleinert. Die Staaten rüsten auf und fallen im Ersten Weltkrieg übereinander her. Die von den historisch überkommenden Produktionsverhältnissen gefesselten Produktivkräfte schlagen im Weltgemetzel zu Destruktivkräften mit unglaublich zerstörerischem Potential um. Mit dem Eintritt des Kapitalismus in die Dekadenz wird selbst der Krieg zu einer Materialschlacht, in der die ganze Produktion den militärischen Bedürfnissen untergeordnet wird. Die blinde Maschine der Zerstörung und Vernichtung zieht die ganze Welt in den Abgrund. Schon vor 1914 hat die Linke innerhalb der Sozialistischen Internationale, habe die revolutionären Kräfte um Rosa Luxemburg und Lenin mit aller Kraft den Kampf gegen das drohende imperialistische Massaker aufgenommen. Der lebendige Marxismus, das heißt der wirkliche Marxismus, der nicht in Dogmen und für alle Zeiten und Gelegenheiten gültigen Formeln gefangen ist, hat erkannt, dass dies nicht ein weiterer Krieg zwischen Nationalstaaten ist, sondern dass dieser Krieg den Eintritt in die Dekadenz des Kapitalismus markiert. Den Marxisten war klar, dass wir uns an einem historischen Scheideweg befanden und immer noch befinden, der erstmals droht, zu einem Existenzkampf der ganzen Gattung zu werden. Der Eintritt des Kapitalismus in seine Dekadenz vor 100 Jahren ist unumkehrbar, jedoch bedeutet dies keinen Stillstand der Produktivkräfte. Diese Kräfte werden vielmehr dermaßen gefesselt und in die alleinige Logik der kapitalistischen Verwertung gepresst, dass die weitere gesellschaftliche Entwicklung in einen immer barbarischer werdenden Strudel gezogen wird. Nur die Arbeiterklasse ist in der Lage, der Geschichte eine andere Richtung zu geben und eine neue Gesellschaft aufzubauen. Mit aller bis dato unvorstellbaren Verrohung erlebten wir die reine Tendenz der kapitalistischen Barbarei nach der Niederlage der revolutionären Aufwallung 1917–23. Der Kurs auf einen weiteren Weltkrieg war offen, Menschen wurden zu Nummern in Lagern und Karteien, gefangen zum Zwecke einer mörderischen Ausbeutung oder direkt der Vernichtung. Die stalinistischen Massenmorde wurden durch den nationalsozialistischen Vernichtungswahnsinn übertroffen, doch die „zivilisierte“ Bourgeoisie selber wollte dieses Rendezvous der Barbarei nicht verpassen: mit dem Einsatz der „demokratischen“ Atombombe, die in Japan zwei Städte ausradierte und den Überlebenden die schrecklichsten Leiden zufügte. Die staatskapitalistische Maschine hat insoweit aus der Geschichte „gelernt“, dass sie sich selbst die Selbstvernichtung verbietet (die Bourgeoisie wird sich nicht einfach selbst umbringen, um die geschichtliche Bühne dem Proletariat zu überlassen), doch ist allein die Rückkehr der Arbeiterklasse nach 1968 ein Garant gegen den offenen Kurs zum Krieg. Während das Proletariat aber den Weg zu einem neuen weltweiten Holocaust hat versperren können, ist es nicht in der Lage dazu gewesen, seine eigene Perspektive durchzusetzen. In dieser Situation, in der keine der beiden bestimmenden Klassen der Gesellschaft eine entschiedene Antwort auf eine unumkehrbare und sich immer mehr vertiefende Wirtschaftskrise hat geben können, ist die Gesellschaft je länger je mehr in einen Verfaulungszustand geraten, in einen zunehmenden sozialen Zerfall. Diese Pattsituation zwischen den Klassen hat der Arbeiterklasse die Perspektive geklaut, die vor 100 Jahren noch eine Selbstverständlichkeit war.
Vor und seit 100 Jahren stand die Arbeiterklasse vor einer gewaltigen historischen Aufgabe. Die Klasse der assoziierten Arbeit, die Arbeiterklasse als Trägerin der gesamten Menschheitsgeschichte, als die zentrale Klasse im Kampf um die Klassenabschaffung muss sich gegen diese Barbarei stemmen. Im Kampf gegen die nihilistische und amoralische Barbarei des Kapitalismus ist sie die Verkörperung der sich selbst bewusst werdenden Menschheit. Sie ist die gefesselte Produktivkraft der Zukunft. In ihr steckt das Potential eines neuen kulturellen Sprungs. Weltweit entstand im Kampf gegen den Eintritt des Kapitalismus in die Dekadenz eine ganze Generation von Revolutionären, die der verdrehten und verdinglichten Vergesellschaftung des Kapitalismus die bewusste Assoziation der Arbeiterklasse – unter dem Leitstern der Kommunistischen Internationale – entgegen setzten.
Mit der russischen Revolution nahm sie den Kampf für die Weltrevolution auf. Diese große Aufgabe, die Verantwortung für die Menschheit in die Hand zu nehmen, ist auch nach bald 100 Jahren für uns aufrüttelnd und begeisternd. Dies zeigt, dass selbst im Angesicht der drohenden Verrohung sich im Herzen der Arbeiterklasse eine moralische Empörung erhebt, die auch heute noch für uns Leitstern ist. Die Arbeiterklasse leidet mit der ganzen Gesellschaft unter der Last des Verfalls. Vereinsamung und Perspektivlosigkeit greifen die eigene Identität an. In den folgenden Auseinandersetzungen wird die Arbeiterklasse zeigen, ob sie sich ihrer historischen Aufgabe wieder bewusst wird. Von der moralischen Empörung zur Politisierung einer ganzen Generation kann es dann ein historisch kurzer Schritt sein. Ein neuer kultureller Sprung in der Menschheitsgeschichte ist möglich und notwendig, das lehrt uns die lebendige Geschichte.
IKS, Januar 2014
[1] Damit keine Missverständnisse entstehen: Wir fassen unter dem Begriff der „Kultur“ alles, was eine Gesellschaft ausmacht: ihre Art und Weise, sich materiell zu reproduzieren, aber auch die Gesamtheit ihrer künstlerischen, wissenschaftlichen, technischen und moralischen Produktion.
Historische Ereignisse:
Erbe der kommunistischen Linke:
Rubric:
Außerordentliche Internationale Konferenz der IKS: Die Nachrichten über unser Ableben sind stark übertrieben
- 2826 Aufrufe
Im Mai 2014 hat die IKS eine Außerordentliche Internationale Konferenz abgehalten. Seit einiger Zeit hatte sich eine Krise in der IKS entfaltet, deren Epizentrum sich in unserer ältesten Sektion befand, der Sektion in Frankreich. Die Durchführung einer außerordentlichen Konferenz, zusätzlich zu den regelmäßigen internationalen Kongressen der IKS, war notwendig geworden, um die Natur dieser Krise vollständig zu verstehen und einen Weg zu ihrer Überwindung zu finden. Die IKS hat bereits in der Vergangenheit außerordentliche Konferenzen einberufen, so 1982 und 2002, und zwar im Einklang mit unseren Statuten, die diesen Schritt vorsehen, wenn die Grundprinzipien der Organisation in Gefahr sind.[1]
Alle internationalen Sektionen der IKS haben Delegationen zu dieser dritten Außerordentlichen Konferenz entsandt und aktiv an der Debatte teilgenommen. Diejenigen Sektionen, die wegen der restriktiven Schengen-Auflagen nicht teilnehmen konnten, haben der Konferenz Stellungnahmen zu den verschiedenen Rapporten und Resolutionen, die zur Diskussion standen, zukommen lassen.
Krisen sind nicht zwangsläufig tödlich
Unsere Kontakte und Sympathisanten mögen durch diese Nachricht verunsichert und alarmiert sein, und die Feinde der IKS sehen darin sicher Grund zum Jubeln. Unter den Letztgenannten werden gar Stimmen laut, die behaupten, diese Krise sei unsere „Todeskrise“; sie sehen sie als Vorzeichen unseres Verschwindens. Doch Prognosen ähnlicher Manier machten schon angesichts der vorangegangenen Krisen unserer Organisation die Runde. Während der Krise von 1981-82 (und das ist 32 Jahre her!) hatten wir darauf mit den Worten von Mark Twain entgegnet: „Die Nachrichten von unserem Ableben sind stark übertrieben!“. Und genauso antworten wir auch heute.
Krisen sind nicht notwendigerweise Indikatoren für einen Zusammenbruch oder ein Scheitern. Im Gegenteil, das Auftreten von Krisen kann durchaus Ausdruck eines gesunden Widerstandes gegen einen Prozess des Scheiterns sein, der bis dahin ganz unbemerkt vonstattengegangen war. Krisen können deshalb Zeichen einer Reaktion gegen Gefahren und des Kampfes gegen das Scheitern sein. Eine Krise kann auch eine willkommene Gelegenheit darstellen, die Probleme an ihren Wurzeln zu packen und damit die Mittel zu deren Überwindung zu entwickeln. All dies erlaubt es der Organisation, sich zu stärken und ihre Militanten für die künftigen Auseinandersetzungen zu wappnen.
In der 2. Internationale (1889-1914) war die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands (SDAPR) bekannt wegen ihrer Anfälligkeit für Krisen und Spaltungen, die sie erlebt hatte. Sie wurde deshalb von den gewichtigsten Parteien der Internationale mit Missachtung bestraft, vor allem von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), die von Erfolg zu Erfolg zu eilen schien und deren Mitgliederzahlen und Wählerstimmen sich stetig vermehrten. Doch die Krisen der russischen Partei und der Kampf des bolschewistischen Flügels, sie zu überwinden und aus ihnen zu lernen, stählten die revolutionäre Minderheit in ihrer Bereitschaft, Widerstand gegen den imperialistischen Krieg von 1914 zu leisten und die Oktoberrevolution von 1917 anzuführen. Im Gegensatz dazu kollabierte die Fassade der Einheit der SPD (die nur von „Störenfrieden“ wie Rosa Luxemburg herausgefordert wurde) 1914 vollkommen und unwiderruflich mit dem totalen Verrat ihrer internationalistischen Prinzipien angesichts des Ersten Weltkrieges.
1982 hatte die IKS erkannt, dass sie in einer Krise steckt (provoziert durch die Ausbreitung von linksbürgerlichen und aktivistischen Konfusionen, die es einem gewissen Chénier[2] erlaubten, in unserer britischen Sektion großes Unheil anzurichten), und ihre Lehren aus dieser Schlappe gezogen, um die Prinzipien der Funktion und der Funktionsweise fester zu etablieren (siehe Internationale Revue Nr. 9: Bericht über die Funktion der revolutionären Organisation, und Internationale Revue Nr. 22: Bericht über die Struktur und die Funktionsweise der revolutionären Organisation). Nach dieser Krise nahm die IKS auch die heute noch bestehenden Statuten an. Die „bordigistische“ Internationale Kommunistische Partei (Kommunistisches Programm), die damals die größte Gruppe der Kommunistischen Linken war, wurde von ähnlichen Tendenzen heimgesucht, nur stärker. Diese Partei schien ganz normal weiterzumachen – nur um letztendlich nach dem Verlust der Mehrheit ihrer Mitglieder wie ein Kartenhaus zusammenzubrechen (siehe dazu: Internationale Revue Nr. 32 auf Französisch, Englisch, Spanisch: „Erschütterungen im revolutionären Milieu“).
Zu der Anerkennung ihrer eigenen Krise kam noch hinzu, dass die IKS einem Prinzip folgte, dass sie aus der bolschewistischen Erfahrung gelernt hatte: die Umstände und Details der Krisen offen zu legen, um so zu einer breiteren Klärung beizutragen. Also anders als jene revolutionären Gruppen zu handeln, die ihre Krisen vor der Arbeiterklasse verbergen. Wir sind davon überzeugt, dass die Kämpfe zur Überwindung der internen Krisen der revolutionären Organisationen erlauben werden, sich über die Wahrheiten und allgemeinen Prinzipien des Kampfes für den Kommunismus klarer zu werden.
Im Vorwort zu Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück schreibt Lenin 1904: „Sie (unsere Gegner) feixen und sind schadenfroh über unsere Streitigkeiten; sie werden sich natürlich bemühen, einzelne Stellen aus meiner Broschüre, die den Mängeln und Unzulänglichkeiten unserer Partei gewidmet ist, für ihre Zwecke aus dem Zusammenhang zu reißen. Die russischen Sozialdemokraten haben bereits genügend im Kugelregen der Schlachten gestanden, um sich durch diese Nadelstiche nicht beirren zu lassen, um dessen ungeachtet ihre Arbeit der Selbstkritik und rücksichtslosen Enthüllungen der eigenen Mängel fortzusetzen, die durch das Wachstum der Arbeiterbewegung unbedingt und unvermeidlich ihre Überwindung finden werden. Die Herren Gegner aber mögen versuchen, uns ein Bild der wahren Sachlage in ihren ‚Parteien‘ zu zeigen, das auch nur im entferntesten dem Bild ähnelt, das die Protokolle unseres zweiten Parteitags bieten!“ [3]
Wir denken wie Lenin, dass, welch oberflächliche Freude unsere Feinde an unseren Schwierigkeiten auch haben mögen (und wie auch immer sie diese durch ihre verzerrte Sichtweise interpretieren), wahre Revolutionäre aus ihren Fehlern lernen und dadurch stärker werden.
Aus diesem Grunde veröffentlichen wir hier, wenn auch nur kurz, eine Darstellung der Entwicklung dieser Krise innerhalb der IKS und der Rolle, die die Außerordentliche Konferenz spielte, um darauf zu antworten.
Die Natur der aktuellen Krise der IKS
Im Mittelpunkt der aktuellen Krise stand das Wiederaufleben einer Verleumdungskampagne innerhalb der Sektion in Frankreich gegen eine Genossin, die dämonisiert wurde (was soweit ging, dass ein anderes Mitglied behauptete, dass allein ihre Präsenz in der Organisation eine Barriere für deren Weiterentwicklung sei). Die Existenz solch einer Sündenbocksuche – einen einzelnen Genossen für die Probleme in der ganzen Organisation verantwortlich zu machen - ist absolut nicht tolerierbar in einer kommunistischen Organisation, die das Mobbing ablehnt, das allgegenwärtig in der kapitalistischen Gesellschaft ist und aus der bürgerlichen Moral des „Jeder für sich“ und „Den Letzten beißen die Hunde“ entspringt. Die Schwierigkeiten der Organisation werden von der gesamten Organisation verantwortet, folgt man ihrer Ethik des „Alle für Einen und Einer für Alle“. Die verdeckte Kampagne der Ächtung eines Genossen bzw. einer Genossin stellt die Prinzipien der kommunistischen Solidarität auf den Kopf, auf denen die IKS gegründet wurde.
Wir konnten uns aber nicht damit zufrieden geben, diese Kampagne lediglich zu stoppen, nachdem sie ans Tageslicht gekommen war und vom Zentralorgan ernst genommen wurde, denn dies ist nicht etwas, worüber man leichtfertig hinweggehen kann. Wir mussten an die Wurzeln des Problems gehen und erklären, weshalb sich eine derart gravierende Verletzung der kommunistischen Prinzipien erneut in unseren Reihen ausbreiten konnte. Die Aufgabe der Außerordentlichen Konferenz war es, eine gemeinsame Übereinkunft über diese Erklärung zu erreichen und eine Perspektive zu entwickeln, um dergleichen in Zukunft auszumerzen.
Eine der Aufgaben der Außerordentlichen Konferenz war es, den Schlussbericht des Ehrentribunals, das Anfang 2003 von der verunglimpften Genossin gefordert worden war, anzuhören und Stellung dazu zu beziehen. Es genügt nicht das bloße Einverständnis, dass die Genossin das Opfer von Verleumdungen und Verunglimpfungen war; es musste auch mit Tatsachen bewiesen werden. Wir mussten minutiös sämtliche Vorwürfe gegen die Genossin untersuchen und der Frage nachgehen, wo deren Wurzeln liegen. Die Vorwürfe und Beleidigungen sollten der gesamten Organisation offengelegt werden, um jegliche Unklarheiten zu beseitigen und in Zukunft eine Wiederholung solcher Beschuldigungen zu verhindern. Nach einem Jahr Arbeit hatte das Ehrengericht (zusammengesetzt aus Genossen von vier Sektionen der IKS) alle Beschuldigungen systematisch als jeglicher Grundlage entbehrend widerlegt (im Besonderen einige beschämende Verleumdungen, die durch einen Genossen in Umlauf gesetzt wurden)[4]. Das Ehrengericht konnte beweisen, dass diese Stigmatisierungskampagne auf dem Eindringen von obskuren Vorurteilen, verbreitet durch den Zirkelgeist, und auf einer gewissen „Kultur des Klatsches“ basierte, einem Erbe aus der Vergangenheit, von dem sich einige Genossen nicht wirklich freimachen konnten. Mit der Freistellung von Kräften zugunsten dieses Ehrengerichts folgte die IKS einer weiteren Lehre der revolutionären Arbeiterbewegung: Jeder Genosse, der das Opfer von Verdächtigungen, unbegründeten Anschuldigungen oder Lügen ist, hat die Pflicht, die Einberufung eines Ehrengerichts zu fordern. Diese Vorgehensweise abzulehnen würde dazu führen, Anschuldigungen stillschweigend anzuerkennen.
Das Ehrengericht ist auch ein Mittel zur „Aufrechterhaltung der moralischen Gesundheit der revolutionären Organisationen“ (so formulierte es Victor Serge[5]), denn Misstrauen unter ihren Mitgliedern ist ein Gift, das eine revolutionäre Organisation schnell zerstören kann.
Wie die Erfahrungen der Arbeiterbewegung gezeigt haben, ist sich die Polizei dessen sehr bewusst und setzt bevorzugt und ständig das Mittel des Schürens von Misstrauen ein, um die revolutionären Organisationen von innen zu zerstören. Vor allem in den 1930er Jahren wurde dieses Mittel von der stalinistischen GPU gegen die trotzkistische Bewegung in Frankreich und anderswo eingesetzt. Genossen zu schwächen, indem sie Verleumdungs- und Lügenkampagnen ausgesetzt werden, ist eine bevorzugte Waffe der gesamten herrschenden Klasse, um Misstrauen gegen und innerhalb der revolutionären Organisation zu säen.
Aus diesem Grunde haben die revolutionären Marxisten stets alles Erdenkliche getan, um solche Angriffe gegen ihre Organisationen zu demaskieren.
Zur Zeit der Moskauer Prozesse in den 1930er Jahren hatte Leo Trotzki im Exil ein Ehrengericht verlangt (bekannt unter dem Namen Dewey-Kommission), um die Lügen zu widerlegen, die vom Ankläger Wyschinski in diesen Prozessen gegen ihn ins Feld geführt wurden[6]. Marx hatte 1860 die Arbeit zur Niederschrift des Kapital ein Jahr lang unterbrochen, um ein ganzes Buch zu verfassen, in dem er die von „Herrn Vogt“ gegen ihn gerichteten Beschuldigungen systematisch widerlegte.
Zur selben Zeit, als das Ehrengericht seine Arbeit erledigte, suchte die IKS nach den tieferliegenden Wurzel ihrer Krise, um sich mit einem theoretischen Rahmen zu versehen. Nach der Krise der IKS von 2001-2002 hatten wir bereits lange theoretische Anstrengungen unternommen, um zu verstehen, weshalb sich innerhalb der Organisation eine so genannte Fraktion herausbilden konnte, deren Mitglieder sich wie Diebe und Lügner verhielten: siehe die heimliche Verbreitung des Gerüchts, wonach eine unserer Genossinnen eine Staatsagentin sei, den Diebstahl von Geld und Material der Organisation (vor allem von Adresslisten unserer Mitglieder und Abonnenten), die Morddrohungen gegen ein Mitglied der IKS, die Veröffentlichung von internen Informationen - was die Arbeit der Polizei unterstützt - usw. Diese schamlose „Fraktion“ mit ihrer kriminellen Politik ist bekannt unter dem Namen IFIKS (Interne Fraktion der IKS)[7] und erinnert an die sogenannte Chénier-Tendenz während unserer Krise von 1981.
Nach der Erfahrung mit der sog. IFIKS hatten wir begonnen, die Frage der Moral unter historischen und theoretischen Gesichtspunkten zu vertiefen. In der Internationalen Revue Nr. 31 und 32 haben wir den Orientierungstext „Vertrauen und Solidarität im Kampf des Proletariats“ veröffentlicht und in der Nummer 39 und 40 den Text „Marxismus und Ethik“. Unsere Organisation hatte, verbunden mit theoretischen Reflexionen, eine historische Untersuchung über das soziale Phänomen des Pogromismus vorangetrieben – dieser kompletten Antithese der kommunistischen Werte, die Kernstück der Mentalität der IFIKS war und mit der sie die IKS zerstören wollte. Auf der Basis dieser ersten Texte und der theoretischen Arbeit über Aspekte der kommunistischen Moral konnte die Organisation ihr Verständnis der grundlegenden Wurzeln der aktuellen Krise entwickeln. Oberflächlichkeit, opportunistische und „arbeitertümlerische“ Tendenzen, ein Mangel an Reflexion und theoretischen Debatten zugunsten aktivistischer und den linksbürgerlichen Praktiken ähnelnder Interventionen in den unmittelbaren Kämpfen, Ungeduld und die Tendenz, den langfristigen Aspekt unserer Arbeit zu vergessen, all das hat die Krise in der IKS ermöglicht. Diese Krise haben wir als eine „intellektuelle und moralische“ Krise identifiziert, die von einer Negierung und Übertretung der Statuten der IKS begleitet wird.[8]
Der Kampf zur Verteidigung moralischer Prinzipien des Marxismus
Auf der Außerordentlichen Konferenz kehrten wir noch ausführlicher zu einem marxistischen Verständnis der Moral zurück, um den theoretischen Kern unserer Aktivitäten in der kommenden Zeit vorzubereiten. Wir werden mit der Diskussion und der Erforschung dieser Frage als Hauptmittel unserer Rekonvaleszenz nach der jüngsten Krise fortfahren. Ohne revolutionäre Theorie kann es keine revolutionäre Organisation geben.
Im kommunistischen Projekt enthalten und unzertrennlich mit ihm verbunden ist eine ethische Dimension. Und es ist diese ethische Dimension, die in einer zerfallenden kapitalistischen Gesellschaft, in der Ausbeutung und Gewalt blühen ( „aus allen Poren, blut- und schmutztriefend “, wie Marx im Kapital schrieb) ganz besonders bedroht ist. Diese Bedrohung ist bereits in der dekadenten Epoche des Kapitalismus besonders entwickelt, wenn die Bourgeoisie zunehmend gar den eigenen moralischen Grundsätzen den Rücken kehrt, an denen sie sich in ihrer expandierenden, liberalen Epoche gehalten hatte. Diese finale Episode der kapitalistischen Dekadenz – die Epoche des gesellschaftlichen Zerfalls, die ungefähr mit dem Wendepunkt des Zusammenbruchs des Ostblocks 1989 einsetzte – verschärft diesen Prozess weiter. Heute zeigt sich die Gesellschaft immer offener barbarisch und brüstet sich gar damit. In jedem Aspekt des Lebens werden wir der Barbarei gewahr: in der Vervielfachung von Kriegen, deren Hauptzweck es zu sein scheint, ihre Opfer zu demütigen und herabzusetzen, ehe sie abgeschlachtet werden; in der großflächigen Zunahme des Banditentums – und seiner Zelebrierung in Film und Musik; in der Auslösung von Pogromen auf der Suche nach Sündenböcken für die Verbrechen des Kapitalismus und für das soziale Leid; im Anstieg der Fremdenfeindlichkeit gegenüber Immigranten und der Schikanen auf dem Arbeitsplatz („Mobbing“); in der Entwicklung von Gewalt gegenüber Frauen, von sexueller Belästigung und Frauenfeindlichkeit, auch in Schulen und unter Jugendlichen in städtischen Wohnsiedlungen. Zynismus, Lügen und Heuchelei werden nicht mehr als verwerflich betrachtet, sondern in „Management“-Lehrgängen gelehrt. Die elementarsten Werte der gesellschaftlichen Existenz – gar nicht zu reden von jenen einer kommunistischen Gesellschaft – werden, je mehr der Kapitalismus verwest, umso stärker mit Füßen getreten.
Die Mitglieder revolutionärer Organisationen können dieser Umwelt mit ihren barbarischen Gedanken und Taten nicht entkommen. Sie sind nicht immun gegen diese verderbliche Atmosphäre, insbesondere da die Arbeiterklasse heute verhältnismäßig passiv und desorientiert bleibt und somit unfähig ist, eine Alternative zum sich beschleunigenden Untergang der kapitalistischen Gesellschaft anzubieten. Andere Klassen in der Gesellschaft, die dem Proletariat nahe stehen, stellen einen aktiven Überträger verrotteter Werte dar. Die traditionelle Ohnmacht und Frustration des Kleinbürgertums – die Zwischenschicht zwischen Bourgeoisie und Proletariat – wird besonders verstärkt und sucht sich ihr Ventil im Pogromismus, im Obskurantismus und in der Hexenjagd, die jenen hetzerischen „Unruhestiftern“ ein Gefühl feiger Ermächtigung verschafft.
Es war besonders notwendig, auf der Außerordentlichen Konferenz von 2014 zum Problem der Moralität zurückzukehren, weil der explosive Charakter der Krise 2000-2002, die widerlichen Handlungen der IFIKS, das Verhalten gewisser ihrer Mitglieder als nihilistische Abenteurer dazu geführt haben, das tiefere, dem zugrundeliegende Unverständnis zu kaschieren, das den Boden für die pogromistische Mentalität bereitet hat, die bei der Bildung dieser so genannten „Fraktion“ Pate stand.[9] Aufgrund der dramatischen Ereignisse rund um den IFIKS-Skandal zehn Jahre zuvor hat es eine starke Tendenz in der Organisation gegeben, in der Zwischenzeit „zur Normalität“ zurückzukehren – eine illusorische Atempause zu finden. Es gab eine Stimmung, die Aufmerksamkeit von einer zutiefst theoretischen und historischen Behandlung von Organisationsfragen zu mehr „praktischen“ Fragen der Intervention und zu einem sanften, aber oberflächlichen „Aufbau“ der Organisation zu lenken. Obwohl der Arbeit der theoretischen Überwindung ihrer vorherigen Krise beträchtliche Anstrengungen gewidmet wurden, wurde dies immer mehr als eine Nebenfrage statt als eine Überlebensfrage für die Zukunft der revolutionären Organisation betrachtet.
Das langsame und schwierige Aufleben des Klassenkampfes 2003 und die größere Bereitschaft im politischen Milieu, mit der kommunistischen Linken zu diskutieren, haben diese Schwäche tendenziell weiter verstärkt. Teile der Organisation begannen die Prinzipien und Errungenschaften der IKS zu „vergessen“ und eine Geringschätzung für die Theorie an den Tag zu legen. Die Statuten der Organisation, die internationalistische, zentralisierte Prinzipien umfassen, wurden tendenziell zugunsten der Gewohnheiten eines lokalen und zirkelhaften Spießbürgertums, des guten, alten „gesunden Menschenverstandes“ und der „Religion des täglichen Lebens“, wie Marx es in Band 1 des Kapital nannte, ignoriert. Der Opportunismus begann sich auf heimtückische Weise auszubreiten.
Jedoch gab es Widerstand gegen diese Neigung zum theoretischen Desinteresse, zur politischen Amnesie und Verknöcherung. Es war insbesondere eine Genossin, die unverblümt diesen opportunistischen Trend kritisierte und infolgedessen als ein „Hindernis“ für eine „normale“, maschinenartige Funktionsweise der Organisation betrachtet wurde. Statt für eine kohärente politische Antwort auf die Kritik der Genossin zu sorgen, drückte sich der Opportunismus in einer unterschwelligen persönlichen Verunglimpfung aus. Andere Mitglieder, besonders in den IKS-Sektionen in Frankreich und Deutschland, die den Standpunkt der Genossin gegen die opportunistischen Verirrungen teilten, wurden ebenfalls zur Zielscheibe dieser Diffamierungskampagne.
So zeigte die Außerordentliche Konferenz, dass heute, wie in der Geschichte der Arbeiterbewegung, Verleumdungskampagnen und Opportunismus zusammengehören. In der Tat erscheinen Erstere in der Arbeiterbewegung als extreme Ausdrücke des Letzteren. Rosa Luxemburg, die als Sprecherin der marxistischen Linken schonungslos in ihrer Anprangerung des Opportunismus war, wurde systematisch von den Führern der deutschen Sozialdemokratie verfolgt und verleumdet. Die Degeneration der bolschewistischen Partei und der Dritten Internationalen wurde von einer uferlosen Verfolgung der alten bolschewistischen Garde und insbesondere Leo Trotzkis begleitet.
Die Organisation musste sich also auch den klassischen Konzepten über den organisatorischen Opportunismus aus der Geschichte der marxistischen Linken zuwenden, die die Lehren aus den eigenen Erfahrungen der IKS mit beinhalten.
Die Notwendigkeit, sowohl den Opportunismus als auch seine versöhnlerischen Ausdrücke abzulehnen, sollte das Motto der Außerordentlichen Konferenz sein: Die Krise der IKS erfordert einen langwierigen Kampf gegen die identifizierten Wurzeln des Problems, nämlich die Neigung, die IKS als einen Kokon zu behandeln und in einen Meinungs-„Club“ zu verwandeln sowie zu versuchen, sie innerhalb der zerfallenden bürgerlichen Gesellschaft unterzubringen. Im Grunde bedeutet das eigentliche Wesen der revolutionären Militanz einen permanenten Kampf gegen das Gewicht der vorherrschenden Ideologie und all der dem Proletariat fremden Ideologien, die revolutionäre Organisationen schleichend infiltrieren können. Diese Auseinandersetzung muss als die „Regel“ im Leben einer kommunistischen Organisation und jedes ihrer Mitglieder verstanden werden.
Der Kampf gegen die oberflächliche Übereinkunft, der Mut, Unterschiede auszudrücken und zu entwickeln, und das individuelle Bemühen, seine Meinung vor der gesamten Organisation auszudrücken, die Stärke, politische Kritik zu üben – dies waren die Qualitäten, auf die die Außerordentliche Konferenz bestand:
„5d) Der revolutionäre Militante muss ein Kämpfer für die Klassenpositionen des Proletariats und für seine eigenen Ideen sein. Dies ist keine optionale Bedingung der Militanz, es ist die Militanz. Ohne sie kann es keinen Kampf um die Wahrheit geben, die lediglich aus einem Zusammenprall von Ideen entstehen kann, bei dem jeder Militante dafür einsteht, woran er glaubt. Die Organisation muss die Position aller Genossen kennen, passive Übereinstimmung ist nutzlos und kontraproduktiv (….) Individuelle Verantwortung zu übernehmen, ehrlich zu sein ist ein fundamentaler Aspekt in der proletarischen Moral.“
Die gegenwärtige Krise ist nicht die „finale“ Krise der IKS
Am Vorabend der Außerordentlichen Konferenz unterstrich die Veröffentlichung eines „Appells an das proletarische Lager und die Militanten der IKS“ im Internet, in dem die „finale“ Krise der IKS angekündigt wurde, deutlich die Bedeutung dieser Notwendigkeit, für die Verteidigung der kommunistischen Organisation und ihrer Prinzipien zu kämpfen, insbesondere gegen all jene, die sie zu zerstören versuchen. Dieser besonders widerliche „Appell“ stammt von der so genannten „Internationalen Gruppe der Kommunistischen Linken“ (IGKL), in Wirklichkeit ein Mummenschwanz, hinter dem die berüchtigte frühere IFIKS steckt, die mittlerweile mit Elementen von Klasbatalo aus Montreal vermählt ist. Es ist ein Text, der durchtränkt ist mit Hass und Pogromaufrufen gegen bestimmte Genossen von uns. Dieser Text kündigt großspurig an, dass die „IGKL“ im Besitz von Dokumenten der IKS sei. Ihre Absicht ist klar: zu versuchen, unsere Außerordentliche Konferenz zu sabotieren, durch die Verbreitung von Misstrauen in ihren Reihen am Vorabend der Außerordentlichen Konferenz Unruhe und Unfrieden innerhalb der IKS zu stiften – mit der Botschaft, dass es „einen Verräter innerhalb der IKS gibt, einen Komplizen der IGKL, der uns die internen Bulletins der IKS zuspielt“.[10]
Die Außerordentliche Konferenz bezog sofort Stellung zum „Appell“ der IGKL. Für alle unsere Militanten war klar, dass die IFIKS einmal mehr und auf noch schädlichere Weise die Arbeit der Polizei verrichtet hatte, und zwar in einer Weise, die Victor Serge so eloquent in seinem Buch What everyone should know about repression geschildert hatte (auf der Grundlage der Archive der zaristischen Polizei verfasst, die nach der Oktoberrevolution entdeckt worden waren).[11]
Doch statt die Genossen der IKS gegeneinander auszuspielen, lösten die Methoden der „IGKL“, die jenen der politischen Polizei Stalins und der Stasi würdig sind, ihre einmütige Abscheu aus; sie bewirkten lediglich, dass die weitergehenden Auswirkungen der internen Krise, in der die IKS steckte, deutlich wurden und die Reihen unserer Mitglieder hinter dem Schlachtruf der Arbeiterbewegung: “Alle für einen, einer für alle!“ (in Erinnerung gerufen in dem Buch von Joseph Dietzgen Das Wesen der menschlichen Kopfarbeit) sich wieder schlossen. Diese polizeitypische Attacke der IGKL machte allen Militanten noch klarer, dass die inneren Schwächen der Organisation, der Mangel an Wachsamkeit gegenüber dem ständigen Druck der vorherrschenden Ideologie die IKS gegenüber den Machenschaften des Klassenfeindes, dessen Absichten fraglos zerstörerisch sind, verwundbar gemacht haben.
Die Außerordentliche Konferenz begrüßte die enorme und äußerst ernsthafte Arbeit des Ehrengerichts. Sie begrüßte ebenfalls den Mut der Genossen, die nach diesem Ehrengericht riefen und wegen ihrer politischen Meinungsverschiedenheiten geächtet wurden.[12] Nur Feiglinge und jene, die wissen, dass sie die ganze Schuld tragen, weigern sich, die Dinge vor einer solchen Kommission zu klären, die ein Vermächtnis der Arbeiterbewegung ist. Die dunklen Wolken, die über die Organisation hingen, haben sich aufgelöst. Und dies rechtzeitig: das Bedürfnis eines jeden Genossen und einer jeden Genossin, zusammen zu kämpfen, war gebieterischer denn je.
Die Außerordentliche Konferenz konnte den Kampf der IKS gegen diese „intellektuelle und moralische Krise“ nicht vollenden – dieser Kampf ist notwendigerweise noch im Gange -, aber sie schuf eine unzweideutige Orientierung: die Eröffnung einer theoretischen Debatte über die „Thesen der Moral“, die vom Zentralorgan der IKS vorgeschlagen wurden. Natürlich werden wir die Debatten und Divergenzen rund um diesen Text veröffentlichen, sobald die Diskussion einen ausreichenden Reifegrad erreicht hat.
Manche unserer LeserInnen mögen denken, dass die Fokussierung der IKS auf ihre interne Krise und ihren Kampf gegen die polizeitypischen Attacken gegen uns der Ausdruck einer Art von narzisstischer Störung oder eines kollektiven, paranoiden Deliriums ist. Die Sorge um eine kompromisslose Verteidigung unserer organisatorischen, programmatischen und ethischen Prinzipien ist, von diesem Standpunkt aus betrachtet, eine Ablenkung von den praktischen Alltagsaufgaben, nämlich die Weiterentwicklung unseres Einflusses in den unmittelbaren Kämpfen der Arbeiterklasse. Dieser Standpunkt ist im Grunde - inhaltlich, wenn auch in einem anderen Kontext – eine Wiederholung der Argumente der Opportunisten, die das reibungslose Funktionieren der deutschen Sozialdemokratie gegenüber der russischen sozialdemokratischen Arbeiterpartei, die die gesamte Vorkriegszeit hindurch von Krisen geschüttelt wurde, hervorgehoben hatten. Solch ein Vorgehen, das danach trachtet, Differenzen zu vermeiden, die Konfrontation politischer Argumente abzulehnen, um die „Einheit“ um jeden Preis zu bewahren, wird früher oder später zum Verschwinden organisierter revolutionärer Minderheiten führen.
Die Verteidigung fundamentaler kommunistischer Prinzipien ist, wie wenig dies auch mit den gegenwärtigen Bedürfnissen und dem Bewusstsein der Arbeiterklasse zu tun haben mag, die vorrangige Aufgabe revolutionärer Minderheiten. Unsere Entschlossenheit, eine permanente Auseinandersetzung zur Verteidigung der kommunistischen Moralität – die im Zentrum des Solidaritätsprinzips steht – zu führen, ist der Schlüssel dafür, unsere Organisation zu verteidigen, die mit dem Pesthauch des gesellschaftlichen Zerfalls des Kapitalismus konfrontiert ist, der unvermeidlich in alle revolutionären Organisationen eindringt. Nur indem wir uns politisch rüsten, indem wir unsere Arbeit der theoretischen Ausführungen stärken, werden wir in der Lage sein, gegenüber dieser tödlichen Gefahr zu bestehen. Darüber hinaus wird ohne die Verteidigung der Ethik jener Klasse, die der Geburtshelfer des Kommunismus ist, die Möglichkeit, dass der Klassenkampf zur Revolution und zum Aufbau einer wahren Weltgemeinschaft führen wird, immer unwahrscheinlicher.
Eine Sache wurde auf der Außerordentlichen Konferenz 2014 klar: Es wird keine „Rückkehr zur Normalität“ geben, ob in den internen oder in den externen Aktivitäten der IKS.
Im Gegensatz dazu, was in der Krise von 2001 passierte, können wir uns bereits jetzt über die Tatsache freuen, dass Genossen, die in diese Logik der irrationalen Stigmatisierung und der Suche nach einem Sündenbock hineingezogen worden waren, in der Lage waren, die Bedenklichkeit dessen zu erkennen, in was sie involviert gewesen waren. Diese Militanten haben sich freiwillig dazu entschlossen, gegenüber der IKS und ihren Prinzipien loyal zu bleiben, und engagieren sich nun in unserem Kampf für die Konsolidierung der Organisation. Wie auch der Rest der IKS nehmen sie nun teil an der Arbeit der theoretischen Reflexion und Vertiefung, die in der Vergangenheit größtenteils unterschätzt worden war. Indem sie sich Spinozas Formulierung „Weder lachen noch weinen, sondern verstehen“ aneignet, versucht die IKS, zur Schlüsselidee des Marxismus zurückzukehren: dass der Kampf des Proletariats für den Kommunismus nicht nur eine „ökonomische“ Dimension hat (wie die Vulgärmaterialisten meinen), sondern auch und fundamental eine „intellektuelle und moralische“ Dimension (wie Lenin und Rosa Luxemburg insbesondere argumentierten).
Wir müssen daher unseren Verleumdern leider mitteilen, dass es in der IKS keine unmittelbare Aussicht auf eine neue parasitäre Abspaltung geben wird, wie dies in den vorherigen Krisen der Fall war. Es gibt keine Perspektive für die Bildung einer neuen „Fraktion“, die empfänglich genug wäre, sich dem „Appell“ der IGKL zum Pogrom gegen unsere eigenen Genossen anzuschließen – ein Appell, der von mannigfaltigen „sozialen Netzwerken“ und dem so genannten „Pierre Hempel“, der sich selbst für einen Repräsentanten des „universellen Proletariats“ hält, frenetisch weiter getragen wird. Im Gegenteil: die Polizeimethoden der IGKL (gesponsert von einer „kritischen“ Tendenz innerhalb einer bürgerlich-reformistischen Partei, der NPA[13]) haben lediglich erreicht, dass die Empörung unter den Militanten der IKS gewachsen ist und sie in ihrer Entschlossenheit bekräftigt wurden, für die Stärkung der Organisation zu kämpfen.
Die Nachrichten über unser Ableben sind somit sowohl übertrieben als auch verfrüht.
Internationale Kommunistische Strömung
[1] Wie bei der Außerordentlichen Konferenz von 2002 (sie dazu den Artikel in der Internationalen Revue Nr. 30 „Außerordentliche Konferenz der IKS: Der Kampf für die Verteidigung der organisatorischen Prinzipien“ (https://de.internationalism.org/print/book/export/html/690 [5]), hat jene von 2014 einen Teil des regulären Kongresses unserer Sektion in Frankreich ersetzt. Das heißt, ein Teil der Zeit war der Außerordentlichen Konferenz gewidmet, ein anderer dem Kongress der Sektion in Frankreich, über den unsere Zeitschrift Révolution International schon berichtet hat.
[2] Chènier war Mitglied unserer Sektion in Frankreich und wurde im Sommer 1981 ausgeschlossen, weil er eine geheime Kampagne mit Verleumdungen gegen das Zentralorgan der Organisation und gegen einige der erfahrensten Mitglieder geführt hatte, mit dem Ziel die Einen gegen die Anderen aufzubringen. Also Verhaltensweisen, die auffallend an die Agenten der GPU innerhalb der trotzkistischen Bewegung in den 1930er Jahren erinnern. Nur einige Monate nach seinem Ausschluss übernahm Chénier einen Posten in der Sozialistischen Partei, die damals an der Regierung war.
[3] Lenin Werke Bd. 7, Seite 202
[4] Parallel zu dieser Kampagne wurden in informellen Diskussionen in der Sektion in Frankreich durch Genossen der „alten“ Generation Geschichten verbreitet, in denen auf skandalöse Weise unseren Gensossen und Gründungsmitglied Marc Chirik verunglimpft wurde, ohne den es die IKS nie gegeben hätte. Solche Klatschgeschichten sind Ausdruck des Einflusses des Zirkelgeistes und des Gewichts des heruntergekommenen Kleinbürgertums, das die aus der Studentenbewegung vom Mai 68 hervorgegangene Generation geprägt hatte (mit all seinen anarcho-modernistischen und linken Ideologien).
[5] Victor Serge: Was jeder Revolutionär über die Repression wissen muss
[6] Das Ehrengericht der IKS hat sich auf die wissenschaftliche Untersuchungs- und Prüfungsmethode der Fakten der Dewey-Kommission gestützt. Die Gesamtheit ihrer Arbeiten (Dokumente, Protokolle, Berichte von Befragungen und Zeugenaussagen, usw.) ist sorgfältig in den Archiven der IKS abgelegt.
[7] Siehe dazu unsere Artikel: „15. Kongress der IKS: Verstärkung der Organisation angesichts der Herausforderungen der gegenwärtigen Periode“, Internationale Revue Nr. 114 (engl., franz., span.), „Die Polizeimethoden der IFIKS“ in Weltrevolution Nr. 117.
[8] Das Zentralorgan der IKS (sowie auch das Ehrengericht) hat klar bewiesen, dass es nicht die verleumdete Genossin war, die die Stauten verletzt hatte, sondern im Gegenteil die Genossen, die in diese Verleumdungskampagne involviert waren.
[9] Das Sträuben in unseren Reihen gegen eine Weiterführung der Debatte über die Frage der Moral hat seinen Ursprung in einer genuinen Schwäche der IKS (die tatsächlich alle Gruppen der kommunistischen Linken beeinträchtigt): Die Mehrheit der ersten Generation von Militanten wies diese Frage von sich, die daher nicht in unsere Statuten integriert werden konnte, wie unser Genosse Chirik gehofft hatte. Moral wurde von diesen jungen Militanten damals als ein Gefängnis betrachtet, als ein „Produkt der bürgerlichen Ideologie“, was soweit ging, dass einige von ihnen, die aus dem libertären Milieu kamen, forderten, „ohne Tabus“ zu leben! Was eine krasse Ignoranz gegenüber der Geschichte der menschlichen Spezies und der Entwicklung ihrer Zivilisation offenbart.
[10] Siehe „Kommuniqué an unsere Leser: die IKS unter Beschuss durch eine neue Agentur des bürgerlichen Staates“.
[11] Als ob er den Klassencharakter des Angriffs bestätigen wollte, veröffentlichte ein gewisser Pierre Hempel auf seinem Blog weitere interne Dokumente der IKS, die die Ex-IFIKS ihm ausgehändigt hatte. Er fügte den Kommentar hinzu: „Wenn die Polizei mir solch ein Dokument zugespielt hätte, würde ich mich im Namen des Proletariats bei ihr bedanken“! Diese Heilige Allianz der Feinde der IKS, die sich zum größten Teil aus der „Ehrenwerten Gesellschaft alter IKS-Recken“ zusammensetzt, weiß, welchem Lager sie angehört!
[12] Dies war auch zu Beginn der Krise von 2001 der Fall gewesen: Als dieselbe Genossin eine politische Meinungsverschiedenheit mit einem schriftlichen Text des Internationalen Sekretariats der IKS (über die Frage der Zentralisierung) zum Ausdruck brachte, machte die Mehrheit des IS die Schotten dicht, erstickte diese Debatte, statt sie zu eröffnen, um auf die politischen Argumente der Genossin zu antworten, und begann eine Verleumdungskampagne gegen diese Genossin (mit dem Abhalten von Geheimtreffen und der Verbreitung des Gerüchts in den Sektionen Frankreichs und Mexikos, dass diese Genossin wegen ihrer politischen Meinungsverschiedenheiten mit Mitgliedern des Zentralorgans der IKS eine „Dreckschleuder“ und gar ein „Bulle“ sei, um die beiden Genossen der Ex-IFIKS. Juan und Jonas, zu zitieren, die die Initiatoren bei der Bildung der IGKL waren).
[13] Wir sollten hervorheben, dass bis heute die IGKL keine Erklärung für ihre Beziehungen und Annäherung mit/an diese Tendenz, die innerhalb der Neuen Antikapitalistischen Partei (NPA) des Olivier Besancenot wirkt, geliefert hat. Schweigen bedeutet Zustimmung!
Aktuelles und Laufendes:
Erbe der kommunistischen Linke:
Rubric:
1914: Wie der deutsche Sozialismus dazu kam, die ArbeiterInnen zu verraten
- 2402 Aufrufe
Von allen Parteien, die in der 2. Internationalen vereint waren, war die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) die weitaus mächtigste. 1914 hatte die SPD mehr als eine Million Mitglieder und mehr als vier Millionen Stimmen in den Reichstagswahlen 1912 errungen;[1] sie war in der Tat die einzige Massenpartei in Deutschland und stellte die größte Fraktion im Reichstag – obwohl sie unter dem autokratischen, imperialen Regime von Kaiser Wilhelm II. faktisch keine Chance hatte, die Regierung zu bilden.
Für die anderen Parteien der 2. Internationalen war die SPD der Nabel der Welt. Karl Kautsky,[2] der Herausgeber des theoretischen Organs der Partei, die Neue Zeit, war der allseits anerkannte „Papst des Marxismus“, der führende Theoretiker der Internationalen. Auf dem Kongress der Internationalen von 1900 hatte Kautsky die Resolution verfasst, die die Beteiligung des französischen Sozialisten Millerand an einer bürgerlichen Regierung verurteilte. Der Dresdner Parteitag der SPD im Jahr 1903 hatte unter der Leitung ihres Vorsitzenden August Bebel[3] die revisionistischen Theorien von Eduard Bernstein in Bausch und Bogen verurteilt und die revolutionären Ziele der SPD bekräftigt. Lenin hatte den „Parteigeist“ der SPD und ihre Immunität gegen die kleinbürgerlichen Animositäten gepriesen, die die Menschewiki dazu verleitet hatten, die Russische Sozialdemokratische Arbeiterpartei (RSDAP) nach deren Parteitag von 1903 zu spalten.[4] Zu alledem wurde die theoretische und organisatorische Überlegenheit der SPD offensichtlich von ihrem Erfolg vor Ort gekrönt: Keine andere Partei der Internationalen konnte für sich beanspruchen, was dem Wahlerfolg der SPD auch nur nahe kam, und was die Gewerkschaften anging, so konnten allein die britischen mit den deutschen Gewerkschaften an Zahl und Disziplin ihrer Mitglieder mithalten.
„In der Zweiten Internationale spielte der deutsche ‚Gewalthaufen‘ die ausschlaggebende Rolle. Auf den Kongressen, in den Sitzungen des Internationalen Sozialistischen Büros wartete alles auf die deutsche Meinung. Ja, gerade in den Fragen des Kampfes gegen den Militarismus und den Krieg trat die deutsche Sozialdemokratie stets entscheidend auf. ‚Für uns Deutsche ist dies unannehmbar‘, genügte regelmäßig, um die Orientierung der Internationale zu bestimmen. Mit blindem Vertrauen ergab sie sich der Führung der bewunderten, mächtigen deutschen Sozialdemokratie: Diese war der Stolz jedes Sozialisten und der Schrecken der herrschenden Klassen in allen Ländern.“[5]
Es lag daher auf der Hand, dass, als sich die Sturmwolken des Krieges im Juli 1914 zusammenzubrauen begannen, das Verhalten der deutschen Sozialdemokratie für den Ausgang der Geschehnisse Ausschlag gebend war. Die deutschen ArbeiterInnen – die großen Massen, die in der Partei und in den Gewerkschaften organisiert waren, für deren Aufbau sie so hart gekämpft hatten – befanden sich in einer Position, die sie zum alleinigen Zünglein an der Waage machte: entweder hin zum Widerstand, zu Verteidigung des proletarischen Internationalismus oder hin zur Klassenkollaboration und zum Verrat, zu Jahren des blutigsten Gemetzels, das die Menschheit jemals erlebt hat.
„Und was erlebten wir in Deutschland, als die große historische Probe kam? Den tiefsten Fall, den gewaltigsten Zusammenbruch. Nirgends ist die Organisation des Proletariats so gänzlich in den Dienst des Imperialismus gespannt, nirgends wird der Belagerungszustand so widerstandslos ertragen, nirgends die Presse so geknebelt, die öffentliche Meinung so erwürgt, der wirtschaftliche und politische Klassenkampf der Arbeiterklasse so gänzlich preisgegeben wie in Deutschland.“[6]
Der Verrat der deutschen Sozialdemokratie kam für die Revolutionären als ein solcher Schock daher, dass Lenin, als er im Vorwärts[7] las, dass die SPD-Parlamentsfraktion zugunsten der Kriegskredite gestimmt hatte, diese Ausgabe für eine Fälschung, für schwarze Propaganda hielt, die von der Reichsregierung lanciert wurde. Wie war eine solche Katastrophe möglich? Wie konnte innerhalb weniger Tage die stolze und mächtige SPD ihr feierlichstes Versprechen brechen und über Nacht sich von einem Juwel in der Krone der Internationalen der ArbeiterInnen in die mächtigste Waffe im Arsenal der kriegslüsternen herrschenden Klasse verwandeln?
Wenn wir in diesem Artikel diese Frage zu beantworten versuchen, mag es paradox erscheinen, sich zum großen Teil auf die Schriften und Handlungen einer verhältnismäßig kleinen Gruppe von Individuen zu konzentrieren: die SPD und die Gewerkschaften waren immerhin Massenorganisationen, die in der Lage waren, Hunderttausende von ArbeiterInnen zu mobilisieren. Es ist jedoch gerechtfertigt, weil Individuen wie Karl Kautsky oder Rosa Luxemburg bestimmte Tendenzen innerhalb der Partei repräsentierten; in diesem Sinn verliehen ihre Schriften politischen Tendenzen eine Stimme, mit denen sich Massen von Mitgliedern und ArbeiterInnen – die in der Geschichte anonym bleiben - identifizierten. Es ist gleichfalls notwendig, die politischen Biografien dieser führenden Figuren mit zu berücksichtigen, wenn wir das Gewicht begreifen wollen, das sie in der Partei hatten. August Bebel, Vorsitzender der SPD von 1892 bis zu seinem Tod 1913, war einer der Parteigründer und zusammen mit seinem Freund, dem Reichstag-Abgeordneten Wilhelm Liebknecht, wegen ihrer Weigerung, den Krieg Preußens gegen Frankreich 1870 zu unterstützen, eingekerkert worden. Kautsky und Bernstein wurden beide durch Bismarcks Sozialistengesetze ins Exil nach London gezwungen, wo sie unter Engels Leitung tätig waren. Das Prestige und die moralische Autorität, die dies ihnen in der Partei verlieh, waren beträchtlich. Selbst Georg von Vollmar, einer der Führer des süddeutschen Reformismus, erlangte zunächst Prominenz als Angehöriger des linken Flügels und als eifriger und talentierter Untergrund-Organisator, der dafür mit wiederholten Gefängnisstrafen büßen musste.
Und schließlich war dies eine Generation, die durch die Jahre des deutsch-französischen Krieges und der Pariser Kommune, durch die Jahre der klandestinen Propaganda und Agitation trotz Bismarcks Sozialistengesetze (1878-1890) politisiert worden war. Aus einem ganz anderen Holz geschnitzt waren Männer wie Gustav Noske, Friedrich Ebert oder Philipp Scheidemann, alles Mitglieder des rechten Flügels in der Parlamentsfraktion der SPD, die 1914 für die Kriegskredite stimmten und eine Schlüsselrolle bei der Unterdrückung der Deutschen Revolution von 1919 – sowie bei der Ermordung Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts durch die Freikorps - spielten. Ähnlich wie Stalin waren sie Apparatschiks, die hinter den Kulissen ihre Strippen zogen, statt sich aktiv an den öffentlichen Debatten zu beteiligen; sie waren Repräsentanten einer Partei, die mit ihrem Wachstum immer mehr dazu neigte, sich dem deutschen Staat, dessen Sturz noch immer ihr offizielles Ziel war, anzugleichen und mit ihm zu identifizieren.
Die revolutionäre Linke wandte sich gegen die wachsende Tendenz innerhalb der Partei, Zugeständnisse gegenüber der „praktischen Politik“ zu machen, und war auffälligerweise in weiten Teilen sowohl aus dem Ausland gekommen als auch jung (eine namhafte Ausnahme war der alte Franz Mehring). Abgesehen vom Holländer Anton Pannekoek und Wilhelm Liebknechts Sohn Karl kamen Männer wie Parvus, Radek, Jogiches und Marchlewski allesamt aus dem Russischen Reich, wo sie unter den harten Bedingungen der zaristischen Unterdrückung zu Militanten geschmiedet worden waren. Und natürlich war die herausragende Figur auf der Linken Rosa Luxemburg, eine Außenseiterin in der deutschen Partei auf jede erdenkliche Weise: jung, weiblich, polnisch, jüdisch und – womöglich das Schlimmste vom Standpunkt einiger Leute aus der deutschen Führung – intellektuell und theoretisch turmhoch über den Rest der Partei stehend.
Die Gründung der SPD
Die Sozialistische Arbeiterpartei (SAP), die spätere SPD, wurde 1875 in Gotha durch die Verschmelzung von zwei sozialistischen Parteien gegründet: die Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP),[8] angeführt von Wilhelm Liebknecht und August Bebel, und der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein (ADAV), der ursprünglich von Ferdinand Lassalle 1863 gegründet worden war.
Die neue Organisation entsprang also zwei unterschiedlichen Quellen. Die SDAP hatte nur sechs Jahre lang existiert; durch ihre langjährige Beziehung zu Liebknecht – obgleich Liebknecht kein Theoretiker war, spielte er eine wichtige Rolle bei der Einführung von Männern wie Bebel und Kautsky in die Ideen von Marx – hatten Marx und Engels eine wichtige Rolle in der Entwicklung der SDAP gespielt. 1870 verfolgte die SDAP entschlossen eine internationalistische Linie gegen den Aggressionskrieg Preußens gegen Frankreich: In Chemnitz nahm ein Delegiertentreffen, das 50.000 sächsische Arbeiter repräsentierte, aus diesem Anlass einmütig eine Resolution an: „Im Namen der deutschen Demokratie und namentlich der Arbeiter der sozialdemokratischen Partei erklären wir den gegenwärtigen Krieg für einen ausschließlich dynastischen (…) Mit Freuden ergreifen wir die uns von den französischen Arbeitern gebotene Bruderhand (...) Eingedenk der Losung der Internationalen Arbeiterassoziation: ‚Proletarier aller Länder, vereinigt euch!‘ werden wir nie vergessen, dass die Arbeiter aller Länder unsre Freunde und die Despoten aller Länder unsere Feinde sind.“[9]
Im Gegensatz dazu war der ADAV dem Widerstand seines Gründers Lassalle gegen die Streikaktion und seinem Glauben treu geblieben, dass die Sache der Arbeiter durch ein Bündnis mit dem Bismarckschen Staat und, allgemeiner, durch die Rezepte des „Staatssozialismus“ vorangebracht werden könnte.[10] Während des deutsch-französischen Kriegs blieb der ADAV pro-deutsch, sein damaliger Präsident, Mende, drängte gar auf französische Reparationen, die benutzt werden sollten, um staatliche Werkstätten für deutsche ArbeiterInnen zu errichten.[11]
Marx und Engels standen der Verschmelzung zutiefst kritisch gegenüber, obwohl Marx‘ Randnotizen über das Programm erst sehr viel später öffentlich gemacht wurden.[12] Marx war der Ansicht: “Jeder Schritt wirklicher Bewegung ist wichtiger als ein Dutzend Programme.“[13] Auch wenn sie es unterließen, die neue Partei offen zu kritisieren, machten sie ihre Ansicht den führenden Mitgliedern dieser Partei deutlich, und in seinem Schreiben an Bebel hob Engels zwei Schwächen hervor, die die Saat für den Verrat von 1914 bilden sollten:
- „Zweitens wird das Prinzip der Internationalität der Arbeiterbewegung praktisch für die Gegenwart vollständig verleugnet, und das von den Leuten, die fünf Jahre lang und unter den schwierigsten Umständen dies Prinzip auf die ruhmvollste Weise hochgehalten. Die Stellung der deutschen Arbeiter an der Spitze der europäischen Bewegung beruht wesentlich auf ihrer echt internationalen Haltung während des Kriegs, kein anderes Proletariat hätte sich so gut benommen. Und jetzt soll dies Prinzip von ihnen verleugnet werden im Moment, wo überall im Ausland die Arbeiter es in demselben Maß betonen, in dem die Regierungen jeden Versuch seiner Betätigung in einer Organisation zu überdrücken streben!(…)
- „…Viertens stellt das Programm als einzige soziale Forderung auf – die Lassallesche Staatshilfe in ihrer nacktesten Gestalt, wie Lassalle sie von Buchez gestohlen hatte. Und das, nachdem Bracke diese Forderung sehr gut in ihrer ganzen Nichtigkeit aufgewiesen; nachdem fast alle, wo nicht alle Redner unserer Parteiim Kampf mit den Lassalleanern genötigt gewesen sind, gegen diese ‚Staatshilfe‘ aufzutreten. Tiefer konnte unsere Bewegung sich nicht demütigen. Der Internationalismus heruntergekommen auf Amand Goegg, der Sozialismus auf den Bourgeoisrepublikaner Buchez, der diese Forderung gegen den Sozialisten stellte, um sie auszustechen.“[14]
Diese Verwerfungslinien in der praktischen Politik waren wenig überraschend angesichts der eklektizistischen theoretischen Untermauerung der neuen Partei. Als Kautsky 1883 die Neue Zeit gründete, hatte er eine Zeitschrift im Sinn, die, „als ein marxistisches Organ publiziert, sich selbst die Aufgabe stellt, das niedrige theoretische Niveau in der deutschen Sozialdemokratie anzuheben, den eklektischen Sozialismus zu zerstören und den Sieg des marxistischen Programms durchzusetzen.“ Er schrieb an Engels: „Ich könnte bei meinen Bemühungen erfolgreich sein, die Neue Zeit zum Sammelbecken der marxistischen Schule zu machen. Ich gewinne viele marxistische Kräfte für eine Mitarbeit, wie ich den Eklektizismus und Rodbertusianismus loswerde.“ (von der IKS übersetzt).[15]
Von Anbeginn, einschließlich der Zeit ihrer Untergrund-Existenz, war die SAP also ein Schlachtfeld von kollidierenden theoretischen Tendenzen – völlig normal in einer gesunden proletarischen Organisation. Doch wie Lenin einst bemerkte: „Ohne revolutionäre Theorie keine revolutionäre Praxis“, und diese unterschiedlichen Tendenzen oder Visionen von Organisation und Gesellschaft sollten ganz praktische Konsequenzen haben.
Mitte der 1870er Jahre hatte die SAP um die 32.000 Mitglieder in mehr als 250 Bezirken, und 1878 setzte Kanzler Bismarck ein „anti-sozialistisches“ Gesetz durch, um die Parteiaktivitäten zu lähmen. Eine Menge Zeitungen, Treffen und Organisationen wurden verboten, und Tausende von Militanten wanderten ins Gefängnis oder wurden mit Geldbußen belegt. Doch die Entschlossenheit der Sozialisten blieb von dem Sozialistengesetz ungebrochen. Ja, die Aktivitäten der SAP blühten unter den Bedingungen der Semi-Illegalität geradezu auf. Die Illegalität zwang die Partei und ihre Mitglieder dazu, sich außerhalb des Fahrwassers der bürgerlichen Demokratie - selbst der limitierten Demokratie des Bismarckschen Deutschland - zu organisieren und eine starke Solidarität gegen Polizeirepression und permanente staatliche Überwachung zu entwickeln. Trotz ständiger Belästigung durch die Polizei gelang es der Partei, ihre Presse aufrechtzuerhalten und ihre Verbreitung soweit zu vergrößern, dass beispielsweise die satirische Zeitung Der wahre Jacob (1884 gegründet) allein 100.000 Abonnenten hatte.
Trotz der Sozialistengesetze verblieb der SAP eine öffentliche Aktivität: Es war den SAP-Kandidaten immer noch möglich, an den Reichstagswahlen als konfessionslose Unabhängige teilzunehmen. Daher konzentrierte sich ein großer Teil der Parteipropaganda auf die Wahlkampagnen auf nationaler und lokaler Ebene, und dies mag der Grund gewesen sein sowohl für das Prinzip, dass die Parlamentsfraktion strikt dem Parteitag und dem Zentralorgan der Partei (der Vorstand)[16] untergeordnet blieb, als auch, angesichts ihrer wachsenden Wahlerfolge, für das wachsende Gewicht der Parlamentsfraktion innerhalb der Partei.
Bismarcks Politik war eine klassische Politik von „Zuckerbrot und Peitsche“. Während die ArbeiterInnen daran gehindert wurden, sich selbst zu organisieren, versuchte der imperiale Staat, den Sozialisten den Boden unter den Füßen wegzuziehen, indem er ab 1883 Sozialversicherungszahlungen im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Ruhestand einführte – volle zwanzig Jahre vor dem französischen Gesetz über Arbeiter- und Bauernpensionen (1910) und dem britischen Sozialversicherungsgesetz (1911). Ende der 1880er Jahre bezogen um die 4,7 Millionen ArbeiterInnen Geld aus der Sozialversicherung.
Weder das Sozialistengesetz noch die Einführung der Sozialversicherung erreichte den erwünschten Effekt, die Unterstützung für die Sozialdemokratie zu stutzen. Im Gegenteil, zwischen 1881 und 1890 stiegen die Wahlergebnisse der SAP von 312.000 auf 1.427.000 Stimmen, was die SAP zur größten Partei in Deutschland machte. Bis 1890 wuchsen ihre Mitgliederzahlen auf 75.000, und ungefähr 300.000 ArbeiterInnen traten Gewerkschaften bei. 1890 wurde Bismarck vom neuen Kaiser Wilhelm II. abgesetzt, und das Sozialistengesetz wurde außer Kraft gesetzt.
Nachdem sie aus der Klandestinität herausgetreten war, wurde die SAP auf ihrem Erfurter Parteitag 1891 als legale Organisation, als Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) neu gegründet. Der Parteitag nahm ein neues Programm an, und obwohl Engels das Erfurter Programm als Verbesserung seines Gothaer Vorgängers betrachte, hielt er es dennoch für notwendig, die Neigung zum Opportunismus zu kritisieren: „Wie nötig das ist, beweist gerade jetzt der in einem großen Teil der sozialdemokratischen Presse einreißende Opportunismus. Aus Furcht vor einer Erneuerung des Sozialistengesetzes, aus der Erinnerung an allerlei unter der Herrschaft jenes Gesetzes gefallenen voreiligen Äußerungen soll jetzt auf einmal der gegenwärtige gesetzliche Zustand in Deutschland der Partei genügen können, alle ihre Forderungen auf friedlichem Weg durchzuführen. Man redet sich und der Partei vor, ‚die heutige Gesellschaft wachse in den Sozialismus hinein‘ (…) Dies Vergessen der großen Hauptgesichtspunkte über den augenblicklichen Interessen des Tages, dies Ringen und Trachten nach dem Augenblickserfolg ohne Rücksicht auf die späteren Folgen, dies Preisgeben der Zukunft der Bewegung um der Gegenwart der Bewegung willen mag ‚ehrlich‘ gemeint sein, aber Opportunismus ist und bleibt es, und der ‚ehrliche‘ Opportunismus ist vielleicht der gefährlichste von allen.“[17] Engels war hier bemerkenswert vorausschauend: Öffentliche Deklarationen von revolutionären Absichten sollten sich ohne einen konkreten Aktionsplan, der ihnen Nachdruck verlieh, als machtlos erweisen. 1914 fand sich die Partei tatsächlich als „plötzlich hilflos“ wieder.
Dennoch blieb es beim offiziellen Schlachtruf der SPD: „Diesem System keinen Mann und keinen Groschen“, und ihre Reichstagsabgeordneten verweigerten systematisch jegliche Unterstützung für Regierungsetats, besonders für Militärausgaben. Solch eine prinzipientreue Opposition gegen jeglichen Klassenkompromiss war im parlamentarischen System möglich, weil der Reichstag keine wirkliche Macht besaß. Die Regierung des Wilhelminischen Deutschen Reichs war autokratisch, dem zaristischen Russland nicht unähnlich,[18] und die systematische Opposition der SPD hatte daher keine praktischen Konsequenzen.
In Süddeutschland lagen die Dinge anders. Hier behauptete die lokale SPD unter der Führung von Männern wie Vollmar, dass „besondere Umstände“ herrschten und dass die SPD zur Machtlosigkeit und Irrelevanz verdammt sei, wenn sie nicht in der Lage sei, verantwortungsvoll in den Legislativen der Länder abzustimmen, wenn sie keine Agrarpolitik habe, die imstande sei, die Kleinbauern anzusprechen. Diese Tendenz tauchte auf, sobald die Partei legalisiert war, auf dem Erfurter Parteitag 1891, und bereits 1891 stimmten SPD-Abgeordnete in den Länderparlamenten von Württemberg, Bayern und Baden zugunsten der Regierungsetats.[19]
Die Reaktion der Partei auf diese direkte Attacke gegen ihre Politik sollte, wie in wiederholten Parteitagsresolutionen zum Ausdruck gekommen, darin bestehen, sie unter den Teppich zu kehren. Ein Versuch von Vollmar, ein besonderes Agrarprogramm vorzubringen, wurde vom Frankfurter Parteitag 1894 niedergestimmt, doch derselbe Parteitag lehnte auch eine Resolution ab, in der gefordert wurde, jegliches Votum eines jeglichen SPD-Abgeordneten für jeglichen Regierungsetat zu verbieten. So lange reformistische Politik auf die süddeutsche „Einzigartigkeit“ beschränkt blieb, konnte sie toleriert werden.[20]
Die Legalität untergräbt den Kampfgeist der SPD
Durch das Gift der Demokratie verblassten bald schon die Erfahrungen der Arbeiterklasse aus einem Dutzend Jahre der Semi-Illegalität. Die bürgerliche Demokratie und der Individualismus, die Hand in Hand gehen, untergraben durch ihr eigentliches Wesen jeglichen Versuch durch das Proletariat, eine Vision von sich selbst als eine historische Klasse mit eigener Perspektive zu entwickeln, die unvereinbar mit der kapitalistischen Gesellschaft ist. Die demokratische Ideologie treibt ständig einen Keil in die Arbeitersolidarität, weil sie die Arbeiterklasse in eine bloße Masse von atomisierten StaatsbürgerInnen aufspaltet. Gleichzeitig wuchsen die Wahlerfolge der Partei sowohl in puncto Stimmen als auch in Form von Parlamentssitzen, während immer mehr ArbeiterInnen sich in den Gewerkschaften organisierten und in der Lage waren, ihren Lebensstandard zu verbessern. Die wachsende politische Stärke der SPD und die industrielle Stärke der organisierten Arbeiterklasse brachten eine neue politische Strömung hervor, die den Gedanken zu theoretisieren begann, dass es möglich sei, den Sozialismus innerhalb des Kapitalismus zu errichten und sich für einen allmählichen Übergang zu engagieren, ohne die Notwendigkeit, den Kapitalismus durch eine Revolution zu stürzen, dass aber die SPD eine spezifisch deutsche expansionistische Außenpolitik haben solle: Die Strömung kristallisierte sich 1897 um die Sozialistische(n) Monatshefte herum, eine Zeitschrift außerhalb der Kontrolle der SPD, mit Artikeln von Max Schippel, Wolfgang Heine und Heinrich Peus.[21]
Dieser unbequeme, aber erträgliche Zustand explodierte 1898 mit der Veröffentlichung von Eduard Bernsteins Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie. Bernsteins Broschüre erklärte offen, was er und andere seit einiger Zeit behaupteten: “Praktisch gesprochen sind wir nicht mehr als eine radikale Partei; wir haben nichts anderes gemacht als das, was bürgerliche Radikale tun, mit dem Unterschied, dass wir es unter einer Sprache verstecken, die in keinem Verhältnis steht zu unseren Taten und unseren Fähigkeiten“.[22] Bernsteins theoretische Position griff die eigentlichen Fundamente des Marxismus insofern an, als er die Unvermeidlichkeit des Niedergangs und finalen Zusammenbruchs des Kapitalismus verneinte. Sich auf den boomenden Wohlstand der 1890er Jahre stützend, argumentierte Bernstein, dass der Kapitalismus seine Tendenz zur selbstzerstörerischen Krise überwunden habe. Unter diesen Umständen sei das Ziel nichts, die Bewegung alles; die Quantität sollte höher stehen als die Qualität, der Antagonismus zwischen dem Staat und der Arbeiterklasse konnte angeblich überwunden werden.[23] Bernstein verkündete offen, dass der elementare Grundsatz des Kommunistischen Manifests, demzufolge die ArbeiterInnen kein Vaterland haben, „obsolet“ sei. Er rief die deutschen ArbeiterInnen auf, die Kolonialpolitik des Kaisers in Afrika und Asien zu unterstützen.[24]
In Wirklichkeit neigte sich eine ganze Epoche, jene der Expansion und des Aufstiegs des kapitalistischen Systems, ihrem Ende zu. Für Revolutionäre stellen solche Perioden einer tiefen historischen Transformation eine große Herausforderung dar, da sie die Charakteristiken der neuen Epoche analysieren, einen theoretischen Rahmen zum Verständnis der wesentlichen Veränderungen, die stattgefunden haben, entwickeln und ihr Programm, falls notwendig, anpassen müssen, wobei sie die ganze Zeit dasselbe revolutionäre Ziel vertreten.
Die rasche Expansion des Kapitalismus um den Globus, seine massive industrielle Entwicklung, der neue Stolz der herrschenden Klasse und ihre imperiale Pose – all dies veranlasste die revisionistische Strömung zu glauben, dass der Kapitalismus für immer existieren werde, dass der Sozialismus innerhalb des Kapitalismus eingeführt werden könne und dass der kapitalistische Staat im Interesse der Arbeiterklasse benutzt werden könne. Die Illusion eines friedlichen Übergangs zeigte, dass die Revisionisten tatsächlich Gefangene der Vergangenheit geworden waren, die nicht in der Lage waren zu erkennen, dass sich eine neue historische Epoche am Horizont ankündigte: die Epoche der Dekadenz des Kapitalismus und der gewaltsamen Explosion seiner Widersprüche. Ihre Unfähigkeit, die neue historische Lage zu analysieren, und ihre Theoretisierung der „Ewigkeit“ der Bedingungen des Kapitalismus Ende des 19. Jahrhunderts bedeuteten auch, dass die Revisionisten außerstande waren zu erkennen, dass die alten Waffen des Kampfes, Parlamentarismus und Gewerkschaftskampf, nicht mehr funktionierten. Die Fixierung auf die parlamentarische Arbeit als die Achse ihre Aktivitäten, die Orientierung auf den Kampf für Reformen innerhalb des Systems, die Illusion eines „krisenfreien Kapitalismus“ und die Möglichkeit, den Sozialismus friedlich innerhalb des Systems einzuführen, bedeutete, dass faktisch große Teile der SPD-Führung sich mit dem System arrangiert hatten. Die offen opportunistische Strömung in der Partei war der Ausdruck des Vertrauensverlustes des Proletariats in seinen historischen Kampf. Nach Jahren des Verteidigungskampfes für das „Minimalprogramm“ hatte die bürgerliche Ideologie die Arbeiterbewegung penetriert. Dies hieß, dass die Existenz und die Kennzeichen von Gesellschaftsklassen in Frage gestellt wurden und eine individualistische Sichtweise die Klassen zu dominieren und im „Volk“ aufzulösen drohte. Der Opportunismus warf die marxistische Methode der Gesellschaftsanalyse im Rahmen des Klassenkampfes und der Klassenwidersprüche über Bord; tatsächlich bedeutete der Opportunismus die Ermangelung jeglicher Methode, jeglicher Prinzipien welcher Art auch immer und den Mangel jeglicher Theorie.
Die Linke schlägt zurück
Die Reaktion der Parteiführung auf Bernsteins Text bestand darin, seine Bedeutung herunterzuspielen (der Vorwärts begrüßte ihn als einen „anregenden Beitrag für die Debatte“ und erklärte, dass alle Strömungen in der Partei die Freiheit besitzen sollten, ihre Auffassungen zum Ausdruck zu bringen), während sie hinter vorgehaltener Hand bedauerte, dass solche Gedanken so offen geäußert wurden. Ignaz Bauer, der Parteisekretär, schrieb an Bernstein: „Mein lieber Ede, das, was Du verlangst, so etwas beschließt man nicht, so etwas sagt man nicht, so etwas tut man.“[25]
Innerhalb der SPD widersetzten sich jene am entschlossensten Bernstein, die die lange Periode nach dem Ende der Sozialistengesetze nicht erlebt hatten. Es ist kein Zufall, dass die klarsten und unverblümtesten Opponenten von Bernsteins Strömung Militante ausländischer Herkunft und besonders russischer Herkunft waren. Der in Russland geborene Parvus, der in den 1890er Jahren nach Deutschland gezogen war und 1898 als Herausgeber der SPD-Presse in Dresden, die Sächsische Arbeiterzeitung, arbeitete,[26] ritt eine glühende Attacke gegen Bernsteins Gedanken und wurde dabei von der jungen Revolutionärin Rosa Luxemburg unterstützt, die im Mai 1898 nach Deutschland gezogen war und die die Repression in Polin miterlebt hatte. Sobald sie nach Deutschland übergesiedelt war, begann sie mit ihrem Text Reform oder Revolution, zwischen 1898 und 1899 verfasst (in dem sie Bernsteins Methode enthüllte, die Idee einer Etablierung des Sozialismus durch Sozialreformen zurückwies und Theorie und Praxis des Opportunismus entlarvte), den Kampf gegen die Revisionisten anzuführen. In ihrer Antwort auf Bernstein unterstrich sie, dass der reformistische Trend seit der Aufhebung der Sozialistengesetze und der Möglichkeit, legal zu arbeiten, voll in Schwung gekommen sei. Vollmars Staatssozialismus, die Haushaltsbestätigung in Bayern, der süddeutsche Agrarsozialismus, Heines Kompensationsvorschläge, Schippels Position zu Zöllen – all dies waren Elemente einer um sich greifenden opportunistischen Praxis. Sie unterstrich den gemeinsamen Nenner dieser Strömung: die feindselige Abneigung gegenüber der Theorie.
„Was kennzeichnet sie vor allem äußerlich? Die Feindseligkeit gegen ‚die Theorie‘. Und dies ist ganz selbstverständlich, denn unsere ‚Theorie‘, d.h. die Grundsätze des wissenschaftlichen Sozialismus, setzen der praktischen Tätigkeit ebenso in bezug auf die angestrebten Ziele wie auf die anzuwendenden Kampfmittel wie endlich selbst auf die Kampfesweise sehr feste Schranken. Daher zeigt sich bei denjenigen, die nur den praktischen Erfolgen nachjagen wollen, das natürliche Bestreben, sich die Hände frei zu machen, d.h. unsere Praxis von der ‚Theorie‘ zu retten, von ihr unabhängig zu machen.“[27]
Die erste Aufgabe von Revolutionären war es, das Endziel zu verteidigen. “Die Bewegung als solche ohne Beziehung auf das Endziel, die Bewegung als Selbstzweck ist mir nichts, das Endziel ist uns alles.”[28]
In Stagnation und Fortschritt des Marxismus (1903) untersuchte Luxemburg die theoretische Unzulänglichkeit der Sozialdemokratie folgendermaßen: „Haben doch schon Marx und Engels die Verantwortlichkeit für die Geistesoffenbarungen eines jeden ‚Marxisten‘ abgelehnt, und die peinliche Angst, um beim Denken ja ‚auf dem Boden des Marxismus‘ zu bleiben mag in einzelnen Fällen für die Gedankenarbeit ebenso verhängnisvoll gewesen sein wie das andere Extrem – die peinliche Bemühung, gerade durch die vollkommene Abstreifung der Marxschen Denkweise um jeden Preis die „Selbständigkeit des eigenen Denkens“ zu beweisen.“ (Rosa Luxemburg, Gesammelte Werke, Bd ½, S. 364)
Luxemburg griff Bernstein an, aber forderte auch, dass das zentrale Presseorgan der SPD die Positionen zu vertreten habe, die auf dem Parteitag beschlossen worden waren. Worauf im März 1899 der Vorwärts (in einem Artikel mit dem Titel „Eitle Hoffnungen“) entgegnete, dass Luxemburgs Kritik an Bernsteins Position ungerechtfertigt sei. Luxemburg konterte: „Der Vorwärts (…) ist eben in der glücklichen Lage, nie Gefahr laufen zu müssen, eine falsche Meinung zu haben oder seine Meinung zu wechseln – eine Sünde, der er bei anderen nachspürt – aus einem höchst einfachen Grund: weil er nie eine Meinung hat.”[29]
Sie fuhr in derselben Manier fort: „Es gibt nämlich zweierlei organische Lebewesen: solche, die ein Rückgrat haben und deshalb auch gehen, zuweilen sogar laufen können. Es gibt andere, die keines haben, deshalb nur kriechen und – kleben.“ (ebenda, S. 565) Jenen, die die Partei dazu bringen wollten, jegliche programmatische Position und jegliches politisches Kriterium fallenzulassen, entgegnete sie auf der Parteikonferenz 1899 in Hannover: „ Wenn Sie aber darunter verstehen sollen, dass die Partei im Namen der Freiheit der Kritik kein Recht haben sollte, zu gewissen Meinungen und Kritiken der letzten Zeit Stellung zu nehmen und durch Majoritätsbeschluss zu erklären: wir stehen nicht auf diesem Standpunkte, so muss ich dagegen protestieren, denn wir sind nicht ein Diskutierclub, sondern eine politische Kampfpartei, die bestimmte Grundanschauungen haben muss.“[30]
Der Sumpf schwankt
Zwischen dem entschlossenen linken Flügel um Luxemburg und der Rechten, die Bernsteins Ideen und seinen Revisionismus prinzipiell vertrat, befand sich ein „Sumpf“, den Bebel mit den folgenden Worten auf dem Dresdner Parteitag 1903 schilderte: „Es ist immer und ewig der alte Kampf, hier links, dort rechts, und dazwischen der Sumpf. Das sind die Elemente, die nie wissen, was sie wollen, oder besser gesagt, die nie sagen, was sie wollen. Das sind die ‚Schlaumeier‘, die immer erst horchen: Wie steht’s da, wie steht’s hier? Die immer spüren, wo die Majorität ist, und dorthin gehen sie dann. Diese Sorte haben wir auch in unsrer Partei (…) Der Mann, der wenigstens offen seinen Standpunkt vertritt, bei dem weiß ich, woran ich bin, mit dem kann ich kämpfen, entweder er siegt oder ich, aber die faulen Elemente, die sich immer drücken und jeder klaren Entscheidung aus dem Weg gehen, die immer wieder sagen: Wir sind ja alle einig, sind ja alle Brüder, das sind die allerschlimmsten! Die bekämpfe ich am allermeisten.“[31]
Dieser Sumpf, der unfähig ist, eine klare Position zu beziehen, schwankt zwischen den unverblümten Revisionisten, der Rechten und der revolutionären Linken. Der Zentrismus ist eines der Gesichter des Opportunismus. Indem er sich stets zwischen den antagonistischen Kräften positioniert, zwischen den reaktionären und den revolutionären Strömungen, versucht der Zentrismus beide zu miteinander zu versöhnen. Er vermeidet die offene Auseinandersetzung von Ideen, rennt vor den Debatten weg, behauptet, dass „die eine Seite nicht völlig recht hat, aber die andere auch nicht“, betrachtet politische Debatten mit klaren Argumenten und polemischem Tonfall als „übertrieben“, „extremistisch“, „wichtigtuerisch“, gar „gewaltsam“. Er denkt, dass der einzige Weg, die Einheit aufrechtzuerhalten, die Organisation intakt zu halten, darin besteht, die Koexistenz aller politischen Tendenzen zu erlauben, selbst einschließlich jener, deren Ziele in direktem Gegensatz zu jenen der Organisation stehen. Er schreckt vor der Verantwortung und der eigenen Positionierung zurück. Der Zentrismus in der SPD neigt dazu, sich widerwillig mit der Linken zu verbünden und gleichzeitig den „Extremismus“ und die „Gewalttätigkeit“ der Linken zu bedauern sowie erfolgreich harte Maßnahmen – wie den Ausschluss der Revisionisten aus der Partei – zur Bewahrung des revolutionären Charakters der Partei zu verhindern.
Luxemburg behauptete dagegen, dass der einzige Weg, die Einheit der Partei als eine revolutionäre Organisation zu verteidigen, darin bestünde, auf die uneingeschränkte Offenlegung und öffentliche Diskussion von gegensätzlichen Auffassungen zu bestehen: „Durch die Vertuschung der Gegensätze, durch künstliche “Vereinigung” unvereinbarer Ansichten last man die Gegensätze nur zur vollen Reife gedeihen, bis sie früher oder später in einer Spaltung sich gewaltsam Luft verschaffen. (…) Wer die Spaltung in den Ansichten hervorkehrt und bekämpft, arbeitet für die Einigkeit der Partei. Wer die Spaltung der Ansichten vertuscht, arbeitet auf eine Spaltung der Partei hin.“[32]
Der Inbegriff der zentristischen Strömung und ihr prestigeträchtigster Repräsentant war Karl Kautsky.
Als Bernstein begann, seine revisionistischen Ansichten zu entwickeln, blieb Kautsky zunächst schweigsam und zog es vor, seinem alten Freund nicht öffentlich zu widersprechen. Er versagte auch völlig darin, das Ausmaß zu würdigen, in dem Bernsteins revisionistische Theorien die revolutionären Fundamente untergruben, auf denen die Partei errichtet worden war. Wie Luxemburg betonte, wenn man einmal akzeptiert, dass der Kapitalismus für immer existieren kann, dass er nicht dazu verdammt ist, als Konsequenz aus seinen eigenen inneren Widersprüchen zusammenzubrechen, dann wird man unweigerlich dazu verleitet, dem revolutionären Ziel den Rücken zu kehren.[33] Kautskys Versagen hier – ein Versagen, das er mit dem größten Teil der Parteipresse gemeinsam hat – war ein deutliches Zeichen für den Verfall des Kampfgeistes in der Organisation: Die politische Debatte war nicht mehr eine Überlebensfrage für den Klassenkampf, sie war zu einer akademischen Angelegenheit von intellektuellen Spezialisten geworden.
Rosa Luxemburgs Ankunft in Berlin 1898 (aus Zürich kommend, wo sie gerade ihre Untersuchungen der polnischen Wirtschaftsentwicklung mit Auszeichnung und ihre Antwort auf Bernsteins Theorien abgeschlossen hatte) sollte eine wichtige Rolle für Kautskys Verhalten spielen.
Als Luxemburg Bebels und Kautskys Zögern und Unwillen, Bernsteins Ansichten zu bekämpfen, klar wurde, kritisierte sie dieses Verhalten in einem Brief an Bebel.[34] Sie fragte, warum sie nicht auf eine energische Antwort auf Bernstein gedrängt hatten, und im März 1899, nach dem Beginn einer Artikelserie, die später als Broschüre mit dem Titel Reform oder Revolution bekannt wurde, berichtete sie Jogiches: „Was Bebel betrifft, über den ich herzog (im Gespräch mit Karl Kautsky), dass er nicht auftritt, erklärte mir K. K., dass Bebel die Lust verloren hat, kein Selbstvertrauen und kein Feuer hat. Als ich wieder über hin herzog,: „Warum geben Sie ihm nicht Mut und Ansporn und Energie“? Dann hieß es erneut: „Tun Sie’s (das bin also ich), gehen Sie zu ihm, reden Sie mit ihm.“ Von Luxemburg befragt, warum Kautsky nicht reagiere: „Ach was, jetzt anfangen mit den Versammlungen, wo ich mitten im parlamentarischen Kampf stecke, da wird es ja Krach geben, ja wohin würde das führen, wo hat man Zeit und Kopf dazu etc.?“[35]
1899 sprach sich Kautsky in Bernstein und das sozialdemokratische Programm. Eine Antikritik zumindest gegen Bernsteins Ideen über die marxistische Philosophie und die politische Ökonomie und gegen seine Ansichten über die Entwicklung des Kapitalismus aus. Dennoch begrüßte er Bernsteins Buch als wertvollen Beitrag für die Bewegung, wandte sich gegen einen Antrag, ihn aus der Partei auszuschließen, und vermied es zu sagen, dass Bernstein das marxistische Programm verriet. Kurz, wie Luxemburg schloss, Kautsky wollte jegliche Störung der ziemlich bequemen Routine des Parteilebens und die Notwendigkeit, seinen alten Freund öffentlich zu kritisieren, vermeiden. Wie Kautsky im Vertrauen Bernstein gegenüber zugab: „dass sie [Parvus und Luxemburg] Deinen Gegensatz zu unseren programmatischen Aussagen schon erkannten, wo ich mich mit diesem Gedanken nicht befreunden konnte und mich an den Gedanken eines Missverständnisses anklammert.“ (26.6.1899), „Mein Fehler war, dass ich damals nicht so weit sah wie Parvus und Luxemburg, die damals schon den Gedankengang Deiner Broschüre witterten.“[36] Tatsächlich minimierte und trivialisierte Kautsky im Vorwärts die Attacke gegen Bernsteins neuer revisionistischer Theorie, als er sagte, dass der „Umfall Bernsteins als eine „lächerliche“ Einbildung von freisinnigen Biedermännern erklärt wurde.“[37]
Freunde oder Klasse?
In seiner Loyalität zu seinem alten Freund meinte Kautsky, er hätte sich bei Bernstein privat zu entschuldigen, als er schrieb: „Es wäre Feigheit gewesen zu schweigen. Ich glaube nicht, dass es zu Deinem Nachteil war, dass ich sprach. Hätte ich nicht August (Bebel) gesagt, ich würde auf Deine Erklärung antworten, hätte er es selbst getan. Wie seine Antwort ausgefallen wäre, kannst Du Dir bei seinem Temperament und seiner Rücksichtslosigkeit vorstellen.“[38] Dies bedeutete, er zog es vor, stumm und blind gegenüber seinem alten Freund zu sein. Er reagierte unwillig und erst, nachdem er von der Linken gezwungen wurde. Später gestand er ein, dass es eine „Sünde“ gewesen sei, seiner Freundschaft mit Bernstein zu erlauben, seine politische Urteilskraft zu dominieren. „Ich habe in meinem Leben nur einmal aus Kameradschaft gesündigt, und diese Sünde bereue ich heute noch aufs tiefste. Hätte ich Bernstein gegenüber nicht so lange gezögert und wäre ich ihm von vornherein mit der nötigen Schärfe entgegengetreten, ich hätte der Partei manches Unangenehmes erspart.“[39] Jedoch ist ein solches Bekenntnis wertlos, es sei denn, es geht bis an die Wurzeln des Problems. Trotz seines „Sündenbekenntnisses“ gab Kautsky nie eine profunde politische Erklärung ab, warum solch ein Verhalten, das sich auf persönliche Affinitäten statt auf politische Prinzipien stützt, eine Gefahr für eine politische Organisation ist. In Wirklichkeit führte ihn sein Verhalten dazu, den Revisionisten eine unbegrenzte „Meinungsfreiheit“ in der Partei zuzugestehen. Wie Kautsky am Vorabend des Parteitags in Hannover sagte: „Man muss es in der Regel jedem Parteimitglied selbst überlassen, zu entscheiden, ob er noch auf dem Boden der Partei steht oder nicht. Mit dem Ausschluss geht man bloß gegen Elemente vor, welche die Partei schädigen, wegen rein sachliche Kritik ist noch nie jemand aus der Sozialdemokratie ausgeschlossen worden, die stets auf die Freiheit der Diskussion den höchsten Wert gelegt hat. Selbst wenn Bernstein nicht so große Verdienste um unsere Sache sich erworben hätte und wenn er nicht wegen seiner Parteitätigkeit im Exil säße, würde seine Ausschließung nicht in Betracht kommen.“[40]
Luxemburgs Antwort war eindeutig. “Sosehr wir die Freiheit der Selbstkritik brauchen und ihr die weitesten Schranken lassen, so muss es doch ein gewisses Mindestmaß von Grundsätzen geben, die unser Wesen, unsere Existenz selbst ausmachen und die den Boden unseres Zusammenwirkens als Mitglieder einer Partei bilden. Auf diese wenigen allgemeinsten Grundsätze können wir nicht innerhalb unserer Reihen das Prinzip der „Freiheit der Kritik“ anwenden, denn sie sind ja die Voraussetzung aller Tätigkeit, also auch der Kritik über diese Tätigkeit in unseren Reihen. Wir brauchen unsere Ohren vor einer von außen kommenden Kritik auch in bezug auf diese Grundsätze nicht zu verschließen. Wir müssen aber, solange wir sie als den Boden unserer Existenz als Partei betrachten, an diesen Grundsätzen festhalten und sie auch nicht von unseren Mitgliedern erschüttern lassen. Hier können wir nur eine Freiheit gewähren: die Freiheit der Zugehörigkeit oder der Nichtzugehörigkeit zu unserer Partei. Wir zwingen niemanden, mit uns in Reih und Glied zu marschieren, tut es aber jemand freiwillig, so müssen wir bei ihm die Zustimmung zu unseren Prinzipien voraussetzen.“ [41]
Die logische Schlussfolgerung aus Kautskys „mangelndem Standpunkt“ war, dass jeder in der Partei sein und vertreten konnte, was er wollte, dass das Programm verwässert wird, dass die Partei zu einem „Schmelztiegel“ verschiedener Auffassungen wird, nicht zu einer Speerspitze für einen entschlossenen Kampf. Kautskys Haltung zeigte, dass er die Loyalität zu einem Freund der Verteidigung von Klassenpositionen vorzieht. Gleichzeitig wollte er die Pose eines theoretischen „Experten“ einnehmen. Es trifft zu, dass er einige sehr wichtige und wertvolle Büchergeschrieben hat (siehe unten) und dass er die Wertschätzung von Engels genoss. Doch wie Luxemburg in einem Brief an Jogiches bemerkte: „Karl Kautsky beschränkt sich auf die Theorie (..)“[42]Indem er es vorzog, jegliche Beteiligung am Kampf zur Verteidigung der Organisation und ihres Programms zu unterlassen, verlor Kautsky allmählich jegliche kämpferische Haltung, und dies hieß, dass er das, was er als seine Verpflichtungen gegenüber seinen Freunden ansah, über jegliche moralischen Verpflichtungen gegenüber seiner Organisation und ihren Prinzipien stellte. Dies führte zu einer Abtrennung der Theorie von der praktischen, konkreten Tat: Zum Beispiel war Kautskys wertvolles Buch über die Ethik, einschließlich insbesondere eines Kapitels über den Internationalismus, nicht eingebunden in einer unerschütterlichen Verteidigung des Internationalismus.
Es gibt einen auffälligen Gegensatz zwischen Kautskys Verhalten gegenüber Bernstein und Rosa Luxemburgs Verhalten gegenüber Kautsky. Nach ihrer Ankunft in Berlin unterhielt sie enge Beziehungen zu Kautsky und seiner Familie. Doch schnell spürte sie, dass die große Aufmerksamkeit, die die Familie Kautsky ihr gegenüber zeigte, zu einer Bürde wurde. Schon 1899 hatte sie sich bei Jogiches darüber beklagt: „Ich fange an vor den Schmeicheleien (der Kautskys) zu fliehen“ , denn „Kautskys betrachten mich als zur Familie gehörig“, (12.11.1899): „All diese Liebesbeweise (er ist mir gegenüber wirklich ehrlich wohlwollend, ich sehe das jedesmal) bedrücken mich wie eine Last, statt mich zu freuen. Tatsächlich, jede im Erwachsenenalter eingegangene Freundschaft, und dazu noch so eine halb ‚parteiliche‘ ist eine Last: sie erlegt Pflichten auf, behindert etc. Und gerade diese Seite der Freundschaft behindert mich. Nach jedem Artikel muss ich denken: Nun jetzt wird er enttäuscht sein, und die ‚Freundschaft‘ wird abkühlen.“[43] Sie war sich über die Gefahren eines auf Affinitäten gestützten Verhaltens im Klaren, wo die Rücksichtnahme auf persönliche Verpflichtungen, auf Freundschaften oder gemeinsame Geschmäcker die politische Urteilskraft des Militanten, aber auch das überschattet, was wir seine moralische Urteilskraft hinsichtlich der Frage, ob eine Aktion in Übereinstimmung mit den Organisationsprinzipien steht, nennen könnten. (44)[44] Luxemburg wagte es dennoch, ihn offen zu konfrontieren: „Mit Kautsky hatte ich vorher ein großes grundsätzliches Streitgespräch über unsere ganze Art, die Dinge zu sehen, wobei er mir als Fazit sagte, dass ich in zwanzig Jahren ebenso denken werde wie er, worauf ich entgegnete, dass ich in diesem Falle in zwanzig Jahren eine Schlafmütze sein werde.“ [45]
Auf dem Lübecker Parteitag 1901 wurde Luxemburg beschuldigt, die Positionen anderer Genossen zu verzerren, eine Beschuldigung, die sie als skandalös betrachtete; sie forderte, dass sie öffentlich geklärt wird. Dies im Auge, reichte sie eine Stellungnahme zur Veröffentlichung beim Vorwärts ein.[46] Doch im Namen der Neue(n) Zeit veranlasste Kautsky sie, ihre Forderung nach Veröffentlichung ihrer Stellungnahme zurückzuziehen. Sie antwortete Kautsky: Sie haben erreicht, was Sie wollten, ich entbinde Sie in diesem Falle Ihrer Verpflichtung mir gegenüber. Aber Sie begehen allem Anschein nach dabei noch den Irrtum, dass Sie in allem Ernst glauben, in diesem Falle nur aus Freundschaft und meinem Interesse so gehandelt zu haben. Gestatten Sie mir, Ihnen diese Selbsttäuschung zu zerstören. Als Freund hätten Sie mir ungefähr folgendes sagend müssen: ‚Ich rate Ihnen, unbedingt und um jeden Preis zum Schutze Ihrer schriftstellerischen Ehre aufzutreten, denn größere Schriftsteller und Männer von durch Jahrzehnte begründetem Ruf, wie Marx und Engels, schreiben ganze Broschüren, führten einigen ganzen Federkrieg, wenn ihnen irgend jemand die kleinste ‚Fälschung‘ vorzuwerfen wagte. Um so mehr müssen Sie in solchem Falle peinlich ins Gericht gehen, weil Sie eine junge und sehr angefeindete Schriftstellerin sind‘. So hätten Sie sich als Freund sagen müssen. (…)Der Freund ließ sich aber ganz vom Redakteur der „Neuen Zeit“ beherrschen, und dieser will seit dem Parteitag überhaupt nur eins: Er will seine Ruhe haben, er will zeigen, dass die „Neue Zeit“ nach den erhaltenen Prügeln artig geworden ist und Mault hält.“[47] „Und deshalb mag auch ein gutes Recht des Mitarbeiters der „Neuen Zeit“ auf die Wahrung seiner wichtigsten Interessen, sein Recht auf die Verteidigung gegen öffentliche Verleumdungen, geopfert werden. Mag auch jemand, der für die ‚Neue Zeit‘ – nicht am wenigsten und nicht am schlechtesten – arbeitet, die öffentliche Anschuldigung der Fälschung verschlucken, damit nur in allen Wipfeln Ruh‘ herrscht.
So liegt die Sache, mein Freund! Und nun mit herzlichem Gruß Ihre Rosa.“[48]
Hier sehen wir eine junge, entschlossene Revolutionärin und dazu eine Frau, die darauf bestand, dass die „alte“, „orthodoxe“, erfahrene Autorität persönliche Verantwortung übernehmen soll. Kautsky antwortete auf Luxemburg: „Sehen Sie, man muss die Leute in der Fraktion nicht reizen, man muss nicht den Schein erwecken, als belehre man sie; wenn man ihnen was vorzuschlagen hat, so schreibe man ihnen einen Privatbrief, das wird viel mehr wirken“[49] Doch Rosa Luxemburg versuchte den Kampfgeist in ihm „wiederzubeleben“. „(…) Aber du musst es mit Lust und Freude tun, nicht wie ein lästiges Intermezzo, denn das Publikum fühlt die Stimmung der Kämpfenden immer heraus, und die Freude am Fecht gibt der Polemik einen hellen Klang und eine moralische Überlegenheit“.[50] Diese Haltung, den normalen Betrieb des Parteilebens nicht stören zu wollen, keine Stellung in der Debatte zu beziehen, nicht auf der Klärung von Divergenzen zu drängen, vor der Debatte wegzulaufen und die Revisionisten zu tolerieren, befremdete Luxemburg immer mehr, und es wurde immer offenkundiger, wie sehr der Verlust des Kampfgeistes, der Verlust der Moral, der Verlust der Überzeugung, der Entschlossenheit zum vorrangigen Charakterzug in Kautskys Verhalten geworden war. „Ich habe jetzt seinen [Artikel] ‚Nationalismus und Internationalismus‘ lesen müssen, und es war mir eine Qual, ein Ekel. Ich werde bald nichts von Karl Kautsky mehr lesen können. Mir ist, als lege sich ein ekliges Spinngewebe um mein Hirn.[51] „Kautsky wird mir immer ungenießbarer. Er verschrumpft und vertrocknet innerlich immer mehr, nichts und niemand außer seiner Familie geht ihn menschlich an. Ich fühle mich unbehaglich mit ihnen.“[52]
Dem Verhalten Kautskys diametral entgegengesetzt war die Haltung Luxemburgs und Jogiches‘. Nach ihrer Trennung von Leo Jogiches 1906 (die ihr immense Schmerzen bereitete, wie auch die große Enttäuschung über ihn als Partner) blieben die beiden engste Genossen bis zum Tag ihrer Ermordung. Trotz tiefen persönlichen Grolls, Enttäuschung und Eifersüchteleien – diese tiefen Gefühle wegen ihrer Trennung hinderten sie nie daran, Seite an Seite im politischen Kampf zu stehen.
Man mag einwenden, dass im Falle Kautskys dies den Mangel an Persönlichkeit und Charakter Kautskys widerspiegelte, doch es wäre zutreffender zu sagen, dass er die moralische Verwesung in der Sozialdemokratie in ihrer Gesamtheit versinnbildlichte.
Luxemburg stieß schon früh auf den Widerstand der „alten Garde“. Als sie die revisionistische Politik auf dem Stuttgarter Parteitag 1898 kritisierte, „Vollmar hat es mir zum bitteren Vorwurf gemacht, dass ich als junger Rekrut in der Bewegung die alten Veteranen belehren will (…) Wenn aber Vollmar gegen meine sachlichen Ausführungen ins Feld führt: Du Gelbschnabel, ich könnte ja dein Großvater sein, so ist das für mich ein Beweis, dass er mit seinen logischen Gründen auf dem letzten Loch pfeift“.[53] Was den schwächelnden Kampfgeist der eher zentristischen Veteranen anging, erklärte sie in einem Artikel, den sie nach dem Parteitag 1898 schrieb. “Wir hätten nämlich viel lieber gesehen, dass die Veteranen der Partei gleich am Anfang der Debatte ins Gefecht getreten wären. (…) Wenn die Debatte trotzdem eingeleitet wurde, so geschah es eben nicht dank, sondern trotz dem Verhalten der Parteiführer. (…) Die Debatte zunächst ihrem eigenen Schicksal überlassen, ruhig zwei Tage zusehen, „wie der Hase läuft“, und dann erst eingreifen, als die Wortführer des Opportunismus zur klaren Sprache gezwungen worden waren, dabei noch über die ‚zu scharfe Tonart‘ derjenigen sich abfällig ausdrücken, deren Standpunkt man dann vollkommen aufrechterhält, das ist eine Taktik, die den Parteiführern in einer so wichtigen Frage schlecht steht. Auch die Erklärung Kautskys, wonach er bis jetzt seiner Meinung über die Bernsteinsche Theorie keinen Ausdruck gab, weil er sich vorbehalten hatte, das Schlusswort in der eventuellen Debatte zu sagen, scheint uns wenig entschuldigend zu sein. Im Februar druckt er die Artikel von Bernstein ohne die geringste redaktionelle Note in der ‚Neuen Zeit‘ ab, schweigt dann 4 Monate; im Juni eröffnet er die Diskussion mit einigen Komplimenten an die ‚neuen‘ Standpunkte Bernsteins, diesen neuen Abklatsch des alten Kathedersozialismus, schweigt dann wieder 4 Monate, lässt den Parteitag heranrücken und erklärt endlich im Laufe der Debatte, dass er das ‚Schlusswort‘ sagen wollte. Wir wünschten, dass unser Theoretiker ex officio immer das Wort und nicht das Schlusswort in wichtigen Dingen sagt und dass er nicht den falschen und verwirrenden Eindruck erweckt, als hätte er längere Zeit selbst nicht gewusst, was er sagen sollte.“[54]
So wurden viele aus der alten Garde, die unter den Bedingungen der Sozialistengesetze gekämpft hatten, vom Gewicht des Demokratismus und Reformismus entwaffnet. Sie waren unfähig geworden, die neue Zeit zu verstehen, und begannen stattdessen den Verzicht auf das sozialistische Ziel zu theoretisieren. Statt die Lehren aus dem Kampf unter den Bedingungen der Sozialistengesetze an die neue Generation weiterzureichen, hatten sie ihren Kampfgeist verloren. Und die zentristische Strömung, die sich versteckte und die Auseinandersetzung vermied, indem sie vor einer offenen Feldschlacht gegen die Opportunisten wegrannte, ebnete den Weg für den Aufstieg der Rechten.
Während die Zentristen den Kampf vermieden, zeigte der linke Flügel um Luxemburg seinen Kampfgeist und war bereit, Verantwortung zu übernehmen. Sie erkannte, dass in Wirklichkeit: „Dass Bebel selbst schon senil geworden ist und die Zügel aus der Hand gleiten lässt, er ist froh, wenn andere kämpfen, aber er hat selbst weder die Energie noch das Feuer für eine Initiative. K.K. (Karl Kautsky) beschränkt sich auf die Theorie (…) Niemand leitet, niemand fühlt sich verantwortlich“[55]. Der linke Flügel bemühte sich um mehr Einfluss und war von der Notwendigkeit überzeugt, als Speerspitze zu handeln. Luxemburg schrieb an Jogiches: „Nur noch ein Jahr ausdauernder positiver Arbeit, und meine Stellung ist glänzend. Einstweilen kann ich die Schärfe meines Auftretens nicht dämpfen, denn es gilt, den extremsten Standpunkt zu vertreten.“[56] Dieser Einfluss wurde jedoch nicht erlangt, und der Preis war eine Verwässerung von Positionen.
Überzeugt von der Notwendigkeit einer entschlossenen Führung und in Erkenntnis, dass sie auf den Widerstand der Zögerlichen stoßen würde, wollte sie die Partei antreiben.
“Ein Mensch, der nicht zur Sippschaft gehört, der niemandes Protektion hat, sondern nur die eigenen Ellbogen, ein Mensch, den für die Zukunft nicht nur die Gegner fürchten (Auer & Co.), sondern im Grunde ihres Herzens auch die Bundesgenossen – Bebel, Karl Kautsky, Singer etc., ein Mensch, von dem sie spüren, dass es besser ist, ihn so weit wie möglich wegzuschieben, da er ihnen schnell über den Kopf wachsen könnte. Dabei habe ich gar nicht die Absicht, mich auf die Kritik zu beschränken, im Gegenteil, ich habe die Absicht und Lust positiv zu schieben, nicht Personen, sondern die Bewegung in ihrer Gesamtheit, unsere ganze positive Arbeit zu revidieren, die Agitation, die Praxis, neue Wege aufzuzeigen (sofern sich welche finden lassen, woran ich nicht zweifle) den Schlendrian zu bekämpfen, etc. mit einem Wort, ein ständige Antrieb der Bewegung zu sein (…) Und dann die mündliche und schriftliche Agitation überhaupt, die in alten Formen versteinert ist und fast auf niemanden mehr wirkt, auf eine neue Bahn zu bringen, überhaupt neues Leben in die Presse, die Versammlungen und die Broschüren hineinzubringen. (…) „stets sich selbst zu sein, ganz ohne Ansehen der Umgebung und der anderen…“[57] Im Oktober 1905 bot sich Luxemburg die Gelegenheit, sich an der Redaktionsleitung des Vorwärts zu beteiligen. Sie war kompromisslos in der Frage einer möglichen Zensur ihrer Positionen. „…sollte es wegen meiner Artikel mit der Redaktion oder mit dem Vorstand zu einem Krach kommen, dass man nicht allein, sondern unsere ganze Linke solidarisch aus dem ‚Vorwärts‘ austritt, und dann ist die Redaktion gesprengt.” (Rosa Luxemburg, Gesammelte Briefe, Bd. 2, S. 183, Brief an Leo Jogiches, 6.10.1905). Für eine kurze Weile hatte die Linke einigen Einfluss erlangt.
Der Niedergang des proletarischen Lebens in der SPD
Der Degenerationsprozess der Partei zeichnete sich nicht allein durch die offenen Versuche, auf ihre programmatischen Positionen zu verzichten, und durch den Mangel an Kampfgeist in breiten Bereichen der Partei aus. Unterhalb der Oberfläche befand sich eine ständige Unter-Strömung der kleingeistigen und persönlichen Verunglimpfungen, die sich gegen jene richteten, die die Prinzipien der Organisation am kompromisslosesten vertraten und die Fassade der Einheit störten. Kautskys Verhalten gegenüber der Kritik Luxemburgs an Bernstein war zum Beispiel ambivalent. Trotz seiner freundlichen Beziehungen zu Luxemburg konnte er dennoch Bernstein unverhohlen schreiben: „Der Luxemburg, dem widerlichen Ding, passt der Waffenstillstand bis zum Erscheinen deiner Broschüre nicht, sie bringt jeden Tag einen Nadelstrich ‚zur Taktik‘.“[58] Bisweilen sollte, wie wir sehen werden, diese Unter-Strömung mit verleumderischen Anschuldigungen und persönlichen Angriffen durch die Oberfläche brechen.
Es war vor allem die Rechte, die mit Personalisierungen und der Suche nach Sündenböcken innerhalb der Partei reagierte. Als es einer Klärung der tiefen Divergenzen durch eine offene Konfrontation bedurfte, wich die Rechte zurück und begann stattdessen die prominentesten Mitglieder der Linken zu verleumden.
Ein klares Minderwertigkeitsgefühl auf der theoretischen Ebene an den Tag legend, verbreiteten sie verleumderische Anspielungen besonders über Luxemburg, indem sie sexistische Kommentare und Andeutungen über ihr „unglückliches“ Gefühlsleben und ihre sozialen Beziehungen machten (ihre Beziehung zu Leo Jogiches war der Partei nicht bekannt): „Diese gescheite Giftnudel wird auch nach Hannover kommen. Ich habe Respekt vor ihr und schätze sie viel höher als wie Parvus. Sie aber hasst mich aus tiefstem Herzensgrund.“[59]
Der rechte Parteisekretär Ignaz Auer räumte gegenüber Bernstein ein: „Sind wir auch theoretisch den Gegnern nicht gewachsen, nicht jeder hat das Zeug zum Kirchenvater, so stehen wir gegenüber der Phrase und dem ungezogenen TamTam unseren Mann. Wenn es aber zur ‚reinlichen‘ Scheidung kommen sollte – woran übrigens kein Mensch im Ernste denkt – dann stünden Clara und Rosa allein. Nicht einmal ihre (Liebhaber?) gingen mit ihnen, weder ihre früheren noch die jetzigen.“[60]
Derselbe Auer zögerte nicht, fremdenfeindliche Töne von sich zu geben, als er sagte, dass „diejenigen, welche die Hauptangriffe gegen Bernstein und dessen Anhänger und gegen Schippel geschleudert „nicht deutsche Genossen, nicht aus der deutschen Bewegung hervorgegangen seien. Das Vorgehen einzelner derselben, namentlich der Frau Rosa Luxemburg sei illoyal, sei ‚unter Kameraden‘ nicht schön“[61]Diese Art von fremdenfeindlichen Tönen – besonders gegen Luxemburg, die jüdischer Herkunft war – wurde ein permanentes Muster in der Kampagne der Rechten, die in den Jahren vor dem I. Weltkrieg zunehmend bösartig wurde.[62]
Der rechte Flügel der Partei verfasste sogar satirische Kommentare oder Texte über Luxemburg.[63] Luxemburg und andere Figuren auf der Linken waren bereits in Polen auf besonders niederträchtige Weise zur Zielscheibe geworden. Paul Frölich berichtet in seiner Luxemburg-Biographie, dass viele Verleumdungen sich gegen Leute wie Warski und Luxemburg richteten. Luxemburg wurde beschuldigt, vom Warschauer Polizeioffizier Markgrafski bezahlt worden zu sein, als sie einen Artikel über die Frage der nationalen Autonomie veröffentlichte; sie wurde ebenfalls beschuldigt, eine bezahlte Agentin der Ochrana, der russischen Geheimpolizei, zu sein.[64]
Rosa Luxemburg begann der Atmosphäre in der Partei überdrüssig zu werden. „Jede Annäherung an die Parteibande hinterlässt in mir ein derartiges Unbehagen, dass ich mir jedesmal danach vornehme: drei Seemeilen weit vom tiefsten Stand der Ebbe! (...) Nach dem Zusammensein mit ihnen wittere ich soviel Schmutz, sehe soviel Charakterschwäche, Erbärmlichkeit etc., dass ich zurückeile in mein Mauseloch.“[65]
Dies war im Jahr 1899, doch auch zehn Jahre später hatte sich ihre Meinung über das Verhalten einiger der führenden Parteifiguren nicht verbessert. „Trotz alledem aber bleibe möglichst ruhig und vergiss nicht, dass es außer Parteivorstand und Kanaillen von der Art der Zietz und Co. Im Leben noch viel Schönes und Reines gibt. Mir ist er außer der unmittelbaren Unmenschlichkeit noch ein schmerzliches Symptom der allgemeinen Misere, in die unsere ‚Führerschaft‘ hinabgesunken ist, ein Symptom erschreckenden geistigen Tiefstands. (…) Andere Zeiten werden diesen stinkenden Tang hoffentlich mit einer schäumenden Welle hinwegfegen.“[66] Und sie drückte des Öfteren ihre Empörung über die erstickende bürokratische Atmosphäre in der Partei aus: „Ach, mir ist manchmal hier schrecklich zumute, und ich möchte am liebsten fort aus Deutschland. In irgendeinem sibirischen Dorf spürt man mehr Menschentum als in der deutschen Sozialdemokratie.“[67] Diese Haltung, nach Sündenböcken zu suchen und die Reputation der Linken zu zerstören, legte die Saat für ihre spätere Ermordung durch die Freikorps, die Luxemburg im Januar 1919 auf Befehl der SPD töteten. Der Tonfall, der gegen sie in der Partei herrschte, bereitete die Pogromatmosphäre gegen Revolutionäre in der revolutionären Welle von 1918–23 vor. Der Rufmord, der allmählich in die Partei sickerte, und der Mangel an Empörung darüber, insbesondere im Zentrum, trug zur moralischen Entwaffnung der Partei bei.
Die Opposition: Zensiert und zum Schweigen gebracht
Zusätzlich zur Sündenbock-Suche, Personalisierung und zu den fremdenfeindlichen Attacken begannen die verschiedenen Instanzen der Partei unter dem Einfluss der Rechten die Artikel der Linken und insbesondere von Luxemburg zu zensieren. Vor allem nach 1905, als die Frage der Massenaktion auf der Tagesordnung stand (s.u.), versuchte die Partei zunehmend, sie mundtot zu machen und die Veröffentlichung ihrer Artikel über die Frage der Massenstreiks und über die russischen Erfahrungen zu verhindern. Zwar waren einige Städte Hochburgen der Linken,[68] jedoch versuchte der gesamte rechte Flügel des Parteiapparates, sie daran zu hindern, ihre Positionen im Zentralorgan der Partei, dem Vorwärts, zu verbreiten: „Leider kann ich Ihre beiden Artikel nicht aufnehmen, da nach einer Vereinbarung zwischen Parteivorstand, geschäftsführendem Ausschuss der preußischen Landeskommission und Redaktion zunächst die Frage des Massenstreiks nicht im ‚Vorwärts‘ erörtert werden soll.“[69]
Wie wir sehen werden, sollten die Konsequenzen des moralischen Niedergangs und des Niedergangs der Solidarität verderbliche Auswirkungen haben, als die imperialistischen Spannungen sich verschärften und die Linke auf der Notwendigkeit bestand, mit Massenaktionen zu antworten.
Franz Mehring, eine wohl bekannte und respektierte Figur der Linken, wurden ebenfalls des Öfteren angegriffen. Doch anders als Rosa Luxemburg war er leicht zu kränken und neigte dazu, sich vom Kampf zurückzuziehen, als er sich ungerechtfertigt angegriffen fühlte. Zum Beispiel kritisierte Mehring vor dem Parteitag in Dresden 1903 die Publizierung von sozialdemokratischen Schriften in der bürgerlichen Presse als unvereinbar mit der Parteimitgliedschaft. Die Opportunisten eröffneten eine Verleumdungskampagne gegen ihn. Mehring bat um ein Parteigericht, das zusammenkam und ein „mildes Urteil“ gegen die Opportunisten verhängte. Doch als er unter den wachsenden Druck der Rechten geriet, neigte Mehring immer mehr dazu, sich aus der Parteipresse zurückzuziehen. Luxemburg pochte darauf, dass er dem Druck der Rechten und ihren Verleumdern Paroli bieten soll: „Jeder anständige Mensch in der Partei, der nicht geistiger Knecht des Parteivorstands ist, wird auf Ihrer Seite stehen. (…) Sie werden sich auch das Gefühl haben, dass wir immer mehr Zeiten entgegengehen, wo die Masse der Partei einer energischen, rücksichtslosen und großzügigen Führung bedarf, und dass unsere führenden Instanzen: Parteivorstand, Zentralorgan, Fraktion – und das ‚wissenschaftliche Organ‘ ohne Sie genau in demselben Verhältnis immer kleinlicher, feiger und parlamentarisch-kretinhafter werden. Wir müssen also offen dieser schönen Zukunft ins Auge blicken, alle Posten besetzen und festhalten, die es ermöglichen, der offiziellen ‚Führerschaft‘ zum Trotz das Recht auf Kritik wahrzunehmen (…) Auf ständige Kämpfe und Reibungen müssen wir ja gefasst sein, namentlichen, wenn man das Allerheiligste: den parlamentarischen Kretinismus so derb schüttelt, wie Sie das getan haben. Aber trotz alledem – keinen Fußbreit nachgeben scheint mir die beste Parole. Die ‚Neue Zeit‘ darf nicht der Senilität und dem Offiziösentum ganz ausgeliefert werden.“[70]
Der Wendepunkt von 1905
Mit Beginn des neuen Jahrhunderts begann das Fundament, auf dem Revisionisten und Reformisten gleichermaßen ihre Theorie und Praxis errichtet hatten, zu zerbröckeln.
Oberflächlich und trotz gelegentlicher Rückschläge schien sich die kapitalistische Wirtschaft in robuster Gesundheit zu befinden und setzte ihre unaufhaltsame Expansion in den letzten Regionen fort, die noch nicht von den imperialistischen Mächten okkupiert worden waren, besonders in Afrika und China. Die Expansion des Kapitalismus über den Globus hatte eine Stufe erreicht, wo die imperialistischen Mächte ihren Einfluss nur noch auf Kosten ihrer Rivalen ausdehnen konnten. Alle Großmächte wurden zunehmend in ei n beispielloses Wettrüsten verwickelt, wobei sich insbesondere Deutschland in einem massiven Programm zur Expansion der Flotte engagierte. Auch wenn es damals nur von Wenigen realisiert worden war, markierte das Jahr 1905 einen Wendepunkt: Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Großmächten führte zu einem Großkrieg, und der Krieg führte seinerseits zur ersten massiven revolutionären Welle der Arbeiterklasse.
Bei dem Krieg zwischen Russland und Japan, der 1904 begonnen hatte, ging es um die Kontrolle über koreanische Halbinsel. Russland erlitt eine schmachvolle Niederlage, und die Streiks im Januar 1905 waren eine direkte Reaktion gegen die Auswirkungen des Krieges. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde ein ganzes Land von einer gigantischen Welle von Massenstreiks geschüttelt. Das Phänomen beschränkte sich nicht allein auf Russland. Wenngleich nicht so massiv und vor einem anderen Hintergrund und anderen Forderungen, brachen ähnliche Streikbewegungen in einer Reihe anderer europäischer Länder aus: 1902 in Belgien, 1903 in den Niederlanden, 1905 im Ruhrgebiet in Deutschland. Auch in den Vereinigten Staaten fand zwischen 1900 und 1906 (besonders in den Kohlebergwerken Pennsylvanias) eine Anzahl von massiven, wilden Streiks statt. In Deutschland hatte Rosa Luxemburg sowohl als revolutionäre Agitatorin als auch als Journalistin für die deutsche Partei und Mitglied des Zentralkomitees der SDKPiL[71] die Kämpfe in Russland und Polen aufmerksam verfolgt.[72] Im Dezember 1905 meinte sie, dass sie nicht mehr als bloße Beobachterin in Deutschland bleiben könne, und brach nach Polen auf, um sich direkt an der Bewegung zu beteiligen. Eng in den laufenden Prozess des Klassenkampfes und der revolutionären Agitation eingebunden, erlebte sie die sich neu entfaltende Dynamik der Massenstrikes aus erster Hand.[73] Zusammen mit anderen revolutionären Kräften begann sie die Lehren daraus zu ziehen. Zur gleichen Zeit, als Trotzki sein berühmtes Buch über 1905 schrieb, in dem er die Rolle der Arbeiterräte hervorhob, betonte Luxemburg in ihrem Text Massenstreik, Partei und Gewerkschaften[74] die historische Bedeutung der „Geburt des Massenstreiks“ und ihre Konsequenzen für die internationale Arbeiterklasse. Ihr Text über den Massenstreik war ein erster programmatischer Text der linken Strömungen in der 2. Internationalen, der beabsichtigte, die breiteren Lehren zu ziehen und die Bedeutung autonomer Massenaktionen der Arbeiterklasse zu betonen.[75]
Luxemburgs Theorie des Massenstreiks richtete sich komplett gegen die Vision des Klassenkampfes, so wie sie allgemein in Partei und Gewerkschaften akzeptiert war. Für Letztere war der Klassenkampf fast wie ein Kriegszug, in dem die Konfrontation nur gesucht wurde, sobald die Armee eine überwältigende Stärke aufgebaut hat, während die Partei- und Gewerkschaftsführung als ein Generalstab agieren sollte, auf dessen Befehl die Arbeitermassen manövrieren. Dies war weit weg von Luxemburgs Insistieren auf die kreative Selbstaktivität der Massen; jegliche Vorstellung, dass die ArbeiterInnen unabhängig von der Führung handeln könnten, war ein Gräuel für die Gewerkschaftsbosse, die 1905 sich zum ersten Mal mit der Aussicht konfrontiert sahen, von genau solch einer massiven Welle von autonomen Kämpfen überrannt zu werden. Die Reaktion des rechten Flügels der SPD und der Gewerkschaftsführung war einfach, jegliche Diskussion über dieses Thema zu unterbinden. Auf dem Gewerkschaftskongress in Köln im Mai 1905 lehnten sie jegliche Diskussion über den Massenstreik als „verwerflich“[76] ab und fuhren fort: „Der Kölner Gewerkschaftskongress hatte ja im Jahre 1905 die „Propagierung des Massenstreiks“ in Deutschland untersagt.“. Dies kündigte die Kooperation zwischen der herrschenden Klasse auf der einen und der SPD sowie der Gewerkschaften auf der anderen Seite im Kampf gegen die Revolution an.
Die deutsche Bourgeoisie hatte ebenfalls die Bewegung aufmerksam verfolgt und wollte vor allem die deutschen ArbeiterInnen daran hindern, „das russische Beispiel zu kopieren“. Wegen ihrer Rede über den Massenstreik auf dem SPD-Parteitag in Jena 1905 wurde Rosa Luxemburg der „Aufreizung zur Gewalttätigkeit“ beschuldigt und zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt. In der Zwischenzeit versuchte Kautsky die Bedeutung der Massenstreiks herunterzuspielen, indem er darauf bestand, dass sie vor allen Dingen ein Produkt primitiver Bedingungen in Russland seien, die nicht auf ein fortentwickeltes Land wie Deutschland angewandt werden könnten. Er „gebraucht die Bezeichnung russische Methode“ als Inbegriff der Unorganisiertheit, der Primitivität, des Chaotischen und Wildem im Vorgehen.“[77] In seinem Buch Der Weg zur Macht behauptete Kautsky, dass „Massenaktionen eine überholte Strategie des Umsturzes“ seien und setzte ihr seine „Ermattungsstrategie“ entgegen.[78]
Die Massenpartei gegen den Massenstreik
Kautsky weigerte sich, den Massenstreik als eine Perspektive für die Arbeiterklasse überall auf der Welt anzuerkennen und griff Luxemburgs Position dergestalt an, als sei sie bloß eine persönliche Laune. Kautsky schrieb an Luxemburg: „Ich habe nicht die Zeit, Dir die Gründe, die Marx und Engels, Bebel und Liebknecht als stichhaltig anerkannten, auseinanderzusetzen. Genug, was du willst, ist eine völlig neue Agitation, die bisher stets abgelehnt worden war. Diese neue Agitation ist aber der Art, dass es nicht gut angeht, sie öffentlich zu diskutieren. Du würdest mit Deinem Artikel auf eigene Faust, als einzelne Person, eine völlig neue Agitation und Aktion proklamieren, die die Partei stets verworfen hat. In dieser Weise können und dürfen wir nicht vorgehen. Eine einzelne Persönlichkeit, wie hoch sie stehen mag, darf nicht auf eigene Faust ein Fait accompli schaffen, das für die Partei unabsehbare Folgen haben kann.“[79]
Luxemburg lehnte den Versuch ab, die Analyse und Bedeutung des Massenstreiks als eine „persönliche Politik“ darzustellen.[80]
Selbst wenn Revolutionäre die Existenz unterschiedlicher Bedingungen in verschiedenen Ländern zur Kenntnis nehmen müssen, müssen sie vor allem die globale Dynamik wechselnder Bedingungen des Klassenkampfes begreifen, insbesondere jene Tendenzen, die Vorboten der Zukunft sind. Kautsky widersetzte sich den „russischen Erfahrungen“, seien sie doch ein Ausdruck der Rückständigkeit Russlands, verweigerte damit indirekt die internationale Solidarität und verbreitete einen Standpunkt, der durchtränkt war mit nationalen Vorurteilen, die vorgeben, dass die ArbeiterInnen in Deutschland mit ihren mächtigen Gewerkschaften fortgeschrittener und ihre Methoden „überlegen“ seien… d.h. zu einer Zeit, als die Gewerkschaftsführung bereits den Massenstreik und die autonome Aktion blockierte! Und als Luxemburg wegen ihrer Propagierung des Massenstreiks ins Gefängnis gesteckt wurde, zeigten Kautsky und seine Anhänger kein Anzeichen von Entrüstung und protestierten nicht.
Luxemburg, die durch solche Zensurversuche nicht mundtot gemacht werden konnte, warf der Parteiführung vor, ihre gesamte Aufmerksamkeit auf die Wahlvorbereitungen zu richten. „
„[Will] der ‚Vorwärts‘ mit einem Delirium der Freude über unsre jetzigen und künftigen Reichstagswahlsiege betäuben? Glaubt der ‚Vorwärts‘ im Ernst, dass der geistigen Vertiefung der breiten Parteikreise mit dieser ewigen Hurrastimmung über Reichstagswahlsiege schon ein, vielleicht anderthalb Jahre vor den Reichstagswahlen sowie durch Erstickung aller Selbstkritik in der Partei ein Dienst erwiesen wird?“[81]
Neben Rosa Luxemburg war Anton Pannekoek der vernehmbarste Kritiker von Kautskys „Ermattungsstrategie“. In seinem Buch „Taktische Differenzen in der Arbeiterbewegung“[82] unternahm Pannekoek eine systematische und fundamentale Kritik an den „alten Werkzeugen“ des Parlamentarismus und des Gewerkschaftskampfes. Pannekoek sollte ebenfalls Opfer der Zensur und Repression innerhalb der Sozialdemokratie und des Gewerkschaftsapparates werden und verlor infolgedessen seinen Job als Parteilehrer. Sowohl Luxemburgs als auch Pannekoeks Artikel wurden zunehmend von der Parteipresse zensiert. Im November 1911 weigerte sich Kautsky zum ersten Mal, einen Artikel von Pannekoek in Neue Zeit zu veröffentlichen.[83]
So zwangen die Massenstreiks von 1905 die SPD-Führung, ihr wahres Gesicht zu zeigen und sich jeglicher Mobilisierung der Arbeiter zu widersetzen, die die „russischen Erfahrungen“ aufzugreifen versuchten. Schon Jahre vor der Entfesselung des Krieges war die Gewerkschaftsführung zu einem Bollwerk für den Kapitalismus geworden. Unter dem Vorwand, die unterschiedlichen Bedingungen des Klassenkampfes zu berücksichtigen, wurden diese in Wahrheit dazu benutzt, internationale Solidarität abzulehnen, wobei die rechten Kräfte in der Sozialdemokratie versuchten, Ängste und selbst nationale Ressentiments gegen den „russischen Radikalismus“ zu schüren. Dies wurde zu einer wichtigen ideologischen Waffe in dem Krieg, der einige Jahre später begann. So wurde nach 1905 das Zentrum, das bisher hin und her geschwankt hatte, allmählich immer mehr zur Rechten gezogen. Die Unfähigkeit und der Unwille des Zentrums, den Kampf der Linken in der Partei zu unterstützen, bedeuteten, dass die Linke immer isolierter innerhalb der Partei wurde. Wie Luxemburg hervorhob: “Der wirkliche Effekt des Auftretens des Genossen Kautsky ist also nur der, dass er eine theoretische Schirmwand für die Elemente in der Partei und in den Gewerkschaften geliefert hat, die sich bei der weiteren rücksichtslosen Entfaltung der Massenbewegung unbehaglich fühlen, sie im Zaume halten und sich am liebsten so schnell wie möglich auf die alten bequemen Bahnen des parlamentarischen und gewerkschaftlichen Alltags zurückziehen möchten. Indem Genosse Kautsky unter Berufung auf Engels und den Marxismus diesen Elementen für ihr Vorgehen eine Gewissensberuhigung gebracht hat, hat er zugleich ein Mittel geliefert, um derselben Demonstrationsbewegung wieder für die nächste Zeit das Genick zu brechen, die er immer machtvoller gestalten möchte.”[84]
Die Kriegsgefahr und die Internationale
Der Stuttgarter Kongress der Internationalen im Jahr 1907 versuchte, die Lehren aus dem Russisch-japanischen Krieg zu ziehen und das Gewicht der organisierten Arbeiterklasse gegen die wachsende Kriegsgefahr in die Waagschale zu werfen. Etwa 60.000 Menschen nahmen an einer Demonstration teil – mit Rednern aus mehr als einem Dutzend Länder, die vor der Kriegsgefahr warnten. August Bebel schlug eine Resolution gegen die Kriegsgefahr vor, die die Frage des Militarismus als integralen Bestandteil des Kapitalismus umging und mit keinem Wort den Kampf der ArbeiterInnen in Russland gegen den Krieg erwähnte. Die deutsche Partei beabsichtigte, sich nicht an irgendwelchen Rezepte bezüglich ihres Tuns im Falle eines Krieges zu binden, vor allem nicht in Form eines Generalstreiks. Lenin, Luxemburg und Martow schlugen gemeinsam einen robusteren Änderungsantrag zur Resolution vor: „„Droht der Ausbruch eines Krieges, so sind in den beteiligten Ländern die Arbeiter und ihre parlamentarischen Vertreter verpflichtet, alles aufzubieten, um den Ausbruch des Krieges durch Anwendung entsprechender Mittel zu verhindern, die sich je nach der Verschärfung des Klassenkampfes und der allgemeinen politischen Situation naturgemäß ändern und steigern. Falls der Krieg dennoch ausbrechen sollte, sind sie verpflichtet, für dessen rasche Beendigung einzutreten und mit allen Kräften dahin zu streben, um die durch den Krieg herbeigeführte wirtschaftliche und politische Krise zur politischen Aufrüttelung der Volksschichten und zur Beschleunigung des Sturzes der kapitalistischen Klassenherrschaft auszunutzen.“[85] Der Stuttgarter Kongress stimmte einstimmig für diese Resolution, doch anschließend versagte die Mehrheit der 2. Internationalen darin, ihren Widerstand gegen die wachsenden Kriegsvorbereitungen zu stärken. Der Stuttgarter Kongress ging in die Geschichte ein als ein Beispiel verbaler Deklarationen ohne Taten der meisten der anwesenden Parteien.[86] Doch er war ein wichtiger Moment der Kooperation unter den linken Strömungen, die trotz ihrer Differenzen in vielen anderen Fragen in der Frage des Krieges gemeinsam Stellung bezogen.
Im Februar 1907 veröffentlichte Karl Liebknecht sein Buch Militarismus und Anti-Militarismus unter besonderer Berücksichtigung der internationalen Jugendbewegung, in dem er insbesondere die Rolle des deutschen Militarismus anprangerte. Im Oktober 1907 wurde er zu 18 Monaten Gefängnis wegen Hochverrats verurteilt. Noch im gleichen Jahr erklärte eine führende Figur der Rechten in der SPD, Noske, in einer Rede vor dem Reichstag, dass im Falle eines „Verteidigungskrieges“ die Sozialdemokratie die Regierung unterstützen würde und „Unsere Stellung zum Militärwesen ist gegeben durch unsere Auffassung des Nationalitätenprinzips. Wir fordern die Unabhängigkeit jeder Nation. Aber das bedingt, dass wir auch Wert darauf legen, dass die Unabhängigkeit des deutschen Volkes gewahrt wird. Wir sind selbstverständlich der Meinung, dass es unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit ist, dafür zu sorgen, dass das deutsche Volk nicht etwa von irgendeinem anderen Volk an die Wand gedrückt wird.“[87] Es war derselbe Noske, der 1918 zum Bluthund der von der SPD geleiteten Repression gegen die ArbeiterInnen werden sollte.
Den Internationalismus um des Wahlerfolgs willen verschleudern
1911 provozierte die Entsendung des deutschen Zerstörers Panther nach Agadir die zweite Marokko-Krise mit Frankreich. Die SPD-Führung schwor jeglicher antimilitaristischen Aktion ab, um ihren Erfolg bei den anstehenden Wahlen von 1912 nicht zu gefährden. Als Luxemburg dieses Verhalten anprangerte, beschuldigte die SPD-Führung sie, Parteigeheimnisse verraten zu haben. Im August 1911, nach langem Zögern und Versuchen, die Frage zu vermeiden, verteilte die Parteiführung ein Flugblatt, was ein Protest gegen die Marokko-Politik des deutschen Imperialismus sein sollte. Der Inhalt des Flugblatts wurde von Luxemburg in ihrem Artikel „Unser Flugblatt über Marokko“ scharf kritisiert,[88] wobei sie sich nicht bewusst darüber war, dass der Autor des Flugblatts Kautsky war. Kautsky antwortete mit einer personalisierten Attacke. Luxemburg schlug zurück: Kautsky, sagte sie, habe ihre Kritik dargestellt als „hämischer, hinterhältiger Angriff auf seine (Kautskys) Person (…) Den Mut, um jemand nicht offen, Auge in Auge zu kritisieren oder zu bekämpfen, wird mir Genosse Kautsky schwerlich bestreiten. Ich habe noch nie einen Menschen aus dem Hinterhalt angegriffen und weise die Vermutung des Genossen Kautsky, als hätte ich um ihn als den Verfasser gewusst und ihn, ohne ihn zu nennen, treffen wollen, mit den gebührenden Gefühlen zurück. (…) Aber ich hätte mich wohl gehütet, ohne dringende Not mich in eine Polemik mit einem Genossen zu stürzen, der mit dieser Reizbarkeit, mit dieser Flut persönlicher Heftigkeiten, Bitterkeiten und Verdächtigungen auf eine streng sachliche, wenn noch so scharfe Kritik antwortet, der hinter jedem Wort eine persönliche gehässige Absicht wittert.“[89] Auf dem Jenaer Parteitag im September 1911 ließ die Parteiführung eine besondere Broschüre gegen Rosa Luxemburg zirkulieren, die voller Angriffe gegen sie war und die Beschuldigung, die Indiskretion gebrochen und das Internationale Sozialistische Büro der 2. Internationalen über die interne SPD-Korrespondenz informiert zu haben.
Kautskys Desertion vom Kampf gegen den Krieg
Obgleich Kautsky in seinem Buch Der Weg zur Macht (1909) davor warnte, dass „Der Weltkrieg wird nun in bedrohlichste Nähe gerückt;, sagte er 1911 voraus, dass, wäre der Krieg einmal ausgebrochen, „jeder wird zu einem Patrioten werden“. Und dass, wenn die Sozialdemokratie sich dazu entschließe, gegen die Strömung zu schwimmen, sie vom rasenden Mob zerrissen werden würde. Er setzte seine Friedenshoffnungen in die „Länder, die die europäische Zivilisation repräsentieren“ und die Vereinigten Staaten von Europa bilden könnten. Gleichzeitig begann er seine Theorie des „Super-Imperialismus“ zu entwickeln; die Idee zugrunde lag die Vorstellung, dass der imperialistische Konflikt keine unvermeidliche Konsequenz der kapitalistischen Expansion sei, sondern lediglich eine „Politik“, die aufgeklärte kapitalistische Staaten wählen oder ablehnen können. Kautsky dachte bereits, dass der Krieg die Klassenwidersprüche in den Hintergrund drängen würde und die Massenaktion des Proletariats zum Scheitern verurteilt sei, dass – wie er sagte, als der Krieg ausgebrochen war – die Internationale lediglich gut für Friedenszeiten sei. Dieses Verhalten – sich der Kriegsgefahr voll bewusst zu sein, aber sich dem vorherrschenden nationalistischen Druck zu beugen und vor einem entschlossenen Kampf zurückzuscheuen – entwaffnete die Arbeiterklasse und ebnete den Weg für den Verrat an den Interessen des Proletariats. So verharmloste Kautsky einerseits in seiner Theorie des „Super-Imperialismus“ die wirkliche Explosivität der imperialistischen Spannungen herab und scheiterte somit völlig, die Entschlossenheit der herrschenden Klasse, sich auf einen Krieg vorzubereiten, wahrzunehmen, während er andererseits aus Angst um den Wahlerfolg der SPD der nationalistischen Ideologie der Regierung (und in wachsender Weise des rechten Flügels in der SPD) nachgab, statt sie zu konfrontieren. Sein Rückgrat, sein Kampfgeist hatten ihn verlassen.
Als eine entschlossene Anprangerung der Kriegsvorbereitungen vonnöten war und während der linke Flügel sein Bestes gab, um Antikriegstreffen zu organisieren, die Tausende anzogen, mobilisierte die SPD-Führung bis an die Grenzen des Möglichen für die anstehenden Parlamentswahlen 1912. Luxemburg prangerte das selbst aufgezwungene Schweigen über die Kriegsgefahr als einen opportunistischen Versuch an, mehr Parlamentssitze zu erzielen, den Internationalismus zu opfern, um mehr Stimmen zu erringen.
1912 veranlasste die Bedrohung des Friedens, die vom zweiten Balkankrieg ausging, den ISB dazu, einen außerordentlichen Internationalen Kongress zu organisieren, der in Basel, Schweiz, mit dem besonderen Ziel abgehalten wurde, die internationale Arbeiterklasse gegen die akute Kriegsgefahr zu mobilisieren. Luxemburg kritisierte die Tatsache, dass die deutsche Partei den Gewerkschaften, die ein paar zurückhaltende Proteste organisierten und ansonsten argumentierten, dass die Partei als politisches Organ nicht mehr zu tun habe, als Lippenbekenntnisse zur Anprangerung des Krieges abzulegen, lediglich hinterherlief. Während einige Parteien in anderen Ländern energischer reagiert hatten, hatte sich die SPD, die größte Arbeiterpartei in der Welt, im Wesentlichen aus der Agitation zurückgezogen und auf die Mobilisierung weiterer Proteste verzichtet. Der Baseler Kongress, der einmal mehr mit einer Großdemonstration und Friedensappellen endete, übertünchte eigentlich die Fäulnis und den bevorstehenden Verrat durch viele ihrer Mitgliedsparteien.
Am 3. Juni 1913 stimmte die SPD-Reichstagsfraktion für eine militärische Sondersteuer: 37 SPD-Abgeordnete, die sich diesem Votum widersetzt hatten, wurden mit dem Mittel der Fraktionsdisziplin zum Schweigen gebracht. Der offene Bruch mit dem vorherigen Motto: „diesem System keinen Mann und keinen Groschen“ bereitete das Votum der Reichstagsfraktion für die Kriegskredite im August 1914 vor.[90] Der moralische Niedergang der Partei wurde auch durch Bebels Reaktion offenbart. 1870/71 hatte sich August Bebel – zusammen mit Wilhelm Liebknecht (Karl Liebknechts Vater) – durch seine entschlossene Opposition gegen den Deutsch-Französischen Krieg ausgezeichnet. Nun, vier Jahrzehnte später, versagte Bebel darin, resoluten Widerstand gegen die Kriegsgefahr zu leisten.[91]
Es wurde zunehmend deutlicher, dass nicht nur die Rechte sich anschickte, offenen Verrat zu begehen, sondern auch dass die schwankenden Zentristen all ihren Kampfgeist verloren hatten und es ihnen nicht gelingen sollte, den Kriegsvorbereitungen auf entschlossene Weise entgegenzutreten. Das Verhalten des berühmtesten Repräsentanten des „Zentrums“, Kautsky, dem zufolge die Partei ihre Position in der Kriegsfrage entsprechend den Reaktionen der Bevölkerung (passive Unterordnung, wenn die Mehrheit des Landes dem Nationalismus zuneigt, oder ein entschlossener Widerstand, wenn es eine wachsende Opposition gegen den Krieg gibt) anpassen soll, wurde mit der Gefahr „der eigenen Isolation gegenüber der Hauptmasse der Partei“ gerechtfertigt. Als nach 1910 die Strömung um Kautsky behauptete, das „marxistische Zentrum“ im Gegensatz zur (extremistischen, radikalen, unmarxistischen) Linken zu sein, bezeichnete Luxemburg dieses „Zentrum“ als Repräsentant der Feigheit, der Vorsichtigkeit und des Konservatismus.
Ihre Desertion vom Kampf, ihre Unfähigkeit, der Rechten entgegenzutreten und der Linken in ihrem entschlossenen Kampf zu folgen, half mit bei der Entwaffnung der ArbeiterInnen. So war der Verrat vom August 1914 durch Parteiführung keine Überraschung; er wurde Stück für Stück vorbereitet. Die Unterstützung des deutschen Imperialismus wurde in etlichen Abstimmungen im Parlament zur Unterstützung der Kriegskredite, in den Bemühungen, jeglichen Protest gegen den Krieg zu zügeln, in der ganzen Parteinahme für den deutschen Imperialismus und in der Ankettung der Arbeiterklasse an Nationalismus und Patriotismus greifbar. Die Linke mundtot zu machen war ausschlaggebend bei der Preisgabe des Internationalismus und bereitete die Repression gegen die Revolutionäre 1919 vor.
Geblendet von Zahlen
Während die SPD-Führung ihre Aktivitäten auf Parlamentswahlen konzentriert hatte, war die Partei selbst am Wahlerfolg gebunden und verlor das Endziel der Arbeiterbewegung aus den Augen. Die Partei bejubelte den scheinbar ununterbrochenen Zuwachs an Wählerstimmen, an Abgeordneten und an Lesern der Parteipresse. Der Zugewinn war in der Tat beeindruckend: 1907 hatte die SPD 530.000 Mitglieder; um 1913 hatte sich die Zahl auf 1.1 Millionen fast verdoppelt. Eigentlich war die SPD die einzige Massenpartei der 2. Internationalen und die größte einzelne Partei in Europa. Dieses numerische Wachstum erzeugte die Illusion einer großen Stärke. Selbst Lenin war bemerkenswert unkritisch gegenüber den „beeindruckenden Zahlen“ von Mitgliedern, Wählern und dem Einfluss der Partei.[92]
Obwohl es unmöglich ist, eine schematische Beziehung zwischen politischer Unnachgiebigkeit und Wahlergebnissen herzustellen, führten die Wahlen von 1907, als die SPD die barbarische Repression des deutschen Imperialismus gegen den Herero-Aufstand in Südwestafrika noch verurteilt hatte, zu einem „Rückschlag“, als die SPD 38 Parlamentssitze verlor und „nur“ noch 43 Sitze übrigblieben. Trotz der Tatsache, dass der Anteil der SPD an den Gesamtstimmen faktisch gestiegen war, bedeutete dieser Rückschlag in den Augen der Parteiführung, dass die Partei vom Wähler und vor allem von den Wählern aus dem Kleinbürgertum wegen der Anprangerung des deutschen Imperialismus abgestraft worden sei. Die Schlussfolgerung, die sie zogen, lautete: Die SPD müsse vermeiden, sich zu schroff gegen Imperialismus und Nationalismus zu wenden, da dies Wählerstimmen koste. Stattdessen sollte die Partei alle ihre Kräfte auf die Kampagne für die nächsten Wahlen konzentrieren, selbst wenn dies bedeutete, ihre Diskussionen zu zensieren und alles zu vermeiden, was ihrem Wahlergebnis schaden könnte. Bei den Wahlen 1912 erzielte die Partei 4,2 Millionen Stimmen (38,5% aller abgegebenen Stimmen) und gewann 110 Sitze. Sie war zur größten einzelnen parlamentarischen Gruppierung geworden, jedoch nur indem der Internationalismus und die Prinzipien der Arbeiterklasse begraben wurden. In den lokalen Parlamenten hatte sie mehr als 11.000 Abgeordnete. Die SPD konnte 91 Zeitungen und 1,5 Millionen Abonnenten vorweisen. Bei den Wahlen von 1912 ging die Integration der SPD in das Spiel der parlamentarischen Politik noch einen Schritt weiter, als sie zum Vorteil der Freiheitlichen Volkspartei Abgeordnete aus etlichen Wahlbezirken zurückzog, obwohl diese Partei bedingungslos die Politik des deutschen Imperialismus unterstützte. Mittlerweile unterstützten die Sozialistischen Monatshefte (im Prinzip keine Parteipublikation, doch im Endeffekt das theoretische Organ der Revisionisten) offen die Kolonialpolitik Deutschlands und die Ansprüche des deutschen Imperialismus auf eine Neuaufteilung der Kolonien.
Allmähliche Integration in den Staat
Tatsächlich ging die volle Mobilisierung der Partei für die Parlamentswahlen Hand in Hand mit ihrer allmählichen Integration in den Staatsapparat. Die indirekte Zustimmung zum Etat im Juli 1910,[93] die wachsende Kooperation mit bürgerlichen Parteien (die bis dahin ein kein Thema gewesen war), wie der Verzicht auf die Nominierung eigener Kandidaten, um die Wahl von Abgeordneten der bürgerlichen Freiheitlichen Volkspartei zu ermöglichen, die Nominierung eines Kandidaten für die Bürgermeisterwahlen in Stuttgart – dies waren einige der Schritte der SPD auf dem Weg zur direkten Beteiligung an der Leitung der staatlichen Administration.
Dieser ganze Trend in Richtung einer zunehmenden Vernetzung der Parlamentsaktivitäten der SPD und ihre Identifizierung mit dem Staat wurde von der Linken gegeißelt, insbesondere von Anton Pannekoek und Luxemburg. Pannekoek widmete ein ganzes Buch den Taktischen Differenzen in der Arbeiterbewegung. Luxemburg, die äußerst alarmiert war wegen der erstickenden Effekte des Parlamentarismus, drängte auf die Initiative und Aktion der Basis: „Aber der ideale Parteivorstand wird nichts ausrichten können, wird unwillkürlich im bürokratischen Schlendrian versinken, wenn die natürliche Quelle seiner Tatkraft, der Wille der Partei, sich nicht bemerkbar macht, wenn der kritische Gedanke, die eigene Initiative der Parteimasse schläft. Ja noch mehr. Ist die eigne Energie, das selbständige geistige Leben der Parteimasse nicht rege genug, dann haben ihre Zentralbehörden den ganz natürlich Hang dazu, nicht bloß bürokratisch zu verrosten, sondern auch eine völlig verkehrte Vorstellung von der eignen amtlichen Autorität und Machtstellung gegenüber der Partei zu bekommen. Als frischer Beweis kann der jüngste sogenannte ‚Geheimerlass‘ unsres Parteivorstandes an die Parteiredaktionen dienen, ein Versuch der Bevormundung der Parteipresse, der nicht scharf genug zurückgewiesen werden kann. Aber auch hier gilt es sich wieder klarzumachen: Gegen Schlendrian wie gegenüber übermäßige Machtillusionen der Zentralbehörden der Arbeiterbewegung gibt es kein andres Mittel als die eigene Initiative, eigne Gedankenarbeit, eignes frisch pulsierendes politisches Leben der großen Parteimasse.“[94] In der Tat beharrte Luxemburg ständig auf die Notwendigkeit, dass die Masse der Parteimitglieder „aufwacht“ und ihre Verantwortung gegen die degenerierende Parteiführung wahrnimmt. „ Die großen Massen müssen sich in einer ihnen eignen Weise betätigen, ihre Massenenergie, ihre Tatkraft entfalten können, sie müssen sich selbst als Masse rühren, handeln, Leidenschaft, Mut und Entschlossenheit entwickeln.“[95]
„Jeder Schritt vorwärts im Emanzipationskampfe der Arbeiterklasse muss zugleich eine wachsende geistige Verselbständigung ihrer Masse, ihre wachsende Selbstbestätigung, Selbstbestimmung und Initiative bedeuten (…) Die Hauptsache für eine normale Entwicklung des politischen Lebens in der Partei, die Lebensfrage der Sozialdemokratie beruht somit darauf, dass der politische Gedanke und der Wille der Masse der Partei stets wach und tätig bleiben, dass sie sie in steigendem Maße zur Aktivität befähigen(…)
Wir haben freilich den jährlichen Parteitag als oberste Instanz, die den Willen der Gesamtpartei periodisch fixiert. Aber es ist klar, dass die Parteitage nur große allgemeine Richtlinien der Taktik für den Kampf der Sozialdemokratie geben können. Die Anwendung dieser Richtlinien in der Praxis erfordert eine ständige, unermüdliche Gedankenarbeit, Schlagfertigkeit und Initiative. (…) Diese ganze Aufgabe der täglichen politischen Wachsamkeit und Initiative einem Parteivorstand zuschieben zu wollen, auf dessen Kommando die bald millionenköpfige Parteiorganisation passiv wartet, ist das Verkehrteste, was es gibt, vom Standpunkt des proletarischen Klassenkampfes. Das ist zweifellos jener verwerfliche ‚Kadavergehorsam‘, den unsere Opportunisten durchaus in der selbstverständlichen Unterordnung aller unter die Beschlüsse der Gesamtpartei suchen wollen.“.[96]
Fraktionsdisziplin erdrosselt individuelle Verantwortung
Am 4. August 1914 stimmte die parlamentarische Fraktion der SPD einmütig für die Kriegskredite. Die Parteiführung und die Parlamentsfraktion hatten „Fraktionsdisziplin“ eingefordert. Die Zensur (staatliche Zensur oder Selbstzensur?) und eine falsche Einheit der Partei folgten ihrer eigenen Logik, dem genauen Gegenteil von persönlicher Verantwortung. Der Degenerationsprozess bedeutete, dass die Fähigkeit zum kritischen Denken und Widerstand gegen die falsche Parteieinheit aufgezehrt war. Die moralischen Werte der Partei wurden auf dem Altar des Kapitals geopfert. Im Namen der Parteidisziplin forderte die Partei die Aufgabe des proletarischen Internationalismus. Karl Liebknecht, dessen Vater es gewagt hatte, eine Unterstützung der Kriegskredite im Jahr 1870 abzulehnen, beugte sich nun dem Druck durch die Partei. Erst einige Wochen später, im Anschluss an eine erste Neugruppierung von Genossen, die dem Internationalismus treu geblieben waren, wagte er es, offen seine Ablehnung der Kriegsmobilisierung durch die SPD-Führung zum Ausdruck zu geben. Doch das Votum der SPD für die Kriegskredite hatte eine Lawine von Demutsgesten gegenüber dem Nationalismus in anderen europäischen Ländern ausgelöst. Mit dem Verrat der SPD unterzeichnete die 2. Internationale ihren eigenen Hinrichtungsbefehl und löste sich auf.
Der Aufstieg der opportunistischen und revisionistischen Strömung, die am deutlichsten in den größten Parteien der 2. Internationalen auftauchte und die das Ziel des Sturzes der kapitalistischen Gesellschaft preisgab, bedeutete, dass das proletarische Leben, der Kampfgeist und die moralische Empörung aus der SPD oder zumindest aus den Reihen ihrer Führung und ihrer Bürokratie gewichen waren. Gleichzeitig war dieser Prozess untrennbar verknüpft mit der programmatischen Degeneration der SPD, was in ihrer Weigerung, die neuen Waffen des Klassenkampfes, den Massenstreik und die Selbstorganisation der ArbeiterInnen, anzuwenden, und in der allmählichen Preisgabe des Internationalismus sichtbar wurde. Der Degenerationsprozess der deutschen Sozialdemokratie, der kein isoliertes Phänomen in der 2. Internationalen war, führte 1914 zu ihrem Verrat. Zum ersten Mal hatte eine politische Organisation der ArbeiterInnen nicht nur die Interessen der Arbeiterklasse verraten, sie wurde darüber hinaus zu einer der wirksamsten Waffen in den Händen der kapitalistischen Klasse, um den Krieg zu entfesseln und die Arbeiterrevolte gegen den Krieg zu zerschmettern. Die Lehren aus der Degeneration der Sozialdemokratie bleiben somit kreuzwichtig für die heutigen Revolutionäre.
Heinrich/Jens
[1] Mit 38,5% der Stimmen errang die SPD 110 Sitze im Reichstag.
[2] Karl Kautsky wurde 1854 in Prag geboren; sein Vater war ein Bühnenbildner und seine Mutter eine Schauspielerin und Schriftstellerin. Die Familie zog nach Wien, als Kautsky sieben Jahre alt war. Er studierte an der Wiener Universität und schloss sich 1875 der Sozialistischen Partei Österreichs (SPÖ) an. 1880 hielt er sich in Zürich auf und leistete Hilfsdienste beim Schmuggel sozialistischer Literatur nach Deutschland.
[3] August Bebel wurde 1840 in einem heutigen Außenbezirk von Köln geboren. Mit 13 Vollwaise geworden, ging er bei einem Zimmermann in die Lehre und reiste als junger Mann ausgiebig durch Deutschland. Er traf 1865 Wilhelm Liebknecht und war sofort beeindruckt über Liebknechts internationale Erfahrung; in seiner Autobiographie erinnert sich Bebel: „Donnerwetter, von dem kann man was lernen“ (Bebel, Aus meinem Leben, Berlin 1946, zitiert in: James Joll, The Second International). Gemeinsam mit Liebknecht wurde Bebel einer der herausragenden Führer in den frühen Jahren der deutschen Sozialdemokratie.
[4] Dies wird deutlich sichtbar in Lenins Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück, wo er sich mit der Krise in der RSDAP 1903 befasste. Auf die Zukunft der Menschewiki angesprochen, schreibt er: “Die Mentalität des Zirkelwesens und einer erstaunlichen Unreife in Parteidingen, die außerstande ist, den frischen Wind in aller Öffentlichkeit geführter Diskussionen zu ertragen, offenbarte sich hier anschaulich (…) Man stelle sich bloß vor, dass in der deutschen Partei solch ein Unsinn, ein solches Gezänk möglich wäre wie die Beschwerde über eine „falsche Beschuldigung des Opportunismus“! Proletarische Organisation und Disziplin haben dort längst mit der intelligenzlerischen Waschlappigkeit Schluss gemacht (…) Nur das verknöchertste Zirkelwesen mit seiner Logik: Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag‘ ich dir den Schädel ein, konnte wegen einer gegen die Mehrheit der Gruppe “Befreiung der Arbeit“ erhobenen „falschen Beschuldigung des Opportunismus“ zu Hysterie, Gezänk und Parteispaltung führen.“ (Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück, j) Die unschuldigen Opfer der falschen Beschuldigung des Opportunismus)
[5] Rosa Luxemburg, Die Krise der deutschen Sozialdemokratie (besser bekannt als Junius-Broschüre), Kapitel 1, in Gesammelte Werke, Band 4, S. 55. Luxemburgs Broschüre ist eine wichtige Lektüre für jeden, der die grundlegenden Ursachen des Ersten Weltkriegs zu begreifen versucht.
[6] Ebenda, S. 55
[7] Das Zentralorgan der SPD.
[8] Auch bekannt als die Eisenacher Partei, benannt nach der Stadt ihrer Gründung.
[9] 9) Marx, Erste Adresse des Generalrats der IAA über den Bürgerkrieg in Frankreich, https://www.marxists.org/deutsch/archiv/marx-engels/1870/07/23-adrs1.htm [10]
[10] Eine ähnliche Tendenz überlebte im französischen Sozialismus aus Nostalgie für das Programm der „Nationalwerkstätten“, die der revolutionären Bewegung 1848 gefolgt war.
[11] Vgl. Toni Offermann in Between reform and revolution: German socialism and communism from 1840 to 1990, Berghahn Books, 1998, S. 96.
[12] Es ist heute bekannt unter dem Titel: Kritik des Gothaer Programms.
[13] Marx an Bracke, 5. Mai 1875, MEW 34, S. 137
[14] Engels an Bebel, März 1875, MEW 34, S. 126 ff.
[15] Zitiert in: Georges Haupt, Aspects of international socialism 1871-1914, Cambridge University Press&Editions de la Maison des Sciences de l’Homme.
[16] Die parlamentarische Zustimmung zu den Kriegskrediten 1914 geschah somit in klarer Vergewaltigung der Statuten und Parteitagsbeschlüsse der SPD, wie Rosa Luxemburg betonte.
[17] Kritik des sozialdemokratischen Programmentwurfs, Marx-Engels-Werke, Bd. 22, Berlin 1963, S. 233–235.
[18] Jedoch sollte nicht vergessen werden, dass die russische Autokratie extremer war: Der russische Pendant zum Reichstag, die Staatsduma, wurde erst unter dem Druck der revolutionären Bewegung von 1905 einberufen.
[19] Vgl. JP Nettls bemerkenswerte Biographie über Rosa Luxemburg, S. 81 (Schocken Paperback edition der Kurzfassung der Oxford University Press 1969, mit einem einleitenden Essay von Hannah Arendt). In diesem Artikel haben wir sowohl aus der gekürzten als auch aus der ungekürzten Fassung zitiert.
[20] Es ist bedeutsam, dass, während die Partei den rechten Reformismus tolerierte, die „Jungen“, die vehement die Gewichtsverlagerung zum Parlamentarismus kritisierten, auf dem Erfurter Parteitag aus der Partei ausgeschlossen wurden. Es ist richtig, dass diese Gruppe im Wesentlichen eine intellektuelle und literarische Opposition mit anarchistischen Tendenzen (eine Reihe ihrer Mitglieder schlitterte nach dem Verlassen der SPD in den Anarchismus) war. Es ist dennoch kennzeichnend, dass die Partei viel schroffer auf eine Kritik durch die Linke reagierte als auf die durch und durch opportunistische Praxis der Rechten.
[21] Vgl. Jacques Droz, Histoire générale du socialisme, S. 41, Editions Quadrige/PUF, 1974.
[22] Brief an Kautsky, 1896, zitiert bei Droz, ob. zit., S. 42, Übersetzung IKS.
[23] Bernsteins revisionistische Strömung war keinesfalls eine isolierte Ausnahme. In Frankreich trat der Sozialist Millerand gemeinsam mit General Gallifet, dem Henker der Pariser Kommune, der Regierung von Waldeck-Rousseau bei; eine ähnliche Tendenz existierte in Belgien; die britische Labour-Bewegung wurde völlig dominiert vom Reformismus und von einem engstirnigen nationalistischen Gewerkschaftstum.
[24] „Aber die Kolonialfrage ist viel mehr als bloß eine Menschlichkeitsfrage. Sie ist eine Menschheitsfrage und eine Kulturfrage ersten Ranges. Sie ist die Frage der Ausbreitung der Kultur und, solange es große Kulturunterschiede gibt, der Ausbreitung oder, je nachdem, Behauptung der höheren Kultur. Denn früher oder später tritt es unvermeidlich ein, dass höhere und niedere Kultur auf einander stoßen, und in Hinblick auf diesen Zusammenstoß, diesen Kampf ums Dasein der Kulturen ist die Kolonialpolitik der Kulturvölker als geschichtlicher Vorgang zu werten. Dass sie meist aus anderen Motiven und mit Mitteln, sowie in Formen betrieben wird, die wir Sozialdemokraten verurteilen, wird in den konkreten Fällen uns zu ihrer Ablehnung und Bekämpfung bewegen, kann aber kein Grund sein, unser Urteil über die geschichtliche Notwendigkeit des Kolonisierens zu ändern.“ Eduard Bernstein, Die Kolonialfrage und der Klassenkampf, (November 1907) Quelle: Sozialistische Monatshefte. Sozialistische Monatshefte. - 11 = 13 (November 1907), S. 988–996.
[25] Vgl. Nettl, ob. zit., S. 101.
[26] Parvus, ebenfalls als Alexander Helphand bekannt, war eine merkwürdige und kontroverse Figur in der revolutionären Bewegung. Nach einigen Jahren auf der Linken in der Sozialdemokratie in Deutschland, dann in Russland in der Revolution von 1905, zog er in die Türkei, wo er eine Firma aufbaute, die mit Waffen handelte, und verdiente sich an den Erlösen aus den Balkan-Kriegen reich. Gleichzeitig profilierte er sich als finanzieller und politischer Berater der nationalistischen Bewegung der Jungtürken und gab die nationalistische Publikation Turk Yurdu heraus. Während des Krieges wurde Parvus ein offener Anhänger des deutschen Imperialismus, sehr zum Leid Trotzkis, dessen Ideen zur „permanenten Revolution“ er stark beeinflusst hatte (vgl. Deutscher, Trotzki, „Der Krieg und die Internationale“).
[27] Rosa Luxemburg, Sozialreform oder Revolution, Gesammelte Werke, Bd. 1/1, S. 441.
[28] „Parteitag der Sozialdemokratie“, Oktober 1898 in Stuttgart, Rosa Luxemburg, Ges. Werke, Bd. 1/1, S. 241.
[29] Rosa Luxemburg, Parteifragen im „Vorwärts“, 29.9.1899, Gesammelte Werke, Bd. 1/1, S. 565, 1899.
[30] Rosa Luxemburg, ebenda, S. 578.
[31] August Bebel, Dresden, 13-20.1903, zitiert bei Luxemburg, „Nach dem Jenaer Parteitag“, Ges. Werke, Bd. 1/1, S. 351.
[32] „Unser leitendes Zentralorgan“, Leipziger Volkszeitung, 22.9.1899, Rosa Luxemburg in: Ges. Werke, Bd. 1/1, S. 558.
[33] Darüber hinaus hat “Bernstein (…) seine Revision des sozialdemokratischen Programms mit dem Aufgeben der Theorie des kapitalistischen Zusammenbruchs angefangen. Da aber der Zusammenbruch der bürgerlichen Gesellschaft ein Eckstein des wissenschaftlichen Sozialismus ist, so musste die Entfernung dieses Ecksteins logisch zum Zusammenbruche der ganzen sozialistischen Auffassung bei Bernstein führen.“ (Rosa Luxemburg, Sozialreform oder Revolution, Zusammenbruch; Gesammelte Werke Bd. 1/1, S. 436).
[34] „Ich bin Ihnen sehr dankbar für die Mitteilungen, die mich über die Lage der Dinge orientieren. Dass Bernstein in seinen bisherigen Ausführungen nicht mehr auf dem Boden unseres Programms steht, war mir natürlich klar, dass man aber auch ganz die Hoffnung auf ihn aufgeben muss, ist sehr schmerzlich. Es wundert mich allerdings, dass Sie und Genosse Kautsky, falls Sie die Sachlage in dieser Weise auffassten, nicht die günstige Stimmung, die durch den Parteitag geschaffen war, zu einer sofortigen energischen Debatte benutzen wollten, sondern erst Bernstein zu einer Broschüre veranlassten, die die Diskussion verschleppen wird“ (Rosa Luxemburg, Ges. Briefe, Bd. 1, Brief an Bebel, 31.10.1898).
[35] Rosa Luxemburg, Ges. Briefe, Bd. 1, S. 289, Brief an Leo Jogiches, 11. März 1899.
[36] Kautsky an Bernstein, 29.7.1899, IISG-Kautsky-Nachlass, C. 227, C. 230, zitiert in: Till Schelz-Brandenburg, Eduard Bernstein und Karl Kautsky, Entstehung und Wandlung des sozialdemokratischen Parteimarxismus im Spiegel ihrer Korrespondenz 1879 bis 1932, Köln, 1992.
[37] Rosa Luxemburg, „Parteifragen im Vorwärts“, Gesammelte Werke, Bd. 1/1, S. 564, 29.9.1899.
[38] Laschitza, Im Lebensrausch, Trotz alledem, S. 104, 27.10.1898, Kautsky-Nachlass C209: Kautsky an Bernstein.
[39] Karl Kautsky an Victor Adler, 20.7.1905, in: Victor Adler, Briefwechsel, a.a.O. S. 463, Zitiert von Till Schelz-Brandenburg, S. 338.
[40] Rosa Luxemburg, Ges. Werke, Bd. 1/1, S. 528, zitierend „Kautsky zum Parteitag in Hannover“. Neue Zeit 18, Stuttgart 1899-1900, 1. Bd., S. 12.
[41] Rosa Luxemburg, Zum kommenden Parteitag (1899), Freiheit der Kritik und der Wissenschaft, Gesammelte Werke, Bd. 1/1, S. 527.
[42] Rosa Luxemburg, Gesammelte Briefe, Bd. 1, S. 279, Brief an Leo Jogiches, 3.3.1899.
[43] Ebenda, Bd. 1, S. 426, Brief an Leo Jogiches, 21.12.1899.
[44] Luxemburg machte es zu einer Frage der Ehre, selbst jenen Parteimitgliedern volle Unterstützung als Agitatorin zu gewähren (sie war sehr gefragt als öffentliche Rednerin), die sie am schärfsten kritisierte, zum Beispiel in der Wahlkampagne des Revisionisten Max Schippel.
[45] Rosa Luxemburg, Gesammelte Briefe, Bd. 1, S. 491, Brief an Leo Jogiches, 7.7.1890.
[46] Rosa Luxemburg, „Erklärung“, Ges. Werke, Bd. ½, S. 146, 1.10.1901.
[47] Auf dem Lübecker Parteitag wurden die Neue Zeit und Kautsky als ihr Herausgeber von den Opportunisten wegen der Kontroverse über den Revisionismus scharf angegriffen.
[48] JP Nettl, Rosa Luxemburg, Bd. 1, S. 192 (das Zitat hier ist der ungekürzten Fassung entnommen), R. Luxemburg, Brief an Kautsky, 3.10.1901.
[49] Rosa Luxemburg, Gesammelte Briefe, Bd. 1, S. 565, Brief an Jogiches, 12.1.1902.
[50] Zitiert von Nettl, ob. zit., S. 127.
[51] Rosa Luxemburg, Gesammelte Briefe, Bd. 3, Brief an Kostja Zetkin, 27.6.1908.
[52] Ebenda, Bd. 3, S. 57, Brief an Kostja Zetkin, 1.8.1909.
[53] Rosa Luxemburg, Ges. Werke, Bd. 1/1, S. 239, 245; „Parteitag der Sozialdemokratie in Stuttgart, Oktober 1898“.
[54] Ebenda, S. 255, „Nachbetrachtungen zum Parteitag 12.-14.Oktober“.
[55] Rosa Luxemburg, Gesammelte Briefe, Bd. 1, S. 279, Brief an Jogiches, 3.3.1899.
[56] Ebenda, S. 384, Brief an Jogiches, 24.9.1899.
[57] Ebenda, S. 322, Brief an Jogiches, 1.5.1899.
[58] Kautsky an Bernstein, 29.10.1898, IISG, Amsterdam, Kautsky-Nicolas, C210.
[59] Laschitza, ebenda, S. 129 (Ignaz Bauer in einem Brief an Bernstein). In seiner Histoire générale du socialisme beschreibt Jacques Droz Auer wie folgt: „Er war ein ‚Praktiker‘, ein ‚Reformist‘ in der Praxis, der es genoss, nichts über Theorie zu wissen, aber so nationalistisch war, dass er vor sozialistischen Zuhörern die Annexion Elsass-Lothringens pries und sich der Wiederherstellung Polens widersetzte, so zynisch, dass er die Autorität der Internationale ablehnte; in Wahrheit unterstützte er die Linie der Sozialistischen Monatshefte und ermutigte aktiv die Entwicklung des Reformismus.“ (S. 41)
[60] Laschitza, ebenda, S. 130.
[61] Laschitza, ebenda, S. 136, in: Sächsische Arbeiterzeitung, 29.11.1899.
[62] Rosa Luxemburg war sich über die Feindschaft ihr gegenüber schon sehr früh im Klaren. Auf dem Hannoveraner Parteitag 1899 wollte die Führung sie nicht über die Frage der Zölle sprechen lassen. Sie beschrieb deren Verhalten in einem Brief an Jogiches: „Wir wollen das doch lieber in der Partei abmachen, d.h. in der Sippschaft) So ist es bei ihnen immer: Brennt die Bude, her der Jude, ist der Brand aus, Jude hinaus“ (R. Luxemburg, Gesammelte Briefe, Bd. 1, S. 317) Victor Adler schrieb 1910 an Bebel „Ich habe ja Gemeinheit genug in mir um einige Schadenfreude daran zu haben, was Karl jetzt an seiner Freundin erlebt – aber es ist wirklich arg – das giftige Luder wird noch sehr viel Schaden anrichten, um so größeren, weil sie blitzgescheit ist, während ihr jedes Gefühl für Verantwortung vollständig fehlt und ihr einziges Motiv eine geradezu perverse Rechthaberei ist.“ (Nettl, 1, S. 432, ungekürzte Fassung, Victor Adler an August Bebel, 5.8.1910)
[63] 63)Die satirische Wochenzeitung Simplicissimus publizierte ein scheußliches Gedicht, das sich gegen Luxemburg richtete:
“Nur eines gibt es, was ich wirklich hasse:
Das ist der Volksversammlungsrednerin.
Der Zielbewussten, tintenfrohen Klasse.
Ich bin der Ansicht, dass sie alle spinnen.
Sie taugen nichts im Hause, nichts im Bette.
Mag Fräulein Luxemburg die Nase rümpfen,
Auch sie hat sicherlich – was gilt die Wette? –
Mehr als ein Loch in ihren woll’nen Strümpfen.”
(Laschitza, S. 136, Simplicissimus, 4. Jahrgang, Nr. 33, 1899/1900, S. 263).
[64] Frölich, Paul, „Gedanke und Tat“, Rosa Luxemburg, Dietz-Verlag Berlin, 1990, S. 62.
[65] R. Luxemburg, Gesammelte Briefe, Bd. 1, S. 316, Brief an Jogiches, 27. April 1899.
[66] ebenda, Bd. 3, S. 89, Brief an Clara Zetkin, 29.9. 1909.
[67] ebenda, Bd. 3, S. 268, Brief an Kostja Zetkin, 30. 11. 1910. Diese Zeilen wurden von der spießbürgerlichen Reaktion in der Parteiführung auf einen Artikel provoziert, den sie über Tolstoi verfasst hatte und der sowohl als irrelevant (künstlerische Artikel waren nicht wichtig) als auch als unerwünscht betrachtet wurde, da er einen Künstler pries, der sowohl Russe als auch Mystiker war.
[68] Da die Partei eine große Zahl an Zeitungen besaß, von denen die meisten nicht unter ihrer direkten Kontrolle standen, hing es oft von der Haltung der lokalen Redaktionen ab, ob Artikel der linken Strömung veröffentlicht wurden. Der linke Flügel hatte seine größte Leserschaft in Leipzig, Stuttgart, Bremen und Dortmund.
[69] Nettl 1, S. 421 (ungekürzte Fassung).
[70] Ebenda, S. 464 (ungekürzte Fassung).
[71] Sozialdemokratie des Königreichs von Polen und Litauen (Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy – SDKPiL). Die Partei wurde 1893 als Sozialdemokratie des Königreichs Polen (SDKP) gegründet, ihre bekanntesten Mitglieder waren Rosa Luxemburg, Leo Jogiches, Julian Marchlewski und Adolf Warszawski. Sie wurde zur SDKPiL im Anschluss an der Verschmelzung mit der Arbeiterunion in Litauen, die unter anderem von Feliks Dzierżyński angeführt wurde. Eines der wichtigsten charakteristischen Kennzeichen der SDKPiL war ihr unerschütterlicher Internationalismus und ihre Überzeugung gewesen, dass die nationale Unabhängigkeit Polens nicht im Interesse der ArbeiterInnen war und dass die polnische Arbeiterbewegung sich im Gegenteil eng mit der russischen Sozialdemokratie und besonders mit den Bolschewiki verbünden sollte. Dies versetzte sie in einen permanenten Widerspruch zur polnischen Sozialistischen Partei (Polska Partia Socialistyczna – PPS), die unter der Führung von Josef Pilsudski, der später (ähnlich wie Mussolini) zum Diktator Polens werden sollte, eine immer nationalistischere Orientierung einschlug.
[72] Es sollte daran erinnert werden, dass Polen nicht als eigenständiges Land existierte. Der Hauptteil des historischen Polens war Bestandteil des Zarenreiches, während andere Teile von Deutschland und Österreich-Ungarn geschluckt worden waren.
[73] Sie wurde im März 1906 zusammen mit Leo Jogiches, der ebenfalls nach Polen zurückgekehrt war, inhaftiert. Es gab ernsthafte Sorgen um ihre Sicherheit, wobei die SDKPiL kundtat, dass sie physische Repressalien gegen Regierungsbeamten anwenden würde, falls Luxemburg irgendetwas zustoßen sollte. In einer Mischung aus List und Hilfe von ihrer Familie gelang es, sie aus den zaristischen Klauen zu befreien, aus denen sie nach Deutschland zurückkehrte. Jogiches wurde zu acht Jahren Zwangsarbeit verurteilt, doch auch ihm gelang es, aus dem Gefängnis zu fliehen.
[74] Den vollständigen Text gibt es auf: marxists.org.
[75] Siehe die Artikelreihe über 1905 (4) in der Internationalen Revue, Nr. 48,49,50.
[76] Rosa Luxemburg, Gesammelte Werke, Bd. 2, S. 344.
[77] Rosa Luxemburg, „Das Offiziösentum der Theorie“, Ges. Werke, Bd. 3, S. 306, erstmals veröffentlicht in Neue Zeit, 1912.
[78] Die Debatte zwischen Kautsky, Luxemburg und Pannekoek wurde auf Französisch unter dem Titel Socialisme, la voie occidentale, Presses Universitaires de France, veröffentlicht.
[79] Rosa Luxemburg, „Theorie und Praxis“, Ges. Werke, Bd. 2, S. 380, erstmals veröffentlicht in Neue Zeit, 28. Jahrgang, 1909/10, als Antwort auf Kautskys Artikel „Was nun?“
[80] Ebenda, S. 398.
[81] R. Luxemburg, „Die totgeschwiegene Wahlrechtsdebatte“ in: Ges. Werke, Bd. 3, S. 441, 17.8.1910.
[82] Auf Englisch veröffentlicht unter dem Titel Marxist theory and revolutionary tactics (5)
[83] Damals schrieb eine andere wichtige Gestalt der holländischen Linken, Herman Gorter, an Kautsky: „Taktische Differenzen bringen oft auch zwischen Freunden Entfremdung. Bei mir war das nicht der Fall, wie du bemerkt hast. Trotzdem dass du Pannekoek und Rosa, mit denen ich im Allgemeinen übereinstimme, oft scharf kritisiertest (also auch mich), blieb ich dir gegenüber derselbe der ich immer war.“ (Gorter, Brief an Kautsky, Dezember 1914, Kautsky-Archiv IISG, DXI 283, zitiert in: Herman Gorter, Herman de Liagre Böhl, Nijmwegen, 1973, S. 105) Und „Aus alter Liebe und Verehrung unterließen wir es in der ‚Tribune‘ immer so viel wie möglich dich zu bekämpfen“.(ebenda)
[84] 84) Rosa Luxemburg, Ermattung oder Kampf, Gesammelte Werke, Bd. 2, S. 374.
[85] Nettl, I, S. 401 (ungekürzte Fassung).
[86] Eine Hauptschwäche der militanteren Deklarationen war die Idee simultaner Aktionen. So verabschiedete die sozialistische Jugend Belgiens eine Resolution, in der stand: “Es ist die Pflicht der sozialistischen Parteien und der Gewerkschaften aller Länder, sich dem Krieg entgegenzustellen. Die wirksamsten Mittel dieses Widerstands sind Generalstreik und Erhebung gegen die Kriegsmobilisierung.“ (The danger of war and the Second International, Die Kriegsgefahr und die Zweite Internationale J. Jemnitz, p. 17).Doch diese Mittel wären nur von Nutzen gewesen, wenn sie simultan in allen Ländern angewandt worden wären, mit anderen Worten: kompromissloser Internationalismus und antimilitaristische Aktion waren für jedermann Bedingung, der dieselbe Position teilte.
[87] Dieter Fricke, Handbuch zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, 1869-1917, Dietz-Verlag, Berlin, 1987, S. 120.
[88] R. Luxemburg, Ges. Werke, Bd. 3, S. 34; erstmals veröffentlicht in: Leipziger Volkszeitung, 30.8.1911.
[89] Ebenda, S. 43.
[90] Ebenda, S. 11.
[91] „Ich bin in einer vollkommen absurden Lage – Ich muss mich verantwortlich verhalten und mich somit zum Schweigen verurteilen, obwohl, wenn ich meinen eigenen Wünschen folgte, ich mich auch gegen die Führung stellen würde.” (J.Jemnitz, S. 73, Brief von Bebel an Kautsky). Bebel starb am 13. August in einem Schweizer Sanatorium an Herzversagen.
[92] In einem Artikel „Partei und breite Schicht“ schrieb er: “In Deutschland gibt es jetzt etwa eine Million Parteimitglieder. Für die Sozialdemokratie werden dort etwa viereinviertel Millionen Stimmen abgegeben, während es etwa 15 Millionen Proletarier gibt. (…)Eine Million gehört der Parteiorganisation an. Viereinviertel Millionen – das ist die „breite Schicht“. Er betonte, dass „In Deutschland beispielsweise ist annähernd einfünfzehntel der Klasse in der Partei organisiert; in Frankreich etwa 1/140. In Deutschland kommen auf ein Parteimitglied 4-5 Sozialdemokraten der „breiten Schicht, in Frankreich 14“. Lenin fügte hinzu: Die Partei – das ist die bewusste, fortgeschrittenste Schicht der Klasse, ihre Vorhut. Die Kraft dieser Vorhut übersteigt ihre Zahl um das Zehn-, das Hundertfache und mehr. (…) Organisation verzehnfacht die Kräfte“ (Lenin, Wie W. Sassulitsch das Liquidatorentum erledigt, September 1913, Gesammelte Werke, Band 19, S. 396).
[93] Rosa Luxemburg, Ges. Werke, Bd. 2, S. 378.
[94] R. Luxemburg, „Wieder Masse und Führer“, Ges. Werke, Bd. 3, S. 40, 29.8.1911)erstmals veröffentlicht in: Leipziger Volkszeitung.
[95] R. Luxemburg, Ges. Werke, Bd. 3, S. 253, „Taktische Fragen“, Juni 1913.
[96] „Wieder Masse und Führer“, ebenda, S. 39.
Historische Ereignisse:
Erbe der kommunistischen Linke:
Rubric:
INTERNATIONALISME Nr. 38 – Oktober 1948: Über das Wesen und die Funktion der politischen Partei des Proletariats
- 2002 Aufrufe
Einleitung der IKS
Das Dokument, das wir hier publizieren, erschien zum ersten Mal 1948 in der Zeitschrift Internationalisme, dem Organ einer kleinen Gruppe mit dem Namen Französische Kommunistische Linke, auf die sich die IKS seit ihrer Gründung 1975 beruft. Wiederveröffentlicht wurde dieses Dokument in den 1970er Jahren im Studien- und Diskussionsbulletin der Gruppe Révolution International in Frankreich, die später zur französischen Sektion der neugegründeten Internationalen Kommunistischen Strömung (IKS) wurde. Dieses Bulletin war seinerseits Vorläufer des theoretischen Organs der IKS, der Internationalen Revue. Sein Ziel war die Konsolidierung der neuen Gruppe Révolution International und ihrer jungen Militanten durch einen theoretische Denkprozess und eine bessere Kenntnis der Geschichte der Arbeiterbewegung, einschließlich der Geschichte ihrer Konfrontationen mit den neuen theoretischen Fragen, die die Geschichte stellte.
Hauptziel dieses Textes ist die Ergründung der historischen Bedingungen, die den Aufbau und die Aktivitäten der revolutionären Organisationen bestimmen. Die bloße Idee einer solchen Festlegung ist grundlegend. Auch wenn die Gründung und die Aufrechterhaltung einer revolutionären Organisation die Frucht des militanten Willens ist, aktiver Faktor der Geschichte zu sein, ist die Form, die sich dieser Wille gibt, nicht losgelöst von der gesellschaftlichen Realität und vor allem nicht unabhängig vom Niveau der Kampfbereitschaft und des Bewusstseins in den breiten Arbeitermassen. Die Auffassung, dass die Bildung einer Klassenpartei allein vom „Willen“ der Militanten abhängt, zeichnete den Trotzkismus der 1930er Jahre, aber auch den gegen Ende des Zweiten Weltkrieges neu gebildeten "Partito Comunista Internazionalista" (IKP), dem Vorgänger der zahlreichen bordigistischen Gruppen und der heutigen Internationalen Kommunistischen Tendenz (dem ehemaligen IBRP), aus. Der Artikel von Internationalisme unterstreicht aus unserer Sicht absolut berechtigt, dass es sich hier um zwei grundlegend verschiedene Konzeptionen der politischen Organisation handelt: eine idealistisch-voluntaristische und eine materialistisch-marxistische. Bestenfalls führte die voluntaristische Konzeption zu einem genuinen Opportunismus – so wie es bei der IKP und ihren Nachfolgern der Fall war; schlimmstenfalls führte sie zur Versöhnung mit dem Klassenfeind und zum Übertritt ins Lager der herrschenden Klasse – wie bei den Trotzkisten.
Für die junge Generation nach '68 liegt die Bedeutung der theoretischen und historischen Reflexion über diese Frage auf der Hand. Es ging darum, die IKS vor den Auswirkungen des blinden Aktivismus und der typischen Ungeduld dieser Periode zu schützen (auch wenn wir weit davon entfernt sind, immun dagegen zu sein), die so viele Gruppen und Militanten zum Rückzug aus dem politischen Leben geführt haben.
Wir sind absolut überzeugt, dass dieser Text auch heute für die junge Generation völlig relevant ist, besonders weil er darauf beharrt, dass die Arbeiterklasse nicht lediglich eine soziologische Kategorie ist, sondern eine Klasse, die eine besondere Aufgabe in der Geschichte hat: die Überwindung des Kapitalismus und der Aufbau einer kommunistischen Gesellschaft. Die Rolle der Revolutionäre hängt auch von der historischen Periode ab. Wenn die Situation es der Arbeiterklasse unmöglich macht, den Verlauf der Ereignisse zu beeinflussen, ist es nicht die Rolle der Revolutionäre, diese Realität zu ignorieren und sich Illusionen zu machen, ihre Intervention könne den Gang der Dinge ändern. Sie muss sich vielmehr einer weitaus weniger spektakulären Aufgabe zuwenden: die Vorbereitung der theoretischen und politischen Bedingungen für eine Intervention, die die zukünftigen Klassenkämpfe beeinflusst.
Einleitung von Internationalisme
Unsere Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, die großen Probleme zu untersuchen, die die Notwendigkeit des Wiederaufbaus einer neuen revolutionären Arbeiterbewegung beinhalten. Wir müssen die Evolution der kapitalistischen Gesellschaft zum Staatskapitalismus und der alten Arbeiterbewegung berücksichtigen, die eine Zeit lang die kapitalistische Klasse unterstützten, um die Arbeiterklasse hinter diese zu scharen. Wir müssen ebenfalls untersuchen, wie und was aus dieser alten Arbeiterbewegung von der kapitalistischen Klasse für ihre Ziele genutzt werden kann. Darüber hinaus ist es unsere Aufgabe zu untersuchen, was seit dem Kommunistischen Manifest in der Arbeiterbewegung gültig geblieben ist und was ungültig wurde.
Es war für uns völlig normal, die Probleme zu untersuchen, die von der Revolution und vom Sozialismus gestellt werden. Dies vor Augen, hatten wir bereits eine Arbeit über den Staat nach der Revolution präsentiert und stellen heute die Studie über die Probleme der revolutionären Partei des Proletariates zur Diskussion.
Wir müssen uns bewusst sein, dass diese Frage eine der wichtigsten der revolutionären Arbeiterbewegung ist. Hier standen Marx und die Marxisten den Anarchisten, gewissen demokratisch-sozialistischen und der revolutionär-syndikalistischen Tendenzen gegenüber. Diese Frage stand im Zentrum der Bemühungen von Marx, der sich vor allem gegenüber verschiedenen Organismen kritisch verhielt, die sich „Arbeiterparteien“, „Sozialistische Parteien“, Internationale oder ähnlich genannt hatten. Obwohl er gelegentlich aktiv am Leben einiger dieser Organismen teilgenommen hatte, betrachtete er sie niemals als politische Gruppen, in denen, in Anbindung an einer Äußerung im Kommunistischen Manifest, Kommunisten sich als „Avantgarde des Proletariats“ ausdrücken konnten. Das Ziel der Kommunisten war es, die Aktivitäten dieser Organismen so weit wie möglich zu treiben und gleichzeitig sich jede Möglichkeit einer Kritik und autonomen Organisierung zu erhalten. Dann erfolgte anlässlich der von Lenin in Was tun? vorgestellten Ideen die Spaltung der sozialdemokratischen Partei Russlands in eine menschewistische und eine bolschewistische Tendenz. Es war dasselbe Problem, das unter den marxistischen Gruppen, die mit der Sozialdemokratie gebrochen hatten, die Rätekommunisten und die KAPD mit der Dritten Internationale entzweiten. Auch in den Divergenzen zwischen der Gruppe von Bordiga und Lenin über die Frage der „Einheitsfront“, die von Lenin und Trotzki vorbereitet und von der 3. Internationale angenommen wurde, ging es um diese Frage. Schlussendlich bleibt dasselbe Problem eine der Hauptmeinungsverschiedenheiten unter den verschiedenen Oppositionsgruppen, zwischen den "Trotzkisten" und den "Bordigisten"; und in der Tat war es ein Diskussionsthema in allen damaligen Gruppen.
Heute müssen wir eine kritische Untersuchung all dieser Ausdrücke der revolutionären Arbeiterbewegung machen. Wir hoffen, aus diesem Prozess - d.h. aus dem Ausdruck unterschiedlicher Denkrichtungen in dieser Frage - eine Strömung herauszuziehen, die unserer Ansicht nach den revolutionären Standpunkt am besten ausdrückt, um somit zu versuchen, das Problem für die zukünftige revolutionäre Arbeiterbewegung zu formulieren.
Wir müssen ebenfalls kritisch die Auffassungen untersuchen, die zur Organisationsfrage entwickelt wurden, um zu bestimmen, was im revolutionären Ausdruck des Proletariats bestehen bleibt, was überholt ist und welche neuen Probleme sich stellen.
Es ist klar, dass eine solche Arbeit nur dann Früchte tragen kann, wenn sie zwischen den Gruppen und innerhalb der Gruppen diskutiert wird, die eine neue revolutionäre Arbeiterbewegung wiederaufzubauen beabsichtigen.
Die Untersuchung, die wir heute vorstellen, ist also ein Beitrag zu dieser Diskussion, sie hat keine anderen Absichten, auch wenn sie in Thesen formuliert ist. Ihr Ziel ist vor allem, die Kritik und Diskussion zu stimulieren und nicht endgültige Lösungen anzubieten. Es ist eine Untersuchungsarbeit, die weniger auf Akzeptanz oder Ablehnung abzielt, sondern schlicht und einfach andere Arbeiten über diese Frage anregen will.
Das Hauptziel dieser Untersuchung ist die „Manifestation des revolutionären Bewusstseins“ im Proletariat. Doch es gibt eine Vielzahl von programmatischen Fragen, welche sich auf die Partei beziehen, die hier nur gestreift werden: organisatorische Probleme, Probleme des Verhältnisses zwischen der Partei und Organismen wie die Arbeiterräte, Probleme bezüglich der Haltung der Revolutionäre angesichts der Formierung etlicher Gruppen, die behaupten, DIE revolutionäre Partei zu sein, oder versuchen, eine solche aufzubauen, Probleme, die sich durch die Aufgaben vor und nach der Revolution ergeben, usw.
Daher sollten Militante, die verstehen, dass die Aufgabe der Stunde die Untersuchung dieser mannigfaltigen Probleme ist, aktiv in der Diskussion teilnehmen, entweder mit ihren eigenen Zeitschriften oder - für diejenigen, die zur Zeit nicht über solche Möglichkeiten verfügen - in diesem Bulletin.
Die entscheidende Rolle des Bewusstseins für die proletarische Revolution
1. Die Idee der Notwendigkeit eines politischen Organismus innerhalb des Proletariats scheint eine Errungenschaft in der sozialistischen Arbeiterbewegung zu sein.
Es ist wahr, dass die Anarchisten stets gegen den Begriff „politisch“ für diesen Organismus protestiert haben. Doch der Protest der Anarchisten gründete auf der Tatsache, dass sie den Begriff der politischen Aktion immer in einem sehr engen Sinne verstanden haben, war er doch für sie Synonym einer Aktion für gesetzliche Reformen: Beteiligung an den Wahlen und am bürgerlichen Parlament usw. Doch weder die Anarchisten noch irgendeine andere Strömung innerhalb der Arbeiterbewegung verneinten den Zusammenschluss der sozialistischen Revolutionäre in Assoziationen, die mittels Aktion und Propaganda die Aufgabe übernehmen, in den Arbeiterkämpfen zu intervenieren und sie zu orientieren. Und jede Gruppe, die sich die Aufgabe stellt, den sozialen Kämpfen eine Richtung zu verleihen, ist eine politische Gruppe.
In diesem Sinne ist der Ideenstreit um den politischen oder nicht-politischen Charakter dieser Organisationen nicht mehr als ein Wortgefecht, das im Grunde hinter allgemeinen Phrasen konkrete Divergenzen über die Orientierung, über die Ziele und die dazu notwendigen Mittel verbirgt. Mit anderen Worten: präzise politische Divergenzen.
Wenn heute neue Tendenzen aufkommen, die die Notwendigkeit einer politischen Organisation für das Proletariat in Frage stellen, so ist das eine Folge aus der Degeneration von Parteien, die einst Organisationen des Proletariats gewesen waren, und ihres Übertritts ins Lager des Kapitalismus: die Sozialistischen und Kommunistischen Parteien. Politische Begrifflichkeiten und politische Parteien leiden heute unter einer Diskreditierung, selbst im bürgerlichen Milieu. Doch was zu den erheblichen Schwächen geführt hat, ist nicht die Politik an sich, sondern eine BESTIMMTE Politik. Politik ist nichts anderes als die Orientierung, die sich die Menschen bei der Organisation ihres gesellschaftlichen Lebens geben. Von dieser Tätigkeit abzukehren bedeutet, jegliche Entschlossenheit aufzugeben, dem gesellschaftlichen Leben eine Orientierung zu geben und es folglich umzuwandeln. Es bedeutet, sich der Gesellschaft, so wie sie besteht, zu unterwerfen und sie zu akzeptieren.
2. Der Begriff der Klasse ist im Wesentlichen ein historisch-politischer Begriff und nicht lediglich eine ökonomische Klassifizierung. Ökonomisch sind alle Menschen Teil desselben Produktionssystems in einer gegebenen Periode. Die Teilung, die sich auf die unterschiedlichen Stellungen stützt, die die Menschen in demselben Produktions- und Verteilungssystem einnehmen und die den Rahmen dieses Systems nicht überschreiten, kann nicht zur Grundlage der historischen Notwendigkeit seiner Überwindung werden. Die Trennung in ökonomische Kategorien ist nur ein konstanter innerer Widerspruch, der sich mit diesem System entwickelt, doch sie bleibt innerhalb seiner Grenzen. Die historische Opposition ist sozusagen etwas Äußeres, in dem Sinne wie sie sich dem ganzen System entgegenstellt. Und diese Opposition verwirklicht sich in der Zerstörung des bestehenden Gesellschaftssystems und in dessen Ersatz durch ein anderes System, das auf einer neuen Produktionsweise basiert. Die Klasse ist die Personifizierung dieser historischen Opposition und gleichzeitig die gesellschaftliche, menschliche Kraft zu ihrer Verwirklichung.
Das Proletariat existiert als Klasse im vollen Sinne des Begriffs erst durch die Orientierung, die es seinen Kämpfen gibt, nicht im Hinblick auf eine Verbesserung seiner Lebensbedingungen innerhalb des kapitalistischen Systems, sondern durch seinen Widerstand gegen die bestehende Gesellschaftsordnung. Der Übergang von der Kategorie zur Klasse, von den ökonomischen Kämpfen zum politischen Kampf ist kein evolutionärer Prozess, keine kontinuierliche und inhärente Entwicklung, aus der eine historische Klassenopposition automatisch und natürlich entsteht, nachdem sie aus schon lange in der ökonomischen Stellung der Arbeiter enthalten war. Es gibt einen dialektischen Sprung von dem einen zum anderen. Er besteht in der Bewusstwerdung der historischen Notwendigkeit für das Verschwinden des kapitalistischen Systems. Diese historische Notwendigkeit fällt mit dem Streben des Proletariats nach Befreiung von seiner Ausbeutung zusammen und ist in ihm enthalten.
3. Alle gesellschaftlichen Transformationen in der Geschichte haben als bestimmende Grundlage die Tatsache gemeinsam, dass die Entwicklung der Produktivkräfte mit den restriktiven Strukturen der alten Gesellschaft unvereinbar geworden ist. Der Grund für den Zusammenbruch des Kapitalismus liegt in seiner Unfähigkeit begründet, die von ihm entwickelten Produktivkräfte weiterhin zu beherrschen. Dies ist auch die Bedingung und historische Berechtigung seiner Überwindung durch den Sozialismus.
Doch nebst dieser Bedingung bleiben die Unterschiede zwischen den vergangenen Revolutionen (die bürgerliche inbegriffen) und der sozialistischen Revolution entscheidend und erfordern eine vertiefte Untersuchung durch die revolutionäre Klasse.
Was die bürgerliche Revolution zum Beispiel angeht, so waren die Produktivkräfte, die mit dem Feudalismus unvereinbar geworden waren, immer noch in einem System eingebettet, das auf dem Privateigentum einer besitzenden Klasse basierte. Infolgedessen entwickelte der Kapitalismus seine ökonomische Basis langsam und für eine lange Zeit innerhalb der feudalen Welt. Die politische Revolution folgte den ökonomischen Tatsachen und segnete sie ab. Deshalb unterliegt die Bourgeoisie nicht der zwingenden Notwendigkeit eines Bewusstseins über ihre ökonomische und soziale Bewegung. Ihre Handlungen werden direkt ausgelöst durch den Druck der Gesetze der ökonomischen Entwicklung, die wie blinde Naturkräfte walten und ihren Willen bestimmen. Ihr Bewusstsein ist etwas Zweitrangiges, es kommt nach den Fakten. Es registriert die Ereignisse, statt ihnen eine Richtung zu verleihen. Die bürgerliche Revolution ist noch Teil der Vorgeschichte der Menschheit, in der die Produktivkräfte die Menschen noch dominieren.
Der Sozialismus basiert im Gegenteil dazu auf einer Entwicklung der Produktivkräfte, die unvereinbar sind mit jeglichem individuellen oder gesellschaftlichen Besitz einer Klasse. Daher kann sich der Sozialismus nicht auf ökonomische Fundamente innerhalb des Kapitalismus stützen. Die politische Revolution ist die erste Bedingung für eine sozialistische Orientierung der Ökonomie und der Gesellschaft. Aus diesem Grunde kann sich der Sozialismus nicht anders realisieren als durch das Bewusstsein über die Endziele der Bewegung, das Bewusstsein über die Mittel des Kampfes und den bewussten Willen zur Tat. Das sozialistische Bewusstsein geht der revolutionären Aktion der Klasse voraus und bestimmt sie. Die sozialistische Revolution ist der Beginn der Geschichte, in der die Menschheit berufen ist, die Produktivkräfte, die sie schon weit entwickelt hat, zu beherrschen, und diese Beherrschung ist exakt das Ziel, das sich die sozialistische Revolution setzt.
4. Aus diesem Grunde sind alle Versuche, den Sozialismus durch praktische Projekte innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft zu realisieren, durch die eigentliche Natur des Sozialismus zum Scheitern verurteilt. Der Sozialismus erfordert zeitlich eine fortgeschrittene Entwicklung der Produktivkräfte und räumlich die gesamte Erde: Seine Vorbedingung ist der bewusste Wille der Menschen. Experimentelle Vorzeigemodelle des Sozialismus innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft erreichen im besten Falle das Niveau einer Utopie. Sich auf diese Utopie zu fixieren führt dazu, den Kapitalismus zu konservieren und zu stärken. Sozialismus innerhalb des kapitalistischen Regimes kann nur ein theoretischer Ausdruck sein, seine Materialisierung kann nur die Form einer ideologischen Kraft annehmen, und seine Realisierung kann nur durch den revolutionären Kampf des Proletariats gegen die bestehende Gesellschaftsordnung vonstattengehen.
Und da die Existenz des Sozialismus sich zuallererst nur durch das sozialistische Bewusstsein ausdrücken kann, hat die Klasse, die es in sich trägt und verkörpert, nur durch dieses Bewusstsein eine historische Existenz. Die Bildung des Proletariats als historische Klasse ist nichts anderes als die Bildung seines sozialistischen Bewusstseins. Dies sind zwei Aspekte desselben historischen Prozesses, die getrennt undenkbar sind, da das eine ohne das andere nicht existieren kann.
Das sozialistische Bewusstsein entspringt nicht der ökonomischen Stellung der Arbeiter, es ist keine Widerspiegelung ihrer Bedingungen als Lohnabhängige. Aus diesem Grunde entwickelt sich das sozialistische Bewusstsein nicht simultan und spontan in den Köpfen der Arbeiter oder einzig und allein in ihren Köpfen. Der Sozialismus als Ideologie taucht separat von und parallel zu den ökonomischen Kämpfen der Arbeiter auf. Sie erzeugen einander nicht, obwohl sie sich gegenseitig beeinflussen. Beide sind in der historischen Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft verwurzelt.
Die Herausbildung der Klassenpartei in der Geschichte
5. Wenn die Arbeiter nur durch das sozialistische Bewusstsein zu einer „Klasse an sich und für sich“ werden (ein Ausdruck von Marx und Engels), so kann man sagen, dass der Prozess der Konstituierung der Klasse mit dem Prozess der Formierung von Gruppen von revolutionären sozialistischen Militanten identisch ist. Die Partei des Proletariats ist nicht eine Auswahl oder eine „Delegation“ der Klasse, sie ist die Existenz- und Lebensweise der Klasse selbst. Genauso wenig wie man die Materie außerhalb ihrer Bewegung begreifen kann, kann man die Klasse ohne ihre Neigung zur Bildung von politischen Organismen verstehen. „Die Organisation der Proletarier zur Klasse und damit zur politischen Partei“ (Kommunistisches Manifest) ist keine zufällige Formulierung, sondern sie drückt das fundierte Denken von Marx und Engels aus. Ein Jahrhundert an Erfahrung hat meisterlich die Gültigkeit bestätigt, den Begriff der Klasse in dieser Weise zu verstehen.
6. Das sozialistische Bewusstsein wird nicht durch spontane Entstehung erzeugt, sondern reproduziert sich ohne Unterbruch. Und wenn es einmal das Tageslicht erblickt hat, wird es in seinem Gegensatz zur existierenden kapitalistischen Welt zum aktiven Prinzip, das seine eigene Weiterentwicklung durch die Tat bestimmt und beschleunigt. Jedoch wird diese Entwicklung durch die Entwicklung der kapitalistischen Widersprüche geprägt und eingeschränkt. In diesem Sinne ist die These von Lenin über das Bewusstsein, das von der Partei in die Arbeiterklasse injiziert wird, sicherlich exakter als Rosas These über die spontane Entwicklung von Bewusstsein, das im Verlauf einer Bewegung erzeugt wird, die mit den ökonomischen Kämpfen beginnt und im revolutionären sozialistischen Kampf kulminiert. Die „Spontaneitäts“-These birgt trotz ihrer demokratischen Erscheinungsweise im Grunde genommen eine schematische Tendenz, einen rigorosen ökonomischen Determinismus in sich. Sie geht vom Verhältnis zwischen Ursprung und Wirkung aus: Das sozialistische Bewusstsein sei nichts anderes als ein Effekt, das Ergebnis einer vorangegangenen Bewegung, d.h. ökonomischer Kämpfe der Arbeiter. Das sozialistische Bewusstsein ist nach dieser Auffassung etwas grundsätzlich Passives im Verhältnis zu den ökonomischen Kämpfen, die den aktiven Faktor darstellen. Die Auffassung Lenins basiert auf dem sozialistischen Bewusstsein und der Partei, die ihren Charakter als ein wesentlicher aktiver Faktor und Prinzip materialisiert. Sie trennt die Partei nicht vom Leben und der Bewegung, sondern versteht sie als Teil davon.
7. Die grundsätzliche Schwierigkeit der sozialistischen Revolution liegt in dieser komplexen und widersprüchlichen Situation: Einerseits kann die Revolution nur durch die bewusste Tat der großen Mehrheit der Arbeiterklasse gemacht werden, andererseits trifft dieses Bewusstsein auf die Bedingungen, die der Kapitalismus für die Arbeiter schafft und die permanent das Bewusstsein der Arbeiter für ihre revolutionäre historische Mission behindern und zerstören. Diese Schwierigkeit kann niemals unabhängig von der historischen Situation, allein durch die theoretische Propaganda überwunden werden. Aber noch weniger als durch die reine Propaganda kann dieses Problem durch die ökonomischen Kämpfe der Arbeiter gelöst werden. Ihrer eigenen Entwicklung überlassen, können die Kämpfe der Arbeiter gegen die kapitalistische Ausbeutung allenfalls zur Explosion von Revolten führen, d.h. zu negativen Reaktionen, die jedoch vollkommen ungenügend sind für die positive Tat der gesellschaftlichen Transformation, die ihrerseits nur durch das Bewusstsein über die Endziele der Bewegung möglich ist. Dieser Faktor kann nur das politische Element der Klasse sein, das seine theoretische Substanz nicht aus den Eventualitäten und dem Partikularismus der ökonomischen Position der Arbeiter bezieht, sondern aus der Bewegung der Möglichkeiten und den historischen Notwendigkeiten. Nur die Intervention dieses Faktors erlaubt es der Klasse, von der Ebene der rein negativen Reaktion auf die der positiven Aktion zu gelangen, von der Revolte zur Revolution.
8. Aber es wäre absolut verfehlt, die Klasse durch diese Organismen, die Ausdruck des Bewusstseins und der Existenz der Klasse sind, zu ersetzen und die Klasse als eine formlose Masse zu betrachten, die dazu bestimmt ist, als Material für diese politischen Organismen zu dienen. Dies hieße, die revolutionäre Konzeption des Verhältnisses zwischen Sein und Bewusstsein und zwischen Partei und Klasse durch eine militaristische zu ersetzen. Die historische Funktion der Partei ist es nicht, ein Generalsstab zu sein, der die Aktionen einer Klasse anführt, die sowohl des Endziels als auch der unmittelbaren Ziele der Operationen unkundig ist. Dies hieße, ihre Bewegung als eine Summe von Manövern zu betrachten.
Die sozialistische Revolution ist in keiner Weise mit einer militärischen Aktion vergleichbar. Ihre Umsetzung hängt vom Bewusstsein der Arbeiter ab, das ihre Entscheide und Taten diktiert.
Die Partei handelt nicht anstelle der Klasse. Sie beansprucht nicht das „Vertrauen“ im bürgerlichen Sinne des Wortes, mit anderen Worten: sie will nicht das Schicksal und Los der Gesellschaft überantwortet bekommen. Ihre einzige historische Funktion ist es, so zu handeln, dass die Klasse sich das Bewusstsein über ihre Mission, die Ziele und die Mittel aneignen kann, die das Fundament für ihre revolutionäre Tat bilden.
9. So wie wir das Konzept der Partei als Generalstab bekämpfen müssen, der anstelle der Klasse handelt, müssen wir auch das andere Konzept ablehnen, das ausgehend davon, dass „die Befreiung der Arbeiter das Werk der Arbeiter selbst“ sein muss (Inauguraladresse der Ersten Internationale), jegliche Rolle der Militanten und der revolutionären Partei verneint. Unter dem sehr lobenswerten Vorwand, den Arbeitern nicht ihren Willen aufzwingen zu wollen, drücken sich diese Genossen vor ihrer Aufgabe und individuellen Verantwortung und verbannen die Revolutionäre ans hintere Ende der Arbeiterbewegung.
Erstere stellen sich außerhalb der Klasse, in dem sie sie negieren und an deren Stelle handeln, Letztere stellen sich nicht weniger außerhalb der Klasse, indem sie die eigentliche Funktion der Klassenorganisation, d.h. der Partei, verleugnen, die eigene Existenz als revolutionären Faktor verleugnen und sich selbst ausschließen, indem sie sich jegliche eigene Aktion verbieten.
10. Ein korrektes Verständnis der Bedingungen der sozialistischen Revolution muss von folgenden Elementen ausgehen und sie verkörpern:
a) Der Sozialismus ist nur deshalb eine Notwendigkeit, weil die Entwicklung, die die Produktivkräfte erreicht haben, nicht mehr vereinbar ist mit einer in Klassen gespaltenen Gesellschaft.
b) Diese Notwendigkeit kann nur durch den Willen und die bewusste Tat der unterdrückten Klasse Wirklichkeit werden, deren die gesellschaftliche Befreiung einhergeht mit der Befreiung der Menschheit von ihrer Entfremdung von den Produktivkräften, der sie bis anhin unterworfen war.
c) Der Sozialismus, der einerseits objektive Notwendigkeit und andererseits subjektiver Wille ist, kann sich letztendlich nur durch die bewusste revolutionäre Tat ausdrücken.
d) Die revolutionäre Tat ist undenkbar ohne revolutionäres Programm. Die Ausarbeitung des Programms ist ihrerseits untrennbar mit der Tat verbunden. Dies, weil die revolutionäre Partei ein „Körper der Lehre und ein Wille zur Tat“ ist (Bordiga), der die umfassendste Konkretisierung des sozialistischen Bewusstseins und das fundamentale Element zu dessen Realisierung ist.
11. Die Tendenz zur Konstituierung der Partei des Proletariats existiert seit der Geburt der kapitalistischen Gesellschaft. Aber solange die historischen Bedingungen für den Sozialismus nicht genügen entwickelt sind, bleiben die Ideen des Proletariats, wie die Entstehung der Partei, nur in einem embryonalen Stadium. Erst mit dem „Bund der Kommunisten“ tauchte zum ersten Mal diese vollendete Form einer politischen Organisation des Proletariats auf.
Wenn man die Entwicklung der Bildung der Klassenparteien näher betrachtet, sticht sofort die Tatsache ins Auge, dass die Organisierung in Parteien nicht in einem konstanten Fluss fortschreitet, sondern im Gegenteil Zeiten der großen Entwicklung kennt, die von Zeiten abgelöst werden, in denen die Partei verschwindet. Die organische Existenz der Partei hängt also nicht einzig vom Willen der Individuen ab, die diese bilden. Ihre Existenz wird von den objektiven Situationen bestimmt. Die Partei, grundlegend ein Organismus der revolutionären Tat der Klasse, kann nur in Situationen existieren, in denen die Klassenaktion sich entfaltet. Wenn die Bedingungen für die Klassenaktionen fehlen (wie in Zeiten wirtschaftlicher und politischer Stabilität des Kapitalismus oder in Folge entscheidender Niederlagen der Arbeiterkämpfe) kann die Partei nicht weiter existieren. Sie löst sich organisch auf, oder sie ist, um zu überleben, d.h. um Einfluss auszuüben, gezwungen, sich den neuen Bedingungen anzupassen, die die revolutionäre Tat ausschließen. So füllt sich die Partei unweigerlich mit einem neuen Inhalt. Sie wird reformistisch, das heißt, sie hört auf, Partei der Revolution zu sein.
Marx hat besser als die meisten die Bedingungen der Existenz der Partei verstanden. Zweimal unternahm er die Auflösung einer großen Organisation: Er sprach sich zuerst 1851 – nach der Niederlage der Revolution und dem Triumpf der Reaktion in Europa -, danach 1873 nach der Niederlage der Pariser Kommune ziemlich offen für die Parteiauflösung aus. Das erste Mal war es der Bund der Kommunisten, das zweite Mal die Erste Internationale.
Die Aufgabe der Stunde für die Revolutionäre
12. Die Erfahrung der Zweiten Internationale bestätigt die Unmöglichkeit für das Proletariat, seine Partei in einer länger anhaltenden Periode aufrechtzuerhalten, die von einer nicht-revolutionären Situation geprägt ist. Die Beteiligung der Parteien der Zweiten Internationale am imperialistischen Krieg von 1914 enthüllte nur die lange Korruption der Organisation. Die stets mögliche Durchlässigkeit der politischen Organisation des Proletariats für die Ideologie der herrschenden kapitalistischen Klasse kann in langen Perioden der Stagnation und des Rückflusses des Klassenkampfs einen solchen Umfang annehmen, dass die Ideologie der Bourgeoisie letztendlich die des Proletariats ersetzt, so dass die Partei zwangsläufig von all ihrem Klasseninhalt entleert und zum Instrument der feindlichen Klasse wird.
Die Geschichte der Kommunistischen Parteien der Dritten Internationale hat von neuem die Unmöglichkeit, die Partei in einer Zeit des revolutionären Rückflusses zu retten, und ihre unvermeidliche Degeneration in einer solchen Periode aufgezeigt.
13. Aus diesem Grunde sind Parteigründungen, wie die trotzkistische Internationale seit 1935 und die kürzlich erfolgte Gründung der Internationalistischen Kommunistischen Partei in Italien, nicht bloß willkürlich: Sie können darüber hinaus lediglich Unternehmungen der Konfusion und des Opportunismus sein. Anstatt Momente in der Bildung der zukünftigen Klassenpartei zu sein, sind diese Gebilde lediglich Hindernisse und durch ihren karikaturistischen Charakter eine Diskreditierung der Klassenpartei. Weit entfernt davon, die Reifung des Bewusstseins und eine Weiterentwicklung des alten Programms auszudrücken, das sie in Dogmen verwandelt haben, reproduzieren sie nur das alte Programm und sind Gefangene dieser Dogmen. Es ist nicht erstaunlich, wenn diese Gebilde die überholten und rückständigen Positionen der alten Partei übernehmen und diese noch verschlimmern, wie z.B. die Taktik des Parlamentarismus, die Arbeit in den Gewerkschaften usw.
14. Aber der Bruch in der organisatorischen Existenz der Partei bedeutet nicht einen Bruch in der Entwicklung der Klassenideologie. Die revolutionären Rückflüsse verkörpern in erster Linie die Unreife des revolutionären Programms. Die Niederlage ist das Signal für eine kritische Überprüfung der bisherigen programmatischen Positionen und für die Verpflichtung, auf der Grundlage der lebendigen Kampferfahrungen über sie hinaus zu gehen.
Diese positive, kritische Arbeit der programmatischen Weiterentwicklung wird von Organismen weitergeführt, die aus der alten Partei hervorgegangen sind. Sie bilden in der Phase des Rückflusses das aktive Element für die Bildung der zukünftigen Partei in einer neuen Periode des revolutionären Aufschwungs. Diese Organismen sind die linken Gruppen oder Fraktionen der Partei, die nach deren Auflösung oder ideologischen Entfremdung aus ihr hervorgegangen sind. Als da waren: die Fraktion von Marx in der Zeit nach der Auflösung des Bundes bis zur Bildung der Ersten Internationale, die linken Strömungen in der Zweiten Internationale (während des Ersten Weltkrieges), die die neuen Parteien und die Dritte Internationale 1919 gründeten; ebenfalls die linken Fraktionen und Gruppen, die die revolutionäre Arbeit nach der Degeneration der Dritten Internationale fortsetzten. Ihre Existenz und ihre Weiterentwicklung sind die Bedingung zur Bereicherung des Programms der Revolution und zur Neugründung der Partei von morgen.
15. Die alte Partei, einmal in den Dienst des Klassenfeindes übergetreten, hört definitiv auf, ein Milieu zu sein, in dem revolutionäres Gedankengut erarbeitet werden kann und in dem sich Militante des Proletariats formieren. Die Erwartung, dass Strömungen aus der Sozialdemokratie oder aus dem Stalinismus als Material für die Bildung der neuen Klassenpartei dienen könnten, bedeutet, das eigentliche Fundament des Parteigedankens zu ignorieren. Die Anhänglichkeit der Trotzkisten gegenüber den Parteien der Zweiten Internationale oder die verlogene Maulwurfsarbeit in diesen Parteien, mit dem Ziel, in diesem anti-proletarischen Milieu „revolutionäre“ Strömungen zu kultivieren, mit denen sie die neue Partei des Proletariates bilden wollen, demonstriert lediglich, dass sie selbst eine tote Strömung sind, ein Ausdruck der vergangenen Bewegung und nicht der Zukunft.
So wie die neue Partei der Revolution nicht auf der Basis eines durch die Ereignisse überholten Programms gebildet werden kann, kann sie auch nicht mit Elementen aufgebaut werden, die organisch an Organisationen gebunden bleiben, die nie mehr der Arbeiterklasse angehören werden.
16. Die Geschichte der Arbeiterbewegung kannte nie eine düsterere Periode und einen tieferen Rückfluss des revolutionären Bewusstseins als die Gegenwart. Wenn sich die ökonomische Ausbeutung der Arbeiter als absolut ungenügende Bedingung für die Aneignung des Bewusstseins über ihre historische Mission herausstellt, dann zeigt sich damit, dass die Aneignung dieses Bewusstseins viel schwieriger ist, als es sich die revolutionären Militanten bisher vorstellten. Vielleicht muss die Menschheit, damit sich das Proletariat erholen kann, durch die Hölle eines Dritten Weltkriegs gehen, mit all dem Horror einer Welt im Chaos, und das Proletariat fühlbar vor dem sehr handfesten Dilemma stehen: sterben oder sich durch die Revolution retten, damit es die Bedingungen hat, um sich selbst und sein Bewusstsein zu erholen.
17. Es ist nicht das Ziel dieser Thesen, die genauen Bedingungen herauszuarbeiten, die die Bewusstseinsentwicklung des Proletariats ermöglichen. Auch wollen wir nicht der Frage nachgehen, was die Bedingungen zur Bildung der Einheitsorganisationen sind, die sich das Proletariat für seinen revolutionären Kampf schaffen wird. Was wir auf der Grundlage der Erfahrungen der letzten dreißig Jahre kategorisch sagen können, ist, dass weder die ökonomischen Forderungen noch die ganze Palette der so genannten „demokratischen“ Forderungen (Parlamentarismus, Selbstbestimmungsrecht der Völker usw.), für die historische Tat des Proletariates von Nutzen ist. Was die Organisationsformen angeht, erscheint es noch klarer, dass es nicht die Gewerkschaften mit ihren vertikalen, berufsständischen und korporatistischen Strukturen sein können. All diese Organisationsformen gehören der Vergangenheit der Arbeiterbewegung an und werden ins Museum verbannt werden. Doch sie müssen auch in der Praxis abgeschafft und überwunden werden. Die neuen Organisationen werden einen Einheitscharakter haben, das heißt, den Großteil der Arbeiterklasse einbeziehen und die Trennung durch partikularistische, berufliche Interessen überwinden. Ihr Fundament ist die gesellschaftliche Ebene, ihre Struktur die Örtlichkeit. Die Arbeiterräte, wie sie ab 1917 in Russland und 1918 in Deutschland entstanden waren, sind der neue Typus der Einheitsorganisation der Klasse. In diesem Typus von Arbeiterräten und nicht in einer Auffrischung der Gewerkschaften werden die Arbeiter die geeignetste Form der Organisation finden.
Doch was auch immer die neuen Einheitsorganisationsformen der Klasse sind, sie ersetzen keineswegs die Notwenigkeit eines politischen Organismus, der die Partei ist, und auch nicht die entscheidende Rolle, die diese zu spielen hat. Die Partei bleibt der bewusste Teil der Klassenaktion. Sie ist die unabdingbare ideologische Antriebskraft für die revolutionäre Tat der Arbeiterklasse. In der gesellschaftlichen Aktion spielt sie eine vergleichbare Rolle wie die Energie in der Produktion. Der Wiederaufbau dieses Klassenorganismus hängt vom Erscheinen einer Tendenz innerhalb der Arbeiterklasse ab, mit der kapitalistischen Ideologie zu brechen und sich praktisch im Kampf gegen das bestehende System zu engagieren, wobei dieser Wiederaufbau gleichzeitig eine Bedingung für die Beschleunigung und Vertiefung dieses Kampfes und die entscheidende Bedingung für dessen Erfolg ist.
18. Das Fehlen der für den Aufbau der Partei erforderlichen Bedingungen in der heutigen Periode sollte nicht zum Schluss führen, dass jede unmittelbare Aktivität der revolutionären Militanten unnütz oder unmöglich ist. Der Militante hat nicht zu wählen wischen dem heiligen „Aktivismus“ des Parteiaufbaus und der individuellen Isolation, zwischen Abenteurertum und machtlosem Pessimismus, sondern er muss beide als dem revolutionären Geist gleichermaßen feindlich gesinnte Haltungen und als eine Gefahr für die Revolution bekämpfen. Wir müssen sowohl die voluntaristische Konzeption der militanten Aktion, die als alleiniger Faktor präsentiert wird, der die Klassenbewegung determiniert, als auch die schematische Parteiauffassung zurückweisen, die eine bloße passive Widerspiegelung der Bewegung ist. Militante müssen ihre Tätigkeit als ein Faktor verstehen, der im Zusammenspiel mit anderen Faktoren die Klassenaktion bedingt und bestimmt. Diese Auffassung verschafft das Fundament für die Notwendigkeit und den Wert der Aktivitäten des Militanten und setzt gleichzeitig die Grenzen seiner Möglichkeiten und seines Einflusses. Die Aktivitäten an die Bedingungen der gegenwärtigen Zeit anzupassen ist das einzige Mittel, diese Aktivitäten effizient und fruchtbar zu gestalten.
19. Der Versuch, die neue Klassenpartei trotz aller ungünstigen objektiven Umstände in aller Hast und um jeden Preis aufzubauen, entspringt einem voluntaristischen und infantilen Abenteurertum und einer falschen Einschätzung der Situation und ihrer unmittelbaren Perspektiven. Es ist schlussendlich eine völlige Unkenntnis über die Rolle der Partei und über das Verhältnis zwischen Partei und Klasse. Diese Versuche sind also fatalerweise zum Scheitern verurteilt; ihnen gelingt es bestenfalls lediglich, opportunistische Gruppierungen zu schaffen, die im Kielwasser der großen Parteien der Zweiten und Dritten Internationalen dümpeln. Ihre Existenz wird fortan allein durch die Entwicklung eines Geistes einer Kapelle und Sekte gerechtfertigt.
So sind alle diese Organisationen in ihrer positiven Einstellung durch ihren unmittelbaren „Aktivismus“ nicht nur gefangen in den Zahnrädern des Opportunismus, sie produzieren in ihrer negativen Einstellung einen kleinkrämerischen Geist, der für eine Sekte typisch ist, ein Kirchturmpatriotismus ,wie auch eine ängstliche und abergläubische Anhänglichkeit an „Führer“, eine Karikatur der größeren Organisationen, eine Vergötterung von Organisationsregeln und eine Unterwerfung unter eine „freiwillige“ Disziplin, die in umgekehrter Proportionalität zu den Zahlen, die sie repräsentieren, noch tyrannischer und intoleranter wird.
Durch diesen doppelseitigen Charakter führt die willkürliche und verfrühte Bildung der Partei zur Negation des Aufbaus des politischen Organismus der Klasse, zur Zerstörung der Kader und über kurz oder lang zum unweigerlichen Verlust von Militanten, die verbraucht, ausgezehrt, ins Nichts gefallen und völlig demoralisiert sind.
20. Das Verschwinden der Partei - sei es durch ihre Schrumpfung und ihre organisatorische Verlagerung, wie es bei der Ersten Internationale der Fall war, sei es durch den Übertritt in den Dienst des Kapitalismus, wie bei den Parteien der Zweiten und Dritten Internationale - drückte jeweils das Ende einer Periode von revolutionären Kämpfen des Proletariats aus. Das Verschwinden der Partei ist also unvermeidlich, und weder der Voluntarismus noch die Präsenz eines mehr oder weniger brillanten Führers kann dies vermeiden.
Marx und Engels haben zweimal erlebt, wie die Organisation des Proletariats, in deren Leben sie beide eine wichtige Rolle gespielt hatten, zerbrach und starb. Lenin und Luxemburg mussten ohnmächtig dem Verrat der großen sozialdemokratischen Parteien zuschauen. Trotski und Bordiga konnten die Degeneration der Kommunistischen Parteien und ihre Umwandlung in monströse Apparate des Kapitalismus, wie wir sie seither kennen, nicht aufhalten.
Diese Beispiele zeigen uns nicht, dass die Partei etwas Sinnloses ist, so wie es etwa eine oberflächliche und fatalistische Analyse behaupten würde, sondern nur dass die notwendige Klassenpartei nicht auf der Basis einer einheitlich geradlinigen und ansteigenden Linie existiert, dass ihre eigentliche Existenz nicht immer möglich ist und dass ihre Entwicklung und ihre Existenz in einem Zusammenhang und in enger Verbindung mit dem Klassenkampf des Proletariats steht, der sie hervorbringt und dessen Ausdruck sie ist. Daher hat der Kampf der revolutionären Militanten innerhalb der Partei im Verlauf ihrer Degeneration und vor ihrem Tod als Arbeiterpartei eine revolutionäre Bedeutung, aber nicht die vulgäre Bedeutung, die ihr von den verschiedenen trotzkistischen Oppositionen verliehen wurde. Für Letztere geht es darum, die Partei aufzurichten, und dafür durfte die Organisation und ihre Einheit nicht gefährdet werden. Es geht für sie darum, die Organisation in ihrer alten Pracht zu erhalten, auch wenn die objektiven Bedingungen dies nicht mehr erlauben und wenn die ursprüngliche Pracht der Organisation nur noch zum Preis einer konstanten und wachsenden Veränderung ihres revolutionären Klassencharakters aufrechterhalten konnte. Sie suchen in organisatorischen Maßnahmen nach Heilmitteln, um die Organisation zu retten, ohne zu verstehen, dass der organisatorische Zusammenbruch stets die Widerspiegelung einer Periode des revolutionären Rückflusses ist und oft die bessere Lösung als das Überleben darstellt. Was die Revolutionäre zu retten haben, ist nicht die Organisation, sondern ihre Klassenideologie, die mit der Organisation unterzugehen droht.
Wenn man die objektiven Gründe für den unvermeidlichen Verlusts der alten Partei nicht versteht, dann begreift man auch die Aufgabe der Militanten in dieser Periode nicht. Einige kommen zu dem Schluss, dass, weil es ihnen nicht gelungen war, die alte Klassenpartei zu schützen, es notwendig sei, geradewegs eine neue auf die Beine zu stellen. Ein solches Unverständnis kann, basierend auf einer voluntaristischen Konzeption der Partei, nur im Abenteurertum enden.
Eine richtige Analyse der Realität macht deutlich, dass der Tod der alten Partei exakt die Unmöglichkeit eines sofortigen Wiederaufbaus der Partei beinhaltet; sie bedeutet, dass die notwendigen Bedingungen für die Existenz jeglicher Partei, ob alte oder neue, gegenwärtig nicht existieren.
In einer solchen Periode können nur kleine revolutionäre Gruppen überleben, die die weniger organisatorische als ideologische Kontinuität sicherstellen. Diese Gruppen konzentrieren in sich die vergangenen Erfahrungen des Klassenkampfes und schaffen eine Verbindung zwischen den Parteien von gestern und jenen von morgen, zwischen dem Höhepunkt der Kämpfe und der Reifung des Klassenbewusstseins in einer Zeit des Aufschwungs sowie ihre Wiederauferstehung auf einer höheren Stufe in einer neuen Aufschwungperiode in der Zukunft. In diesen Gruppen lebt die Ideologie der Klasse fort durch die Selbstkritik ihrer Kämpfe, die kritische Überprüfung ihrer vergangenen Ideen, die Ausarbeitung ihres Programms, die Reifung ihres Bewusstseins und die Bildung neuer Kader, neuer Militanter für die nächste Stufe des revolutionären Sturmlaufs.
21. Die gegenwärtige Periode, in der wir leben, ist einerseits das Produkt der Niederlage der ersten großen revolutionären Welle des internationalen Proletariats, die den ersten imperialistischen Weltkrieg beendet hat und ihren Höhepunkt in der Oktoberrevolution von 1917 in Russland und der spartakistischen Bewegung von 1918-19 in Deutschland erreichte, und andererseits das Produkt einer tiefgreifenden Transformation in der polit- ökonomischen Struktur des Kapitalismus, der sich auf seine ultimative und dekadente Form hin entwickelt: den Staatskapitalismus. Überdies existiert ein dialektisches Verhältnis zwischen dieser Entwicklung des Kapitalismus und der Niederlage der Revolution.
Trotz ihres heroischen Kampfgeistes, trotz der permanenten und unüberwindbaren Krise des kapitalistischen Systems und der beispiellosen Verschlimmerung der Lebensbedingungen der Arbeiter, konnte die Arbeiterklasse und ihre Avantgarde der Gegenoffensive des Kapitalismus nicht die Stirn bieten. Sie standen nicht mehr dem klassischen Kapitalismus gegenüber und wurden von seinen Transformationen überrascht, die sie vor Probleme stellten, auf die sie weder theoretisch noch politisch vorbereitet waren. Das Proletariat und seine Avantgarde, die lange Zeit und häufig den Kapitalismus mit dem Privateigentum an Produktionsmitteln und den Sozialismus mit der Verstaatlichung gleichgesetzt hatten, wurden von den Tendenzen des modernen Kapitalismus zu staatlicher Konzentration und Wirtschaftsplanung verwirrt und desorientiert. Die große Mehrheit der Arbeiter wurde mit der Vorstellung zurückgelassen, dass diese Entwicklung eine neue gesellschaftliche Transformation vom Kapitalismus zum Sozialismus darstelle. Sie begannen diese Idee zu verinnerlichen, kehrten ihrer historischen Mission den Rücken und wurden die unerschütterlichsten Anhänger der kapitalistischen Gesellschaft.
Dies sind die historischen Gründe, die die gegenwärtige Physiognomie der Arbeiterklasse formen. So lange diese Bedingungen bestehen, solange die staatskapitalistische Ideologie die Köpfe der Arbeiterklasse dominieren, kann es nicht um den Wiederaufbau der Klassenpartei gehen. Nur durch den Verlauf der blutigen Katastrophen, die die Phase des Staatskapitalismus auszeichnen, wird das Proletariat den Unterschied zwischen dem befreienden Sozialismus und dem heutigen monströsen staatskapitalistischen Regime erkennen; nur so wird es eine wachsende Fähigkeit entwickeln, sich selbst von dieser Ideologie zu lösen, die es gegenwärtig und vernichtet. Nur dann wird der Weg wieder offen sein für „die Organisierung des Proletariats als Klasse und damit als politische Partei“. Diese Stufe wird umso schneller erreicht werden, wenn die revolutionären Kerne die notwendige theoretische Anstrengung unternommen haben, die benötigt werden, um auf die neuen Probleme, die durch den Staatskapitalismus gestellt werden, zu antworten und dem Proletariat helfen, seine Klassenlösung und die Mittel zu ihrer Durchsetzung zu finden.
22. In der gegenwärtigen Periode können die revolutionären Militanten nur durch die Bildung kleiner Gruppen überleben, die eine geduldige Propagandaarbeit in einem zwangsläufig limitierten Rahmen ausüben und gleichzeitig unermüdliche Anstrengungen der Untersuchung und theoretischen Klärung unternehmen.
Diese Gruppen werden ihre Aufgabe nur erfüllen können, wenn sie auf der Basis von Kriterien, die durch die Klassengrenzen bestimmt sind, national und international den Kontakt zu anderen Gruppen suchen. Nur diese Kontakte und ihre Vermehrung, mit dem Ziel, Positionen gegenüberzustellen und Probleme zu klären, ermöglichen es den Gruppen und Militanten, physisch und politisch dem schrecklichen Druck des Kapitalismus in der gegenwärtigen Periode zu widerstehen und einen echten Beitrag zum Emanzipationskampf des Proletariats zu leisten.
Die Partei von Morgen
23. Die Partei wird keine einfache Wiederholung der Partei von Gestern sein. Sie kann nicht nach dem alten Modell aus der Vergangenheit wiedererbaut werden. So wie ihr Programm, gründen sich auch ihre organische Struktur und das Verhältnis, das sie zwischen sich selbst und der Gesamtheit der Klasse etabliert hat, auf einer Synthese der vergangenen Erfahrungen und den neuen, fortgeschrittenen Bedingungen der gegenwärtigen Stufe. Die Partei folgt der Evolution des Klassenkampfes und entspricht auf jeder Stufe der Geschichte des Letzteren einer besonderen Form des politischen Organismus des Proletariats.
In den Anfängen des modernen Kapitalismus, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, unternahm die Arbeiterklasse, die sich noch in ihrer Phase der Konstituierung befand, sporadische und lokale Kämpfe und konnte nur doktrinäre Denkschulen, Sekten und Bündnisse hervorbringen. Der Bund der Kommunisten war der fortschrittlichste Ausdruck dieser Periode, während sein Kommunistisches Manifest mit dem Aufruf: „Proletarier aller Länder – Vereinigt Euch!“ bereits ein Vorbote der kommenden Periode war.
Die Erste Internationale entsprach dem wirkungsvollen Auftritt des Proletariats auf der Bühne der sozialen und politischen Kämpfe in den wichtigsten Ländern Europas. So sammelte sie alle organisierten Kräfte der Arbeiterklasse mit all ihren unterschiedlichen ideologischen Strömungen. Die erste Internationale brachte alle Strömungen und alle anfälligen Aspekte des Klassenkampfes zusammen: ökonomisch, erzieherisch, politisch und theoretisch. Sie war der Gipfel der Einheitsorganisation der Arbeiterklasse in all ihrer Vielfalt.
Die Zweite Internationale markierte eine Stufe der Differenzierung zwischen den ökonomischen Kämpfen der Lohnarbeiter und dem gesellschaftspolitischen Kampf. In dieser Periode, als die kapitalistische Gesellschaft in voller Blüte stand, war die Zweite Internationale die Organisation des Kampfes für Reformen und für politische Eroberungen für die politische Bestätigung des Proletariats. Gleichzeitig markierte sie eine höhere Stufe in der ideologischen Abgrenzung des Proletariats durch die Klärung und Erarbeitung der theoretischen Grundlagen seiner revolutionären historischen Mission.
Der Erste Weltkrieg offenbarte die historische Krise des Kapitalismus und leitete die Epoche seines Niedergangs ein. Die sozialistische Revolution entwickelte sich von der theoretischen Ebene zu einer praktischen Demonstration. In der Hitze der Ereignisse hat sich das Proletariat gewissermaßen gezwungen gesehen, in aller Eile seine revolutionäre Kampforganisation zu gründen. Der monumentale programmatische Beitrag der ersten Jahre der Dritten Internationale erwies sich dennoch als unzureichend, um den riesigen Problemen zu begegnen, die durch diese letzte Phase des Kapitalismus und durch die Aufgaben der revolutionären Transformation gestellt wurden. Gleichzeitig zeigten die lebendigen Erfahrungen schnell die allgemeine ideologische Unreife der gesamten Klasse. Angesichts dieser beiden Gefahren und unter dem Druck der Ereignisse, die sich in schneller Abfolge häuften, blieb der Dritten Internationale nichts anderes übrig, als mit organisatorischen Maßnahmen zu reagieren: eiserne Disziplin der Militanten, etc.
Dieser organisatorische Aspekt musste die Unvollständigkeit des Programms wettmachen und die Partei die Unreife der Klasse. Infolgedessen endete die Partei damit, die Klassenaktion selbst zu ersetzen, mit dem Resultat, dass sich die Vorstellungen über die Partei und ihr Verhältnis zur Klasse wandelten.
24. Auf der Grundlage dieser Erfahrungen wird die zukünftige Partei auf der Wiederherstellung dieser Wahrheit gegründet werden: Wenn es in der Revolution ein organisatorisches Problem gibt, so ist das kein Problem der Organisation selbst. Die Revolution ist in erster Linie ein ideologisches Problem der Reifung des Bewusstseins in den breiten Massen des Proletariats.
Keine Organisation und keine Partei kann die Klasse selbst ersetzten, und mehr denn je zuvor gilt: „Die Befreiung der Arbeiter kann nur das Werk der Arbeiter selbst sein.“ Die Partei, die die Kristallisierung des Klassenbewusstseins ist, ist weder unterschiedlich von noch synonym mit der Klasse. Die Klassenpartei bleibt zwangsläufig eine kleine Minderheit; sie hat keine Ambition, eine numerisch große Kraft zu sein. In keinem Moment kann sie sich von der lebendigen Tat der Klasse trennen, noch kann sie diese ersetzen. Ihre Funktion ist nach wie vor die ideologische Inspiration innerhalb der Bewegung und der Klassenaktion.
25. Während der aufständischen Periode der Revolution besteht die Rolle der Partei weder darin, die Macht für sich einzufordern, noch darin, die Massen aufzurufen, der Partei zu „vertrauen“. Sie interveniert und entfaltet ihre Aktivitäten zugunsten der Selbstorganisierung der Klasse, innerhalb derer sie den Triumph ihrer Prinzipien und der Mittel für die revolutionäre Tat anstrebt.
Die Mobilisierung der Klasse rund um die Partei, der sie die Führung „anvertraut“ oder die sie vielmehr in die Wüste schickt, ist ein Konzept, das einen Zustand der Unreife der Klasse widerspiegelt. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es für die Revolution unter solchen Umständen unmöglich ist, zu siegen, und schnell degeneriert, was in einer Trennung der Klasse und der Partei resultiert. Letztere sieht sich veranlasst, mehr und mehr zu Zwangsmethoden zu greifen, um sich gegen die Klasse selbst durchzusetzen, und endet als ein großes Hindernis gegen den Vormarsch der Revolution.
Die Partei ist keine Organisation der Leitung und Ausführung; diese Funktionen gehören zur Einheitsorganisation der Klasse. Falls Militante der Partei an diesen Funktionen teilnehmen, übernehmen sie diese Aufgaben als Mitglieder der größeren Gemeinschaft des Proletariats.
26. In der post-revolutionären Periode, in der Periode der Diktatur des Proletariats, wird die Partei nicht die Einheitspartei sein, wie es das klassische Markenzeichen totalitärer Regimes ist. Letztere wird charakterisiert durch ihre Identifikation mit und Assimilierung in der Staatsmacht, die ihnen das Monopol überträgt. Im Gegensatz dazu zeichnet sich die Klassenpartei des Proletariats dadurch aus, dass sie sich vom Staat unterscheidet, der ihre historische Antithese ist. Die totalitäre Einheitspartei tendiert dazu, sich aufzublähen und Millionen von Individuen zu einzuverleiben, was ein physisches Element ihrer Dominanz und Unterdrückung ist. Ganz im Gegenteil dazu bleibt die Partei des Proletariats von Natur aus eine strenge ideologische Auswahl, deren Militante keine materiellen oder sozialen Vorteile zu erlangen oder zu verteidigen haben. Ihr Privileg besteht lediglich darin, zu den klarsten Kämpfern zu gehören, der revolutionäre Sache am stärksten verpflichtet zu sein. So beabsichtigt die Partei nicht, eine große Anzahl von Militanten aufzunehmen, weil, wenn ihre Ideologie zur Ideologie größerer Massen wird, die Notwendigkeit für ihre eigene Existenz zu verschwinden tendiert und die Stunde ihre Auflösung geschlagen hat.
Das interne Regelwerk der Organisation
27. Die organisatorischen Regeln, die das interne Regelwerk der Partei begründen, sind genauso entscheidend wie ihr programmatischer Inhalt. Die vergangenen Erfahrungen, im speziellen die Erfahrungen der Parteien der Dritten Internationale, haben gezeigt, dass die Parteiauffassung aus einem einheitlichen Ganzen zusammensetzt. Organisationsregeln sind ein Aspekt und Ausdruck dieser Konzeption. Die Frage der Organisation ist nicht zu trennen von der Vorstellung, die man von der Rolle und Funktion der Partei und von ihrer Beziehung zur Klasse hat. Keine dieser Fragen existiert an sich, stattdessen bringen sie Elemente zusammen, die ein begründendes Element und Ausdruck des Ganzen sind.
Die Parteien der Dritten Internationale hatten die Regeln oder die innere Ordnung, die sie hatten, weil sie in einer Zeit der offensichtlichen Unreife der Klasse errichtet wurden, die zur Substitution durch die Partei statt der Klasse, zur Organisation statt zum Bewusstsein, zur Disziplin statt zur Überzeugung führte.
Die organisatorischen Regeln der zukünftigen Partei werden sich also auf einer sehr unterschiedlichen Konzeption der Rolle der Partei auf einer weitaus fortgeschritteneren Stufe des Kampfes stützen, basierend auf einer viel größeren ideologischen Reife der Klasse.
28. Die Frage des demokratischen oder organischen Zentralismus, die einen wichtigen Platz in der Dritten Internationale eingenommen hat, hat ihre Relevanz für die zukünftige Partei verloren. Als die Klassenaktion sich auf die Aktion der Partei verließ, musste die Frage der maximalen praktischen Effizienz zwangsläufig die Partei dominieren und konnte darüber hinaus nur Teillösungen anbieten.
Die Wirksamkeit der Aktion der Partei liegt nicht in der praktischen Tätigkeit der Führung und Ausführung, sondern in ihrer ideologischen Aktion. Folglich liegt die Stärke der Partei nicht in der Unterwerfung ihrer Militanten unter die Disziplin, sondern in ihren Kenntnissen, in ihrer größeren ideologischen Entwicklung und in ihrer festen Überzeugung.
Die Regeln der Organisation kommen nicht von abstrakten Auffassungen, die auf den Sockel immanenter oder unanfechtbarer Prinzipien gehoben werden, seien sie demokratisch oder zentralistisch. Solche Prinzipien sind ohne Bedeutung. Wenn mangels einer geeigneteren Methode die Regelung von Entscheidungen der („demokratischen“) Mehrheit aufrechterhalten bleiben muss, bedeutet das auf keinen Fall, dass die Mehrheit per Definition das Monopol auf die Wahrheit und die richtigen Positionen besitzt. Eine richtige Position rührt von der größten Kenntnis des Objektes, vom höchstmöglichen Realitätsbezug her.
Die internen Regeln der Organisation müssen also mit ihren Zielen und so mit der Rolle der Partei korrespondieren. Wie wichtig auch immer die Effizienz ihrer praktischen unmittelbaren Aktion sein mag, die die Grundlage bieten kann, um eine größere Disziplin auszuüben, sie bleibt dennoch weniger wichtig als das maximale Gedeihen der Ansichten seiner Militanten und ist folglich diesem untergeordnet.
So lange wie die Partei ein Schmelztiegels bleibt, in dem die Klassenideologie entwickelt und vertieft wird, darf ihr Leitprinzip nicht nur die größtmögliche Gedankenfreiheit und die Vielfalt an Meinungen im Rahmen der ihrer programmatischen Prinzipien sein: Eine noch größere Sorge sollte sein, pausenlos das Feuerwerk der Gedanken aufrechtzuerhalten und zu erleichtern, indem die Mittel zur Diskussion und Konfrontation von Ideen und Tendenzen innerhalb der Organisation gestellt werden.
29. Betrachten wir die Konzeption der Partei von diesem Standpunkt aus, so liegt ihr nichts ferner als die monströse Vorstellung einer homogenen, monolithischen oder monopolistischen Partei.
Die Existenz von Tendenzen und Fraktionen innerhalb der Partei ist nicht nur etwas, das toleriert werden sollte, ein Recht, das einem zusteht, und damit Gegenstand der Diskussion.
Ganz im Gegenteil, die Existenz von Strömungen innerhalb der Partei ist – im Rahmen der erworbenen und verifizierten Prinzipien – eine der Manifestationen einer gesunden Konzeption der Idee der Partei.
Marco. Juni 1948
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Erbe der kommunistischen Linke:
Rubric:
1914: Wie das Blutvergießen begann
- 3899 Aufrufe
2014: Ein Jahr des Vergessens
 Selbst heute ist der Krieg, der im August 1914 begann, als der Große Krieg bekannt, trotz der Tatsache, dass der Zweite Weltkrieg, der ihm 1939 folgte, mehr als doppelt so viele Menschen tötete, und trotz der Tatsache, dass die nicht enden wollenden Kriege seit 1945 für noch mehr Tote und Zerstörung als der II. Weltkrieg verantwortlich zeichnen.
Selbst heute ist der Krieg, der im August 1914 begann, als der Große Krieg bekannt, trotz der Tatsache, dass der Zweite Weltkrieg, der ihm 1939 folgte, mehr als doppelt so viele Menschen tötete, und trotz der Tatsache, dass die nicht enden wollenden Kriege seit 1945 für noch mehr Tote und Zerstörung als der II. Weltkrieg verantwortlich zeichnen.
Um zu verstehen, warum 1914–18 immer noch der „Große Krieg“ ist, muss man nur irgendein Dorf in Frankreich besuchen, und seien es die isoliertesten in seinen Alpenregionen, und die Namensaufrufe der Toten auf den Kriegsdenkmälern lesen: Ganze Familien stehen da – Brüder, Väter, Onkel, Söhne. Diese stummen Zeitzeugen des Schreckens stehen nicht nur in den Städten und Dörfern der europäischen Kriegsteilnehmer, sondern sogar auf der anderen Seite der Welt: Das Denkmal in der winzigen Siedlung von Ross auf der australischen Insel Tasmanien trägt die Namen von 16 Toten und 44 Überlebenden, vermutlich aus der Schlacht von Gallipoli. Der Menschheit war der Krieg nichts Fremdes, doch 1914 stürzte sie sich zum ersten Mal in einen Weltkrieg.
Für die beiden Generationen nach dem Krieg war 1914–18 das Synonym für sinnloses Gemetzel, angetrieben von der gefühllosen, blinden Dummheit einer herrschenden Klasse von Aristokraten und der zügellosen Habgier imperialistischer Kriegsgewinnler und Waffenproduzenten. Trotz aller offiziellen Zeremonien, des Ablegens von Kränzen und des Tragens von Mohnblumen am Gedenktag (wie in Großbritannien) ging diese Sicht auf den I. Weltkrieg in die Populärkultur der kriegführenden Nationen ein. In Frankreich hatte Gabriel Chevaliers autobiographischer Roman über das Leben in den Schützengräben, La Peur (Die Angst), 1930 veröffentlicht, solch einen enormen Erfolg, dass die Behörden kurzzeitig das Buch auf den Index setzten. 1937 wurde Jean Renoirs Antikriegsfilm La Grande Illusion (Die große Illusion) im Pariser Kino „Mariveaux“ ununterbrochen von 10 Uhr morgens bis zwei Uhr nachts gespielt; er schlug alle bisherigen Kassenrekorde, in New York wurde er 36 Wochen lang gespielt.[1]
Im Deutschland der 20er Jahre nahmen die satirischen Cartoons eines George Grosz die Generäle, Politiker und Profiteure aufs Korn, die sich am Krieg gütlich getan hatten. 1929 wurde das Buch des Kriegsveteranen Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues, veröffentlicht; 18 Monate später waren 2,5 Millionen Exemplare in 22 Sprachen verkauft; die Filmversion der Universal Studios 1930 war ein Riesenerfolg in den USA und gewann einen Oscar für den „Besten Film“.[2]
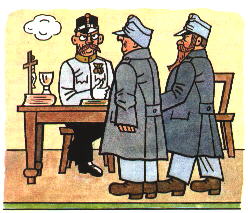 Einen der größten Antikriegsromane hinterließ das sich auflösende österreichisch-ungarische Habsburger Reich der Nachwelt: Jaroslav Hašeks Der brave Soldat Schwejk, 1923 veröffentlicht und seither in 58 Sprachen übersetzt – mehr als jedes andere tschechische Werk.
Einen der größten Antikriegsromane hinterließ das sich auflösende österreichisch-ungarische Habsburger Reich der Nachwelt: Jaroslav Hašeks Der brave Soldat Schwejk, 1923 veröffentlicht und seither in 58 Sprachen übersetzt – mehr als jedes andere tschechische Werk.
Der Abscheu in der Erinnerung an den 1. Weltkrieg überlebte das noch größere Blutvergießen des II. Weltkriegs. Verglichen mit den Schrecken von Auschwitz und Hiroshima verblasste die Barbarei des preußischen Militarismus und die zaristische Unterdrückung – ganz zu schweigen vom französischen und britischen Kolonialismus –, die die Rechtfertigung für den Krieg 1914 lieferten, nahezu bis zur Unkenntlichkeit, was das Gemetzel in den Schützengräben noch monströser und absurder machte: Der II. Weltkrieg konnte wenn nicht als ein „guter Krieg“, so doch wenigstens als ein gerechter und notwendiger Krieg dargestellt werden. Nirgendwo ist dieser Widerspruch deutlicher als in Großbritannien, wo eine Flut von Filmen über die Helden des „Guten Kriegs“ (Dambuster 1955, 633 Squadron 1964, etc.) in den 50er und 60er Jahren auf den Leinwänden erschien, während gleichzeitig 15-jährige SchülerInnen Antikriegs-Schriften von Poeten wie Wilfred Owen, Siegfried Sassoon und Robert Graves lesen mussten.[3] Die vielleicht schönste Komposition von Benjamin Britten, des bekanntesten britischen Komponisten des 20. Jahrhunderts, war sein War Requiem (1961), das Owens Poesie in Musik umsetzte, während 1969 zwei sehr unterschiedliche Filme die Kinoleinwände stürmten: Schlacht um England, ein patriotischer Streifen, und die böse Satire Oh what a lovely war! (O welch reizender Krieg), der es gelang, eine musikalische Anprangerung des Ersten Weltkriegs zu bewerkstelligen, indem Original-Soldatenlieder aus den Schützengräben benutzt wurden.
Zwei weitere Generationen später befinden wir uns am Vorabend des 100. Jahrestages des Kriegsausbruchs am 4. August 1914. Angesichts der symbolischen Bedeutung von runden Jahrestagen und mehr noch von Hundertjahrfeiern sind Vorbereitungen im Gange, um des Krieges zu gedenken („feiern“ ist vielleicht nicht das richtige Wort). In Großbritannien und Frankreich wurden Haushaltsmittel von zig Millionen Euros bzw. Pfund abgezweigt; in Deutschland sind aus offensichtlichen Gründen die Vorbereitungen diskreter und haben keinen offiziellen Segen durch die Regierung.[4]
„Wer die Musik bezahlt, bestimmt, was sie spielt“: Was also erhalten die herrschenden Klassen für die zig Millionen, die sie bewilligten, um „des Krieges zu gedenken“?
Ein Blick auf die Websites der für die Gedenkfeiern verantwortlichen Organisationen (in Frankreich eine spezielle Körperschaft, die von der Regierung aufgestellt wurde; in Großbritannien – angemessenerweise – das Imperial War Museum) und die Antwort scheint klar zu sein: Sie kaufen sich dafür eine der teuersten Nebelwände der Geschichte. In Großbritannien widmet sich das Imperial War Museum der Aufgabe, Geschichten von Individuen zusammenzubringen, die während des Krieges lebten, und sie in Podcasts zu verwandeln.[5] Die Website Centenary Project (1914.org) bietet solch wichtigen Vorkommnisse an wie z.B. die museale Zurschaustellung des „Revolvers von J.J.R. Tolkien im Ersten Weltkrieg“ (wir machen keine Witze – wahrscheinlich ist der Hintergedanke dabei, vom Erfolg der Verfilmung von Herr der Ringe zu profitieren) oder die Sammlung von „Bus Stories“ aus dem I. Weltkrieg durch das Londoner Verkehrsmuseum (ernsthaft!). Der BBC hat eine „bahnbrechende“ Dokumentation produziert: „Der Erste Weltkrieg von oben“ – Foto- und Filmmaterial, aufgenommen aus Flugzeugen oder Beobachtungsballons. Auch die Pazifisten kommen mit dem Gedenken an die Kriegsdienstverweigerer nicht zu kurz. Kurz, wir werden in einem Meer von Details und gar Belanglosigkeiten ertränkt. Laut des Generaldirektors des Imperial War Museum ist „unsere Ambition (…), dass viel mehr Leute verstehen werden, dass man die Welt von heute nicht begreifen kann, es sei denn, man versteht die Ursachen, den Verlauf und die Konsequenzen des Ersten Weltkrieges“[6], eine Aussage, der wir 100% zustimmen würden. Doch die Realität ist, dass alles Mögliche unternommen wurde – und der ehrenwerte Generaldirektor macht keine Ausnahme –, um uns daran zu hindern, diese Gründe und Konsequenzen zu verstehen.
In Frankreich verfasste die Hundertjahr-Website den unfehlbaren, offiziellen „Bericht an den Präsidenten über das Gedenken an den Großen Krieg“, datiert vom September 2011[7], der mit folgenden Worten aus der Rede General de Gaulles zum 50. Jahrestag im Jahr 1964 beginnt: „Am 2. August 1914 wurde die Mobilmachung verkündet, das ganze französische Volk stand geschlossen auf. Dies war niemals zuvor geschehen. Alle Regionen, alle Distrikte, alle Kategorien, alle Familien, alle Lebewesen machten mit einem Male gemeinsame Sache. Im Nu verschwanden alle politischen, sozialen, religiösen Streitereien, die das Land gespalten hatten. Von einem Ende der Nation bis zum anderen drückten Worte, Lieder, Tränen und vor allem die Ruhe eine einzige Entschlossenheit aus.“ Und in dem Bericht selbst lesen wir: „Auch wenn die Hundertjahrfeier unter unseren Zeitgenossen Grauen über das Massengemetzel und die immensen Opfer, die damals akzeptiert wurden, auslösen wird, so wird sie auch einen Schauder durch die französische Gesellschaft schicken und uns an die Einheit und den nationalen Zusammenhalt erinnern, die die Franzosen angesichts der Prüfung des I. Weltkrieges an den Tag legten.“ Es erscheint daher unwahrscheinlich, dass die herrschende Klasse Frankreichs beabsichtigt, uns irgendetwas über die brutale Polizeirepression gegen die Antikriegsdemonstration von ArbeiterInnen im Juli 1914 oder über die infame „Carnet B“ (eine Regierungsliste von sozialistischen und syndikalistischen anti-militaristischen Militanten, die zusammengetrieben und interniert bzw. bei Kriegsausbruch an die Front geschickt wurden – die Briten hatten ihr eigenes Äquivalent) mitzuteilen, gar nicht zu sprechen von den Umständen, unter denen der Antikriegs-Sozialist Jean Jaurès am Vorabend des Konfliktes ermordet wurde, oder von den Meutereien in den Schützengräben…[8]
Wie immer können die Propagandisten auf die Unterstützung der gelehrten Herren aus der akademischen Welt zählen, die sie mit Themen und Material für ihre Talkshows und TV-Sendungen versorgen. Wir möchten nur ein Beispiel nennen, das uns sinnbildlich erscheint: The Sleepwalkers von Christopher Clarke von der Cambridge Universität, dessen erste Auflage 2012 und dessen Taschenbuchauflage 2013 veröffentlicht wurde und das bereits ins Französische (Les Somnambules) und ins Deutsche (Die Schlafwandler) übersetzt wurde.[9] Clark ist ein schamloser Empiriker. Und seine Einleitung legt seine Absichten ganz offen dar: „Dieses Buch (…)befasst sich weniger damit, warum der Krieg geschah, sondern vielmehr damit, wie es dazu kam. Fragen nach dem Warum und dem Wie sind logischerweise nicht voneinander zu trennen, aber sie führen uns in unterschiedliche Richtungen. Die Frage nach dem Wie lädt uns dazu ein, näher auf die Abfolge von Wechselwirkungen zu schauen, die bestimmte Ergebnisse zeitigten. Im Gegensatz dazu lädt uns die Frage nach dem Warum dazu ein, uns auf die Suche nach entfernten und kategorischen Ursachen zu begeben: Imperialismus, Nationalismus, Rüstungen, Bündnisse, Hochfinanz, Ideen der nationalen Ehre, die Mechanismen der Mobilisierung.“ (eigene Übersetzung, d. Red.) Was auf Clarks Liste fehlt, ist der „Kapitalismus“. Konnte der Kapitalismus als solcher Krieg generieren? Konnte der Krieg nicht nur „Politik mit anderen Mitteln“ sein (um Clausewitz‘ berühmten Ausspruch zu benutzen), sondern der ultimative Ausdruck der Konkurrenz, die der kapitalistischen Produktionsweise innewohnt? Oh nein, nein, nein: Gott behüte! Clark macht sich schließlich daran, „die Fakten“ auf dem Weg in den Krieg vor uns auszubreiten, und dies tut er mit unerhörter Gelehrsamkeit und mit enormer Detailkenntnis, bis hin zur Farbe der Straußenfedern auf dem Helm des Erzherzogs Franz Ferdinand am Tage seiner Ermordung (sie waren grün). Wenn sich jemand die Mühe gemacht hätte, die Farbe der Unterwäsche des Attentäters Gavrilo Principe an jenem Tag zu notieren, sie stünde in diesem Buch.
Der Umfang des Buches, seine überwältigende Detailfülle macht ein riesiges Versäumnis noch auffälliger: Obwohl er ganze Abschnitte der „öffentlichen Meinung“ widmet, hat Clark nichts über den einen Teil der „öffentlichen Meinung“ zu sagen, der wirklich von Belang ist – die Stellung, die von der organisierten Arbeiterklasse eingenommen wurde. Clark zitiert ausführlich aus Zeitungen wie den Manchester Guardian, der Daily Mail oder Le Matin, lange nachdem sie verdientermaßen in die Versenkung verschwunden waren, aber nicht ein einziges Mal zitiert er den Vorwärts oder L’Humanité (die Presse der deutschen bzw. französischen sozialdemokratischen bzw. sozialistischen Parteien) oder La Vie Ouvrière, dem quasi-offiziellen Organ der französischen syndikalistischen CGT[10] oder ihre Bataille Syndicaliste. Dies waren keine unbedeutenden Publikationen: Der Vorwärts war nur eine von 91 Tageszeitungen der SPD, mit einer Gesamtauflage von 1,5 Millionen Exemplaren (im Vergleich dazu gibt die Daily Mail eine Auflage von 900.000 an)[11], und die SPD war die größte politische Partei in Deutschland. Clark erwähnt den Jenaer Parteitag der SPD 1905 und seine Weigerung, im Kriegsfall zum Generalstreik aufzurufen, aber die Antikriegs-Resolutionen auf den Kongressen der Sozialistischen Internationalen in Stuttgart (1907) und Basel (1912) bleiben unerwähnt. Der einzige Führer der SPD, der einer Erwähnung würdig ist, ist Albert Südekum, eine relativ unbedeutende Figur auf der Rechten der SPD, dem am 28. Juli mit seiner Beteuerung gegenüber dem deutschen Reichskanzler Bethmann-Hollweg, dass die SPD sich einem „Verteidigungskrieg“ nicht widersetzen werde, eine Nebenrolle zukam.
Über den Kampf zwischen der Linken und der Rechten in der sozialistischen und breiteren Arbeiterbewegung herrscht Stillschweigen. Über die politische Auseinandersetzung von Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Anton Pannekoek, Herman Gorter, Domela Nieuwenhuis, Wladimir Ilijitsch Lenin, Pierre Monatte und vielen anderen herrscht Schweigen. Über die Ermordung von Jean Jaurès herrscht Schweigen, Schweigen, Schweigen…
Es ist offenkundig, dass die Proletarier sich nicht wirklich auf die bürgerliche Geschichtsschreibung verlassen können, um die Ursachen und Konsequenzen des Großen Krieges zu verstehen. Wenden wir uns daher zwei herausragenden Mitstreitern der Arbeiterklasse zu: Rosa Luxemburg, wohl die beste Theoretikerin der deutschen Sozialdemokratie, und Alfred Rosmer, einem standhaften Kämpfer der französischen Vorkriegs-CGT. Insbesondere werden wir uns hier auf Luxemburgs Krise der Sozialdemokratie[12] (besser bekannt als „Junius-Broschüre“) und auf Rosmers Le mouvement ouvrier pendant la Première Guerre mondiale („Die Arbeiterbewegung während des Ersten Weltkrieges“)[13] beziehen. Die beiden Werke sind sehr unterschiedlich: Luxemburgs Broschüre wurde 1916 im Gefängnis geschrieben (kein privilegierter Zugang zu Bibliotheken und Regierungsarchiven für sie, um so beeindruckender die Kraft und Klarheit ihrer Analyse); der erste Band[14] von Rosmers Werk, wo er sich mit der Periode befasst, die zum Krieg führte, wurde 1936 veröffentlicht und ist die Frucht sowohl seines gewissenhaften Einsatzes für die historische Wahrheit als auch seiner leidenschaftlichen Verteidigung internationalistischer Prinzipien.
Der I. Weltkrieg: seine Bedeutung und seine Ursachen
Manche mögen sich fragen, ob dies noch wirklich von Belang ist. All dies geschah vor langer Zeit, die Welt hat sich verändert, was können wir wirklich aus diesen Schriften der Vergangenheit lernen?
Wir würden darauf antworten, dass es aus drei Gründen unerlässlich ist, den I. Weltkrieg zu begreifen.
Erstens weil der I. Weltkrieg eine neue historische Epoche eröffnete: Wir leben noch immer in einer Welt, die von den Konsequenzen jenes Krieges geprägt worden ist.
Zweitens weil die ihm zugrundeliegenden Ursachen immer noch sehr präsent und wirkkräftig sind: Es gibt eine allzu auffällige Parallele zwischen dem Aufstieg Deutschlands als neue imperialistische Macht vor 1914 und dem Aufstieg Chinas heute.
Schließlich – und möglicherweise am wichtigsten, weil genau dies die Regierungspropagandisten und die Historiker in der Tat vor uns verbergen möchten – weil es nur eine Kraft gibt, die dem imperialistischen Krieg ein Stoppzeichen setzen kann: die Weltarbeiterklasse. Wie Rosmer sagt: „… die Regierungen wussten sehr gut, dass sie das gefährliche Kriegsabenteuer – vor allem diesen Krieg – nicht unternehmen konnten, es sei denn, sie wussten praktisch die einmütige Unterstützung der öffentlichen Meinung und vor allem der Arbeiterklasse hinter sich; um sie zu erhalten, müssen sie täuschen, übertölpeln, irreführen, provozieren“.[15] Luxemburg zitiert die bekannten Worte des Reichskanzlers von Bülow, „daß man jetzt hauptsächlich aus Angst vor der Sozialdemokratie jeden Krieg möglichst hinauszuschieben trachte.“ Sie zitiert auch aus Bernhardis Vom heutigen Krieg: „Wo aber große, zusammenhängende Massen einmal der Führung aus der Hand gehen (…), da werden solche Massen nicht nur widerstandsunfähig gegen den Feind, sondern sie werden sich selbst und der eigenen Heeresleitung zur Gefahr werden, indem sie die Bande der Disziplin sprengen, den Gang der Operationen willkürlich stören und damit die Führung vor Aufgaben stellen, die sie zu lösen außerstande ist“. Und Luxemburg fährt fort: „So hielten bürgerliche Politiker wie militärische Autoritäten den Krieg mit den modernen Massenheeren für ein ‚gewagtes Spiel‘, und dies war das wirksamste Moment, um die heutigen Machthaber vor der Anzettelung der Kriege zurückzuhalten wie im Falle des Kriegsausbruchs auf dessen rasche Beendigung bedacht zu sein. Das Verhalten der Sozialdemokratie in diesem Kriege, das nach jeder Richtung dahin wirkt, um ‚die ungeheure Spannung‘ zu dämpfen, hat die Besorgnisse zerstreut, es hat die einzigen Dämme, die der ungehemmten Sturmflut des Militarismus entgegenstanden, niedergerissen (…) Und so fallen seit Monaten Tausende von Opfern, welche die Schlachtfelder bedecken, auf unser Gewissen“.[16]
Der Ausbruch des generalisierten, weltweiten imperialistischen Krieges (wir sprechen hier nicht über lokale Konflikte, auch nicht von wichtigen wie den Korea- oder Vietnamkrieg, sondern über die Massenmobilisierung des Proletariats im Herzen des Kapitalismus) wird von zwei einander widersprechenden Kräften bestimmt: das Streben zum Krieg, zu einer Neuaufteilung der Welt unter den imperialistischen Großmächten und der Kampf zur Verteidigung ihrer eigenen Existenz durch die Arbeiterklasse, die sowohl das Kanonenfutter als auch die industrielle Armee liefern muss, ohne die der moderne Krieg unmöglich ist. Die Krise der Sozialdemokratie und besonders ihrer mächtigsten Fraktion, der deutschen Sozialdemokratie – eine Krise, die systematisch von den geistlosen Historikern der akademischen Welt ignoriert wird -, ist somit der kritische Faktor, der den Krieg 1914 ermöglichte.
Wir werden in einem späteren Artikel dieser Reihe detaillierter darauf eingehen, doch hier schlagen wir vor, Luxemburgs Analyse der wechselnden imperialistischen Rivalitäten und Bündnisse aufzugreifen, die die Großmächte unaufhaltsam in das Blutbad 1914 hineindrängt hatten.
„Zwei Linien der Entwicklung in der jüngsten Geschichte führen schnurgerade zu dem heutigen Kriege. Eine leitet noch von der Periode der Konstituierung der sogenannten Nationalstaaten, d.h. der modernen kapitalistischen Staaten, vom Bismarckschen Kriege gegen Frankreich her. Der Krieg von 1870, der durch die Annexion Elsaß-Lothringens die französische Republik in die Arme Rußlands geworfen, die Spaltung Europas in zwei feindliche Lager und die Ära des wahnwitzigen Wettrüstens eröffnet hat, schleppte den ersten Zündstoff zum heutigen Weltbrande herbei (…)
So hat der Krieg von 1870 in seinem Gefolge die äußere politische Gruppierung Europas um die Achse des deutsch-französischen Gegensatzes wie die formale Herrschaft des Militarismus der Völker eingeleitet. Diese Herrschaft und jene Gruppierung hat die geschichtliche Entwicklung aber seitdem mit einem ganz neuen Inhalt gefüllt. Die zweite Linie, die im heutigen Weltkrieg mündet und die Marxens Prophezeiung[17] so glänzend bestätigt, führt von Vorgängen internationaler Natur her, die Marx nicht mehr erlebt hat: von der imperialistischen Entwicklung der letzten 25 Jahre.“[18]
Die letzten 30 Jahre des 19. Jahrhunderts erlebten also eine rapide Expansion des Kapitalismus in der ganzen Welt, aber auch das Entstehen eines neuen, dynamischen, expandierenden und selbstsicheren Kapitalismus im Herzen Europas: das Deutsche Reich, das ausgerufen wurde nach der Niederlage Frankreichs im preußisch-französischen Krieg 1871, in den Preußen als der lediglich stärkste einer Vielzahl von deutschen Zwergstaaten und Fürstentümer eintrat und aus dem es als die dominante Komponente eines neuen, vereinigten Deutschlands heraustrat. „… so konnte man voraussehen“, schreibt Luxemburg, „daß dieser junge, kraftstrotzende, von keinerlei Hemmung beschwerte Imperialismus, der auf die Weltbühne mit ungeheuren Appetiten trat, als die Welt bereits so gut wie verteilt war, sehr rasch zum unberechenbaren Faktor der allgemeinen Beunruhigung werden mußte.“ [19].
 Durch eine jener Eigenarten der Geschichte, die es uns erlauben, einen Wechsel in der historischen Dynamik durch ein einziges Datum zu symbolisieren, erlebte das Jahr 1898 drei Ereignisse, die solch einen Wechsel kennzeichnen.
Durch eine jener Eigenarten der Geschichte, die es uns erlauben, einen Wechsel in der historischen Dynamik durch ein einziges Datum zu symbolisieren, erlebte das Jahr 1898 drei Ereignisse, die solch einen Wechsel kennzeichnen.
Das erste war die „Faschoda-Krise“, einer Konfrontation zwischen britischen und französischen Truppen um die Kontrolle über den Sudan. Damals schien die Gefahr, dass Frankreich und Großbritannien wegen der Kontrolle über Ägypten und den Suez-Kanal und über die Frage, wer die Vorherrschaft in Afrika ausübt, in den Krieg treten, real zu sein. Stattdessen endete die Krise mit einer Verbesserung der britisch-französischen Beziehungen, die in der „Entente Cordiale“ 1904 formalisiert wurden, und in einer wachsenden Neigung Großbritanniens, Frankreich gegen Deutschland zu stützen, das beide als eine Bedrohung ansahen. Die beiden „Marokko-Krisen“ 1905 und 1911[20] zeigten, dass fortan Großbritannien deutsche Ambitionen in Nordafrika blockieren würde (auch wenn es bereit war, Deutschland einige Leckerbissen zu überlassen wie Portugals Kolonialbesitztümer).
Das zweite Ereignis war Deutschlands Besitzergreifung vom chinesischen Hafen Tsingtao (heute: Qingdao),[21] die Deutschlands Ankunft auf der imperialistischen Bühne als eine Macht mit weltweiten, nicht bloß europäischen Aspirationen – Weltpolitik, wie es damals in Deutschland genannt wurde – ankündigte.
Passenderweise war 1898 das Todesjahr von Otto von Bismarck, dem großen Kanzler, der Deutschland durch die Vereinigung und rapide Industrialisierung geleitet hat. Bismarck hat stets den Kolonialismus und den Flottenbau abgelehnt, seine Außenpolitik trug primär dafür Sorge, das Aufkommen von anti-deutschen Bündnissen unter anderen europäischen Mächten zu verhindern, die Deutschland den Aufstieg missgönnten – oder sich davor fürchteten. Doch zurzeit der Jahrhundertwende war Deutschland zu einer erstklassigen Industriemacht mit entsprechenden erstklassigen Ambitionen geworden, die nur von den USA übertroffen wurde. Luxemburg zitiert schließlich Außenminister von Bülow am 11. Dezember 1899: „Wenn die Engländer von einem Greater Britain (größeren Britannien – R.L.), wenn die Franzosen von einem Nouvelle France (neuen Frankreich – R.L.) reden, wenn die Russen sich Asien erschließen, haben auch wir Anspruch auf ein größeres Deutschland (…) Wenn wir nicht eine Flotte schaffen, welche genügt (…), unseren Handel und unsere Landsleute in der Fremde, unsere Missionen und die Sicherheit unserer Küsten zu schützen, so gefährden wir die vitalsten Interessen des Landes (…) In dem kommenden Jahrhundert wird das deutsche Volk Hammer oder Amboß sein.“ (Hervorhebungen von R.L.) Und sie kommentiert: „Streift man die Redefloskeln von dem Küstenschutz, den Missionen und dem Handel ab, so bleibt das lapidare Programm: größeres Deutschland, Politik des Hammers für andere Völker.“
Anfang des 20. Jahrhunderts bedeutete Weltpolitik eine erstklassige Flotte zu haben. Wie Luxemburg sehr deutlich betont, hatte Deutschland keinen unmittelbaren wirtschaftlichen Bedarf für eine Flotte: Niemand plante, Besitz von seinen Kolonien in China oder Afrika zu ergreifen. Eine Flotte war vor allen Dingen eine Angelegenheit des Prestiges: Um seine Expansion fortzusetzen, musste Deutschland als ernsthafter Mitspieler anerkannt sein, als eine Macht, mit der gerechnet werden muss, und dafür war eine „erstklassige aggressive Flotte“ eine Notwendigkeit. In Luxemburgs unvergesslichen Worten war es eine „Herausforderung nicht bloß an die deutsche Arbeiterklasse, sondern an die übrigen kapitalistischen Staaten, eine gegen niemand im besonderen, aber gegen alle insgesamt ausgestreckte geballte Faust.“
Die Parallele zwischen dem Aufstieg Deutschlands an der Wende zwischen dem 19. und dem 20. Jahrhundert und dem Aufstieg Chinas 100 Jahre später ist offensichtlich. Wie Bismarck ging es Deng Xiao ping mit seiner Außenpolitik größtenteils darum zu vermeiden, dass Chinas Nachbarn und der Welthegemon, die Vereinigten Staaten, auf den Plan gerufen werden. Doch mit seinem Aufstieg zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht erfordert Chinas Prestige zumindest die Fähigkeit, seine maritimen Grenzen zu kontrollieren und seine Seewege zu schützen: daher die Aufrüstung seiner Flotte, der Aufbau einer U-Boot-Flotte und der Bau eines Flugzeugträgers sowie die jüngste Ausrufung einer „Flugüberwachungszone“ über dem Senkaku/Diaoyu-Eiland.
Die Parallele zwischen Deutschland 1914 und China heute ist natürlich nicht identisch, und dies besonders aus zwei Gründen: Erstens war Deutschland Anfang des 20. Jahrhunderts nicht nur die zweitgrößte Industriemacht in der Welt nach den Vereinigten Staaten, es stand auch an der Spitze des technischen Fortschritts und der Innovation (wie dies zum Beispiel an der Zahl deutscher Nobelpreisgewinner und deutscher Innovationen in der Stahl-, Elektro- und Chemieindustrie ermessen werden kann); zweitens konnte Deutschland seine Militärmacht global ausrichten, wie es China nicht kann, zumindest noch nicht.
Und so wie die Vereinigten Staaten heute der Bedrohung ihres eigenen Prestiges und der Sicherheit ihrer Verbündeten (Japan, Südkorea und die Philippinen insbesondere) durch China begegnen müssen, so konnte Großbritannien Deutschlands Flottenbau nur als eine Bedrohung ansehen, noch dazu als eine Bedrohung, die sich gegen die Lebensader der Kanalschifffahrt und gegen seine Küstenverteidigung richtete.[22]
Was immer seine Flottenambitionen waren, die natürliche Expansionsrichtung einer Landmacht wie Deutschland ging nach Osten und besonders zum verfallenden Osmanischen Reich; dies traf um so mehr zu, als seine Ambitionen in Afrika und im westlichen Mittelmeerraum von den Briten und Franzosen blockiert wurden. Geld und Militarismus gingen Hand in Hand, als deutsches Kapital in die Türkei floss[23] und um mehr Ellbogenfreiheit gegenüber seinen französischen und britischen Konkurrenten kämpfte. Ein großer Anteil dieses deutschen Kapitals ging drauf für die Finanzierung der Bagdad-Bahn: Diese war eigentlich ein Liniennetz, das Berlin mit Konstantinopel und schließlich mit dem Süden Anatoliens, mit Syrien und Bagdad, aber auch mit Palästina, dem Hidjas und Mekka verbinden sollte. Zu einer Zeit, in der Truppenbewegungen von Eisenbahnen abhingen, würde dies einer türkischen Armee ermöglichen, Truppen, ausgerüstet mit deutschen Waffen und ausgebildet von deutschen Instrukteuren, mithilfe der Eisenbahn zu mobilisieren, um sowohl die britische Ölraffinerie in Abadan (Persien)[24] als auch die britische Kontrolle über Ägypten und den Suezkanal zu bedrohen: Auch hier gab es eine direkte deutsche Bedrohung gegen vitale strategische Interessen Großbritanniens. Im weitaus größten Teil des 19. Jahrhunderts ging die größte Bedrohung der Sicherheit des britischen Empires von der russischen Expansion nach Zentralasien aus, die bis an die Grenzen Persiens reichte und eine Gefahr für Indien darstellte; durch Russlands Niederlage gegen Japan im Jahr 1905 hatten seine östlichen Ambitionen jedoch einen derartigen Dämpfer erlitten, dass – zumindest eine Zeitlang – die Streitigkeiten zwischen den beiden Ländern in Persien, Afghanistan und Tibet in einer anglo-russischen Konvention 1907 bereinigt wurden. Nun war Deutschland der Rivale, dem es entgegenzutreten galt.
Die deutsche Ostpolitik hatte notwendigerweise ein strategisches Interesse am Balkan, am Bosporus und an den Dardanellen. Die Tatsache, dass die Route der Eisenbahnverbindung Berlin-Konstantinopel durch Wien und Belgrad geplant war, machte die Kontrolle über Serbien oder zumindest die serbische Neutralität zu einer Angelegenheit großer strategischer Bedeutung für Deutschland. Dies konnte umgekehrt nur zu einem Konflikt mit einem Land führen, das zu Bismarcks Zeiten eine Bastion der autokratischen Reaktion und Solidarität und daher ein unerschütterlicher Verbündeter Preußens und des Deutschen Reiches war: Russland.
Spätestens mit der Herrschaft von Katharina der Großen hatte sich Russland (in den 1770er Jahren) als Vormacht an der Schwarzmeerküste etabliert und die Osmanen ersetzt. Die immer wichtigere Bedeutung des Handels über das Schwarze Meer für die russische Industrie und Landwirtschaft stand und fiel mit der freien Passage durch den Bosporus, der von Konstantinopel kontrolliert wurde. Russlands Ambitionen reichten bis zu den Dardanellen und der Kontrolle des Seeverkehrs zwischen dem Schwarzen Meer und dem Mittelmeer (Russlands Absichten hinsichtlich der Dardanellen hatten 1853 bereits zu einem Krieg mit Großbritannien und Frankreich auf der Krim geführt). Luxemburg fasst die Dynamiken in der russischen Gesellschaft zusammen, die die imperialistische Politik Russlands antreiben: „Einerseits äußert sich in den Eroberungstendenzen des Zarentums die traditionelle Expansion des gewaltigen Reichs, dessen Bevölkerung heute 170 Millionen Menschen umfaßt und das aus wirtschaftlichen wie strategischen Gründen den Zutritt zum freien Weltmeer, zum Stillen Ozean im Osten, zum Mittelmeer im Süden, zu erlangen sucht. Andererseits spricht hier das Lebensinteresse des Absolutismus mit, die Notwendigkeit, in dem allgemeinen Wettlauf der Großstaaten auf weltpolitischem Felde eine achtungsgebietende Stellung zu behaupten, um sich den finanziellen Kredit im kapitalistischen Auslande zu sichern, ohne den der Zarismus absolut nicht existenzfähig ist (…) Allein auch moderne bürgerliche Interessen kommen immer mehr als Faktor des Imperialismus im Zarenreich in Betracht. Der junge russische Kapitalismus, der unter dem absolutistischen Regime natürlich nicht voll zur Entfaltung gelangen und in großen und ganzen nicht aus dem Stadium des primitiven Raubsystems herauskommen kann, sieht jedoch bei den unermeßlichen Hilfsquellen des Riesenreiches eine gewaltige Zukunft vor sich (…) Es sind die Ahnung dieser Zukunft und die Akkumulationsappetite sozusagen auf Vorschuß, die die russische Bourgeoisie mit einem sehr ausgeprägten imperialistischen Drang erfüllten und bei der Weltverteilung mit Eifer ihre Ansprüche melden lassen.“.[25] Die Rivalität zwischen Deutschland und Russland in der Frage der Kontrolle über den Bosporus stand also unvermeidlich in einem Zusammenhang mit dem Balkan, wo der Aufstieg nationalistischer Ideologien, charakteristisch für den sich entwickelnden Kapitalismus, eine Situation permanenter Spannungen und zeitweiliger blutiger Konflikte zwischen den drei neuen Staaten geschaffen hat, die vom niedergehenden osmanischen Reich abgefallen waren: Griechenland, Bulgarien und Serbien. Diese drei Länder führten den ersten Balkan-Krieg als Verbündete gegen die Osmanen, dann den Zweiten Balkan-Krieg untereinander, um die Beute aus dem Ersten, besonders in Mazedonien und Albanien, neu aufzuteilen.[26]
Der Aufstieg aggressiver neuer Nationen auf dem Balkan konnten der anderen verfallenden Dynastie in dieser Region nicht gleichgültig bleiben: dem Habsburger Reich, das „nicht die politische Organisation eines bürgerlichen Staates, sondern bloß ein lockeres Syndikat einiger Cliquen gesellschaftlicher Parasiten ist, die mit vollen Händen unter Ausnutzung der staatlichen Machtmittel raffen wollen, solange der morsche Bau der Monarchie noch hält“.[27] So konstituiert, stand das Habsburger Reich unter ständiger Bedrohung durch die aufstrebenden neuen Nationen um sich herum; alle von ihnen teilten ethnische Bevölkerungsteile mit dem Habsburgerreich: daher die österreichisch-ungarische Annexion Bosnien-Herzegowinas, die der ständigen Sorge entsprang, Serbien daran zu hindern, Zugang zum Mittelmeer zu erlangen.
Um 1914 hatte sich die Situation in Europa zu einem tödlichen Zauberwürfel entwickelt, dessen verschiedene Teile derart ineinander verschränkt waren, dass die Bewegung eines Teils auch alle anderen Teile verschob.
Die hellwachen Schlafwandler
Bedeutet dies, dass die herrschende Klasse, dass die Regierungen nicht wussten, was sie taten? Dass sie – wie der Titel von Christopher Clarks Buch Die Schlafwandler andeutet – irgendwie in den Krieg hineinschlitterten, dass der I. Weltkrieg nur ein fürchterlicher Fehler war?
Pustekuchen! Sicherlich hielten die historischen Kräfte, die Luxemburg in der wahrscheinlich profundesten Analyse des Kriegsausbruchs, die je geschrieben wurde, schilderte, die Gesellschaft fest in ihrem Griff: In diesem Sinn war der Krieg das unvermeidliche Resultat der miteinander verzahnten imperialistischen Rivalitäten. Doch historische Situationen rufen die Menschen hervor, die sich mit ihnen messen, und die Regierungen, die Europa und die Welt in den Krieg zogen, wussten allzu gut, was sie taten; sie taten es bewusst. Die Jahre zwischen der Jahrhundertwende und dem Kriegsausbruch war von wiederholter Kriegshysterie gekennzeichnet, die von Mal zu Mal schlimmer wurde: die Tanger-Krise 1905, der Agadir-Zwischenfall 1911, der erste und zweite Balkan-Krieg. Jeder dieser Zwischenfälle ließ die Pro-Kriegsfraktion aller herrschenden Klassen mehr in den Vordergrund treten und verstärkte das Gefühl, dass der Krieg unvermeidlich sei. Das Ergebnis war ein irrsinniges Wettrüsten: Deutschland setzte sein Flottenbau-Programm in Gang, und die Briten folgten dem Beispiel; Frankreich verlängerte die Dauer des Militärdienstes auf drei Jahre; riesige französische Anleihen finanzierten die Modernisierung der russischen Eisenbahnen, die dazu bestimmt waren, Truppen zur Westfront zu transportieren, genauso wie die Modernisierung der kleinen, aber effektiven Armee Serbiens. Alle Kontinentalmächte erhöhte die Anzahl der unter Waffen stehenden Männer.
In zunehmendem Maße davon überzeugt, dass der Krieg unvermeidlich sei, ging es für die Regierungen Europas nur noch um das „Wann“. Wann war die militärische Bereitschaft der Nation, verglichen mit ihren Rivalen, auf ihrem höchsten Stand? War doch dieser Moment der „richtige“ Augenblick für den Krieg.
Wenn Luxemburg im aufstrebenden Deutschland den neuen „von keinerlei Hemmung beschwerte(n) Imperialismus“ in der europäischen Gemengelage erblickte, bedeutete dies, dass die Mächte der Dreier-Entente (Großbritannien, Frankreich, Russland) die unschuldigen Opfer der expansionistischen Aggression Deutschlands waren? Dies ist die These von gewissen „revisionistischen“ Historikern heute: Nicht nur dass der Kampf gegen den deutschen Expansionismus 1914 gerechtfertigt wurde, auch wurde im Kern 1914 als der Vorläufer des „guten Krieges“ 1939 betrachtet. Dies ist zweifellos der Fall, doch die Dreier-Entente war alles andere als ein unschuldiges Opfer, und der Gedanke, dass Deutschland allein „expansionistisch“ und „aggressiv“ war, ist lachhaft, wenn wir die Größe des britischen Empires – das Resultat einer aggressiven britischen Expansion – mit jener Deutschlands vergleichen: Irgendwie scheint dies nicht in die Köpfe geistloser britischer Historiker zu gehen.[28]
In der Tat hatte die Dreier-Entente jahrelang eine Politik der Umzingelung Deutschlands betrieben (so wie die USA eine Umzingelungspolitik gegenüber der UdSSR während des Kalten Krieges betrieben hatten und nun dasselbe gegenüber China heute versuchen). Rosmer demonstrierte dies mit kompromissloser Klarheit auf der Grundlage der geheimen diplomatischen Korrespondenz unter den belgischen Botschaftern in den verschiedenen europäischen Hauptstädten.[29]
Im Mai 1907 schreibt der Botschafter in London: „Es liegt auf der Hand, dass das offizielle Großbritannien eine hinterlistige und feindliche Politik verfolgt, die auf die Isolation Deutschlands abzielt, und dass König Edward (d.h. Edward VII.) ohne Zögern seinen eigenen persönlichen Einfluss zugunsten dieser Idee in die Waagschale geworfen hat.“[30] im Februar 1909 lässt der Botschafter in Berlin verlauten: „Der König von England beteuert, dass die Bewahrung des Friedens stets sein Ziel gewesen sei; er hat dies mehrfach wiederholt, seit er seinen erfolgreichen Feldzug begonnen hatte, Deutschland zu isolieren; doch kommt man nicht umhin zu bemerken, dass der Weltfrieden sich niemals in größerer Gefahr befand, seitdem der König von England sich anschickte, ihn zu verteidigen.“[31] Auch im April 1913 vernehmen wir aus Berlin: „… die Arroganz und Geringschätzung, mit denen (die Serben) die Proteste der Regierung in Wien aufnehmen, können nur mit der Unterstützung erklärt werden, die sie von St. Petersburg erwarten. Der serbische diplomatische Geschäftsträger sagte hier jüngst, dass seine Regierung niemals ein solches Risiko auf sich nehmen würde, von Österreichs Drohungen keine Notiz zu nehmen, wenn sie nicht vom russischen Botschafter, Herrn Hartwig, ermutigt worden wäre…“[32]
In Frankreich wurde dem belgischen Botschafter in Paris (Januar 1914) die bewusste Entwicklung einer aggressiven chauvinistischen Politik völlig klar: „Ich hatte bereits die Ehre gehabt, Sie darüber zu informieren, dass es die Herren Poincaré, Delcassé, Millerand und ihre Freunde sind, die die nationalistische, hurrapatriotische und chauvinistische Politik erfunden hatten, deren Wiedergeburt wir heute erblicken (…) Ich sehe hier die größte Gefahr für den europäischen Frieden (…), weil die von der Barthou-Regierung eingenommene Haltung in meiner Auffassung der ausschlaggebende Grund für die zunehmend militaristischen Tendenzen in Deutschland ist.“[33]
Die Wiedereinführung des dreijährigen Militärdienstes in Frankreich war keine Verteidigungspolitik, sondern eine vorsätzliche Kriegsvorbereitung. Hier noch einmal der Botschafter in Paris (Juni 1913): „Die Kosten des neuen Gesetzes werden so schwer auf der Bevölkerung liegen, die daraus resultierenden Ausgaben so exorbitant sein, dass das Land bald protestieren wird, und Frankreich wird mit dem Dilemma konfrontiert sein: entweder ein Abstieg, den es nicht dulden kann, oder einen Krieg auf kurze Sicht.“[34]
Wie den Krieg erklären
Zwei Faktoren flossen in den Vorkriegsjahren in die Kalkulationen der Staatsmänner und Politiker ein: Der erste war die Einschätzung ihrer eigenen militärischen Vorbereitung und die ihrer Feinde, doch der zweite – gleichermaßen wichtig, selbst im autokratischen zaristischen Russland – war die Notwendigkeit, gegenüber der Welt und der eigenen Bevölkerung, insbesondere den ArbeiterInnen, als die angegriffene Seite aufzutreten, die allein in Selbstverteidigung handelt. Alle Mächte wollten in den Krieg, der allerdings von dem anderen angefangen werden musste: „Das Spiel bestand darin, den Feind dazu zu verleiten, eine Handlung zu begehen, die gegen ihn benutzt werden kann, oder Nutzen aus einer Entscheidung zu ziehen, die er bereits getroffen hatte.“[35]
Die Ermordung von Franz Ferdinand, die den Funken entzündete, um den Krieg auszulösen, war schwerlich das Werk eines isolierten Individuums: Gavrilo Principe feuerte zwar den fatalen Schuss ab, doch er war nur einer aus einer Gruppe von Attentätern, die sich selbst in einem der Netzwerke der ultranationalistischen serbischen Gruppierungen „Schwarze Hand“ und Narodna Odbrana („Nationale Verteidigung“) organisiert hatten und von ihnen bewaffnet wurden; Netzwerke, die geradezu ein Staat im Staate bildeten und deren Aktivitäten der serbischen Regierung und insbesondere ihrem Premierminister Nicolas Pasiĉ zweifellos bekannt waren. Die Beziehungen zwischen der serbischen und der russischen Regierung waren extrem eng, und es gilt als sicher, dass die Serben eine solche Provokation nicht unternommen hätten, wären ihnen nicht die russische Unterstützung im Falle einer österreichisch-ungarischen Reaktion zugesichert worden.
Für die österreichisch-ungarische Regierung erschien das Attentat wie eine Gelegenheit, die man nicht verpassen darf, um Serbien an die Kandare zu nehmen.[36] Die Polizeiuntersuchungen hatten nur wenig Mühe, mit dem Finger auf Serbien zu zeigen, und die Österreicher rechneten mit einem Schock unter den herrschenden Klassen Europas, um deren Unterstützung oder zumindest Neutralität zu erreichen, als sie Serbien angriffen. In der Tat hatte das Habsburger Reich keine andere Wahl, als Serbien zu attackieren oder zu demütigen: Alles darunter wäre ein verheerender Schlag gegen sein Prestige und seinen Einfluss in der kritischen Balkanregion gewesen und hätte sie völlig dem russischen Rivalen überlassen.
Die französische Regierung sah in einem „Balkan-Krieg“ ein ideales Szenario für ihren Angriff gegen Deutschland: Wenn Deutschland in einen Verteidigungskrieg der Habsburger hineingezwungen werden konnte und Russland Serbien zu Hilfe kommen würde, dann konnte die französische Mobilmachung als eine Vorsorgemaßnahme gegen die Drohung eines deutschen Angriffs dargestellt werden. Darüber hinaus war es äußerst unwahrscheinlich, dass Italien, nominell ein Verbündeter Deutschlands, aber mit seinen eigenen Interessen auf dem Balkan, in den Krieg ziehen würde, um die Stellung des Habsburger Reichs in Bosnien-Herzegowina zu verteidigen.
Angesichts des Bündnisses, das sich gegen Deutschland aufstellte, fand sich Letzteres in einer Position der Schwäche wieder, mit den Habsburgern, jenem „lockere(n) Syndikat einiger Cliquen gesellschaftlicher Parasiten“, um Luxemburgs Worte zu benutzen, als einzigen Verbündeten. Die Kriegsvorbereitungen in Frankreich und Russland, der Ausbau ihrer Entente mit Großbritannien führten die deutschen Strategen zunehmend zur Schlussfolgerung, dass der Krieg eher früher denn später ausgefochten werden müsse, bevor seine Gegner vollständig vorbereitet waren. Daher die Bemerkung des Kanzlers Bethmann-Hollweg: „Sollte sich der Konflikt (zwischen Serbien und dem Habsburger Reich) ausbreiten, dann ist es absolut notwendig, dass Russland die Verantwortung tragen muss.“[37]
Die britische Bevölkerung war kaum daran interessiert, in den Krieg zu ziehen, um Serbien oder gar Frankreich zu verteidigen. Großbritannien benötigte daher ebenfalls „einen Vorwand, um den Widerstand eines großen Teils der öffentlichen Meinung zu überwinden. Deutschland lieferte einen exzellenten Vorwand, indem es seine Armeen durch Belgien marschieren ließ.“[38] Rosmer zitiert in diesem Zusammenhang aus Viscount Eshers Tragedy of Lord Kitchener: „Die deutsche Invasion Belgiens bewahrte, obwohl sie keinen wesentlichen Unterschied für den Beschluss ausmachte, der von (Premierminister) Asquith und (Außenminister) Grey bereits gefasst worden war, die Einheit der Nation, wenn nicht sogar die Integrität der Regierung.“[39] In Wirklichkeit waren die britischen Pläne für einen Angriff gegen Deutschland, etliche Jahre lang zusammen mit dem französischen Militär vorbereitet, lange vor der Verletzung der belgischen Neutralität ausgearbeitet worden…
Die Regierungen aller kriegführenden Nationen mussten also ihre „öffentliche Meinung“ zur Annahme verleiten, dass der Krieg, den sie vorbereiteten und den sie jahrelang vorsätzlich angestrebt hatten, ihnen unfreiwillig aufgezwungen worden sei. Das kritische Element in dieser „öffentlichen Meinung“ war die organisierte Arbeiterklasse mit ihren Gewerkschaften und Sozialistischen Parteien, die jahrelang ihre klare Opposition gegen den Krieg erklärt hatten. Der wichtigste Einzelfaktor, der den Weg zum Krieg öffnete, war daher der Verrat durch die Sozialdemokratie und ihre Unterstützung dessen, was die herrschende Klasse fälschlicherweise als „Verteidigungskrieg“ porträtiert hat.
Die tieferliegenden Ursachen dieses monströsen Verrats an der elementarsten internationalistischen Pflicht der Sozialdemokratie werden das Thema eines späteren Artikels sein. Es genügt hier zu sagen, dass die heutige Behauptung der französischen Bourgeoisie, dass „politische, soziale, religiöse Streitereien… im Nu verschwanden“, eine schamlose Lüge ist. Im Gegenteil, Rosmers Bericht über die Tage vor dem Kriegsausbruch handelt von ständigen Arbeiterdemonstrationen gegen den Krieg, die brutal von der Polizei unterdrückt wurden. Am 27. Juli rief die CGT zu einer Demonstration auf, und „von neun Uhr bis Mitternacht (…) strömte eine enorme Menge ohne Pause entlang der Boulevards zusammen. Eine riesige Anzahl von Polizisten wurde mobilisiert (…) Doch die Arbeiter, die von den Außenbezirken ins Stadtzentrum strömten, waren so zahlreich, dass die Polizeitaktiken (der Zersplitterung der ArbeiterInnen) zu einem unerwarteten Resultat führten: Es gab bald so viele Demonstrationen, wie es Straßen gab. Die Polizei scheiterte mit ihrer Gewaltsamkeit und Brutalität, der Kampfkraft der Menge einen Dämpfer zu verpassen; den ganzen Abend hindurch hallte der Ruf ‚Nieder mit dem Krieg‘ von der Oper bis zum Place de la République wider.“[40] Die Demonstrationen wurden am folgenden Tag fortgesetzt und breiteten sich bis zu den größeren Städten in der Provinz aus.
Die französische Bourgeoisie sah sich einem weiteren Problem gegenüber: der Haltung des sozialistischen Führers Jean Jaurès. Jaurès war Reformist zu einem Zeitpunkt in der Geschichte, als der Reformismus zu einem unhaltbaren Mittelweg zwischen Bourgeoisie und Proletariat geworden war, doch Jaurès fühlte sich zutiefst der Verteidigung der Arbeiterklasse verpflichtet (und sein Ruf und Einfluss unter den ArbeiterInnen war aus diesem Grund sehr gut), und er war leidenschaftlich gegen den Krieg. Am 25. Juli, als die Presse von Serbiens Ablehnung des österreichisch-ungarischen Ultimatums berichtete, befand sich Jaurès wegen einer Rede auf einer Wahlveranstaltung in Vaise in der Nähe von Lyon: In seiner Rede widmete er sich nicht den Wahlen, sondern der fürchterlichen Kriegsgefahr. „Niemals in den vergangenen 40 Jahren ist Europa mit einer solch bedrohlichen und tragischen Situation konfrontiert worden (…) Eine fürchterliche Gefahr bedroht Frieden und Menschenleben, wogegen die Proletarier Europas die höchsten Anstrengungen der Solidarität unternehmen müssen, zu denen sie in der Lage sind.“[41]
Zunächst glaubte Jaurès den falschen Zusicherungen der französischen Regierung, dass sie für den Frieden arbeite, doch nach dem 31. Juli war er desillusioniert und rief im Parlament einmal mehr die ArbeiterInnen zum äußersten Widerstand auf. Rosmers greift die Geschichte auf: „… wurden Gerüchte verbreitet, dass der Artikel, den er in Kürze für die Samstagsausgabe der L’Humanité schreiben sollte, ein neues ‚J’accuse‘ (Ich klage an)[42] sein würde und die Intrigen und Lügen anprangern werde, die die Welt an den Rande eines Krieges gebracht hätten. Am Abend (…) führte er eine Delegation der sozialistischen (Parlaments-)Gruppe zum Quai d’Orsay an.[43] (Außenminister) Viviani war abwesend, und die Delegation wurde von Unterstaatssekretär Abel Ferry empfangen. Nachdem er Jaurès hat reden lassen, fragte Ferry, was die Sozialisten in der Situation zu tun gedachten. ‚Unsere Kampagne gegen den Krieg fortsetzen‘, antwortete Jaurès. Worauf Ferry antwortete: ‚Das werden Sie niemals wagen, denn dann würden Sie an der nächsten Straßenecke umgelegt werden.‘[44] Zwei Stunden später wurde Jaurès bei seiner Rückkehr zu seinem L’Humanité-Büro, wo er den gefürchteten Artikel schreiben wollte, von dem Attentäter Raoul Villain niedergeschossen; zwei Revolverschüsse aus nächster Nähe verursachten seinen sofortigen Tod.“[45]
Zweifelsohne überließ die herrschende Klasse Frankreichs nichts dem Zufall, um „Einheit und nationalen Zusammenhalt“ sicherzustellen.
Kein Krieg ohne die ArbeiterInnen
Wenn also die Kränze niedergelegt sind, wenn die Großkopferten während der Gedenkfeiern, für die unsere Herrscher Millionen von Pfund oder Euros ausgegeben haben, ihre Häupter in Trauer gebeugt haben, wenn die Trompeten am Ende dieser pathetischen Zeremonien den letzten Ton von sich gegeben haben, wenn die Dokumentationen sich auf den Fernsehbildschirmen entfaltet und die gelehrten Historiker über all die Gründe für den Krieg außer den einen, auf dem es ankommt, und über all die Faktoren, die den Krieg möglicherweise verhindert hätten außer den einen, der wirklich Gewicht hatte, geredet haben, dann lasst die Proletarier der Welt sich erinnern.
Lasst sie sich daran erinnern, dass der I. Weltkrieg nicht von einem historischen Zufall verursacht wurde, sondern von dem unerbittlichen Walten des Kapitalismus und Imperialismus, dass der Weltkrieg eine neue Epoche in der Geschichte einleitete, eine „Epoche der Kriege und Revolutionen“, wie die Kommunistische Internationale sie nannte. Diese Epoche ist auch heute noch präsent, und dieselben Kräfte, die die Welt 1914 in den Krieg trieben, sind auch heute verantwortlich für die endlosen Massaker im Mittleren/Nahen Osten und Afrika, für die noch gefährlicheren Spannungen zwischen China und dessen Nachbarn im Südchinesischen Meer.
Lasst sie sich daran erinnern, dass Kriege ohne ArbeiterInnen als Kanonenfutter und zur Bemannung der Fabriken nicht ausgefochten werden können. Lasst sie sich daran erinnern, dass die herrschende Klasse die nationale Einheit für den Krieg benötigt und dass sie über Leichen geht, um sie zu bekommen, von polizeilicher Repression bis hin zum blutigen Mord.
Lasst sie sich daran erinnern, dass es eben jene „sozialistischen“ Parteien, die heute an der Spitze jeder pazifistischer Kampagne und jedes humanitären Protestes stehen, sind, die 1914 das Vertrauen unserer Vorfahren verraten hatten und sie unorganisiert und wehrlos zurückließen, statt sich der Kriegsmaschinerie des Kapitalismus entgegenzustellen.
Und lasst sie sich schließlich daran erinnern, dass, wenn die herrschende Klasse solche Anstrengungen unternommen hat, die Arbeiterklasse 1914 zu neutralisieren, dies nur deshalb geschah, weil das Weltproletariat eine wirksame Barriere gegen den imperialistischen Krieg sein kann. Nur das Weltproletariat trägt in sich die Hoffnung, den Kapitalismus und die Kriegsgefahren ein für allemal zu überwinden.
Vor einhundert Jahren stand die Menschheit vor einem Dilemma, dessen Lösung in den Händen allein des Proletariats lag: Sozialismus oder Barbarei. Dieses Dilemma herrscht noch heute.
Jens
[1] Ironischerweise wurde der Filmtitel einem Buch des britischen Ökonomen Norman Angell vor dem Krieg entnommen, in dem argumentiert wird, dass ein Krieg zwischen den entwickelten kapitalistischen Mächten unmöglich geworden sei, weil ihre Ökonomien zu eng miteinander integriert und voneinander abhängig seien – exakt dieselbe Art von Argumentation, die wir heute in Bezug auf China und die Vereinigten Staaten vernehmen.
[2] Überflüssig zu sagen, dass wie alle anderen Werke, die wir erwähnten, Nichts Neues im Westen nach 1933 von den Nazis verboten wurde.
[3] In auffälligem Gegensatz dazu erlebte der in Großbritannien bekannte patriotische Kriegspoet Rupert Brooke faktisch nie die Schlacht, da er erkrankte und unterwegs zum Sturm auf Gallipoli verstarb.
[4] Dies war das Objekt einiger Polemiken in der deutschen Presse gewesen.
[5] Zweifellos ein würdiges, selbstständiges Werk, aber keins, das allzu viel zum Verständnis beitragen wird, warum der Krieg ausbrach.
[7] „Commémorer la Grande Guerre (2014-2020): propositions pour un centenaire international“ von Joseph Zimet der „Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives“.
[8] Es fällt auf, dass die große Mehrzahl der Hinrichtungen wegen militärischem Ungehorsam in der französischen Armee in den ersten Monaten des Krieges stattfand, was auf einen Mangel an Begeisterung hindeutet, der von Anbeginn unterdrückt werden musste. Siehe den Bericht an den Minister für die Kriegsveteranen Kadir Arif im Oktober 2013: centenaire.org/sites/default/files/references-files/rapport_fusilles.pdf
[9] Es ist erwähnenswert, dass der Titel Die Schlafwandler Hermann Brochs 1932 verfasste Trilogie desselben Namens entnommen wurde. Broch wurde 1886 in Wien als Spross einer jüdischen Familie geboren, konvertierte jedoch 1909 zum römischen Katholizismus. 1938, nach dem Anschluss Österreichs, wurde er von der Gestapo verhaftet. Doch mit der Hilfe von Freunden (einschließlich James Joyce, Albert Einstein und Thomas Mann) wurde ihm gestattet, in die USA zu emigrieren, wo er bis zu seinem Tod 1951 lebte. Die Schlafwandler ist eine Geschichte von drei Individuen von 1888, 1905 bzw. 1918 und untersucht die Fragen des Werteverfalls und der Unterordnung der Moralität unter die Profitgesetze.
[10] Confédération Générale du Travail. Siehe „Anarcho-syndicalism faces a change in epoch : the CGT up to 1914“, in: Internationale Revue, Nr. 120 (eng., franz., span. Ausgabe).
[11] Siehe Hew Strachan, The First World War, Bd. 1.
[12] Siehe Die Junius-Broschüre, Gesammelte Werke, Bd. 4.
[13] Editions d’Avron, Mai 1993.
[14] Der zweite Band wurde nach dem II. Weltkrieg veröffentlicht und ist weitaus kürzer, da Rosmer während der Nazi-Besetzung aus Paris fliehen musste; seine Archive wurden im Krieg beschlagnahmt und zerstört.
[15] Rosmer, S. 84.
[16] Junius, Kapitel 6.
[17] Luxemburg zitiert hier aus einem Brief an den Braunschweiger Ausschuss: „Wer nicht ganz vom Geschrei des Augenblicks übertäubt ist oder ein Interesse hat, das ganze deutsche Volk zu übertäuben, muß einsehen, daß der Krieg von 1870 ganz so notwendig einen Krieg zwischen Deutschland und Rußland im Schoße trägt wie der Krieg von 1866 den Krieg von 1870. Ich sage notwendig, unvermeidlich, außer im unwahrscheinlichen Falle eines vorherigen Ausbruchs einer Revolution in Rußland. Tritt dieser unwahrscheinliche Fall nicht ein, so muß der Krieg zwischen Deutschland und Rußland schon jetzt als un fait accompli (eine vollendete Tatsache) behandelt werden. Es hängt ganz vom jetzigen Verhalten der deutschen Sieger ab, ob dieser Krieg nützlich oder schädlich. Nehmen sie Elsaß und Lothringen, so wird Frankreich mit Rußland Deutschland bekriegen. Es ist überflüssig, die unheilvollen Folgen zu deuten“.
[18] Junius, Kapitel 3.
[19] Ebenda.
[20] Die erste Marokko-Krise 1905 wurde provoziert vom Besuch des Kaisers in Tanger, den dieser angeblich zur Unterstützung der marokkanischen Unabhängigkeit unternahm, doch der in Wirklichkeit ein Versuch war, dem französischen Einfluss in dem Land entgegenzuwirken. Die militärischen Spannungen waren extrem: Die französischen Militärs strichen allen Urlaub und rückten mit Truppen an die Grenze zu Deutschland vor, während Deutschland begann, alle Reservisten einzuziehen. Am Ende lenkten die Franzosen ein und akzeptierten den deutschen Vorschlag einer multinationalen Konferenz, die in Algeciras 1906 abgehalten wurde. Hier erlebten die Deutschen einen Schock, als sie sich von allen teilnehmenden europäischen Mächten, besonders von den Briten, geschnitten sahen und lediglich die Unterstützung des Habsburger Reichs erlangen konnten. Die zweite Marokko-Krise kam 1911, als eine Rebellion gegen Sultan Abdelhafid Frankreich den Vorwand lieferte, um angeblich zum Schutz europäischer Bürger Truppen in das Land zu schicken. Die Deutschen griffen denselben Vorwand auf, um das Kanonenboot Panther in den Atlantikhafen von Agadir zu entsenden. Dies betrachteten die Briten als das Vorspiel zur Installierung einer deutschen Marinebasis an der Atlantikküste, die Gibraltar direkt bedrohen würde. Die Rede von Lloyd George in seinem Amtssitz (zitiert von Rosmer) war eine kaum verhüllte Erklärung, dass Großbritannien in den Krieg ziehen werde, wenn Deutschland nicht einlenkt. Am Ende erkannte Deutschland im Austausch für ein bisschen Sumpfland an der Kongo-Mündung das französische „Protektorat“ in Marokko an.
[21] Die Deutschen etablierte die Brauerei, die mittlerweile das „Tsingtao“-Bier produziert.
[22] Der Gedanke, den Clark, aber auch Niall Ferguson in The Pity of War präsentiert, dass Deutschland im maritimen Wettrüsten weit hinter Großbritannien zurückgefallen sei, ist absurd: Die britische Marine musste anders als die deutsche die weltweite Schifffahrt schützen, und es fällt schwer, sich vorzustellen, dass die Briten keine Bedrohung in dem Aufbau einer großen Kriegsflotte sahen, die weniger als 500 Meilen von ihrer Hauptstadt entfernt und noch näher an ihren Küsten ankerte.
[23] Obwohl in damaligen europäischen Texten abwechselnd von der Türkei und vom „Osmanischen Reich“ die Rede war, ist es wichtig, daran zu erinnern, dass letztgenannter Begriff genauer ist: Zu Beginn des 19. Jahrhunderts erstreckte sich das Osmanische Reich nicht nur auf die Türkei, sondern auch auf das heutige Libyen, Syrien, den Irak, die arabische Halbinsel und auf einen großen Teil Griechenlands und des Balkan.
[24] Diese Raffinerie war vor allem aus militärischen Gründen wichtig: Die britische Flotte musste von kohlebefeuerten auf ölgefeuerte Maschinen umgestellt werden. Doch während Großbritannien Kohle im Überfluss besaß, hatte es kein Öl. Die Suche nach Öl in Persien wurde vor allem von dem Bedürfnis der Royal Navy veranlasst, eine konstante Ölversorgung für die Flotte sicherzustellen.
[25] Junius, Kap. 4.
[26] Der Erste Balkan-Krieg brach 1912 aus, als die Mitglieder des Balkan-Bundes (Serbien, Bulgarien und Montenegro) mit der stilschweigenden Unterstützung Russlands das Osmanische Reich angriffen. Obwohl kein Teil des Balkan-Bundes, schloss sich Griechenland den Kämpfen an, an deren Ende die osmanischen Armeen größtenteils besiegt waren: Das Osmanische Reich verlor zum ersten Mal seit 500 Jahren die meisten seiner europäischen Territorien. Der zweite Balkan-Krieg brach unmittelbar danach, im Jahr 1913, aus, als Bulgarien Serbien angriff, das mit der stillschweigenden Billigung der Griechen einen großen Teil Mazedoniens besetzt hatte, das ursprünglich Bulgarien versprochen worden war.
[27] Junius, Kap. 4.
[29] Diese Dokumente wurden von den Deutschen beschlagnahmt, die beträchtliche Auszüge nach dem Krieg veröffentlichten. Wie Rosmer betont: „Die Einschätzungen der belgischen Repräsentanten in Berlin, Paris und London haben einen besonderen Wert. Belgien ist neutral, und sie können somit unvoreingenommener bei der Beurteilung von Ereignissen sein; darüber hinaus sind sie sich sehr wohl bewusst, dass ihr kleines Land, sollte der Krieg zwischen den beiden gegnerischen Blöcken ausbrechen, sich in ernster Gefahr befindet, insbesondere als Schlachtfeld zu dienen.“ (ebenda, eigene Übersetzung).
[30] Ebenda, S. 69.
[31] Ebenda, S. 70.
[32] Ebenda, S. 71.
[33] Ebenda, S. 73.
[34] Ebenda, S. 72
[35] Rosmer, S. 87.
[36] In der Tat hatte die Regierung bereits versucht, durch das Durchstecken von gefälschten Dokumenten zum Historiker Heinrich Friedjung, die den Anschein erwecken sollten, ein serbisches Komplott gegen Bosnien und Herzegowina zu enthüllen, Druck zu erzeugen (cf. Clark, loc 1890).
[37] Zitiert von Rosmer, S. 87, aus deutschen Dokumenten, die nach dem Krieg veröffentlicht wurden.
[38] Rosmer S. 87.
[39] ia700301.us.archive.org/18/items/tragedyoflordkit00esheutoft/tragedyoflordkit00esheuoft.pdf
[40] Rosmer, S. 102.
[41] Ebenda, S. 84.
[42] Eine Referenz an Emile Zolas vernichtende Attacke gegen die Regierung in der Dreyfus-Affäre.
[43] Das Außenministerium.
[44] Rosmer, S.91. Die Unterhaltung wurde in Charles Rappoports Jaurès-Biographie geschildert und von Abel Ferrys eigenen Papieren bestätigt. Vgl. Alexandre Croix, Jaurès et ses détracteurs, Editions Spartacus, S. 313.
[45] Jaurès wurde erschossen, als er im Café du Croissant gegenüber der L’Humanité speiste. Raoul Villain ähnelte in gewisser Weise Gavrilo Principe: labil, emotional fragil, zu politischem oder religiösem Mystizismus neigend – kurz: genau die Art Charakter, die die Geheimdienste als entbehrliche Provokateure benutzen. Nach dem Mord wurde Villain inhaftiert und verbrachte den Krieg im sicheren, wenn auch nicht komfortablen Gefängnis. In seinem Prozess wurde er freigesprochen, und Jaurès Witwe wurde dazu verdonnert, die Gerichtskosten zu tragen.
Aktuelles und Laufendes:
- Erster Weltkrieg [16]
Historische Ereignisse:
- I. Weltkrieg [17]
Theoretische Fragen:
- Krieg [18]
Rubric:
Der Anarchismus und der imperialistische Krieg: Nationalismus oder Internationalismus?
- 2842 Aufrufe
 "Aber die deutsche Sozialdemokratie war nicht bloß der stärkste Vortrupp, sie war das denkende Hirn der Internationale. Deshalb muss in ihr und an ihrem Fall die Analyse, der Selbstbesinnungsprozess ansetzen. Sie hat die Ehrenpflicht, mit der Rettung des internationalen Sozialismus, das heißt mit schonungsloser Selbstkritik voranzugehen. Keine andere Partei, keine andere Klasse der bürgerlichen Gesellschaft darf die eigenen Fehler, die eigenen Schwächen im klaren Spiegel der Kritik vor aller Welt zeigen, denn der Spiegel wirft ihr zugleich die vor ihr stehende geschichtliche Schranke und das hinter ihr stehende geschichtliche Verhängnis zurück. Die Arbeiterklasse darf stets ungescheut der Wahrheit, auch der bittersten Selbstbezichtigung ins Antlitz blicken, denn ihre Schwäche ist nur eine Verirrung, und das strenge Gesetz der Geschichte gibt ihr die Kraft zurück, verbürgt ihren endlichen Sieg.
"Aber die deutsche Sozialdemokratie war nicht bloß der stärkste Vortrupp, sie war das denkende Hirn der Internationale. Deshalb muss in ihr und an ihrem Fall die Analyse, der Selbstbesinnungsprozess ansetzen. Sie hat die Ehrenpflicht, mit der Rettung des internationalen Sozialismus, das heißt mit schonungsloser Selbstkritik voranzugehen. Keine andere Partei, keine andere Klasse der bürgerlichen Gesellschaft darf die eigenen Fehler, die eigenen Schwächen im klaren Spiegel der Kritik vor aller Welt zeigen, denn der Spiegel wirft ihr zugleich die vor ihr stehende geschichtliche Schranke und das hinter ihr stehende geschichtliche Verhängnis zurück. Die Arbeiterklasse darf stets ungescheut der Wahrheit, auch der bittersten Selbstbezichtigung ins Antlitz blicken, denn ihre Schwäche ist nur eine Verirrung, und das strenge Gesetz der Geschichte gibt ihr die Kraft zurück, verbürgt ihren endlichen Sieg.
Die schonungslose Selbstkritik ist nicht bloß das Daseinsrecht, sie ist auch die oberste Pflicht der Arbeiterklasse."
Das schrieb Rosa Luxemburg 1915 in Die Krise der deutschen Sozialdemokratie, besser bekannt als Junius-Broschüre, in ihrer Untersuchung über den Verrat, den die Mehrheit in der deutschen SPD und anderen sozialistischen Parteien gegenüber der wichtigsten Prüfung, dem imperialistischen Weltkrieg, begangen hatten. In dieser Passage brachte sie klar ein zentrales Element der marxistischen Methode zur Sprache: das Prinzip der permanenten „schonungslosen Selbstkritik“, weil sie sowohl notwendig als auch möglich für den Marxismus ist, weil es das theoretische Produkt der ersten Klasse in der Weltgeschichte ist, die „der Wahrheit stets ungescheut ins Antlitz blicken darf“. Während und nach dem Ersten Weltkrieg war die Absicht, zu den Wurzeln des Zusammenbruchs der Zweiten Internationale zu gehen, eine abgrenzende Eigenschaft der linken Strömungen, die aus den sozialdemokratischen Parteien hervorgegangen waren, die jetzt aber darauf hin arbeiteten, eine neue, ausdrücklich kommunistische Internationale zu gründen. Als ihrerseits die Dritte Internationale nach dem Rückgang der revolutionären Welle, die nach dem Krieg entstanden war, in den Opportunismus hineinschlitterte – ein Rückschritt, der sich symbolisch am stärksten in der Politik der Einheitsfront mit den sozialdemokratischen Verrätern ausdrückte – wurde die gleiche Arbeit der Kritik von den linkskommunistischen Fraktionen innerhalb der Dritten Internationalen geleistet, insbesondere von der deutschen, italienischen und russischen Linken.
1914 geriet auch die anarchistische Bewegung in eine Krise – nach dem Entscheid des viel verehrten Peter Kropotkin und einer Gruppe um ihn, den „Entente-Imperialismus“ gegen den anderen Block, der von Deutschland angeführt wurde, zu unterstützen, und nach der Übernahme der gleichen Politik durch die französische anarchosyndikalistische Gewerkschaft CGT.[1] Innerhalb der anarchistischen Bewegung gab es viele, die dem Internationalismus treu blieben, die auch das Verhalten von Kropotkin und anderen „Schützengraben-Anarchisten“ mutig bekämpften. Vermutlich war es eine Mehrheit der Anarchisten, die sich dem imperialistischen Krieg entgegenstellte. Aber im Unterschied zur marxistischen Linken gab es wenige Anstrengungen von Seiten bedeutender Teile der anarchistischen Bewegung, die Kapitulation von 1914 auf der Grundlage einer theoretischen Analyse zu untersuchen und zu verstehen. Während die marxistische Linke fähig war, die grundlegenden Methoden und Praktiken der sozialdemokratischen Parteien vor der ganzen Periode des Ersten Weltkriegs in Frage zu stellen, hat sich die Fähigkeit, der „schonungslosen Selbstkritik“ bei den Anarchisten nicht entwickelt. Sie wenden nicht die Methode des historischen Materialismus an, sondern stützen sich auf mehr oder weniger zeitlose abstrakte Prinzipien, die durchtränkt sind von der Auffassung, dass man eine Art Familie sei, die vereint für Freiheit und gegen den Autoritarismus kämpfe. Es kann Ausnahmen geben, ernsthafte Versuche, tiefer in die Problematik einzudringen; im Allgemeinen geschieht dies aber bei Anarchisten, die fähig gewesen sind, sich gewisse Elemente der theoretischen Methode des Marxismus anzueignen.
Diese Unfähigkeit, sich wirklich selbst in Frage zu stellen, ist in der Klassennatur des Anarchismus selbst begründet, der durch den Widerstand des Kleinbürgertums entstanden war, insbesondere durch die unabhängigen Handwerker, die sich der Proletarisierung entgegenstellten, die durch die Auflösung der Klassenstrukturen der Feudalgesellschaft im 19. Jahrhundert stattfand. Der französische Anarchist Pierre-Joseph Proudhon war die deutlichste Verkörperung dieser Strömung mit seiner Rückweisung des Kommunismus zu Gunsten einer Gesellschaft von unabhängigen Produzenten, die durch einen Äquivalententausch verbunden waren. Es ist sicher wahr, dass die Proudhonisten auch eine Bewegung darstellten, die sich mit dem Eintritt in die Erste Internationale zum Proletariat hin bewegte. Aber selbst in den ausdrücklichsten proletarischen anarchistischen Strömungen wie bei den Anarchosyndikalisten, die Ende des 19. Jahrhunderts auftauchten, wurde die inkonsequente, idealistische und ahistorische politische Auffassung, die typisch für die kleinbürgerliche Weltanschauung ist, nie ganz überwunden.
Der Preis für dieses Scheitern, keine wahren Lehren aus 1914 gezogen zu haben, wurde in voller Höhe in der neuen Krise bezahlt, die die anarchistische Bewegung infolge der Ereignisse in Spanien von 1936–37 erschütterte. Wichtige Teile der anarchistischen Bewegung, die 1914 nicht verraten hatten – insbesondere die spanische CNT – stürzten sich jetzt in die Unterstützung des imperialistischen Kriegs, in einen Konflikt zwischen zwei kapitalistischen Fraktionen, den Republikanern, die von der bürgerlichen Linken dominiert waren, und den rechten Kräften, die von Franco angeführt wurden. Diese Frontstellung war Teil einer weitaus breiteren imperialistischen Schlacht, am offensten zwischen den faschistischen Staaten Deutschland und Italien und dem neuen aufsteigenden russischen Imperialismus. Unter dem antifaschistischen Einheits-Banner integrierte sich die CNT schnell auf allen Ebenen in den republikanischen Staat, bis hin zur Teilnahme an der katalanischen und der madrilenischen Regierung. Das Wichtigste, die zentrale Rolle der CNT war, die ursprünglich authentische proletarische Antwort auf den frankistischen Staatsstreich, eine Antwort, die die Methode des proletarischen Klassenkampfes anwendete – den Generalstreik, die Verbrüderung der Truppen, Betriebsbesetzungen und die Bewaffnung der Arbeiter – in eine militärische Verteidigung der kapitalistischen Republik umzuwandeln. Angesichts der Stärke der ersten proletarischen Reaktion waren nicht nur die Anarchisten, sondern auch zahlreiche marxistische Strömungen außerhalb des Stalinismus in der einen oder anderen Weise in der Unterstützung der antifaschistischen Front beteiligt. Dies schloss nicht allein die opportunistischsten Tendenzen rund um Trotzki ein, sondern auch Teile der kommunistischen Linken, einschließlich eine Minderheit der Fraktion der Italienischen [kommunistischen] Linken. Andererseits gab es bei den Anarchisten auch gewisse Klassenreaktionen auf den Verrat der CNT, wie die der Freunde Durrutis und der Gruppe um Berneri „Guerra di Classe“. Aber eine wirkliche Klarheit über den Charakter des Kriegs verkörperte allein eine kleine Minderheit der marxistischen Linken, insbesondere die Italienische Fraktion, die die Zeitschrift Bilan herausgab. Letztere waren die Einzigen, welche die Behauptung zurückwiesen, dass der Krieg in Spanien in irgendeiner Weise den Interessen des Proletariats diene: Im Gegenteil war er eine Art Generalprobe für das bevorstehende imperialistische Weltgemetzel. Für Bilan war Spanien ein neues 1914, insbesondere für die anarchistische Bewegung.[2] Und 1939, mit dem neuen Weltkrieg konfrontiert, den Bilan vorausgesagt hatte, ließ sich eine Mehrheit der Anarchisten, die vom Antifaschismus vergiftet waren, in die Kriegsanstrengungen der Alliierten einbinden. Einerseits als Teil der „Resistance“ oder andererseits direkt als offizielle Verbündete der alliierten Armeen: An der Spitze der „Freiheits“-Parade in Paris 1944 fuhr ein Panzerwagen, mit den Fahnen der CNT geschmückt, die mit der freien französischen Armee Division unter General Leclerc gekämpft hatte. Noch einmal, es gab anarchistische Gruppen und einzelne Individuen, die während 1939–45 den internationalistischen Prinzipien treu blieben, aber einmal mehr gibt es wenig Hinweise auf eine systematische Untersuchung über den Verrat einer Mehrheit der Bewegung, zu der man immer noch gehören wollte. Das Resultat war wie nach dem Verrat von 1914, dass man es versäumte, eine Klassengrenze zwischen den Internationalisten und den Anarcho-Patrioten zu ziehen: In vielen Fällen wurden letztere einfach wieder in ihre „Gruppe von Freunden“ integriert, welche die anarchistische Bewegung im Grunde ist, wenn sich die Dinge nach dem Krieg wieder „normalisieren“. Hinter dieser Unfähigkeit, Klassenprinzipien in einer unnachgiebigen Art zu verteidigen, ist nicht nur eine intellektuelle Schwäche, sondern auch eine Schwäche, sich moralisch zu empören: Alles wird verziehen, wenn du innerhalb der Familie bleibst.
Heute steht die Frage des Krieges wieder vor dem Weltproletariat. Kein Weltkrieg zwischen bestehenden Blöcken, sondern ein allgemeinerer, chaotischerer Abstieg in die militärische Barbarei auf dem ganzen Planeten, wie die Kriege in Afrika, im Nahen Osten und in der Ukraine es veranschaulichen. Diese Kriege sind erneut imperialistische Kriege, in denen die größeren kapitalistischen Staaten mittels verschiedener lokaler oder nationaler Gruppierungen gegen ihre Konkurrenten kämpfen, und sie sind alle Ausdrucksformen des zunehmenden Abstiegs in die Selbstzerstörung. Und wieder einmal beteiligt sich ein Teil der anarchistischen Bewegung offen an diesen imperialistischen Konflikten:
· In Russland und der Ukraine gibt es eine gesteigerte Aktivität von anarchistisch-nationalistischen oder 'ethno-anarchistischen' Gruppen, die offen als 'libertärer' Flügel der Kriegstreiberei im jeweiligen Land funktionieren. Aber auch eine 'respektablere' anarchistische Gruppe, wie die Autonomous Workers‘ Union (Autonome Arbeitergewerkschaft), die Texte auf libcom veröffentlicht und auf der jährlichen anarchistischen Buchmesse (in GB) dieses Jahr ein Treffen abhielt, hat ihre tiefe Unklarheit über den aktuellen Krieg offenbart: In einigen offiziellen Erklärungen scheint sie eine Gegenposition zur ukrainischen Regierung wie auch zu den pro-russischen Separatisten, der NATO und der russischen Föderation einzunehmen, aber Erklärungen einiger führender Mitglieder dieser Gruppierung auf Facebook erzählen eine andere Geschichte, offenbar verteidigen sie die Kiewer Regierung und ihren Krieg gegen die russische Intervention und rufen sogar die NATO zur Unterstützung auf[3].
· In Rojava oder dem syrischen Kurdistan unterstützen das Kurdish Anarchist Forum (kurdisch-anarchistisches Forum) und die türkische DAF (Devrimci Anarşist Faaliyet - revolutionäre anarchistische Aktivisten) die sogenannte 'Rojava-Revolution', beteiligen sich an ihr und machen Propaganda für sie; sie behaupten, dass sich die lokale Bevölkerung in unabhängigen Kommunen in ihrem Kampf gegen die syrische Regierung und vor allem gegen die brutalen Dschihadisten des Islamischen Staates organisiere. Die DAF bietet ihre Dienste denjenigen an, die sich an den Kämpfen um die belagerte Stadt Kobane, nahe der türkischen Grenze, beteiligen wollen. In Wirklichkeit werden diese Kommunen von der kurdisch-nationalistischen PKK, die sich in den letzten Jahren vom Maoismus distanziert und Richtung "liberalen Kommunalismus" (à la Murray Bookchin)[4] orientiert hat, streng kontrolliert.
· Anarchistische Leute im Westen werden ebenfalls in die Kampagne zur 'Solidarität mit Kobane' einbezogen, die effektiv eine Kampagne zur Solidarität mit der PKK ist. Der anarchistische Promi, David Graeber, hat für The Guardian einen Artikel geschrieben mit dem Titel: "Warum ignoriert die Welt die revolutionären Kurden in Syrien?"[5], in dem er die PKK-Übungen in 'direkter Demokratie' als eine 'soziale Revolution' beschreibt und sie mit den anarchistischen Kollektiven in Spanien 1936 vergleicht und verlangt, dass die "internationalen Linke" eine Wiederholung der gleichen tragischen Niederlage verhindere. Eine ähnliche Perspektive wird von einem Schreiber verteidigt, der auf libcom als Ocelot zeichnet, auch wenn seine Argumente für den Antifaschismus und für die "revolutionären Kurden" eine verfeinerte Version der gleichen Sache bieten, denn er weiß von dem, was er die "bordigistische Position" zur Frage des Faschismus nennt, und ist vehement dagegen[6]. Vielleicht noch wichtiger ist die Reaktion der etablierten anarchistischen Organisationen. In Frankreich z. B. beteiligt sich die CNT-AIT[7] an Demonstrationen zur 'Solidarität mit Kobane' hinter dem Transparent mit der Parole: "Waffen für den kurdischen Widerstand, Rojava ist die Hoffnung, solidarische Anarchisten" (siehe Foto). Die Fahnen der Französischen Fédération Anarchiste sind hinter dem gleichen Transparent zu sehen, während die Internationale der Anarchistischen Föderationen, in der die französische FA und die Anarchist Federation in Großbritannien zusammen geschlossen sind und welche die DAF und KAF als befreundete Organisationen auflistet, die meisten Artikel der DAF über die Lage in Kobane kommentarlos publiziert.
Natürlich gibt es Leute innerhalb des Anarchismus, die sehr konsequent in ihrer Ablehnung der Unterstützung des Nationalismus gewesen sind. Wir haben bereits die internationalistische Stellungnahme von KRAS, der russischen Sektion der anarchosyndikalistischen Internationalen Arbeiterassoziation gegen den Krieg zwischen Russland und Ukraine veröffentlicht[8], und wir haben darauf hingewiesen, dass ein Mitglied von KRAS, das als foristaruso auftritt, auf libcom einige sehr harte Kritiken an den Positionen der AWU gepostet hat (siehe Fußnote 3). Auf einem der Hauptdiskussionsstränge auf libcom zur Situation im Nahen Osten haben einzelne Genossen nachdrücklich gegen die pro-PKK-Linie argumentiert, insbesondere ein Mitglied der britischen Sektion der IAA (Solidarity Federation), das als AES auftritt. Das Kollektiv, das die libcom-Webseite betreibt, hat zwei Artikel zur PKK und Rojava verlinkt, die aus einer linkskommunistischen Perspektive geschrieben sind: die 'Warnung' der IKS vor dem neuen libertären Facelifting der PKK (siehe Fußnote 4) und der Artikel "Das Blutbad in Syrien: Klassenkrieg oder ethnischer Krieg"[9], geschrieben von Devrim und zuerst auf der Webseite von Internationalistische Kommunistische Tendenz veröffentlicht. In den darauffolgenden Kommentaren finden sich wütende und verleumderische Antworten von Schreibern, die wahrscheinlich Mitglieder oder Anhänger der türkischen DAF sind.
Zum Zeitpunkt des Verfassens des vorliegenden Artikels hat die AF in Großbritannien eine Stellungnahme veröffentlicht, die keine Illusionen über den linksbürgerlichen, nationalistischen Charakter der PKK hat und zeigt, dass die Ausrichtung auf den Bookchinismus und die "föderale Demokratie" von oben durch ihren großen Führer Öcalan initiiert wurde, der schon ähnliche Avancen gegenüber dem Assad-Regime, dem türkischen Staat und gegenüber dem Islam vorgetragen hat[10]. Die AF hat den Mut zuzugeben, dass die von ihr eingenommene Position angesichts der großen Anzahl von Anarchisten, die sich für die Unterstützung der ‚Rojava-Revolution’ mobilisieren lassen, nicht gut ankommen werde. Aber wir sehen hier noch einmal eine totale Inkohärenz innerhalb derselben 'internationalen' Tendenz. Die Stellungnahme der AF enthält keine Kritiken weder an der DAF noch an der IAF, und in ihrer Liste konkret vorgeschlagener Maßnahmen am Ende der Stellungnahme findet sich ein Aufruf zur "humanitären Hilfe zugunsten von Rojava via IFA, die einen direkten Kontakt zur DAF hat". Dies ist ein Zugeständnis an die Logik: "wir müssen jetzt etwas tun", die im anarchistischen Milieu stark verbreitet ist – „etwas zu tun“, auch wenn die Hilfe (ob militärisch oder humanitär), die von einer kleinen Gruppe in der Türkei organisiert wird, zwangsläufig in die Hände von größeren Organisationen wie der PKK spielen wird. Und dies ist denn auch das, was die DAF vorschlägt, indem sie Freiwillige angeboten hat, die in den unter der Kontrolle der PKK stehenden "Volksschutzeinheiten" oder YPG kämpfen wollen. Die AF schreibt auch, dass sie darauf abzielt, "jede unabhängige Aktion der Arbeiter und Bauern in der Rojava-Region zu fördern und zu unterstützen. Gegen jede nationalistische Agitation und für die Vereinigung von kurdischen, arabischen, muslimischen, christlichen und yezidischen Arbeitern und Bauern einzutreten. Solche unabhängigen Initiativen müssen sich von der Kontrolle der PKK/PYD befreien und ebenfalls von der Hilfe der westlichen Alliierten, von deren Klienten wie der Freien Syrischen Armee, von Barzanis Demokratischer Partei Kurdistans und vom türkischen Staat". Aber diese Ziele sind nicht zu erreichen, wenn nicht auch gegen die Unterstützung der PKK durch die DAF selber argumentiert wird.
Es ist kein Zufall, dass die konsequentesten Antworten auf die Situation in Rojava in der Tradition der kommunistischen Linken geschrieben worden sind. Was die Antwort der Anarchisten im Allgemeinen auszeichnet, ist ihre völlig fehlende Kohärenz. Wenn man die Webseiten der IWA, der CNT-AIT oder der Solidarity Federation anschaut, so stellt man ihre enge Sicht auf unmittelbare und lokale Arbeiterkämpfe fest, in die sie selber einbezogen sind[11] - ziemlich im Stile der ökonomistischen Strömungen, die Lenin vor etwa 100 Jahren kritisiert hat. Die großen wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Ereignisse auf der Welt werden kaum erwähnt, und es gibt kein Anzeichen von Debatten über grundsätzliche Fragen zum Internationalismus und zum imperialistischen Krieg, auch wenn es darüber offensichtlich ernsthafte Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Strömung - vom Internationalismus bis zum Nationalismus - gibt. Dieser Mangel an Debatten, diese Vermeidung der Konfrontation der sich widersprechenden Positionen - die wir auch in der IAF beobachten - ist weit gefährlicher als die Krise, die die anarchistischen Bewegung 1914 und 1936 getroffen hat, als es noch eine viel heftigere Reaktion auf den Verrat der Prinzipien in den Reihen der Bewegung gab. Der Anarchismus bleibt eine Familie, die bürgerliche und proletarische Positionen leicht unter einen Hut bringen kann und in diesem Sinne noch die Unbestimmtheit, die Schwankungen der gesellschaftlichen Schichten, die zwischen den beiden Hauptklassen der Gesellschaft gefangen sind, wiederspiegelt. Diese Atmosphäre ist ein Hindernis für die Klärung und hält selbst die klarsten und entschlossen internationalischen Individuen oder Gruppierungen davon ab, zu den Wurzeln des jüngsten Problems der anarchistischen Zusammenarbeit mit der Bourgeoisie vorzustoßen. Ihre Positionen bis zu ihren logischen Schlussfolgerungen weiter zu treiben, würde eine gründliche Untersuchung früherer Krisen im anarchistischen Milieu verlangen, vor allem derjenigen von 1936, die nach der Argumentation in den letzten Artikeln unserer Internationalen Revue die fatalen Schwächen des Anarchismus schonungslos enthüllten. In letzter Instanz würde eine solche Untersuchung eine grundsätzliche Kritik des Anarchismus und eine echte Aneignung der marxistischen Methode verlangen.
Amos, 3.12.2014
[1] Siehe in der Serie über die CGT folgende Artikel (auf Englisch, Spanisch oder Französisch):
https://en.internationalism.org/ir/120_cgt.html [19]. Der Link zur ganzen Serie: https://en.internationalism.org/series/271 [20]
Ein anderer Artikel, aber zum gleichen Thema auf Deutsch: https://de.internationalism.org/welt156_anarchistenkrieg [21]
[2] Siehe insbesondere: https://en.internationalism.org/ir/2008/132/spain_1934; [22] https://en.internationalism.org/ir/133/spain_cnt_1936; [23] https://en.internationalism.org/internationalreview/201409/10367/war-spa... [24]. Die Fortsetzung des letzten Artikels über dissidente Anarchisten in Spanien und anderwo wird bald erscheinen.
[3] Vgl. die Threads auf libcom, die foristaruso begonnen hat, ein Mitglied der russischen anarchosyndikalitischen Gruppe KRAS, Sektion der IAA: https://libcom.org/news/about-declaration-awu-confrontation-ukraine-2306... [25] https://libcom.org/news/when-patriotic-anarchists-tell-verity-02072014; [26] https://libcom.org/forums/news/ukrainian-crisis-left-necessary-clarifica... [27]
[4] https://en.internationalism.org/icconline/201304/7373/internationalism-only-response-kurdish-issue [28]
[5] https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/08/why-world-ignoring-revolutionary-kurds-syria-isis [29]
[7] AIT steht für Association International des Travailleurs (Internationale Arbeiterassoziation IAA).
[11] Die Foto mit dem CNT-AIT-Transparent ist typisch für den Stil dieser Artikel aus dem anarchosyndikalistischen Milieu, die wenn immer möglich zeigen, welche wesentliche Rolle IAA-Leute bei diesem oder jenem Kampf spielten – folgerichtig mit Blick auf ihr Verständnis, dass sie die Rolle hätten, die Klasse in revolutionären Gewerkschaften zu organisieren.
Aktuelles und Laufendes:
- Anarchismus [34]
Politische Strömungen und Verweise:
Theoretische Fragen:
- Imperialismus [36]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Die "Einheitsfront" [37]
