Dezember 2008
- 782 Aufrufe
Bewegung an den Universtäten in Italien: Wir zahlen nicht für die Krise
- 3463 Aufrufe
Wie vor genau 40 Jahren, seit die Bewegung des französischen Mai 68 nach Italien und in die ganze Welt getragen wurde, sind die Schüler und die Angestellten der Universitäten wieder auf den Strassen Italiens, um sich dem sogenannten Dekret Gelmini (Gelmini ist die Ministerin für Bildung, Hochschule und Erziehung) entgegenzustellen.
Wir zahlen nicht für die Krise[1]
„Wir zahlen nicht für die Krise.“ (1) Wie vor genau 40 Jahren, als die Bewegung des französischen Mai 68 nach Italien und in die ganze Welt getragen wurde, sind die SchülerInnen und die Angestellten der Universitäten wieder auf den Straßen Italiens, um sich dem so genannten Gelmini-Dekret (Gelmini ist die Ministerin für Bildung, Hochschulen und Erziehung) entgegenzustellen. Die Gründe sind bekannt, wir beschränken uns darauf, sie kurz zu wiederholen.
Auf der Ebene der Schule beinhaltet das Gelmini-Dekret - abgesehen vom Zwang, Schuluniformen zu tragen, was in der endgültigen Version des Dekrets nicht mehr erwähnt wurde, oder z. B. die Wiedereinführung der Kopfnote - vor allem Kürzungen, die den Bildungsbereich und die Qualität der Dienstleistung für die SchülerInnen und StudentInnen betreffen.
Die Einsparungen auf Kosten der SchülerInnen durchzusetzen beinhaltet:
- eine Einschränkung der Schulzeit in der Primärschule und im Kindergarten;
- eine drastische Einschränkung des Personals (DozentInnen, Verwaltung und technisches Personal), indem man den Zugang blockiert, restrukturiert und Arbeitszeiten reduziert: 87.000 DozentInnenen werden in eine prekäre Situation geraten (Zeitarbeitsverträge), und 45.000 Aushilfskräfte (Sekretärinnen und Hausmeister) werden nicht mehr zur Arbeit gerufen;
- Zunahme der SchülerInnen in den Klassen;
- Wegfall des technischen Unterrichts und der zweiten Fremdsprache in der Oberstufe;
- Reduzierung der Schulzeit in den technischen Schulen und Berufsschulen.
Auf der Ebene der Universitäten gibt es, jenseits der Märchen, die uns die Regierung erzählt:
- eine Kürzung der Budgets von über 500 Mio. Euro in den nächsten drei Jahren;
- eine Reduzierung des Personals der Universitäten in den Jahren 2010 und 2011, so dass auf fünf Pensionierungen nur eine Neuanstellung kommt;
- Vorbereitung für die Umwandlung der öffentlichen Universitäten in privatrechtliche Stiftungen.
Dies sind die wesentlichen Elemente des Regierungsmanövers. Wie man sieht, reicht dies, um die öffentliche Bildung in Italien verwahrlosen zu lassen, weil es sich nicht um Gesetze handelt, welche die öffentliche Bildung in Italien reorganisieren. Es geht vielmehr darum, die öffentliche Bildung teilweise stillzulegen sowie die Ressourcen und das Personal auf Null zu setzen. Genau das hat das betroffene Personal, das in diesen Bereichen arbeitet, zum Widerstand angestachelt, ganz besonders die Jungen und die ZeitarbeiterInnen, was personell fast identisch ist. Die Betroffenen im Studentenbereich sehen in der Gelmini-Reform, in den finanziellen Manövern der Berlusconi-Regierung berechtigterweise einen Angriff auf ihre eigene Zukunft. Bei einer weiteren Deklassierung der Bildung in Italien und der Umgestaltung von Universitäten in Stiftungsuniversitäten (ungeachtet der Diskussionen, ob nun das Private oder das Öffentliche besser ist) werden in Zukunft nur noch jene eine Chance haben, die sich den Zugang zu guter Bildung erkaufen können. „Es stellt ein eindeutiges Signal für das abnehmende Interesses des Staates an der Förderung des öffentlichen Bildungssystems dar, das für jeden den Zugang zu den höchsten Ebenen der Bildung garantiert.“ (2)
Dieses Gefühl der Zukunftslosigkeit erfasst die Bewegung der StudentInnen und ZeitarbeiterInnen umso mehr, weil dies vor dem Hintergrund einer noch nie dagewesenen Wirtschaftskrise geschieht, die außergewöhnlich besorgniserregend ist.
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass diese Bewegung nur schwach studentisch geprägt ist. Ihre größte Kraft gewinnt sie daraus, dass der Angriff der Berlusconi-Regierung ausgerechnet inmitten der Wirtschaftskrise stattfindet, die Italien und die ganze Welt betrifft. In diesem Sinn erinnert die Bewegung in Italien stark an die Bewegung der französischen StudentInnen 2006, die sich gegen das „CPE“-Gesetz (Vertrag zur Ersteinstellung) gewandt hatten. Ein Gesetz, das, wenn es angenommen worden wäre, die Arbeitsbedingungen der jungen ArbeiterInnen massiv verschlechtert hätte. Beide Bewegungen gingen bzw. gehen von den materiellen Bedingungen aus, welche die beruflichen und Lebensperspektiven der neuen Arbeitergenerationen betreffen, und stellen sich somit auf proletarisches Terrain. Es ist kein Zufall, dass die Parole der Studenten und ZeitarbeiterInnen heißt: „Wir zahlen nicht für die Krise!“
Dies drückt sich darin aus, dass dem Gerede darüber, „dem Land in Schwierigkeiten zur Hand zu gehen“ oder „in diesen schwierigen Zeiten Opfer auf sich zu nehmen“, kein Glauben geschenkt wird.
Die schwache studentische Ausprägung der Bewegung wird auch in dem Willen ersichtlich, sich für eine gemeinsame Zukunft in allen Lebensbereichen einzusetzen. Man sieht dies auch an anderen Faktoren, z.B. daran, dass es im Gegensatz besonders zu den 68er Bewegungen keinen Gegensatz zwischen den Generationen und auch keine Konfrontation zwischen StudentInnen und DozentInnen gibt. Es gibt hingegen eine Tendenz, zusammen zu kämpfen. Außerdem ist die Bewegung wenig ideologisch, was sich darin ausdrückt, dass sie sich weder als links noch als rechts charakterisiert und auch nicht von linken oder rechten Parteien benutzt werden kann. Jedoch hat die Bewegung ein klares Bewusstsein darüber, dass ihr Kampf den Sieg davontragen muss.
Die Fallen, die der Bewegung gestellt werden
Trotz allem hat die Bewegung, die sich auf den Straßen Italiens zeigt, auch eine Reihe von Schwächen, die die herrschende Klasse bewusst ausnutzt, um die Bewegung zum Scheitern zu bringen. Eine dieser Schwächen ist das Fehlen von klaren Zielen. Anders als in Frankreich, wo die Reife der StudentInnen durch einen frontalen Angriff der Regierung gefördert wurde, hat der indirekte Charakter des Angriffs in Italien weniger für Klarheit gesorgt. Wie gesagt, ist es richtig, dass ein wichtiger Faktor, der die Bewegung antreibt, die Wirtschaftskrise ist, in der sich Italien und der Rest der Welt befinden. Aber was bedeutet diese Krise genau? Eine Finanzkrise, welche von skrupellosen Spekulanten hervorgerufen wurde? Eine Krise, die dem ungezügelten Konsum oder der Überbevölkerung weltweit zuzuschreiben ist? Eine Krise, die von der Invasion des Weltmarktes durch die Chinesen verursacht wurde? Oder ist es nicht doch eine unlösbare Krise des Systems, in dem wir leben?
Es ist klar, dass die eine oder andere dieser Erklärungen dazu verleiten kann, sich den Wechsel zu den Obamas oder Veltronis (dem Oppositionsführer der Linken in Italien) zu wünschen, zur Linken allgemein, die als der gutgesinnte Teil der Gesellschaft hingestellt wird, als jener, der fähig ist, gut und gerecht zu regieren. Andernfalls müsste man die ganze Gesellschaftsordnung in Frage stellen, die Ausbeutung, die sich seit Jahrhunderten, ganz unabhängig von dieser oder jenem Regime, ständig fortgesetzt hat.
In dieser Hinsicht wird in den Medien viel Aufhebens über die Eigenschaften der Gelmini gemacht. Sie sei „eine dem verhassten Berlusconi würdige Ministerin“; sie wird dafür verantwortlich gemacht, „die öffentliche Schule in die Hände von Privaten zu legen“. Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Maßnahmen der Berlusconi-Regierung drakonisch sind und dass Schulen sowie Universitäten stark davon betroffen sind. Aber man muss sich von der Logik befreien, dass dies die rechte Regierung nur gemacht habe, um sich eines politisch gefährlichen Sektors zu entledigen, wie dies aus einer Rede von Calamandrei aus dem Jahre 1950 hervorgeht, in der er ausführt, wie man eine öffentliche Schule in eine parteihörige Schule umwandelt. Diese Rede wird im Moment bewusst lanciert, wobei behauptet wird, dass eine linke Regierung diesen Sektor nie angerührt hätte. (3)
„Wie etabliert man in einem Land parteihörige Schulen? Man kann es auf zwei Arten tun. Einerseits mit einem offenen Totalitarismus. Na ja, wir haben diese Erfahrung schon mit dem Faschismus gemacht. Aber es gibt weitere Formen, Schulen in partei- oder sektenhörige Schulen umzuwandeln. Nehmen wir einmal an, ganz abstrakt, es gäbe eine Partei an der Macht, eine dominierende Partei, die das Grundgesetz respektieren will. Sie will es nicht brechen, sie will nicht auf Rom marschieren und die Aula in eine Schaltzentrale der Macht verwandeln, aber sie will, ohne dass es so aussehen soll, eine Diktatur in versteckter Form durchsetzen. Also, was soll man tun, um sich eine Schule anzueignen und die öffentlichen Schulen in parteihörige Schulen umzuwandeln? Man stellt fest, dass die Schulen den Makel haben, unparteiisch zu sein. Es gibt einen gewissen Widerstand, auch während des Faschismus gab es ihn. Also folgt die dominierende Partei einem anderen Weg (um es klar zu sagen, all dies ist nur eine theoretische Überlegung). Man fängt damit an, die öffentlichen Schulen zu vernachlässigen, sie zu diskreditieren, sie verarmen zu lassen. Man lässt zu, dass sich die öffentlichen Schulen auflösen, und beginnt damit, die privaten Schulen zu bevorzugen. Nicht alle privaten Schulen, sondern nur die Schulen, die dieser Partei hörig sind. Dann fließt alle Fürsorge nur in diese Schulen. Fürsorge in Form von Geld und Privilegien. Dann rät man den Jungen, in diese Schulen zu gehen, weil sie im Grunde genommen besser als die staatlichen Schulen seien. Da die dominierende Partei nicht in der Lage ist, die öffentliche Schule offen in eine parteihörige Schule zu verwandeln, lässt sie einfach die öffentlichen Schulen vor die Hunde gehen, um so dann den privaten Schulen den Vorzug zu geben.“ (4)
Abgesehen von der Illusion, dass es in der kapitalistischen Gesellschaft eine unabhängige Schule geben könnte, eine Kultur, die über den Parteien steht, verhält es sich in der Realität so, dass, wer auch immer an der Regierungsspitze steht, nicht anders kann, als zu versuchen, die kapitalistische Ökonomie aus der Krise zu retten. Was zu nichts anderen führen kann als zu immer aggressiveren Angriffen gegen die Bevölkerung. Es spielt keine große Rolle, wenn die Kultur eines Landes darunter leidet. Es ist richtig, dass die Regierung Berlusconis in ihrer Rohheit einen harten Sparplan durchgesetzt hat. Man sollte aber nicht denken, dass dies bloß ein politisches Manöver ist; es ist notwendig für den Staat, den Gürtel enger zu schnallen. (5)
Aber dies sind noch nicht alle Fallen! Gerade weil sich eine kämpferische Dynamik an den Universitäten und Schulen verbreitet hat, beginnt sich die herrschende Klasse Sorgen zu machen und setzt weitere Hebel in Bewegung, um sich zu verteidigen. Zuerst hat Berlusconi davon gesprochen, dass es nötig sei, die Besetzung der Schulen und Universitäten zu verhindern, indem er Innenminister Maroni entsprechende Instruktionen erteilt hat. Später hat er dies quasi dementiert, um nachher vom Ex-Ministerpräsidenten Cossiga korrigiert zu werden. Dieser hat als „Weiser“ der Bourgeoisie mit großer Unverfrorenheit eine Reihe von Ratschlägen für den „Ehrenmann“ Berlusconi herausgearbeitet, die wir hier wegen ihrer Brisanz wiedergeben wollen, um zu verstehen, was auf den Straßen und Plätzen Italiens geschieht, und möglicherweise auch vorauszusehen, welche Maßnahmen die herrschenden Klasse gegen die Bewegung ergreifen wird:
„Präsident Cossiga, denken Sie dass man mit der Androhung von staatlicher Gewalt gegen die Studenten übertrieben hat?“
„Das hängt davon ab, ob der Ratspräsident (Berlusconi) sich für einen Präsidenten eines starken Staates hält. Nun, dann hat er richtig gehandelt. Aber weil Italien einen schwachen Staat hat und in der Opposition nicht die eiserne PCI (partito comunista italiano, die ehemalige stalinistische Partei Italiens) steht, sondern die in der Auflösung begriffene PD (partito democratico di sinistra; eine der Nachfolgeparteien des PCI), befürchte ich, dass den Worten keine Taten folgen werden und Berlusconi somit dumm dastehen wird.“
„Welche Taten sollten folgen?“
„An diesem Punkt sollte Maroni (Innenminister) das tun, was ich tat, als ich Innenminister war.“
„Das heißt?“
„Sie machen lassen, die Polizei aus den Straßen und den Universitäten abziehen, gleichzeitig die Bewegung mit Agents Provocateurs (Spitzeln) infiltrieren, die zu allem bereit sind, und die Demonstranten etwa zehn Tage lang Läden zerstören lassen, Autos in Brand stecken lassen und zuschauen, wie die Stadt in Schutt und Asche gelegt wird.“
„Danach?“
„Danach werden, unter Beifall der Bevölkerung, die Sirenen der Krankenwagen jene der Polizei übertönen.“
„In welchem Sinn?“
„In dem Sinne, dass die Ordnungskräfte die Demonstranten massakrieren, ohne Gnade alle spitalreif schlagen sollen. Man soll sie nicht verhaften, die Richter würden sie sowieso gleich wieder auf freien Fuß setzen, aber sie blutig schlagen und mit ihnen auch die Dozenten, die sie anstifteten.“
„Auch die Dozenten?“
„Vor allem die Dozenten. Nicht die alten, sicher, aber besonders die jungen Lehrerinnen, die schon. Sind Sie sich bewusst, was da vor sich geht? Es gibt Lehrkräfte, die Kinder indoktrinieren und sie dazu bringen, auf der Straße zu demonstrieren. Das ist ein kriminelles Verhalten.“ (6)
Wenn man dieses Interview liest, kommt man nicht umhin, einen Zusammenhang mit den Geschehnissen am 29. Oktober auf der Piazza Navona (Rom) herzustellen. Eine Gruppe Neofaschisten provozierte einen Zusammenstoß mit den Studenten, die an der Demonstration teilnahmen. Tatsächlich setzt der Staat mit seinen Medien und materiellen Möglichkeiten (Presse, TV, Polizei etc.) bereits den Entwurf von Cossiga um.
Die Provokation geht nicht nur von den infiltrierten Provokateuren aus, die es sicherlich gibt, sondern auch vom Antifaschismus, der durch eine ganze Reihe von Provokationen wiederbelebt wird. Vor und nach der Episode auf der Piazza Navona gab es unzählige Provokationen durch neofaschistische Banden, die die Konfrontation gewaltsam austragen wollen und so das Ganze auf einen Diskurs für die Verteidigung der Demokratie, des Respekts für die Legalität und der Ordnung lenken, wie es Ex-Präsident Cossiga vorhersagte. Doch zum Glück widersteht die Bewegung diesen Fallen sehr gut; bei vielen Gelegenheiten wird deutlich, was auch durch zahlreiche kürzlich erschienene Videos und Blogs belegt wird: dass die Bewegung sich bewusst nicht auf einen falschen Zusammenstoß mit den Faschisten einlässt, sondern weiterhin auf den bisherigen Grundlagen ihres Kampfes besteht.
Die Perspektive der Bewegung
Eine Bewegung, die auch nach der endgültigen Verabschiedung des Gesetzes, dem Ausgangspunkt der Bewegung, durch den Senat aktiv bleibt, demonstriert einen Willen, der nicht oberflächlich ist, sondern aus einem tiefen Leid gespeist wird. Auch wenn wir im Augenblick nicht in der Lage sind zu sagen, wie die nächste Zukunft dieser Bewegung aussehen wird, denken wir, dass Bewegungen dieser Art eine wichtige Rolle in der Zukunft spielen. Die ökonomische wie auch die politische und soziale Situation ist auf einem Tiefpunkt.
Die Bewegung in Italien hat noch nicht die politische Reife erlangt, wie sie die Studentenbewegung in Frankreich hatte, als diese gegen die CPE demonstrierte. Dies, weil die Bewegung keine klare Instanzen hervorgebracht hat, wie z. B. Vollversammlungen, auf denen die Delegationen gewählt und jederzeit wieder abgewählt werden können.
Wenn auch kein klares Bewusstsein über die Notwendigkeit einer Verbindung zu anderen Gesellschaftsschichten während des Kampfes bestand, so hat die Bewegung trotzdem Folgendes ausgedrückt:
- eine klare Unabhängigkeit gegenüber Parteien und Gewerkschaften, ohne dabei der Entpolitisierung anheimzufallen;
- das ausdrückliche Anliegen, der Bevölkerung die Gründe ihres Kampfes mitzuteilen, nicht nur durch Demonstrationen und Transparente, sondern auch durch die „Straßenlektionen“, die von Dozenten vor einer großen Anzahl von Studenten abgehalten wurden, die sogenannten „weißen Nächte“ usw.
Die Auseinandersetzung ist noch nicht vorbei. Die Demonstrationen in ganz Italien am Tag der Verabschiedung des Gelmini-Gesetzes (29.10), der Streik von einer Million Schülern am 30. Oktober und die emsigen Aktivitäten, die sich im Umfeld von Schulen und Universitäten entwickelten, führten am 14. November zu einer nationalen Demonstration. Sie war ein lebendiger Ausdruck des Kampfes und der Aktivitäten, die die Bewegung dazu bringen könnte, wie ein einheitlicher Körper agieren und zu anderen gesellschaftlichen Bereichen, die sich im Kampf befinden, eine Brücke zu schlagen.
4.11.2008 Ezechiele
[1] Parole, die die ganze italienische Studentenbewegung erobert hat.
[2] Aus dem Antrag der wissenschaftlichen Fakultät der Universität Federico II in Neapel 29.10.2008.
[3] Eigentlich wurde der erste Teil der Kürzungen - die Abschaffung von Schulklassen, Dozenten und technischem Personal - von der Prodi-Regierung durchgesetzt.
[4] Aus einer Rede von Piero Calamandrei am 11. Februar 1950 zur Verteidigung einer nationalen Schule.
[5] Es gibt eine weitere politische Mystifizierung, die dazu tendiert, alles auf die Kürzungen in der Grundlagenforschung zu fokussieren. Dabei wird beklagt, dass unsere „klugen Köpfe“ dazu gezwungen werden, auszuwandern, wie es in der TV-Sendung von Michele Santoro dargestellt wurde; es lief darauf hinaus, dass die Angelegenheit einer ganzen Generation so hingestellt wird, als betreffe sie nur eine kleine Minderheit.
[6] Interview von Andrea Cangini mit Cossiga vom 23. Oktober 2008 mit dem Titel: „Man muss sie aufhalten, auch der Terrorismus fing in den Universitäten an.“ (aus der Zeitung Quotidiano nationale, man kann das ganze Interview lesen unter:
Geographisch:
- Italien [2]
Aktuelles und Laufendes:
- Studentenbewegung Italien [3]
- 2008 [4]
- Klassenkampf [5]
Erbe der kommunistischen Linke:
Das Wachstum in Asien: ein Ausdruck der Krise und der Dekadenz des Kapitalismus
- 22754 Aufrufe
Bislang hat sich der Kapitalismus als unfähig erwiesen, zwei Drittel der Menschheit an seiner Entwicklung teilnehmen zu lassen. Nach dem gewaltigen Wirtschaftswachstum in Indien und China - und insgesamt in Ostasien - wird lauthals verkündet, dass er nun dazu in der Lage sei, der Hälfte der Menschheit eine Entwicklung anzubieten. Und er wäre dazu um so mehr in der Lage, wenn man ihn von all seinen Fesseln befreien würde. So verkündet man, dass mit Löhnen und Arbeitsbedingungen auf dem Niveau Chinas im Westen ebenfalls Wachstumsraten von 10% pro Jahr erreicht werden könnten.
Die theoretische und ideologische Herausforderung ist also ziemlich groß: Spiegelt die Entwicklung in Ostasien eine Erneuerung des Kapitalismus wider, oder handelt es sich nur um eine einfache Schwankung in seinem normalen Krisenverlauf? Auf diese wesentliche Frage versuchen wir eine Antwort zu geben. Während wir auf die gesamte Entwicklung im asiatischen Subkontinent eingehen wollen, werden wir jedoch insbesondere den Fall Chinas behandeln, da er am bekanntesten ist und in den Medien am meisten behandelt wird.
Wir werden auf diese Herausforderungen und Fragen in den folgenden Kapiteln eingehen.
Einige Fragen an die revolutionäre Theorie aufgrund der Entwicklung des asiatischen Subkontinentes
1. Während 25 Jahren Wirtschaftswachstum und ‚Globalisierung'[1] (1980-2005), während dessen Europa sein Bruttoinlandprodukt (BIP) auf das 1,7-Fache vergrößerte, die USA ihres auf das 2,2-Fache, die Welt auf das 2,5-Fache, konnte Indien sein BIP auf das Vierfache, das sich entwickelnde Asien auf das Sechsfache, China seins auf das Zehnfache erhöhen. Chinas Entwicklung war also viermal schneller als der Weltdurchschnitt - und das, während die Welt in einer Wirtschaftskrise steckt. Das bedeutet, dass das Wachstum im ostasiatischen Subkontinent den fortgesetzten Fall des weltweiten BIP-pro-Kopf-Wachstums seit Ende der 1960er Jahre abgefedert hat: 1960: 3,7% (1960-69); 2,1% (1970-79); 1,3% (1980-89); 1,1% (1990-1999) und 0,9% (2000-2004)[2]. Die erste Frage, vor der wir stehen, ist folgende: Kann diese Region der Krise entweichen, in welcher der Rest der Weltwirtschaft steckt?
2. Die USA brauchten 50 Jahre zur Verdoppelung ihres Prokopfeinkommens von 1865 und dem 1. Weltkrieg (1914); China gelang dies doppelt so schnell, zudem noch im Zeitraum der Dekadenz und der Krise des Kapitalismus! Während 1952 noch 84% der Bevölkerung Chinas auf dem Land lebte, beträgt heute die Zahl der in der Industrie beschäftigten Arbeiter (170 Millionen) 40%; sie übersteigt damit die Zahl aller Arbeiter in der OECD (123 Millionen Beschäftigte in der Industrie)! Das Land wurde zur Werkstatt der Welt und die Beschäftigung im Dienstleistungsbereich steigt enorm schnell an. Die Umwälzung der Beschäftigungsstrukturen ist eine der schnellsten in der ganzen Geschichte des Kapitalismus gewesen.[3] So ist China mittlerweile zur viertgrößten Wirtschaft der Erde aufgestiegen, wenn man sein BIP in Dollars berechnet und China steht an zweiter Stelle bei Kaufkraftparität.[4] All diese Faktoren verlangen eine Antwort auf die Frage, ob es in diesem Land nicht eine wahre ursprüngliche Akkumulation und eine industrielle Revolution gibt wie die, welche im 18. und 19. Jahrhundert in den entwickelten Ländern stattgefunden hat. Anders ausgedrückt: gibt es einen Raum für das Auftauchen von neuen Kapitaleinheiten und neuen Ländern im Zeitalter der Dekadenz? Wäre gar ein Aufholprozess denkbar, wie in seiner aufsteigenden Phase? Wenn die gegenwärtigen Wachstumszahlen anhalten, würde China zu einer der größten Wirtschaftsmächte innerhalb von weniger als zwei Jahrzehnten werden. Dies war im 19. Jahrhundert auch den USA und Deutschland gelungen, als diese England und Frankreich ein- und überholten, obwohl diese erst später ‚gestartet' waren.
3. Das Wachstum des BIP Chinas ist ebenfalls das höchste, das jemals in der Geschichte des Kapitalismus registriert wurde: Während der letzten 25 Jahre ist es im Jahresdurchschnitt um 8-10% gewachsen, trotz weltweiter Krise. Das Wachstum Chinas übertrifft sogar noch die Wachstumsrekorde Japans in der Blütephase nach dem 2. Weltkrieg. Damals wuchs die Wirtschaft Japans um 8.2% zwischen 1950-1973 und die Koreas um 7.6% zwischen 1962-1990. Darüber hinaus ist der Wachstumsrhythmus Chinas im Augenblick größer und stabiler als der seiner schon industrialisierten Nachbarn (Südkorea, Taiwan, Hongkong). Gibt es also ein Wirtschaftswunder in China?
4. Zudem begnügt sich China nicht mehr damit, Grundstoffe zu produzieren und zu exportieren oder Waren wieder auszuführen, die in Chinas Fabriken mit Billiglöhnen veredelt wurden. Immer mehr produziert und exportiert China hochwertige Güter wie z.B. Elektronikware und Transportmittel. Kommt es somit in China zum Aufbau neuer Industriezentren wie in den NIL (Neu industrialisierten Ländern) (Südkorea, Taiwan, Hongkong, Singapur)? Wird China es wie diese Länder schaffen, seine Exportabhängigkeit zu reduzieren und den Binnenmarkt zu entwickeln? Sind Indien und China nur Sternschnuppen, deren Licht irgendwann verlöschen wird, oder werden sie zu neuen global players auf Weltebene?
5. Die schnelle Herausbildung von großen Arbeiterkonzentrationen in Asien, von denen die meisten Beschäftigten noch sehr jung und unerfahren sind, wirft jedoch eine Reihe von Fragen hinsichtlich der Entwicklung des Klassenkampfes und des Einflusses auf das Kräfteverhältnis zwischen den Klassen auf Weltebene auf. Die Zunahme von Klassenkämpfen und das Auftauchen von politischen Minderheiten sind dafür eindeutige Zeichen.[5] Im Gegenzug werden die sehr niedrigen Löhne und die extrem prekären Beschäftigungsverhältnisse in Ostasien von der herrschenden Klasse der entwickelten Länder dazu benutzt, um die Beschäftigten mit Arbeitsplatzverlust (Verlagerung des Arbeitsplatzes usw.) und Lohnsenkungen und einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen zu erpressen.
Wir können nur auf all diese Fragen Antworten geben und die wahren Hintergründe, Widersprüche und Grenzen des Wachstums in Asien aufzeigen, wenn wir den ganzen Fragenkomplex in den weltweiten Kontext der Entwicklung des Kapitalismus auf historischer und internationaler Ebene einbetten. Nur indem man die gegenwärtige Entwicklung in Ostasien einerseits in den Zeitraum des Beginns der Dekadenzphase seit 1914 einordnet (dies werden wir im 1. Teil tun), und andererseits die internationale Krisenentwicklung seit Ende der 1950er Jahre berücksichtigt (dies geschieht im 2. Teil), kann man umfassend das Wachstum in Asien erklären (3. Teil). Diese Achsen werden wir in diesem Artikel aufgreifen.[6]
Teil 1
Ein für den dekadenten Kapitalismus typischer Verlauf
Der Werdegang Chinas, der geprägt wurde durch das Joch des Kolonialismus und seine nicht abgeschlossene, mehrfach abgewürgte bürgerliche Revolution, ist typisch für jene Länder, die während der aufsteigenden Phase des Kapitalismus keine industrielle Revolution mehr durchführen konnten. Während China mit seinem BIP, das ein Drittel aller produzierten Güter der Welt umfasste, noch bis 1820 die erste Wirtschaftsmacht der Ende war, betrug das chinesische BIP 1950 nur noch 4.5% der Weltproduktion; d.h. ein Siebtel des vorherigen Wertes.
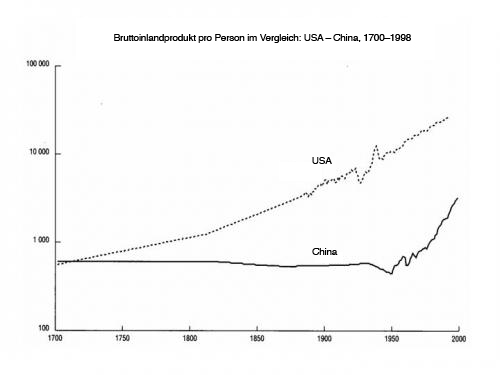
Grafik 1, Quelle Angus Maddison, Die Weltwirtschaft, OECD 2001: 45.
Die obige Statistik zeigt einen Rückgang des BIP Pro-Kopf in China von 8% während der gesamten aufsteigenden Phase des Kapitalismus. Es fiel von 600$ 1820 auf 552$ 1913. Dies verdeutlicht, dass eine richtige bürgerliche Revolution ausgeblieben ist, und dass das Land ständigen Konflikten zwischen Kriegsherren innerhalb einer geschwächten herrschenden Klasse ausgeliefert war, sowie unter dem furchtbaren Gewicht des kolonialen Jochs gelitten hat, der es nach der Niederlage im Opiumkrieg 1840 ausgesetzt wurde. Diese Niederlage stellte den Auftakt zu einer Reihe von demütigenden Verträgen dar, welche zur Aufteilung Chinas unter die Kolonialmächte führte. Derart geschwächt, war China schlecht gerüstet, um für die Bedingungen des einsetzenden Niedergangs des Kapitalismus gewappnet zu sein. Die relative Sättigung der Märkte und ihre Beherrschung durch die Großmächte, die während der gesamten Zeit des Niedergangs des Kapitalismus vorherrschen, haben China eine absolute Unterentwicklung während des größten Teils dieses Zeitraums aufgezwungen, da sein pro Kopf BIP zwischen 1913 (552$) und 1950 (439$) noch schneller zurückging (-20%).
All diese Fakten bestätigen vollauf die von der Kommunistischen Linken entwickelte Analyse, der zufolge es in der Dekadenz des Kapitalismus nicht mehr möglich ist, dass neue Länder und Mächte in einem Umfeld des global gesättigten Weltmarktes aufstreben[7]. Erst in den 1960er Jahren konnte China sein BIP wieder auf das Niveau von 1820 (600$) anheben. Danach stieg es beträchtlich an, aber erst während der letzten 30 Jahre ist das Wachstum förmlich explodiert und hat bislang in der Geschichte des Kapitalismus nie erreichte Werte erreicht[8]. Diese jüngste und außergewöhnliche Phase der Geschichte Chinas bedarf einer Erklärung, denn diese Phase scheint auf den ersten Blick viele Erkenntnisse über die Entwicklung des Kapitalismus zu widerlegen. Aber bevor wir die Wirklichkeit dieses gewaltigen Wachstums in Ostasien ergründen, müssen wir auf zwei andere Merkmale des dekadenten Kapitalismus eingehen, die von den Linkskommunisten aufgedeckt worden sind, und die den asiatischen Subkontinent stark geprägt haben: Die allgemeine Tendenz zum Staatskapitalismus einerseits, und die Eingliederung eines jeden Landes in einen imperialistischen Block mit jeweiligem Führer andererseits. Auch auf dieser Ebene scheint die jüngste Entwicklung Chinas diesen Merkmalen zu widersprechen, da China auf internationaler Ebene eher als "Einzelkämpfer" auftritt. Darüber hinaus werden ständig Reformen verabschiedet und Deregulierungen getroffen, die eher dem Manchesterkapitalismus gleichen, so wie Marx ihn in ‚Das Kapital' oder Engels in "Die Lage der arbeitenden Klasse in England" beschrieben haben. Wir wollen hier vorgreifend sagen, dass all dem nicht so ist. Einerseits werden all diese Reformen aufgrund staatlicher Initiativen und unter der strengen Kontrolle des Staates durchgeführt; andererseits hat die Implosion der beiden imperialistischen Blöcke, d.h. des US- und sowjetisch geführten, es nach 1989 ermöglicht, dass jedes Land eigenmächtig handelt. Wir wollen auf diese beiden Tatsachen näher eingehen, bevor wir den wirtschaftlichen Erfolg Ostasiens während des letzten Vierteljahrhunderts untersuchen.
Die allgemeine Infrastruktur des Staatskapitalismus im Zeitalter der Dekadenz
Wie wir 1974 in einer umfangreichen Untersuchung des Staatskapitalismus schrieben:
„Die Tendenz zur staatlichen Kontrolle ist der Ausdruck der permanenten Krise des Kapitalismus seit 1914. Es handelt sich um eine Art Anpassung des Systems, um in einem Zeitraum zu überleben, in welchem die wirtschaftliche Dynamik des Kapitalismus auf ihre historischen Grenzen stößt. Wenn die Widersprüche des Kapitalismus nur dazu führen können, dass die Welt durch eine Reihe von unvermeidbaren imperialistischen Rivalitäten und Kriegen erschüttert wird, ist der Staatskapitalismus der Ausdruck der Tendenz zur Autarkie, zur permanenten Kriegswirtschaft, der Bündelung der nationalen Kräfte, um das nationale Kapital zu schützen (...) Im Zeitalter des Niedergangs hat die permanente Krise aufgrund der relativen Sättigung der Märkte bestimmte Änderungen der Organisationsstruktur des Kapitalismus aufgezwungen (...) Weil es keine rein wirtschaftliche Lösung für diese Schwierigkeiten gibt, darf man es nicht zulassen, dass die Gesetze des Kapitalismus blind walten. Die Bourgeoisie versucht, deren Konsequenzen mit Hilfe des Staates zu beherrschen: Subventionen, Verstaatlichung von defizitären Bereichen, Kontrolle der Rohstoffe, Planung auf Landesebene, Eingriffe in die Wechselkurse usw." (Révolution Internationale, Alte Serie, Nr. 10, S. 13-14).
Diese Analyse ist nichts anderes als die Position, die die Kommunistische Internationale 1919 bezogen hatte: „Der nationale Staat, der der kapitalistischen Entwicklung einen mächtigen Impuls gegeben hat, ist für die Fortentwicklung der Produktivkräfte zu eng geworden" (Manifest der Komintern). Dieser Widerspruch zwischen den kapitalistischen Produktionsverhältnissen und der Bremswirkung, die sie seitdem auf die Entwicklung der Produktivkräfte ausüben, ist die Ursache für die allgemeine Tendenz zum Staatskapitalismus in der Niedergangsphase des Kapitalismus. Die erbarmungslose Konkurrenz auf einem mittlerweile global gesättigten und von den Großmächten kontrollierten Weltmarkt hat jeden Nationalstaat dazu gezwungen, für seine Interessen zu kämpfen, indem der Staat auf allen Ebenen eingreift: auf sozialer, politischer und ökonomischer. Im Allgemeinen spiegelt die Entwicklung des Staatskapitalismus in der Dekadenz den mittlerweile unüberwindbaren Widerspruch zwischen den immer mehr weltweiten Akkumulationsbedürfnissen des Kapitals und der engen nationalen Grundlage der bürgerlichen Eigentumsverhältnisse: „Die Verstaatlichung des wirtschaftlichen Lebens, gegen welche sich der kapitalistische Liberalismus so sträubte, ist zur Tatsache geworden. Nur zum freien Wettbewerb, sondern auch zur Herrschaft der Trusts, Syndikate und anderer wirtschaftlicher Ungetüme, gibt es keine Rückkehr", hob das Manifest der Kommunistischen Internationale ebenso hervor.
Diese Tendenzen, die nationalen Interessen des Staates in die Hände zu nehmen und sich auf den nationalen Rahmen zurückzuziehen, führten zu einer brutalen Stockung der Expansion und der Internationalisierung des Kapitals, welche die aufsteigende Phase geprägt hatten. So wuchs der Anteil der Exporte der entwickelten Länder in der aufsteigenden Phase ständig, bis er sich mehr als verdoppelte, denn von 5.5% 1830 war er 1914 auf 12.9% gestiegen (Tabelle 2). Dies verdeutlicht die frenetische Eroberung der Welt durch den Kapitalismus während der damaligen Phase.
Der Eintritt des Kapitalismus in seine Niedergangsphase sollte jedoch einen brutalen Stopp des kapitalistischen Vordringens auf der Welt bewirken. Die Stagnation des Welthandels zwischen 1914-1950 (siehe Tabelle 2), der um die Hälfte sinkende Anteil der Exporte der entwickelten Ländern an der weltweiten Produktion (von 12.9% 1913 auf 6.2% 1938 - Tabelle 2), und die Tatsache, dass das Wachstum des Welthandels oft unter dem der Produktion lag, zeigen jeweils den relativ starken Rückgang im Rahmen des Nationalstaates während der Dekadenzphase. Selbst in den ‚fettesten' Jahren des Wirtschaftswunders, in denen es zu einem starken Anstieg des internationalen Handels bis in den 1970er Jahren kam, blieb der Anteil der Exporte der entwickelten Länder (10.2%) immer noch unter dem Niveau von 1914 (12.9%) und selbst unter dem Niveau, das 1860 (10.9% - siehe Tabelle 2[9]) erreicht worden war. Erst mit dem Einzug der "Globalisierung" Mitte der 1980er Jahre überstieg der Exportanteil das ein Jahrhundert zuvor erreichte Niveau. Diese gleiche, entgegen gesetzte Dynamik zwischen aufsteigender und niedergehender Phase des Kapitalismus findet man auch auf der Ebene der Investitionsströme zwischen den Ländern. Der Anteil der direkten Auslandsinvestitionen stieg 1914 auf einen Prozentsatz von 2% des Weltbruttoindustrieproduktes, während sie trotz einer deutlichen Zunahme in der Zeit der Globalisierung 1995 nur die Hälfte des früheren Wertes (1%!) erreichten. Das Gleiche trifft für die Auslandsdirektinvestitionen der entwickelten Länder zu. Während diese von 6.6% 1980 auf 11.5% 1995 anstiegen, lag dieser Prozentsatz immer noch nicht über dem von 1914 (zwischen 12-15%). Diese ökonomische Ausrichtung auf den nationalen Rahmen und der entwickelten Länder im Zeitalter der Dekadenz kann auch noch durch folgende Tatsache verdeutlicht werden. „Am Anfang des Ersten Weltkriegs wurden 55-65% der direkten Auslandsinvestitionen in der Dritten Welt getätigt und nur 25-35% wurden in den entwickelten Ländern vorgenommen. Ende der 1960er Jahre hatte sich dieses Verhältnis umgekehrt, da 1967 nur 31% der direkten Auslandsinvestitionen der entwickelten Länder des Westens in der Dritten Welt getätigt worden waren und 61% in den entwickelten Staaten des Westens. Und seitdem hat sich diese Tendenz nur noch verstärkt (...) Gegen 1980 stieg dieser Anteil auf 78% der direkten Auslandsinvestitionen in den entwickelten Ländern und 22% in der Dritten Welt. (...) Der Umfang gegenüber dem Bruttoinlandsprodukt in den westlichen Industriestaaten betrug Mitte der 1990er Jahre zwischen 8.5% und 9%, gegen 3.5%-4% gegen 1913, d.h. mehr als das Doppelte"[10]
Während der aufsteigende Kapitalismus die Welt nach seinem Bild formte, indem immer mehr Staaten in seinen Bann gezogen wurden, sollte der Niedergang des Systems die Verhältnisse zum Zeitpunkt des Höhepunktes des Systems "einfrieren".
„Dass es unmöglich geworden ist, neue, große kapitalistische Einheiten zur Entstehung zu verhelfen, drückt sich unter anderem in der Tatsache aus, dass die sechs größten Industrieländer bereits am Vorabend des Ersten Weltkriegs die führenden Wirtschaftsmächte, wenn auch in einer anderen Reihenfolge, gestellt hatten". (Der Kampf des Proletariats im aufsteigenden und dekadenten Kapitalismus, in Internationale Revue Nr. 23, S. 25) All dies verdeutlicht den spektakulären Rückzug auf den nationalen Rahmen, welcher die ganze Niedergangsphase des Kapitalismus mittels eines massiven Rückgriffs auf die Politik staatskapitalistischer Maßnahmen prägte.
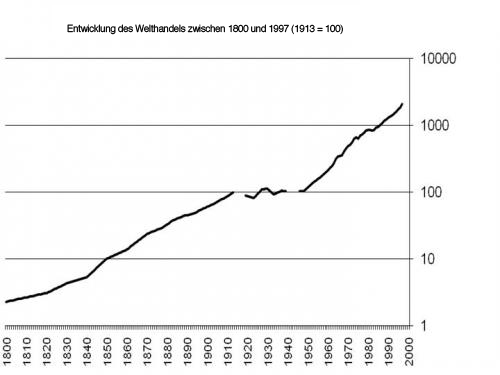
Grafik 2, Quelle: Rostow, The World Economy, History and Prospect, University of Texas Press 1978 : 662
Tabelle 2
|
Exportquote der entwickelten westlichen Staaten (% des BIP) |
|
|
1830 |
5,5 |
|
1860 |
10,9 |
|
1890 |
11,7 |
|
1913 |
12,9 |
|
1929 |
9,8 |
|
1938 |
6,2 |
|
1950 |
8 |
|
1960 |
8,6 |
|
1970 |
10,2 |
|
1980 |
15,3 |
|
1990 |
14,8 |
|
1996 |
15,9 |
|
Philippe Norel, L'invention du marché, Seuil, 2003 : 431. |
Ganz Ostasien sollte von dieser umfangreichen Rückzugsbewegung auf den Rahmen des Nationalstaates erfasst werden. Nach dem 2. Weltkrieg lebte fast die Hälfte der Weltbevölkerung außerhalb des Weltmarktes; sie war durch die Bipolarisierung der Welt zwischen zwei geostrategischen Blöcken "eingepfercht". Dieser Zustand wurde erst im Laufe der 1980er Jahre beendet. Davon betroffen waren die Ostblockstaaten, Indien, mehrere Staaten in der Dritten Welt wie Kuba, Vietnam, Kambodscha, Algerien, Ägypten usw. Diese brutale Abschottung der Hälfte der Welt vom Weltmarkt ist eine klare Verdeutlichung der relativen Sättigung des Weltmarktes. Diese Sättigung zwingt jedes nationale Kapital, direkt die Verteidigung seiner Interessen auf nationaler Ebene zu übernehmen und sich der Politik der beiden Blockführer zu unterwerfen, um in der Hölle der Dekadenz zu überleben. Diese Zwangspolitik musste allerdings scheitern. Dieser ganze Zeitraum bedeutete nur ein sehr mäßiges Wachstum für China und Indien. Vor allem im Falle Indiens lag dieses Wachstum noch unter dem Afrikas.
Tabelle 3:
|
BIP pro Kopf (Indiz 100 = 1950) |
||
|
|
1950 |
1973 |
|
Japan |
100 |
594 |
|
Westeuropa |
100 |
251 |
|
USA |
100 |
243 |
|
Welt |
100 |
194 |
|
China |
100 |
191 |
|
Afrika |
100 |
160 |
|
Indien |
100 |
138 |
|
Quelle : : Angus Maddison, L'économie mondiale, annexe C, OCDE, 2001. |
Es stimmt, dass das Wachstum Chinas das Wachstum der gesamten Dritten Welt zwischen 1950-73 übertroffen hat; aber dennoch blieb das Wachstum in diesem Zeitraum unter dem weltweiten Durchschnitt. Es war geprägt von einer schrecklichen Ausbeutung der Bauern und Arbeiter, und es war erst möglich geworden durch die intensive Unterstützung des Ostblocks bis Anfang der 1960er Jahre sowie durch die Eingliederung in den amerikanischen Einflussbereich. Zudem wurde sie geschwächt durch zwei bedeutende Rückgänge während des genannten Zeitraums - während des "Großen Sprungs nach vorne" (1958-61) und der "Kulturrevolution" (1966-70), die zum Tod von Dutzenden Millionen Bauern und Arbeitern aufgrund schrecklicher Hungersnöte und materiellen Leidens führten. Dieses globale Scheitern der Autarkiepolitik des Staates wurde von uns schon vor einem viertel Jahrhundert festgestellt: "Die protektionistische Politik hat im 20. Jahrhundert völlig ausgedient. Sie bietet der Wirtschaft in den unterentwickelten Ländern keine Gelegenheit mehr zum Luftholen, sondern führt im Gegenteil zu ihrer Strangulierung" Internationale Revue; Nr. 23, S. 27, engl./franz./span. Ausgabe). Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Staatskapitalismus keine Lösung für die Widersprüche des Kapitalismus darstellt, sondern nur ein Mittel, um Zeit zu gewinnen.
China in den jeweiligen Machtbereichen der beiden großen imperialistischen Blöcke
Da China der Konkurrenz des global gesättigten Weltmarktes, welcher von den Großmächten kontrolliert wurde, allein gegenüberstand, konnte China seine nationalen Interessen am besten vertreten, indem es sich zunächst bis Anfang der 1960er Jahre in den sowjetischen Block eingliederte, um dann später in den 1970er Jahren auf die amerikanische Seite zu wechseln. Seine Entwicklung fand auf einem Hintergrund statt, wo der Aufstieg neuer Mächte nicht mehr möglich war und diese ihre Verspätung nicht mehr aufholen konnten, wie das in der aufsteigenden Phase noch möglich gewesen war. Die Verteidigung nationalistischer Projekte der "Entwicklung" in der Dekadenz (das Projekt des Maoismus) war nur unter dieser Bedingung möglich. China bot sich dem meistbietendem in einer Zeit der bipolaren imperialistischen Blockkonfrontation in der Zeit des kalten Krieges (1945-89) an. Die Abschottung vom Weltmarkt, die Eingliederung in den sowjetischen Block und dessen massive Hilfe an China lieferten die Grundlagen für ein sicherlich sehr bescheidenes Wachstum - da es gerade unter dem Weltdurchschnitt lag - aber noch über dem Indiens und dem Rest der Dritten Welt. Tatsächlich hatte sich Indien nur teilweise vom Weltmarkt zurückgezogen. Es war gar eine Zeit lang als Führer der Blockfreien Staaten[11] aufgetreten und es musste dafür den Preis zahlen in Gestalt eines niedrigeren Wirtschaftswachstums als das Afrikas in der Zeit von 1950-73. Der Zusammenbruch der imperialistischen Blöcke nach dem Fall der Berliner Mauer (1989) und der fortgesetzte Verlust der US-Führungsrolle auf der Welt haben diesen Zwang zu einer internationalen Bipolarisierung überwunden, wodurch alle Staaten einen größeren Spielraum bei der Verfolgung ihrer eigenen Interessen erhalten haben.
Teil 2
Stellung und Entwicklung Ostasiens in der Geschichte der kapitalistischen Entwicklung
Die Scherenbewegung in Ostasien historisch betrachtet (1700-2006)
Nachdem wir die Entwicklung Ostasiens in den historischen Kontext der aufsteigenden und dekadenten Phase des Kapitalismus und in den Rahmen der Entwicklung des Staatskapitalismus und der Integration in die beiden imperialistischen Blöcke eingeordnet haben, müssen wir nun versuchen zu begreifen, warum diese Gegend der Erde die historische Tendenz zur Marginalisierung hat umkehren können. Die unten aufgeführte Tabelle zeigt, dass Indien und China 1820 mehr als die Hälfte der auf der Welt produzierten Güter (48.9%) umfassten, während ihr Anteil 1973 auf 7.7% abgefallen war. Das Gewicht der Geißel des Kolonialismus, schließlich der Eintritt des Kapitalismus in seine Niedergangsphase, führten zu einem Rückgang des Anteils Indiens und Chinas am Weltbruttosozialprodukt um das sechsfache. Oder anders ausgedrückt, als Europa und die neuen Länder sich entwickelten, kam es in Indien und China zu einem relativen Rückgang. Heute beobachten wir genau das Gegenteil. Seitdem die entwickelten Länder in die Krise geraten sind, hat sich Ostasien weiter entwickelt, so dass sein Anteil an der Weltproduktion 2006 auf 20% angestiegen ist. Wir beobachten hier also eine deutliche Scherenbewegung über die Jahre betrachtet. Als die Industriestaaten sich mächtig entwickelten, war die Entwicklung in Asien relativ rückläufig, und seitdem sich die Krise dauerhaft in den entwickelten Ländern niedergelassen hat, hat Asien angefangen, einen Boom zu durchlaufen.
Tabelle 4
|
Anteil der verschiedenen Gebiete der Welt in Prozent am weltweiten Bruttoinlandsprodukt |
||||||||
|
|
1700 |
1820 |
1870 |
1913 |
1950 |
1973 |
1998 |
2001 |
|
Europa und die neuen Länder (*) |
22,7 |
25,5 |
43,8 |
55,2 |
56,9 |
51 |
45,7 |
44,9 |
|
Rest der Welt |
19,7 |
18,3 |
20,2 |
22,9 |
27,6 |
32,6 |
24,8 |
(°) |
|
Asien |
57,6 |
56,2 |
36,0 |
21,9 |
15,5 |
16,4 |
29,5 |
|
|
Indien |
24,4 |
16,0 |
12,2 |
7,6 |
4,2 |
3,1 |
5,0 |
5,4 |
|
China |
22,3 |
32,9 |
17,2 |
8,9 |
4,5 |
4,6 |
11,5 |
12,3 |
|
Rest Asiens |
10,9 |
7,3 |
6,6 |
5,4 |
6,8 |
8,7 |
13,0 |
(°) |
|
(*) Neuen Länder = USA, Kanada, Australien, Neuseeland (°) = 37,4 : Rest der Welt und Rest Asiens |
||||||||
|
Quelle : Angus Maddison, L'économie mondiale, OCDE, 2001 : 280 |
Die Entwicklung Asiens nach dem 2. Weltkrieg
Diese Scherenbewegung wird auch anhand der Entwicklung der Wachstumszahlen in China im Vergleich zum Rest der Welt nach dem 2. Weltkrieg deutlich. Die Tabellen 3 (siehe oben) und 5 (siehe unten) zeigen, während in den entwickelten Ländern ein fortgesetztes Wachstums registriert wird, hinkten Indien und China hinterher: zwischen 1950 und 1973 erzielte Europa doppelt so hohe Werte wie Indien, Japans Wachstum war dreimal so hoch wie das Chinas und viermal so hoch wie das Indiens. Das Wachstum Indiens und Chinas lag unter dem Weltdurchschnitt. Aber danach trat genau das Gegenteil ein: zwischen 1978 und 2002 war der Jahresdurchschnitt des BIP Wachstums Chinas (pro Kopf) viermal so hoch (5.9%) wie der Weltdurchschnitt (1.4%) und Indien vervierfachte sein BIP, während dieses sich weltweit zwischen 1980 - 2005 nur um das 2.5-fache erhöhte.
Tabelle 5
|
Durchschnittliche Jahreswachstumsraten des BIP (pro Kopf) in %: |
||
|
|
1952-1978 |
1978-2002 |
|
China (bereinigte Zahlen) |
2,3 |
5,9 |
|
Welt |
2,6 |
1,4 |
|
Quelle : F. Lemoine, L'économie chinoise, La Découverte : 62. |
Erst als die zentralen Länder des Kapitalismus in die Krise gerieten, erlebten China und Indien ihren Aufschwung. Warum? Wie kann man diese Schwerenbewegung erklären? Warum kam es zu einem Wachstumsschub in Ostasien, während der Rest der Welt in die Krise abrutschte? Warum diese Kehrtwende? Wie konnte es in Ostasien zu dem starken Aufstieg kommen, während die Wirtschaftskrise sich international weiter ausdehnte. Wir werden versuchen darauf zu antworten.
Das Wiederauftauchen der Wirtschaftskrise offenbart das Scheitern all der nach dem 2. Weltkrieg eingesetzten Hilfsmittel
Als die Wirtschaftskrise Ende der 1960er Jahre wieder auftauchte, wurden all die Wachstumsmodelle, welche nach dem 2. Weltkrieg aufgeblüht waren, beiseite gefegt: das stalinistische Modell im Osten, das Keynessche Modell im Westen und das nationalistisch-militaristische Modell in der 3. Welt. Dadurch wurden die jeweiligen Ansprüche, sich als eine Lösung gegenüber den unüberwindbaren Widersprüchen des Kapitalismus zu preisen, zunichte gemacht. Die Zuspitzung derselben während der 1970er Jahre offenbarte das Scheitern der neo-keynesianischen Rezepte in allen Ländern der OECD, sie führte zum Zusammenbruch des Ostblocks während des nachfolgenden Jahrzehnts und zeigte die Machtlosigkeit all der "Alternativen" der 3. Welt (Algerien, Vietnam, Kambodscha, Iran, Kuba usw.). All diese Modelle, die während der "fetten" Jahre des Wirtschaftswunders viele Illusionen geschaffen hatten, sind später durch die darauf folgenden Rezessionen zusammengebrochen - dadurch wurde erkennbar, dass sie keineswegs eine Überwindung der inneren Widersprüche des Kapitalismus ermöglichen.
Die Konsequenzen und Reaktionen gegenüber dem Scheitern all dieser Formen waren ganz unterschiedlich. Von 1979-80 an vollzogen die westlichen Staaten eine Umkehr hin zu einem deregulierten Staatskapitalismus (der "neoliberalen" Wende, wie sie von den Medien und der Extremen Linke genannt wird). Aber weil sie durch einen ridigen Staatskapitalismus stalinistischer Art regiert wurden, sollten die Ländern Osteuropas erst nach dem Zusammenbruch des Ostblocks einen ähnlichen Weg antreten. Und es war auch der starke Druck durch die Wirtschaftskrise, welcher verschiedene Länder und Modelle in der 3. Welt dazu trieb, immer mehr in eine endlose Spirale der Barbarei hineinzurutschen (Algerien, Iran, Afghanistan, Sudan usw.), oder einfach in den Bankrott zu geraten (Argentinien, eine Vielzahl afrikanischer Staaten usw.), oder sie standen vor solch großen Schwierigkeiten, dass sie ihre Ansprüche, als Erfolgsmodelle aufzutreten, (die asiatischen Tiger und Drachen) herunterschrauben mussten. Dagegen gelang es einigen Ländern Ostasiens wie China und Vietnam, oder Indien Reformen durchzuführen, welche sie dem Weltmarkt zuführten und während der 1980er Jahre in den internationalen Akkumulationszyklus eingliederten.
Diese verschiedenen Reaktionen führten zu unterschiedlichen Ergebnissen. Wir wollen hier nur auf die westlichen Länder und Ostasien eingehen. Genau wie die Krise zunächst in den Industriezentren auftauchte, um anschließend auf die Länder der Peripherie überzuschwappen, sollte die wirtschaftliche Kehrtwende, die Anfang der 1980er Jahre in den entwickelten Ländern eintrat, die Stellung der Länder des ostasiatischen Subkontinentes im internationalen Akkumulationszyklus bestimmen.
Der Einzug des deregulierten Staatskapitalismus und einer pervertierten Globalisierung
All diesen neokeynesianischen Wiederankurbelungsmaßnahmen, welche während der 1970er Jahre angewandt wurden, gelang es nicht, eine zwischen den 1960er und 1980er Jahren um auf die Hälfte gesunkene Profitrate (siehe Tabelle unten)[12] zu erhöhen. Dieses ununterbrochene Abfallen der Rentabilität des Kapitals trieb eine Reihe von Betrieben an den Rand des Bankrotts. Die Staaten, welche sich zur Stützung ihrer Wirtschaft stark verschuldet hatten, standen praktisch vor der Zahlungsunfähigkeit. Dieser quasi-Bankrott Ende der 1970er Jahre war der Hauptgrund für den Wechsel zum deregulierten Staatskapitalismus - die pervertierte Globalisierung war die dazugehörige Begleiterscheinung. Die Hauptstoßrichtung dieser neuen Politik bestand in einem massiven und frontalen Angriff gegen die Arbeiterklasse mit dem Ziel der Wiederherstellung der Rentabilität des Kapitals. Zu Beginn der 1980er Jahre leitete die herrschende Klasse eine Reihe von massiven Angriffen gegen die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeiterklasse ein. Viele neokeynesianischen Rezepte wurden fallen gelassen. Die Arbeitskraft musste nunmehr international direkt miteinander durch Arbeitsplatzverlagerungen konkurrieren. Überall hielt international die Konkurrenz mit ihrer Deregulierung Einzug. Dieser massive gesellschaftliche Rückschritt ermöglichte eine spektakuläre Wiederherstellung der Profitraten auf einer Höhe, die heute sogar höher liegen als während des Wirtschaftswunders (siehe Tabelle 6 unten).
Die Grafik 3 weiter unten veranschaulicht diese gnadenlose Deregulierungspolitik. Mit ihrer Hilfe konnte die Bourgeoisie schon den Anteil der Lohnmasse am Bruttosozialprodukt international auf +/-10% senken. Diese Senkung ist nichts Anderes als die Umsetzung der spontanen Tendenz zur Erhöhung des Mehrwerts oder des Ausbeutungsgrades der Arbeiterklasse[13]. Diese Grafik zeigt uns auch die Stabilität der Mehrwertrate während der Zeit vor den 1970er Jahren. Diese Stabilität, die mit großen Produktivitätsfortschritten einherging, lieferte die Grundlagen für die Erfolge des Wirtschaftswunders. Diese Rate sank gar während der 1970er Jahre infolge des Drucks durch den Klassenkampf ab, welcher Ende der 1960er Jahre wieder massiv seinen Einzug hielt:
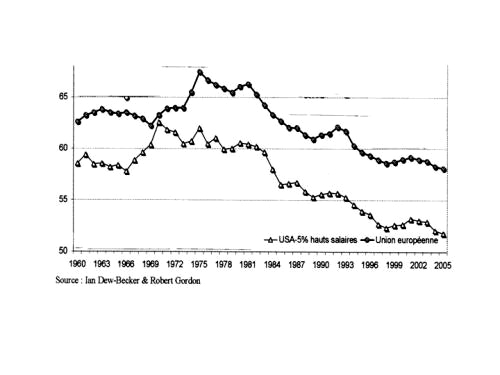
Grafik 3. Anteil der Löhne am Bruttoinlandsprodukt: USA und die Europäische Union 1960-2005.
Diese Senkung des Lohnanteils der Arbeiterklasse am Gesamtprodukt war in Wirklichkeit oft stärker als durch die Grafik deutlich wird, da diese Grafik alle Kategorien von Beschäftigten umfasst, auch beinhaltet die Grafik die Löhne, die sich die Bourgeoisie selber auszahlt[14]. Nachdem er zur Zeit des Wirtschaftswunders gesunken war, vergrößerte sich die Bandbreite der Einkommen. Der Rückgang des Lohnanteils war noch umfangreicher bei den Beschäftigten. Die Statistiken mit Unterscheidung der sozialen Kategorien belegen nämlich, dass für viele Beschäftigte - zumindest für die Qualifizierten - dieser Rückgang noch viel größeren Ausmaß war, da ihre Löhne auf das Niveau der 1960er Jahre sanken, wie dies schon in den USA bei den in der Produktion Beschäftigten der Fall war (Wochenverdienst). Während sich ihre Reallöhne zwischen 1945-1972 nahezu verdoppelt hatten, sind sie danach wieder auf das Niveau von 1960 gesunken.
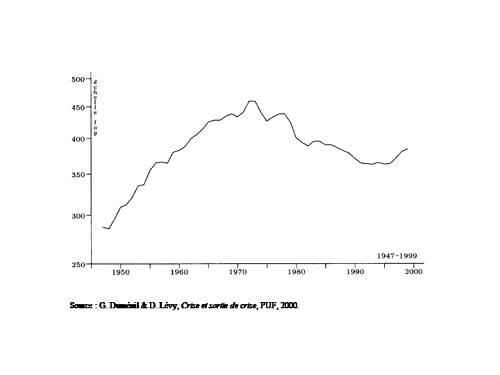
Grafik 4 - Wochenverdienst eines in der Produktion Beschäftigten (Dollarwerte von 1990): USA
Seit einem Vierteljahrhundert hat sich eine massive und breite Bewegung der absoluten Verarmung der Arbeiterklasse auf der ganzen Welt durchgesetzt. Der durchschnittliche Verlust des relativen Anteils am BIP betrug ca. +/-15-20%. Dies ist ein beträchtliches Ausmaß - zu dem auch noch die tiefgreifende Verschlechterung der Lebens- und Arbeitsbedingungen hinzugefügt werden muss. Wie Trotzki auf dem 3. Kongress der Kommunistischen Internationale sagte: SEQ CHAPTER \h \r 1"Die Theorie der Pauperisierung der Massen wurde unter den misstrauischen Pfiffen der Eunuchen, die die Tribünen der bürgerlichen Universitäten bevölkern und den Mandarinen des opportunistischen Sozialismus, begraben geglaubt. Jetzt zeigt sich nicht nur die soziale, sondern auch noch eine physiologische und biologische Pauperisierung, in ihrer ganzen Schrecklichkeit." (Eigene Übersetzung aus dem französischen)
Mit anderen Worten: die Konzessionen des Keynesschen Staatskapitalismus während des Wirtschaftswunders - die Reallöhne verdreifachten sich im Durchschnitt zwischen 1945-1980 - werden vom deregulierten Staatskapitalismus wieder zunichte gemacht. Abgesehen von diesem zeitlich begrenzten Zeitraum nach dem 2. Weltkrieg wird dadurch die Analyse der Kommunistischen Internationale und der Kommunistischen Linken vollauf bestätigt, denen zufolge in der Niedergangsphase des Systems keine wirklichen, vor allem dauerhaften Reformen mehr möglich sind.
Diese massive Senkung der Löhne führte zu zweierlei Konsequenzen. Einerseits konnte dadurch die Mehrwertrate gesteigert, damit wieder eine beträchtliche Profitrate sichergestellt werden. Diese hat nunmehr wieder das Niveau aus der Zeit des Wirtschaftswunders erreicht und dieses sogar übertroffen (siehe Grafik Nr. 6). Indem die Kaufkraft um +/-10 à 20% drastisch gesenkt wurde, sank das Volumen der aufnahmefähigen Märkte weltweit entsprechend. Damit sind direkt verbunden die schwerwiegende Zuspitzung der Überproduktionskrise auf internationaler Ebene und der Rückgang der Akkumulationsrate (das Wachstum des fixen Kapitals) auf ein historisch sehr niedriges Niveau (siehe Grafik 6). Diese doppelte Bewegung mit dem Ziel der Rentabilitätserhöhung zur Wiederherstellung der Profitrate, sowie die Notwendigkeit, neue Märkte für die Aufnahme von Waren zu finden, liegt an der Wurzel des Phänomens der Globalisierung, das in den 1980er Jahren auftauchte. Diese Globalisierung ist nicht zurückzuführen, wie uns die Vertreter der Extremen Linken und die anderen Globalisierungsgegner glauben machenwollen, auf die Dominierung durch das (bösartige) unproduktive Finanzkapital über das (gute) produktive industrielle Kapital. Einige Vertreter der Extremen Linken verlangen, das Finanzkapital müsse abgeschafft werden (oft berufen sie sich dabei unberechtigterweise auf Lenins "Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus"), andere verlangen die Besteuerung (Tobinsteuer) oder die Regulierung, je nach Antiglobalisierungscouleur oder linkssozialdemokratischer Orientierung usw.
Die historische Bedeutung der Globalisierung heute
Die ganze Literatur zur Globalisierung, ob aus linker oder rechter, aus Antiglobalisierungs- oder linksextremer Feder, stellt die Globalisierung als eine Wiederauflage der Eroberung der Welt durch kapitalistische Warenbeziehungen dar. Sehr oft stößt man dabei sogar auf berühmte Stellen aus dem Kommunistischen Manifest, wo Marx die fortschrittliche Rolle der Bourgeoisie und die Ausdehnung des Kapitalismus auf den ganzen Planeten beschrieb. Sie wird als ein umfassender Vorläufer der Herrschaft und der Herstellung der Warenbeziehung über alle Aspekte des Lebens durch kapitalistische Verhältnisse bezeichnet. Man behauptet sogar, dass es sich um die zweite Globalisierung nach der von 1875-1914 handele.
Gemäß dieser Darstellung der gegenwärtigen Globalisierung wäre der ganze Zeitraum seit dem 1. Weltkrieg bis zu den 1980er Jahren nur eine Zwischenphase isolationistischer (1914-45) oder regulierter Art (1945-1980). Während dieser Zeit hätte eine Sozialpolitik zugunsten der Arbeiterklasse (so die Vertreter der Extremen Linken) betrieben werden können, oder in dieser Zeit sei der Kapitalismus daran gehindert worden, sich grenzenlos zu entfalten (die liberale Variante). Kommen wir auf diese "glücklichen Tage" aus der Sicht der Ersten zurück oder derjenigen, die fordern "deregulieren" und "liberalisieren" wir so stark wie möglich, wie es die Letztgenannten wollen. Die Liberalen meinen, wenn man dem Markt seine ganze "Freiheit" und sein "Handlungsvermögen" ließe, würden überall auf der Welt gleich hohe Wachstumszahlen erzielt wie in China. Indem man die Arbeitsbedingungen und Löhne auf dem Niveau der Arbeiter Chinas akzeptiert, würde die Tür zu einem Paradies fulminanten Wachstums aufgestoßen! Nichts ist aber irreführender. Sowohl die linksextreme wie auch die liberale Darstellung täuschen darüber hinweg, dass die gegenwärtigen Wurzeln der Globalisierung nicht vergleichbar sind mit der Dynamik der Internationalisierung des Kapitalismus im 19. Jahrhundert:
1) Die erste Globalisierung (1880-1914) entsprach der Bildung des Weltmarktes und dem tiefen Eindringen der kapitalistischen Warenbeziehungen auf der ganzen Welt. Sie spiegelte die geographische Ausdehnung des Kapitalismus und seiner Herrschaft auf dem ganzen Planeten wider; durch die Lohn-und Nachfragesteigerungen weltweit wurde das Akkumulationsniveau angehoben Während die Dynamik des Kapitalismus im 19. Jahrhundert in eine nach oben gerichtete Spirale mündete, ist die gegenwärtige Globalisierung nur ein Phase der Entwicklung des Kapitalismus, dessen Akkumulations- und Wachstumsraten weltweit absinken. Die Lohnmasse und die kaufkraftfähige Nachfrage gingen zurück. Heute dagegen sind die Globalisierung und die grenzenlose Deregulierung nur Mittel, um den zerstörerischen Auswirkungen der historischen Krise des Kapitalismus entgegenzutreten. Die 'neoliberale' Politik der Globalisierung und Deregulierung sind eine von unzähligen Versuchen, das Scheitern früherer Mittel - Keynesianismus und Neokeynesianismus- auszugleichen. Heute befinden wir uns nicht in der Phase des triumphierenden Kapitalismus des 19. Jahrhunderts, sondern seit den 1970er Jahren stecken wir in der Phase der langsamen Agonie.
Dass das neue Ende des Akkumulationskreislaufs, der seit Ende der 1980er Jahre weltweit Einzug gehalten hat, durch eine örtlich beschränkte Entwicklung des asiatischen Subkontinentes geprägt ist, ändert nichts an dieser Charakterisierung der pervertierten Globalisierung, denn diese Entwicklung umfasst nur einen kleinen Teil der Erde. Sie ist nur möglich für eine kurze Zeit und entspricht in Wirklichkeit einem weit reichenden und massiven sozialen Rückschritt auf internationaler Ebene.
2) Während die erste Globalisierung der weltweiten Eroberung und dem Eindringen kapitalistischer Produktionsverhältnisse entsprach, und dabei immer mehr neue Nationen in diese Warenverhältnisse eingezogen wurden und die Vorherrschaft der alten Kolonialmächte noch verstärkt wurde, beschränkt sich diese heute hauptsächlich auf den südasiatischen Kontinent und lässt die Wirtschaft der entwickelten Länder und des Restes der Dritten Welt immer zerbrechlicher werden und gefährdet diese gar. Während die erste Globalisierung die geographische Ausdehnung und die Vertiefung der kapitalistischen Verhältnisse bedeutete, ist diese heute nur eine Schwankung des allgemeinen Prozesses der weltweiten Zuspitzung der Krise. Die Entwicklung beschränkt sich auf einen Teil der Welt- Ostasien- , während sich die Lage in anderen Teilen verschlechtert. Zudem kann dieser kurze Zeitraum der auf einige Gebiete beschränkten Entwicklung des asiatischen Subkontinentes nur solange dauern, wie die Rahmenbedingungen dafür bestehen. Aber diese Zeit läuft ab (siehe unten und die folgenden Teile dieses Artikels).
3) Während die erste Globalisierung mit einer allgemeinen Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiterklasse einherging, sich dabei die Reallöhne verdoppelten, bewirkt die gegenwärtige Globalisierung eine massive gesellschaftliche Regression: Druck zur Senkung der Löhne, absolute Verarmung von Dutzenden Millionen von Proletariern, massive Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, schwindelerregende Verschärfung des Ausbeutungsgrades usw. Während die erste Globalisierung einen Fortschritt für die Menschheit mit sich brachte, verbreitet die gegenwärtige Globalisierung die Barbarei auf Weltebene.
4) Während die erste Globalisierung eine Integration von immer mehr Arbeitern in die Lohnarbeitsverhältnisse der Produktion bedeutete, zerstört die gegenwärtige Globalisierung - auch wenn durch sie ein junges und unerfahrenes Proletariat in der Peripherie entsteht, die Arbeitsplätze und wälzt die Sozialstruktur der Länder um, in denen die erfahrensten Teile der Weltarbeiterklasse leben. Während die erste Globalisierung dazu neigte, die Bedingungen und das Gefühl der Solidarität zu vereinigen, verschärft die gegenwärtige Globalisierung die Konkurrenz und des "jeder für sich" im Rahmen des allgemeinen Zerfalls der gesellschaftlichen Beziehungen.
Aus all diesen Gründen ist es völlig falsch die gegenwärtige Globalisierung als eine Neuauflage des Zeitraums der aufsteigenden Phase des Kapitalismus zu bezeichnen, und zu diesem Zweck die berühmten Passagen des Kommunistischen Manifestes zu zitieren, in denen Marx die fortschrittliche Rolle der Bourgeoisie zum damaligen Zeitraum beschrieb. Heute gehört der Kapitalismus auf den Misthaufen der Geschichte. Das 20. Jahrhundert war das barbarischste Jahrhundert in der Menschheitsgeschichte. Seine Produktionsverhältnisse ermöglichen heute keinen Fortschritt mehr für die Menschheit, sondern treiben diese in eine immer größere Barbarei und erhöhen die Gefahr einer weltweiten Zerstörung der Umwelt. Die Bourgeoisie war eine fortschrittliche Klasse, welche im 19. Jahrhundert die Produktionsverhältnisse vorantrieb. Sie ist heute eine historisch überholte Klasse, welche den Planeten zerstört und nur noch Misere verbreitet, so dass die ganze Zukunft der Menschheit selbst in Frage gestellt wird. Deshalb darf man eigentlich nicht von Globalisierung reden, sondern von einer pervertieren Globalisierung.
Die politische Bedeutung der Deregulierung und der Globalisierung
Alle Medien und linken Kritiker der Globalisierung bezeichnen die neue Politik der Deregulierung und der Liberalisierung, welche von der Bourgeoisie seit den 1980er Jahren betrieben wird, als "neoliberale" Globalisierung. Diese Bezeichnungen werden ideologisch zu einem völlig verschleiernden Zweck eingesetzt. Einerseits wurde die sogenannte 'neoliberale' Deregulierung aufgrund einer Initiative und unter der Kontrolle des Staates eingeführt. Dies bedeutet bei weitem nicht, dass der 'Staat schwach' ist und die Regulierung nur durch den Markt erfolgte. Andererseits hat die heutige Globalisierung, wie wir weiter oben gesehen haben, nichts mit dem zu tun, was Marx in seinen Werken beschrieben hat. Sie spiegelt eine Etappe der Zuspitzung der Krise auf internationaler Ebene wider - und stellt keinesfalls eine wirkliche schrittweise Ausdehnung des Kapitalismus dar, wie dies in der aufsteigenden Phase des Kapitalismus im 19. Jahrhundert der Fall war; in Wirklichkeit handelt es sich um eine pervertierte Globalisierung. Dies schließt jedoch keineswegs aus, dass die Warenbeziehungen und die Lohnarbeit sich punktuell und örtlich begrenzt entwickeln (wie in Ostasien zum Beispiel), sondern der grundlegende Unterschied besteht darin, dass dieser Prozess in einem völlig unterschiedlichen Rahmen stattfand als jener während der aufsteigenden Phase des Kapitalismus.
Diese beiden Arten Politik (deregulierter Staatskapitalismus und die pervertierte Globalisierung) bringen keineswegs eine Erneuerung des Kapitalismus und auch nicht die Einführung eines neuen "Finanzkapitalismus" zum Ausdruck, wie uns die vulgären Linken und die Antiglobalisierungsbewegung weismachen wollen. Sie spiegeln vor allem die Zuspitzung der Weltwirtschaftskrise wider, da sie das Scheitern all der bislang benutzten klassischen staatskapitalistischen Maßnahmen verdeutlichen. Und die ständigen Aufrufe von gewissen Teilen der Bourgeoisie zur Erweiterung und Generalisierung dieser Politik belegen auch nichts Anderes als ein Scheitern dieser Politik. Zudem hat ein mehr als ein Viertel Jahrhundert deregularisierter und weltweit handelnder Kapitalismus die Wirtschaftskrise international nicht überwinden können. Nachdem diese Politik angewandt wurde, ist das pro-Kopf BIP seit Jahrzehnten gesunken; auch wenn es in bestimmten Regionen vorübergehend angestiegen ist (wie in Ostasien) und ein spektakuläres Wachstum stattgefunden hat.
Der Einzug des deregulierten Staatskapitalismus und die pervertierte Globalisierung sind ein klarer Ausdruck der Dekadenz des Kapitalismus
Die andauernde Krise und der fortdauernde Fall der Profitrate in den 1970er Jahren haben die Rentabilität des Kapitals und der Unternehmen angeschlagen. Ende der 1970er Jahre mussten diese sich sehr stark verschulden. Viele von ihnen standen am Rande des Bankrotts. Zusammen mit dem Scheitern der neo-keynesianischen Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft erzwang dieser Bankrott die Aufgabe der keynesianischen Rezepte zugunsten eines deregulierten Staatskapitalismus und einer pervertierten Globalisierung, deren Hauptziele in der Wiederherstellung der Profitrate, der Rentabilität der Unternehmen und der Öffnung der Märkte für den Weltmarkt liegen. Diese Umorientierung der Wirtschaftspolitik der Bourgeoisie stellte also vor allem eine Stufe der Zuspitzung der Krise auf internationaler Ebene dar. Sie bedeutete keineswegs eine neue Blütephase, die von der sogenannten "neuen Wirtschaft" getragen wurde, wie uns ständig die Medienpropaganda eintrichtern will. Die Krise hatte solche Ausmaße angenommen, dass die herrschende Klasse keine andere Möglichkeit hatte, als auf die "liberaleren" Maßnahmen zurückzugreifen, während diese die Krise und die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in Wirklichkeit nur noch weiter verschärft haben. 27 Jahre deregulierter Staatskapitalismus und die Globalisierung haben gar nichts gelöst, sondern tatsächlich die Wirtschaftskrise noch weiter zugespitzt.
Die beiden Hauptstützen der pervertierten Globalisierung, welche mit der Einführung des deregulierten Staatskapitalismus seit 1980 verbunden sind, stützten sich zum einen auf die frenetische Suche nach Standorten mit geringen Lohnkosten, um entsprechende Profitraten der Betriebe (Lieferanten usw. eingeschlossen) aufzutreiben. Andererseits suchte man unaufhörlich eine Nachfrage aus dem Ausland, um den massiven Einbruch der Binnennachfrage nach den Sparmaßnahmen mit dem Ziel der Wiederherstellung der Profitraten auszugleichen. Von dieser Politik profitierte direkt Ostasien, das sich auf diese Entwicklung entsprechend einstellte. Anstatt zur Erhöhung des internationalen Wirtschaftswachstums beizutragen, hat das sehr spektakuläre Wachstum in Ostasien zum Rückgang der Endnachfrage durch die Senkung der Lohnmasse auf Weltebene beigetragen. Deshalb haben diese beiden Formen der Politik wesentlich zur Zuspitzung der internationalen Krise des Kapitalismus geführt. Dies wird sehr deutlich anhand der unten folgenden Grafik, welche eine logische und konstante Parallele zwischen der Entwicklung der Produktion und dem Welthandel seit dem 2. Weltkrieg aufzeigt, mit Ausnahme des Zeitraums seit den 1990er Jahren, als zum ersten Mal seit 60 Jahren eine Abweichung auftauchte zwischen einem Welthandel, der an Geschwindigkeit gewann, und einer schlapp bleibenden Produktion:
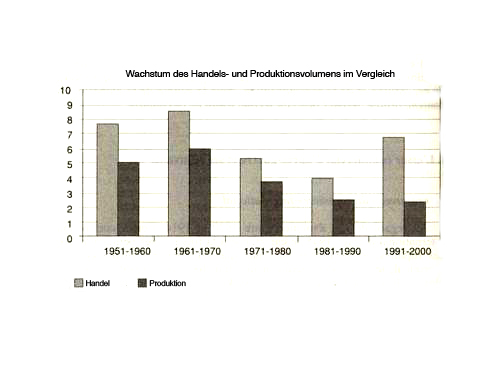
Grafik 5. Quelle: Die Erfindung des Marktes, Philippe Norel, Seuil, 2004, S.430.
Der Handel mit der Dritten Welt, welcher während des Wirtschaftswunders um mehr als die Hälfte gesunken war, stieg ab den 1990er Jahren infolge der Globalisierung wieder an. Aber davon profitierten nur einige Länder der Dritten Welt, d.h. genau diejenigen, welche sich seitdem zu den "Werkstätten" der Welt für Waren entwickelt haben, die mit Billiglöhnen hergestellt wurden[15]. Dass die Zunahme des Welthandels und der Exporte seit den 1980er Jahren nicht mit einem Anstieg des Wirtschaftswachstums einhergingen, belegt das, was wir vorhin aufgezeigt haben. Im Gegensatz zur ersten Globalisierung im 19. Jahrhundert, welche die Produktion und die Lohnmasse erweiterten, wird die heutige Globalisierung in dem Sinne pervertiert, da diese zu einem Schrumpfen der Lohnmasse führt und auch die Grundlagen der Akkumulation auf Weltebene begrenzt. Die gegenwärtige "Globalisierung" bedeutet letzten Endes nichts Anderes als ein gnadenloser Kampf zur Kürzung der Produktionskosten mittels einer massiven Reduzierung der Reallöhne. Sie offenbart, dass der Kapitalismus der Menschheit außer Verarmung und wachsender Barbarei nichts mehr anzubieten hat. Die sogenannte 'neoliberale Globalisierung' hat also nichts zu tun mit einer Rückkehr zur Eroberung der Welt durch einen triumphierenden Kapitalismus wie im 19. Jahrhundert, sondern sie bringt vor allem das Scheitern all der Hilfsmittel zum Ausdruck, um eine Wirtschaftkrise zu bekämpfen, die langsam aber unaufhörlich den Kapitalismus in den Abgrund führt.
Teil 3
Ostasien im weltweiten Akkumulationszyklus
Eine doppelte Bewegung ermöglichte somit Ostasien, sich von Beginn der 1990er Jahre an zu seinen Gunsten in den weltweiten Akkumulationszyklus einzubringen. Einerseits die Wirtschaftskrise, welche Indien und China zwang, ihre jeweiligen Modelle des stalinistischen und nationalistischen Staatskapitalismus fallen zu lassen; andererseits hat die Globalisierung Ostasien die Möglichkeit geboten, sich in den Weltmarkt einzugliedern, indem dort seitens der entwickelten Länder Investitionen getätigt und Arbeitsplätze verlagert wurden, um billige Arbeitskräfte für ihre Produktion aufzutreiben. Diese beiden Tendenzen erklären die Scherenbewegung, eines auf Weltebene rückläufigen, aber im asiatischen Subkontinent stark steigenden Wachstums.
Die Zuspitzung der Wirtschaftskrise ist somit die Ursache für diesen Abschluss des weltweiten Akkumulationszyklus, welcher Ostasien die Eingliederung als Werkstätte der Welt erlaubte. Dies geschah, indem dort Investitionen getätigt, Produktionsstätten und Zuliefererbetriebe aus den entwickelteren Ländern verlagert wurden, welche nur billige Arbeitskräfte suchten, indem die zu Billigstlöhnen produzierten Konsumgüter wieder exportiert wurden, und indem schließlich hochwertige, in Asien veredelte Waren sowie auch Luxusgüter an die neuen Reichen in Asien verkauft wurden, welche in den entwickelten Ländern hergestellt wurden.
Das Wachstum in Ostasien spiegelt keine Erneuerung des Kapitalismus sondern seine Krise wider
Das Scheitern der neokeynesianischen Maßnahmen während der 1970er Jahre in den zentralen Ländern stellte somit eine bedeutende Stufe der Zuspitzung der Wirtschaftskrise auf internationaler Ebene dar. Dieses Scheitern war die Ursache für die Aufgabe des keynesianischen Staatskapitalismus zugunsten einer mehr deregulierten Variante, deren wesentliche Achse in einem massiven und frontalen Angriff gegen die Arbeiterklasse mit dem Ziel bestand, eine seit Ende der 1960 Jahre um die Hälfte gesunkene Profitrate (siehe Grafik 6) wiederherzustellen. Dieser massive gesellschaftliche Rückschritt nahm vor allem die Form einer systematischen Politik der Verstärkung der weltweiten Konkurrenzverhältnisse unter den Lohnabhängigen an. Indem sie in die neue internationale Arbeits- und Lohnteilung eingegliedert wurden, konnten Indien und China daraus einen großen Nutzen ziehen. Während das Kapital die Entwicklungsländer in der Zeit des Wirtschaftswunders fast total vernachlässigte, wird heute massiv (fast ein Drittel) in diesen Ländern investiert. Dabei fließen die Investitionen hauptsächlich in einige asiatische Länder. Dadurch sind Indien und China zu einer Plattform für die Herstellung und den Neuexport von Waren geworden, die in ohnehin relativ produktiven Betrieben hergestellt werden, aber deren Arbeitsbedingungen mit denen der Gründerzeit des Kapitalismus vergleichbar sind. Dies ist im Wesentlichen die Erklärung für den Erfolg dieser Länder.
Ab den 1990er Jahren strömten große Kapitalmengen in diese Länder. Auch wurden viele Betriebe dorthin verlagert, um so zu den Werkstätten der Welt zu werden. Der Weltmarkt wurde mit dort zu Billiglöhnen hergestellten Waren überschwemmt. Im Gegensatz zu früher, als die Lohnunterschiede in den veralteten Betrieben und die protektionistische Politik es den Entwicklungsländern nicht gestatteten, auf den Märkten der zentralen Länder zu konkurrieren, ermöglicht heute die Liberalisierung die Produktion mit geringen Lohnkosten in den ausgelagerten Fabriken. Dadurch können viele Produkte vom Markt verdrängt werden, die in den westlichen Industriestaaten produziert werden. Das spektakuläre Wachstum Ostasiens stellt somit keine Erneuerung des Kapitalismus dar, sondern ein momentanes Aufbäumen bei seinem langsamen internationalen Abstieg. Während diese Schwankung einen beträchtlichen Teil der Welt (Indien und China) dynamisieren und gar zur Aufrechterhaltung des Weltwachstums beitragen konnte, handelt es sich in Wirklichkeit um ein Paradox, wenn man es in den Kontext der langsamen internationalen Entwicklung der Krise und der historischen Phase der Dekadenz einbettete.[16] Nur indem man mit Abstand und Überblick urteilt und all diese besondere Entwicklung in ihrem globaleren Kontext sieht, kann man ihre wirkliche Bedeutung verstehen und daraus etwas ableiten. Wenn man in der Biegung eines Mäanders steckt, kann man daraus nicht die Schlussfolgerung ziehen, dass der Fluss vom Meer in die Berge fließt.[17]
Die offensichtlich werdende Schlussfolgerung, welche mit Nachdruck betont werden muss, lautet, dass das Wachstum in Ostasien keinesfalls eine Erneuerung des Kapitalismus zum Ausdruck bringt. Dadurch kann die Vertiefung der Krise auf internationaler Ebene und vor allem in den zentralen Ländern nicht ausgemerzt werden. Das offensichtliche Paradox kann dadurch erklärt werden, dass Ostasien zu einem günstigen Zeitpunkt handeln konnte, um von einer Stufe der Zuspitzung der internationalen Krise zu profitieren, mit Hilfe derer es zur Werkstatt der Welt mit Niedrigstlöhnen werden konnte.
Das Wachstum Asiens beschleunigt die Depression weltweit
Dieser neue 'Abschluss' der Akkumulation auf Weltebene trägt zur Verschärfung der wirtschaftlichen Depression auf Weltebene bei, da sein Warenausstoß die Überproduktion nur noch weiter erhöht, indem die Endnachfrage aufgrund der relativen Senkung der weltweiten Kaufkraft und der Zerstörung einer Reihe von Gebieten oder Bereichen, die nicht mehr der weltweiten Konkurrenz standhalten können, sinkt.
Marx zeigte auf, dass es im Wesentlichen zwei Wege zur Wiederherstellung der Profitrate gibt: entweder "von oben", indem Produktivitätsgewinne erzielt werden durch die Investitionen in neue Maschinen und Produktionsverfahren, oder "von unten", indem die Löhne gesenkt werden. Da die Rückkehr der Krise Ende der 1960er Jahre sich durch einen quasi ununterbrochenen Rückgang der Produktivitätsgewinne äußerte, bestand der einzige Weg zur Wiederherstellung der Profite in einer massiven Kürzung der Löhne.[18] Die unten aufgeführte Grafik zeigte diese depressive Dynamik deutlich auf: Während des Wirtschaftswunders entwickelten sich Profitraten und die Akkumulation parallel auf einem hohen Niveau. Seit dem Ende der 1960er Jahre sind die Profitraten und die Akkumulation um die Hälfte gesunken. Nach der Einführung der Politik des deregulierten Staatskapitalismus seit den 1980er Jahren ist die Profitrate spektakulär angestiegen und sie hat sogar die Raten der Zeit des Wirtschaftswunders übertroffen. Aber trotz der Wiederherstellung der Profitraten ist die Akkumulationsrate nicht dem gleichen Rhythmus gefolgt und sie befindet sich weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau. Dies ist direkt auf die Schwäche der Endnachfrage zurückzuführen, welche durch die massive Kürzung der Lohnmasse herbeigeführt wurde, welche die Grundlage für die Wiederherstellung der Profitrate ist. Heute befindet sich der Kapitalismus in einer langsam wirkenden Rezessionsspirale: Seine Betriebe sind nunmehr rentabel, aber sie sie funktionieren auf einer immer eingeschränkteren Basis, da das Problem der Überproduktion akuter ist als je zuvor und dadurch die Akkumulationsgrundlagen begrenzt werden.
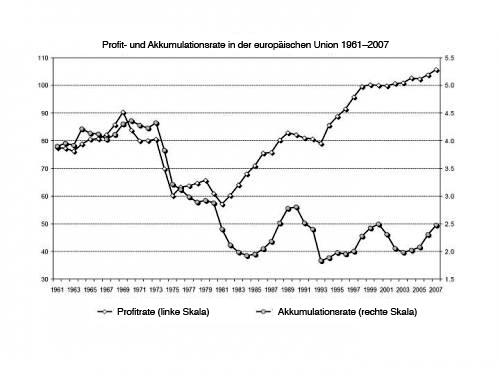
Grafik 6, Quelle: Michel Husson
Deshalb ist das gegenwärtige Wachstum in Ostasien keinesfalls ein asiatisches Wirtschaftswunder; auch handelt es sich nicht um eine Erneuerung des Kapitalismus auf Weltebene, sondern es handelt sich um eine Erscheinungsform des Versinkens in der Krise.
Schlussfolgerung
Der Ursprung, das Zentrum und die Dynamik der Krise rühren aus den zentralen Ländern. Die Verlangsamung des Wachstums, die Arbeitslosigkeit, die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen sind alles Erscheinungen, die vor dem Entwicklungsschub in Ostasien aufgetreten sind. Es waren gerade die Folgen der Krise in den entwickelten Ländern, die einen "Abschluss" der Akkumulation auf Weltebene und damit die Integration Asiens in den Weltmarkt als Werkstatt der Welt bewirkt haben. Dieser neue Abschluss verstärkt im Gegenzug die wirtschaftliche Depression in den zentralen Ländern, da auf internationaler Ebene die Überproduktion weiter zunimmt (das Angebot), während der zahlungskräftige Markt (Nachfrage ) schrumpft, nachdem die Löhne gesenkt wurden (ein für die Wirtschaft ausschlaggebender Faktor) und indem ein Großteil der weniger konkurrenzfähigen Wirtschaft in der Dritten Welt (ein marginaler Faktor auf ökonomischer, aber ein dramatischer Faktor auf menschlicher Ebene) zerstört wurde.
Die Rückkehr der historischen Krise des Kapitalismus Ende der 1960er Jahre, deren Zuspitzung in den 1970er Jahren sowie das Scheitern der seitdem eingesetzten neokeynesianischen Hilfsmittel haben den Weg bereitet für einen deregulierten Staatskapitalismus, welcher später eine pervertierte Globalisierung in den 1990er Jahren eingeleitet hat. Einige Länder konnten so zu Werkstätten mit Niedriglöhnen werden. Dies ist die Grundlage des spektakulären Wachstums in Ostasien, welches zusammen mit der Krise des stalinistischen und nationalistischen Modells der autarken Entwicklung, sich zu einem richtigen Zeitpunkt in den neuen weltweiten Akkumulationszyklus eingliedern konnte.
Frühjahr 2008, C.Mcl
[1] Siehe unseren Artikel: „Hinter der ‚Globalisierung' die Krise des Kapitalismus" in Internationale Revue 18
[2] Quellen: Weltbank: Indikatoren der Entwicklung auf der Welt 2003 (Online-Version) und Weltweite Wirtschaftsperspektiven 2004
[3] Tabelle 1: Strukturelle Verteilung als Prozent des produzierten Werts und Beschäftigung
|
Bereich |
Primärer (Landwirtschaft) |
Sekundärer (Industrie) |
Tertiärer (Dienstleistungen) |
|||
|
|
Wert |
Beschäftigung |
Wert |
Beschäftigung |
Wert |
Beschäftigung |
|
1952 |
51 |
84 |
21 |
7 |
29 |
9 |
|
1978 |
28 |
71 |
48 |
17 |
24 |
12 |
|
2001 |
15 |
50 |
51 |
22 |
34 |
28 |
|
Quelle: Statistisches Jahrbuch China 2002 |
[4] Diese Berechnungsweise ist deutlich zuverlässiger, da sie sich nicht auf die jeweiligen Werte stützt, die nur durch den Warentausch auf dem Weltmarkt entstanden sind, sondern auf den Vergleich der Preise eines Warenkorbs und Standarddienstleistungen in verschiedenen Ländern.
[5] Wir verweisen unsere Leser/Innen auf unseren Bericht zur Konferenz in Korea, auf der eine Reihe von Gruppen und Leuten zusammen kamen, die sich auf den proletarischen Internationalismus und die Kommunistische Linke berufen (siehe International Review - engl./franz./span. Ausgabe Nr. 129) sowie auf die Webseite einer neuen politischen internationalistischen Gruppe, die in den Philippinen entstanden ist und sich ebenfalls an die Kommunistische Linke anlehnt (siehe unsere Webseite).
[6] Auf unserem 17. Internationalen Kongress (siehe Internationale Revue Nr. 130; engl./franz./span. Ausgabe) hatten wir ausführlich über die Wirtschaftskrise im Kapitalismus diskutiert; dabei haben wir uns insbesondere mit dem gegenwärtigen Wachstum bestimmter ‚Schwellenländer' wie Indien oder China befasst, welches scheinbar die Analysen unserer Organisation und des Marxismus im Allgemeinen hinsichtlich des endgültigen Bankrotts der kapitalistischen Produktionsweise widerlegen. Wir haben beschlossen, in unserer Presse, insbesondere in der Internationalen Revue Vertiefungsartikel zu diesem Thema zu veröffentlichen. Dieser Artikel ist eine Konkretisierung dieser Orientierung. Wir meinen, dass er einen richtigen und nützlichen Beitrag zum Begreifen des Phänomens des chinesischen Wachstums im Rahmen der Dekadenz des Kapitalismus liefert. Die gegenwärtig in unserer Organisation stattfindende Debatte hinsichtlich der Analyse der Mechanismen, die dem Kapitalismus sein spektakulärstes Wachstum nach dem 2. Weltkrieg ermöglichten, spiegeln sich wider bei der Art und Weise, wie man die gegenwärtige Dynamik der Wirtschaft bestimmter ‚Schwellenländer', insbesondere Chinas, begreift. Gegenüber dem hier vorgelegten Artikel gibt es Differenzen, weil der Artikel die Auffassung vertritt, dass die Lohnmasse ausreichen würde, um einen aufnahmefähigen Absatzmarkt für die kapitalistische Produktion darzustellen, wenn sie nicht extrem stark "reduziert" wird. Dies spiegelt sich in der Formulierung einer Idee hinsichtlich der gegenwärtigen Globalisierung wider, die "pervertiert wird in dem Sinne, dass sie diese Lohnmasse relativ ‚komprimiert' und die Akkumulationsgrundlagen auf Weltebene um so mehr begrenzt". Die Mehrheit des Zentralorgans der Organisation vertritt diese Auffassung nicht. Sie geht stattdessen davon aus, wenn der Kapitalismus der Arbeiterklasse eine Kaufkraft ermöglicht (deren Gründe wir hier nicht näher erläutern können), die höher ist als das für die Reproduzierung der Arbeitskraft strikt Notwendige, und damit der Konsum der Arbeiter ansteigt, wird damit jedoch nicht dauerhaft die Akkumulation begünstigt.
[7] „Die Periode der kapitalistischen Dekadenz zeichnet sich dadurch aus, dass die Entstehung neuer Industrienationen unmöglich geworden ist. Jene Länder, die ihren industriellen Rückstand vor dem Ersten Weltkrieg nicht wettmachen konnten, waren dazu verdammt, in totaler Unterentwicklung zu stagnieren oder in eine chronische Abhängigkeit gegenüber den hoch industrialisierten Ländern zu geraten. So verhält es sich mit Nationen wie China oder Indien, in denen es trotz angeblicher „nationaler Unabhängigkeit" oder gar „Revolution" (d.h. die Einführung eines drakonischen Staatskapitalismus) nicht gelang, Unterentwicklung und Armut abzustreifen. (...) Die Unfähigkeit der unterentwickelten Länder, das Niveau der hoch entwickelten Mächte zu erreichen, lässt sich durch folgende Tatsachen erklären:
1) Die Märkte, die einst die außerkapitalistischen Sektoren für die Industrieländer verkörperten, sind durch die Kapitalisierung der Landwirtschaft und den fast vollständigen Niedergang des Handwerks gänzlich ausgeschöpft. (...) 3) Die außerkapitalistischen Territorien dieser Welt sind nahezu vollständig vom kapitalistischen Weltmarkt einverleibt worden. Trotz der ungeheuren Armut und der immensen Nachholbedürfnisse, trotz der völligen Unterentwicklung ihrer Wirtschaft stellen die Drittweltländer keinen zahlungsfähigen Markt dar, weil sie schlicht und einfach pleite sind. (4) Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage behindert jegliche Entstehung neuerer kapitalistischer Nationen. In einer Welt der gesättigten Märkte übertrifft das Angebot die Nachfrage bei weitem; die Preise werden durch die niedrigsten Produktionskosten bestimmt. Dadurch sind jene Länder mit den höchsten Produktionskosten gezwungen, ihre Waren für wenig Profit, wenn nicht gar mit Verlust, zu veräußern. Dies drückt ihre Akkumulationsrate auf ein niedriges Niveau. Selbst mit ihren billigen Arbeitskräften gelingt es ihnen nicht, die notwendigen Investitionen zur Anschaffung moderner Technologien zu tätigen. Das Ergebnis ist die ständige Vergrößerung des Abstandes zwischen ihnen und den Industrieländern. (...) 6) Die moderne Produktion von heute erfordert eine im Vergleich zum 19. Jahrhundert weitaus höher entwickelte Technologie und somit enorme Investitionen, die lediglich die Industriemächte zur Verfügung haben. So wirken sich auch rein technische Faktoren negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung aus." (Internationale Revue, Nr. 23, 1980, engl./franz./span. Ausgabe)
[8] Maddison, OCDE, 2001 : 283, 322.
[9] Der Welthandel entwickelte sich nach 1945 sehr schnell, sogar noch stärker als während der aufsteigenden Phase, da der Welthandel sich zwischen 1945-1971 im Laufe von 23 Jahren verfünffachte - während er zwischen 1890 und 1913 (ebenso 23 Jahre) nur um das 2.3 fache stieg. Der Anstieg des Welthandels war also doppelt so stark während des Wirtschaftswunders als während der stärksten Wachstumszeiten in der Aufstiegsphase (Quelle: Rostow, The World Economy, History and Prospect, University of Texas Press, 1978 : 662). Aber trotz dieses enormen Wachstums des Welthandels blieb der Anteil der Exporte an der Weltproduktion unterhalb des Niveaus von 1913 und selbst unterhalb des Niveaus von 1860: Die entwickelten Länder exportierten 1970 nicht mehr als ein Jahrhundert zuvor. Dies ist ein unverkennbares Zeichen eines auf sich selbst zentrierten Wachstums, das sich auf den nationalen Rahmen ausrichtet. Und zudem ist diese Beobachtung eines starken Anstiegs des Welthandels nach 1945 um so mehr zu relativieren, wenn man die Grafik genauer anschaut. Denn ein ständig wachsender Teil des Welthandels entsprach nicht wirklichen Verkäufen, sondern einem Austausch zwischen Filialen aufgrund der zunehmenden internationalen Arbeitsteilung. „Schätzungen der UNCTAD (Welthandelskonferenz) zufolge setzen allein die Multis zwei Drittel des Welthandels untereinander um. Und die Hälfte des Welthandels entspricht einem Transfer zwischen Filialen der gleichen Handelsgruppe" (Bairoch Paul, Victoires et déboires, III: 445). Diese Feststellung bekräftigt somit unsere allgemeine Schlussfolgerung, wonach die Dekadenz sich im Wesentlichen durch einen allgemeinen Rückzug eines jeden Landes auf seinen nationalen Rahmen auszeichnet und im Gegensatz zur aufsteigenden Phase nicht durch eine Ausdehnung und einen Wohlstand, der auf einer weiteren stürmischen Eroberung der Welt fußt.
[10] Alle Angaben der direkten Auslandsinvestitionen entstammen dem Buch von Bairoch Paul, 1997, Victoires et déboires, III : 436-443.
[11] Auf der indonesischen Insel Java fand zwischen dem 18.-24. April 1955 in Bandung die erste afroasiatische Konferenz statt, an der sich 29 Länder beteiligten, von denen die meisten erst kurz zuvor aus der kolonialen Abhängigkeit entlassen worden waren und die alle der Dritten Welt angehörten. Die Initiative für diesen Gipfel war von dem indischen Premierminister Nehru ausgegangen, der auf internationaler Ebene Staaten zusammenführen wollte, welche dem Griff der beiden Großmächte und der Logik des Kalten Kriegs entweichen wollten. Aber diese „blockfreien Staaten" konnten niemals wirklich unabhängig werden und der Dynamik der imperialistischen Zusammenstöße zwischen den beiden großen Blöcken (dem amerikanischen und sowjetischen) entziehen. So gehörten dieser Bewegung damals pro-westliche Staaten wie Pakistan oder die Türkei an, aber auch andere wie China und Nordvietnam, die pro-sowjetisch eingestellt waren.
[12] In der Nr. 128 unserer Internationalen Revue(engl./franz./span. Ausgabe) haben wir zwei Grafiken veröffentlicht, welche die Entwicklung der Profitrate während der letzten 150 Jahre in den USA und Frankreich widerspiegelten. Dort wird das Absinken um die Hälfte der Profitraten zwischen dem Ende der 1960er Jahre und 1980 deutlich. Es handelte sich um einen der spektakulärsten Rückgänge der Profitrate in der Geschichte des Kapitalismus weltweit.
[13] Die Mehrwertrate ist nichts anderes als die Ausbeutungsrate, welche den durch die Kapitalisten angeeigneten Mehrwert (m) ins Verhältnis setzt zur Lohnmasse (v, variables Kapital), den dieser den Beschäftigten zahlt. Ausbeutungsrate = Mehrwert/variables Kapital.
[14] Diese Grafik entstammt aus einer Untersuchung, die von Ian Dew-Becker & Robert Gordon verfasst wurde: Where did the Productivity Growth Go? Inflation Dynamics and the Distribution of Income, Washington DC, September 8-9, 2005, zugänglich im Internet auf folgender Webseite: https://zfacts.com/metaPage/lib/gordon-Dew-Becker.pdf [7].
[15] Diese niedrigen Herstellungskosten erklären die Stabilisierung auf hohem Niveau des Teils der Produktion, welche zwischen 1980 (15,3%) und 1996 15,9%) exportiert wurde. Dieser Anteil wird viel höher, wenn man ihn nicht nach seinem Wert, sondern nach Umfang misst: 19,1% im Jahre 1980 und 28,6% im Jahre 1996.
[16] Während das Weltbruttoinlandsprodukt pro Kopf jedes Jahrzehnt seit den 1960er Jahren gesunken ist: 3,7% (1960-69) ; 2,1% (1970-79), 1,3% (1980-89) ; 1,1% (1990-1999) und 0,9% für 2000-2004 kann man jetzt davon ausgehen - wenn nicht eine tiefe Rezession vor dem Ende des Jahrzehnts ausbricht, was sehr wahrscheinlich ist, dass der Durchschnitt für das Jahrzehnt 2000-2010 zum ersten Mal wesentlich höher liegen könnte als im Vergleich zum Jahrzehnt zuvor. Diese Steigerung ist vor allem auf die wirtschaftliche Dynamik in Ostasien zurückzuführen. Aber dieser Anstieg muss stark relativiert werden, denn wenn man deren Parameter untersucht, kann man feststellen, dass das Weltwachstum seit dem Crash der "New Economy" (2001-2002) sich hauptsächlich auf eine große Verschuldung der Haushalte und amerikanische Rekordhandelsdefizite stützte. Die US-Privathaushalte (wie auch die vieler anderer europäischer Länder) haben das Wachstum aufgrund einer starken Verschuldung nach einer Umschuldung ihrer Hypothekenkredite getragen (welche durch die Politik der Niedrigzinsen zur Ankurbelung des Wachstums betrieben wurde), so dass heute die Gefahren eines Immobiliencrashs erkennbar sind. Gleichzeitig haben die öffentliche Verschuldung, vor allem auch die Handelsdefizite, Rekordniveaus erreicht, welche ebenso stark das Wachstum auf der Welt mit getragen haben. Wenn man die Zahlen näher untersucht, wird diese wahrscheinliche Verbesserung während des ersten Jahrzehnts in diesem Jahrhundert erreicht worden sein, indem man viele Wechsel auf die Zukunft ausgestellt hat.
[17]Diese Art Anstieg ist keineswegs überraschend und sie traten auch im Verlauf der Dekadenz des Kapitalismus relativ häufig auf. Während dieser Phase bestand der Daseinsgrund der Politik der Bourgeoisie und insbesondere der staatskapitalistischen Politik darin, die wirtschaftlichen Gesetze und Regeln auszuhebeln, um ein System zu retten versuchen, welches unvermeidlich zum Bankrott neigt. Insbesondere während der 1930er Jahre wurden solche Maßnahmen schon ergriffen. Damals schon ließen viele staatskapitalistische Maßnahmen sowie massive Aufrüstungsprogramme viele vorübergehend glauben, dass man die Krise im Griff habe und es sogar wieder einen Aufschwung geben könnte: New Deal in den USA, Volksfront in Frankreich, DeMan-Plan in Belgien, Fünfjahrespläne in der UdSSR, Faschismus in Deutschland usw.
[18] Wir verweisen unsere Leser auf einen Artikel in unserer Internationale Revue Nr. 121, (engl./franz./span. Ausgabe) - in welcher wir auf diesen Prozess eingehen und empirische Angaben liefern.
Geographisch:
- Asien [8]
Aktuelles und Laufendes:
Theoretische Fragen:
- Politische Ökonomie [12]
Erbe der kommunistischen Linke:
Deutschland 1918 – 19, /1 Der Krieg und die Erneuerung der internationalistischen Prinzipien durch das Proletariat
- 6103 Aufrufe
Es ist 90 Jahre her, seitdem dieproletarische Revolution mit den Kämpfen von 1918 und 1919 in Deutschland ihrentragischen Höhepunkt erreicht hatte. Nach der heroischen Machtergreifung durchdas russische Proletariat im Oktober 1917 wechselte das Hauptschlachtfeld derWeltrevolution nach Deutschland. Dort wurde der entscheidende Kampf gefochtenund verloren. Die Weltbourgeoisie strebte stets an, diese Ereignisse historisch
Es ist 90 Jahre her, seitdem die proletarische Revolution mit den Kämpfen von 1918 und 1919 in Deutschland ihren tragischen Höhepunkt erreicht hatte. Nach der heroischen Machtergreifung durch das russische Proletariat im Oktober 1917 wechselte das Hauptschlachtfeld der Weltrevolution nach Deutschland. Dort wurde der entscheidende Kampf gefochten und verloren. Die Weltbourgeoisie strebte stets an, diese Ereignisse historisch in Vergessenheit geraten zu lassen. Das geht soweit, dass sie zwar nicht abstreiten kann, dass diese Kämpfe stattgefunden hatten, dass sie aber vorgibt, dass letztere nur auf „Frieden" und „Demokratie" abgezielt hätten - zu den glückseligen Bedingungen, die gegenwärtig im kapitalistischen Deutschland herrschen. Ziel dieser Artikelreihe, die wir hiermit beginnen, ist es aufzuzeigen, dass die revolutionäre Bewegung in Deutschland die Bourgeoisie in dem zentralen Land des europäischen Kapitalismus nahe an den Abgrund gerückt hatte, den Verlust ihrer Klassenherrschaft. Trotz ihrer Niederlage ist die Revolution in Deutschland wie jene in Russland ein Ansporn für uns heute. Sie erinnert uns daran, dass es nicht nur notwendig, sondern auch möglich ist, die Herrschaft des Weltkapitalismus zu stürzen.
Diese Reihe teilt sich in fünf Teile auf. Der erste Teil wird sich der Frage widmen, wie sich das revolutionäre Proletariat angesichts des I. Weltkrieges um sein Prinzip des proletarischen Internationalismus scharte. Teil 2 wird sich mit den revolutionären Kämpfen von 1918 beschäftigen. Teil 3 wird sich dem Drama der Formierung einer revolutionären Führung widmen, konkretisiert am Beispiel des Gründungskongresses der deutschen Kommunistischen Partei Ende 1918. Teil 4 wird die Niederlage von 1919 untersuchen. Der letzte Teil wird sich mit der historischen Bedeutung der Ermordung Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts sowie mit der Hinterlassenschaft dieser Revolutionäre für uns heute widmen.

I. Niederlage und Auflösung
Die internationale revolutionäre Welle, die gegen den I. Weltkrieg einsetzte, fand nur einige Jahre nach der größten politischen Niederlage statt, die die Arbeiterbewegung bis dahin erlitten hatte: der Zusammenbruch der sozialistischen Internationale im August 1914. Es ist daher wichtig zu begreifen, warum dieser Krieg stattfinden konnte und die Internationale versagte, um den Charakter und Verlauf der Revolutionen in Russland und besonders in Deutschland zu verstehen.
Der Marsch in den Krieg
Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts lag der Weltkrieg in der Luft. Hektisch begannen die imperialistischen Großmächte ihn vorzubereiten. Die Arbeiterbewegung hatte ihn vorausgesagt und vor ihm gewarnt. Doch zunächst wurde sein Ausbruch hinausgezögert - durch zwei Faktoren. Einer von ihnen war die unzureichende militärische Vorbereitung der wichtigsten Protagonisten. Deutschland beispielsweise war erst dabei, den Aufbau einer Kriegsflotte zu vervollständigen, die gegenüber Großbritannien, dem Beherrscher der Weltmeere, bestehen konnte. Es musste erst die Insel Helgoland in eine hochseetüchtige Marinebasis umwandeln und vollendete den Bau eines Kanals zwischen der Nordsee und dem Baltikum. Als das erste Jahrzehnt des Jahrhunderts sich dem Ende näherte, standen diese Vorbereitung kurz vor ihrem Abschluss. Dies rückte den zweiten Verzögerungsfaktor um so mehr in den Vordergrund: die Angst vor der Arbeiterklasse. Die Existenz dieser Furcht war keine bloße spekulative Hypothese der Arbeiterbewegung. Sie wurde offen von den Hauptrepräsentanten der Bourgeoisie ausgedrückt. Von Bülow, eine führende politische Figur im deutschen Staat, erklärte, dass es vornehmlich die Angst vor der Sozialdemokratie war, die die herrschende Klasse dazu veranlasste, den Krieg zu verschieben. Paul Rohrbach, der infame Propagandist der unverhohlen imperialistischen Kreise der Kriegsbefürworter in Berlin, schrieb: „... Zitat ..." General von Bernhard, ein prominenter Militärtheoretiker dieser Tage, warnte in seinem Buch „Über den zeitgenössischen Krieg", dass die moderne Kriegführung wegen der Notwendigkeit, Millionen von Menschen zu disziplinieren und zu mobilisieren, ein enormes Risiko sei. Solche Einsichten basierten nicht allein auf theoretischen Betrachtungen, sondern auch auf der praktischen Erfahrung aus dem ersten imperialistischen Krieg des 20. Jahrhunderts zwischen Großmächten. Dieser Krieg - zwischen Russland und Japan - verhalf der revolutionären Bewegung von 1905 in Russland zum Leben.
Solche Erwägungen nährten die Hoffnung innerhalb der Arbeiterbewegung, dass die herrschende Klasse es nicht wagen würde, in den Krieg zu ziehen. Diese Hoffnungen hatten ihren Anteil daran, dass die Divergenzen innerhalb der Sozialistischen Internationale just zu dem Zeitpunkt übertüncht wurden, als die Notwendigkeit einer proletarischen Klärung die offene Debatte erforderte. Die Tatsache, dass keine der verschiedenen Strömungen innerhalb der sozialistischen Bewegung den Krieg „wollte", schuf die Illusion der eigenen Stärke und Einheit. Doch der Reformismus und Opportunismuswaren prinzipiell nicht unvereinbar mit dem imperialistischen Krieg, sondern befürchteten lediglich den Verlust ihres juristischen und finanziellen Status im Falle seines Ausbruchs. Das „marxistische Zentrum" um Kautsky wiederum fürchtete den Krieg hauptsächlich deswegen, weil er die Illusion einer Einheit in der Arbeiterbewegung, die es um jeden Preis zu verteidigen entschlossen war, zerstören würde.
Was zugunsten der Fähigkeit der Arbeiterklasse sprach, den Ausbruch eines Weltkrieges zu verhindern, war vor allem die Intensität des Klassenkampfes in Russland. Dort hatten die Arbeiter nicht lange gebraucht, um sich von der Niederlage der 1905er Bewegung zu erholen. Am Vorabend des I. Weltkrieges gewann im zaristischen Herrschaftsbereich eine neue Welle von Massenstreiks an Fahrt. In einem gewissen Umfang ähnelte die damalige Lage der Arbeiterklasse in Russland jener im China von heute - eine Minderheit in der Gesamtbevölkerung zwar, aber dafür hochkonzentriert in modernen Fabriken, die vom internationalen Kapital finanziert wurden, brutal ausgebeutet in einem rückständigen Land, dem es an den politischen Kontrollmechanismen des bürgerlichen parlamentarischen Liberalismus mangelte. Mit einem gewichtigen Unterschied: das russische Proletariat wurde in den sozialistischen Traditionen des Internationalismus erzogen, während die chinesischen ArbeiterInnen heute immer noch unter dem Albtraum der nationalistisch-stalinistischen Konterrevolution leiden.
All dies machte Russland zu einer Bedrohung der kapitalistischen Stabilität.
Aber Russland war nicht typisch für das internationale Gleichgewicht der Klassenkräfte. Im Mittelpunkt des Kapitalismus und der imperialistischen Spannungen standen West- und Mitteleuropa. Der Schlüssel zur Weltlage befand sich nicht in Russland, sondern in Deutschland. Dies war das Land, das die Weltherrschaft der Kolonialmächte am meisten herausforderte. Und es war das Land mit der höchstkonzentrierten Arbeiterklasse, eine Klasse, deren sozialistische Erziehung am weitesten gediehen war. Die politische Rolle der deutschen Arbeiterklasse wurde von der Tatsache veranschaulicht, dass in Deutschland die Gewerkschaften von den sozialistischen Parteien gegründet worden waren, während in Großbritannien - der anderen führenden kapitalistischen Nation in Europa - die sozialistische Bewegung ein bloßes Anhängsel der Gewerkschaftsbewegung zu sein schien. In Deutschland standen die Tageskämpfe der ArbeiterInnen traditionell im Lichte des großen sozialistischen Endziels.
Ende des 19. Jahrhunderts begann jedoch ein Prozess der De-Politisierung der sozialdemokratischen Gewerkschaften in Deutschland, ihre „Emanzipation" von der sozialistischen Partei. Die Gewerkschaften zweifelten offen die Existenz einer Einheit zwischen Bewegung und Ziel an. Der Parteitheoretiker Eduard Bernstein verallgemeinerte dieses Bestreben mit seiner berühmten Formulierung: „Das Ziel ist mir nichts, die Bewegung alles". Diese Infragestellung der führenden Rolle der Sozialdemokratie in der Arbeiterbewegung, des Vorrangs des Ziels über die Bewegung brachte die sozialistische Partei in Konflikt mit ihren eigenen Gewerkschaften. Nach dem Massenstreik 1905 in Russland verschärfte sich dieser Konflikt. Er endete in einem Triumph der Gewerkschaften über die Partei. Unter dem Einfluss des„Zentrums" um Kautsky - der um jeden Preis die „Einheit" der Arbeiterbewegung aufrechterhalten wollte - beschloss die Partei, dass die Frage des Massenstreiks eine Angelegenheit der Gewerkschaften sei1.Doch der Massenstreik beinhaltete die ganzen Fragen der kommendenproletarischen Revolution! Auf diese Weise wurde die deutsche und die internationale Arbeiterklasse am Vorabend des I. Weltkrieges politisch entwaffnet.
Die Erklärung ihres nicht-politischen Charakters bereitete die Integration der Gewerkschaften in den kapitalistischen Staat vor. Somit hatte die herrschende Klasse, was sie benötigte, um die ArbeiterInnen für den Krieg zu mobilisieren. Diese Mobilisierung im Herzen des Kapitalismus würde ihrerseits ausreichend sein, um die ArbeiterInnen in Russland - für die Deutschland der Hauptbezugspunkt war - zu demoralisieren und desorientieren und somit die Stoßkraft der dortigen Massenstreiks zu brechen.
Das russische Proletariat, das sich seit 1911 in Massenbewegungen engagierte, hatte einschlägige Erfahrungen mit Wirtschaftskrisen, Kriegen und revolutionären Kämpfen. Nicht so in West- und Mitteleuropa. Dort brach der Weltkrieg am Ende einer langen Phase der wirtschaftlichen Entwicklung aus, der realen Verbesserungen der Lebensbedingungen der ArbeiterInnen, der steigenden Löhne und sinkenden Arbeitslosigkeit, der reformistischen Illusionen. Eine Phase, in der größere Kriege sich auf die Peripherie des Weltkapitalismus beschränkten. Die erste große Weltwirtschaftskrise des dekadenten Kapitalismus sollte erst 15 Jahre später ausbrechen - 1929. Die Epoche der Dekadenz begann nicht mit einer Wirtschaftskrise, wie die Arbeiterbewegung traditionell erwartete, sondern mit der Krise des Weltkrieges. Mit der Niederlage und der Isolierung des linken Flügels der Arbeiterbewegung in der Frage des Massenstreiks gab es keinen Grundmehr für die Bourgeoisie, den Sprung in den imperialistischen Krieg weiter hinauszuzögern. Im Gegenteil: jede weitere Verzögerung hätte sich als fatal für ihre Pläne erwiesen. Ein weiteres Abwarten konnte nur bedeuten: Warten auf die Wirtschaftskrise, auf den Klassenkampf, auf die Entwicklung eines revolutionären Bewusstseins ihrer Totengräber!
Der Zusammenbruch der Internationale
Somit war der Weg zum Weltkrieg frei. Sein Ausbruch führte zum Auseinanderplatzen der Sozialistischen Internationale. Am Vorabend des Krieges organisierte die Sozialdemokratie noch Massenprotestdemonstrationen und Versammlungen in ganz Europa. Die SPD-Führung in Deutschland sandte Friedrich Ebert (einem der künftigen Mörder der Deutschen Revolution) mit dem Parteivermögen nach Zürich in die Schweiz, um dessen Beschlagnahmung zu verhindern, und den stets wankelmütigen Hugo Haase nach Brüssel, um den internationalen Widerstand gegen den Krieg zu organisieren. Doch es war eine Sache, sich dem Krieg entgegenzustellen, bevor er ausgebrochen war. Eine ganz andere war es, Stellung gegen ihn zu beziehen, war er einmal ausgebrochen. Und hier stellten sich die Gelübde der proletarischen Solidarität, auf dem internationalen Kongress in Stuttgart 1907 einmütig geleistet und 1912 in Basel erneuert, als bloße Lippenbekenntnisse heraus. Selbst einige linke Befürworter scheinbar radikaler Sofortaktionen gegen den Krieg - Mussolini in Italien, Hervé in Frankreich - wechselten nun ins Lager des Chauvinismus.
Jeder wurde von dem Ausmaß des Fiaskos der Internationale überrascht. Es ist allgemein bekannt, dass Lenin zunächst annahm, die Pro-Kriegs-Deklarationen der deutschen Parteipresse seien Polizeifälschungen, die darauf abzielten, die ausländische sozialistische Bewegung zu destabilisieren. Auch die Bourgeoisie schien von dem Ausmaß überrascht zu sein, in dem die Sozialdemokratie ihre Prinzipien verraten hatte. Sie hatte hauptsächlich damit gerechnet, dass die Gewerkschaften die ArbeiterInnen mobilisieren, und sie hatte am Vorabend des Kriegs Geheimvereinbarungen mit deren Führung erreicht. In einigen Ländern widersetzten sich jedoch wichtige Teile der Sozialdemokratie dem Krieg. Dies zeigt, dass die politische Öffnung für den Weg zum Krieg nicht automatisch bedeutete, dass die politischen Organisationen der Klasse Verrat begehen mussten. Um so auffälliger war das Versagen der Sozialdemokratie in den führend am Krieg beteiligten Nationen. In Deutschland schafften es in einigen Fällen auch die entschlossensten Kriegsgegner nicht, ihre Stimme zu erheben. In der parlamentarischen Reichtagsfraktion, in der 14 Mitglieder gegen die Kriegskredite stimmten und 78 dafür, unterwarf sich selbst Karl Liebknecht zunächst der traditionellen Parteidisziplin.
Wie war das zu erklären?
Zu diesem Zweck müssen wir natürlich zunächst die Ereignissein ihren historischen Kontext setzen. Hier sind die Veränderungen in den fundamentalen Bedingungen des Klassenkampfes durch den Eintritt in eine neue Epoche der Kriege und Revolutionen, des historischen Niedergangs des Kapitalismus entscheidend. Erst durch diesen historischen Zusammenhang können wir vollständig erfassen, dass das Überwechseln der Gewerkschaften in das Lager der Bourgeoisie historisch unvermeidbar war. Da diese Organe, Ausdrücke eines spezifischen, unreifen Niveaus des Klassenkampfes, naturgemäß niemals revolutionär waren, konnten sie in einer Epoche, in der eine effektive Verteidigung der unmittelbaren Interessen jeglichen Teils des Proletariats notwendigerweise auf die Revolution hinausläuft, nicht mehr ihrer ursprünglichen Klasse dienen und nur überleben, indem sie zum feindlichen Lage überliefen.
Doch was die Rolle der Gewerkschaften so vollständig erklärt, erweist sich bereits bei der Untersuchung des Falles der sozialdemokratischen Parteien als unvollständig. Es trifft zu, dass mit dem I. Weltkrieg diese Parteien ihr Gravitätszentrum, nämlich die Mobilisierungen für die Wahlen, verloren hatten. Es trifft ebenfalls zu, dass die veränderten Bedingungen den politischen Massenparteien des Proletariats allgemeinhin die Basis genommen hatten. Angesichts der Kriege wie auch der Revolutionen musste eine proletarische Partei nun in der Lage sein, auch gegen den Strom zu schwimmen und sich selbst der herrschenden Stimmung in der Klasse insgesamt zu widersetzen. Doch die Hauptaufgabe einer politischen Organisation des Proletariats - die Verteidigung seines Programms und besonders des proletarischen Internationalismus - änderte sich nicht in der neuen Epoche. Im Gegenteil, sie wurde noch wichtiger. Obwohl es also eine historische Notwendigkeit war, dass die sozialistischen Parteien in eine Krise stürzten und dass sogar ganze Strömungen, die vom Reformismus und Opportunismus verseucht waren, Verrat begehen und in der Bourgeoisie aufgehen, erklärt dies nicht vollständig das, was Rosa Luxemburg die „Krise der Sozialdemokratie" nannte.
Es ist auch wahr, dass ein solch fundamentaler historischer Wechsel notwendigerweise eine programmatische Krise auslöst; alte und bewährte Taktiken und sogar Prinzipien werden plötzlich out of date, wie die Teilnahme an den parlamentarischen Wahlen, die Unterstützung nationaler Bewegungen oder der bürgerlichen Revolution. Doch sollten wir hier im Kopf behalten, dass viele damalige Revolutionäre nichtsdestotrotz in der Lage waren, dem proletarischen Internationalismus treu zu bleiben, obwohl sie noch nicht diese politischen und taktischen Implikationen begriffen.
Jeder Erklärungsansatz, der allein von der Grundlage der objektiven Bedingungen ausgeht, wird darin enden, alles, was in der Geschichtepassiert, als von Anfang an unvermeidlich zu betrachten. Diese Betrachtungsweise stellt die Möglichkeit in Frage, von der Geschichte zulernen, da wir wiederum ebenfalls das Produkt unserer eigenen „objektiven Bedingungen" sind. Kein Marxist wird bei vollem Verstand die Wichtigkeit dieser objektiven Bedingungen bestreiten. Doch wenn wir die Erklärung untersuchen, die die damaligen Revolutionäre selbst für die Katastrophe des Sozialismus 1914hatten, entdecken wir, dass sie vor allem die Bedeutung der subjektiven Faktoren betonten.
Einer der Hauptgründe für den Niedergang der sozialistischen Bewegung lag in ihrem illusorischen Gefühl der Unbezwingbarkeit, ihrer irrigen Überzeugung in der Gewissheit ihres eigenen künftigen Triumphes. In der Zweiten Internationale basierte diese Überzeugung auf drei Entwicklungsbedingungen des Kapitalismus, die bereits von Marx ausgemacht worden waren. Diese waren: die Konzentration von Kapital und Produktivkräften einerseits und des besitzlosen Proletariats andererseits; die Eliminierung der gesellschaftlichen Zwischenschichten, die den Hauptwiderspruch zwischen den Klassen verwischen; und die wachsende Anarchie der kapitalistischen Produktionsweise, insbesondere in Gestalt der Wirtschaftskrisen, die die Totengräber des Kapitalismus dazu treiben, das System in Frage zu stellen. Diese Einsichten waren in sich selbstvollkommen schlüssig. Da diese drei Vorbedingungen für den Sozialismus das Produkt objektiver Widersprüche sind, die sich unabhängig vom Willen jeglicher Gesellschaftsklassen entfalten und sich langfristig unvermeidlich durchsetzen, führen sie zu zwei sehr problematischen Schlussfolgerungen. Erstens, dass der Triumph des Sozialismus unvermeidbar sei. Zweitens, dass sein Sieg nur verhindert werden könne, wenn die Revolution zu früh ausbräche, wenn die Arbeiterbewegung auf Provokationen hereinfiele.
Diese Schlussfolgerungen waren um so gefährlicher, als sie durchaus, aber nur teilweise zutrafen. Der Kapitalismus produziert unvermeidlicherweise die materiellen Vorbedingungen für die Revolution und für den Sozialismus. Und die Gefahr, von der herrschenden Klasse zu vorzeitigen Konfrontationen provoziert zu werden, ist eine reale. Wir werden die ganze tragische Bedeutung dieser Frage im dritten und vierten Teil dieser Artikelreihe sehen.
Doch das Problem mit diesem Schema der sozialistischen Zukunft besteht darin, dass es keinen Platz für das neue Phänomen der imperialistischen Kriege zwischen den modernen kapitalistischen Mächten ließ. Die ganze Frage des Weltkrieges passte nicht in dieses Schema. Wir haben bereits gesehen, dass die Arbeiterbewegung das unvermeidliche Heranreifen eines Krieges erkannt hatte, lange bevor er tatsächlich ausbrach. Doch für die Sozialdemokratie in ihrer Gesamtheit führte diese Erkenntnis überhaupt nicht zu der Schlussfolgerung, dass der Triumph des Sozialismus nicht mehr unvermeidbar war. Diese beiden Seiten in der Analyse der Wirklichkeit blieben in einer Weisegetrennt voneinander, die nahezu schizophren anmutet. Solch eine Unkohärenz ist, auch wenn sie fatal sein kann, keinesfalls unüblich. Viele der großen Krisen und Desorientierungen in der Geschichte der Arbeiterbewegung resultierten aus diesem Problem, in den Schemata der Vergangenheit eingesperrt zu sein, aus einem Bewusstsein, das hinter der Realität hinterherhinkte. Wir können das Beispiel der Unterstützung für die provisorische Regierung und die Fortsetzung des Krieges durch die bolschewistische Partei nach der Februarrevolution in Russland 1917 erwähnen. Die Partei ist dem Schema einerbürgerlichen Revolution zum Opfer gefallen, das aus dem Jahre 1905 stammte und seine Unzulänglichkeit im neuen Kontext des Weltkrieges enthüllte. Erst Lenins Aprilthesen und Wochen intensiver Diskussionen öffneten den Weg aus dieser Krise.
Friedrich Engels war kurz vor seinem Tode 1895 der erste, der die notwendigen Schlussfolgerungen aus der Perspektive eines allgemeinen Krieges in Europa zog. Er erklärte, dass sie die historische Alternative zwischen Sozialismus und Barbarei bedingt. Doch nicht einmal Engels konnte sofort alle Schlussfolgerungen aus dieser Einsicht ziehen. So gelang ihm nicht zuerkennen, dass das Erscheinen der oppositionellen Strömung „Die Jungen" in der SPD ein wahrhafter Ausdruck der gerechtfertigten Unzufriedenheit mit einem Handlungsrahmen (der sich vornehmlich auf den Parlamentarismus orientierte)war, der größtenteils unzureichend geworden war. Engels warf angesichts der letzten Krise der deutschen Partei sein ganzes Gewicht für jene in die Waagschale, die im Namen der Geduld und der Notwendigkeit, sich nicht provozieren zu lassen, die Aufrechterhaltung des Status quo der Parteiverteidigten.
Es war Rosa Luxemburg, die in ihrer Polemik gegen Bernstein zur Jahrhundertwende den entscheidenden Schluss aus Engels‘ Vision des„Sozialismus oder Barbarei" zog: Obwohl die Geduld eine der höchsten Tugenden der Arbeiterbewegung bleibt und vorzeitige Konfrontationen vermieden werden müssen, besteht die Hauptgefahr historisch nicht mehr darin, dass die Revolution zu früh kommt, sondern dass sie zu spät kommen könnte. Diese Auffassung legt die ganze Betonung auf die aktive Vorbereitung der Revolution, auf die zentrale Bedeutung des subjektiven Faktors.
Dieser Schlag gegen den Fatalismus, der dabei war, die Zweite Internationale zu beherrschen, diese Restaurierung des revolutionären Marxismus sollte zu einem der Kennzeichen der gesamten revolutionären Linken vor und während des I. Weltkrieges werden.2
Wie Rosa Luxemburg in ihrer „Krise der Sozialdemokratie" schrieb: „Der wissenschaftliche Sozialismus hat uns gelehrt, die objektiven Gesetze der geschichtlichen Entwicklung zu begreifen. Die Menschen machen ihre Geschichte nicht aus freien Stücken, aber sie machen sie selbst. Das Proletariat ist in seiner Aktion von dem jeweiligen Reifegrad der gesellschaftlichen Entwicklung abhängig, aber die geschichtliche Entwicklung geht nicht jenseits des Proletariats vor sich, es ist in gleichem Maße ihre Triebfeder und Ursache, wie es ihr Produkt und ihre Folge ist."
Eben weil sie die objektiven Gesetze der Geschichte entdeckt hatte, kann zum ersten Mal in der Geschichte eine gesellschaftliche Kraft - das klassenbewusste Proletariat - ihren Willen bewusst einsetzen. Das Proletariat kann nicht nur Geschichte machen, sondern auch bewusst ihren Verlaufbeeinflussen.
„Der Sozialismus ist die erste Volksbewegung der Weltgeschichte, die sich zum Ziel setzt, und von der Geschichte berufen ist, in das gesellschaftliche Tun der Menschen einen bewußten Sinn, einen planmäßigen Gedanken und damit den freien Willen hineinzutragen. Darum nennt Friedrich Engels den endgültigen Sieg des sozialistischen Proletariats einen Sprung der Menschheit aus dem Tierreich in das Reich der Freiheit. Auch dieser „Sprung" ist an eherne Gesetze der Geschichte, an Tausend Sprossen einer vorherigenqualvollen und allzu langsamen Entwicklung gebunden. Aber er kann nimmermehr vollbracht werden, wenn aus all dem von der Entwicklung zusammengetragenen Stoff der materiellen Vorbedingungen nicht der zündende Funke des bewussten Willens der großen Volksmasse aufspringt. Der Sieg des Sozialismus wird nicht wie Fatum vom Himmel herabfallen. Er kann nur durch eine lange Kette gewaltiger Kraftproben zwischen den alten und den neuen Mächten erkämpft werden, Kraftproben, in denen das internationale Proletariat unter der Führung der Sozialdemokratie lernt und versucht, seine Geschicke in die eigene Hand zunehmen, sich des Steuers des gesellschaftlichen Lebens zu bemächtigen, au seinem willenlosen Spielball der eigenen Geschichte zu ihrem zielklaren Lenker zu werden."3
Für den Marxismus gehören die Anerkennung der Bedeutung der objektiven historischen Gesetze und ökonomischen Widersprüchen - vom Anarchismus geleugnet oder ignoriert - sowie die subjektiven Elemente zusammen.4
Sie sind unzertrennbar miteinander verknüpft und beeinflussen sich gegenseitig. Wir können dies im Verhältnis zu den wichtigsten Faktoren beider allmählichen Unterminierung des proletarischen Lebens in der Internationalesehen. Einer dieser Faktoren war die Untergrabung der Solidarität innerhalb der Arbeiterbewegung. Dies wurde natürlich erheblich von der wirtschaftlichen Expansion vor 1914 und den reformistischen Illusionen, die dadurch erzeugt wurden, begünstigt. Doch es resultierte auch aus der Fähigkeit des Klassenfeindes, aus seiner Erfahrung zu lernen. Bismarck führte (zusammen mit seinen Sozialistengesetzen) das System der Sozialversicherungen ein, um die Solidarität unter den ArbeiterInnen durch ihre individuelle Abhängigkeit von dem, was später zum „Wohlfahrtsstaat" werden sollte, zu ersetzen. Und als Bismarcks Versuch scheiterte, die Arbeiterbewegung durch ihre Illegalisierung zu besiegen, änderte die imperialistische Bourgeoisie, die Ende des 19.Jahrhunderts seine Regierung ersetzte, ihre Taktik. Nachdem sie realisiert hatte, dass die Arbeitersolidarität unter Bedingungen der Repression oftmals geradezu aufblüht, zog sie die Sozialistengesetze zurück und lud stattdessen wiederholt die Sozialdemokratie dazu ein, „konstruktiv (...) am politischen Leben (d.h. an der Leitung des Staates) teilzunehmen", ja beschuldigte sie der„sektiererischen" Entsagung der „allein praktischen Mittel", um wirkliche Verbesserungen für die ArbeiterInnen zu erreichen.
Lenin wies auf die Verknüpfung zwischen der objektiven und subjektiven Ebene im Verhältnis zu einem anderen entscheidenden Faktor beim Verfall der großen sozialistischen Parteien hin. Dies war die Degradierung des Kampfes für die Befreiung der Menschheit zu einer leeren, tagtäglichen Routine. Er identifizierte drei Strömungen innerhalb der Sozialdemokratie und beleuchtete die zweite unter ihnen - „die zweite Strömung - das sogenannte „Zentrum" -besteht aus Leuten, die zwischen den Sozialchauvinisten und den wirklichen Internationalisten schwanken" (...) „Das „Zentrum" - das sind Leute der Routine, zerfressen von der faulen Legalität, korrumpiert durch die Atmosphäre des Parlamentarismus usw., Beamte, gewöhnt an warme Pöstchen und an „ruhige" Arbeit. Historisch und ökonomisch gesehen vertreten sie keine besondere Schicht, sie sind lediglich eine Erscheinung des Übergangs von der hinter uns liegenden Periode der Arbeiterbewegung, der Periode von 1871 bis1914 - (...) zu einer neuen Periode, die seit dem ersten imperialistischen Weltkrieg, der die Ära der sozialen Revolution eingeleitet hat, objektiv unumgänglich geworden ist"5
Für damalige Marxisten war die „Krise der Sozialdemokratie" nicht etwas, was außerhalb ihres Aktionsradius stand. Sie fühlten sich persönlich verantwortlich für das, was passiert war. Für sie war das Versagen der damaligen Arbeiterbewegung auch ihr eigenes Scheitern. Wie Rosa Luxemburg formulierte: Die Opfer des Krieges liegen auf unserem Gewissen.
Was den Kollaps der sozialistischen Internationale so bemerkenswert macht, ist, dass er nicht in erster Linie das Ergebnis der programmatischen Unzulänglichkeit oder einer falschen Analyse der Weltlage war.
„Nicht an Postulaten, Programmen, Losungen fehlt es dem internationalen Proletariat, sondern an Taten, an wirksamem Widerstand, an der Fähigkeit, den Imperialismus im entscheidenden Moment gerade im Kriege anzugreifen (...)"6
Für Kautsky hatte das Versagen, den Internationalismusaufrechtzuhalten, die Unmöglichkeit bewiesen, ihn tatsächlich zu praktizieren. Seine Schlussfolgerung: die Internationale ist eigentlich ein Instrument des Friedens, die in Kriegszeiten beiseite treten müsse. Für Rosa Luxemburg wie für Lenin war das Fiasko vom August 1914 vor allem das Resultat der Erosion der Ethik einer proletarischen internationalen Solidarität innerhalb ihrer Führung.
„Und dann kam das Unerhörte, das Beispiellose, der 4. August1914. Ob es so kommen mußte? Ein Geschehnis von dieser Tragweite ist gewiß kein Spiel des Zufalls. Es müssen ihm tiefe und weitgreifende objektive Ursachenzugrunde liegen. Aber diese Ursachen können auch in Fehlern der Führerin des Proletariats, der Sozialdemokratie, im Versagen unseres Kampfwillens, unseres Muts, unserer Überzeugungstreue liegen." (ebenda, S. 61)
II. Der Gezeitenwechsel
Der Kollaps der sozialistischen Internationale war ein Ereignis von historischem Rang und eine schreckliche politische Niederlage. Doch es war nicht die entscheidende, d.h. irreversible Niederlage einer ganzen Generation. Ein erstes Anzeichen dafür: die am meisten politisierten Schichtendes Proletariats hielten treu zum proletarischen Internationalismus. Richard Müller, Führer der Gruppe der Revolutionären Obleute, der Fabrikdelegierten in der Metallindustrie, erinnerte sich: „Soweit diese breiten Volkskreise bereits vor dem Krieg unter dem Einfluss der sozialistischen und gewerkschaftlichen Presse zu bestimmten Grundanschauungen über Staat und Gesellschaft erzogen worden waren, zeigte sich, wenn auch zunächst nicht offen, eine direkte Ablehnung der Kriegspropaganda und des Krieges"7 Dies stand in starkem Gegensatz zur Lage in den 1930er Jahren, nach dem Sieg des Stalinismus in Russland und des Faschismus in Deutschland, als die fortgeschrittensten ArbeiterInnen auf das politische Terrain des Nationalismus und der Verteidigung des(imperialistischen) „antifaschistischen" oder „sozialistischen" Vaterlandes gezogen wurden.
Die Vollständigkeit der anfänglichen Kriegsmobilisierung war also kein Beweis für eine schwere Niederlage, sondern eine zeitweilige Überrumpelung der Massen. Diese Mobilisierung wurde von Szenen der Massenhysterie begleitet. Doch diese Ausdrücke dürfen nicht mit einem aktiven Engagement der Bevölkerung verwechselt werden, wie in den Nationalkriegen der revolutionären Bourgeoisien in den Niederlanden und in Frankreich. Die intensive öffentliche Agitation von 1914 wurde zunächst einmal vom Massencharakter der modernen bürgerlichen Gesellschaft und von den beispiellosen Mitteln der Propaganda und Manipulation verursacht, die dem kapitalistischen Staat zur Verfügung stehen. In diesem Sinne war die Hysterie von 1914 nicht ganz neu. In Deutschland wurde dies bereits zurzeit des Deutsch-Französischen Krieges von 1870 beobachtet. Doch durch die Entwicklungen im Charakter der modernen Kriegsführung erhielt sie eine neue Qualität.
Der Irrsinn des imperialistischen Krieges
Es scheint, als habe die Arbeiterbewegung die Kraft des gigantischen politischen, wirtschaftlichen, sozialen und psychologischen Erdbebens unterschätzt, das durch den Weltkrieg ausgelöst wurde. Ereignisse von solch kolossalem Umfang und Gewalt, fern jeder Kontrolle irgendeiner menschlichen Kraft, müssen zwangsläufig extreme Emotionen schüren. Einige Anthropologen glauben, dass der Krieg den Instinkt wecke, das eigene „Reservat" zu verteidigen, etwas, was die Menschheit mit anderen Arten gemeinsam habe. Dies mag der Fall sein oder auch nicht. Sicher ist jedenfalls, dass der moderne Krieg uralte Ängste schürt, die in unserem kollektiven Gedächtnis schlummern, durch Tradition und Kultur über viele Generationen, bewusst oder unbewusst, weitergereicht: die Angst vor dem Tod, dem Verhungern, der Vergewaltigung, Vertreibung, Entbehrung, Versklavung. Die Tatsache, dass die moderne allgemeine imperialistische Kriegführung sich nicht mehr auf Berufssoldaten beschränkt, sondern die gesamte Gesellschaft miteinbezieht und Waffen von beispielloser zerstörerischer Kraft einsetzt, kann die Panik und Instabilität, die sie verursacht, nur steigern. Hinzugefügt werden sollten die tiefen moralischen Folgen. Im Weltkrieg wird nicht nur eine kleine Kaste von Soldaten von der Armee eingezogen, sondern Millionen von Arbeitern, die dazu aufgerufen werden, sich gegenseitig zu töten. Die restliche Gesellschaft, die „Heimatfront", wird dazu angehalten, für denselben Zweck zu arbeiten. In solch einer Situation findet die moralische Grundlage, die jede menschliche Gesellschaft erst möglich macht, keine Anwendung mehr. Wie Rosa Luxemburg sagte: „wie wenn nicht jedes Volk, das zum organisierten Mord auszieht, sich in demselben Augenblick in eine Horde Barbaren verwandelte"8
All dies produzierte in dem Moment, wo der Krieg ausbrach, eine wahrhafte Massenpsychose und eine allgemeine Pogromstimmung. Rosa Luxemburg schilderte, wie sich die Bevölkerungen ganzer Städte in einen verrückt gewordenen Mob verwandelten. Der Keim all der Barbarei des 20.Jahrhunderts, Auschwitz und Hiroshima eingeschlossen, war bereits in diesem Krieg enthalten.
Wie hätte die Arbeiterpartei auf den Kriegsausbruchreagieren sollen? Indem sie den Massenstreik ausrief? Indem sie die Soldaten dazu aufforderte zu desertieren? Unsinn, antwortete Rosa Luxemburg. Die erste Aufgabe von Revolutionären sei es hier, dem zu widerstehen, was Wilhelm Liebknecht einst bezüglich der Erfahrungen aus dem Krieg von 1870 einen Orkan menschlicher Leidenschaften nannte. „...
„Solche Ausbrüche der ‚Volksseele' haben durch ihre ungeheure Elementarkraft etwas Verblüffendes, Betäubendes, Erdrückendes. Man fühlte sich machtlos einer höheren Macht gegenüber - einer richtigen, jeden Zweifel ausschließenden force majeure. Man hat keinen greifbaren Gegner. Es ist wie eine Epidemie - in den Menschen, in der Luft, überall. (...) Aber eine Kleinigkeit war's nicht, damals gegen den Strom zu schwimmen".
1870 schwamm die Sozialdemokratie gegen den Strom. Rosa Luxemburgs Kommentar: „Sie blieben auf dem Posten, und die deutsche Sozialdemokratie zehrte 40 Jahre lang von der moralischen Kraft, die sie damals gegen eine Welt von Feinden aufgeboten hatte." (ebenda, S. 151).9
Und hier kommt sie zum Punkt, zum Herzstück ihrer ganzen Argumentation. „So wäre es auch diesmal gegangen. Im ersten Moment wäre vielleicht nichts anderes erreicht, als dass die Ehre des deutschen Proletariats gerettet war, als dass Tausende und Abertausende Proletarier, die jetzt in den Schützengräben bei Nacht und Nebel umkommen, nicht in dumpfer seelischer Verwirrung, sondern mit dem Lichtfunken im Hirn sterben würden, dass das, was ihnen im Leben das Teuerste war: die Internationale, Völker befreiende Sozialdemokratie kein Trugbild sei. Aber schon als ein mächtiger Dämpfer auf den chauvinistischen Rausch und die Besinnungslosigkeit der Menge hätte die mutige Stimme unserer Partei gewirkt, sie hätte die aufgeklärteren Volkskreise vor dem Delirium bewahrt, hätte den Imperialisten das Geschäft der Volksvergiftung und Volksverdummung erschwert. Gerade der Kreuzzug gegen die Sozialdemokratie hätte die Volksmassen am raschesten ernüchtert. So dann im weiteren Verlaufe des Krieges (...) würde alles Lebendige, Ehrliche, Humane, Fortschrittliche sich um die Fahne der Sozialdemokratie scharen" (ebenda, S.151, 152).
Die Erlangung dieser „enormen moralischen Autorität" ist die erste Aufgabe von Revolutionären im Falle eines Krieges.
Unmöglich für solche wie Kautsky, diese Sorge um die letzten Gedanken der sterbenden Proletarier in Uniform nachzuvollziehen. Für ihn wäre die Provozierung des wütenden Mobs und der staatlichen Repression, sobald der Krieg einmal ausgebrochen war, nichts anderes als eine leere Geste gewesen. Der französische Sozialist Jaurès erklärte einst: Die Internationale verkörperte die ganze moralische Stärke auf der Welt. Nun auf einmal wussten viele ihrer einstigen Führer nicht mehr, dass der Internationalismus keine leere Geste ist, sondern eine Überlebensfrage des Weltsozialismus.
Der Wendepunkt und die Rolle der Revolutionäre
Das Scheitern der sozialistischen Partei führte zu einerwahrhaft dramatischen Situation. Sein erstes Resultat: es ermöglichte eine schier unendliche Fortsetzung des Krieges. Die militärische Strategie der deutschen Bourgeoisie basierte voll und ganz auf der Vermeidung eines Zweifrontenkrieges, auf der Erzielung eines schnellen Sieges über Frankreich, um daraufhin all ihre Kräfte gen Osten zu werfen, um Russland in die Knie zu zwingen. Ihre Strategie gegen die Arbeiterklasse hatte dieselbe Grundlage: sie zu überrumpeln und den Krieg für sich zu entscheiden, bevor Letztere die Zeit hatte, ihre Orientierung wiederzuerlangen.
Ab dem September 1914 (der ersten Schlacht an der Marne) war das Überrennen Frankreichs und damit die ganze Strategie des schnellen Siegesvollständig gescheitert. Nicht nur die deutsche, sondern auch die Weltbourgeoisie war nun in ein Dilemma getappt, dem sie weder ausweichen nochüberwinden konnte. Daraus ergaben sich beispiellose Massaker an Millionen von Soldaten, was selbst vom kapitalistischen Standpunkt aus irrsinnig ist. Das Proletariat selbst war gefangen, ohne jegliche sofortige Perspektive, den Krieg durch eigene Initiative zu beenden. Die Gefahr, die sich somit daraus ergab, war die Zerstörung der bedeutendsten materiellen und kulturellen Vorbedingungen für den Sozialismus: das Proletariat selbst. Revolutionäre verhalten sich zu ihrer Klasse, wie sich ein Teil zum Ganzen verhält. Minderheiten der Klassen können nie die Selbstaktivität und die Kreativität der Massen ersetzen. Doch gibt es Augenblicke in der Geschichte, in denen die Intervention von Revolutionären einen entscheidenden Einfluss haben können. Solche Momente entstehen in einem Prozess hin zur Revolution, wenn die Massen um den Siegkämpfen. Hier ist es entscheidend, der Klasse dabei zu helfen, den richtigen Weg zu finden, die Fallen ihres Feindes zu umgehen, zu vermeiden, zu früh oder zu spät auf ihrem Rendezvous mit der Geschichte zu erscheinen. Doch sie entstehen auch in Momenten der Niederlage, wenn es lebenswichtig ist, die richtigen Lehren zu ziehen. Wir müssen hier jedoch differenzieren. Im Angesichteiner verheerenden Niederlage ist diese Arbeit nur langfristig bedeutsam, indem diese Lehren an künftige Generationen weitergereicht werden. Im Falle der Niederlage von 1914 war der entscheidende Einfluss, den Revolutionäre haben konnten, so unmittelbar wie während der Revolution selbst. Dies nicht nur, weil die erlittene Niederlage keine definitive war, sondern auch aufgrund der Bedingungen eines Weltkrieges, welche, indem sie den Klassenkampf fastbuchstäblich zu einer Überlebensfrage machten, eine außerordentliche Beschleunigung der Politisierung provozierten.
Angesichts des Kriegselends war es unvermeidbar, dass der wirtschaftliche Klassenkampf sich weiterentwickelte und unvermittelt einen offenpolitischen Charakter annahm. Doch die Revolutionäre konnten sich nicht damit zufrieden geben, darauf zu warten, was passiert. Die Orientierung der Klasse war, wie wir gesehen haben, vor allen Dingen das Ergebnis der Unterlassung ihrer politischen Führung. Es lag somit in der Verantwortung aller verbliebenen Revolutionäre innerhalb der Arbeiterbewegung, den Gezeitenwechsel zuinitiieren. Noch vor den Streiks an der „Heimatfront", noch vor den Revolten der Soldaten in den Schützengräben mussten die Revolutionäre hinausgehen und das Prinzip der internationalen Solidarität des Proletariats bekräftigen.
Sie begannen mit dieser Arbeit im Parlament, wo sie den Krieg anprangerten und gegen die Kriegskredite stimmten. Dies war das letzte Mal, dass diese Tribüne für revolutionäre Anliegen benutzt werden konnte. Doch war dies von Anfang an von illegaler revolutionärer Propaganda und Agitation sowie von der Beteiligung an den ersten Brotdemonstrationen begleitet. Doch die alles überragende Aufgabe der Revolutionäre war es noch immer, sich selbst zuorganisieren, um ihren Standpunkt zu klären, und vor allem den Kontakt zu anderen Revolutionären im Ausland wiederherzustellen, um die Gründung einerneuen Internationale vorzubereiten. Am 1. Mai 1916 fühlte sich jedoch der Spartakusbund, der Kern der künftigen Kommunistischen Partei, erstmals stark genug, um auf den Straßen offene und massive Präsenz zu zeigen. Es war der Tag, an dem die Arbeiterbewegung traditionellerweise ihre internationale Solidarität feiert. Der Spartakusbund rief zu Demonstrationen in Dresden, Jena, Hanau, Brunswick und vor allem in Berlin auf. Dort erschienen 10.000 Menschen auf dem Potsdamer Platz, um Liebknecht zu hören, der den imperialistischen Krieg anprangerte. Bei dem vergeblichen Versuch, ihn vor einer Festnahme zu schützen, kam es zu einer Straßenschlacht.
Die Proteste am 1. Mai auf dem Potsdamer Platz raubten der internationalistischen Opposition ihren bekanntesten Führer. Andere Inhaftierungen folgten. Liebknecht wurde beschuldigt, unverantwortlich gehandelt zu haben, ja beabsichtigt zu haben, seine Person ins Rampenlicht zustellen. In Wahrheit wurde seine Aktion am Maitag kollektiv von der Führung des Spartakusbundes beschlossen. Es trifft zu, dass der Marxismus leere Gesten wie den Terrorismus oder das Abenteurertum kritisiert. Worauf es ankommt, ist die kollektive Tat der Massen. Doch die Geste von Liebknecht war mehr als ein Akt des individuellen Heldentums. Sie verkörperte die Hoffnungen und Bestrebungen von Millionen von ProletarierInnen angesichts des Irrsinns der bürgerlichen Gesellschaft. Wie Rosa Luxemburg später schreiben sollte:
„Vergessen wir aber nicht: Weltgeschichte wird nicht gemacht ohne geistige Größe, ohne sittliches Pathos, ohne edle Geste"10
Dieser großartige Geist breitete sich rasch vom Spartakusbund auf die Metallarbeiter aus. 27. Juni 1916, Berlin, Höhepunkt des Prozesses gegen Karl Liebknecht, der wegen öffentlicher Agitation gegen den Krieg festgenommen worden war. Ein Treffen von Fabrikdelegierten wurde verschoben, es sollte nun nach der illegalen Protestdemonstration, zu der der Spartakusbund auf gerufen hatte, stattfinden. Auf der Tagesordnung: Solidarität mit Liebknecht. Gegen den Widerstand von Georg Ledebour, der einzige Repräsentant der Oppositionsgruppe innerhalb der Sozialdemokratischen Partei, wurden für den nächsten Tag weitere Aktionen vorgeschlagen. Es gab keine Diskussion. Jeder stand auf und ging schweigend.
Am nächsten Morgen schalteten um neun Uhr früh die Dreher ihre Maschinen in den großen Waffenfabriken des deutschen Kapitals ab. 55.000 Arbeiter von Löwe, AEG, Borsig, Schwartzkopf legten ihr Werkzeug nieder und versammelten sich außerhalb der Fabriktore. Trotz Militärzensur verbreiteten sich die Neuigkeiten wie ein Lauffeuer überall im Reich: die Rüstungsarbeiter aus Solidarität mit Liebknecht auf der Straße! Wie sich herausstellte, nicht nur in Berlin, sondern auch in Brunswick, auf den Schiffswerften in Bremen, etc. Selbst in Russland gab es Solidaritätsaktionen.
Die Bourgeoisie schickte Tausende von Streikenden an die Front. Die Gewerkschaften starteten auf ihrer Suche nach den „Rädelsführern" eine Hexenjagd in den Fabriken. Doch kaum einer von ihnen wurden eingesperrt, so groß war die Solidarität der ArbeiterInnen. Internationalistische proletarische Solidarität gegen imperialistischen Krieg: dies war der Beginn der Weltrevolution, der erste politische Massenstreik in der Geschichte Deutschlands.
Doch noch schneller griff die Flamme, die auf dem Potsdamer Platz entzündet wurde, auf die revolutionäre Jugend über. Inspiriert vom Beispiel ihrer politischen Führer, löste diese Jugend noch vor den erfahrenen Metallarbeitern den ersten großen Streik gegen den Krieg aus. In Magdeburg und vor allem in Brunswick, das eine Bastion von Spartakus war, eskalierten die illegalen Maiproteste zu einer offenen Streikbewegung gegen die Entscheidung der Regierung, einen Teil der Löhne für die Auszubildenden und JungarbeiterInnen auf ein Zwangskonto zu überweisen, das zur Finanzierung der Kriegsanstrengungen benutzt werden sollte. Die erwachsenen ArbeiterInnen kamen zur Unterstützung heraus. Am 5. Mai bliesen die Militärführer diesen Angriff ab, um eine weitere Ausdehnung der Bewegung zu verhindern.
Nach der Schlacht von Jütland 1916, der ersten und einzigen wichtigen Konfrontation zwischen der britischen und der deutschen Marine im gesamten Krieg, plante eine kleine Gruppe von revolutionären Matrosen, das Schlachtschiff „Hyäne" zu übernehmen und nach Dänemark zu bringen, als eine„Demonstration für die gesamte Welt" gegen den Krieg.11 Obgleich diese Pläne denunziert und durchkreuzt wurden, kündigten sie die ersten offenen Revolten in der Kriegsmarine an, die Anfang August 1917 folgten. Sie entzündeten sich um Fragen, die die Behandlung und die Bedingungen der Mannschaften betrafen. Doch bald schickten die Matrosen ein Ultimatum an die Regierung: Entweder beendet diese den Krieg, oder wir treten in den Streik. Der Staat antwortete mit einer Welle der Repression. Zwei der revolutionären Anführer, Albin Köbis und Max Reichpietsch, wurden hingerichtet.
Doch schon Mitte April 1917 hatte eine Welle von Massenstreiks in Berlin, Leipzig, Magdeburg, Halle, Brunswick, Hannover, Dresden und in anderen Städten stattgefunden. Obwohl die Gewerkschaften und die SPD-Führung, die es nicht mehr wagten, sich der Bewegung offen entgegenzusetzen, versuchten, sie auf wirtschaftliche Fragen zu begrenzen, formulierten die ArbeiterInnen in Leipzig eine Reihe von politischen Forderungen - insbesondere die Forderung nach Beendigung des Krieges -, die in anderen Städten aufgenommen wurden.
Somit waren zu Beginn des Jahres 1918 die Zutaten einerbreiten revolutionären Bewegung gegeben. Die Streikwelle vom April 1917 war die erste Massenintervention von Hunderttausenden von ArbeiterInnen quer durchs ganze Land, die ihre materiellen Interessen auf einem Klassenterrainverteidigten und sich dem imperialistischen Krieg offen widersetzten. Gleichzeitig war diese Bewegung vom Beginn der russischen Februarrevolution1917 inspiriert worden und erklärte offen ihre Solidarität mit ihr. Der proletarische Internationalismus hatte die Herzen der Arbeiterklasse erfasst.
Andererseits hatte das Proletariat mit der Bewegung gegen den Krieg wieder begonnen, seine eigene revolutionäre Führung zu schaffen. Damit meinen wir nicht nur die politischen Gruppen wie den Spartakusbund oder die Bremer Linken, die dazu übergingen, Ende des Jahres 1918 die KPD zugründen. Wir meinen damit auch das Auftreten von hochpolitisierten Schichten und Zentren des Lebens und Kampfes der Klasse, die mit den Revolutionärenverknüpft waren und mit ihren Positionen sympathisierten. Eines dieser Zentren war in den Industriestädten, insbesondere im Metallsektor, anzutreffen, dass ich an dem Phänomen der Obleute, den Fabrikdelegierten, kristallisierte: „Innerhalb der Industriearbeiterschaft befand sich ein kleiner Kern von Proletariern, die den Krieg nicht nur als solchen ablehnten, sondern auch willens waren, seinen Ausbruch mit allen Mitteln zu verhindern; und als der Krieg zur Tatsache geworden, hielten sie es für ihre Pflicht, mit allen Mitteln sein Ende herbeizuführen. Die Zahl war klein, um so entschlossener und rühriger waren die Personen. Hier fand sich das Gegenstück zu jenen, die an die Front zogen, um für ihre Ideale das Leben zu opfern. Der Kampf gegen den Krieg in Fabriken und Büros war zwar nicht so ruhmreich, wie der Kampf an der Front, aber mit gleichen Gefahren verbunden. Die den Kampf aufnahmen und führten, suchten die höchsten Menschheitsideale zu verwirklichen"12
Ein anderes Zentrum fand sich in der neuen Generation von ArbeiterInnen an, den Lehrlingen und JungarbeiterInnen, die keine andere Perspektive vor sich sahen, als zum Sterben in die Schützengräben geschickt zu werden. Der Kern dieses Gärungsprozesses befand sich in den sozialistischen Jugendorganisationen, die sich bereits vor dem Krieg durch die Revolte gegen die „Routine" auszeichneten, welche im Begriff war, die ältere Generation zu kennzeichnen.
Auch innerhalb der bewaffneten Kräfte, wo die Revolte gegen den Krieg viel länger als an der „Heimatfront" benötigte, um sich zu entwickeln, war ein politischer Vorposten etabliert worden. Wie in Russland entstand dieses politische Widerstandszentrum unter den Matrosen, die eine direkte Verbindung zu den ArbeiterInnen und den politischen Organisationen in ihren Heimathäfen hatten und deren Jobs und Bedingungen in jeder Weise jenen der FabrikarbeiterInnen ähnelten, von denen sie im allgemeinen herstammten. Darüber hinaus wurden viele von ihnen aus der „zivilen" Handelsflotte rekrutiert, junge Männer, die die ganze Welt bereist haben und für welche die internationale Brüderlichkeit nicht eine Phrase, sondern eine Lebensweise war.
Ferner war das Aufkommen und die Vervielfältigung dieser Konzentrationen von politischem Leben von einer intensiven theoretischen Tätigkeit geprägt. Alle Augenzeugenberichte aus dieser Periode betonen das außerordentlich hohe Niveau der Debatten auf den verschiedenen illegalen Treffen und Konferenzen. Dieses theoretische Leben fand seinen Ausdruck in Rosa Luxemburgs „Krise der Sozialdemokratie", in Lenins Schriften gegen den Krieg, in den Artikeln der Zeitschrift Arbeiterpolitik in Bremen, aber auch in der großen Anzahl von Flugblättern und Deklarationen, die in strengster Illegalität zirkulierten und zu den scharfsinnigsten und mutigsten Produkten der menschlichen Kultur zählen, die das 20. Jahrhundert emporgebracht hat.
Die Bühne war frei für den revolutionären Ansturm gegen eine der stärksten und wichtigsten Bastionen des Weltkapitalismus.
Steinklopfer
1 Beschluss des Mannheimer Parteikongresses von 1906.
2 In seinen Memoiren über die proletarische Jugendbewegung rief Willi Münzenberg, der sich während des Krieges in Zürich aufhielt, Lenins Standpunkt in Erinnerung: „Durch Lenin lernten wir die Fehler des von Kautsky und seiner theoretischen Schule verfälschten Marxismus kennen, der alles von der historischen Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse und fast nichts von den subjektiven Kräften zur Beschleunigung der Revolution erwartete. Im Gegensatz dazu betonte Lenin die Bedeutung des Individuums und der Masse im historischen Prozess und stellte die marxistische These in den Vordergrund, dass die Menschen im Rahmen der wirtschaftlich gegebenen Verhältnisse ihre Geschichte selbst machen. Diese Betonung des persönlichen Wertes der einzelnen Menschen und Gruppen in den gesellschaftlichen Kämpfen machte auf uns den größten Eindruck und spornte uns zu den denkbar stärksten Leistungen an" (Münzenberg, Die dritte Front, S. 230).
3„Die Krise der Sozialdemokratie", Luxemburg-Werke Bd4, S. 61, 62.
4 Während sie gegen Bernstein richtigerweise die Realität der Tendenzen zum Verschwinden der Mittelschichten und zur Krise und Pauperisierung des Proletariats vertrat, scheiterte die Linke jedoch daran, das Ausmaß zu erkennen, in dem der Kapitalismus in den Jahren vor dem I. Weltkrieg diese Tendenzen zeitweilig abzuschwächen in der Lage gewesen war. Dieser Mangel an Klarheit drückte sich in Lenins Theorie der„Arbeiteraristokratie" aus, der gemäß nur eine privilegierte Minderheit substanzielle Lohnerhöhungen über einen längeren Zeitraum hinweg erlangt hatte, nicht aber die breiten Massen der Klasse. Dies führte zur Unterschätzung der Bedeutung der materiellen Grundlage für die reformistischen Illusionen, die der Bourgeoisie halfen, das Proletariat für den Krieg zu mobilisieren.
5 Lenin, Die Aufgaben des Proletariats in unserer Revolution, Lenin Bd. 24., S. 61,62
6 Luxemburg, Die Krise der Sozialdemokratie(Junius-Broschüre), Januar 1916, ebenda, S. 159.
7 Richard Müller, Vom Kaiserreich zur Republik, S.32, Teil 1 der Trilogie von Müller über die Geschichte der Deutschen Revolution.
8 Ebenda, S. 162.
9 Ebenda, S. 317f.
10 Rosa Luxemburg, Eine Ehrenpflicht, Bd. 4, S. 406,November 1918,
11 Dieter Nelles, Proletarische Demokratie und internationale Bruderschaft - Das abenteuerliche Leben des Hermann Knüfken, S.1, https://www [14]. Anarchismus.at/txt5/nellesknuefken.htm
12 Müller, ebenda, S. 33.
Aktuelles und Laufendes:
Leute:
- Liebknecht [16]
- Luxemburg [17]
- Jogiches [18]
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Historische Ereignisse:
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Theoretische Fragen:
- Internationalismus [23]
Erbe der kommunistischen Linke:
Deutschland 1918 – 19, Teil 2 Vom Krieg zur Revolution
- 3743 Aufrufe
Im ersten Teil dieser Artikelreihe zum 90. Jahrestag des revolutionären Anlaufs des deutschen Proletariats untersuchten wir den welthistorischen Kontext, in dem sich die Revolution entfaltete. Dieser Kontext war die Katastrophe des I. Weltkrieges und das Scheitern der Arbeiterklasse und ihrer politischen Führung, diesen Ausbruch zu verhindern. Obgleich die frühen Jahre des 20. Jahrhunderts von ersten Manifestationen einer allgemeinen Tendenz
Im ersten Teil dieser Artikelreihe zum 90. Jahrestag des revolutionären Anlaufs des deutschen Proletariats untersuchten wir den welthistorischen Kontext, in dem sich die Revolution entfaltete. Dieser Kontext war die Katastrophe des I. Weltkrieges und das Scheitern der Arbeiterklasse und ihrer politischen Führung, diesen Ausbruch zu verhindern. Obgleich die frühen Jahre des 20. Jahrhunderts von ersten Manifestationen einer allgemeinen Tendenz zur Entwicklung von Massenstreiks gekennzeichnet waren, waren diese Bewegungen, abgesehen von Russland, noch nicht mächtig genug, um das Gewicht der reformistischen Illusionen zu untergraben. Was die organisierte internationalistische Arbeiterbewegung angeht, so stellte sie sich als theoretisch, organisatorisch und moralisch unvorbereitet gegenüber dem Weltkrieg dar, den sie lange zuvor vorausgesagt hatte. Als Gefangene ihrer eigenen Schemata der Vergangenheit, denen zufolge die proletarische Revolution ein mehr oder weniger unvermeidbares Produkt der wirtschaftlichen Entwicklung des Kapitalismus sei, hatten sie sich als eine Art zweite Natur die Behauptung zu Eigen machen, dass es die vorrangige Aufgabe der Sozialisten sei, verfrühte Konfrontationen zu vermeiden und passiv die Reifung der objektiven Bedingungen abzuwarten. Abgesehen von ihrer revolutionären linken Opposition scheiterte – oder weigerte sich – die Sozialistische Internationale, die Konsequenzen aus der Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, dass der erste Akt in der Niedergangsepoche des Kapitalismus ein Weltkrieg statt einer Wirtschaftskrise ist. Vor allem unterschätzte die Internationale, indem sie die Zeichen der Zeit, die Dringlichkeit der sich nähernden Alternative zwischen Sozialismus oder Barbarei, ignorierte, vollkommen den subjektiven Faktor in der Geschichte, insbesondere ihre eigene Rolle und Verantwortung. Das Resultat war der Bankrott der Internationale im Angesicht des Kriegsausbruchs und die chauvinistische Ekstase von Teilen ihrer Führung, insbesondere der Gewerkschaften. Die Bedingungen für den ersten Versuch einer weltweiten proletarischen Revolution wurden also von dem relativ plötzlichen, handstreichartigen Abstieg des Kapitalismus in seine Dekadenzphase, in den imperialistischen Weltkrieg bestimmt, aber auch von einer beispiellosen, katastrophalen Krise der Arbeiterbewegung. Es wurde bald deutlich, dass es keine revolutionäre Antwort auf den Krieg geben konnte ohne die Wiederbelebung der Überzeugung, dass der proletarische Internationalismus keine taktische Frage ist, sondern das „heiligste“ Prinzip des Sozialismus, das einzige „Vaterland“ der Arbeiterklasse (wie Rosa Luxemburg sagte). Wir sahen im vorhergegangenen Artikel, dass Karl Liebknechts öffentliche Erklärung gegen den Krieg am 1. Mai 1916 in Berlin so wie auch die internationalistischen Konferenzen wie jene in Zimmerwald und Kienthal und die weitverbreiteten Gefühle der Solidarität, die sie weckten, unerlässliche Wendepunkte auf dem Weg zur Revolution waren. Angesichts der Schrecken des Krieges in den Schützengräben und der Verarmung und intensivierten Ausbeutung der Arbeitermassen an der „Heimatfront“, die mit einem Schlag all die Errungenschaften von Jahrzehnten des Arbeiterkampfes wegwischten, sahen wir die Entwicklung von Massenstreiks und die Reifung von politisierten Schichten und Zentren der Arbeiterklasse, die in der Lage waren, einen revolutionären Sturm anzuführen. Die Verantwortung des Proletariats, den Krieg zu beendenDie Ursachen für das Scheitern der sozialistischen Bewegung angesichts des Krieges zu verstehen war somit das Hauptanliegen des vorherigen Artikels und auch eine wichtige Beschäftigung der Revolutionäre während der ersten Kriegsphase. Dies wird deutlich in Die Krise der Sozialdemokratie ausgedrückt, der sog. Junius-Broschüre von Rosa Luxemburg. Im Mittelpunkt der Ereignisse, mit denen sich dieser zweite Artikel befasst, finden wir eine zweite entscheidende Frage, eine Konsequenz aus der ersten: Welche gesellschaftliche Kraft bringt den Krieg zu einem Ende und auf welche Weise? Richard Müller, eine der Führer der „revolutionären Obleute“ in Berlin und später ein wichtiger Historiker der Revolution in Deutschland, formulierte die Verantwortung der Revolution damit, was sie verhindern soll: „Es war der Untergang der Kultur, die Vernichtung des Proletariats und der sozialistischen Bewegung überhaupt.“ [1]Wie so oft war es Rosa Luxemburg, die die welthistorische Frage damals am deutlichsten stellte: „Was nach dem Kriege sein wird, welche Zustände und welche Rolle die Arbeiterklasse erwarten, das hängt ganz davon ab, in welcher Weise der Friede zustande kommt. Erfolgt er bloß aus schließlicher allseitiger Erschöpfung der Militärmächte oder gar – was das Schlimmste wäre – durch den militärischen Sieg einer der kämpfenden Parteien, erfolgt er mit einem Worte ohne Zutun des Proletariats, bei völliger Ruhe im Innern des Staates, dann bedeutet ein solcher Frieden nur die Besiegelung der weltgeschichtlichen Niederlage des Sozialismus im Krieg (...) Nach dem Bankrott des 4. August 1914 ist also jetzt die zweite entscheidende Probe für den historischen Beruf der Arbeiterklasse: ob sie verstehen wird, den Krieg, dessen Ausbruch sie nicht verhindert hat, zu beenden, den Frieden nicht aus den Händen der imperialistischen Bourgeoisie als Werk der Kabinettdiplomatie zu empfangen, sondern ihn der Bourgeoisie aufzuzwingen, ihn zu erkämpfen.“[2]Hier beschreibt Rosa Luxemburg drei mögliche Szenarien, wie der Krieg ein Ende findet. Das erste ist der Ruin und die Erschöpfung der kriegführenden imperialistischen Parteien auf beiden Seiten. Hier erkennt sie von Anfang an die potenzielle Sackgasse der kapitalistischen Konkurrenz in der Epoche ihres historischen Niedergangs, die zu einem Prozess der Verrottung und Auflösung führen kann – wenn das Proletariat nicht in der Lage sein sollte, seine eigene Lösung durchzusetzen. Diese Tendenz zum Zerfall der kapitalistischen Gesellschaft sollte sich nur einige Jahrzehnte später völlig manifestieren, mit der „Implosion“ des von Russland angeführten Blocks und der stalinistischen Regimes 1989 sowie dem darauffolgenden Niedergang der Führerschaft der verbleibenden US-amerikanischen Supermacht. Sie realisierte bereits, dass solch eine Dynamik für sich genommen nicht günstig ist für die Entwicklung einer revolutionären Alternative. Das zweite Szenario besteht darin, dass der Krieg bis zum bitteren Ende ausgefochten wird und in einer totalen Niederlage einer der beiden sich gegenüberstehenden Blöcke endet. In diesem Fall wäre das wichtigste Ergebnis die unvermeidliche Spaltung innerhalb des siegreichen Lagers, die eine neue Front für einen zweiten, noch zerstörerischen Weltkrieg eröffnen würde, dem sich die Arbeiterklasse noch weniger entgegenstellen könnte. In beiden Fällen wäre das Resultat nicht eine momentane, sondern eine welthistorische Niederlage des Sozialismus zumindest für eine Generation, die langfristig die eigentliche Möglichkeit einer proletarischen Alternative zur kapitalistischen Barbarei untergraben könnte. Die damaligen Revolutionäre verstanden bereits, dass der „Große Krieg“ einen Prozess eingeleitet hatte, der das Potenzial hat, das Vertrauen der Arbeiterklasse in ihre eigene historische Mission zu unterminieren. Als solches bildet die „Krise der Sozialdemokratie“ eine Krise der menschlichen Gattung an sich, da nur das Proletariat innerhalb des Kapitalismus Geburtshelfer einer alternativen Gesellschaft ist. Die Russische Revolution und der Massenstreik im Januar 1918Was heißt es, den imperialistischen Krieg durch revolutionäre Mittel zu beenden? Die Augen der wahren Sozialisten der ganzen Welt richteten sich auf Deutschland, um diese Frage zu beantworten. Deutschland war die größte Wirtschaftsmacht in Kontinentaleuropa, der Führer – tatsächlich die einzige Großmacht – des einen der beiden konkurrierenden imperialistischen Blöcke. Und es war das Land mit der größten Anzahl von gebildeten, sozialistisch trainierten, klassenbewussten Arbeitern, die sich im Verlaufe des Krieges in wachsendem Maße für die Sache der internationalistischen Solidarität einsetzten. Doch die proletarische Bewegung ist von ihrem Wesen her international. Die erste Antwort auf die o.g. Frage wurde nicht in Deutschland, sondern in Russland gegeben. Die Russische Revolution von 1917 war ein Wendepunkt in der Weltgeschichte. Sie half auch die Situation in Deutschland umzuwandeln. Bis Februar 1917, dem Beginn der Erhebung in Russland, war es das Ziel der klassenbewussten deutschen Arbeiter, den Kampf bis zu einem Umfang auszuweiten, der die Regierungen dazu zwingt, den Frieden herbeizuführen. Selbst innerhalb des Spartakusbundes[3] zum Zeitpunkt seiner Gründung am Neujahrstag 1916 hatte niemand an die Möglichkeit einer direkten Revolution geglaubt. Doch im Lichte der russischen Erfahrungen waren ab April 1917 die klandestinen revolutionären Zirkel in Berlin und Hamburg zur Schlussfolgerung gelangt, dass das Ziel nicht nur darin bestand, den Krieg zu beenden, sondern auch darin, dabei gleich auch das gesamte Regime zu stürzen. Bald klärte der Sieg der Revolution in Petrograd und Moskau im Oktober 1917 für diese Zirkel in Berlin und Hamburg weniger das Ziel als vielmehr die Mittel zu diesem Zweck: bewaffneter Aufstand, von den Arbeiterräten organisiert und angeführt. Paradoxerweise bewirkte der Rote Oktober in den breiten Massen in Deutschland unmittelbar so ziemlich das Gegenteil. Eine Art unschuldige Euphorie über das Nahen des Friedens brach aus, gestützt auf der Annahme, dass die deutsche Regierung nichts anderes machen könne, als in die Hand des „Friedens ohne Annexionen“ einzuschlagen, die vom Osten ausgestreckt wurde. Diese Reaktion zeigt, in welchem Umfang die Propaganda der zur „sozialistischen“ kriegstreiberischen Partei gewordenen SPD – dass der Krieg einem sich sträubenden Deutschland aufgehalst wurde -, immer noch Einfluss ausübte. Was die Volksmassen betraf, so kam der Wendepunkt in der Haltung gegenüber dem Krieg, der von der Russischen Revolution ausgelöst wurde, erst drei Monate später mit den Friedensverhandlungen zwischen Deutschland und Russland in Brest-Litowsk.[4] Diese Verhandlungen wurden von den Arbeitern in ganz Deutschland und im österreichisch-ungarischen Reich intensiv verfolgt. Das Resultat – das imperialistische Diktat Deutschlands und seine Besetzung großer Teile der westlichen Gebiete der späteren Sowjetrepublik, wobei es die dortigen im Gange befindlichen revolutionären Bewegungen grausam unterdrückte – überzeugte Millionen von der Richtigkeit des Schlachtrufs von Spartakus: Der Feind sitzt im „eigenen Land“, es ist das kapitalistische System selbst. Brest verhalf einem gigantischen Massenstreik zum Leben, der in Österreich-Ungarn begann, mit seinem Zentrum in Wien. Er breitete sich sofort auf Deutschland aus und lähmte das Wirtschaftsleben in über zwanzig größeren Städten, mit einer halben Million Streikenden in Berlin. Die Forderungen waren dieselben wie die der Sowjetdelegation in Brest: sofortige Beendigung des Krieges, keine Annexionen. Die Arbeiter organisierten sich selbst mittels eines Systems gewählter Delegationen, die größtenteils den konkreten Vorschlägen eines Flugblatts des Spartakusbundes folgten, welche die Lehren aus Russland zogen. Der Augenzeugenbericht der SPD-Tageszeitung Vorwärts, für die Ausgabe vom 28. Januar 1918 verfasst, schilderte, wie die Straßen an jenem Morgen erst wie ausgestorben wirkten und in Nebel gehüllt waren, so dass die Umrisse der Gebäude, ja der ganzen Welt vage und verzerrt erschienen. Als die Massen in stiller Entschlossenheit auf die Straßen gingen, kam die Sonne hervor und vertrieb den Nebel, schrieb der Reporter.
Spaltungen und Divergenzen innerhalb der Streikführung
This strike gave rise to a debate within the revolutionary leadership about the immediate goals of the movement, but which increasingly touched the very heart of the question of how the proletariat could end the war. The main centre of gravity of this leadership lay at the time within the left wing of the social-democracy which, after being excluded from the SPD[5] because of its opposition to the war, formed a new party, the USPD (the "Independent" SPD). This party, which brought together most of the well known opponents to the betrayal of internationalism by the SPD - including many hesitant and wavering, more petty bourgeois than proletarian elements - also included a radical revolutionary opposition of its own, the Spartakusbund: a fraction with its own structure and platform. Already in the summer and autumn of 1917 the Spartakusbund and other currents within the USPD began to call for protest demonstrations in response to mass discontent and growing enthusiasm for the revolution in Russia. This orientation was opposed by the Obleute, the "revolutionary delegates" in the factories, whose influence was particularly strong in the armaments industry in Berlin. Pointing to the masses' illusions about the "will for peace" of the German government, these circles wanted to wait until discontent became more intense and generalised, and then give it expression in a single, unified mass action. When, during the first days of 1918, calls for a mass strike from factories all over Germany were reaching Berlin, the Obleute decided not to invite the Spartakusbund to the meetings where this central mass action was prepared and decided on. They feared that what they called the "activism" and "precipitation" of Spartakus - which in their eyes had become dominant in this group since its main theoretical mind, Rosa Luxemburg, had been sent to prison - could constitute a danger to the launching of a unified action throughout Germany. When the Spartakists found out about this, they launched a summons to struggle of their own, without waiting for the decision of the Obleute.
This mutual distrust then intensified in relation to the attitude to be adopted towards the SPD. When the trade unions discovered that a secret strike leadership committee had been constituted, which did not contain a single member of the SPD, the latter immediately began to clamour for representation. On the eve of the January 28 strike action, the majority at a clandestine meeting of factory delegates in Berlin voted against this. Nevertheless, the Obleute, who dominated the strike committee, decided to admit delegates of the SPD, arguing that the social-democrats were no longer in a position to prevent the strike, but that their exclusion would create a note of discord and thus undermine the unity of the coming action. Spartakus strongly condemned this decision.
The debate then came to a head in the course of the strike itself. In face of the elementary might of this action, the Spartakusbund began to plead for the intensification of the movement in the direction of civil war. The group believed that the moment might already have come to end the war by revolutionary means. The Obleute strongly opposed this, preferring to take responsibility themselves for an organised ending of the movement, once it had reached what they considered to be its culmination point. Their main arguments were that an insurrectional movement, even were it to succeed, would remain restricted to Berlin, and that the soldiers had not yet been won over to the side of the revolution.
Der Platz Russlands und Deutschlands in der Weltrevolution
Hinter diesem Streit über die Taktik steckten zwei allgemeinere und tiefergehende Fragen. Eine von ihnen betraf die Kriterien, um über die Reife der Bedingungen für einen revolutionären Aufstand zu urteilen. Wir werden im Verlauf dieser Reihe auf die Frage zurückkommen. Die andere bezog sich auf die Rolle des russischen Proletariats in der Weltrevolution. Konnte der Sturz der bürgerlichen Herrschaft in Russland sofort eine revolutionäre Erhebung in Mittel- und Westeuropa anregen oder zumindest die imperialistischen Hauptprotagonisten dazu zwingen, den Krieg zu beenden? Genau dieselbe Diskussion fand auch in der bolschewistischen Partei in Russland statt, sowohl am Vorabend des Oktoberaufstandes als auch anlässlich der Friedensverhandlungen mit der deutschen Reichsregierung in Brest-Litowsk. Innerhalb der bolschewistischen Partei argumentierten die von Bucharin angeführten Gegner jeglicher Vertragsunterzeichnung mit Deutschland, dass das Hauptmotiv des Proletariats, im Oktober 1917 die Macht in Russland zu ergreifen, darin bestand, die Revolution in Deutschland und im Westen loszutreten, und dass die Unterzeichnung eines Vertrages mit Deutschland nun gleichbedeutend mit der Abkehr von dieser Orientierung sei. Trotzki nahm eine Zwischenposition ein, um Zeit zu schinden, was das Problem auch nicht wirklich löste. Die Befürworter der Notwendigkeit der Unterzeichnung eines Vertrages, wie Lenin, stellten keineswegs die internationalistische Motivierung des Oktoberaufstandes in Frage. Was sie bezweifelten, war, dass die Entscheidung, die Macht zu ergreifen, sich auf der Annahme stützte, dass die Revolution sofort auf Deutschland übergreifen werde. Im Gegenteil: die Befürworter des Aufstandes hatten damals darauf hingewiesen, dass die unmittelbare Ausdehnung der Revolution nicht gewiss war und dass das russische Proletariat somit Isolation und beispiellose Leiden riskiert, wenn es die Initiative ergreift und die Weltrevolution beginnt. Solch ein Risiko war jedoch, wie insbesondere Lenin argumentierte, gerechtfertigt, weil das, was auf dem Spiel stand, die Zukunft nicht nur des russischen, sondern auch des Weltproletariats war; die Zukunft nicht nur des Proletariats, sondern der gesamten Menschheit. Diese Entscheidung sollte daher in vollem Bewusstsein und in verantwortlichster Weise getroffen werden. Lenin wiederholte diese Argumente auch in Bezug auf Brest: Das russische Proletariat war moralisch berechtigt, selbst den ungünstigsten Vertrag mit der deutschen Bourgeoisie zu unterzeichnen, um Zeit zu gewinnen, da es nicht sicher war, ob die deutsche Revolution sofort beginnen wird. Isoliert in ihrer Gefängniszelle vom Rest der Welt, intervenierte Rosa Luxemburg in dieser Debatte mit drei Artikeln – „Die historische Verantwortung“, „In die Katastrophe“ und „Die russische Tragödie“; geschrieben im Januar, Juni und September in dieser Reihenfolge -, die drei der wichtigsten berühmten „Spartakusbriefe“ aus dem Untergrund. Hier macht sie klar, dass weder die Bolschewiki noch das russische Proletariat wegen der Tatsache angeklagt werden dürfen, dass sie gezwungen wurden, einen Vertrag mit dem deutschen Imperialismus zu unterzeichnen. Diese Situation war das Resultat der Abwesenheit der Revolution anderswo, besonders aber in Deutschland. Auf dieser Grundlage war sie in der Lage, das folgende tragische Paradoxon zu identifizieren: Obwohl die Russische Revolution der höchste Punkt war, den die Menschheit bis dahin jemals erklommen hatte, und als solcher ein historischer Wendepunkt war, bestanden ihre unmittelbaren Auswirkungen nicht darin, die Schrecken des Weltkrieges zu verkürzen, sondern zu verlängern. Und dies aus dem einfachen Grund, dass sie den deutschen Imperialismus von dem Zwang befreite, einen Zweifrontenkrieg zu führen. Wenn Trotzki an die Möglichkeit eines Sofortfriedens unter dem Druck der Massen im Westen glaubt, so schreibt sie im Januar 1918, „dann muss allerdings in Trotzkis schäumenden Wein viel Wasser gegossen werden.“ Und sie fährt fort: „Die nächste Wirkung des Waffenstillstandes im Osten wird nur die sein, daß deutsche Truppen vom Osten nach dem Westen dirigiert werden. Vielmehr, sie sind es schon.“[6] Im Juni zog sie eine zweite Schlussfolgerung aus dieser Dynamik: Deutschland war zum Gendarm der Konterrevolution in Osteuropa geworden und massakrierte die revolutionären Kräfte von Finnland bis zur Ukraine. Wie gelähmt durch diese Entwicklung, hatte sich das Proletariat „tot gestellt.“. Im September 1918 erläutert sie dann, dass die Welt damit droht, das revolutionäre Russland selbst zu verschlingen. „Der eherne Ring des Weltkrieges, der damit im Osten durchbrochen schien, schließt sich wieder um Rußland und um die Welt lückenlos: Die Entente rückt mit Tschechoslowakei und Japanern vom Norden und Osten her – eine natürliche, unvermeidliche Folge des Vorrückens Deutschland vom Westen und vom Süden aus. Die Flammen des Weltkrieges züngeln auf russischen Boden hinüber und werden im nächsten Augenblick über der russischen Revolution zusammenschlagen. Sich dem Weltkriege – und sei es um den Preis der größten Opfer – zu entziehen erweist sich letzten Endes für Rußland allein unmöglich.“[7]Rosa Luxemburg erkennt deutlich, dass der unmittelbare militärische Vorteil, den Deutschland durch die Russische Revolution erlangt hatte, einige Monate lang dazu beitragen werde, das Kräfteverhältnis zwischen den Klassenkräften in Deutschland zugunsten der Bourgeoisie zu kippen. Obwohl die Revolution in Russland die deutschen Arbeiter inspirierte, obwohl der „Raubfrieden“, der nach Brest vom deutschen Imperialismus durchgesetzt wurde, diesen Arbeitern viele ihrer Illusionen beraubte, dauerte es noch fast ein Jahr, bis dies zu einer offenen Rebellion gegen den Imperialismus reifte. Der Grund hat etwas mit dem spezifischen Charakter einer Revolution im Kontext eines Weltkrieges zu tun. Der „Große Krieg“ 1914 war nicht nur ein Gemetzel in einem Ausmaß, das bis dahin unbekannt war; er war auch die gigantischste organisierte ökonomische, materielle und menschliche Operation in der Geschichte bis dahin. Buchstäblich Millionen von Menschen wie auch alle Ressourcen der Gesellschaften waren Zahnräder in einer infernalischen Maschinerie, eine Größenordnung, die jegliche menschliche Vorstellung übertraf. All dies löste zwei intensive Gefühle innerhalb des Proletariats aus: Hass gegen den Krieg auf der einen Seite und ein Gefühl der Machtlosigkeit auf der anderen. Unter solchen Umständen erfordert es unermessliche Leiden und Opfer, ehe die Arbeiterklasse erkennen kann, dass sie allein die Kraft ist, die den Krieg beenden kann. Darüber hinaus erfordert dieser Prozess Zeit und entfaltet sich auf ungleichmäßige, heterogene Weise. Zwei der wichtigsten Aspekte dieses Prozesses sind die Erkenntnis über die wahren, räuberischen Motive der imperialistischen Kriegsanstrengungen sowie über die Tatsache, dass die Bourgeoisie selbst die Kriegsmaschinerie nicht kontrolliert, die als Produkt des Kapitalismus unabhängig vom menschlichen Willen geworden ist. In Russland 1917 wie auch in Deutschland und Österreich-Ungarn 1918 stellte sich die Erkenntnis, dass die Bourgeoisie nicht imstande war, den Krieg zu beenden, selbst wenn sie sich einer Niederlage gegenübersieht, als entscheidend heraus. Was Brest-Litowsk und die Grenzen des Massenstreiks in Deutschland und Österreich-Ungarn im Januar 1918 enthüllten, war vor allem dies: dass die Weltrevolution von Russland initiiert werden kann, dass jedoch nur eine entscheidende proletarische Aktion in einem der kriegführenden Hauptländer – Deutschland, Großbritannien oder Frankreich – den Krieg anhalten konnte. Der Wettlauf zur Beendigung des KriegesObwohl sich das deutsche Proletariat „tot stellte“, wie Rosa Luxemburg es nannte, setzte sich der Reifungsprozess seines Klassenbewusstseins während der ersten Hälfte des Jahres 1918 fort. Darüber hinaus begannen die Soldaten ab dem Sommer dieses Jahres zum erstenmal ernsthaft vom Bazillus der Revolution infiziert zu werden. Zwei Faktoren trugen besonders dazu bei. In Russland wurden die gefangenen deutschen Soldaten freigelassen und vor die Wahl gestellt, in Russland zu bleiben, um an der Revolution teilzunehmen, oder nach Deutschland zurückzukehren. Jene, die den zweiten Weg wählten, wurden selbstverständlich von der deutschen Armee sofort wieder als Kanonenfutter zurück an die Front geschickt. Doch sie trugen die Neuigkeiten von der Russischen Revolution mit sich. In Deutschland selbst wurden Tausende von Führern des Massenstreiks im Januar bestraft, indem sie an die Front geschickt wurden, wo sie die Nachrichten von der wachsenden Revolte der Arbeiterklasse gegen den Krieg weitergaben. Doch letztendlich war es die wachsende Erkenntnis von der Sinnlosigkeit des Krieges und der Unvermeidlichkeit der Niederlage Deutschlands, die sich als entscheidend für den Stimmungswechsel in der Armee erwies. Im Herbst jenes Jahres begann also etwas, was noch einige Monate zuvor als undenkbar erschien: ein Wettlauf gegen die Zeit zwischen den klassenbewussten Arbeitern einerseits und den Führern der deutschen Bourgeoisie auf der anderen, um zu bestimmen, welche von den beiden großen Klassen der modernen Gesellschaft dem Krieg ein Ende bereiten wird. Auf Seiten der herrschenden Klasse Deutschlands mussten zwei wichtige Probleme in ihren eigenen Reihen gleich zu Anfang gelöst werden. Eines von ihnen war die völlige Unfähigkeit vieler ihrer Repräsentanten, die Möglichkeit einer Niederlage, die ihnen ins Gesicht starrte, auch nur in Erwägung zu ziehen. Das andere war, wie man einen Frieden erwirken kann, ohne das eigentliche Zentrum ihres eigenen Staatsapparates irreparabel zu diskreditieren. Was die letzte Frage anbetrifft, so müssen wir uns vergegenwärtigen, dass in Deutschland die Bourgeoisie an die Macht getragen wurde und das Land nicht durch eine Revolution von unten, sondern durch das Militär, an erster Stell durch die königliche preußische Armee, vereint wurde. Wie konnte man die Niederlage eingestehen, ohne diesen Pfeiler, dieses Symbol der nationalen Stärke und Einheit in Frage zu stellen? 15. September: die westlichen Alliierten durchbrachen die österreichisch-ungarische Front auf dem Balkan. 27. September: Bulgarien, ein wichtiger Verbündeter Berlins, kapitulierte. 29. September: der Chef der deutschen Armee, Erich Ludendorff, informierte das Oberkommando, dass der Krieg verloren sei, dass es nur noch eine Frage von Tagen oder gar Stunden sei, ehe die gesamte militärische Front zusammenbrach. Tatsächlich war die Schilderung der unmittelbaren Frontlage durch Ludendorff etwas übertrieben. Wir wissen nicht, ob er selbst in Panik geriet oder ob er bewusst ein Bild zeichnete, das dunkler war als die Realität, um die deutsche Führung zu veranlassen, seine Vorschläge zu akzeptieren. Jedenfalls wurden seine Vorschläge angenommen: Kapitulation und Installierung einer parlamentarischen Regierung. Mit dieser Vorgehensweise wollte Ludendorff einer totalen deutschen Niederlage zuvorkommen und der Revolution den Wind aus den Segeln nehmen. Doch er hatte noch ein weiteres Ziel in den Augen. Er wollte, dass die Kapitulation von einer zivilen Regierung erklärt wird, so dass das Militär weiterhin seine Niederlage in der Öffentlichkeit leugnen konnte. Er bereitete das Terrain der Dolchstoßlegende vor, dem Mythos vom „Messer in den Rücken“, dem zufolge eine siegreiche deutsche Armee von einem verräterischen Feind hinter den Linien bezwungen wurde. Doch dieser Feind, das Proletariat, konnte natürlich nicht beim Namen genannt werden. Dies würde die wachsende Kluft, die Bourgeoisie und Proletariat trennt, zementieren. Aus diesem Grund musste ein Sündenbock gefunden werden, den man anklagen konnte, die Arbeiter „verleitet“ zu haben. Angesichts der spezifischen Geschichte der westlichen Zivilisation in den vergangenen zweitausend Jahren war das geeignetste Opfer dieser Sündenbock-Suche schnell an der Hand: die Juden. Es war also jener Antisemitismus, der bereits in den Jahren vor dem großen Krieg auf dem Aufstieg war, vor allem im Russischen Reich, und der auf die Hauptbühne der europäischen Politik zurückgekehrt war. Der Weg nach Auschwitz beginnt hier. Oktober 1918: Ludendorff und Hindenburg forderten ein sofortiges Friedensangebot an die Entente[8]. Zur gleichen Zeit rief eine nationale Konferenz der kompromisslosesten revolutionären Gruppierungen, der Spartakusbund und die Bremer Linken, zu einer forcierten Agitation unter den Soldaten und für die Bildung von Arbeiterräten auf. Zu dieser Zeit befanden sich Hunderttausende von desertierenden Soldaten auf der Flucht von der Front. Und, wie der Revolutionär Paul Frölich später schreiben sollte (in seiner Biographie von Rosa Luxemburg), es gab ein neues Verhalten der Massen, das an ihren Augen abgelesen werden konnte. Innerhalb des Lagers der Bourgeoisie wurden die Bemühungen, den Krieg zu beenden, von zwei neuen Faktoren aufrechterhalten. Keiner der unbarmherzigen Führer des deutschen Staates, die nie zögerten, Millionen ihrer eigenen „Subjekte“ in den sicheren wie sinnlosen Tod zu schicken, hatte den Mut, Kaiser Wilhelm II. darüber zu informieren, dass er von seinem Thron zurücktreten muss. Denn eine andere, opponierende Seite im imperialistischen Krieg dachte sich weiterhin neue Ausreden aus, um den Waffenstillstand zu verschieben, da sie noch nicht von der unmittelbaren Wahrscheinlichkeit der Revolution und der Gefahr, die dies für ihre eigene Herrschaft bedeutete, überzeugt war. Die Bourgeoisie verlor Zeit. Doch nichts davon hinderte sie daran, eine blutige Repression gegen die revolutionären Kräfte vorzubereiten. Insbesondere hatte sie bereits jene Teile der Armee auserwählt, die nach ihrer Rückkehr von der Front dazu benutzt werden konnten, die wichtigsten Städte zu besetzen. Innerhalb des Lagers des Proletariats bereiteten die Revolutionäre immer intensiver einen bewaffneten Aufstand vor, um den Krieg zu beenden. Die Obleute in Berlin setzten erst den 4. November, dann den 11. November als Tag des Aufstandes fest. Doch in der Zwischenzeit nahmen die Ereignisse eine Wendung, die weder die Bourgeoisie noch das Proletariat erwartet hatte und die einen großen Einfluss auf den Verlauf der Revolution ausübte. Meuterei in der Marine, Auflösung der ArmeeUm die Bedingungen für einen Waffenstillstand zu erfüllen, die mit ihren Kriegsgegnern vereinbart worden waren, stoppte die Regierung in Berlin am 20. Oktober alle Militäroperationen der Marine, insbesondere die Untersee-Kriegführung. Eine Woche später erklärte sie ihre Bereitschaft, einem Waffenstillstand ohne Bedingungen zuzustimmen. Angesichts dieses Beginns vom Ende drehten Offiziere der Kriegsflotte an der norddeutschen Küste durch. Oder vielmehr trat die Verrücktheit ihrer uralten Kaste – die Verteidigung der Ehre, der Tradition des Duells, der Forderung bzw. Gewährung von „Satisfaktion“ – durch den Irrsinn des modernen imperialistischen Krieges an die Oberfläche. Hinter dem Rücken ihrer eigenen Regierung beschlossen sie, mit der Kriegsflotte zu einer großen Seeschlacht gegen die britische Navy auszulaufen, auf die sie vergeblich während des Krieges gewartet hatte. Sie zogen es vor, in Ehre zu sterben, statt sich ohne Schlacht zu ergeben. Sie nahmen an, dass die Matrosen und die Mannschaften – 80.000 Leben zusammen – unter ihrem Kommando bereit wären, ihnen zu folge[9].Dies war jedoch nicht der Fall. Die Mannschaften meuterten gegen ihre Kommandierenden. Mindest einige von ihnen starben dabei. In einem dramatischen Moment richteten Schiffe, die von ihren Mannschaften übernommen worden waren, und Schiffe, auf denen dies (noch) nicht der Fall war, ihre Geschütze aufeinander. Schließlich ergaben sich die Meuterer, wahrscheinlich, um zu vermeiden, auf ihre eigenen Gefährten zu schießen. Doch dies war es noch nicht, was die Revolution in Deutschland ins Rollen brachte. Was entscheidend war, war, dass ein Teil der inhaftierten Matrosen als Häftlinge nach Kiel gebracht wurde, wo sie wahrscheinlich als Verräter zum Tode verurteilt werden sollten. Die anderen Matrosen, die nicht den Mut beessen hatten, sich der ursprünglichen Rebellion auf offener See anzuschließen, drückten nun furchtlos ihre Solidarität mit ihren Kameraden aus. Doch vor allem kam in Solidarität mit ihnen auch die Arbeiterklasse von Kiel heraus und verbrüderte sich mit den Matrosen. Der Sozialdemokrat Noske, der entsandt wurde, um die Erhebung gnadenlos niederzuschlagen, traf in Kiel am 4. November ein, um die Stadt in den Händen bewaffneter Arbeiter, Matrosen und Soldaten vorzufinden. Darüber hinaus hatten bereits Massendelegationen Kiel in alle Richtungen verlassen, um die Bevölkerung zur Revolution aufzufordern, wobei sie sehr gut wussten, dass sie eine Schwelle überschritten hatten, nach der es keinen Rückweg mehr gibt: Sieg oder sicherer Tod. Noske war völlig überrascht, sowohl von der Geschwindigkeit der Ereignisse als auch von der Tatsache, dass die Rebellen von Kiel ihn als einen Held begrüßten[10].Unter den Hammerschlägen dieser Ereignisse löste sich die mächtige deutsche Militärmaschinerie letztendlich auf. Die Divisionen, die aus Belgien zurückfluteten und mit denen die Regierung bei der „Wiederherstellung der Ordnung“ in Köln geplant hatte, desertierten. Am Abend des 8. November wandten sich alle Blicke nach Berlin, dem Sitz der Regierung und dem Ort, wo die bewaffneten Kräfte der Konterrevolution hauptsächlich konzentriert waren. Es ging das Gerücht herum, dass die Entscheidungsschlacht am nächsten Tag in der Hauptstadt ausgetragen werde. Richard Müller, Führer der Obleute in Berlin, erinnerte später daran. „Am 8. November abends stand ich am Halleschen Tor[11]. Schwer bewaffnete Infanteriekolonnen, Maschinengewehr-Kompanien und leichte Feldartillerie zogen in endlosen Zügen an mir vorüber, dem Inneren der Stadt zu. Das Menschenmaterial sah recht verwegen aus. Es war im Osten zum Niederschlagen der russischen Arbeiter und Bauern und gegen Finnland mit ‚Erfolg‘ verwendet worden. Kein Zweifel, es sollte in Berlin die Revolution des Volkes im Blute ersäufen.“ Müller fährt fort zu schildern, wie die SPD Botschaften zu all ihren Funktionären schickte, in denen letztere instruiert wurden, sich dem Ausbruch der Revolution mit allen Mitteln zu widersetzen. Er fährt fort: „Seit Kriegsausbruch stand ich an der Spitze der revolutionären Bewegung. Niemals, auch bei den ärgsten Rückschlägen nicht, hatte ich am Siege des Proletariats gezweifelt. Aber jetzt, wo die Stunde der Entscheidung nahte, erfaßte mich ein beklemmendes Gefühl, eine große Sorge um meine Klassengenossen, um das Proletariat. Ich selbst kam mir angesichts der Größe der Stunde beschämend klein und schwach vor.“[12]
Die Novemberrevolution: Das Proletariat beendet den Krieg
It has often been claimed that the German proletariat, on account of the culture of obedience and submission which, for historic reasons, dominated the culture in particular of the ruling classes of that country for several centuries, is incapable of revolution. The 9th of November 1918 disproves this. On the morning of that day, hundreds of thousands of demonstrators from the great working class districts which encircle the government and business quarters on three sides, moved towards the city centre. They planned their routes to pass the main military barracks on their way to try and win over the soldiers, and the main prisons, where they intended to liberate their comrades. They were armed with guns, rifles and hand grenades. And they were prepared to die for the cause of the revolution. Everything was planned on the spot and spontaneously.
That day, only 15 people were killed. The November Revolution in Germany was as bloodless as the October Revolution in Russia. But nobody knew or even expected this in advance. The proletariat of Berlin showed great courage and unswerving determination that day.
Midday. The SPD leaders Ebert and Scheidemann were sitting in the Reichstag, the seat of the German parliament, eating their soup. Friedrich Ebert was proud of himself, having just been summoned by the rich and the nobles to form a government to save capitalism. When they heard noises outside, Ebert, refusing to allow a mob to interrupt him, silently continued his meal. Scheidemann, accompanied by functionaries who were afraid the building was going to be stormed, stepped out on the balcony to see what was going on. What he saw was something like a million demonstrators on the lawns between the Reichstag and the Brandenburg Gate. A crowd which fell silent when it saw Scheidemann on the balcony, thinking he had come to make a speech. Obliged to improvise, he declared the "free German republic". When he got back to tell Ebert what he had done, the latter was furious, since he had been intending to save not only capitalism, but even the monarchy.[13]
Around the same moment the real socialist Karl Liebknecht was standing on the balcony of the palace of that very monarchy, declaring the socialist republic, and summoning the proletariat of all countries to world revolution. And a few hours later, the revolutionary Obleute occupied one of the main meeting rooms in the Reichstag. There, they formulated the appeals for delegates to be elected in mass assemblies the next day, to constitute revolutionary workers and soldiers councils.
The war had been brought to an end, the monarchy toppled. But the rule of the bourgeoisie was still far from being over.
Nach dem Krieg: der Bürgerkrieg
Zu Beginn dieses Artikels riefen wir in Erinnerung, was historisch auf dem Spiel stand, wie es von Rosa Luxemburg formuliert worden war, und dass dies sich in der Frage konzentriert: Welche Klasse wird den Krieg beenden? Wir erinnerten an die drei möglichen Szenarien, wie der Krieg enden könnte: durch das Proletariat, durch die Bourgeoisie oder durch gegenseitige Erschöpfung der kriegführenden Parteien. Die Ereignisse zeigen deutlich, dass es letztendlich das Proletariat war, das bei der Beendigung des „Großen Krieges“ die führende Rolle spielte. Diese Tatsache allein veranschaulicht die potenzielle Macht des revolutionären Proletariats. Sie erklärt, warum die Bourgeoisie sich bis zu dem heutigen Tag über die Novemberrevolution 1918 in Schweigen hüllt. Doch dies ist nicht die ganze Geschichte. Bis zu einem gewissen Umfang waren die Ereignisse im November 1918 die Kombination aller drei Szenarien, die von Rosa Luxemburg geschildert wurden. Bis zu einem gewissen Umfang waren diese Ereignisse auch das Produkt der militärischen Niederlage Deutschlands. Zu Beginn November 1918 stand Deutschland wirklich am Rande einer totalen militärischen Niederlage. Ironischerweise ersparte die proletarische Erhebung der deutschen Bourgeoisie das Schicksal einer militärischen Okkupation und zwang die Alliierten, den Krieg zu stoppen, um die Verbreitung der Revolution zu vermeiden. November 1918 enthüllte auch Elemente des „wechselseitigen Ruins“ und der Erschöpfung, vor allem in Deutschland, aber auch in Großbritannien und Frankreich. Tatsächlich war es erst die Intervention der Vereinigten Staaten auf Seiten der westlichen Alliierten ab 1917, die den Ausschlag zugunsten Letzterer gaben und den Weg aus der tödlichen Sackgasse öffneten, in welche die europäischen Großmächte hineingetappt waren.
Wenn wir die Rolle dieser anderen Faktoren erwähnen, dann nicht, um die Rolle des Proletariats zu minimieren. Sie sind jedoch zu wichtig, um unberücksichtigt zu bleiben, denn sie helfen den Charakter der Ereignisse zu erklären. Die Novemberrevolution errang den Erfolg als unwiderstehliche Kraft. Aber auch, weil der deutsche Imperialismus den Krieg bereits verloren hatte, weil seine Armeen sich in voller Auslösung befanden und weil nicht nur die Arbeiterklasse, sondern auch breite Sektoren des Kleinbürgertums und sogar der Bourgeoisie nun den Frieden wollten.
Am Tag nach dem großen Triumph wählte die Bevölkerung von Berlin Arbeiter- und Soldatenräte. Diese ernannten ihrerseits zusammen mit ihrer eigenen Organisation eine Art provisorische sozialistische Regierung, die von der SPD und der USPD unter der Führung von Friedrich Ebert gebildet wurde. Am gleichen Tag unterzeichnete Ebert ein Geheimabkommen mit der neuen militärischen Führung, um die Revolution niederzuschlagen. Im nächsten Artikel wollen wir die Kräfte der revolutionären Avantgarde im Kontext des beginnenden Bürgerkriegs und am Vorabend der entscheidenden Ereignisse der Weltrevolution untersuchen. Steinklopfer im Juli 2008
[12] Richard Müller, „Vom Kaiserreich zur Republik“, S. 143.
[13] Anekdoten dieser Art aus dem Innersten des Lagers der Konterrevolution können in den Memoiren führender Sozialdemokraten zur damaligen Zeit gefunden werden. Philipp Scheidemann („Memoiren eines Sozialdemokraten“), 1928. Gustav Noske: Von Kiel bis Kapp – Zur Geschichte der deutschen Revolution, 1920.
Aktuelles und Laufendes:
- Deutschland 1918 [25]
Leute:
- Liebknecht [16]
- Luxemburg [17]
- Jogiches [18]
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Historische Ereignisse:
- Novemberrevolution [26]
- Deutschland 1918- 1919 [20]
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Theoretische Fragen:
- Internationalismus [23]
Erbe der kommunistischen Linke:
Deutschland 1918 – Teil 3 Gründung der Partei, Abwesenheit der Internationale
- 3567 Aufrufe
Nachdem der I. Weltkrieg ausgebrochen war, trafen sich die Sozialisten am 4. August 1914, um den Kampf für den Internationalismus und gegen den Krieg aufzunehmen: Es waren sieben von ihnen in Rosa Luxemburgs Wohnung. Diese Reminiszenz, die uns daran erinnert, dass die Fähigkeit, gegen den Strom zu schwimmen, eine der wichtigsten revolutionären Qualitäten ist, darf uns nicht zur Schlussfolgerung verleiten, dass die Rolle der proletarischen Partei in den Ereignissen, die die damalige Welt erschütterten, peripher gewesen sei. Das Gegenteil war der Fall, wie wir in den ersten beiden Artikeln dieser Serie zum Gedenken des 90. Jahrestages der revolutionären Kämpfe in Deutschland aufzuzeigen versucht haben. Im ersten Artikel stellten wir die These vor, dass die Krise in der Sozialdemokratie, insbesondere in der deutschen SPD (1) – der führenden Partei der Zweiten Internationale -, einer der wichtigsten Faktoren gewesen war, die die Möglichkeit für den Imperialismus eröffnet haben, das Proletariat in den Krieg marschieren zu lassen. In Teil 2 argumentierten wir, dass die Intervention von Revolutionären entscheidend war, um die Arbeiterklasse in die Lage zu versetzen, inmitten des Krieges ihre internationalistischen Prinzipien wiederzuentdecken und so das Ende der imperialistischen Schlachterei durch revolutionäre Mittel (die Novemberrevolution von 1918) zu erwirken. Indem sie so verfuhren, legten sie die Fundamente für eine neue Partei und eine neue Internationale.
Und in beiden dieser Phasen, so haben wir hervorgehoben, war die Fähigkeit der Revolutionäre, die Prioritäten des Augenblicks zu begreifen, die Vorbedingung dafür, eine solch aktive und positive Rolle zu spielen. Nach dem Aufbrechen der Internationale angesichts des Krieges war es die Aufgabe der Stunde, die Ursachen dieses Fiaskos zu verstehen und die Lehren daraus zu ziehen. Im Kampf gegen den Krieg war es die Verantwortung wirklicher Sozialisten, die ersten zu sein, um das Banner des Internationalismus zu hissen, den Weg zur Revolution auszuleuchten.
Die Arbeiterräte und die Klassenpartei
Die Arbeitererhebung am 9. November 1918 brachte am Morgen des 10. Novembers 1918 den Krieg zu Ende. Der deutsche Kaiser und zahllose Fürsten waren niedergerungen – nun begann eine neue Phase der Revolution. Obwohl der Novemberaufstand von den Arbeitern angeführt wurde, nannte Rosa Luxemburg ihn eine „Revolution der Soldaten“. Dies darum, weil der Geist, der ihn beherrschte, der Geist einer tiefen Sehnsucht nach Frieden war. Ein Wunsch, den die Soldaten nach vier Jahren in den Schützengräben mehr als jede andere gesellschaftliche Gruppe verkörperten. Dies gab jenem unvergesslichen Tag seine spezifische Färbung, seinen Ruhm und nährte seine Illusionen. Da selbst Teile der Bourgeoisie erleichtert waren, dass der Krieg endlich vorbei war, beherrschte die allgemeine Verbrüderung die damalige Stimmung. Selbst die beiden Hauptprotagonisten des gesellschaftlichen Kampfes, die Bourgeoisie und das Proletariat, waren von den Illusionen des 9. November betroffen. Die Illusion der Bourgeoisie war, dass sie die von der Front heimkehrenden Soldaten noch immer gegen die Arbeiter benutzen könnte. In den folgenden Tagen verflüchtigte sich diese Illusion. Die „grauen Röcke“ (2) wollten nach Hause und nicht gegen die Arbeiter kämpfen. Das Proletariat hatte die Illusion, dass die Soldaten schon jetzt auf ihrer Seite waren und die Revolution wollten. Während der ersten Sitzungen der Arbeiter- und Soldatenräte, die in Berlin am 10. November gewählt worden waren, lynchten die Soldatendelegierten fast die Revolutionäre, die von der Notwendigkeit sprachen, den Klassenkampf fortzuführen, und die die neue sozialdemokratische Regierung als Volksfeind identifizierten.
Diese Arbeiter- und Soldatenräte waren im allgemeinen von der menschlichen Trägheit gekennzeichnet, die merkwürdigerweise den Beginn einer jeden großen sozialen Erhebung auszeichnet. Sehr oft wählten Soldaten ihre Offiziere als Delegierte, und Arbeiter ernannten dieselben sozialdemokratischen Kandidaten, für die sie schon vor dem Krieg gestimmt hatten. So hatten diese Räte nichts Besseres zu tun, als eine Regierung zu ernennen, die von den Kriegstreibern der SPD angeführt wurde, und ihren eigenen Selbstmord im Voraus zu beschließen, indem sie zu allgemeinen Wahlen für ein parlamentarisches System aufriefen.
Trotz der Hoffnungslosigkeit dieser ersten Maßnahmen waren die Arbeiterräte das Herz der Novemberrevolution. Wie Rosa Luxemburg hervorhob, war es vor allem das Auftreten dieser Organe, die den wesentlich proletarischen Charakter dieses Aufstandes bewiesen und verkörperten. Doch jetzt wurde eine neue Phase der Revolution eröffnet, in der die zentrale Frage nicht mehr die der Räte war, sondern die Frage der Klassenpartei. Die Phase der Illusionen kam zu ihrem Ende, der Augenblick der Wahrheit, des Ausbruchs des Bürgerkriegs rückte näher. Die Arbeiterräte waren durch ihre eigentliche Funktion und Struktur als Massenorgane in der Lage, sich selbst von einem Tag zum anderen zu erneuern und zu revolutionieren. Die zentrale Frage war jetzt: Würde die entschlossen revolutionäre, proletarische Auffassung innerhalb dieser Räte, innerhalb der Arbeiterklasse die Oberhand erlangen?
Um siegreich zu sein, bedarf die proletarische Revolution einer vereinten, zentralisierten politischen Avantgarde, in der die Klasse in ihrer Gesamtheit Vertrauen hat. Dies war die vielleicht wichtigste Lehre aus der Oktoberrevolution in Russland im Jahr zuvor. Die Aufgabe dieser Partei ist nicht mehr, wie Rosa Luxemburg 1906 in ihrem Pamphlet über den Massenstreik argumentiert hat, die Massen zu organisieren, sondern der Klasse eine politische Führung und ein wirkliches Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten zu geben.
Die Schwierigkeit bei der Umgruppierung der Revolutionäre
Doch Ende 1918 war in Deutschland eine solche Partei nicht in Sicht. Jene Sozialisten, die sich der Pro-Kriegs-Politik der SPD widersetzten, waren hauptsächlich in der USPD anzutreffen, der früheren Parteiopposition, die Zug um Zug aus der SPD ausgeschlossen worden war. Ein bunte Mix mit Zehntausenden von Mitgliedern, von den Pazifisten und jenen, die eine Versöhnung mit den Kriegstreibern wollten, bis zu den prinzipienfesten revolutionären Internationalisten. Die Hauptorganisation dieser Internationalisten, der Spartakusbund, war eine unabhängige Fraktion innerhalb der USPD. Andere, kleinere internationalistische Gruppen, wie die IKD (3) (die aus der linken Opposition in Bremen hervorkamen), waren außerhalb der USPD organisiert. Der Spartakusbund war unter den Arbeitern wohlbekannt und respektiert. Doch die anerkannten Führer der Streikbewegungen gegen den Krieg waren nicht diese politischen Gruppierungen, sondern die informelle Struktur der Fabrikdelegierten, die „revolutionären Obleute“. Ab Dezember 1918 spitzte sich die Lage zu. Die ersten Geplänkel, die zum offenen Bürgerkrieg führten, hatten bereits stattgefunden. Doch die verschiedenen Komponenten einer potenziellen revolutionären Klassenpartei – der Spartakusbund, die anderen linken Elemente in der USPD, die IKD, die Obleute waren noch immer getrennt und mehrheitlich zaudernd.
Unter dem Eindruck der Ereignisse begann sich die Frage der Parteigründung konkreter zu stellen. Schließlich wurde sie eilig in Angriff genommen.
Der erste nationale Kongress der Arbeiter- und Soldatenräte war am 16. Dezember in Berlin zusammengekommen. Während 250.000 radikale Arbeiter draußen demonstrierten, um Druck auf die 489 Delegierten (von denen nur zehn den Spartakusbund, zehn die IKD repräsentierten) auszuüben, wurde es Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht nicht gestattet, sich an das Treffen zu wenden (unter dem Vorwand, dass sie kein Mandat besäßen). Als dieser Kongress damit endete, dass er seine Macht an ein künftiges parlamentarisches System aushändigte, wurde klar, dass die Revolutionäre darauf mit vereinten Kräften antworten müssen.
Am 14. Dezember veröffentlichte der Spartakusbund eine programmatische Prinzipienerklärung: Was will der Spartakusbund?
Am 17. Dezember rief eine nationale Konferenz der IKD in Berlin zur Diktatur des Proletariats und zur Bildung einer Klassenpartei durch einen Prozess der Umgruppierung auf. Die Konferenz scheiterte dabei, eine Übereinstimmung in der Frage der Teilnahme an den kommenden Wahlen zur parlamentarischen Nationalversammlung zu erzielen.
Etwa zur gleichen Zeit begannen Führer innerhalb der USPD, wie Georg Ledebour, und unter den Fabrikdelegierten, wie Richard Müller, die Frage der Notwendigkeit einer vereinten Arbeiterpartei zu stellen.
Zum gleichen Zeitpunkt trafen sich Delegierte der internationalen Jugendbewegung in Berlin, wo sie ein Sekretariat einsetzten. Am 18. Dezember wurde eine internationale Jugendkonferenz abgehalten, der eine Massenversammlung in Berlin-Neukölln folgte, auf der Karl Liebknecht und Willi Münzenberg sprachen.
In diesem Kontext beschloss ein Treffen der Delegierten des Spartakusbundes am 29. Dezember in Berlin, mit der USPD zu brechen und eine separate Partei zu bilden. Drei Delegierte stimmten gegen diese Entscheidung. Dasselbe Treffen rief zu einer vereinten Konferenz von Spartakus und IKD auf, die am folgenden Tag in Berlin begann und auf der 127 Delegierte aus 56 Städten und Sektionen teilnahmen. Diese Konferenz wurde teilweise durch die Vermittlung von Karl Radek, dem Delegierten der Bolschewiki, möglich gemacht. Viele dieser Delegierten waren sich bis zu ihrer Ankunft nicht im Klaren, dass sie gerufen wurden, um eine neue Partei zu gründen (4). Die Fabrikdelegierten waren nicht eingeladen, da das Gefühl vorherrschte, dass es noch nicht möglich sei, sie mit den sehr entschlossenen revolutionären Positionen zu vereinen, die von der Mehrheit der oft noch jungen Mitglieder und Anhänger von Spartakus und IKD vertreten wurde. Stattdessen herrschte die Hoffnung vor, dass die Fabrikdelegierten der Partei beitreten werden, sobald diese gegründet worden war. (5)
Der Gründungskongress der KPD brachte führende Figuren aus der Bremer Linken (einschließlich Karl Radek, auch wenn er die Bolschewiki auf diesem Treffen vertrat), die meinten, dass die Gründung der Partei lange überfällig war, und des Spartakusbundes, wie Rosa Luxemburg und vor allem Leo Jogiches, zusammen, deren prinzipielle Sorge es war, dass diese Schritt voreilig sein könnte. Paradoxerweise hatten beide Seiten gute Argumente, um ihre Standpunkte zu rechtfertigen.
Die russische Kommunistische Partei (Bolschewiki) sandte sechs Delegierte zur Konferenz, von denen zwei von der deutschen Polizei an der Teilnahme gehindert wurden (6),
Der Gründungskongress: ein großer programmatischer Fortschritt
Zwei der Hauptdiskussionen auf dem Gründungskongress der KPD betrafen die Frage der parlamentarischen Wahlen und der Gewerkschaften. Dies waren Themen, die bereits in den Debatten vor 1914 eine wichtige Rolle gespielt hatten, die aber im Verlaufe des Krieges zweitrangig geworden waren. Nun kehrten sie in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zurück. Karl Liebknecht griff bereits in seiner einleitenden Präsentation über die „Krise in der USPD“ die parlamentarische Frage auf. Der erste nationale Kongress der Arbeiterräte in Berlin hatte bereits die Frage gestellt, die die USPD unvermeidlich spalten musste: Nationalversammlung oder Räterepublik? Es war die Verantwortung aller Revolutionäre, die bürgerlichen Wahlen und ihr parlamentarisches System als konterrevolutionär, als den Tod der Herrschaft der Arbeiterräte zu brandmarken. Doch die Führung der USPD hatte sich sowohl dem Aufruf des Spartakusbundes als auch dem Aufruf der Obleute in Berlin zu einem außerordentlichen Kongress verweigert, um diese Frage zu diskutieren und zu entscheiden.
Als Sprecher der russischen Delegation entwickelte Karl Radek das Verständnis weiter, dass es die historische Entwicklung selbst sei, die nicht nur die Notwendigkeit eines Gründungskongresses, sondern auch seine Tagesordnung bestimmte. Mit dem Ende des Krieges würde sich die Logik der Revolution in Deutschland notwendigerweise von jener in Russland unterscheiden. Die zentrale Frage sei nicht mehr der Frieden, sondern die Nahrungsmittelversorgung und ihre Preise sowie die Frage der Arbeitslosigkeit.
Indem sie die Frage der Nationalversammlung und der „ökonomischen Kämpfe“ auf die Tagesordnung der ersten beiden Tage des Kongresses setzte, hoffte die Führung des Spartakusbundes auf eine klare Position für die Arbeiterräte und gegen das parlamentarische System, gegen die überholte Gewerkschaftsform des Kampfes als solide programmatische Basis für die neue Partei. Doch die Debatten gingen noch darüber hinaus. Die Mehrheit der Delegierten sprach sich gegen jegliche Beteiligung an bürgerlichen Wahlen, selbst als ein Mittel der Agitation gegen sie, sowie gegen die Arbeit innerhalb der Gewerkschaften aus. Auf dieser Ebene war der Kongress einer der stärksten Augenblicke in der Geschichte der Arbeiterbewegung. Er half zum ersten Mal überhaupt, im Namen einer revolutionären Klassenpartei diese radikalen Positionen zu formulieren, die der neuen Epoche des dekadenten Kapitalismus entsprachen. Diese Ideen sollten die Formulierung des Manifestes der Kommunistischen Internationale stark beeinflussen, das einige Monate später von Trotzki verfasst wurde. Und sie sollten zu fundamentalen Positionen der Kommunistischen Linken werden – so wie sie es bis heute sind.
Die Interventionen der Delegierten, die diese Positionen definierten, waren oft von Ungeduld und einem gewissen Mangel an Argumenten gekennzeichnet und wurden von den erfahreneren Mitgliedern kritisiert, auch von Rosa Luxemburg, die nicht ihre radikalsten Schlussfolgerungen teilte. Doch die Protokolle des Treffens illustrieren gut, dass diese neuen Positionen nicht das Produkt von Individuen und ihrer Schwächen, sondern der Ausdruck einer tiefergehenden gesellschaftlichen Bewegung waren, die Hunderttausende von klassenbewussten Arbeitern umfasste (7). Gelwitzki, ein Delegierter aus Berlin, rief die Partei auf, statt der Beteiligung an den Wahlen zu den Kasernen zu gehen, um die Soldaten davon zu überzeugen, dass die Räteversammlung die „Regierung des Weltproletariats“ ist und die Nationalversammlung jene der Konterrevolution. Leviné, Delegierter aus Neukölln (Berlin) wies darauf hin, dass die Teilnahme an den Wahlen nichts anderes bewirke als die Verstärkung der Illusionen der Massen. (8) In den Debatten über die ökonomischen Kämpfe argumentierte Paul Frölich, Delegierter aus Hamburg, dass die alte gewerkschaftliche Form nun überholt sei, da sie auf einer Trennung zwischen den ökonomischen und politischen Dimensionen des Klassenkampfes beruhten. (9) Hammer, Delegierter aus Essen, berichtete, dass die Bergarbeiter vom Ruhrgebiet ihre Gewerkschaftsausweise weggeworfen hatten. Was Rosa Luxemburg selbst angeht, die noch immer für die Arbeit innerhalb der Gewerkschaften aus taktischen Gründen plädierte, so erklärte sie, dass der Kampf des Proletariats für seine Befreiung identisch mit dem Kampf für die Befreiung der Gewerkschaften sei.
Massenstreik und Aufstand
Die programmatischen Debatten auf dem Gründungskongress waren von großer historischer Bedeutung, besonders für die Zukunft.
Doch zum Zeitpunkt des Gründungskongresses selbst lag Rosa Luxemburg völlig richtig, als sie sagte, dass sowohl die Frage der parlamentarischen Wahlen als auch die Frage der Gewerkschaften zweitrangig waren. Einerseits war die Frage der Rolle dieser Institutionen in dem, was sich anschickte, zur Epoche des Imperialismus zu werden, noch zu neu für die Arbeiterbewegung. Sowohl die Debatten als auch die praktischen Erfahrungen waren noch nicht ausreichend, um diese Frage völlig zu klären. Für den Augenblick reichte es aus, zu wissen und zuzustimmen, dass die Masseneinheitsorgane der Klasse, die Arbeiterräte, und nicht das Parlament oder die Gewerkschaften die Mittel des Arbeiterkampfes und der proletarischen Diktatur sind.
Auf der anderen Seite neigten diese Debatten dazu, von der Hauptaufgabe des Kongresses abzulenken, die darin bestand, die nächsten Schritte der Klasse auf dem Weg zur Macht auszumachen. Tragischerweise scheiterte der Kongress darin, diese Frage zu klären. Die Schlüsseldiskussion über dieses Thema wurde von Rosa Luxemburgs Präsentation über „Unser Programm“ am Nachmittag des zweiten Tages (31. Dezember 1918) eingeleitet. Hier erkundete sie den Charakter dessen, was als zweite Phase der Revolution ausgerufen wurde. Die erste Phase, sagte sie, war sofort politisch gewesen, da sie gegen den Krieg gerichtet war. Während der Novemberrevolution wurde die Frage der spezifischen Klassenforderungen der Arbeiter hintangestellt. Dies half seinerseits das verhältnismäßig niedrige Niveau des Klassenbewusstseins zu erklären, welches diese Ereignisse begleitete und sich in dem Wunsch nach Wiederversöhnung und nach einer „Wiedervereinigung“ des „sozialistischen Lagers“ ausdrückte. Für Rosa Luxemburg war das Hauptkennzeichen der zweiten Phase der Revolution die Rückkehr der wirtschaftlichen Klassenforderungen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.
Sie hatte dabei keineswegs außer Acht gelassen, dass die Eroberung der Macht vor allem ein politischer Akt ist. Doch wollte sie einen anderen wichtigen Unterschied zwischen den revolutionären Prozess Russlands und Deutschlands beleuchten. 1917 kam das russische Proletariat ohne größeren Gebrauch der Streikwaffe an die Macht. Doch war dies, wie Rosa Luxemburg hervorhob, nur möglich, weil die Revolution in Russland nicht 1917, sondern 1905 begonnen hatte. Mit anderen Worten, das russische Proletariat hatte bereits vor 1917 die Erfahrung des Massenstreiks gemacht.
Auf dem Kongress wiederholte sie nicht die Hauptgedanken, die von der Linken der Sozialdemokratie über den Massenstreik von 1905 entwickelt worden waren. Sie konnte getrost davon ausgehen, dass sie noch immer in den Köpfen der Delegierten präsent waren. Wir möchten sie an dieser Stelle kurz in Erinnerung rufen: Der Massenstreik ist die Vorbedingung für die Machtergreifung, gerade weil er die Trennung zwischen wirtschaftlichen und politischen Kämpfen wegwischt. Und während die Gewerkschaften selbst in ihren stärksten Zeiten als Instrumente der Arbeiter nur Minderheiten der Klasse organisierten, aktiviert der Massenstreik die „zusammen geknäuelte Masse der Heloten“ des Proletariats, der unorganisierten Massen, die unberührt vom Licht der politischen Bildung sind. Der Arbeiterkampf richtet sich nicht nur gegen die materielle Armut. Er ist eine Erhebung gegen die existierende Arbeitsteilung selbst, angeführt von ihren Hauptopfern, den Lohnsklaven. Das Geheimnis des Massenstreiks ist das Streben der Proletarier nach vollständiger Menschwerdung. Last but not least: Der Massenstreik würde zur Wiederverjüngung der Arbeiterräte führen, indem der Klasse die organisatorischen Mittel verliehen werden, ihren Machtkampf zu zentralisieren.
Daher beharrte Rosa Luxemburg in ihrer Rede auf dem Kongress darauf, dass die bewaffnete Erhebung der letzte, nicht der erste Akt des Machtkampfes sei. Die Aufgabe der Stunde, sagte sie, sei es nicht, die Regierung zu stürzen, sondern sie zu untergraben. Der Hauptunterschied zur bürgerlichen Revolution sei, so argumentierte sie, ihr Massencharakter, indem sie von „unten“ komme. (10)
Die Unreife des Kongresses
Doch genau dies wurde auf dem Kongress nicht verstanden. Für viele Delegierten war die nächste Phase der Revolution nicht von Massenstreikbewegungen, sondern vom unmittelbaren Kampf um die Macht charakterisiert. Diese Konfusion wurde besonders deutlich von Otto Rühle (11) artikuliert, der behauptete, dass es möglich sei, innerhalb von vierzehn Tagen die Macht zu erobern. Selbst Karl Liebknecht wollte, obwohl er die Möglichkeit einer lang hingezogenen Revolution in Betracht zog, nicht die Möglichkeit einer „ganz rapiden Entwicklung“ ausschließen (12)
Wir haben jeden Grund, den Augenzeugenberichten Glauben zu schenken, denen zufolge insbesondere Rosa Luxemburg von den Resultaten dieses Kongresses schockiert und alarmiert war. Was Leo Jogiches anbelangt, soll seine erste Reaktion gewesen sein, Luxemburg und Liebknecht zu raten, Berlin zu verlassen und sich für eine Weile zu verstecken. (13) Er befürchtete, dass die Partei und das Proletariat sich auf eine Katastrophe zu bewegten.
Was Rosa Luxemburg am meisten alarmierte, waren nicht die verabschiedeten programmatischen Positionen, sondern die Blindheit der meisten Delegierten gegenüber der Gefahr, die die Konterrevolution darstellte, und die allgemeine Unreife, mit der die Debatten geführt wurden. Viele Interventionen zeichneten sich durch Wunschdenken aus und erweckten den Eindruck, dass eine Mehrheit der Klasse bereits hinter der neuen Partei stünde. Die Präsentation von Rosa Luxemburg wurde mit Jubel begrüßt. Einem Antrag von sechzehn Delegierten, sie so schnell wie möglich als „Agitationsbroschüre“ zu veröffentlichen, wurde sofort stattgegeben. Im Gegensatz dazu gelang es dem Kongress nicht, darüber ernsthaft zu diskutieren. Insbesondere griff kaum eine Intervention Rosas Hauptgedanken auf: dass der Kampf um die Macht noch nicht auf der Tagesordnung war. Eine löbliche Ausnahme war der Beitrag von Ernst Meyer, der über seinen jüngsten Besuch in den ostelbischen Provinzen sprach. Er berichtete, dass große Bereiche des Kleinbürgertums über der Notwendigkeit sprachen, Berlin eine Lektion zu erteilen. Er fuhr fort: „Fast noch erschrockener war ich darüber, dass auch die Arbeiter in den Städten selbst noch nicht das Verständnis dafür hatten, was in dieser Situation notwendig ist. Deshalb müssen wir die Agitation nicht nur auf dem flachen Lande, sondern auch in den Klein- und Mittelstädten mit aller Macht in die Wege leiten.“ Meyer antwortete auch aufs Frölichs Idee, zur Bildung lokaler Räterepubliken anzuspornen. „Es ist geradezu typisch für die konterrevolutionären Bestrebungen, dass sie die Möglichkeit von selbständigen Republiken propagieren, worin sich nichts anderes äußert als der Wunsch, Deutschland in verschiedene Bezirke zu zerteilen, die sozial voneinander abweichen, oder die sozial rückständigen Gebiete dem Einfluss der sozial fortgeschrittenen Gebiete zu entziehen“ (14)
Besonders bedeutsam war die Intervention von Fränkel, einem Delegierten aus Königsberg, der den Vorschlag machte, dass es überhaupt keine Diskussion über die Präsentation geben solle. „Ich bin der Ansicht, dass eine Diskussion die ausgezeichnete Rede der Genossin Luxemburg nur abschwächen kann,“ erklärte er. (15)
Diesem Beitrag folgte eine Intervention von Bäumer, der erklärte, dass die proletarische Position gegen jegliche Beteiligung an Wahlen so evident sei, dass er „auf das Bitterste“ bedauerte, dass es überhaupt eine Diskussion über das Thema gegeben habe. (16)
Rosa Luxemburg wurde vorgeschlagen, das Schlusswort zu dieser Diskussion zu sprechen. Der Vorsitzende verkündete: „Die Genossin Luxemburg ist leider nicht in der Lage, das Schlusswort zu halten, da sie körperlich unpässlich ist.“ (17)
Was Karl Radek später als die „jugendliche Unreife“ des Gründungskongresses beschrieb (18), war also gekennzeichnet von Ungeduld und Naivität, aber auch von einem Mangel an Diskussionskultur. Rosa Luxemburg hatte tags zuvor dieses Problem angesprochen. „Ich habe die Überzeugung, Ihr wollt Euch Euren Radikalismus ein bischen bequem und rasch machen, namentlich die Zurufe „Schnell abstimmen“ beweisen das. Es ist nicht die Reife und der Ernst, die in diesen Saal gehören. Es ist meine feste Überzeugung, es ist eine Sache, die ruhig überlegt und behandelt werden muss. Wir sind berufen, zu den größten Aufgaben der Weltgeschichte, und es kann nicht reif und gründlich genug überlegt werden, welche Schritte wir vor uns haben, damit wir sicher sind, dass wir zum Ziel gelangen. So schnell übers Knie brechen kann man nicht so wichtige Entscheidungen. Ich vermisse das Nachdenkliche, den Ernst, der durchaus den revolutionären Elan nicht ausschließt, sondern mit ihm gepaart werden soll.“ (19)
Die Verhandlungen mit den „Fabrikdelegierten“
Die revolutionären Obleute aus Berlin sandten eine Delegation zum Kongress, um über ihren möglichen Beitritt zur neuen Partei zu verhandeln. Eine Eigentümlichkeit dieser Verhandlungen war, dass die Mehrheit der sieben Delegierten sich selbst als Repräsentant der Fabriken ansah und ihre Stimme zu besonderen Fragen auf der Grundlage einer Art von Proportionalsystem, nur nach Konsultation mit „ihren“ Arbeitskollegen gab, die sich anscheinend bei Gelegenheit versammelten. Liebknecht, der die Verhandlungen für Spartakus leitete, berichtete dem Kongress, dass zum Beispiel in der Frage der Teilnahme an den Wahlen zur Nationalversammlung 26 Stimmen dafür abgegeben wurden und 16 Stimmen dagegen. Liebknecht fügte hinzu: „Aber unter der Minderheit befanden sich u.a. die Vertreter der äußerst wichtigen Spandauer Betriebe, die allein 60.000 Mann hinter sich haben“ Däumig und Ledebour, die Repräsentanten der Linken der USPD waren, nicht Obleute, nahmen nicht an der Abstimmung teil.
Ein weiterer Zankapfel war die Forderung der Obleute nach Parität in der Programm- und Organisationskommission, die vom Kongress nominiert wurde. Dies wurde aus dem Grunde abgelehnt, dass die Delegierten zwar einen großen Teil der Arbeiterklasse von Berlin repräsentierten, die KPD aber die Klasse im gesamten Land repräsentiere.
Doch der Hauptstreit, der die Atmosphäre der Verhandlungen, die sehr konstruktiv begonnen hatten, offensichtlich vergiftete, betraf die Strategie und Taktik für die kommende Periode, d.h. jene Frage, die eigentlich im Mittelpunkt der Kongressberatungen hätte stehen müssen. Richard Müller forderte, dass der Spartakusbund davon abkehrte, was er die „putschistische Taktik“ nannte. Er schien sich insbesondere auf die Taktik der täglichen bewaffneten Demonstrationen durch Berlin zu beziehen, die vom Spartakusbund angeführt wurden, und dies zu einem Moment, als, laut Müller, die Bourgeoisie versuchte, eine vorzeitige Konfrontation mit der politischen Vorhut in Berlin zu provozieren. Wie Liebknecht dem Kongress berichtete „Ich sagte dem Genossen Richard Müller, er scheine ein Sprachrohr des Vorwärts zu sein“ (20) (die konterrevolutionäre Zeitung der SPD).
Wie Liebknecht dem Kongress schilderte, schien dies der negative Wendepunkt der Verhandlungen gewesen zu sein. Die Obleute, die bis dahin sich damit zufrieden gaben, fünf Repräsentanten in den o.g. Kommissionen zu haben, zogen nun ihre Stimme zurück, um acht zu fordern etc. Die Fabrikdelegierten fingen sogar an, damit zu drohen, eine eigene Partei zu bilden.
Der Kongress seinerseits verabschiedete eine Resolution, die „einige scheinradikale Mitglieder der bankrotten USPD“ für das Scheitern der Verhandlungen verantwortlich machte. Unter verschiedenen „Vorwänden“ würden diese Elemente versuchen, „unter verschiedenen, zum Teil anmaßenden unzulässigen Vorwänden suchen diese Leute Kapital zu schlagen aus ihrem Einfluss unter den revolutionären Arbeitern“ (ebenda, S.281) (21)
Der Artikel über den Kongress, der in der Ausgabe der Roten Fahne vom 3. Januar 1919 erschien und von Rosa Luxemburg verfasst wurde, drückte einen anderen Geist aus. Dieser Artikel sprach vom Beginn der Verhandlungen zur Vereinigung mit den Obleuten und den Delegierten der großen Berliner Fabriken, von dem Beginn eines Prozesses, der „ganz selbstverständlichen, unaufhaltsamen Prozesses der Vereinigung aller wirklich proletarischen und revolutionären Elemente in einem organisatorischen Rahmen. Dass die revolutionären Obleute Großberlins, die moralischen Vertreter des Kerntrupps des Berliner Proletariats, mit dem Spartakusbund zusammengehen, hat die Zusammenwirkung beider Teile in allen bisherigen revolutionären Aktionen der Berliner Arbeiterschaft bewiesen“ (ebenda S. 302). (22)
Der angebliche „Luxemburgismus“ der jungen KPD
Wie kann man diese schweren Geburtsnarben der KPD erklären?
Nach der Niederlage der Revolution in Deutschland wurde eine Reihe von Erklärungen sowohl innerhalb der KPD als auch in der Kommunistischen Internationale vorgestellt, die die spezifischen Schwächen der Bewegung in Deutschland insbesondere im Vergleich mit Russland betonten. Der Spartakusbund wurde beschuldigt, eine „spontaneistische“ und so genannte Luxemburgistische Theorie der Parteibildung vertreten zu haben. Man suchte hier die Ursprünge von allem, von dem angeblichen Zögern der Spartakisten, sich von den Kriegstreibern der SPD zu trennen, bis zur so genannten Nachsicht Rosa Luxemburgs gegenüber den jungen „Radikalen“ in der Partei.
Die Ursprünge der angeblichen „spontaneistischen Theorie“ der Partei werden gewöhnlich auf Rosa Luxemburgs Broschüre über die Russische Revolution von 1905 – Der Massenstreik, die politische Partei und die Gewerkschaften – zurückgeführt, wo sie angeblich zur Intervention der Massen im Kampf gegen den Opportunismus und den Reformismus der Sozialdemokratie als Alternative zum politischen und organisatorischen Kampf innerhalb der Partei selbst aufruft. In Wahrheit war die Erkenntnis, dass der Fortschritt der Klassenpartei von einer Reihe „objektiver“ und „subjektiver“ Faktoren abhängt, von denen die Evolution des Klassenkampfes einer der wichtigsten ist, eine Grundthese der marxistischen Bewegung lange vor Rosa Luxemburg. (23)
Vor allem hatte Rosa Luxemburg sehr wohl einen sehr konkreten Kampf innerhalb der Partei vorgeschlagen: der Kampf zur Wiederherstellung der politischen Kontrolle der Partei über die sozialdemokratischen Gewerkschaften. Es ist allgemeiner Glaube, insbesondere unter Syndikalisten, dass die organisatorische Form der politischen Partei viel anfälliger ist, vor der Logik des Kapitalismus zu kapitulieren, als die Gewerkschaften, die die Arbeiter direkt im Kampf organisieren. Rosa Luxemburg verstand sehr gut, dass das Gegenteil der Fall war, da die Gewerkschaften die herrschende Arbeitsteilung widerspiegelten, die die tiefste Grundlage der Klassengesellschaft ist. Sie verstand, dass die Gewerkschaften, und nicht die SPD, die Hauptträger der opportunistischen und reformistischen Ideologie in der Vorkriegs-Sozialdemokratie waren. Unter dem Mantel der Parole ihrer „Autonomie“ waren die Gewerkschaften in Wirklichkeit dabei, die politische Arbeiterpartei zu übernehmen. Es ist wahr, dass die Strategie, die von Rosa Luxemburg vorgeschlagen wurde, sich als unzureichend erwies. Doch dies macht sie noch lange nicht „spontaneistisch“ oder syndikalistisch (!), wie manchmal behauptet wird! Genausowenig drückte die Orientierung von Spartakus während des Kriegs auf die Formierung einer Opposition zunächst in der SPD und schließlich in der USPD eine Unterschätzung der Partei aus, sondern eine unerschütterliche Entschlossenheit, für die Partei zu kämpfen, zu verhindern, dass ihre besten Elemente in die Hände der Bourgeoisie fielen.
In einer Intervention auf dem vierten Kongress der KPD im April 1920 behauptete Clara Zetkin, dass Rosa Luxemburg in ihrem letzten Brief an Zetkin geschrieben habe, dass der Gründungskongress einen Fehler gemacht habe, als er die Akzeptanz der Beteiligung an den Wahlen nicht zu einer Bedingung für die Mitgliedschaft in der neuen Partei machte. Es gibt keinen Grund, die Ehrlichkeit von Clara Zetkins Behauptung anzuzweifeln. Die Fähigkeit, zu lesen, was andere Leute wirklich schreiben, und nicht, was man selbst will oder von den anderen erwartet, ist wahrscheinlich seltener, als man allgemein annimmt. Der Brief von Luxemburg an Zetkin, datiert vom 11. Januar 1919, wurde später veröffentlicht. Was Rosa Luxemburg schrieb, ist folgendes: „Also vor allem, was die Frage der Nichtbeteiligung an den Wahlen betrifft: Du überschätzt enorm die Tragweite dieses Beschlusses. Es gibt gar keine „Rühlianer“, Rühle war gar kein „Führer“ auf der Konferenz. Unsere „Niederlage“ war nur der Triumph eines etwas kindischen, unausgegorenen, geradlinigen Radikalismus... Wir haben alle einstimmig beschlossen, den Casus nicht zur Kabinettsfrage zu machen und nicht tragisch zu nehmen. In Wirklichkeit wird die Frage der Nationalversammlung von den stürmischen Ereignissen ganz in den Hintergrund geschoben, und wenn die Dinge so weiter verlaufen, wie bisher, erscheint es recht fraglich, ob es überhaupt zu Wahlen und Nationalversammlung kommt“ (Brief Rosa Luxemburgs an C. Zetkin vom 11. Januar 1919). (24)
Die Tatsache, dass die radikalen Positionen häufig von jenen Delegierten vorgetragen wurden, die am deutlichsten die Ungeduld und Unreife jener Konferenz ausdrückten, trug mit zum Eindruck bei, dass diese Unreife das Produkt der Weigerung sei, sich an bürgerlichen Wahlen oder in Gewerkschaften zu beteiligen. Dieser Eindruck sollte ein Jahr tragische Konsequenzen haben, als die Führung auf dem Heidelberger Kongress die Mehrheit aufgrund ihrer Position zu den Wahlen und der Gewerkschaften ausschloss. (25) Dies war nicht die Haltung von Rosa Luxemburg, die wusste, dass es für die Revolutionäre keine Alternative zur Notwendigkeit gibt, ihre Erfahrungen zur nächsten Generation weiterzureichen, und dass eine Klassenpartei nicht ohne die Beteiligung der jüngeren Generation gegründet werden kann.
Der angeblich „deklassierte“ Charakter der „jungen Radikalen“
Nach dem Ausschluss der Radikalen aus der KPD und der KAPD aus der Kommunistischen Internationale gab es den Ansatz einer Theoretisierung der Rolle der „Radikalen“ innerhalb der jungen Partei als Ausdruck des Gewichtes der „entwurzelten“ und „deklassierten“ Elemente. Es trifft sicherlich zu, dass es unter den jungen Anhängern des Spartakusbundes während des Krieges und noch mehr innerhalb der Reihen von Gruppierungen wie die „Roten Soldaten“, die Kriegsdeserteure, die Invaliden, etc. Strömungen gab, die von der Zerstörung und dem „totalen revolutionären Terror“ träumten. Einige dieser Elemente waren hochgradig dubios, und die Obleute waren ihnen gegenüber zu Recht misstrauisch. Andere waren Hitzköpfe oder einfach junge Arbeiter, die vom Krieg politisiert wurden und es nicht gelernt hatten, ihre Gedanken anders als durch den Kampf mit der Waffe zu artikulieren, und die sich nach jener Art von „Guerrilla“-Kampagnen sehnten, wie sie bald von Max Hoelz praktiziert wurden. (26)
Diese Interpretation wurde erneut in den 1970er Jahren von Autoren wie Fähnders und Rector in ihrem Buch Linksradikalismus und Literatur aufgegriffen. (27) Sie versuchten, ihre These der Verbindung zwischen dem Linkskommunismus und der „Verlumpung“ durch das Beispiel der Biographien radikaler Künstler und Schriftsteller der Linken zu illustrieren, von Rebellen, die, wie Maxim Gorki oder Jack London, die herrschende Gesellschaft abgelehnt hatten, indem sie sich außerhalb ihrer setzten. Bezüglich eines der einflussreichsten Führer der KAPD schrieben sie: „Adam Scharrer war einer der radikalsten Vertreter dieses internationalen – auch in der Literatur international verbreiteten – Rebellentums, das ihn zu seiner so extrem starren Position des Linkskommunismus führte“ (28) (S. 262)
In Wirklichkeit wurden die meisten der jungen Militanten der KPD und der Kommunistischen Linken in der sozialistischen Jugendbewegung vor 1914 politisiert. Politisch waren sie nicht ein Produkt der durch den Krieg verursachten „Entwurzelung“ und „Verlumpung“. Doch ihre Politisierung kreiste sehr wohl um die Frage des Krieges. Im Gegensatz zur älteren Generation der sozialistischen Arbeiter, die unter dem Gewicht von Jahrzehnten der politischen Routine in der Epoche der relativen Stabilität des Kapitalismus gelitten hatte, wurde die sozialistische Jugend direkt durch das Gespenst des heraufziehenden Krieges mobilisiert und entwickelte eine starke „antimilitaristische“ Tradition. (29) Und während die marxistische Linke innerhalb der Sozialdemokratie zu einer isolierten Minderheit wurde, war ihr Einfluss innerhalb der radikalen Jugendorganisationen weitaus stärker. (30)
Was die Beschuldigungen angeht, dass die „Radikalen“ in ihrer Jugend Vagabunden gewesen seien, so lässt dies außer acht, dass diese „Wanderjahre“ eine typische Episode in proletarischen Biographien damals waren. Teils ein Überbleibsel aus der alten Tradition der wandernden Handwerksgesellen, die die ersten sozialistischen politischen Organisationen in Deutschland charakterisierten, wie den Bund der Kommunisten, war diese Tradition vor allem die Frucht des Arbeiterkampfes, um Kinderarbeit aus der Fabrik zu verbannen. Viele junge Arbeiter wollten eine Auszeit nehmen, um „die Welt zu sehen“, ehe sie sich dem Joch der Lohnsklaverei unterordneten. Zu Fuß unterwegs, wollten sie die deutschsprechenden Länder, Italien, den Balkan und gar den Nahen Osten erforschen. Jene, die mit der Arbeiterbewegung verknüpft waren, fanden freie oder billige Unterkunft in den Gewerkhäusern der großen Städte, politische und soziale Kontakte sowie Unterstützung in den örtlichen Jugendorganisationen. Auf diese Weise entstanden rund um politische, kulturelle, künstlerische und wissenschaftliche Entwicklungen Angelpunkte des internationalen Austausches. (31) Andere gingen zur See, lernten Sprachen und etablierten sozialistische Verbindungen rund um den Globus. Kein Wunder, dass diese Jugend zur Vorhut des proletarischen Internationalismus überall in Europa wurde! (32)
Wer waren die „revolutionären Obleute“?
Die Konterrevolution beschuldigte die Obleute, bezahlte Agenten ausländischer Regierungen - erst der Entente und dann des „Weltbolschewismus“ - zu sein. Im allgemeinen gingen sie in die Geschichte ein als eine Art Basisgewerkschafter, als eine lokalistische und fabrikorientierte Anti-Partei-Strömung. In „operaistischen“ Kreisen werden sie bewundernd als eine Art von revolutionärer Konspiration anerkannt, die den imperialistischen Krieg sabotiert habe. Wie kann man sonst die Art und Weise erklären, in der sie die Schlüsselsektoren und –fabriken der deutschen Waffenindustrie „infiltrierten“?
Bleiben wir bei den Tatsachen. Die Obleute begannen als ein kleiner Kreis von sozialdemokratischen Parteifunktionären und –mitgliedern, die durch ihre unerschütterliche Opposition gegen den Krieg das Vertrauen ihrer Kollegen erworben hatten. Sie hatten eine besonders starke Basis in der Hauptstadt Berlin und in der Metallindustrie, vor allem unter den Drehern. Sie gehörten zu den intelligentesten, gebildeten Arbeitern mit den höchsten Löhnen. Doch sie waren berühmt wegen ihres Sinnes für Unterstützung und Solidarität gegenüber anderen, schwächeren Bereichen der Klasse, wie die Frauen, die mobilisiert wurden, um die männlichen Arbeiter zu ersetzen, die an die Front geschickt wurden. Im Verlaufe des Krieges wuchs ein ganzes Netzwerk von politisierten Arbeitern um sie heran. Weit davon entfernt, eine Anti-Partei-Strömung zu sein, waren sie fast ausschließlich aus früheren Sozialdemokraten zusammengesetzt, die nun Mitglieder oder Sympathisanten des linken Flügels der USPD waren, einschließlich des Spartakusbundes. Sie beteiligten sich leidenschaftlich an allen politischen Debatten, die im revolutionären Untergrund während des gesamten Krieges stattfanden.
Die besondere Form dieser Politisierung war zu einem großen Teil durch die Bedingungen der klandestinen Aktivitäten bestimmt, die Massenversammlung rar und eine offene Diskussion unmöglich machten. In den Fabriken dagegen schützten die Arbeiter ihre Führer vor der Repression, häufig mit bemerkenswertem Erfolg. Das extensive Spitzelsystem der Gewerkschaften und der SPD scheiterte regelmäßig daran, auch nur die Namen der „Rädelsführer“ herauszufinden. Im Falle der Verhaftung hatte jeder dieser Delegierten einen Ersatz nominiert, der sofort die Lücke schloss.
Das „Geheimnis“ ihrer Fähigkeit, die Schlüsselsektoren der Industrie zu „infiltrieren“, war sehr einfach. Sie gehörten zu den „besten“ Arbeitern, so dass die Kapitalisten miteinander konkurrierten, um sie zu verpflichten. Auf diese Weise setzten die Arbeitgeber selbst, ohne es zu wissen, diese revolutionären Internationalisten in Schlüsselpositionen der Kriegswirtschaft.
Die Abwesenheit der Internationale
Es ist keine Eigentümlichkeit der Lage in Deutschland, dass die drei o.g. Kräfte innerhalb der Arbeiterklasse eine kreuzwichtige Rolle im Drama der Formierung der Partei spielten. Eines der Merkmale des Bolschewismus während der Revolution in Russland war die Weise, wie er im Grunde die gleichen Kräfte in der Arbeiterklasse vereint: die Vorkriegs-Partei, die das Programm und die organisatorische Erfahrung verkörperte; die fortgeschrittenen, klassenbewussten Arbeiter in den Fabriken und an den Arbeitsplätzen, die die Partei in der Klasse verankerten und eine entscheidende, positive Rolle bei der Lösung verschiedener Krisen in der Organisation spielten; und die revolutionäre Jugend, die durch den Kampf gegen den Krieg politisiert wurde.
Daran gemessen, fällt in Deutschland die Abwesenheit eines ähnlichen Grades an Einheit und gegenseitigem Vertrauen zwischen diesen wesentlichen Komponenten auf. Dies, und nicht irgendeine untergeordnete Qualität dieser Elemente selbst, war entscheidend. So besaßen die Bolschewiki die Mittel, um ihre Konfusionen zu klären und gleichzeitig ihre Einheit aufrechtzuerhalten und zu stärken. In Deutschland war dies nicht der Fall.
Die revolutionäre Avantgarde in Deutschland litt an einem tiefer verwurzelten Mangel an Einheit und Vertrauen in ihre eigene Mission.
Eine der Haupterklärungen dafür ist, dass die Deutsche Revolution sich einem mächtigeren Feind gegenübersah. Die Bourgeoisie in Deutschland war sicherlich grausamer als in Russland. Darüber hinaus hatte ihr die geschichtliche Phase, die durch den Weltkrieg eingeläutet worden war, eine neue und mächtige Waffe in ihre Hände gelegt. Deutschland vor 1914 war das Land mit den entwickeltsten Organisationen der Arbeiterbewegung weltweit gewesen. In der neuen Ära, in der die Gewerkschaften und die sozialdemokratischen Massenparteien nicht mehr der Sache des Proletariats dienen konnten, wurden diese Instrumente zu enormen Hindernissen. Hier war die Dialektik der Geschichte am Werk. Was einst eine Stärke der deutschen Arbeiterklasse gewesen war, wurde nun zu ihrer Schwäche.
Es bedarf Mut, um solch eine furchteinflößende Festung anzugreifen. Die Versuchung kann sehr stark sein, die Stärke des Feindes zu ignorieren, um sich selbst in Sicherheit zu wiegen.
Doch das Problem war nicht nur die Stärke der deutschen Bourgeoisie. Als das russische Proletariat 1917 den bürgerlichen Staat stürmte, war der Weltkapitalismus durch den imperialistischen Krieg noch immer gespalten. Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass das deutsche Militär tatsächlich Lenin und andere bolschewistische Führer zur Rückkehr nach Russland verhalf, da es hoffte, dass dies irgendwie den militärischen Widerstand seines Gegners an der Ostfront schwächen würde.
War der Krieg erst einmal vorbei, vereinigte sich die Weltbourgeoisie gegen das Proletariat. Einer der stärkeren Momente des ersten Kongresses der KPD war die Annahme einer Resolution, die die militärische Kollaboration der britischen und deutschen Militärs mit den lokalen Grundbesitzern in den baltischen Staaten beim Training konterrevolutionärer paramilitärischer Einheiten identifizierten und anprangerten, welche sich gegen „die russische Revolution heute“ und die „deutsche Revolution morgen“ richtete.
In solch einer Lage konnte nur eine neue Internationale den Revolutionären und dem gesamten Proletariat das notwendige Vertrauen und Selbstvertrauen geben. Die Revolution konnte in Russland noch erfolgreich sein ohne die Präsenz einer Weltpartei, weil die russische Bourgeoisie relativ schwach und isoliert war – aber dies traf nicht auf Deutschland zu. Die Kommunistische Internationale war noch nicht gegründet, als die entscheidende Konfrontation der Deutschen Revolution in Berlin stattfand. Nur eine solche Organisation hätte, indem sie die theoretischen Errungenschaften und die Erfahrungen des gesamten Proletariats zusammengebracht hätte, sich der Aufgabe, eine Weltrevolution anzuführen, als ebenbürtig erwiesen.
Erst bei Ausbruch des Großen Krieges dämmerte den Revolutionären die Notwendigkeit einer wirklich vereinten und zentralisierten internationalen linken Opposition. Doch unter den Bedingungen des Krieges war es äußerst schwer, sich organisatorisch zusammenzutun oder die politischen Divergenzen zu klären, die noch immer die beiden wichtigsten Strömungen in der Vorkriegs-Linken voneinander trennten: die Bolschewiki um Lenin und die deutsche und polnische Linke um Rosa Luxemburg. Dieser Mangel an Einheit vor dem Krieg machte es um so schwerer, die politischen Stärken von Strömungen in verschiedenen Ländern zum gemeinsamen Erbe aller zu machen und die Schwächen eines jeden zu vermindern.
In keinem Land saß der Schock nach dem Kollaps der Zweiten Internationale so tief wie in Deutschland. Hier wurde das Vertrauen in solche Qualitäten wie der theoretischen Bildung, der politischen Führung, der Zentralisierung oder der Parteidisziplin schwer erschüttert. Die Bedingungen des Krieges, der Krise der Arbeiterbewegung erschwerte die Wiederherstellung solch eines Vertrauens. (33)
Schlussfolgerung
In diesem Artikel haben wir uns auf die Schwächen konzentriert, die bei der Formierung der Partei auftauchten. Dies war notwendig, um die Niederlage Anfang 1919 zu verstehen, das Thema des nächsten Artikels. Doch trotz dieser Schwächen waren jene, die zur Gründung der KPD zusammenkamen, die besten Repräsentanten ihrer Klasse und verkörperten all das Edelmütige und Großherzige in der Menschheit, die wahren Repräsentanten einer besseren Zukunft. Wir werden auf dieses Thema am Ende dieser Serie zurückkommen.
Die Vereinigung der revolutionären Kräfte, die Bildung einer politischen Führung des Proletariats, die den Namen verdient, war zur zentralen Frage der Revolution geworden. Niemand verstand dies besser als jene Klasse, die von diesem Prozess direkt bedroht war. Vom 9. November an war die Hauptstoßrichtung des politischen Lebens der Bourgeoisie auf die Liquidierung des Spartakusbundes gerichtet. Die KPD war inmitten dieser Pogromatmosphäre gegründet worden, die die entscheidenden Schläge gegen die Revolution vorbereitete, die bald folgen sollten.
Dies wird das Thema des nächsten Artikels sein.
Steinklopfer
(1) Sozialdemokratische Partei Deutschlands
(2) Deutsche Soldaten in „feldgrauer“ Uniform.
(3) Internationale Kommunisten Deutschlands
(4) Die Tagesordnung, die im Einladungsschreiben angekündigt worden war, war: 1. Die Krise in der USPD; 2. Programm des Spartakusbundes; 3. Nationalversammlung; 4. Internationale Konferenz.
(5) Jogiches auf der anderen Seite wollte offensichtlich, dass die Obleute an der Gründung der Partei teilnehmen.
(6) Sechs der Militanten, die auf dieser Konferenz anwesend waren, sind in den darauf folgenden Monaten von den deutschen Behörden ermordet worden.
(7) Der Gründungsparteitag der KPD. Protokoll und Materialien. Herausgeber: Hermann Weber.
(8) Eugen Leviné wurde einige Monate später als einer der Führer der bayrischen Räterepublik hingerichtet.
(9) Frölich, ein prominenter Repräsentant der Bremer Linken, sollte später eine berühmte Biographie über Rosa Luxemburg schreiben.
(10) Protokoll und Materialien, S. 222.
(11) Obgleich er bald darauf jegliche Klassenpartei vollständig als bürgerlich ablehnte und eine eher individuelle Auffassung über die Entwicklung des Klassenbewusstseins entwickelte, blieb Otto Rühle dem Marxismus und der Sache der Arbeiterklasse treu verbunden. Schob auf dem Kongress war er Anhänger der „Einheitsorganisationen“ (politisch-ökonomische Gruppierungen), die nach seiner Auffassung sowohl die Partei als auch die Gewerkschaften ersetzen sollten. Luxemburg antwortete auf diese Auffassung, dass die Alternative zu den Gewerkschaften die Arbeiterräte und Massenorgane seien, nicht die Einheitsorganisationen.
(12) Protokoll und Materialien, S. 222.
(13) Laut Clara Zetkin wollte Jogiches in Reaktion auf die Diskussionen den Kongress scheitern lassen, d.h. die Parteigründung verschieben.
(14) Ebenda, S. 214.
(15) Ebenda, S. 206. Laut den Protokollen wurde dieser Vorschlag mit Rufen wie: „Ganz richtig!“ begrüßt. Glücklicherweise wurde Fränkels Antrag niedergestimmt.
(16) Ebenda, S. 209. Aus dem gleichen Grunde sagte Gelwitzki am Vortag, dass es eine Schande gewesen sei, die Frage überhaupt diskutiert zu haben. Und als Fritz Heckert, der nicht den gleichen revolutionären Ruf genoss wie Luxemburg oder Liebknecht versuchte, die Position des Zentralkomitees zur Beteiligung an den Parlamentswahlen zu verteidigen, wurde er durch einen Zwischenruf von Jakob unterbrochen, „hier spricht der Geist Noskes“ (S. 117). Noske, der sozialdemokratische Innenminister der damaligen bürgerlichen Regierung ging in die Geschichte ein als der „Bluthund der Konterrevolution“.
(17) Ebenda S. 224
(18) „Der Kongress verdeutlichte stark die Jugend und Unerfahrenheit der Partei. Die Verbindung zu den Massen war sehr schwach. Der Kongress bezog eine ironische Haltung gegenüber den linken Unabhängigen. Ich hatte nicht das Gefühl, schon eine Partei vor mir zu haben“.
(19) Ebenda S. 99-100
(20) Ebenda S. 271
(21) Ebenda S. 290
(22) Ebenda S. 302
(23) Siehe die Argumente Marxens und Engels im Bund der Kommunisten nach der Niederlage der Revolution 1848-1849.
(24) Protokolle und Materialien, S. 42, 43
(25) Ein Großteil der ausgeschlossenen Mehrheit gründete später die KAPD. Plötzlich gab es in Deutschland zwei kommunistische Parteien, eine wahrlich tragische Spaltung der revolutionären Kräfte!
(26) Max Hoelz, Sympathisant der KPD und der KAPD, dessen bewaffnete Unterstützer in Mitteldeutschland Anfang der 1920er Jahre aktiv waren.
(27) Walter Fähnders, Martin Rector: Linksradikalismus und Literatur, Untersuchungen zur Geschichte der sozialistischen Literatur in der Weimarer Republik.
(28) S. 262, Adam Scharrer, ein führender Kopf der KAPD, verteidigte bis zur Niederschlagung der linkskommunistischen Organisationen 1933weiterhin die Notwendigkeit einer revolutionären Klassenpartei.
(29) Die erste radikale sozialistische Jugendbewegung tauchte in Belgien in den 1860er Jahren auf, als junge Militante (mit einigermaßen Erfolg) unter den Soldaten in den Kasernen Agitation betrieben, um sie daran zu hindern, gegen streikende Arbeiter eingesetzt zu werden.
(30) Siehe Scharrers 1929 geschriebener Roman Vaterlandslose Gesellen sowie die Bibliographie und die Kommentare in „Arbeitskollektiv proletarisch-revolutionärer Romane“, veröffentlicht vom Oberbaumverlag Berlin.
(31) Einer der wichtigsten Zeitzeugen dieses Kapitels der Geschichte is Willi Münzenberg zum Beispiel in seinem Buch Die Dritte Front (Aufzeichnungen aus 15 Jahren proletarischer Jugendbewegung), zuerst 1930 veröffentlicht.
(32) Der anerkannte Führer der sozialistischen Vorkriegsjugend in Deutschland war Karl Liebknecht und in Italien Amadeo Bordiga.
(33) Das Beispiel der Reifung der sozialistischen Jugend in der Schweiz unter dem Einfluss regelmäßiger Diskussionen mit den Bolschewiki während des Krieges belegt, was unter günstigeren Bedingungen möglich war. „Mit großem psychologischem Geschick zog Lenin die Jugendlichen an sich heran, ging zu ihren Diskussionsabenden, lobte und kritisierte stets in offensichtlicher Teilnahme. Ferdy Böhny schrieb später: „Die Art, wie er mit uns diskutierte, glich dem sokratischen Gespräch.“ (Babette Gross, Willi Münzenberg, Eine politische Biografie, S. 93).
Leute:
- Liebknecht [16]
- Luxemburg [17]
- Jogiches [18]
- Richard Müller [27]
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Historische Ereignisse:
- Deutsche Revolution 1918 [28]
- 1919 [29]
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Theoretische Fragen:
- Internationalismus [23]
Erbe der kommunistischen Linke:
Griechenland: Gewerkschaftshausbesetzung: Bestimmen wir unsere Geschichte selbst, oder andere werden sie ohne uns bestimmen
- 4053 Aufrufe
Wir veröffentlichen eine Erklärung von kämpfenden Arbeitern aus Athen, die sich selbst als „aufständische Arbeiter" bezeichnen. Sie besetzen seit dem 17. Dezember den Sitz der GSEE (Allgemeiner Gewerkschaftsbund Griechenlands), welcher der Zentralsitz der Gewerkschaft ist und haben daraus einen Ort gemacht, wo man Vollversammlungen abhalten kann, Versammlungen die offen für alle sind.
Wir veröffentlichen eine Erklärung von kämpfenden ArbeiterInnen aus Athen, die sich selbst als „aufständische Arbeiter" bezeichnen. Sie halten seit dem 17. Dezember den Sitz der GSEE (Allgemeiner Gewerkschaftsbund Griechenlands) besetzt und haben daraus einen Ort gemacht, wo man Vollversammlungen abhalten kann, Versammlungen, die offen für alle sind.
Der Text auf dem Transparent, das fast eine ganze Fassadenseite der besetzten Gewerkschaftszentrale bedeckt, lautet:
* Angefangen von den so genannten Arbeitsunfällen bis hin zu den kaltblütigen Hinrichtungen - Staat und Kapital morden!
* Stoppt die Repression - sofortige Freilassung der Gefangenen!
* Generalstreik!
* Die Selbstorganisation der Arbeiter wird das Grab der Bosse sein!
Hervorzuheben gilt auch, dass ein fast identisches Szenario an der ökonomischen Fakultät der Athener Universität abläuft.
Wir werden später detaillierter auf die Ereignisse zurückkommen, die sich seit dem 6. Dezember in ganz Griechenland abspielen. Im Moment wollen wir die Schweigemaur durchbrechen, die von der verlogenen Berichterstattung der bürgerlichen Medien aufgebaut worden ist. Die Kämpfe werden lediglich als Krawalle einzelner jugendlicher Anarchisten dargestellt, die die Bevölkerung terrorisieren. Die Erklärung zeigt im Gegenteil, wie das solidarische Gefühl der Arbeiterklasse diese Bewegung auszeichnet und somit auch die verschiedenen Generationen der Proletarier verbindet.
***********
Wir, Handarbeiter, Angestellte, Erwerbslose, Zeitarbeiter, ob hier geboren oder eingewandert - wir sind keine passiven Fernsehkonsumenten. Seit dem Mord an Alexandros Grigoropoulos Samstagnacht nehmen wir an den Demonstrationen teil, an den Zusammenstößen mit der Polizei, den Besetzungen der Innenstadt oder der Wohnviertel. Immer wieder haben wir unsere Arbeit und unsere täglichen Verpflichtungen fallen gelassen, um mit den Schülern, Studenten und den anderen kämpfenden Proletariern auf die Straße zu gehen.
Wir haben entschieden, das Gebäude der GSEE zu besetzen:
* um es in einen Ort des freien Meinungsaustausches und in einen Treffpunkt für ArbeiterInnen zu verwandeln;
* um den von den Medien verbreiteten Irrglauben, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen nicht an den Zusammenstößen der letzten Tage beteiligt waren, dass die um sich greifende Wut die Sache von 500 „Vermummten“, „Hooligans“ sei, sowie andere Ammenmärchen, die verbreitet werden, zu widerlegen. Auf den Fernsehschirmen werden die ArbeiterInnen als Opfer der Unruhen dargestellt, während gleichzeitig die unzähligen Entlassungen infolge der kapitalistischen Krise in Griechenland und der restlichen Welt von den Medien und ihren Managern als „Naturereignisse“ betrachtet werden;
* um die Rolle der Gewerkschaftsbürokratie bei der Untergrabung des Aufstandes - und nicht nur dort - aufzudecken. Die GSEE und der ganze seit Jahrzehnten dahintersteckende gewerkschaftliche Apparat untergraben die Kämpfe, handeln Brosamen für unsere Arbeitskraft aus und verewigen das System der Ausbeutung und der Lohnsklaverei. Das Vorgehen der GSEE am letzten Mittwoch (dem Tag des Generalstreiks) ist ziemlich erhellend: Die GSEE sagte eine vorgesehene Demonstration der streikenden ArbeiterInnen ab, stattdessen gab es eine kurze Kundgebung am Syntagma-Platz, bei der Erstere aus Furcht davor, dass sie vom Virus des Aufstandes angesteckt werden, dafür sorgte, dass die Leute in aller Eile den Platz verließen;
* um diesen Ort, der durch unsere Beiträge errichtet wurde, von dem wir aber ausgeschlossen waren, zum ersten Mal zu einem offenen Ort zu machen. Einem offenen Ort, der die gesellschaftliche Öffnung, die der Aufstand hervorgebracht hat, fortsetzt. All die vielen Jahre haben wir schicksalhaft allen möglichen Heilsverkündern geglaubt und dabei unsere Würde verloren. Als Arbeiter und Arbeiterinnen müssen wir unsere Sache selbst in die Hand nehmen und Schluss damit machen, auf kluge Anführer oder „fähige“ Vertreter zu hoffen. Wir müssen unsere Stimme gegen die ständigen Angriffe erheben, uns treffen, miteinander reden, zusammen entscheiden und handeln. Gegen die allgemeinen Angriffe einen langen Kampf führen. Die Entwicklung eines kollektiven Widerstandes an der Basis ist der einzige Weg dazu;
* um die Idee der Selbstorganisation und Solidarität an den Arbeitsplätzen, der Kampfkomitees und des kollektiven Handelns der Basis zu verbreiten und dadurch die Gewerkschaftsbürokratien abzuschaffen.
All die Jahre haben wir das Elend hinuntergeschluckt, die Ausnutzung der Situation der Schwächeren, die Gewalt auf der Arbeit. Wir haben uns daran gewöhnt, die Verkrüppelten und die Toten - die sogenannten „Arbeitsunfälle“ - einfach nur noch zu zählen. Wir haben uns daran gewöhnt, zu ignorieren, dass die Migranten, unsere Klassenbrüder- und schwestern, getötet werden. Wir haben die Schnauze voll davon, mit der Angst um unseren Lohn und in Aussicht auf eine Rente zu leben, die sich mittlerweile wie ein in die Ferne entrückter Traum anfühlt.
So wie wir darum kämpfen, unser Leben nicht für die Bosse und die Gewerkschaftsvertreter zu vergeuden, so werden wir auch keinen der verhafteten Aufständischen allein lassen, die sich in den Händen des Staates und der Justizmaschine befinden.
Sofortige Freilassung der Festgenommenen!
Keine Strafe für die Verhafteten!
Selbstorganisation der Arbeiter und Arbeiterinnen!
Generalstreik!
Die Arbeiter-Versammlung im „befreiten“ Gebäude der GSEE
Mittwoch, 17. Dezember 2008, 18:00 Uhr.
Die Vollversammlung der aufständischen ArbeiterInnen
(Die Besetzung des GSEE-Gebäudes wurde am 21. Dezember beendet und ging am Polytechnischen Institut weiter...)
Geographisch:
- Griechenland [31]
Aktuelles und Laufendes:
- Griechenland [32]
- Studenten- und Arbeiterunruhen [33]
- Studentenbewegung [34]
Leute:
Theoretische Fragen:
- Arbeiterklasse [36]
Erbe der kommunistischen Linke:
Solidarität mit der Bewegung der Studenten in Griechenland!
- 4525 Aufrufe
Der Ausbruch der Wut und der Revolte der jungen Arbeitergenerationen in Griechenland ist kein isoliertes oder besonderes Phänomen. Ihre Wurzeln liegen in der Weltwirtschaftskrise des Kapitalismus. Der Zusammenstoß der Protestierenden mit dem gewalttätigen Unterdrückungsapparat entblößt das wahre Gesicht der bürgerlichen Herrschaft und des Staatsterrors. Es ist eine direkte Fortsetzung der Mobilisierung der Jugendlichen auf einem Klassenterrain wie in Frankreich im Zusammenhang mit dem CPE-Gesetz im Frühjahr 2006 und dem LRU 2007, als die Studenten und Gymnasiasten sich vor allem als zukünftige Beschäftigte sahen, die gegen ihre künftigen Ausbeutungsbedingungen protestierten. Alle Herrschenden der wichtigsten europäischen Länder haben dies auch so verstanden, denn sie haben ihre Besorgnis zum Ausdruck gebracht, dass ähnliche soziale Explosionen aus Widerstand gegen die Zuspitzung der Krise auch woanders ausbrechen. So hat bezeichnenderweise die herrschende Klasse in Frankreich einen Rückzieher gemacht, indem sie ganz überstürzt ihr Programm zur Reformierung der Gymnasien (siehe dazu den Artikel auf unserer französischsprachigen Website) vorläufig auf Eis gelegt hat. Der internationale Charakter der Proteste und die wachsende Kampfbereitschaft der Studenten und vor allem der Schüler ist schon deutlich zu spüren.
Der Ausbruch der Wut und der Revolte der jungen Arbeitergenerationen in Griechenland ist kein isoliertes oder besonderes Phänomen. Ihre Wurzeln liegen in der Weltwirtschaftskrise des Kapitalismus. Der Zusammenstoß der Protestierenden mit dem gewalttätigen Unterdrückungsapparat entblößt das wahre Gesicht der bürgerlichen Herrschaft und des Staatsterrors. Es ist eine direkte Fortsetzung der Mobilisierung der Jugendlichen auf einem Klassenterrain wie in Frankreich im Zusammenhang mit dem CPE-Gesetz im Frühjahr 2006 und dem LRU 2007, als die Studenten und Gymnasiasten sich vor allem als zukünftige Beschäftigte sahen, die gegen ihre künftigen Ausbeutungsbedingungen protestierten. Alle Herrschenden der wichtigsten europäischen Länder haben dies auch so verstanden, denn sie haben ihre Besorgnis zum Ausdruck gebracht, dass ähnliche soziale Explosionen aus Widerstand gegen die Zuspitzung der Krise auch woanders ausbrechen. So hat bezeichnenderweise die herrschende Klasse in Frankreich einen Rückzieher gemacht, indem sie ganz überstürzt ihr Programm zur Reformierung der Gymnasien (siehe dazu den Artikel auf unserer französischsprachigen Website) vorläufig auf Eis gelegt hat. Der internationale Charakter der Proteste und die wachsende Kampfbereitschaft der Studenten und vor allem der Schüler ist schon deutlich zu spüren.
In Italien fanden am 25. Oktober und am 14. November massive Demonstrationen unter dem Motto „Wir wollen nicht für die Krise blechen“ gegen die Regierungsverordnung von Gelmini statt, die zahlreiche Einschnitte im Erziehungswesen mit drastischen Konsequenzen anstrebt: So sollen zum Beispiel die Zeitverträge von 87.000 Lehrern und 45.000 anderen Beschäftigten des Erziehungswesens nicht verlängert werden. Gleichzeitig sollen umfangreiche Kürzungen in den Universitäten vorgenommen werden.
In Deutschland sind am 12. November ca. 120.000 Schüler in den meisten Großstädten des Landes auf die Straße gegangen und haben zum Teil Parolen gerufen wie „Der Kapitalismus ist die Krise“ (Berlin) oder das Landesparlament in Hannover belagert.
In Spanien sind am 13. November Hunderttausende Studenten in mehr als 70 Städten auf die Straße gegangen, um gegen die neuen, europaweit gültigen Bologna-Bestimmungen der Bildungsreform und der Universitäten zu protestieren, in denen u.a. die Privatisierung der Universitäten und immer mehr Praktika in den Unternehmen vorgesehen sind.
Viele von ihnen identifizieren sich mit dem Kampf der griechischen Studenten. In vielen Ländern sind zahlreiche Kundgebungen und Solidaritätsveranstaltungen gegen die Repression, unter der die griechischen Studenten leiden, organisiert worden, wobei die Polizei auch sehr oft gewaltsam dagegen vorgegangen ist.
Das Ausmaß der Mobilisierung gegen diese gleichen, staatlichen Maßnahmen überrascht keineswegs. Die europaweite Reform des Bildungswesens dient der Anpassung der jungen Arbeitergeneration an eine perspektivlose Zukunft und der Generalisierung prekärer Arbeitsbedingungen sowie der Arbeitslosigkeit.
Der Widerstand und die Revolte der neuen Generationen von Schülern, die die zukünftigen Beschäftigten stellen werden, gegen die Arbeitslosigkeit und dieses ganze Ausmaß an Prekarisierung lässt überall ein Gefühl der Sympathie unter den ArbeiterInnen aufkommen, das bei allen Generationen zu spüren ist.
Gewalt durch Minderheiten oder massiver Kampf gegen die Ausbeutung und den Staatsterror?
Die in den Diensten der Lügenpropaganda des Kapitals stehenden Medien haben permanent versucht, die Wirklichkeit der Ereignisse in Griechenland seit der Ermordung des 15jährigen Alexis Andreas Grigropoulos am 6. Dezember zu verzerren. Sie stellen die Zusammenstöße mit der Polizei entweder als das Werk einer Handvoll autonomer Anarchisten und linksextremer Studenten aus einem wohlbetuchten Milieu dar oder als das Vorgehen von Schlägern aus Randgruppen. Ständig werden in den Medien Bilder von gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei gesendet. Vor allem erscheinen Bilder von Jugendlichen, die Autos anstecken, Schaufenster von Geschäften und Banken zerschlagen, oder Bilder von Plünderungen von Geschäften.
Das ist die gleiche Fälschungsmethode, die 2006 gegen die Proteste gegen den CPE in Frankreich angewandt wurde, als die Proteste der Studenten mit den Aufständen in den Vorstädten von Paris im Herbst 2005 in den gleichen Topf geworfen wurden. Es ist das gleiche Vorgehen wie bei den Protesten gegen den LRU 2007 in Frankreich, als die Demonstranten als „Terroristen“ oder „Rote Khmer“ beschimpft wurden.
Aber auch wenn das Zentrum der Zusammenstöße im griechischen „Quartier Latin“, in Exarcia, lag, kann man heute solch Lügen nur viel schwerer verbreiten. Wie könnten diese aufständischen Erhebungen das Werk von Randalierern oder anarchistischen Aktivisten sein, da sie sich doch lawinenartig auf alle Städte das Landes und selbst bis auf die Inseln (Chios, Samos) und bis in die großen Touristenhochburgen wie Korfu oder Kreta oder Heraklion ausgedehnt haben?
Die Gründe für die Wut
Alle Ingredienzien waren vorhanden, damit die Unzufriedenheit eines Großteils der jungen Arbeitergeneration sich ein Ventil sucht. Diese Generation hat Angst vor der Zukunft, die ihnen der Kapitalismus bietet. Griechenland verdeutlicht die Sackgasse, in welcher der Kapitalismus steckt und die auf alle Jugendlichen zukommen wird. Wenn diejenigen, die die „Generation der 600 Euro-Jobber“ genannt wird, auf dem Arbeitsmarkt auftauchen, haben sie den Eindruck, verarscht zu werden. Die meisten Studenten können ihr Studium nur finanzieren und überleben, indem sie in zwei Jobs schuften. Sie müssen kleine Jobs, meist unterbezahlte Schwarzarbeit, annehmen. Selbst in besser bezahlten Jobs wird ein Großteil des Lohns nicht versteuert, wodurch der Anspruch auf Sozialleistungen geschmälert wird. Insbesondere gelangen sie nicht in den Genuss der Sozialversicherung. Überstunden werden ebensowenig bezahlt. Oft können sie bis Mitte 30 nicht von zu Hause ausziehen, weil sie keine Miete zahlen können. 23 Prozent der Arbeitslosen in Griechenland sind Jugendliche (die Jugendarbeitslosigkeit der 15 bis 24-Jährigen beträgt offiziell 25,2 Prozent). Wie eine französische Zeitung schrieb: „Diese Studenten fühlen sich durch niemanden mehr geschützt: Die Polizei schlägt auf sie ein bzw. schießt auf sie; durch das Bildungswesen stecken sie in einer Sackgasse, einen Job kriegen sie nicht, die Regierung belügt sie.“ (1) Die Jugendarbeitslosigkeit und ihre Schwierigkeiten in der Arbeitswelt haben somit ein Klima der allgemeinen Verunsicherung, der Wut und der Angst geschaffen. Die Weltwirtschaftskrise löst immer neue Wellen von Entlassungen aus. 2009 erwartet man allein in Griechenland den Abbau von mehr als 100.000 Arbeitsplätzen; dies allein würde fünf Prozent mehr Arbeitslose bedeuten. Gleichzeitig verdienen mehr als 40 Prozent der Beschäftigten weniger als 1100 Euro brutto im Monat. In Griechenland gibt es die meisten Niedriglöhner unter den 27 Staaten der EU: 14 Prozent.
Aber nicht nur die Jugendlichen sind auf die Straße gegangen, sondern auch die schlecht bezahlten Lehrer und viele Beschäftigte, die den gleichen Problemen, der gleichen Armut gegenüberstehen und von dem gleichen Gefühl der Revolte angetrieben werden. Die brutale Repression gegen die Bewegung, bei der der Mord an dem 15-jährigen Jugendlichen nur die dramatischste Episode war, hat dieses Gefühl der Solidarität nur noch gestärkt. Die soziale Unzufriedenheit bricht sich immer stärker Bahn. Wie ein Student berichtete, waren auch viele Eltern zutiefst schockiert über die Ereignisse: „Unsere Eltern haben festgestellt, dass ihre Kinder durch die Schüsse eines Polizisten ums Leben kommen“ (2). Sie haben den Fäulnisprozess einer Gesellschaft gerochen, in der ihre Kinder nicht den gleichen Lebensstandard erreichen werden wie sie. Auf zahlreichen Demonstrationen haben sie mit eigenen Augen das gewalttätige Vorgehen der Polizei, die brutalen Verhaftungen, den Einsatz von Schusswaffen durch die Ordnungskräfte und das harte Eingreifen der Bereitschaftspolizei (MAT) beobachten können.
Nicht nur die Besetzer der Polytechnischen Hochschule, das Zentrum der Studentenproteste, prangern den Staatsterror an. Diese Wut über die polizeiliche Repression trifft man auch auf allen Demonstrationen an, wo Parolen gerufen werden wie: „Kugeln gegen die Jugendlichen, Geld für die Banken“. Noch deutlicher war ein Teilnehmer der Bewegung, der erklärte: „Wir haben keine Arbeit, kein Geld; der Staat ist wegen der Krise pleite, und die einzige Reaktion, die wir sehen, ist, dass man der Polizei noch mehr Waffen gibt“ (3).
Diese Wut ist nicht neu. Schon im Juni 2006 waren die Studenten gegen die Universitätsreform auf die Straße gegangen, da die Privatisierung der Unis den weniger wohlhabenden Studenten den Zugang zur Uni verwehrte. Die Bevölkerung hat auch gegen die Schlamperei der Regierung während der Waldbrände im Sommer 2007 protestiert, als 67 Menschen zu Tode gekommen waren. Die Regierung hat bis heute noch nicht jene Menschen entschädigt, die ihre Häuser, ihr Hab und Gut verloren hatten. Aber vor allem die Beschäftigten waren massiv gegen die Regierungspläne einer „Rentenreform“ auf den Plan getreten; Anfang 2008 fand zweimal innerhalb von zwei Monaten ein Generalstreik mit hoher Beteiligung statt. Damals beteiligten sich mehr als eine Millionen Menschen an den Demonstrationen gegen die Abschaffung des Vorruhestands für Schwerabeiter und die Aufkündigung der Vorruhestandsregelung für über 50-jährige Arbeiterinnen.
Angesichts der Wut der Beschäftigten sollte der Generalstreik vom 10. Dezember, der von den Gewerkschaften kontrolliert wurde, als Ablenkungsmanöver gegen die Bewegung dienen. Die Gewerkschaften forderten, mit der SP und der KP an der Spitze, den Rücktritt der gegenwärtigen Regierung und vorgezogene Neuwahlen. Allerdings konnten die Wut und die Bewegung nicht eingedämmt werden - trotz der verschiedenen Manöver der Linksparteien und der Gewerkschaften, um die Dynamik bei der Ausdehnung des Kampfes zu hemmen, und trotz all der Anstrengungen der herrschenden Klasse und ihrer Medien zur Isolierung der Jugendlichen gegenüber den anderen Generationen und der gesamten Arbeiterklasse, indem man versuchte, diese in sinnlose Zusammenstöße mit der Polizei zu treiben. Die ganze Zeit über gab es immer wieder Zusammenstöße: gewaltsames Vorgehen der Polizei mit Gummiknüppel und Tränengaseinsätzen, Verhaftungen und Verprügeln von Dutzenden von Protestierenden.
Die jungen Arbeitergenerationen bringen am klarsten das Gefühl der Desillusionierung und der Abscheu gegenüber einem total korrupten politischen Apparat zum Ausdruck. Seit dem Krieg teilen sich drei Familien die Macht und seit mehr als 30 Jahren herrschen in ständigem Wechsel die beiden Dynastien Karamanlis (auf dem rechten Flügel) und Papandreou (auf dem linken Flügel) - begleitet jeweils von großen Bestechungsaffären und Skandalen. Die Konservativen haben 2004, nach großen Skandalen der Sozialisten in den Jahren zuvor, die Macht übernommen. Viele lehnen mittlerweile den ganzen politischen und gewerkschaftlichen Apparat ab, der immer mehr an Glaubwürdigkeit verliert. „Der Geldfetisch beherrscht die Gesellschaft immer mehr. Die Jugendlichen wollen mit dieser seelenlosen und visionslosen Gesellschaft brechen.“ (4) Vor dem Hintergrund der Krise hat diese Generation von Arbeitern nicht nur ihr Bewusstsein über eine kapitalistische Ausbeutung weiterentwickelt, die sie an ihrem eigenen Leib spürt, sondern sie bringt auch das Bewusstsein für die Notwendigkeit eines gemeinsamen Kampfes zum Ausdruck, indem sie spontan die Methoden der Arbeiterklasse anwendet und ihre Solidarität sucht. Anstatt der Hoffnungslosigkeit zu verfallen, gewinnt sie ihr Selbstvertrauen aus der Tatsache, dass sie die Trägerin einer neuen Zukunft ist; sie setzt sich mit aller Macht gegen den Fäulnisprozess der Gesellschaft zu Wehr, in der sie lebt. So haben die Demonstranten ihren Stolz zum Ausdruck gebracht, als sie riefen: „Wir stellen ein Bild der Zukunft gegenüber einer sehr düsteren Vergangenheit dar“.
Die Lage erinnert an die Verhältnisse im Mai 1968, aber das Bewusstsein dessen, was heute auf dem Spiel steht, geht viel weiter.
Die Radikalisierung der Bewegung
Am 16. Dezember besetzten Studenten wenige Minuten lang die Studios des Regierungsenders NET und rollten vor den Kameras ein Spruchband aus: „Hört auf, Fernsehen zu sehen. Kommt alle auf die Straße!“. Und sie riefen dazu auf: „Der Staat tötet. Euer Schweigen ist seine Waffe. Besetzen wir alle öffentlichen Gebäude!“ Der Sitz der Bürgerkriegspolizei Athens wurde angegriffen und ein Fahrzeug dieser Polizeitruppen angezündet. Diese Aktionen wurden daraufhin sofort von der Regierung als „Versuch des Umsturzes der Demokratie“ gebrandmarkt und auch von der KP Griechenlands (KKE) verurteilt. Am 17. Dezember wurde das Gebäude der größten Gewerkschaft Griechenlands GSEE (Allgemeiner Gewerkschaftsbund Griechenlands) in Athen von Beschäftigten besetzt, die die ArbeiterInnen dazu aufriefen, an diesem Ort zusammenzukommen, um Vollversammlungen abzuhalten, die allen Beschäftigten, allen StudentInnen und den Arbeitslosen offen stehen (siehe dazu die auf unserer Website und in dieser Zeitung veröffentlichte Erklärung). Vor der Akropolis wurden Spruchbänder angebracht, die zu einer Massenkundgebung am folgenden Tag aufriefen. Am Abend versuchten ca. 50 Gewerkschaftsbonzen und deren Führer, die Gewerkschaftszentrale zurückzuerobern, mussten aber vor den Studenten, die schnell Verstärkung erhielten, die Flucht ergreifen. Diese Verstärkung kam vor allem von meist anarchistischen Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, die ebenfalls besetzt und in einen Ort der Versammlungen und Diskussionen umgewandelt worden war, der auch allen Beschäftigen offen stand. Man eilte den Besetzern zur Hilfe und rief: „Solidarität“. Der Verband albanischer Migranten verbreitete u.a. einen Text, in dem er seine Solidarität mit der Bewegung bekundete: „Diese Tage sind auch unsere Tage“! Immer lauter wurde zu einem unbefristeten Generalstreik aufgerufen. Die Gewerkschaften sahen sich gezwungen, am 18. Dezember zu einem dreistündigen Generalstreik im öffentlichen Dienst aufzurufen.
Am Morgen des 18. Dezember wurde ein weiterer Schüler, 16 Jahre alt, der sich an einem Sit-in in der Nähe seiner Schule in einem Athener Vorort beteiligte, von einer Kugel verletzt. Am gleichen Tag wurden mehrere Radio- und Fernsehstudios durch Demonstranten besetzt, insbesondere in Tripoli, Chania und Thessaloniki. Das Gebäude der Handelskammer in Patras wurde besetzt, wo es erneut zu Zusammenstößen mit der Polizei kam. Die gigantische Demonstration in Athen wurde gewaltsam angegriffen. Dabei setzte die Bürgerkriegspolizei neue Waffen ein: lähmende Gase und ohrenbetäubende Granaten. Ein Flugblatt, das sich gegen den Staatsterror richtete, wurde von „revoltierenden Schülerinnen“ unterzeichnet und in der Wirtschaftswissenschaftlichen Universität verteilt. Die Bewegung spürte ganz vage ihre eigenen geographischen Grenzen. Deshalb nahm sie mit Enthusiasmus die internationalen Solidaritätsdemonstrationen in Frankreich, Berlin, Rom, Moskau, Montreal oder in New York auf. Die Rückmeldung lautete: „Diese Unterstützung ist für uns sehr wichtig“. Die Besetzer der Polytechnischen Hochschule riefen zu einem „internationalen Aktionstag gegen die staatlichen Tötungen“ am 20. Dezember auf. Der einzige Weg, die Isolierung dieses proletarischen Widerstandes in Griechenland zu überwinden, besteht darin, die Solidarität und den Klassenkampf, die heute als Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise immer deutlicher in Erscheinung treten, international zu entfalten.
Iannis, 19.12.08
(1) Marianne Nr. 608, 13. Dezember 2008 : „Grèce : les leçons d'une émeute“.
(2) Libération, 12. Dezember 2008.
(3) Le Monde , 10. Dezember 2008.
(4) Marianne, s.o.
