IKSonline - 2000s
- 3950 reads
IKSonline - 2004
- 3405 reads
Juni 2004
- 1044 reads
Irak-Krise: Die Interessen des deutschen Imperialismus
- 2208 reads
Als Bundeskanzler Schröder im Februar 2003 zu “Konsultationen” mit seinem Amtskollegen und bekannten Befürworter einer harten, kriegerischen Gangart gegen Irak, José Maria Aznar anreiste, wurde er am Flughafen von spanischen “Friedensaktivisten” begeistert empfangen. Dieser Jubel für den zu Hause zuletzt so verschmähten Kanzler sollte keine Ausnahme bleiben. Ob von Hollywoodstar Dustin Hoffman oder vom britischen Sänger Sir Elton John: von überall her erhielt Schröders “Friedenspolitik” Zuspruch aus der Welt der “Promis”. Und als am 15. Februar Millionen von Menschen weltweit für eine “friedliche Beilegung” des Irakkonfliktes demonstrierten, wurde auf zahllosen Transparenten und Rednerbühnen an die deutsche Regierung appelliert, dem Druck Amerikas und Großbritanniens nicht nachzugeben und weiterhin gegenüber einem Krieg am Golf Stellung zu beziehen.
Und tatsächlich: allen Befürchtungen der selbsternannten Friedensbewegung zum Trotz ist die Regierung der Bundesrepublik Deutschland bis heute in ihrer Ablehnung eines amerikanischen Krieges gegen den Irak standhaft geblieben. Seit Jahresanfang hat Berlin emsig daran gearbeitet, eine internationale Koalition gegen diesen Krieg zu schmieden. Es hat zu diesem Zweck die Achse Deutschland-Frankreich wiederbelebt und zwei weitere “Vetomächte” des UN Sicherheitsrates – Rußland und China – auf seine Seite gezogen. Jede neue diplomatische Initiative der USA in Richtung Krieg wurde durch Schröder und den französischen Präsidenten Chirac sofort mit einer Gegeninitiative beantwortet, welche eine Legitimierung dieses Krieges durch die Vereinten Nationen verhindern und immer mehr Zeit und Spielraum für die berühmten Waffeninspektoren vor Ort im Irak herausschlagen sollten. In der NATO legten Deutschland, Frankreich und Belgien zeitweilig ein erstes Veto ein, um eine Aktivierung des Bündnisses zugunsten der Türkei als Nachbarland des Iraks wenigstens einige Tage lang aufzuhalten.
Ist Deutschland ein Vorkämpfer des Weltfriedens geworden?
Auch die aggressivsten politischen Verbalattacken aus Washington können die deutsche Führung nicht mehr einschüchtern und von ihrer Frontstellung gegenüber Amerika abbringen. Schon auf der Wehrkundetagung der NATO Anfang Februar in München rief Joschka Fischer dem mit versteinerter Miene dasitzenden amerikanischen Verteidigungsminister Rumsfeld zu: “Sorry, I am not convinced.” Dessen Ausspruch, dass Deutschland wie Frankreich nun nicht mehr zum relevanten “alten Europa” gehören, wurde von der CSU mit der Forderung nach Rumsfelds Entlassung quittiert, während Schröder den Spieß umdrehte und das “alte Europa” dafür lobte, dass es den Schrecken des Krieges am eigenen Leibe kennengelernt und daraus seine friedlichen Konsequenzen gezogen habe. Auch die Erwähnung Deutschlands in einem Atemzug mit den “Schurkenstaaten” Libyen und Kuba wurde an der Spree v.a. mit Spott und Hohn kommentiert. Auch die Isolierung Deutschlands innerhalb der EU und gegenüber den EU-Beitrittskandidaten in Osteuropa brachte die Regierung in Berlin von ihrem “Friedenskurs” nicht ab.
Läßt sich die herrschende Klasse Deutschlands in der Definition ihrer Politik inzwischen durch hehre Ideale leiten?
Deutschlands Widerstand hat offenbar andere Kräfte der Weltpolitik ermutigt, sich ebenfalls gegen die amerikanische Weltmacht aufzulehnen. In der Sendung “Berlin Direkt” des ZDF vom 2. März erklärte der CSU Politiker Göppel die Ablehnung des amerikanischen Begehrens nach Bereitstellung von Militärbasen gegen Irak durch das türkische Parlament damit, dass die deutsche Haltung auch schwächere Mächte ermutigen würde, in die gleiche Kerbe zu schlagen. Nicht nur Ankara fühlt sich auf diese Weise durch das Beispiel aus Berlin und Paris angespornt. Anfang März hat die sonst notorisch zerstrittene Arabische Liga einstimmig verlangt, dass der Irak nicht einer amerikanischen Besatzungsmacht, sondern einer UN Verwaltung nach Saddam unterworfen werden soll. Berlin jedenfalls hat seinen Beitrag dazu geleistet, dass heute nicht Saddam, sondern Bush weltweit als die größere Bedrohung des “Weltfriedens” empfunden wird. Um ihre angebliche Friedenspolitik zu untermauern, hat die Bundesregierung eine Reihe von Argumenten vorgetragen, welche den Diskurs der Bush Administration widerlegen sollen. Dabei soll es Deutschland im Kern darum gehen, die Souveränität der Vereinten Nationen als oberste Instanz des internationalen Rechts zu verteidigen, welche allein über Krieg und Frieden zu entscheiden habe. Zudem führt Deutschland an, dass selbst ein blutiger Diktator wie Saddam Hussein, der Teile der eigenen Bevölkerung abschlachte, einen “Befreiungskrieg” gegen den Irak nicht rechtfertige, da Militäraktionen unweigerlich nur noch mehr Unglück über das ohnehin leidgeprüfte irakische Volk brächten. Außerdem sei es möglich, mittels Abrüstungsinspektionen “Schurkenstaaten” auch mit friedlichen Mittel zu entwaffnen. Es sei die Sorge des “alten Europas”, eine Destabilisierung des benachbarten Nahen Ostens zu vermeiden, welche ein Krieg am Golf auszulösen droht. Schließlich gibt sich Berlin als verständnisvoller Kenner der islamischen Welt, das eine Demütigung der arabischen Nation verhindern will, da diese wiederum den fundamentalistischen Terrorismus anfachen würde.
Während die von CDU/CSU angeführte innenpolitische Opposition Schröder vorwirft, einen deutschen Sonderweg zu begehen, bescheinigen Teile der Massenmedien dem Kanzler ein neues Sendungsbewusstsein. Der einst als machtbesessen verdammte “Genosse der Bosse” soll nunmehr zu einer Art schimmerndem David mutiert sein, der gegen den amerikanischen Goliath heldenhaft ringt und um des Friedens willen bereit sein soll, seine Kanzlerschaft aufs Spiel zu setzen.
Viele Altachtundsechziger, welche sich angesichts des Kosovokrieges von dem einstigen Jusochef und Vietnamkriegsgegner Schröder und dem berühmten autonomen Street-fighter Fischer noch verraten fühlen, begeistern sich jedenfalls jetzt wieder für die rot-grüne Opposition gegen die amerikanische Führungsmacht. Was steckt wirklich hinter der so plötzlich entdeckten “Friedensliebe” des wichtigsten Staats Europas? Wie erklärt sich die bisher nie dagewesene offene Frontstellung gegenüber den Vereinigten Staaten? Und was ist von den politischen Argumenten zu halten, welche linke deutsche Politiker täglich gegen die Kriegspropaganda aus Washington vortragen?
Wie immer setzt die Propaganda der Bourgeoisie auch hier auf das kurze Gedächtnis der eigenen Bevölkerung. Denn als es vor vier Jahren darum ging, den Kosovokrieg zu führen, stand die Regierung Schröder-Fischer vorne an, um ein militärisches Eingreifen an der Seite der USA zu befürworten. Auch damals gab es keine Legitimierung des Krieges durch die UN, weil insbesondere die Vetomacht Russland als traditioneller Verbündeter Serbiens ein erklärter Gegner eines Angriffs gegen Rest-Jugoslawien war. Die Argumente, mit denen sich Rot-Grün über die fehlende völkerrechtliche Absegnung des Krieges hinwegsetzte – die Brutalität des Diktators Milosevic, seine Massaker an den eigenen Staatsbürgern, die nationale Unterdrückung der Kosovo-Albaner durch Belgrad – sind den Argumenten nicht unähnlich, welche Washington auch heute einsetzt, um den Einwänden aus Berlin und Frankreich zu begegnen. Denn damals zeigten sich der Kanzler und sein Außenminister völlig unbeeindruckt gegenüber damals aus Moskau oder Peking kommenden Einwänden, dass ein neuer Krieg den Balkan destabilisieren, den Terrorismus schüren und Leid über die Bevölkerung vor Ort bringen würde.
Die Erklärung, weshalb Deutschland damals zu den entschiedensten Kriegsbefürwortern und heute zu den entschiedensten “Kriegsgegnern” gehört, ist ebenso naheliegend wie einleuchtend. Die Ausbeuterstaaten werden in ihrem Handeln nicht durch Ideale und eine “freie Meinungsbildung” geleitet, sondern durch materielle Interessen. Berlin beteiligte sich damals an dem Krieg gegen Belgrad, weil die kosovoalbanischen Terrorgruppen wie die UCK seine Verbündete waren, und weil die Schwächung Serbiens eine wesentliche Voraussetzung der deutschen imperialistischen Expansion auf dem Balkan darstellt. Berlin und Paris laufen heute Sturm gegen einen Irakkrieg, weil die Regierung Saddam Husseins ein Verbündeter dieser Länder ist, und weil die USA das herrschende pro-deutsche und pro-französische Regime in Bagdad durch eine von den Gnaden Amerikas abhängige Administration gewaltsam ersetzen wollen.
Unabhängig von den wechselnden Bündnissen und Machtkonstellationen, welche im Laufe der Geschichte entstehen und wieder vergehen, gibt es Konstanten der Außenpolitik imperialistischer Staaten, welche sich nicht ohne weiteres ändern, weil sie nicht nur in der Geschichte, sondern darüber hinaus auch noch in der Geographie begründet sind. Solches trifft für die Verfechtung deutscher Interessen auf dem Balkan, in der Türkei und im Vorderen Orient zu. Ob unter Kaiser Wilhelm II, Hitler, Adenauer oder Willy Brandt waren deutsche Regierungen stets bestrebt, über die “Landbrücke” des Balkans und Kleinasiens Einfluss auf die Weltpolitik über Europa hinaus zu gewinnen. Selbst in der Zeit des Ost-Westkonfliktes, als die alte Bundesrepublik ihre eigenen Interessen denen des von den USA angeführten westlichen Blockes anpassen musste, wurde ein besonderes Augenmerk auf diesen Weltteil gerichtet. Nicht zufällig bezog Nachkriegsdeutschland seine “Gastarbeiter” vornehmlich aus Jugoslawien und der Türkei, nicht zufällig wurden vor allem an Ankara deutsche Waffen zielstrebig geliefert und deutsche Kredite vergeben. Darüber hinaus war Bonn stets bestrebt gewesen, gute Beziehungen zum Irak und Iran zu unterhalten.
Der Unterschied zu heute war aber, dass diese Verfolgung deutscher Eigeninteressen damals nicht auf die Missbilligung, sondern auf das Wohlwollen Washingtons stieß. Denn die traditionellen Verbindungen der deutschen Bourgeoisie in dieser Region nutzten der “freien Welt” insgesamt, um den Einfluss des gegnerischen, von der UdSSR angeführten imperialistischen Blocks in dieser lebenswichtigen Gegend zurückzudrängen. Als dann Ende der 70er Jahre mit dem Sturz des prowestlichen Schah-Regimes ein Prozess der Destabilisierung des Irans einsetzte, ermutigte Washington Saddam Hussein dazu, Iran anzugreifen. Es ging darum, einerseits Iran in Schach zu halten und davon abzuhalten, sich dem Ostblock anzunähern, und andererseits darum zu verhindern, dass der Irak auf Kosten des Irans zu mächtig würde und damit das imperialistische Gleichgewicht in der Region über den Haufen werfe. Die “westliche Welt” war somit an einem langen, zermürbenden Waffengang zwischen dem Iran und dem Irak interessiert, welcher beide Seiten in Schach und in einem gewissen Gleichgewicht zueinander halten sollte. Zu diesem Zwecke erhielt die damalige Bundesrepublik von Washington grünes Licht, um ihr traditionell enges Verhältnis zu beiden Ländern spielen zu lassen und zu vertiefen, um dem Einfluss der UdSSR in der Region entgegenzutreten. So kam es, dass ab diesem Zeitpunkt v.a. im Irak kaum eine Industrieanlage, eine Munitions- und Giftgasfabrik oder ein Regierungsbunker gebaut wurde ohne die führende Beteiligung deutscher Firmen. Als dann 1989 der Ostblock auseinanderbrach und Deutschland wiedervereinigt wurde, änderten sich die politischen Rahmenbedingungen natürlich von Grund auf. Nicht mehr die UdSSR, die bald darauf selbst auseinanderbrach, sondern das wiedererstarkte Deutschland – der Hauptherausforderer Amerikas und Großbritanniens in zwei Weltkriegen – stellte nun die potenzielle erste Bedrohung für die amerikanische Führungsmacht dar. Doch gleichzeitig hatte der Untergang des Moskauer Imperiums dazu geführt, dass Deutschland nunmehr sowohl in Teheran als auch in Bagdad als einflußreichste ausländische Macht galt.
Bereits der erste Golfkrieg Anfang der 90er Jahre bildete die erste massive Antwort Washingtons auf diese neue Weltlage. Nicht zuletzt damit sollte die relative Ohnmacht Deutschlands vorgeführt werden, indem die Bundesrepublik gezwungen wurde, einem Krieg gegen ihre eigenen Verbündeten nicht nur tatenlos zuzuschauen, sondern auch noch zu finanzieren. Doch damals wurde Saddam durch die USA stark geschwächt aber noch nicht gestürzt. Der erste Golfkrieg diente somit als Warnung an alle potenzielle Herausforderer der USA, trotz des Verschwindens des gemeinsamen Gegners in Form des Warschauer Paktes sich weiterhin der amerikanischen Führungsmacht zu unterordnen. Doch die anderen Mächte ordneten sich nicht unter. Gerade Deutschland forderte Amerika heraus, indem es die Auflösung Jugoslawiens betrieb und seine Beziehungen zu Irak (und zu Iran) weiterhin emsig pflegte. Jetzt, ein Jahrzehnt danach, geht es um weitaus mehr. Mit dem angedrohten Regimewechsel in Bagdad, mit der Einreihung auch Irans in eine von Washington definierte “Achse des Bösen” geht es den USA nunmehr u.a. darum, den deutschen wie auch den französischen und den russischen Einfluss in einer der strategisch wichtigsten Regionen der Welt radikal zurückzudrängen. Der Ruf nach Waffeninspektoren und einer friedlichen Beilegung der Irakkrise, nach der Eindämmung und Mäßigung der gegenwärtigen amerikanischen Politik ist der Schlachtruf des französischen, des russischen und natürlich auch des deutschen Imperialismus. Nicht um den Frieden geht es hier, sondern um die blutige imperialistische Neuaufteilung der Welt.
Wenn sich dieser Konkurrenzkampf gegen den amerikanischen Rivalen heute der Sprache des “Friedens” bedient, dann in erster Linie wegen der militärischen Schwäche des Herausforderers und in erster Linie Deutschlands im Vergleich zu den USA. Doch diese militärische Schwäche wird zu einer politischen Stärke, wenn es darum geht, die Interessen des deutschen Imperialismus propagandistisch zu fördern. Gerade die deutsche Bourgeoisie, die die Welt in zwei Weltkriege im letzten Jahrhundert mit hineinstürzte, die die Welt mit unaussprechlichen Verbrechen überzog, und die dafür immer wieder von ihren Rivalen angeprangert wird, hat es nötig, gegenüber der Welt, gegenüber der eigenen Arbeiterklasse, ihre Außenpolitik in einem Licht der Friedfertigkeit darzustellen. Es ist politisch von großem Vorteil für die deutsche Großmacht, wenn ihre erste offene, der Welt zur Schau getragene Gegnerschaft zur USA – womit sie ihre eigene Anwärterschaft als künftiger Blockführer anmeldet – im Namen des Friedens, des Völkerrechts und anderer heuchlerischer Phrasen vorgetragen wird. Vor allem die deutsche Sozialdemokratie als erfahrenste, entschlossenste und kühnste Vertreterin des deutschen Imperialismus von heute hat die Bedeutung dieses Aspekts der Weltpolitik erkannt. Kein Zufall also, wenn Rot-Grün heute ihre “Modernisierungs-” und “Friedenspolitik” verknüpft und der Arbeiterklasse wachsendes Elend und die zunehmende Bürde des Militarismus als notwendiges Opfer um des lieben Friedens willens zu verkaufen versucht.
Um die wirkliche Natur und die Ziele dieser “Friedenspolitik” der deutschen Kapitalistenklasse zu begreifen, um die Heuchelei, aber auch die Gefährlichkeit der pazifistischen, anti-amerikanischen Kriegspropaganda bedeutender Teile der europäischen Bourgeoisie zu durchschauen, um im Interesse des internationalen Proletariats alle Seiten im imperialistischen Räuberkrieg abzulehnen, ist es notwendig, die jüngsten Entwicklungen der Weltpolitik um den Irak marxistisch zu begreifen. 10.03.03
September 2004
- 1044 reads
Anmerkungen zur Geschichte der imperialistischen Konflikte im Nahen Osten, 3. Teil
- 5941 reads
Die ersten zwei Artikel dieser Serie über die imperialistischen Konflikte im Nahen Osten (veröffentlicht in der Internationalen Revue Nr. 34, 35) verdeutlichten die Manipulation des arabischen und zionistischen Nationalismus durch die Großmächte, besonders durch Großbritannien, mit dem Zweck, die Region zu dominieren. Sie wurden ebenso benutzt als eine Waffe gegen die Drohung seitens der Arbeiterklasse zu einem Zeitpunkt, der direkt auf die Russische Revolution folgte. In diesem Artikel setzen wir die Studie der imperialistischen Rivalitäten in der Region im Vorfeld des Zweiten Weltkrieges und des Krieges selbst fort, um den blanken Zynismus der imperialistischen Politik jeder Fraktion der Bourgeoisie zu enthüllen.
Zionisten und arabische Nationalisten wählten ihr Lager im imperialistischen Krieg
Sowohl die palästinensischen Bauern und Arbeiter wie auch die jüdischen Arbeiter wurden mit der falschen Alternative, nämlich sich auf die Seite des einen oder anderen Flügels der Bourgeoisie (palästinensisch oder jüdisch) zu stellen, konfrontiert. Diese falsche Alternative bedeutete, dass die Arbeiter auf das Terrain der militärischen Konfrontation gezogen wurden für rein bürgerliche Forderungen. Während der 1920er Jahre gab es eine Reihe von gewalttätigen Zusammenstößen zwischen Juden und Arabern und zwischen Arabern und den britischen Besatzungstruppen.
Diese Zusammenstöße verstärkten sich nach der Weltwirtschaftskrise von 1929. Ein Faktor, der für diese Intensivierung verantwortlich war, war die zunehmende Einwanderung von jüdischen Flüchtlingen, die vor den Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise und der Unterdrückung flohen, die die Nazis begonnen hatten gegen die Juden in Szene zu setzen. Dazu kam noch die vom Stalinismus durchgeführte Repression. Zwischen 1920 und 1930 verdoppelte sich die Zahl der Einwanderer, zwischen 1933-39 erreichten einige 200’00 neue Einwanderer Palästina, so dass 1939 die Juden 30% der Bevölkerung ausmachten.
Der breitere historische und internationale Rahmen war die allgemeine, weltweite Verschärfung der imperialistischen Konflikte. Palästina und der Nahe Osten im Ganzen waren tiefgreifend betroffen von der weltweiten Neuausrichtung der imperialistischen Kräftekonstellation während der 1930er Jahre.
Einerseits machte es die katastrophale Niederlage des Proletariats (Sieg der stalinistischen Konterrevolution in Russland, des Faschismus und Nazismus in Italien und Deutschland, Einreihung der Arbeiter unter das Banner des “Antifaschismus” und der Volksfront in Frankreich und Spanien 1936) sowohl jüdischen als auch arabischen Arbeitern nahezu unmöglich, den zunehmend blutigen Kämpfen zwischen den jüdischen und arabischen Bourgeoisien eine internationalistische Klassenfront entgegenzustellen. Die weltweite Niederlage der Arbeiterklasse öffnete der Bourgeoisie den Spielraum, um den Weg für einen neuen generalisierten Weltkrieg frei zu machen. Zur gleichen Zeit entflohen immer mehr Juden der Unterdrückung und den Pogromen in Europa und verschärften so die Konflikte zwischen Arabern und Juden in Palästina.
Andererseits begannen die traditionellen imperialistischen Rivalitäten in der Gegend (zwischen den Franzosen und Briten) zu verschwinden, als neue und für die alten Banditen gefährlichere Rivalen die Gegend betraten. Italien, bereits in Libyen anwesend nach einem Krieg mit der Türkei 1911, begann 1936 eine Invasion Abessiniens (heute Äthiopien) und drohte damit, Ägypten und den strategischen Suez-Kanal einzukreisen. Deutschland, das mächtigste Mitglied der faschistischen Achse, arbeitete im Hintergrund, um seinen Einfluss auszubauen, indem es Unterstützung für örtliche nationalistische und imperialistische Ambitionen anbot, besonders in der Türkei, im Irak und Iran[1] [1].
Der historische Kurs in Richtung generalisierter Krieg sollte den Nahen Osten verschlingen. Seit dem Ende des Ersten Weltkrieges hatten die Zionisten die allgemeine Bewaffnung der Juden gefordert. In der Tat hatte man mit dieser Bewaffnung schon zuvor im Geheimen begonnen. Die zionistische “Selbstverteidigungs”organisation, Hagan, die während des Ersten Weltkrieges gegründet worden war, wurde in eine richtige militärische Einheit umgewandelt. 1935 wurde eine getrennte Terroristengruppe, Irgun Zwai Leumi - bekannt als Ezel – mit etwa 3-5000 Kämpfern gegründet. Die “allgemeine Wehrpflicht” wurde in der jüdischen Gemeinschaft eingeführt; alle jungen Männer und Frauen zwischen 17 und 18 Jahren mussten an diesem Militärdienst im Untergrund teilnehmen.
Die palästinensische Bourgeoisie ihrerseits erhielt bewaffnete Unterstützung von Nachbarländern. 1936 gab es eine weitere Eskalation von Zusammenstößen zwischen zionistischen und arabischen Nationalisten. Im April 1936 rief die palästinensische Bourgeoisie einen Generalstreik gegen die britischen Herrscher aus. Diese sollten gezwungen werden, ihren pro-zionistischen Standpunkt aufzugeben. Die arabischen Nationalisten mit Amin Hussein an der Spitze riefen die Bauern und Arbeiter auf, ihren Kampf gegen die Juden und Briten zu unterstützen. Der Generalstreik dauerte bis Oktober 1936 – und wurde erst abgeblasen nach einem Appell von Nachbarstaaten wie Transjordanien, Saudi-Arabien und Irak, die begonnen hatten, eine palästinensische Guerilla zu bewaffnen.
Die gewalttätigen Zusammenstöße dauerten bis 1938 an. Die britischen “Beschützer” mobilisierten Truppen von 25’000 Mann, um ihren strategischen palästinensischen Außenposten zu verteidigen.
Angesichts der allgemeinen Destabilisierung der Lage schlug die britische Bourgeoisie 1937 eine Teilung von Palästina in zwei Sektoren vor (Bericht der Peel Kommission). Die Juden sollten den fruchtbaren Nordteil Palästinas, die Palästinenser den weniger fruchtbaren Südosten bekommen, Jerusalem sollte unter internationales Mandat gestellt werden und mit dem Mittelmeer durch einen Korridor verbunden sein. Sowohl zionistische als auch palästinensische Nationalisten wiesen den Plan der Peel-Kommission zurück. Ein Flügel der Zionisten bestand auf völliger Unabhängigkeit von Großbritannien, sie bewaffneten sich weiterhin selbst und intensivierten ihre Guerillaaktionen gegen die britischen Besatzungskräfte.
Indem es einen Plan präsentierte, der Palästina in zwei Teile trennen sollte, hoffte Großbritannien seine Vorherrschaft in diesem strategisch lebenswichtigen Teil der Welt beizubehalten. Einem Teil der Welt, der zudem ein starkes Ansteigen imperialistischer Spannungen erlebte – besonders mit Deutschland und Italien, die versuchten in die Region einzudringen.
Während die Französische Volksfront Syrien 1936 die Unabhängigkeit gewährte, die jedoch erst drei Jahre später umgesetzt werden sollte, erklärte Frankreich 1939 Syrien erneut zu einem Französischen Protektorat.
Diese neue Ausrichtung der imperialistischen Kräfte war eine tatsächliche Quelle von Schwierigkeiten für die britische Bourgeoisie, die nun jedes Interesse daran hatte, die Situation in Palästina zu beruhigen und jede Konfliktpartei davon abzuhalten, Unterstützung bei einem von Großbritanniens Hauptrivalen zu suchen. Aber als der Konflikt zwischen jüdischen Einwanderern und Arabern immer bitterer wurde, begannen die Parteigänger der Politik nach dem alten Grundsatz “teile und herrsche” ihre Projekte einer Revision zu unterziehen.
Großbritannien musste versuchen, die arabischen Nationalisten zu “neutralisieren” und die Zionisten dazu zu zwingen, sich bei ihrer Forderung nach einer “nationalen Heimat” für die Juden etwas zurück zu halten.
Großbritannien verabschiedete ein Weißbuch, das die von Juden besetzten Territorien zu einer “Nationalen Heimstätte” der Juden erklärte und bestimmte, dass weiterhin nach einem Zeitraum von 5 Jahren, während dem die jährliche Einwanderung von Juden die Zahl von 75’000 nicht überschreiten sollte, die jüdische Einwanderung ganz aufhören sollte – und das zu einer Zeit, als die Massaker am jüdischen Volk in Europa in die Millionen gingen ... Gleichzeitig sollte der Landkauf durch Juden begrenzt werden.
Diese Erklärungen waren dazu gedacht, die zunehmenden arabischen Proteste zu zügeln und die Araber davon abzuhalten, sich gegen die Briten zu wenden.
Angesichts der steigenden Gewalt zwischen Zionisten und arabischen Nationalisten wurde eine weitere Eskalation des Konflikts nur dadurch vereitelt, weil ein übergeordneter Konflikt – die Konfrontation zwischen Deutschland, Italien und ihren Feinden, d.h. die Formation der Achse in Europa – diesen Konflikt für weitere 10 Jahre in den Hintergrund drängte.
Und der bedrohlich näher rückende Weltkrieg zwang die Nationalisten auf beiden Seiten – die arabische Bourgeoisie und die Zionisten – erneut, sich ihr imperialistisches Lager auszusuchen.
Mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges entschlossen sich die Zionisten, sich auf die Seite Großbritanniens zu begeben und Stellung gegen den deutschen Imperialismus zu beziehen. Sie stellten ihre Forderung nach einem eigenen jüdischen Staat zurück, solange Großbritannien von deutschen Angriffen bedroht war.
Innerhalb der arabischen Bourgeoisie führte der Krieg zu einer Spaltung – einige Fraktionen schlugen sich auf die britische Seite, andere auf die deutsche.
Der Nahe Osten und seine Rolle im Zweiten Weltkrieg
Sogar als die hauptsächlichen Schlachtfelder während des Zweiten Weltkrieges Europa und der Ferne Osten waren, spielte der Nahe und Mittlere Osten eine entscheidende Rolle für Großbritanniens und Deutschlands lang angelegte strategische Planung.
Für Großbritannien blieb die Verteidigung seiner Positionen im Nahen Osten eine Angelegenheit von Leben und Tod, um sein Kolonialreich zu bewahren, denn, sollte Ägypten verloren gehen, war Indien in Gefahr, in deutsche oder japanische Hände zu fallen. Am Vorabend der deutschen Versuche 1940 Großbritannien mit einer Invasion zu bedrohen, mobilisierte Großbritannien ca. 250’000 Mann zur Verteidigung des Suezkanals.
Die deutsche militärische Planung in Bezug auf den Nahen Osten sah mehrere Kehrtwendungen. Zu Beginn des Krieges, zumindest für eine gewisse Zeit, war es Deutschlands Strategie, mit Russland ein geheimes Abkommen über das östliche Anatolien zu treffen. Vergleichbar mit den Geheimabkommen zwischen Stalin und Hitler über Polen (Russland und Deutschland vereinbarten, Polen unter sich aufzuteilen), schlug der deutsche Außenminister Ribbentrop im November Stalin gegenüber vor, dass Russland und Deutschland ihre Interessensphären an der iranischen Grenze und entlang der nördlichen und südöstlichen anatolischen Flanke unter sich aufteilen sollten. (Die Palästinensische Frage 1917-1948, Palästina und die Nahostpolitik der europäischen Mächte und der USA, 1918-48, Seite 193) Aber die deutsche Invasion Russlands im Sommer 1941 beendete schließlich solche Pläne.
Eines der langfristigen militärischen Ziele Deutschlands, das 1941 vom Führungsstab der Reichswehr formuliert wurde, lautete, sobald Russland erfolgreich besiegt worden sei, solle Deutschland Großbritannien aus dem Nahen und Mittleren Osten und Indien vertreiben. Sofort nach der zu erwartenden Niederlage Russlands plante die Reichswehr eine globale Offensive, um den Irak zu besetzen, Zugang zu den irakischen Ölquellen zu finden und britische Positionen im Nahen und Mittleren Osten und im Indischen Ozean zu bedrohen. Deutschland allein war jedoch nicht in der Lage, eine solche Offensive zu starten. Um den Irak “erreichen” zu können, musste Deutschland noch einige Hindernisse aus dem Weg räumen: Es musste die Türkei auf seine Seite ziehen – die noch zwischen Großbritannien und Deutschland hin- und herschwankte. Deutsche Truppen mussten durch Syrien (das noch unter französischer Besatzung war) und den Libanon marschieren. Dies bedeutete, dass Deutschland das Vichy Regime um Erlaubnis fragen musste, bevor die Reichswehr Syrien und den Libanon passieren konnte. Und es musste auf die Hilfe schwächerer Teile seiner Allianz zählen – namentlich auf Italien, das unzureichende militärische Mittel besaß, um Großbritannien anzugreifen. Solange die deutsche Militärplanung sich in erster Linie auf die Mobilisierung seiner Truppen gegen Russland konzentrieren musste, war es unfähig, mehr Truppen im Mittelmeerraum aufmarschieren zu lassen. Sehr gegen seinen Willen, nachdem italienische Truppen von den britischen 1940-41 in Libyen besiegt worden waren, intervenierte 1942 das deutsche Afrika-Korps unter Rommel und versuchte die britische Armee aus Ägypten zu vertreiben und den Suezkanal zu erobern. Aber Deutschland hatte nicht die Mittel, um eine weitere Front in Afrika und dem Nahen Osten zu unterhalten, erst recht, nachdem seine Offensive gegen Russland zum Stehen gekommen war.
Zur gleichen Zeit wurde das deutsche Kapital mit seinen eigenen unüberwindlichen Widersprüchen konfrontiert. Einerseits zielte es auf die “Endlösung” ab (Holocaust, die Verschleppung und Vernichtung aller Juden), was bedeutete, dass das deutsche Kapital die Juden zur Flucht zwang, wovon folglich viele von ihnen nach Palästina vertrieben wurden. Nazipolitik war also zu einem großen Teil verantwortlich für die Zunahme jüdischer Flüchtlinge, die in Palästina ankamen – eine Situation, die das deutsche Kapital in Widerspruch brachte mit den Interessen der palästinensischen und arabischen Bourgeoisie.
Andererseits musste der deutsche Imperialismus Ausschau halten nach Alliierten unter den arabischen Bourgeoisien, um gegen die Briten zu kämpfen. Deshalb propagierten die Nazis den Ruf der arabischen Bourgeoisie nach nationaler Einheit und unterstützten deren Ablehnung einer nationalen Heimat für die Juden[2] [1].
In verschiedenen Ländern gelang es dem deutschen Imperialismus, einige Fraktionen der arabischen Bourgeoisie auf seine Seite zu ziehen.
Im April 1941 stürzten Teile der Armee die Regierung des Irak und bildeten eine Regierung der nationalen Verteidigung unter Rachid Ali al-Kailani. Diese Regierung deportierte all diejenigen, die als pro-britisch betrachtet wurden. Die palästinensischen Nationalisten, die ins irakische Exil gegangen waren, bildeten Freiwilligenbrigaden unter der Führung von al-Hussein und diese Einheiten beteiligten sich am Kampf gegen die Briten.
Als die britische Armee gegen die pro-deutsche Regierung im Irak intervenierte, entsandte Deutschland zwei Luftwaffenverbände. Die deutsche Armee hatte jedoch keine ausreichenden logistischen Möglichkeiten zur Verfügung, um seine Truppen über eine solche Distanz zu unterstützen. Zur großen Enttäuschung der pro-deutschen irakischen Regierung musste Deutschland seine Verbände zurückziehen. Die britische Armee dagegen mobilisierte nicht nur ihre eigenen Truppen, sie benutzten auch eine zionistische Spezialeinheit gegen Deutschland. Großbritannien entließ den zionistischen Terroristen David Raziel, einen Führer der zionistischen Organisation Irgun Zvai Leumi aus britischer Internierung und betraute ihn mit einer Spezialmission. Seine Einheit sollte Ölfelder im Irak sprengen und Mitglieder der pro-deutschen Regierung ermorden.
In diesem Stadium gelang es jedoch der deutschen Jagdfliegerstaffel, den zionistischen Terroristen abzuschießen, der in einem britischen Flugzeug geflogen war. Dieser Vorfall – trotz seiner begrenzten militärischen Bedeutung – enthüllt, für welche fundamentalen Interessen Großbritannien, als die absteigende “Supermacht” und Deutschland als der “Herausforderer” kämpften, mit welchen Beschränkungen sie zu rechnen hatten, und auf welche Verbündete sie sich in der Region verließen.
Der Mufti von Jerusalem, Amin al-Hussein, war in den Irak geflohen und der Führer der pro-deutschen irakischen Regierung, Ali al-Keilani musste aus dem Irak fliehen. Über die Türkei und Italien gelang es ihnen nach Berlin zu entkommen, wo sie im Exil blieben. Palästinensische und irakische Nationalisten genossen den Schutz und das Exil, das ihnen von den Nazis angeboten wurde.
Zur selben Zeit neigten die pro-deutschen Teile der arabischen Bourgeoisie dazu, sich nur solange auf die Seite Deutschlands zu schlagen, wie der deutsche Imperialismus im Vorteil war. Nach dessen Niederlage bei el-Alamein 1942 und in Stalingrad 1943, als sich der Wind gegen den deutschen Imperialismus drehte, wechselten die pro-deutschen Teile der arabischen Bourgeoisie die Seiten oder wurden von den pro-britischen Teilen der örtlichen Bourgeoisie verdrängt.
Die Niederlage der Deutschen zwang auch die Zionisten dazu, ihre Taktik zu ändern. Während sie Großbritannien solange unterstützt hatten, wie die Kolonialmacht unter der Nazibedrohung lag, so nahmen sie jetzt ihre Terrorkampagne gegen die Briten in Palästina wieder auf. Diese sollte bis 1948 andauern. Eine führende Figur unter den zionistischen Terroristen war Menachem Begin (der später Premierminister von Israel wurde und der zusammen mit Yasser Arafat den Friedensnobelpreis verliehen bekam). Unter anderen ermordeten die Zionisten den englischen Minister Lord Moyne in Kairo.
Um arabische Sympathie zu gewinnen und die arabischen Nationalisten davon abzuhalten, sich näher in Richtung ihres deutschen imperialistischen Rivalen zu bewegen, errichtete Großbritannien eine Seeblockade vor Palästina, um den Zustrom jüdischer Flüchtlinge zu zügeln. Die westliche Demokratie war bereit, ihrer imperialistischen Interessen willen den Zustrom von Flüchtlingen zu regulieren. Die Juden mögen sich erleichtert gefühlt haben, dem Tod in den Nazikonzentrationslagern entkommen zu sein, aber die britische Bourgeoisie war nicht willens, dass sich die Juden in Palästina niederließen – denn die Ankunft der Juden in diesem Moment passte nicht in ihre imperialistischen Pläne[3] [1].
Die Ähnlichkeit zwischen der Situation des Ersten und des Zweiten Weltkrieges ist auffallend. Alle örtlichen imperialistischen Fraktionen mussten zwischen dem einen und dem anderen imperialistischen Lager wählen. Das dominante imperialistische Lager, Großbritannien, herausgefordert durch Deutschland, verteidigte seine Macht mit Zähnen und Klauen.
Deutschland stand jedoch unüberwindlichen Hindernissen in dieser Region gegenüber: seinen schwächeren militärischen Fähigkeiten (über solch große Entfernungen intervenieren zu müssen, überforderte seine militärischen und logistischen Mittel) und sein Mangel an starken und verlässlichen Alliierten. Deutschland war nicht in der Lage, irgendeinem seiner Alliierten eine Belohnung anzubieten; weder hatte es die militärischen Mittel, ein Land in seinen Block zu zwingen noch Schutz gegen den anderen Block anzubieten.
So konnte es nur die Rolle eines “Herausforderers” spielen gegenüber der vorherrschenden Macht jener Zeit – Großbritannien. Es konnte niemals mehr tun als die britischen Positionen zu untergraben, und es war unfähig, selbst einen festen strategischen Außenposten einzurichten oder ein Land standhaft in seinem Machtbereich zu halten.
Globale imperialistische Umgruppierung im Nahen und Mittleren Osten
Zur selben Zeit änderte sich im Zweiten Weltkrieg zwischen den alliierten Mächten das Gleichgewicht der Kräfte.
Die USA stärkten ihre Position auf Kosten Großbritanniens. Großbritannien, das durch den Krieg ausgeblutet war und am Rand des Bankrotts stand, verschuldete sich gegenüber den USA. So wie in jedem Krieg veränderte sich die imperialistische Hackordnung.
Schließlich wandten sich die zionistischen Organisationen ab 1942 in Richtung der USA, um deren Unterstützung für die Schaffung einer jüdischen Heimat in Palästina zu gewinnen. Im November traf sich der Jewish Emergency Council in New York und wies das britische Weißbuch von 1939 zurück. Die Schlüsselforderung war die Umwandlung Palästinas in einen unabhängigen zionistischen Staat – eine Forderung, die den britischen Interessen widersprach.
Bis zum Zweiten Weltkrieg waren es hauptsächlich die westeuropäischen Mächte, die im Nahen und Mittleren Osten zusammenstießen (Großbritannien, Frankreich, Italien, Deutschland). Und während Frankreich und Großbritannien die Hauptnutznießer des Zusammenbruchs des Osmanischen Reiches nach dem Ersten Weltkrieg waren, so wurden diese beiden Länder nun vom amerikanischen und russischen Imperialismus übertrumpft, die beide danach strebten, den britischen und französischen kolonialen Einfluss auszubremsen.
Russland unternahm alles, um jede Macht zu unterstützen, die danach strebte, die britische Position zu schwächen. Über die Tschechoslowakei lieferte es Waffen an die zionistischen Guerillakräfte. Die USA lieferten ebenso Waffen und Geld an die Zionisten – obwohl letztere gegen ihren britischen Kriegsalliierten kämpften.
Nachdem der Ferne Osten ein zweites Zentrum der Kriegführung im Zweiten Weltkrieg geworden war, blieb der Nahe Osten am Rand der weltweiten imperialistischen Konfrontationen. Der Beginn des Kalten Krieges sollte jedoch den Nahen Osten in das Zentrum imperialistischer Rivalitäten ziehen. Während der Koreakrieg (1950-53) eine der ersten großen Konfrontationen zwischen dem Ost- und dem Westblock war, sollte die Gründung des Staates Israel am 15. Mai 1948 einen anderen Kriegsschauplatz eröffnen, der für Jahrzehnte im Zentrum der Ost-West-Konfrontationen bleiben sollte.
Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts im Nahen Osten zeigte, dass nationale Befreiung unmöglich geworden war und dass alle lokalen bürgerlichen Fraktionen in die globalen imperialistischen Konflikte zwischen den größeren imperialistischen Rivalen hineingezogen wurden. Mehr denn je hat das Proletariat keine imperialistische Seite, die es auswählen könnte.
Die Gründung des Staates Israel 1948 markierte die Eröffnung einer weiteren Runde von 50 Jahren blutiger Konfrontationen. Mehr als 100 Jahre von Konflikten im Nahen Osten haben unwiderlegbar illustriert, dass das verfallende kapitalistische System nichts anderes anzubieten hat als Krieg und Vernichtung.
DE (Herbst 2004)
[1] [1] Der Schah des Iran (Vater des Schahs, der später von Khomeini gestürzt werden sollte) wurde 1941 von den Briten wegen seiner vermuteten pro-Nazi Sympathien abgesetzt.
[2] [1] Im Ersten Weltkrieg hatte der deutsche Imperialismus aus strategischen Gründen bereits die Idee eines arabischen “Dschihad” gegen Großbritannien gepflegt, weil er so hoffte, die britische Vorherrschaft im Nahen und Mittleren Osten schwächen zu können – sogar dann, wenn ein Widerspruch nicht zu überwinden war, nämlich dass ein arabischer “Dschihad” sich notwendigerweise gegen den türkischen Imperialismus richten würde, Deutschlands Alliiertem im Nahen Osten.
[3] [1] Großbritannien zum Beispiel hinderte ein Schiff mit mehr als 5000 jüdischen Flüchtlingen an Bord daran, in palästinensische Häfen einzulaufen, weil dies gegen die britisch-imperialistischen Interessen gewesen wäre. Das Schiff wurde auf eine Odyssee zurück ins Schwarze Meer gesandt, wo es von der russischen Armee versenkt wurde – mehr als 5000 Juden ertranken. Im Mai 1939 reisten 930 jüdische Flüchtlinge an Bord des Hapag-Lloyd-Dampfers “St-Louis” nach Kuba. Sobald sie kubanische Gewässer erreicht hatten, wurde ihnen das Einlaufen verweigert. Das Schiff wurde von der US-Küstenwache davon abgehalten, in den Hafen von Miami einzulaufen – trotz wiederholter Appelle zahlreicher “Persönlichkeiten”. Schließlich wurde das Schiff zurück nach Europa gesandt – wo die meisten der jüdischen Flüchtlinge im Holocaust massakriert wurden. Sogar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, zur Zeit der Blockade der palästinensischen Küste durch britische Schiffe, versuchten 4’500 Flüchtlinge auf dem Schiff “Exodus” die Blockade zu durchbrechen. Die britischen Besatzungskräfte wollten nicht, dass das Schiff Haifa anlief, die jüdische Terrororganisation Haganah wollte das Schiff mit all den Flüchtlingen an Bord als ein Mittel benutzen, um die britische Blockade zu durchbrechen. Die Briten deportierten die Passagiere nach Hamburg.
Den Zynismus der westlichen Bourgeoisie in Bezug auf das Schicksal der Juden entlarvte der PCI Le Prolétaire in seinem Text Auschwitz – das große Alibi).
Geographisch:
- Naher Osten [2]
Theoretische Fragen:
- Imperialismus [3]
Erbe der kommunistischen Linke:
Massaker von Beslan, Chaos im Irak:
- 3175 reads
Ein weiterer Schritt im Zerfall des Kapitalismus
Die gegenwärtige Entwicklung des Kapitalismus stürzt die Welt in ein „Entsetzen ohne Ende“, in eine irrsinnige Zuspitzung von Attentaten, Entführungen, Geiselnahmen, Bombardierungen und Morden. Im Irak überschreitet dies alles, was man sich vor einigen Jahren überhaupt vorzustellen wagte. Doch auch der Rest der Welt, vor allem in den strategisch wichtigen Zonen, ist davor nicht mehr gefeit. Die grausamen Morde von Beslan in Nordossetien sind ein schreckliches Zeugnis. Die Ernsthaftigkeit der heutigen Situation lässt nicht nur „einzelne Schwarzmaler“ von einem Chaos sprechen, sondern auch die Medien und die Politik sprechen in diesen Worten.
Das Massaker von Beslan zeigt uns wie tief der Kapitalismus in der Barbarei versunken ist: Die Tatsache, dass Kinder als Geiseln genommen und von tschetschenischen Terroristen als Druckmittel eingesetzt werden, zeigt eine abscheuliche Haltung gegenüber Mitmenschen. Das Vorgehen der Terroristen mündet nicht in einen Hass gegen Institutionen oder eine Regierung, sondern gegen Menschen, welche das Pech haben, nicht derselben nationalistischen Clique anzugehören. Und auch der russische Staat scheut vor keinem Massaker an der Zivilbevölkerung zurück, um seine Autorität durchzusetzen. Das Resultat dieser Spirale ist bekannt: eine Destabilisierung des gesamten russischen Kaukasus, das Ausbrechen einer Serie von ethnischen oder religiösen Konflikten und die Herrschaft von Banden in jeder Region, deren Ziele vor allem in ethnischen Verfolgungen bestehen.
Im Irak herrscht ein Krieg Jeder gegen Jeden. Die Medien und gewisse linke Gruppen sprechen von einer „nationalen Widerstandsbewegung“[1] Dies ist absolut falsch. Es existiert kein „nationaler Befreiungskampf gegen die amerikanischen Besetzer“. Was sich dort abspielt ist ein Aufspriessen von verschiedensten Gruppen auf der Basis von Clans, Territorien oder religiöser Besessenheit, welche sich gegenseitig zerfleischen und gleichzeitig gegen die Besatzer losschlagen. Jede religiöse Gruppe ist in verschiedenste Cliquen aufgeteilt die einander gegenüberstehen. Anschlägen gegen Staatsangehörige und gegen Journalisten, welche nicht am Krieg beteiligt sind, zeigen nur noch deutlicher die Blindheit und Anarchie in diesem Krieg. Es herrscht ein totales Durcheinander, in dem die gesamte arbeitende Bevölkerung, die Stromversorgung und auch das Trinkwasser eine Geisel in den Händen jeder Seite in diesen blindwütigen Zusammenstössen geworden sind. Ein Terror, welcher jenen der Zeiten unter Saddam Hussein bei weitem übertrifft.
Ein isolierter Blick auf die lokalen und unmittelbaren Begebenheiten lässt uns diese Situation jedoch nicht wirklich verstehen. Alleine eine historische und internationale Sichtweise ermöglicht uns, die Natur, die Wurzeln und eine mögliche Perspektive zu erkennen. Wir haben schon verschiedenste Male versucht, einen Rahmen für das Verständnis der heutigen Situation darzulegen und begrenzen uns hier auf die wichtigsten Aspekte.
Der Terrorismus wird ein bestimender Faktor in der Entwicklung des Imperialismus
Gleich nach dem Zusammenbruch des Ostblocks 1989 und angesichts der hochtrabenden Versprechen über eine „Neue Weltordnung“ von Bush senior hatten wir eine entgegengesetzte Entwicklung vorausgesagt, diejenige einer neuen Unordnung auf dieser Welt. In einem Orientierungstext von 1992 hatten wir folgende Analyse entwickelt: „Das Ende der Blöcke eröffnet die Türe zu einer noch wilderen und chaotischeren Form des Imperialismus“, welche sich durch „noch gewalttätigere und zahlreichere Konflikte vor allem in den Regionen, wo das Proletariat am schwächsten ist“[2], auszeichnet. Diese Tendenz, welche sich in den vergangenen 15 Jahren nur bestätigt hat, war nicht ein mechanisches Resultat des Verschwindens des „Blocksystems“, sondern Resultat des Eintritts des Kapitalismus in seine letzte Phase der Dekadenz, die sich durch einen generalisierten Zerfall auszeichnet[3]. Auf der Ebenen des Krieges ist das Chaos wohl das herausragendste Zeichen des Zerfalls. Es drückt sich einerseits durch eine Zunahme der imperialistischen Konfliktherde aus, welche offen ausbrechen[4] und bei denen unterschiedlichste, sich gegenüberstehende imperialistische Interessen bestehen. Auf der anderen Seite drückt es sich durch die zunehmende Instabilität der imperialistischen Allianzen aus, und aufgrund dessen durch eine Unfähigkeit der Grossmächte, die Situation auch nur vorübergehend zu stabilisieren[5].
Auf der Basis dieser Analyse haben wir beim Ausbruch des ersten Golfkrieges gesagt, dass „nur noch die militärische Gewalt in einer Welt des zunehmenden Chaos ein Minimum an Stabilität garantieren kann“ und dass in dieser Welt „der mörderischen Unordnung und des blutigen Chaos der amerikanische Weltpolizist versucht ein Minimum an Kontrolle aufrecht zu erhalten, indem er sein militärisches Potential immer massiver einsetzt“.
Doch in der heutigen Situation hat der Einsatz militärischer Kräfte alles andere als eine Besänftigung der Konflikte zur Folge, sondern den Verlust jeglicher Kontrolle. Und dies ist auch das Schicksal der USA im Irak-Krieg, bei dem sie in eine bodenlose Falle geraten sind. Die grossen Schwierigkeiten der führenden Weltmacht schwächen ihre Rolle als Weltpolizist und stimulieren die Machenschaften und Gelüste aller anderen Imperialisten, ob gross oder klein, auch jene von Banden – wie in Tschetschenien, dem Irak oder der Al Kaida – welche nicht über einen eigenen Staat verfügen. Das Schachbrett der internationalen Beziehungen erinnert an einen riesigen Jahrmarkt auf dem sich alle ohne Erbarmen bekämpfen und damit den Grossteil der Weltbevölkerung in einen Albtraum stürzen.
Das Chaos und die Zersetzung der sozialen Beziehungen erklären, weshalb der Terrorismus zu einer wichtigen Waffe im Krieg zwischen rivalisierenden imperialistischen Staaten geworden ist[6]. In den 80er-Jahren war der Terrorismus die „Bombe der Armen“, eine Waffe der schwächsten Staaten, um sich im imperialistischen Konzert Gehör zu verschaffen (Syrien, Iran, Libyen). In den 90er-Jahren ist er zu einer Waffe der imperialistischen Konkurrenz zwischen den Grossmächten geworden, welche mit ihren Geheimdiensten mehr oder weniger direkt die unaufhörlichen Aktionen von Banden steuerten (IRA, ETA usw.). Die Attentate 1999 in Russland und die Twin Towers 2001 zeigten, dass „die blinden terroristischen Anschläge durch fanatische Kamikaze-Kommandos, welche direkt die Zivilbevölkerung treffen, von den Grossmächten ausgenutzt werden um die Entfesselung der kapitalistische Barbarei zu rechtfertigen“[7]. Mehr und mehr herrscht eine Tendenz, in der sich diese Banden vor allem in Tschetschenien und Islamisten aller Färbung als „unabhängig“ von ihren alten Unterstützern[8] erklären und versuchen, ihre eigene Karte auf dem imperialistischen Schachbrett zu spielen.
All dies ist Zeugnis des Chaos, welches die imperialistischen Beziehungen dominiert und der Unfähigkeit der Grossmächte, ihre Hexenlehrlinge zu kontrollieren. Trotz aller grössenwahnsinnigen Erklärungen können jedoch diese Kriegsherren nie eine komplett unabhängige Rolle spielen, da sie von den Geheimdiensten der Grossmächte unterwandert sind, die ihrerseits versuchen, sie zu ihren Gunsten zu manipulieren, was zu einer noch verstärkteren Konfusion bei den imperialistischen Rivalitäten führt.
Zentralasien, Epizentrum des weltweiten Chaos
Zentralasien mit seinen Schlüsselregionen Afghanistan im Osten, Saudi-Arabien im Süden, dem Kaukasus und der Türkei im Norden und der orientalischen Mittelmeerküste (Syrien, Palästina usw.) im Westen bildet das strategische Herz des Planeten, da es die wichtigsten Energiereserven besitzt und sich im Fadenkreuz der entscheidenden See- und Landwege der imperialistischen Expansion befindet.
Die Staaten dieser Region sind einer Tendenz der Zuspitzung und Entfesselung des Krieges zwischen allen Fraktionen der Bourgeoisie unterworfen. Das Epizentrum bildet der Irak, von wo aus sich die Welle der Gewalt in alle Richtungen verbreitet: wiederkehrende Attentate in Saudi-Arabien, welche nur die Spitze des Eisberges eines blutigen Kampfes um die Macht darstellen; ein offener Krieg in Israel und Palästina; Krieg in Afghanistan; eine Destabilisierung des russischen Kaukasus; Attentate und Zusammenstösse in Pakistan; Attentate in der Türkei und eine kritische Situation im Iran und in Syrien[9]. Dies haben wir schon im Editorial der Internationalen Revue 33 bezüglich der Situation im Irak beschrieben, wo sich die Lage bis heute noch mehr zugespitzt hat: „Dieser Krieg tritt soeben in eine neue Phase ein. Er wandelt sich in eine Art internationaler Bürgerkrieg. Im Irak finden die Zusammenstösse immer häufiger nicht nur zwischen dem ‚Widerstand‘ und den amerikanischen Truppen statt, sondern zwischen den diversen Kräften der Saddam-Anhänger, den wahabitisch inspirierten Sunniten (zu denen sich auch Ossama bin Laden zählt), den Schiiten, Kurden und Turkmenen. In Pakistan entwickelt sich mit dem Bombenattentat gegen eine schiitischen Prozession (mit 40 Toten) und der umfangreichen Militäroperation der pakistanischen Armee in Waziristan an der afghanischen Grenze ein Bürgerkrieg. In Afghanistan können all die Erklärungen über die Festigung der Regierung Karzai nicht darüber hinwegtäuschen , dass die Regierung nur Kabul und die nähere Umgebung kontrolliert, und auch dies nur unter grössten Anstrengungen. Der Bürgerkrieg im gesamten Süden des Landes verrichtet weiterhin ein zerstörerisches Werk. In Israel und Palästina verschlechtert sich die Situation mit dem Einsatz von Kindern zum Transport von Bomben durch die Hamas.“
Eine ähnliche Situation hat sich schon in verschiedenen afrikanischen Ländern abgespielt (Kongo, Somalia, Liberia usw.), die in einen endlosen Bürgerkrieg abgeglitten sind. Doch die Tatsache dass dies nun auf brutalste Art und Weise auch in der Region stattfindet, welche das strategische Herzstück der Welt bildet, hat schwerwiegendste Auswirkungen auf die internationale Situation.
Auf strategischer Ebene sind es vor allem die „traditionellen“ Expansionsbedürfnisse des deutschen Imperialismus Richtung Asien, welche damit blockiert werden. Die Interessen einer Grossmacht wie England sind durch die Destabilisierung Zentralasiens ebenfalls bedroht. Die gegenwärtige Situation ist wie eine Splitterbombe, die auch Russland (dies zeigt deutlich die Situation im Kaukasus, wo die Tragödie von Beslan nur ein Ausdruck davon ist), die Türkei, Indien und Pakistan verletzt, aber auch andere Regionen erreicht wie Osteuropa, China und Nordafrika. Da diese Region die Energiereserven des Planeten birgt, wird ihre Destabilisierung auch schwerwiegende Auswirkungen auf die ökonomische Situation zahlreicher Industriestaaten haben, wie die steigenden Ölpreise deutlich zeigen. Das Gravierendste an der heutigen Situation aber ist die Unfähigkeit der Grossmächte, diesem Prozess der Destabilisierung auch nur vorübergehend Einhalt zu gebieten. Dies trifft für die USA zu, wo der „Krieg gegen den Terrorismus“ zu einem Mittel geworden ist, um selbst überall den Terrorismus und kriegerische Konflikte zu säen. Die honigsüssen Appelle der Rivalen (Deutschland, Frankreich usw.) zur Einsetzung einer „multilateralen“ Weltordnung, die auf dem „internationalen Recht“ und einer „internationalen Zusammenarbeit“ beruhen soll, sind lediglich Mystifikationen, welche in den Köpfen der Arbeiter eine Konfusion über die wirklichen Interessen der herrschenden Klasse in dieser Region verbreiten sollen. Schlüpfrige Bananenschalen unter die Füsse des amerikanischen Mammuts zu werfen ist eines der einzigen wirksamen Mittel welches sie gegen die militärische Übermacht der USA wirksam einsetzen können.
Der Weltkapitalismus befindet sich in einer unüberwindbaren Situation von Widersprüchen: Der Einsatz brutaler militärischer Gewalt durch die grösste Weltmacht ist der letzte Versuch geworden, um das herrschende Chaos ein wenig einzudämmen, doch zeigt sich dieser Versuch nicht nur wirkungslos, sondern wird selber zum Hauptfaktor der Beschleunigung des Chaos.
Nur die Arbeiterklasse kann eine andere Perspektive anbieten
Auch wenn die amerikanische Armee weitaus die stärkste der Welt ist, breitet sich in ihren Truppen eine Demoralisierung aus und sie hat immer mehr Probleme, ihre Reihen zu füllen. Die Welt befindet sich nicht in derselben Lage wie zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, als die Arbeiterklasse – am Ende der weltrevolutionären Welle geschlagen und unter die Fahnen des Nationalismus getrieben – eine enorme Reserve an Kanonenfutter für den Krieg war.
Heute ist das Proletariat nicht geschlagen und selbst der mächtigste Staat der Erde hat nicht die Mittel, Millionen von Arbeitern für den Krieg zu gewinnen. Das Kräfteverhältnis zwischen den Klassen ist heute der Schlüssel zur Entwicklung der Gesellschaft.
Nur die Arbeiterklasse ist fähig, das Abgleiten in die kapitalistische Barbarei zu stoppen. Sie ist die einzige Kraft, welche der Menschheit eine andere Perspektive anbieten kann. Das Entstehen revolutionärer Minderheiten auf der ganzen Welt ist Ausdruck einer unterirdischen Reifung des Bewusstseins innerhalb der Arbeiterklasse. Sie sind ein sichtbares Zeichen der Anstrengungen der Arbeiterklasse eine proletarische Antwort auf die heutige Situation zu geben. Der Weg ist schwierig und mit zahlreichen Hindernissen bestückt. Ein Hindernis sind Illusionen über falsche „Lösungen“, welche die verschiedenen Teile der herrschenden Klasse anbieten. Auch wenn viele Arbeiter Bushs schamloser Kriegstreiberei misstrauen und sehen, dass der „Krieg gegen den Terrorismus“ die Konflikte und den Terrorismus nur noch zuspitzt, so fällt es ihnen schwer, die pazifistischen Mystifikationen zu durchschauen, welche sich Bushs Gegner wie Schröder, Chirac, Zapatero und Kompanie auf die Fahnen schreiben. Und noch schwieriger ist es, den Charakter der Cliquen zu durchschauen, die der Bourgeoisie treu zur Seite stehen: die radikalen Linken und Antiglobalisierer. Wir dürfen keine Illusionen haben: all diese Fraktionen der herrschenden Klasse sind Zahnräder in der tödlichen Maschine des Kapitalismus, welche die Gesellschaft in den Abgrund reisst.
Die ganze Geschichte des vergangenen Jahrhunderts bestätigt die Analyse, die vom 1. Kongress der Kommunistischen Internationale formuliert wurde: „Der Menschheit, deren ganze Kultur jetzt in Trümmern liegt, droht die Gefahr vollständiger Vernichtung. (...) Die alte kapitalistische „Ordnung“ existiert nicht mehr, sie kann nicht mehr bestehen. Das Endresultat der kapitalistischen Produktionsweise ist das Chaos. Und dieses Chaos kann nur die grösste, produktive Klasse überwinden: die Arbeiterklasse. Sie muss eine wirkliche Ordnung schaffen, die kommunistische Ordnung. Sie muss die Herrschaft des Kapitals brechen, die Kriege unmöglich machen, die Grenzen der Staaten vernichten, die ganze Welt in eine für sich arbeitende Gemeinschaft verwandeln, die Verbrüderung und Befreiung der Völker verwirklichen.“[10]
Um sich für diese gewaltige Aufgabe zu rüsten, muss das Proletariat mit Geduld und Ausdauer seine Klassensolidarität entwickeln. Der zerfallende Kapitalismus will uns an den Horror gewöhnen und uns weismachen, dass die von ihm verursachte Barbarei „Normalität“ sei. Die Arbeiterklasse kann gegenüber diesem Zynismus nur mit Empörung reagieren und ihm ihre Solidarität gegenüber den Opfern all der endlosen Konflikte und Massaker durch die verschiedensten kapitalistischen Banden entgegenstellen. Abscheu und Zurückweisung gegen alles, was der zerfallende Kapitalismus der Menschheit antut und die Solidarität zwischen den Mitgliedern einer gesellschaftlichen Klasse, welche gemeinsame Interessen hat, sind entscheidende Faktoren in der Entwicklung des Bewusstseins dass eine andere Perspektive möglich ist, die nur von der geeinten Arbeiterklassen erkämpft werden kann.
Mir. 26. 9. 2004
[1] Die parasitäre Gruppe GCI wagt es, dies sogar als „Klassenkampf“ zu bezeichnen.
[2] s. Militarismus und Zerfall, in: Internationale Revue Nr. 13.
[3] s. Thesen über den Zerfall, in: Internationale Revue Nr. 13 und: Die marxistischen Wurzeln der Erkenntnis über den Zerfall, (s. Artikel in der vorliegenden Internationale Revue Nr. 34).
[4] Statistiken der UNO zählen heute Einundvierzig lokale Kriegsherde auf der Welt.
[5] Die Unmöglichkeit einer Regelung des Konfliktes Israel – Palästina und die Perspektive von nie endenden Zusammenstößen ist eine bittere Illustration.
[6] Wir haben dies schon in folgendem Artikel analysiert: Der Terrorismus, Waffe und Legitimation für den Krieg, in: Internationale Revue Nr.112, (engl., franz., span. Ausgabe).
[7] s. Pearl Harbour 1941, Twin Towers 2001, in: Internationale Revue Nr. 29.
[8] Es muss daran erinnert werden, dass diese Kriegsherren in den 80er-Jahren treue Diener der Grossmächte waren: Bin Laden arbeitete in Afghanistan für die USA und Balajev, der vermutliche Kommandant auf tschetschenischer Seite im Massaker von Beslan, ist ein ehemaliger Offizier der russischen Armee.
[9] Auch der stärkste Staat dieser Region, Israel, ist vor dieser Tendenz nicht gefeit, auch wenn sie sich in einer milderen Form manifestiert. Die radikalsten Fraktionen der Rechten rufen dort, als Antwort auf den Plan Sharons zu einem Rückzug der jüdischen Siedlungen aus dem Gaza-Streifen, zur Desertion aus der Arme und den Polizeikräften auf.
[10] s. Richtlinien der Kommunistischen Internationale“, angenommen auf dem 1. Kongress, 2. bis 6. März 1919, in: Die Kommunistischen Internationale: Manifeste, Leitsätze, Thesen und Resolutionen” Bd, 1, Intarlit (1984) und: www.sinistra.net/komintern/dok/1krichtkid.html [5]
Geographisch:
- Tschetschenien [6]
Aktuelles und Laufendes:
- Irak [7]
Theoretische Fragen:
- Zerfall [8]
Oktober 2004
- 1019 reads
Briefe der IKS an das IBRP
- 2471 reads
Paris, 26.10.04
Genoss/Innen,
Vor vier Tagen, am 22. Oktober, haben wir euch einen Brief geschickt, dessen Kernaussage wir hier wiederholen:
Seit mehr als einer Woche findet man auf der französischen und englischen Webseite des IBRP eine „Erklärung des Zirkels internationalistischer Kommunisten (Circulo Comunistas Internacionalistas) (Argentinien)“ mit Datum vom 12. Oktober und der Überschrift „Gegen die ekelerregende Methode der IKS“. Der Titel allein spiegelt schon die Reihe von Verleumdungen wider, den der „Zirkel“ über uns verbreitet und auf die wir hier nicht näher eingehen wollen. Wie wir schon in unserer Stellungnahme mit der Überschrift „Der Zirkel internationalistischer Kommunisten (Circulo Comunistas Internacionalistas – Argentinien) – Eine neue, seltsame Erscheinung“ schrieben: „Hinsichtlich dieser Erklärung (vom 12. Oktober), sagt die IKS, dass es sich um ein Netz von Lügen und Verleumdungen handelt“. Bislang waren die Angriffe und Verleumdungen des Stils, wie sie nun vom „Zirkel“ gegen uns gerichtet werden, das Markenzeichen der „IFIKS“ (oder sie wurden von dieser auf ihrer Webseite gegen uns weiterverbreitet), d.h. einer Gruppe, deren einziger Daseinsgrund darin besteht, die IKS zu diskreditieren, was natürlich die Tragweite dieser Angriffe abschwächte. Die Tatsache, dass Angriffe dieser Art heute von dem IBRP übernommen und weiterverbreitet werden (zusätzlich zu deren Verbreitungen durch die IFIKS), ohne auch nur einen Kommentar, mit dem man sich von den Beschuldigungen distanziert (was umgekehrt bedeutet, dass das IBRP diese Beschuldigungen unterstützt), ist natürlich von einer ganz anderen Tragweite. Euch steht es natürlich frei, die von dem ‚Zirkel‘ verbreiteten Gerüchte ohne irgendwelche Überprüfungen für bare Münze zu nehmen. Aber unter dem Titel eines „Rechts auf Gegendarstellung“ bitten wir euch, nach der Erklärung des „Zirkels“ auf eurer Webseite und in der jeweiligen Sprache die folgende Stellungnahme zu veröffentlichen:
„Die IKS erklärt, dass die in der Erklärung des „Zirkels internationalistischer Kommunisten“ vom 12. Oktober enthaltenen Beschuldigungen, denen zufolge die IKS „Praktiken benutzt, die nicht dem Erbe des Linkskommunismus entsprechen, sondern eher den Methoden, die typisch sind für die bürgerliche Linke und den Stalinismus,“ damit „unser kleiner Kern (der aus der NCI hervorgegangen ist) oder ihre Mitglieder jeweils einzeln zerstört werden“, eine totale Lüge sind. Die IKS empfiehlt den Lesern, die Webseite der IKS (fr.internationalism.org/ri350/ficci.htm [9]) aufzusuchen, um dort mehr Informationen zum selbigen Thema zu finden. Die IKS ruft zur Durchführung einer unabhängigen Untersuchung auf, die von einer Mannschaft durchgeführt werden kann, die aus Leuten zusammengesetzt ist, die linkskommunistischen Organisationen angehören oder ihnen nahe stehen, damit die gegen sie gerichteten Beschuldigungen aufgeklärt werden. Zu diesem Zweck hat die IKS angefangen, mit Personen und Organisationen Kontakt aufzunehmen, die für die Beteiligung an einer solchen Untersuchungskommission infrage kämen.“
Wir bitten euch, diese Stellungnahme so schnell wie möglich zu veröffentlichen.
Bis dato haben wir auf keiner Webseite des IBRP diese Stellungnahme gefunden. Handelt es sich um eine technische Verspätung oder handelt es sich um eine Weigerung, unseren kurzen Text zu veröffentlichen?
Wenn es sich um eine technische Verspätung handelt, bitten wir euch die Schritte zu unternehmen, damit die Stellungnahme so schnell wie möglich veröffentlicht wird. Jeden Tag können neue Besucher euer Webseite die verlogene Erklärung des “Zirkels” lesen, ohne die Möglichkeit erfahren zu können, dass die IKS die gegen sie gerichteten Beschuldigungen verwirft.
Wenn ihr euch hingegen weigert, die Stellungnahme zu veröffentlichen, ist das noch schwerwiegender und wir fordern euch dazu auf, über die Bedeutung solch einer Haltung nachzudenken: Nicht nur, dass ihr euch an der Verbreitung solcher infamen Verleumdungen gegen eine Organisation des proletarischen Lagers beteiligt, sondern ihr übernehmt dafür sogar noch die Verantwortung.
Welche Gründe es für die Nichtveröffentlichung unserer Stellungnahme auch geben mag, wir fordern euch auf, dies uns so schnell wie möglich mitzuteilen.
Hinsichtlich der anderen Punkte, die wir in dem Brief vom 22. Oktober aufgeworfen haben, erwarten wir ebenso eine Antwort, auch wenn wir verstehen, dass ihr mehr Zeit zum Nachdenken haben möchtet.
Kommunistische Grüße
Die IKS
Die IKS an das IBRP Paris, 30.10.04
Genossen,
Am 22. und 26. Oktober haben wir an die E-Mail-Adresse eurer beiden Sektionen zwei Briefe mit der Bitte geschickt, auf eurer jeweiligen Webseite eine Stellungnahme der IKS zu der „Erklärung des Zirkels Internationalistischer Kommunisten (Argentinien) gegen die ekelerregenden Methoden der IKS“ vom 12. Oktober, welche auf eurer Webseite verbreitet wurde, zu veröffentlichen. Bis heute seid ihr auf unsere Bitte nicht eingegangen, noch habt ihr es für nötig befunden, auch nur auf unsere Post zu antworten. Während diese Erklärung nur auf französisch und englisch auf eurer Webseite verbreitet wurde, als wir euch unseren ersten Brief schickten, wird sie mittlerweile von euch auch auf spanisch verbreitet.
In Anbetracht eures Schweigens und eurer Haltung, die darauf hinweist, dass ihr euch weigert, unsere Stellungnahme zu verbreiten, sehen wir uns gezwungen, unsere früheren Briefe an euch auf unserer Webseite zu veröffentlichen.
Genossen, wir möchten noch einmal unterstreichen, dass euer fortgesetztes Schweigen gleichbedeutend ist mit der Unterstützung für die infamen Verleumdungen des ‚Zirkels‘ gegen unsere Organisation.
Kommunistische Grüße
Die IKS
Politische Strömungen und Verweise:
Zuerst Verunglimpfungen, dann Lügen – das IBRP entfernt sich von der Sache des Proletariats
- 2803 reads
Das IBRP[1] veröffentlichte auf seiner Website in vier Sprachen (italienisch, französisch, englisch, spanisch) das folgende Communiqué mit dem Titel "Letzte Antwort auf die Beschuldigungen der IKS":
"Wir informieren die Genossen, die die internationalen Schicksalsschläge der Gruppen der Kommunistischen Linken verfolgen, dass wir seit einiger Zeit das Ziel von heftigen und vulgären Angriffen von Seiten der IKS sind, die tobt, weil sie von einer tiefen und unumkehrbaren inneren Krise zerrissen wird, die ihre Ex-Militanten dazu bringt, mit kritischer Aufmerksamkeit die Positionen des IBRP zu studieren.
Wir haben eine Zeitlang gehofft, die (Ex-?)Genossen der IKS würden wieder ein Mindestmaß an psychologischem Gleichgewicht finden, und wir haben einige Male auf ihre verrückten Anschuldigungen geantwortet, aber es hat nichts gebracht. Ihr Verfolgungswahn und ihre Komplotttheorien, die ihre Träume anregen, sind offensichtlich die vergiftete Frucht eines politischen Kurses, der auf Voraussetzungen beruht, die mit dem historischen Materialismus überhaupt nichts zu tun haben.
Dies treibt sie dazu, immer alle des bourgeoisen Komplotts gegen sie zu bezichtigen, was all diejenigen nervt, die ernsthaft revolutionäre Politik betreiben. Man entdeckt plötzlich, dass Militante, die 25 Jahre Militanz hinter sich haben und Mitglieder der leitenden Organe der IKS waren, nichts als Diebe, Schurken oder Parasiten seien.
Der IKS zu folgen wäre deshalb für uns eine große Zeitverschwendung, die wir uns nicht erlauben können. Aus diesem Grund werden wir vom heutigen Tag an weder auf ihre vulgären Angriffe antworten noch darauf reagieren. Diejenigen hingegen, die die Kenntnis unserer Kritik der Positionen der IKS vertiefen möchten, finden in der (bald erscheinenden) Nr. 10 von Prometeo[2] unsere Kritik an ihrer letzten Kongressresolution.
PS: Dieses Communiqué bleibt 15–20 Tage auf unserer Website."
Wie steht es nun mit den "heftigen und vulgären Angriffen von Seiten der IKS", die dieses Communiqué erwähnt?
Das Verhalten des IBRP in letzter Zeit – eine offene Schuld, die sich nicht einfach in Luft auflöst
Tatsächlich haben wir gegenüber dem IBRP sehr energische Kritik geübt, und zwar aufgrund eines Verhaltens von ihm, das der Tradition der Kommunistischen Linken nicht würdig ist und wie folgt zusammengefasst werden kann[3]:
- Das IBRP veröffentlichte auf seiner Website in verschiedenen Sprachen schubkarrenweise Verleumdungen gegen die IKS, die von einem schleierhaften "Zirkel Internationalistischer Kommunisten" stammten, ohne dass es die Behauptungen auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft hätte;
- es zögerte die Veröffentlichung auf seiner Website eines von uns verfassten Dementis, das eine begründete Widerlegung der Verleumdungen enthielt und auch auf unserer Website zu lesen war, so lange wie möglich hinaus;
- es leistete unserem Begehren um "Gegendarstellung" (das jede bürgerliche Zeitung unter ähnlichen Umständen akzeptiert hätte) erst nach drei Briefen von uns Folge, und zwar insbesondere erst nach dem Auftauchen einer Anzahl von Tatsachen, die den lügenhaften Charakter der Behauptungen des Abenteurers (Herrn B.) bewiesen, der sich hinter dem ominösen "Zirkel Internationalistischer Kommunisten" versteckte;
- es veröffentlichte nie die dieses Element verurteilende Stellungnahme des NCI (Nucleo Comunista Internacional), einer Gruppe in Argentinien, die mit den Positionen der IKS sympathisiert und die das erste Opfer der Manöver des Herrn B. war;
- es hat die heuchlerischste Methode angewandt, um möglichst zu vermeiden, angesichts der Tatsachen, die sich hinsichtlich der Intrigen des Herrn B. und des Charakter seines Textes aufdrängten, vor aller Welt bloß gestellt zu werden: es entfernte diesen Text ebenso kommentarlos von der Website, wie es ihn seinerzeit in Umlauf gesetzt hatte, während er fast zwei Monate lang dazu diente, schubkarrenweise Dreck auf unsere Organisation zu kippen;
- mit anderen Worten wandte es sich von der einzigen Methode ab, die unter solchen Umständen der Revolutionäre würdig ist: das Verhalten des Schwindlers mit allem Nachdruck zu verurteilen, um den ernsthaften politische Fehler zu korrigieren, den es durch die stillschweigende Gutheißung und Weiterverbreitung der Verleumdungen gegen unsere Organisation begangen hatte.
Tatsächlich ist die Antwort des IBRP auf unsere Kritik sehr klar: Es ist ein Nichteintretensbescheid, der mit dem Vorwand begründet wird, uns zu antworten wäre eine "Zeitverschwendung, die wir uns nicht erlauben können". Und darüber hinaus behauptet das IBRP auch noch, dass es diejenige Organisation sei, die angegriffen worden sei! Eine solche Haltung zeigt klar, dass diese Organisation uns keine einzige konkrete Tatsache und kein politisches Argument entgegen halten kann. Wenn das IBRP auf dieser Haltung beharrt, liefert es - wie bereits gesagt - selber den Beweis dafür, dass es zu einem Hindernis für die Bewusstseinsreifung des Proletariats wird, "nicht so sehr durch den schlechten Ruf, den unsere Organisation davon tragen könnte, sondern durch den schlechten Ruf und die Schande, die solches Verhalten über das Andenken an die Italienische Kommunistische Linke und somit über deren unersetzlichen Beitrag bringt" ("Offener Brief an die Militanten des IBRP" vom 7. Dezember 2004).
Überprüfen wir nun gleich diese Vertiefung der "Kenntnis unserer Kritik der Positionen der IKS" durch BC, die das Communiqué des IBRP verspricht. Es handelt sich dabei um den Artikel auf Italienisch mit dem Titel "Dekadenz, Zerfall, Produkte der Verwirrung" aus der Nr. 10 von Prometeo.
Ja zum politische Kampf, aber nicht mit den Methoden der Bourgeoisie
Die IKS befürwortet absolut und ohne Abstriche die offene Konfrontation der unterschiedlichen Standpunkte, die die verschiedenen Strömungen in der Arbeiterbewegung vertreten. "Es gibt gewiss keine Partei, für die die freie und unaufhörliche Selbstkritik in diesem Maße eine Lebensbedingung wäre wie für die Sozialdemokratie. Da wir mit der Entwicklung der Gesellschaft fortschreiten müssen, so ist ein beständiger Unwandlungsprozess auch in unserer Kampfesweise die Vorbedingung unseres Wachstums, dieser ist aber nicht anders als durch die unaufhörliche Kritik unseres theoretischen Besitzstandes zu erreichen." (Rosa Luxemburg, Freiheit der Kritik und der Wissenschaft, Sept. 1899)[4]. Es ist deshalb alles andere als Zufall, wenn die Strömungen, die die marxistische Linke der Arbeiterbewegung verkörperten, nach dem Vorbild Lenins, Rosa Luxemburgs und Pannekoeks mit Begeisterung die Polemik begrüßten, die sie als belebend erachteten – ganz im Gegensatz zu den opportunistischen Tendenzen innerhalb der Arbeiterbewegung. Die IKS sieht sich als Fortsetzerin dieser Tradition, was zahlreiche ernsthafte Polemiken beweisen, die in ihrer Presse erschienen sind und deren Ehrlichkeit bis jetzt von niemandem in Frage gestellt worden sind.
Was den Artikel von Prometeo betrifft, müssen wir zugeben, dass wir den "Tiefgang", der versprochen wurde, nicht gefunden haben, aber das ist nicht das entscheidende Problem. BC scheint nicht zu wissen oder vergessen zu haben, dass die Polemik im revolutionären Milieu nichts mit dem "politischen Wettkampf" zu tun hat, den die Bourgeoisie pflegt und bei dem das Ziel darin besteht, mehr "Punkte" als der Gegner zu gewinnen, indem dieser mit allen Mitteln schlecht gemacht wird, die typisch für diese Klasse sind: Schienbeintritte, falsche Unterstellungen, Hinterlist, Lügen, usw.. Auf solche Methoden greift BC zurück, um ihren Standpunkt "um jeden Preis" zur Geltung zu bringen. Aus diesem Grund geben wir der Antwort auf diese Herangehensweise von BC die höchste Priorität, ohne dass wir daneben vergessen, wie wichtig es ist, weiterhin Stellung zu nehmen zu den wesentlichen Fragen, bei denen unsere beiden Organisationen ernsthaft anderer Auffassung sind (was wir immer wieder tun)[5] – diese Herangehensweise von BC wollen wir heftig kritisieren, denn sie ist bei einer Organisation, die sich auf den Marxismus und die Kommunistischen Linke beruft, nicht zu akzeptieren.
Es ist nicht das erste Mal, dass wir gezwungen sind, diese Art von Problemen in der Diskussion mit dieser Organisation zu erörtern. So schrieben wir im März 2001 in einem zweiteiligen Artikel, der der Kritik der vom IBRP angewandten, opportunistischen Herangehensweise beim Aufbau der Partei gewidmet war[6], Bezug nehmend auf eine Antwort dieser Organisation zum ersten Teil des Artikels, die IKS "wird nur dann zitiert, wenn es nicht anders geht. Der ganze Artikel ist oberflächlich und enthält keine Zitate unserer Positionen, die vielmehr von BC zusammengefasst werden, und zwar teilweise klar entstellend". Doch während wir damals geneigt waren zu glauben, dass "dies die Folge eines mangelnden Verständnisses [unserer Positionen] und nicht Ausdruck von Böswilligkeit" war, sind wir heute, angesichts der Systematik der Entstellung und der Schamlosigkeit gewisser Lügen, unschlüssig: Muss man diese Haltung als Zeichen der intellektuellen und politischen Altersschwäche deuten, oder entspringt sie einem außerordentlichen Zynismus, der seinerseits Ausdruck eines totalen Verlusts jeder Moral und jedes proletarischen Bezugs dieser Organisation wäre. Warum nicht beides? Jedenfalls kann sich der Leser selbst ein Urteil bilden.
Schamlose Entstellung der Positionen der IKS
Der Artikel von Prometeo geht grob und ohne Ordnung auf unsere Position zur Fähigkeit der Bourgeoisie und ihrer Gewerkschaften los, gegen die Arbeiterklasse Manöver zu veranstalten (wie während der Streiks vom Dezember 95 in Frankreich der Fall war), sowie auf unsere Analyse über den politischen Parasitismus. Nachdem die tollwütige Feder von BC die erste Frage gestreift hat, entstellt sie ohne Zurückhaltung absichtlich zum Zwecke ihrer Polemik auf tiefstem Niveau unsere Analyse über den Parasitismus. Sie sagt folgendes: "Jeder hatte die Möglichkeit, diese Sichtweise zu überprüfen, diejenige der IKS, über eine bei verschiedenen Gelegenheiten Komplotte schmiedende Bourgeoisie, wobei wir an die großen Streiks in Frankreich erinnern, wo die Bourgeoisie die Gewerkschaft derart manipulierte, dass sie das Proletariat in eine Falle laufen ließ, oder (…) die Thesen über "den Parasitismus", die der Bourgeoisie ganz einfach die Verantwortung dafür zuschieben, parasitäre Grüppchen zu gründen, um genau in der IKS Schaden anzurichten". Der Autor des Artikels tut so, als ob es sich bei dem, was er schreibt, um offensichtliche Tatsachen handeln würde: "Jeder hatte die Möglichkeit, diese Sichtweise zu überprüfen", und der Hinweis auf unsere "Thesen über den Parasitismus" soll den Beweis dieser Offensichtlichkeit darstellen. Angesichts einer solchen Lüge ist es notwendig, länger aus diesen Thesen zu zitieren:
– "Der politische Parasitismus (ist) mehrheitlich auch ein Ausdruck des Eindringens fremder Ideologien in die Arbeiterklasse (...)" (Punkt 8 der "Thesen den politischen Parasitismus", veröffentlicht in der Internationalen Revue Nr. 22)
– Er stellt eine Bedrohung dar "in Perioden der relativen Unreife der Arbeiterbewegung, in denen die Organisationen des Proletariates noch eine schwache Wirkung und wenig Tradition haben" (Punkt 8)
– "Der Begriff des politischen Parasitismus ist (...) keineswegs "eine Erfindung der IKS". Es war die IAA (Internationale Arbeiterassoziation), (…) - und zuvorderst Marx und Engels - (...), die die Parasiten schon damals als politisierte Elemente beschrieb, welche zwar vorgeben, zum Programm und den Organisationen des Proletariats zu gehören, ihre Energie aber nicht auf den Kampf gegen die herrschende Klasse, sondern gegen die Organisationen der revolutionären Klasse konzentrieren." (Punkt 9);
– die Anfälligkeit gegenüber dem Parasitismus liegt heutzutage insbesondere begründet im "Bruch der organischen Kontinuität mit den Traditionen der früheren Generationen von Revolutionären, (der) das Gewicht der kleinbürgerlichen Reflexe und Verhaltensweisen gegen die Organisation bei vielen Elementen (erklärt), die sich auf den Marxismus und die Kommunistischen Linke berufen" (Punkt 12);
– "der Parasitismus (stellt) keine Fraktion der Bourgeoisie dar, da er weder ein Programm oder eine spezifische Orientierung für das nationale Kapital beinhaltet noch Einsitz in den staatlichen Organen zur Kontrolle des Arbeiterkampfes nimmt" (Punkt 18);
– doch wird "das Eindringen von Staatsagenten in parasitäre Bewegungen offensichtlich durch die Tatsache erleichtert, dass ihre Berufung die Bekämpfung der wirklichen proletarischen Organisationen ist" (Punkt 20).
Außerdem haben wir in den Schlussfolgerungen unserer Resolution, die BC kritisiert, sehr wohl über die Frage des Parasitismus gesprochen, und zwar wie folgt: "So wie die Abdankung der Arbeiterklasse gegenüber der Logik des Zerfalls sie der Fähigkeit beraubt, für eine Antwort auf die Krise zu sorgen, der sich die Menschheit gegenüber sieht, so riskiert die revolutionäre Minderheit ihre Zerstörung und Einebnung durch die verkommene Umwelt, von welcher sie umgeben ist und die ihre Reihen in Gestalt des Parasitismus, Opportunismus, Sektierertums und der theoretischen Konfusion penetriert." Wir fordern alle, die dies wollen, dazu auf, einen Zusammenhang zu finden zwischen dem, was BC schreibt, und dem, was die IKS über den Parasitismus sagt, einschließlich in denjenigen Passagen, die hier nicht zitiert worden sind. Aus unseren Texten, die öffentlich zugänglich sind (auch für das IBRP), geht klar hervor, dass für uns der politische Parasitismus entgegen der Polizeisichtweise, die uns BC betrügerisch unterstellt, überhaupt nicht eine Schöpfung der Bourgeoisie ist, sondern ein Ergebnis des Druckes der bürgerlichen Ideologie unter bestimmten historischen Umständen.
Aus dem ganzen Artikel von Prometeo geht umgekehrt hervor, dass BC ein armseliger Fälscher und darüber hinaus ein unermüdlicher Verleumder ist.
Ein bedauernswerter Geisteszustand
Das oben erwähnte Beispiel stellt eine Karikatur der Unehrlichkeit dar, die den ganzen Artikel von Prometeo prägt.
Das Frisieren der Texte "des Gegners"
Der Artikel von BC wirft unserer Resolution vor, dass sie in den Punkten 6 bis 9 "bedeutungslosen Sätze" enthalte, von denen der folgende "eine Perle" sei: "Das Aufgeben solcher Institutionen [UNO und NATO] des "internationalen Rechts" stellt einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung des Chaos in den internationalen Beziehungen dar". Das Problem liegt nicht in der Beurteilung dieses Satzes durch BC, sondern vielmehr in der Tatsache, dass er, aus dem Zusammenhang gerissen, den Eindruck erwecken kann, wir hätten die Einschätzung, dass die UNO die Rolle eines internationalen Schiedsrichters spielen, über den besonderen Interessen der einen oder anderen stehen und eine gewisse Weltordnung gewährleisten würde, so dass der Verlust ihres Einflusses ein Faktor des Chaos wäre. Dies ist aber überhaupt nicht unsere Position (und BC weiß dies ganz genau, so wie sie auch weiß, dass die IKS die UNO immer schon als "Bund von Räubern" betrachtete)[7], wie man feststellen kann, wenn man die beiden vorangehenden Sätze unserer Resolution liest, die aber von BC unterschlagen werden: "Diese Krise hat auf das Dahinscheiden nicht nur der NATO (deren Irrelevanz sich an ihrer Unfähigkeit zeigte, kurz vor dem Krieg in der Frage der "Verteidigung" der Türkei zu einer Übereinkunft zu kommen), sondern auch der UN aufmerksam gemacht. Die amerikanische Bourgeoisie betrachtet diese Institution zunehmen als Mittel ihrer Hauptrivalen und äußert offen, dass sie keine Rolle beim "Wiederaufbau" des Iraks spielen werde."
Die Kunst, mit den Worten so zu spielen, dass die Ansichten und Gedanken "des Gegners" durch den Dreck gezogen werden
Die Resolution der IKS, die BC kritisiert, kommt auf die Zerfallsperiode zurück: "… die Arbeiterklasse, deren Kämpfe in der Periode von 1969–1989 die Bourgeoisie daran gehindert hatten, ihre "Lösung" der Wirtschaftskrise durchzusetzen, (sah sich) nun immer mehr den Konsequenzen aus ihrem eigenen Scheitern gegenüber, ihre Kämpfe auf eine höhere, politische Stufe zu stellen und der Menschheit eine Alternative anzubieten. Die Zerfallsperiode, das Resultat dieses "Patts" zwischen den beiden Hauptklassen, bringt der ausgebeuteten Klasse keinerlei positiven Früchte ein. Obwohl die Kampfbereitschaft der Klasse auch in dieser Periode nicht ausgetilgt wurde und ein Prozess der unterirdischen Reifung des Bewusstseins immer noch konstatiert werden konnte, besonders in Gestalt "suchender Elemente", kleiner politisierter Minderheiten, trat der Klassenkampf überall den Rückzug an und tut dies noch heute. Die Arbeiterklasse sah sich in dieser Periode nicht nur mit ihren eigenen politischen Mängeln konfrontiert, sondern auch mit der Gefahr, ihre Klassenidentität unter dem Gewicht eines sich auflösenden Gesellschaftssystems zu verlieren." Diese Analyse der IKS wird unter der Feder von BC wie folgt zusammengefasst: "Der Zerfall (der Produktionsweise? der Gesellschaftsformation? pfff!) sei demnach die Folge des stabilen Gleichgewichts, das zwischen den Klassen, Proletariat und Bourgeoisie, erreicht worden sei." Wir hätten den zitierten Gedankengang etwas anders zusammengefasst, aber mit Rücksicht darauf, dass BC diese Frage nicht versteht, können wir ihr diese Unbeholfenheit nicht vorwerfen. Doch die Art und Weise, wie BC fortfährt, ist bezeichnend für ihre Methode, die mit dem Gebrauch des Begriffs "Verantwortung" spielt, um unserer Analyse einen ganz anderen Sinn zu geben, als wir ausgedrückt haben, so dass unsere Auffassung entstellt wird. "Insbesondere komme der proletarischen Klasse die Verantwortung [für den Zerfall] zu, die … sich als unfähig erwiesen habe, ihre Kämpfe auf ein höheres politisches Niveau zu heben." Es gibt in der Tat eine historische Verantwortung der Arbeiterklasse dafür, den Kapitalismus zu beseitigen, bevor dieser die Gesellschaft in eine Barbarei zieht, aus der es kein Zurück mehr gibt. Dem Proletariat kommt die Aufgabe zu, sich auf die Höhe seiner Verantwortung zu schwingen. Das haben die Revolutionäre seit der ersten weltweiten revolutionären Welle von 1917-23 immer wieder betont. Etwas ganz anderes ist es aber, uns die Idee zu unterstellen, dass die Arbeiterklasse für den Zerfall des Kapitalismus "verantwortlich" sei. Es ist eine billige Verleumdung, die es BC erlaubt (ohne irgendeine weitere Erklärung) zu folgern: "Seine eigene theoretische Unfähigkeit als Schwäche der Klasse auszugeben, ist ein Betrug auf tiefem Niveau und zahlt sich nicht aus."
Eine gewaltige Lüge
Wir haben gesehen, dass BC ständig die Positionen der IKS verdreht; oft sogar sehr grob, um sie lächerlich zu machen, abzuwerten und herabzusetzen. Aber bei den oben erwähnten Verfälschungen unserer Positionen kann man zusätzlich anführen, dass neben den offensichtlich unlauteren Absichten der Gruppe BC die kritisierten Positionen kaum kennt und sich herzlich wenig mit ihnen auseinandersetzt. Dies geht einher mit einer oberflächlichen politischen Vorgehensweise. Aber das trifft bei dem folgenden Beispiel nicht zu, welches den Propagandamethoden Goebbels würdig ist, der behauptete, "eine gewaltige Lüge bewirkt, dass die Zweifel beseitigt werden".
Der Artikel Prometeos kommt auf die Analyse der IKS zurück, was historisch auf dem Spiel stand, bevor die beiden Blöcke verschwanden. Solange der Kalte Krieg fortdauerte, war die Existenz zweier mit einander rivalisierender imperialistischer Blöcke eine Vorbedingung für den Ausbruch eines 3. Weltkriegs. Die einzige Hürde, die solch einen fatalen Ausgang für die Menschheit verhinderte, war eine Arbeiterklasse, die im Gegensatz zur Zeit vor den beiden Weltkriegen nicht von der Bourgeoisie geschlagen war. Während der Zeit des Kalten Krieges bekämpfte die IKS unaufhörlich die Illusionen, die von einigen revolutionären Gruppen, unter anderem von BC, vertreten wurden, und eine schwerwiegende Unterschätzung dessen widerspiegelten, was auf dem Spiel stand. Sie stimmten nämlich in den Chor derjenigen ein, die behaupteten, "die Bourgeoisie ist nicht selbstmörderisch, sie wird nie einen Atomkrieg auslösen". Damit wurde im Kern die bürgerliche These vom "Gleichgewicht des Schreckens" unterstützt. Heute leugnet BC nicht, was sie damals zu diesem Thema sagte: "Sicher blieb die von den Atomwaffen ausgehende Gefahr einer der Gründe für die Abschwächung der Spannungen, oder zumindest ein gewichtiger Grund für die Kommandozentralen des Imperialismus, andere Lösungen zu suchen" (‚Dekadenz, Zerfall, Ergebnisse der Verwirrung’). Darüber hinaus stellt BC auch fest, dass mit dem Verschwinden der Blöcke die IKS ihre Formulierung der historischen Alternative "Krieg oder Revolution" geändert hat, die nunmehr "Zerstörung der Menschheit oder Revolution" lauten muss, da die Zerstörung der Menschheit entweder durch einen Weltkrieg entstehen kann[8], falls sich zwei neue imperialistische Blöcke bilden und die Arbeiterklasse eine Niederlage erleidet, oder die Zunahme immer mehr zerstörerischer lokaler Kriege und Versinken des Kapitalismus im Chaos und Zerfall, bis eine Umkehr nicht mehr möglich ist. Während der Artikel von BC bis zu dieser Stelle unsere Positionen einigermaßen wahrheitsgetreu wiedergibt, wird BC plötzlich ausfällig, indem sie erfindet, was keine Erfindung des Jahrhunderts ist, aber alle bisherigen Entstellungen durch BC in den Schatten stellt: "… jetzt, urplötzlich, informiert uns die IKS, dass der einzige Grund, weshalb der Weltkrieg nicht ausgelöst wurde, darin liegt, dass ein Atomkrieg die Menschheit zerstört hätte". Da wir unseren Augen nicht glaubten, haben wir diesen Abschnitt immer wieder gelesen. Nicht nur steht davon überhaupt nichts in der Resolution der IKS; und auch in unseren früheren und seitdem verfassten Texten findet man keine Aussage dieser Art. Eine Verwechslung war jedoch auch nicht möglich, da während der Diskussionsveranstaltung in Paris am 2. Oktober 2004 die IKS dem IBRP folgende Frage in aller Öffentlichkeit gestellt hatte: "Verteidigt das IBRP heute noch seine Auffassung, derzufolge man sagen kann, wenn vor dem Zusammenbruch des Ostblocks kein Atomkrieg ausgebrochen ist, sei dies auf die Atombombe und das Gleichgewicht des Schreckens zurückzuführen?" In unserem Pressebericht über diese Diskussion ("Politische Leere und mangelnde Methode des IBRP" in Weltrevolution 127) wiesen wir auf folgenden Tatbestand hin: "Anfänglich wollte kein Mitglied des IBRP auf unsere Frage antworten. Und erst nachdem wir die Frage zum dritten Mal gestellt hatten, hat ein Genosse des IBRP die Güte gehabt uns sehr knapp zu antworten, ohne auch nur irgendein Argument zu liefern: Das Gleichgewicht des Schreckens sei ‚einer der Faktoren', der erklärt, weshalb die Bourgeoisie einen dritten Weltkrieg nicht auslösen konnte." Zum Zeitpunkt dieser öffentlichen Diskussionsveranstaltung, d.h. ungefähr zwei Monate vor der Veröffentlichung des Artikels in Prometeo musste BC wissen, dass wir eine tiefgreifende Divergenz mit ihm hinsichtlich dieser Frage hatten. Fazit: Abgesehen davon, dass es gegenüber der IKS bürgerliche Praktiken benutzt, macht sich BC offensichtlich über seine Leser lustig.
Die Flucht vor der erforderlichen Klärung
Der Verbreitung lügnerischer Verleumdungen gegen die IKS überführt, die es bereitwillig auf seiner Website gegen die IKS veröffentlicht hatte, hat das IBRP angefangen, die Spuren seiner Angriffe gegen die IKS heimlich zu verwischen, um die ganze Angelegenheit zu vertuschen[9]. Als die IKS es um Rechenschaft bat, schrie das IBRP auf, es werde angegriffen: Deshalb "werden wir vom heutigen Tag an weder auf ihre vulgären Angriffe antworten noch darauf reagieren" (aus "Letzte Antwort auf die Beschuldigungen der IKS")[10]. Um von dem sehr problematischen Verhalten der politischen Einstellung des IBRPs abzulenken, nimmt das Büro die politischen Divergenzen zwischen unseren Organisationen bei programmatischen Fragen und allgemeinen Analysen ins Visier. So geschehen in seinem Artikel in Prometeo "Dekadenz, Zerfall, Produkte der Verwirrung". Aber da es auch bei diesen Fragen unfähig ist, die wirklichen Divergenzen ehrlich auszutragen, ist es gezwungen, schlechte Taschenspielertricks anzuwenden, um nicht auf die wirklichen politischen Argumente der IKS zu antworten. Und um einer Situation vorzubeugen, wo es über die erneuten Regelverletzungen Rechenschaft ablegen müsste, lehnt es eine weitere Auseinandersetzung ab. Dies wird mit einem Dünkel gerechtfertigt, der nur mit seiner politischen Nichtigkeit verglichen werden kann: "Dies sind – und sie sind es wirklich – die theoretischen Grundlagen der IKS. Aus diesem Grunde haben wir beschlossen, keine Zeit, kein Papier und keine Tinte mehr damit zu verschwenden, um mit ihr zu diskutieren oder gar zu polemisieren. Die Gründe dürften klar sein."[11]
Gelingt es dem IBRP noch, sich selbst oder seine grenzenlosen Bewunderer zu täuschen? Ihnen gegenüber müsste das IBRP dann doch erklären, warum es nutzlos ist, mit der IKS aufgrund unserer theoretischen Grundlagen zu diskutieren, während es dem IBRP sehr wohl möglich ist, dies mit der "IFIKS" zu tun, gar mit ihr Kontakte aufrechtzuerhalten, die "fortbestehen und Bestand haben"[12], obgleich letztere behauptet, die wahre IKS mit den gleichen ‚theoretischen Grundlagen‘ zu verkörpern. Der größte Unterschied zwischen der IKS und der "IFIKS" ist, und dies lässt diese in den Augen des IBRPs[13] sicherlich attraktiver erscheinen, dass sie unsere Organisation verleumdet, und den Verdacht hegt, dass es Polizeiagenten in den Reihen der IKS gebe (eine typische Vorgehensweise polizeilicher Provokation), dass sie die IKS bestohlen hat, und Spitzeldienste geleistet hat, als sie schutzbedürftige Interna der Organisation veröffentlichte[14] und jüngst einem unserer Mitglieder drohte, ihm die Kehle durchzuschneiden[15].
Die angeborene Angst vor der politischen Auseinandersetzung
Das also ist der traurige Zustand, in dem sich heute ein Teil befindet, der aus der Italienischen Kommunistischen Linke hervorgegangen ist. Dabei hatte diese Strömung es während der 1930er Jahre inmitten der Konterrevolution geschafft, die Ehre des revolutionären Proletariats gegen den Verrat der KPs und den Niedergang des Trotzkismus zu verteidigen. Es stimmt, dass diese politische Gruppierung, die bei der Gründung des PCInt (Partito Comunista Internazionale) 1943 in Italien dabei war, sich schon sehr früh und gerade bei dieser Gelegenheit durch ihre opportunistische Öffnung gegenüber den Gruppen, die aus dem PSI (der Italienischen Sozialistischen Partei) und dem PCI (der Italienischen Kommunistischen Partei) stammen, hervorgetan hat, oder gegenüber Leuten, die zuvor mit dem programmatischen Rahmen der Italienischen Linken gebrochen hatten, um sich in konterrevolutionäre Abenteuer zu stürzen[16]. Die Französische Fraktion der Kommunistischen Linken (FFGC, die damals Internationalisme veröffentlichte), auf welche sich die IKS beruft, kritisierte damals diese Vorgehensweise, welche die programmatische und organisatorische Unnachgiebigkeit der Italienischen Kommunistischen Linken (GCI) der 1930er Jahre verwarf[17]. So schrieb die FFGC im November 1946 einen Brief (welcher in Internationalisme Nr. 16 im Dezember 1946 veröffentlicht wurde), und in dem sie eine Liste aller Fragen erstellte, die wegen Meinungsverschiedenheiten innerhalb der GCI[18] diskutiert werden sollten. Aber danach passierte genau das Gleiche, was zuvor eingetreten war. Genau so wie die GCI auf bürokratische Art und Weise aus der Komintern nach 1926 ausgeschlossen worden war, und wie sie wiederum aus der Linksopposition 1933 ausgeschlossen wurde, schloss nun die GCI die Französische Fraktion von den politischen Diskussionen in ihren Reihen aus, um der politischen Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen. Die seinerzeit für solche Maßnahmen angeführte ‚Rechtfertigung’ erinnert an die angeborenen üblen Absichten des IBRP: "Da (…) euer Brief erneut die ständige Deformierung der Tatsachen und der politischen Positionen erwähnt, die entweder von der PCI Italiens oder von den französischen und belgischen Fraktionen vertreten wurden (…), beschränken sich eure Aktivitäten darauf Verwirrung zu stiften und unsere Genossen zu beschmutzen. Deshalb haben wir einstimmig die Möglichkeit verworfen, dass wir eurer Bitte nach Beteiligung an der internationalen Versammlung der GCI stattgeben". Dieser Auszug des Briefes der PCInt wird in dem Artikel "Disziplin – Hauptstärke….", der im August 1947 in Internationalisme Nr. 25 erschien, zitiert[19]. Derselbe Artikel in Internationalisme 25 machte dazu folgenden Kommentar: "Man mag halten, was man will, von dem Geist, mit dem diese Antwort verfasst wurde, aber man muss festhalten, dass es mangels politischer Argumente diesem Brief nicht an bürokratischer Energie und Entscheidung fehlt".
Die gegenwärtig von BC gegenüber uns praktizierte Methode ist also seitens dieser Organisation nichts Neues, auch wenn sie sich aufgrund unterschiedlicher Umstände heute anders äußert. Heute steht nicht die Frage unseres Ausschlusses auf der Tagesordnung, da wir keiner gemeinsamen Organisation angehören. Was unsere gegenwärtige "Disqualifizierung" gegenüber einem ganzen Milieu von Sympathisanten mit den Positionen der Kommunistischen Linken betrifft, erscheint dies deutlich als ein Ziel von BC, da sie ein Konkurrenz- und sektiererisches Denken hinsichtlich der Beziehungen unter kommunistischen Gruppen hat. Aber um ihr Ziel zu erreichen, womit sie der offenen und loyalen Auseinandersetzung ausweicht, ergreift sie die Flucht und benützt unloyale Methoden wie Verleumdungen, indem sie mit Verachtung erklärt, sie werde gegenüber den Argumenten des Gegners nicht mehr antworten.
Das IBRP krankt an seinen organisatorischen Auffassungen und Praktiken
Die Verachtung und Geringschätzung, mit der die GCI seinerzeit diese kleine von der FFGC gebildete Minderheit behandelte, welche die opportunistische Gründung der PCInt kritisiert hatte, stützte sich auf eine falsche Legitimation hinsichtlich des damals bestehenden Zahlenverhältnisses zwischen der GCI und ihren Mitgliedsgruppen in Italien (der Partei gehörten bei ihrer Gründung mehrere Tausend Mitglieder an), Belgien und Frankreich, und andererseits der zahlenmäßig sehr begrenzten und nur in Frankreich bestehenden Gruppe der kleinen FFGC. Mit der gleichen Arroganz behandelt das IBRP heute noch die IKS, aber hinzu kommt nun die Lächerlichkeit. Auch wenn die IKS sich trotz der Tatsache, dass wir in 13 Ländern bestehen, bewusst ist, dass wir noch eine kleine revolutionäre Organisation sind, ist sich das IBRP offensichtlich noch nicht darüber im klaren, dass es selbst eine winzig kleine Organisation ist. BC mag wohl versuchen sich zu trösten, indem sie ihre Träume und das Gerede der "IFIKS" für bare Münze nimmt und immer wieder versichert, dass die IKS "von einer tiefgreifenden und unumkehrbaren internen Krise erschüttert ist", aber an der Wirklichkeit der IKS ändert das nichts. Die IKS erfüllt nämlich ihre Verantwortung der Analyse der Lage, der Intervention in der Arbeiterklasse, der regelmäßigen Herausgabe der Presse, und wir sind fähig, auf das wachsende Interesse für revolutionäre Politik zu reagieren, das man heute in der jungen Generation spürt, … und wir finden gar die Zeit, um uns gegen Angriffe zur Wehr zu setzen, die das Bündnis des IBRP und der Parasiten gegen uns richtet. Es stimmt, dass man mehr von den Krisen der IKS als von denen des IBRP redet. Und das aus gutem Grund! Nicht nur verbirgt die IKS diese Krisen nicht, sondern wir legen auch deren Ursachen und die gegenüber der Arbeiterklasse daraus zu ziehenden Lehren in der Öffentlichkeit dar. Darüber hinaus mussten - wie wir schon in unserer Antwort auf das IBRP (siehe unseren Artikel "Diebstahl und Verleumdungen sind keine Methoden der Arbeiterklasse", der im Internet veröffentlicht wurde) dargelegt haben - alle lebendigen Organisationen der Arbeiterbewegung (insbesondere die IAA und die SDAPR) einen langen Verteidigungskampf in ihren Reihen gegen diejenigen politische Auffassungen und Verhaltensweisen führen, die dem Proletariat fremd sind[20]. Es stimmt, dass das IBPR nicht sehr gesprächig ist hinsichtlich dieser Fragen, die in seinem politischen Leben auftauchen können. Aber man entdeckt die in dieser Organisation vorhandenen völlig falschen Auffassungen anhand eines Satzes. Um den Diebstahl der Adressendatei unserer Abonnenten durch ein Mitglied unserer Organisation zu rechtfertigen, welches sich später an der Gründung der "IFIKS" beteiligte, äußerte sich das IBRP folgendermaßen: "Wenn führende Genossen der IKS, - welche als solche über die Adressendateien ihrer Organisation verfügen – mit der Organisation brechen, und erklären, dass sie Genossen für ihren ‚richtigen Weg’ gewinnen wollen, und dabei die Adressendateien behalten, handelt es sich nicht um einen Diebstahl. Die falsche Moral der IKS stinkt nach Heuchelei, wenn sie alle möglichen Beschuldigungen gegen diejenigen richtet, die mit ihr brechen" (auf der Website des IBRP veröffentlichte Stellungnahme). Wir haben schon gezeigt (siehe "Diebstahl und Verleumdungen sind keine Methode der Arbeiterklasse), weshalb diese Rechtfertigung des Diebstahls der Werkzeuge einer Organisation, die dieser insgesamt und nicht den einzelnen ihr angehörenden Mitgliedern gehören, nicht hinnehmbar ist. Wir haben bei der Gelegenheit schon darauf hingewiesen, wenn man von einer "Organisation mit ihren Führern an ihrer Spitze" redet, dies sich auf eine Organisationsauffassung bezieht, die wir nicht teilen. Es gab und gibt in der Arbeiterbewegung Organisationsauffassungen, die insbesondere von der bordigistischen Strömung (dem Vetter des IBRPs) vertreten wird, welche innerhalb der Organisation von Führern und der Basis der Mitglieder sprechen[21]. Solche Auffassungen sind Konzessionen gegenüber einer hierarchischen und bürgerlichen Organisationsauffassung. Im Gegensatz zu dieser Auffassung kann die Partei wie jede revolutionäre Organisation ihre Funktion nur dann erfüllen, wenn sie ein Ort der kollektiven Ausarbeitung der politischen Orientierungen ist, an der sich alle Mitglieder beteiligen. Dies beinhaltet notwendigerweise die größtmögliche offene und breite Diskussion, genauso wie in der Arbeiterklasse insgesamt, deren Befreiung von dem bewussten und kollektiven Werk der ganzen Arbeiterklasse abhängt.
Wir sind noch nicht auf diese Auffassung des IBRPs eingegangen, die den ‚führenden Mitgliedern’ besondere Vorrechte einräumt; in diesem Fall den Diebstahl, der nicht verurteilt wird. Diese Auffassung spiegelt eine hierarchische Auffassung der Organisation wider. Man ist geneigt, diese Auffassung zurückzuführen nicht auf den Einfluss der bürgerlichen Ideologie, sondern auf den der feudalen Ideologie. Diese Erleuchtungen des IBPRs verweisen auf das Recht im Mittelalter, als die Adligen das Privileg besaßen, bei der Jagd oder im Krieg die Ernten der Bauern zu vernichten, und die zu ihrem eigenen Vergnügen das Recht der ersten Nacht besaßen.
Wenn sich heute im Wesentlichen die Geschichte von BC wiederholt, wäre es dennoch ein Fehler daraus abzuleiten, dass diese Organisation eigentlich die gleiche geblieben ist. Denn die Wiederholung opportunistischer Praktiken beeinflusst die Dynamik einer Organisation, insbesondere wenn diese verschlossen ist gegenüber jeder Kritik und jede kritische Infragestellung ablehnt. Die wiederholten Flirts des IBRPs mit den Gruppen, die den Positionen und den Methoden des Proletariats zuwiderhandeln, insbesondere der jüngste Flirt mit dem Pack der "IFIKS", haben dazu geführt, dass das IBRP bürgerliche Methoden übernimmt.
In diesem und dem vorhergehenden Text haben wird gezeigt, dass unsere Kritiken am IBRP vollkommen gerechtfertigt sind, und dass die Beschuldigung dieser Organisation uns gegenüber auf Sand gebaut sind. Wir erwarten weiterhin vom IBRP (und wir werden nicht locker lassen), dass es das belegt, was es behauptet, und wenn es sich weiterhin in Schweigen hüllt, dann beweist das nur, dass es nichts zu antworten weiß. IKS
[1]Das Internationale Büro für die Revolutionäre Partei (IBRP - www.ibrp.org [11]), gegründet vom Partito Comunista Internazionalista - Battaglia Comunista (BC) und der Communist Workers' Organisation (CWO) in England, beruft sich auf die Tradition der Kommunistischen Linken Italiens.
[2]Prometeo ist die theoretische Zeitschrift von Battaglia Comunista.
[3]Wir laden unsere Leser dazu ein, auf unserer Website die Dokumente zu dieser Angelegenheit zu lesen, insbesondere den letzten Brief an sie: den "Offenen Brief an die Militanten des IBRP" vom 7. Dezember 2004.
[4]Was für die Sozialdemokratie zutraf, als sie noch eine Organisation der Arbeiterklasse war, gilt gleichermaßen für alle Organisationen der Arbeiterbewegung, wie groß auch immer ihr Einfluss innerhalb der Arbeiterklasse sein mag, und gilt auch noch heute voll und ganz für die kleinen Organisationen, die auf der Ebene der programmatischen Positionen dem Kampf des Proletariat für seine Befreiung treu geblieben sind.
[5]Tatsächlich bezieht sich ja der Artikel von BC auf ein Dokument der IKS, das bald zwei Jahre als ist. Wir stehen nach wie vor ganz und gar zu seinem Inhalt, möchten aber anmerken, dass wir zwar vor kürzerer Zeit, aber doch vor der Publikation dieses Artikels von BC, Texte zur Polemik mit dem IBRP veröffentlicht haben, die genau die zentralen Fragen zum Gegenstand haben, um die es Prometeo geht. Es handelt sich um die beiden Teile des Artikels "Battaglia Comunista gibt die marxistische Auffassung über die Dekadenz auf", der in den Nrn. 119 und 120 der International Review (engl./frz./span. Ausgabe) erschienen ist (der erste Teil des Artikels wird in der Internationalen Revue Nr. 35 auf Deutsch erscheinen), und um den Artikel "Politische Leere und mangelnde Methode des IBRP" in Weltrevolution Nr. 127, der über die öffentliche Veranstaltung des IBRP vom 2. Oktober 2004 in Paris berichtet. Diese Texte blieben bis jetzt unbeantwortet. Möglicherweise beantwortet sie das IBRP wieder zwei Jahre später, wenn es ihm gelingt, ein bisschen seiner kostbaren Zeit dafür frei zu machen.
[6]"Die marxistische und die opportunistische Sichtweise beim Aufbau der Partei" in Nr. 103 und 105 der International Review (engl./frz./span. Ausgabe)
[7]Wie schon Lenin den Völkerbund bezeichnete (den Vorläufer der UNO), vgl. Lenin Werke Bd. 31 S. 314 f., Rede vom 15.10.1920
[8]Die IKS hat aber nicht auf den Zusammenbruch des Ostblocks gewartet, um aufzuzeigen, dass ein dritter Weltkrieg die Auslöschung der Menschheit bedeuten würde, oder zumindest einen Rückfall der Zivilisation um Tausende von Jahren.
[9]Falls das IBRP völlig an Gedächtnisstörungen hinsichtlich einige Phasen seiner Vergangenheit leiden sollte, haben wir schriftliche Kopien der Texte gemacht, die es von seiner Website hat verschwinden lassen.
[10]Das IBRP beklagt sich wegen der Vulgarität der IKS ihm gegenüber. Es stimmt, dass wir einige seiner Verhaltensweisen hart kritisieren, manchmal auch mit Ironie. Dies verdienen sie, und manchmal ist es unmöglich die Dinge nicht beim Namen zu nennen. Aber dem IBRP steht es nicht zu, sich zu beschweren, vor allem weil es weniger kleinlich und empfindlich ist, wenn die "IFIKS", aufgepeitscht durch die Beschuldigungen des Abenteurers Herrn B. gegen die IKS, uns in ihrem Bulletin als "Schweine" bezeichnet.
[11]Wir wollen aber festhalten, dass das IBRP gar nicht kleinlich war, als es darum ging, die Verleumdungen des Herrn B. gegen die IKS möglichst weit zu verbreiten, und es fand Zeit und Mittel, um dessen Texte in verschiedene Sprache zu übersetzen und sie auf seine Website zu stellen.
[12]"Antwort auf die stupiden Beschuldigungen einer auseinanderbrechenden Organisation" – von dem IBRP im Internet veröffentlichter Text
[13]Die "IFIKS" stellt auch einen Köder für das IBRP dar, da es sich vorstellt, dadurch ein Mittel zu seiner zahlenmäßigen Verstärkung in Frankreich und, wer weiß, auch in Mexiko zu finden. Mit anderen Worten, es spielen auch Aspekte der Rekrutierungsversuche gegenüber denjenigen eine Rolle, die sich auf der einen Seite als die wahre IKS darstellen und gleichzeitig "mit kritischer Aufmerksamkeit die Positionen des IBRP studieren" (Letzte Antwort auf die stupiden Beschuldigungen der IKS"). Wenn das IBRP entschieden hat, nicht kleinlich zu sein gegenüber dem Wesen der rekrutierten Leute, betrachtet die IKS es um so mehr als ihre Aufgabe, das IBRP erneut davor zu warnen.
[14]Siehe dazu unseren Artikel "Die Polizeimethoden der "IFIKS"" in Weltrevolution Nr. 117.
[15]Siehe dazu unseren Artikel "Todesdrohungen gegen Mitglieder der IKS" in Weltrevolution Nr. 129
[16]Siehe unseren Artikel "Battaglia Comunista zu den Ursprüngen der Internationalistischen Kommunistischen Partei" in International Review Nr. 34 (engl. Ausgabe) und "Die Internationale Kommunistische Partei (Kommunistisches Programm) bis zu ihren Wurzeln, was sie zu sein behauptet und was sie ist" (International Review Nr. 32 – engl. Ausgabe).
[17]Siehe unser Buch "Die Kommunistische Linke Italiens" (auf Deutsch auszugsweise als Broschüre erhältlich)
[18]Damit man sich von der Ernsthaftigkeit überzeugt, mit der diese Divergenzen und Kritiken ausgeführt wurden, raten wir unseren Lesern die Liste in unserer Broschüre "La Gauche Communiste de France (GCF)" nachzulesen.
[19]Ein Artikel, der unter dem gleichen Namen in unserer International Review Nr. 34 (engl. Ausgabe) veröffentlicht wurde.
[20]Auch bei Kämpfen in ihren Reihen haben sie Leute mit einer oft langen und bewundernswerten militanten Vergangenheit verloren, die in der einen oder anderen Form die Sache des Proletariats verraten haben.
[21]Solche Auffassungen wurden schon von der FFGC bekämpft; insbesondere in ihrer Kritik der "Auffassung vom genialen Führer" (derzufolge nur besondere Persönlichkeiten – die genialen Führer – die Fähigkeit besitzen, die revolutionäre Theorie zu vertiefen, um sie zu verbreiten und sie ‚entsprechend aufbereitet’ den Mitgliedern der Organisation weiterzuvermitteln) und in derjenigen der "Disziplin als Hauptstärke…"(die die Mitglieder der Organisation als einfache Ausführende auffasst, die nicht über die politischen Orientierungen der Organisation diskutieren sollen) in Internationalisme Nr. 25. Diese Auffassungen waren auch von Lenin bekämpft worden, als er schrieb: "Es ist die Aufgabe eines jeden kommunistischen Militanten, selbst das zu überprüfen, was die führenden Instanzen der Partei beschlossen haben. Derjenige, der in der Politik aufs Wort glaubt, ist ein unverbesserlicher Idiot" (zit. in Internationalisme Nr. 25).
November 2004
- 931 reads
Antwort an das IBRP (2004)
- 1296 reads
In seiner “Antwort auf die dummen Anschuldigungen einer in Auflösung begriffenen Organisation”, veröffentlicht auf seiner Internetsite, legt das IBRP einen zusätzlichen schwerwiegenden Schritt in seiner opportunistischen Abgleitung zurück, die wir bereits in unserem Artikel “Das IBRP als Geisel von Dieben“ offengelegt haben: Es rechtfertigt nun die antiproletarischen Sitten einer parasitären Gruppe, die sich selbst “Interne Fraktion der IKS” nennt.
Diebstahl und Verleumdung sind keine Methoden der Arbeiterklasse
In seiner “Antwort auf die dummen Anschuldigungen einer in Auflösung begriffenen Organisation”, veröffentlicht auf seiner Internetsite, legt das IBRP[1] einen zusätzlichen schwerwiegenden Schritt in seiner opportunistischen Abgleitung zurück, die wir bereits in unserem Artikel “Das IBRP als Geisel von Dieben“ offengelegt haben: Es rechtfertigt nun die antiproletarischen Sitten einer parasitären Gruppe, die sich selbst “Interne Fraktion der IKS” nennt.
Diese “Antwort” des IBRP beginnt mit einer Kritik an dem “extrem tiefen Niveau” unseres Artikels, in dem wir die angebliche “Interne Fraktion der IKS” (FICCI) als eine Bande von “Dieben” denunziert haben.
Wenn das IBRP eine aufgeschreckte Jungfrau[2] spielt, so tut es dies keineswegs, weil es etwa selbst distinguiertere, mehr gentleman-like Verhaltensweisen hätte, sondern einzig weil es die Methoden der FICCI gutheißt. Und gerade deshalb hat das IBRP auch nichts weder auf das tiefe Niveau des Textes der FICCI mit dem Titel “Die Schande hat keine Grenze” noch auf das „extrem tiefe Niveau“ der Methoden dieser kleinen Diebe erwidert, die mit einem Aufruf zum Pogrom gegen unsere angeblichen „Schweinereien“ und gegen unsere als “gemeine Kerle” bezeichneten Militanten nicht den geringsten Skrupel kennen.[3]
So zielt also die “Antwort” des IBRP auf die “dummen Anschuldigungen” der IKS in erster Linie darauf ab, den Diebstahl unserer Adresskartei durch ein Mitglied der FICCI mit folgenden Argumenten reinzuwaschen: “Wenn führende Genossen der IKS – die als solche auch über die Adresskartei ihrer Organisation verfügten - mit der Organisation brechen und des weiteren erklären, dass sie die Genossen wieder für den ‚rechten Weg’ gewinnen wollen, die Adresskartei behalten, so handelt es sich nicht um Diebstahl. Der falsche Moralismus der IKS stinkt vor Heuchelei, wenn sie alle nur möglichen Anschuldigungen gegen Abtrünnige richtet.”
Das Komplizentum des IBRP beim Diebstahl von Material der IKS Dieser Rechtfertigungsversuch der Gangstersitten der FICCI zwingt uns zu einigen Bemerkungen:
1) Unsere Adresskartei gehört ebenso wie das Geld und alles andere politische Material der Organisation als Ganzes und nicht den einzelnen Individuen, aus denen sie zusammengesetzt ist. Das ist ein elementares Funktionsprinzip aller revolutionären Organisationen. Und das IBRP weiß dies sehr wohl! Aus diesem Grund lehnt es eine Antwort auf unseren Brief vom 1.10.2004 ab, in dem wir u.a. folgende Fragen stellen:
- Wie gelangte die Einladung des IBRP zu seiner öffentlichen Veranstaltung vom 2. Oktober in Paris in die Briefkästen unserer Abonnenten, die ihre Adresse nur der IKS gegeben hatten?
- “Wie hätte das IBRP reagiert, wenn die IKS die gleiche Haltung eingenommen hätte, wenn sie also ein ehemaliges Mitglied des IBRP beim Diebstahl der Adresskartei unterstützt hätte” dadurch, dass sie den Gebrauch “für die Einladung seiner Abonnenten für unsere öffentliche Veranstaltung” akzeptiert hätte? (Aus dem Brief der IKS an das IBRP)
2) Im Fall dass das IBRP mit dem Prinzip, dass dieses Material der Organisation und nicht einzelnen Individuen gehört, nicht einverstanden wäre, würde das also heißen, dass ein mit der Kasse betrauter Militanter unter dem Vorwand, die politische Arbeit fortzusetzen, ruhig mit dem Geld von dannen ziehen könnte, wenn er ausgeschlossen oder er mit der Organisation brechen würde. Das ist eine anarchistische oder eine lumpenproletarische Sichtweise, aber keine einer proletarischen Organisation.
Wir erinnern das IBRP daran, dass die Diebesbande der FICCI sich nicht damit zufrieden gab, unsere Adresskartei zu stehlen. Sie hat auch Geld der IKS gestohlen. Sie hat Gelder der IKS unterschlagen, indem sie sich weigerte, die Kosten für Flugtickets der zwei Delegierten unserer mexikanischen Sektion für die Reise nach Paris rückzuerstatten: Die beiden Delegierten sind auf dem Flughafen Roissy von den Dieben der FICCI gekidnappt und daran gehindert worden, an unserer ausserordentlichen Konferenz im April 2002 teilzunehmen (siehe unseren Artikel in Révolution Internationale 323, Mai 2002).
Nach der Lektüre der Argumente des IBRP zur Rechtfertigung des Diebstahls unseres politischen Materials nehmen wir das Recht in Anspruch, eine Frage zu stellen: Hat das IBRP auch die Miete für den Raum der öffentlichen Veranstaltung vom 2. Oktober in Paris mit dem der IKS gestohlenen Geld bezahlt (da ja das IBRP diese Versammlung mit der materiellen Unterstützung der FICCI organisiert hat)?
3) Die Konzeption des IBRP, wonach die “führenden Genossen” alles ihnen anvertraute Material mitnehmen dürfen, weil es ihnen nicht gelungen sei, die Militanten von der Gültigkeit ihrer Positionen zu überzeugen, ist der Arbeiterbewegung vollständig fremd. Diese Politik trägt einen Namen: es handelt sich um die zerstörerische Politik der verbrannten Erde. Weil es einem nicht gelingt, seine Positionen durchzusetzen, plündert man die Organisation; man eignet sich ihr politisches Material an, um ihre Aktivitäten zu sabotieren.[4]
Diese Diebessitten hat die IKS schon anlässlich der “Affaire Chénier” im Jahr 1981 öffentlich verurteilt. Damals wiesen die beiden Organisationen, die dann das IBRP bilden sollten (Battaglia Comunista und Communist Workers’ Organisation) noch ein Mindestmass an Würde auf: Sie haben damals weder mit der Hilfe des Bürgers Chénier noch mit derjenigen der parasitären Gruppe CBG gestohlen. Damals haben sie nicht lauthals über das “extrem tiefe Niveau” der IKS gelästert, als wir die Sitten dieser kleinen Diebe mit folgenden Worten verurteilt hatten: “Diese Genossen (von der ehemaligen Sektion der IKS in Aberdeen) hatten während Monaten Kenntnis von den Manövern Chéniers und sie haben den Diebstahl als, im Fall einer Spaltung „normal“ bezeichnet. Unsere Verurteilung dieser Praktiken wurde als ‚Reaktion von besitzenden Kleinbürgern’ bezeichnet (...) In den ersten Nummern von ‚The Bulletin’ übernahm die CBG die Verantwortung für dieses Verhalten, indem sie sich wälzte im Verbreiten von dummem Geschwätz gegen die IKS (...). Wenn man sich abspaltet, darf man stehlen, was man will, wenn man jedoch endlich eine eigene Gruppe hat, der eigene Herr ist, bringt die Thronbesteigung des Besitzes die kleinen Gangster zur Vernunft (...). Welche Positionen hat die CBG? Wir haben es mit einer neuen parasitären Gruppe zu tun. Was stellt sie für das Proletariat dar? Eine provinzielle Version der Plattform der IKS mit weniger Kohärenz und mehr Diebstahl.” (Revue Internationale Nr. 36, Antwort auf die Antworten).Was wir also vor 20 Jahren über die Diebesmethoden des CBG schrieben, lässt sich perfekt auf die FICCI anwenden.
Es dürfte klar sein, dass die IKS nicht auf die Wiederaneignung des durch die FICCI gestohlenen Geldes verzichtet.[5] Sie wird in einem geeigneten Augenblick dieselbe Politik anwenden wie vor 20 Jahren, als wir das von einigen Elementen der Tendenz Chénier, hauptsächlich von solchen die die CBG bildeten, gestohlene Geld zurückholten.[6]
4) Gerade weil es sich um eine elementare Funktionsregel der proletarischen Organisationen handelt, schreiben unsere Statuten auch vor, dass jeder Militante, der die Organisation verlässt (sei es aus eigenem Antrieb oder wegen eines Ausschlusses), alles Material, das ihm zur Ausführung seiner Aufgaben anvertraut worden ist, der IKS zurückerstatten muss: “Der Militante nimmt keine persönliche ‚Investition’ in die Organisation vor , von der er Dividenden erwarten oder die er bei einem Austritt wieder zurück ziehen könnte. All diese Praktiken der Aneignung von Material oder Ersparnissen der Organisation müssen als dem Proletariat vollständig fremd geächtet werden, auch wenn damit eine andere politische Gruppe gegründet werden sollte.” (Bericht über die Struktur und Funktionsweise der revolutionären Organisation, in: Revue Internationale, Nr. 33, franz., engl., span.). Die Mitglieder der FICCI wissen ganz genau, dass sie mit der Aneignung unserer Adresskartei (und mit dem Diebstahl von Geld der Organisation) solche “dem Proletariat vollständig fremde” Praktiken angewendet haben. Sie haben unsere Statuten verhöhnt und haben so mit der IKS gebrochen, indem sie sich selbst außerhalb der Organisation stellten, bevor sie überhaupt ausgeschlossen wurden.
Deshalb haben sie sich u.a. geweigert, sich an eine Ehrenjury zu wenden, wie es ihnen die IKS zweimal vorgeschlagen hatte. Sie erklärten schlicht, dass unsere Anschuldigungen gegen ihr Verhalten Lügen seien (siehe unseren Artikel dazu auf der französischen Website: Le jury d’honneur: arme de défense des militants et des organisations communistes).
5) Das IBRP gibt noch ein anderes Argument zur Rechtfertigung des Diebstahls: Weil sie “führende Genossen” gewesen seien, sei es ihnen “als solche” erlaubt, das der Organisation gehörende Material mit sich zu nehmen. Die “Führer” hätten also Rechte und Privilegien, die den “Militanten an der Basis” vorenthalten seien! Diese elitäre und bürokratische Konzeption findet man in bürgerlichen (und hauptsächlich stalinistischen) Organisationen, aber nicht in Organisationen der Arbeiterklasse!
Wir bringen hier klar zum Ausdruck, dass die IKS die Auffassung des IBRP nicht teilt, dass die Organisation eine Pyramidenstruktur mit “Führern” besitzt, sondern dass sie Mitglieder der “Zentralorgane” hat. Und die IKS hat einem gegenwärtigen Mitglied der FICCI die Adresskartei nicht “als solchem” (d.h. als “führendem” Mitglied) anvertraut, sondern als einer mit der Aufgabe der Versendung unserer Publikationen an unsere Abonnenten betrauten Militanten. Wenn wir diesem vom IBRP so bezeichneten “führenden Genossen” (was bei den Militanten der IKS einen Lacher auslöste!) die bedeutende Verantwortung für diese Aufgabe anvertrauten, so einzig weil sie sie sehr gut wahrnahm.[7]
Hinter den in dieser “Antwort” enthaltenen Argumenten gegen “unsere dummen Anschuldigungen” entdecken wir die Komplizenschaft des IBRP bei diesem Diebstahl. Das IBRP sagt uns eigentlich, dass die FICCI das Recht hatte, die Adresskartei zu behalten, um “die Genossen für den richtigen Weg zu gewinnen”.[8] Dieses Argument zielt nicht nur darauf ab, das unwürdige Verhalten der FICCI reinzuwaschen, sondern auch darauf, die hinterrücks seit zwei Jahren begangenen Sabotage- und Destabilisierungsversuche des IBRP gegenüber der IKS zu rechtfertigen.
Im Bulletin Nr. 9 der FICCI können unsere Leser die Manöver des IBRP entdecken, die daraus bestehen, diese Diebesbande zu ermutigen, die Angriffe gegen unsere Zentralorgane und gegen unsere Militanten fortzusetzen, um ein Maximum an Genossen für ... “den richtigen Weg” zu gewinnen! Wir fordern unsere Leser dazu auf, die “Zusammenfassung der Sitzung vom 17/03/02 zwischen der FICCI und dem BIPR” (im Bulletin Nr. 9 auf der Website der FICCI) zu konsultieren. Man findet hier die den Diebstahl unserer Adresskartei rechtfertigenden “Argumente”: Es hätte sich darum gehandelt, dass die FICCI (mit dem Segen des IBRP) mit ihrer Ekel erregenden Prosa an die IKS “den Militanten der IKS, die sich, wie wir meinen, in einer Dynamik des unhinterfragten hinter den ZO`s (Zentralorgane) Nachfolgens befinden, die Augen öffnet ... Das IBRP hat diese Orientierung in folgenden Worten gutgeheißen: “Ihr müsst Euren Kampf gegen das gegenwärtige Abdriften und für die Wiederaufrichtung der organisatorischen und politischen Errungenschaften der IKS fortsetzen.”
So erfahren wir auch, dass das IBRP die FICCI nicht nur zu ihrer dreckigen Arbeit ermutigte (daraus bestehend, die Briefkästen unserer Militanten und Abonnenten mit Verleumdungen zu füllen), sondern sie darüber hinaus auch noch “für die Wiederherstellung der organisatorischen und politischen Errungenschaften der IKS” unterstützte! Unsere Leser können sich selbst eine Vorstellung von der Hinterhältigkeit und von der unglaublichen (aber wahren!) Doppelzüngigkeit des IBRP machen: Einerseits gibt es scheinheilig vor, die “politischen und organisatorischen Errungenschaften” der IKS zu verteidigen, anderseits unterstreicht es (in seiner “Antwort” auf unsere “dummen Beschuldigungen”), dass es die FICCI “überzeugen” wolle, dass die “eigentlichen Schwächen” der IKS “in den methodologischen Grundfragen, die uns (das IBRP) schon immer von der IKS trennt”, liegen würden.
Und diese Scheinheiligkeit erreichte einen Höhepunkt, als das IBRP zur gleichen Zeit, als es die FICCI in ihrem Kampf gegen unsere angebliche “liquidatorische Führung” (so die FICCI) unterstützte, schrieb: “Es ist nicht an uns, bezüglich der organisatorischen/disziplinarischen Streitereien der IKS Recht oder Unrecht zu sprechen”! (siehe den Text des IBRP vom Februar 2002 veröffentlicht in verschiedenen Sprachen auf ihrer Homepage: Reflexionen über die Krisen in der IKS).
Man versteht viel besser, weshalb das IBRP den Diebstahl unserer Adresskartei nicht verurteilen konnte. Es war ganz einfach daran interessiert, die FICCI (und ihre hinterhältigen Methoden) nicht nur zur Rekrutierung für das eigene Geschäft, sondern auch zur Aussaat von Schwierigkeiten in der IKS zu benutzen.
Es ist klar, dass es nicht (wie das IBRP vorgibt) der “falsche Moralismus der IKS” ist, sondern die Abwendung des IBRP von jeder proletarischen Moral, die “vor Scheinheiligkeit stinkt”!
Und wir wiederholen gegenüber dem IBRP einmal mehr (auch wenn wir ihr Schamgefühl eines Erstkommunikanten nochmals schocken): wenn man es mit einer Hure treibt, muss man sich nicht wundern, wenn man den Tripper einfängt.
Im Punkt 2 ihrer “Antwort” auf unsere “dummen Anschuldigungen” unterstreicht das IBRP immer noch in Bezug auf den Diebstahl unserer Adresskartei, die zur Versendung der Einladung zu seiner öffentlichen Veranstaltung vom 2. Oktober diente: “Wir müssen weder gegenüber der IKS noch gegenüber sonst jemandem Rechenschaft über unsere politische Handlungsweise ablegen”, und das IBRP stigmatisiert “den Anspruch der IKS, die angeblichen Traditionen der Kommunistischen Linken wieder zu beleben” als “pathetisch”.
Was uns “pathetisch” erscheint, das ist viel eher, dass das IBRP, dadurch dass es sich zum Komplizen der FICCI machte, sein Recht als Ältester für einen Teller Linsen verkaufte. Deshalb ist es dabei, nicht nur die Tradition der Kommunistischen Linken, sondern auch die elementaren Prinzipien der Arbeiterbewegung zum Fenster hinaus zu werfen und das Gesetz des Dschungels einzuführen!
Auf die von unseren Abonnenten gestellte Frage, wie das IBRP in den Besitz ihrer Adressen gekommen sei, antwortete es folgendermaßen: Man solle Leine ziehen, das IBRP muss niemandem über seine “politische Verhaltensweise” Rechenschaft ablegen!
Meinen die “Führer” des IBRP, dass sie auch nicht den Militanten der eigenen Organisation Rechenschaft ablegen müssten (die nicht an dieser öffentlichen Veranstaltung teilgenommen haben oder die davon überrascht waren, dass die Einladung des IBRP an Personen verschickt worden ist, von denen sie die Adressen gar nicht besaßen)? Ist diese “politische Verhaltensweise” im Einklang mit den Statuten des IBRP oder folgen die Militanten der (vollständig unverantwortlichen) Politik ihrer “Führer” blind ... “ohne sich Fragen zu stellen”?
Das IBRP und die FICCI: Vereint durch dick und dünn! Im ersten Punkt seiner „Antwort“ auf unsere „dummen Anschuldigungen“ beginnt das IBRP mit der Feststellung dass seine Kontakte mit der FICCI „existieren und andauern“. Dies mit folgendem Argument: „Wir wollen verhindern, dass die rätselhafte Spaltung der IKS mit dem Austritt der Führer der „alten Garde“ nicht zur Geburt einer neuen abtrünnigen Gruppe der IKS führt, welche sich als orthodox bezeichnet“.
Dies ist eine wahrhaft gute Absicht des IBRP (und wir sind wirklich berührt von dieser Fürsorge!). Doch wir wissen, dass der weg zur Hölle mit vielen guten Vorsätzen gepflastert ist. Das IBRP will uns also glauben machen, sich gegen das Auftauchen einer neuen parasitären Gruppe einzusetzen (auch wenn sie dies so nicht anerkennen muss man die Dinge beim Namen nennen!), wenn es versucht, die Mitglieder der FICCI von den programmatischen Positionen der IKS abzubringen.[9] In Wirklichkeit diskutieren sie mit den Mitgliedern der FICCI um sie zu rekrutieren.
Wir sehen nicht ein, weshalb es notwendig wäre solche Verrenkungen zu machen um sich von seiner „guten Seite“ zu zeigen. Das IBRP verfügt nicht mehr über die geringste Würde: es beschränkt sich heute darauf... den Müllhaufen der IKS zu spielen!
Unsererseits können wir das IBRP nur beruhigen: unser Ziel ist mit Nichten seine Anstrengungen für eine „Umgruppierung“ zu sabotieren (wie es die FICCI und ihr Zwillingsbruder, der „Circulo“ in Argentinien in die Welt hinausschreien). Würden wir einen „Krämergeist“ vertreten, so würde es uns sogar von grossem Nutzen sein, wenn das IBRP die Mitglieder der FICCI in ihre Reihen aufnehmen würde. Es würde unserer Organisation einen grossen Dienst erweisen indem es uns von diesem parasitären Grüppchen erlöst, welches lediglich den Namen der IKS beschmutz wenn sie sich auf unsere Plattform beziehen.
Der alleinige Grund weshalb wir das IBRP auf die Verführungsspiele der FICCI aufmerksam gemacht haben ist folgender: Wir wollten verhindern (doch es ist schon zu spät), dass eine Organisation der Kommunistischen Linken die proletarischen Prinzipien verhöhnt und die Methoden dieser Lumpenbande übernimmt. Doch wenn sich das IBRP diskreditieren will indem es sich mit solchen Elementen zusammenschliesst, so kann dies niemand verhindern. Wie sagt doch das Sprichwort: „Man kann einen Esel der keinen Durst hat nicht zum trinken zwingen“!
Nochmals: Je schneller das IBRP die FICCI davon „überzeugt“ die Hände von uns zu lassen desto besser für uns! Leider weist das IBRP unsere Analyse des Parasitismus (welche auf diejenige von Marx gegenüber der Allianz von Bakunin innerhalb der Ersten Internationale zurückgeht) von sich und beraubt sich damit einer Waffe welche verhindern könnte, dass es alle Federn in diesem schmutzigen Abenteuer lassen muss. Das IBRP rennt weiterhin hinter der FICCI her, in der Hoffnung das Zuckerstückchen das ihr von der FICCI hingehalten wird zu erhalten: Die Perspektive einer zukünftigen Sektion des IBRP in Paris und Mexiko!
Sicherlich haben die Mitglieder der FICCI keineswegs die Absicht sich vom IBRP „überzeugen“ zu lassen und noch weniger in ihre Reihen einzutreten. Und genau deshalb wiederholen diese Parasiten mit einer krankhaften Besessenheit, dass sie „nicht mit der IKS gebrochen hätten“. In ihrem letzten Bulletin (Nr. 28) unterstreicht die FICCI eine Differenz mit dem IBRP: Im Gegensatz zu dem was das IBRP in ihrer „Antwort“ auf die „dummen Anschuldigungen“ der IKS behauptet, schien es der FICCI wichtig „eine Präzisierung zur Aussage des IBRP zu machen: Wir haben nicht (mit der IKS) gebrochen, wir wurden ausgeschlossen“. Es tut uns wahrlich leid für das IBRP und hoffen, dass es sich von dieser grossen Enttäuschung erholt. Wir können nur dazu aufrufen seine Illusionen zu überwinden: Die Mitglieder der FICCI können nicht in die Reihen des IBRP eintreten, weil, wie sie in ihrem Bulletin Nr. 28 schreiben „die Fraktion die IKS ist“!: „Wir, die Fraktion, sind die IKS!“
Man kann das IBRP nicht darum bitten einen Verrückten der sich für Napoleon hält wieder auf den Boden der Realität zurückzubringen wenn dies seine ganze Existenzberechtigung ist. Dennoch sind wir konsterniert, wenn das IBRP, zerrüttet vom eigenen Opportunismus, nicht mehr fähig ist den total irren und grössenwahnsinnigen Charakter des mentalen Universums der angeblichen „Fraktion“ wahrzunehmen.
Bezüglich unserer „Thesen über den Parasitismus“ schreibt das IBRP auch noch folgendes: „wenn solche Dinge auf der Welt noch häufiger vorkommen wird die IKS wohl nichts besseres zu tun wissen als „Thesen“ über die internen Querelen zu schreiben“.
Es ist empfehlenswert wenn der aufmerksame Leser die Bilanz der öffentlichen Diskussion vom 2. Oktober welche von der IKS publiziert wurde mit derjenigen des IBRP (auf der Internetseite des IBRP) vergleicht. Dort sieht man, dass das IBRP weder fähig war auf die Fragen über die Wurzeln des Krieges im Irak zu antworten die an der Veranstaltung gestellt wurden, noch die Analyse zurückzuweisen, welche von der IKS vertreten wurde (siehe Revolution Internationale Nr. 351, „Die inhaltslose Politik und die mangelnde Methode des IBRP“)! Angesichts der Entfesselung der kriegerischen Barbarei und des blutigen Chaos im Irak, im Nahen Osten und in Afrika weiss das IBRP heute nichts besseres zu tun als die Analyse der Dekadenz des Kapitalismus in Frage zu stellen (welche durch die Kommunistische Internationale entwickelt wurde). Es weiss nichts besseres zu tun als sich der Propaganda der bürgerlichen Ökonomen anzuschliessen um damit das Proletariat zu vertrösten (und zu mystifizieren), indem man ihm glauben macht, der Kapitalismus habe noch goldene Tage der Zukunft zu bieten!
Bezüglich der Kritik an unseren „Thesen“ über unsere „internen Querelen“ sollte sich das IBRP zuerst einmal an Marx wenden: Als sich auf der Erde ein Ereignis von grösster Wichtigkeit abspielte, die Pariser Kommune 1871, hatte Marx „nichts besseres“ zu tun als eine Konferenz in London einzuberufen, welche sich vornehmlich organisatorischen Fragen widmete und den Fall von Bakunin und seiner parasitären Gruppe „Allianz der sozialistischen Demokratie“ untersuchte! Auch der einzige Kongress der AIT auf dem Marx anwesend war, Den Haag 1872, widmete sich vornehmlich, und dies vor allem auf Bestreben von Marx und Engels, Fragen der Organisation und der Funktionsweise. Auch im darauf folgenden Jahr widmeten Marx, Engels und Lafargue enorme Energien einer bedeutenden Schrift über die geheimen Machenschaften des Bürgers Bakunin und seiner Komplizen („Ein Komplott gegen die Internationale Arbeiterassoziation“). Was sagt das IBRP wohl zu Lenin, der nach den 2. Kongress der SDAPR „nichts besseres“ zu tun wusste, als nicht nur einige „Thesen“, sondern gar ein ganzes Buch („Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück“) über die „internen Querelen“ der SDAPR zu verfassen?
Das IBRP hat nie begriffen (wegen seiner Unfähigkeit, sich die Lehren aus der Geschichte der Arbeiterbewegung anzueignen), dass die Frage der politischen Verhaltensweise kommunistischer Militanter eine Frage des Prinzips ist. Und genau deshalb ist es das IBRP (und nicht die IKS!) welches von der „Zersetzung“ bedroht ist.[10] Indem es gemeinsame Sache macht mit den Elementen die nichts besseres zu tun haben als Seitenweise Verleumdungen gegen die IKS und ihre Genossen zu schreiben (siehe dazu unter anderem den Polizeiroman der FICCI „Geschichte der IKS“), hat das IBRP sich heute eine „politische Verhaltensweise“ angeeignet, welche der Arbeiterklasse total fremd ist und nicht nur auf dem Diebstahl, sondern auch auf Lügen und Verleumdungen beruht.
Das IBRP benützt Lügen und Verleumdungen
Im Punkt 5 seiner „Antwort“ auf unsere „dummen Anschuldigungen“ sagt das IBRP, dass es nie über die Vorwürfe des Stalinismus von Seiten der FICCI gegen die IKS „spekuliert“ habe: „Wir weisen die „Behauptungen“ einer Organisation als lächerlich zurück, welche (...) immer der Anschuldigung des Opportunismus und des Stalinismus bezichtigt, über welche wir nie spekuliert haben“.
Diese Behauptung ist eine absolute Lüge. Wir möchten unseren Lesern Einblick in das Bulletin Nr. 9 der FICCI geben, in dem das IBRP die „These“ der FICCI, nach der die IKS in einen Prozess der stalinistischen Degenerierung eingetreten sei, mit eigenen Worten unterstützt: „Es ist für uns (das IBRP) offensichtlich, dass ein Prozess der Eliminierung von Militanten stattfindet. Eine Eliminierung der alten Garde von der einzig Peter übrigbleibt (...) dies geht schnell vor sich, die Tendenz zu Ausschlüssen ist immer unwiederbringlich“.[11]
Damit ist das IBRP nicht nur einer Lüge überführt bei den heutigen Behauptungen „nie über die Anschuldigungen des Stalinismus“ gegen die IKS spekuliert zu haben, sondern macht sich, Hand aufs Herz, zum Sprachrohr von Verleumdungen gegen einen unserer Genossen, den „Chef der Liquidatoren“ (um einen von der FICCI geliebten Ausdruck zu verwenden), welcher, wie Stalin, „die alte Garde eliminiere“!
Es ist diese „Ekelerregende Methode“, basierend auf Lügen und Verleumdungen, welche das IBRP dazu geführt hat, kürzlich auf ihrer Internetseite (in drei Sprachen!) den Lügentext des „Circulo de Comunistas Internacionalistas“ aus Argentinien zu veröffentlichen (von dem wir aufgezeigt haben, dass es sich um nichts anderes als einen gigantischen Schwindel handelt)
Trotz unserer Veröffentlichung der Erklärung des NCI vom 27. Oktober (siehe unsere Internetseite), fährt das IBRP weiter fort die Lüge zu verbreiten, dass der NCI, gleich wie die FICCI, „mit der IKS gebrochen habe“ (siehe die Internetseite von Battaglia Comunista). Auch hier hält das IBRP seine Träume für Wirklichkeit.
Auch wenn der NCI ihm seine Erklärung zugeschickt hat (in welcher er schreibt, dass die Texte des „Circulo“ „Lügen und beschämende Verleumdungen gegen die IKS sind“), hat es das IBRP nie für notwendig befunden den Text des „Circulo“, der die angeblich „stalinistischen Methoden“ der IKS anprangert, von seiner Internetseite zu löschen. Dies zeigt klar sein Festhalten am Gebrauch von Lügen und Verleumdungen auf.
Die Beweggründe einer solchen Politik bürgerlicher Natur kann man im Bulletin Nr. 9 finden. Der Leser entdeckt dort, dass im März 2002 das IBRP und die FICCI begonnen haben, orchestriert eine politische Strategie zur Zerstörung der IKS zu entwickeln.
Dies hört man auch aus dem Munde des IBRP mit der Aussage: „Wenn wir zum Schluss gekommen sind, dass die IKS eine Organisation ohne „Berechtigung“ geworden ist, so ist unser Ziel alles zu tun um deren Verschwinden voranzutreiben.“ (hervorgehoben durch uns)
Zu welchem Ziel und mit welchem „politischen Projekt“ „existieren und bestehen“ also die Kontakte zwischen dem IBRP und der FICCI!
Es ist mit diesem klar ausgesprochenen Ziel „alles zu tun um deren Verschwinden voranzutreiben“ (dasjenige der IKS), mit dem sich das IBRP (wie auch die FICCI) auf den Lügentext eines Schwindlers (den angeblichen „Circulo de Comunistas Internacionalistas“) gestürzt hat, gleich wie die Misere auf die Armen dieser Welt!
Das IBRP ist wahrlich nicht geeignet um uns Lehren über die „wahre Moral“ beizubringen. Seine Kritik an unserem „falschen Moralismus“ dient nur zur Maskierung der beschämenden Realität: das IBRP hat sich die antiproletarische „Moral“ der Jesuiten angeeignet, nach welcher der Zweck die Mittel heiligt!
Um die IKS zu zerstören und das Urteil welches es gegenüber uns ausgesprochen hat (hinter unserem Rücken!) zu vollziehen, ist das IBRP heute bereit (und dies hat es schon bewiesen) die schmutzigsten Methoden der bürgerlichen Propaganda anzuwenden.
Um zu seinem Ziel zu kommen hat es nicht nur Allianz mit den Strolchen der FICCI und dem Hochstapler des „Circulo“ in Argentinien gemacht, sondern geht mehr und mehr dazu über sich die ekelerregenden Methoden dieser Welt anzueignen!
Wenn man dem IBRP einen Rat geben kann, dann denjenigen, zuerst vor der eigenen Türe zu wischen: Es sind seit dem 11. September 2001 „genug Dinge geschehen in dieser Welt“, doch das IBRP hat nichts besseres zu tun gewusst als Händel mit der FICCI über die Eliminierung der „alten Garde“ der IKS zu treiben. Es hat nichts besseres zu tun gewusst als sich den Kopf zu zerbrechen um zum Schluss zu kommen dass „die IKS heute todkrank sei“ (Brief des IBRP an die Fraktion, im Bulletin Nr. 19 der FICCI). Es hat nichts interessanter gefunden als die Polizeiromane der FICCI zu lesen die gespickt sind mit kleinen „pikanten“ Details über den „Lebensstil“ oder das Privatleben von diesem oder jenem Genossen der IKS!
Und heute wo noch mehr „Dinge geschehen in dieser Welt“, welche die letzten Seitensprünge dieser Gruppe sind, die die Hochstapelei und Dreistigkeit besitzt sich der ganzen Welt als... den einzig „seriösen Pol“ der Kommunistischen Linken zu präsentieren? Heute hat das IBRP nichts besseres zu tun gewusst als auf seiner Internetseite in drei Sprachen die Hirngespinste eines Psychopathen (dessen Lügen genauso imposant wie skrupellos sind) zur „Diskussion“ zu stellen. Und dies alles um zu erfahren...dass unsere Telefonanrufe (deren Inhalt das IBRP gar nicht kennt!) an die Militanten des NCI in Argentinien ein erneuter Beweis für die „stalinistische Degeneration“ der IKS seien!
Indem es sich heute mit der FICCI eingelassen hat, hat das IBRP eine Bombe ins eigene Haus gesetzt. Wir können der FICCI nur Danke sagen, uns via ihre Bulletins über die Absichten des IBRP „alles zu tun um das Verschwinden (unserer Organisation) voranzutreiben“ aufgeklärt zu haben. Für einmal hat ihr Denunziantentum der IKS einen Dienst erwiesen!
Wenn es sich nicht selbst versenken will, so ist höchste Zeit für das IBRP seine „Reflexionen (und dummen Spekulationen) über die Krisen der IKS“ einzustellen um erst einmal eine Reflexion über die Gründe seines eigenen organisatorischen Kummers und seine heutige Entwicklung zu beginnen.
Dies ist die einzige „Methode“ welche das IBRP (vielleicht?) aus dieser Dynamik, zu der es sein genetischer Opportunismus verdammt hat, entrinnen lässt.
Es ist höchste Zeit für das IBRP einzusehen, dass trotz seiner diplomatischen und „taktischen“ Allianz mit der FICCI es nicht die Mittel in die Hände bekommt um „das Verschwinden der IKS voranzutreiben“ und der „einzige Pol der Umgruppierung“ der Kommunistischen Linken zu sein. Je mehr das IBRP mit dieser Bande von Schurken (und ihrem kleinen degenerierten Klon in Argentinien) Intrigen spinnt, desto weniger begibt es sich auf den Weg einer „langsamen und sicheren Zusammenführung der revolutionären Kräfte“ (wie es in seiner „Antwort“ auf unsere „dummen Anschuldigungen“ behauptet), sondern vielmehr auf den tragischen und grotesken... einer Mücke die grösser sein will als ein Elefant!
IKS
18. 11. 2004
[1]Internationales Büro für die revolutionäre Partei: Diese Organisation beruft sich auf die Tradition der Kommunistischen Linken Italiens. Es setzt sich hauptsächlich aus der Communist Workers’ Organisation (CWO) in England und aus Battaglia Comunista in Italien zusammen.
[2]In den ersten Zeilen seiner “Antwort” auf unsere “dummen Anschuldigungen” ist das IBRP richtig gehend lächerlich: Es ist darüber empört, dass die IKS (in dem Artikel ...) so vulgäre Wörter wie “Diebe”, “Hure” und “Tripper” hat verwenden können. Offensichtlich beherrscht der Verfasser der “Antwort” an die IKS das Französisch nicht so gut, da kein einziger dieser Ausdrücke “vulgär” ist.
[3]Siehe den auf der Homepage der FICCI publizierten Text “Die Schande hat keine Grenze”, der die Erklärung des “Circulo” vom 2. Oktober einleitet. Eigenartigerweise ist dieser Text von der Homepage FICCI entfernt worden. Glücklicherweise haben wir Kopien anfertigen können, die wir dem Leser auf Anfrage auch zustellen. Übrigens haben die Pogromaufrufe dieser Diebe ein gewisses Echo gefunden, wie ein anonymer Drohbrief bezeugt, der Anfang November an unsere E-Mail-Adresse in Spanien geschickt wurde. Die Leser können diesen (dummen und Ekel erregenden) Brief begleitet von unserer Antwort auf unserer spanischen Homepage lesen: Antwort auf ein anonymes Schreiben.
[4]So behandelt die FICCI die IKS als ihr Privateigentum, da sie in ihrem Bulletin 28 unterstreicht, dass die IKS “UNSERE Organisation” sei. Die gleiche Sichtweise hat den Ex-Militanten Michel dazu verleitet, an einer geheimen Zusammenkunft, von der wir das Protokoll entdeckt haben, zu unterstreichen: “Man muss die Funktionsmittel zurück bekommen”. Man muss hier auch sagen, dass wenn Michel es vorzog, sich zurückzuziehen statt der FICCI beizutreten, so gerade deshalb, weil er eingesehen hat, dass (wie er es ganz klar gegenüber einer Delegation der IKS ausrückte) “das was man (hinter dem Rücken der IKS) getan hat, schmutzig gewesen sei”. Und im Gegensatz zu seinen Freunden der FICCI hat er einen “ehrenhafteren” Abgang vollzogen, indem er seine Schulden an die IKS vollständig beglich. Das war auch bei einem anderen Ex-Militanten (Stanley) der Fall, der sich, obwohl er mit den Mitglieder der FICCI an allen Aktivitäten hinter dem Rücken der IKS teilgenommen hatte, mit diesen desolidarisierte und ebenfalls alle Schulden mit der IKS beglich.
[5]Und wir sehen auch kein Hindernis in der “Solidarität” des IBRP mit der FICCI, dadurch dass es ihr eine Anleihe eröffnete, um die Schulden an die IKS zurück zu bezahlen!
[6]Mit der gleichen Unnachgiebigkeit und Entschlossenheit hat die IKS im Herbst 2002 in einem Zweitwohnsitz eines Mitglieds der FICCI zwischengelagerten Archive zurück geholt, als dieser kleine Dieb sie gerade umlagern wollte. Diese Wiederaneignung hat sich in aller größter Ruhe abgespielt: Der Bürger Olivier, “führendes” Mitglied der FICCI, hat sie uns widerstandslos und ohne Protest ausgehändigt.
[7]Dies mindestens bis zum 14. Kongress. Danach begann sie Angesichts der wachsenden Ablehnung in der Organisation gegen ihr Verhalten diese Arbeit zu sabotieren, weshalb wir ihr diese Arbeit wegnahmen. Sie hat dennoch ohne unser Wissen (und mit Vorsatz) für sich eine Kopie unserer Abonnentenliste gemacht, und dies noch bevor die angebliche „Fraktion“ gegründet wurde.
[8]Nebenbei: Es muss gesagt sein, dass die Mitglieder der FICCI zu keinem Zeitpunkt die Anstrengung unternommen haben den Rest der IKS von ihrem „richtigen Weg“ zu überzeugen. Ganz im Gegenteil: Es war ihre offen destruktive Haltung der „verbrannten Erde“, ihre systematische Verwendung von Lügen und Verleumdungen, und ihre heimlichen und schmutzigen Manöver, welche sie von allen anderen Militanten der IKS isoliert haben, eingenommen von denen, die anfänglich sehr offen für ihre Argumente gewesen waren. Auch wenn sie von der IKS aufgefordert wurden ihre Differenzen offen in unseren internen Bulletins und regelmässigen Sitzungen darzulegen, so haben sie es bevorzug unter „Eingeweihten“ Texte zirkulieren zu lassen welche sie vor dem Rest der Organisation zurückhielten und sie haben heimliche Sitzungen abgehalten, mit dem Ziel gegen die Organisation ein Komplott zu schmieden und sie (nach den Worten eines ihre Anführer) zu „destabilisieren“. Als wir ihnen vorgeschlagen hatten für unsere Internationale Revue eine Antwort auf den Artikel über die Bedeutung einer Fraktion, der auf der Erfahrung der Geschichte der Fraktionen der Vergangenheit die Konzeption verwirft mit welcher die „FICCI“ gegründet wurde (erschienen in derselben Nummer 108) zu schreiben, so haben sie dieses Mittel den Leser von ihrem „richtigen Weg“ zu überzeugen zurückgewiesen.
[9]In seiner „Antwort“ auf unsere „dummen Anschuldigungen“ beginnt das IBRP zuerst einmal mit einem kleinen Versuch das Phänomen des Parasitismus zu analysieren. Es behauptet mit Recht, dass „die Gründung einer neuen dissidenten Gruppe der IKS“ einen „Geist auf gewisse Sympathisanten ausstrahlen würde, das Recht zu haben seine eigene kleine Gruppe zu gründen, hier und dort einige Ideen und Positionen zusammenzuklauen, und eine grosse Unfähigkeit mit Genossen zusammenzuarbeiten“. Durch den Verrat an unseren organisatorischen Prinzipien, durch das Verbreiten von Verleumdungen gegen unsere Zentralorgane und unsere Genossen haben die Elemente der FICCI mit der IKS gebrochen (und wir sind ganz und gar einig mit dem IBRP über diesen Punkt!): Sie haben ihre „grosse Unfähigkeit mit Genossen zusammenzuarbeiten“ bewiesen, durch das „Zusammenklauen“ von Geld und Material der IKS, durch das „hier und dort (von der IKS oder dem IBRP) Zusammenklauen von einigen Ideen und Positionen“. Diese Hochstapler haben nicht das „Recht“ sich auf die Kommunistische Linke zu beziehen. Wir können das IBRP nur ermutigen nochmals einen Anlauf zu nehmen um seine Überlegungen zu Ende zu denken: Dieses selbsternannte Grüppchen „Interne Fraktion der IKS“ ist nicht ein historisches Produkt der Arbeiterklasse. Es hat keinerlei Berechtigung und ist nichts anderes als eine parasitäre Gruppe. Bei der Karikierung unserer Analyse über den Parasitismus und der Lächerlichmachung der „dummen“ Anschuldigungen der IKS, welche „von einem Komplott der Bourgeoisie schreie!“, vergisst das IBRP eine Sache: seine Ignoranz gegenüber dem was schon Marx gegenüber seinen Verleumdern denunziert hatte, als er sagte (als Beweis seiner „Dummheit“?), dass der Kampf des Generalrats der Ersten Internationalen gegen Bakunin ein „Komplott der Sonne gegen den Schatten“ war!
[10]Im Juni 1897 hatte der amerikanische Schriftsteller Mark Twain auf Gerüchte über seinen Tod geantwortet: „Die Neuigkeiten über meinen Tod waren stark übertrieben“ („The reports of my death have been grately exaggerated“). Wir sind in der Lage dem IBRP zu sagen, dass die Neuigkeit über unsere „Zersetzung“ ebenfalls „stark übertrieben“ ist. Es wäre ein für alle Mal an der Zeit, dass die Genossen des IBRP den Horrorgeschichten (sowie auch den Märchen) der FICCI Glauben schenken. Dafür ist es zu alt.
[11]Wir möchten hier in einigen Zeilen die Wahrheit wieder herstellen:
a) Die vom IBRP verbreitete Idee, nach welcher nur noch ein „Gründungsmitglied“ der IKS (Peter) übrigbleibe ist eine Lüge. Wir raten dem IBRP die Informationen die es von der FICCI erhält in Zukunft zu überprüfen. Wie schon Lenin sagte: „Wer aufs Wort glaubt ist ein unverbesserlicher Idiot“.
b) Gründungsmitglied zu sein bedeutet keinesfalls immun zu sein gegen Verrat. Muss man das IBRP an die sechs Gründungsmitglieder der Iskra erinnern (welche ein anderes Format hatten als die Diebesbande der FICCI)? Vier davon hatten verraten und sind während des Ersten Weltkrieges ins Lager der Bourgeoisie übergelaufen. Lenin ist das einzige Mitglied der Iskra welches bis zum Schluss der revolutionären Sache treu blieb.
Zum Schluss müssen wir eine andere Wahrheit wieder herstellen: Die Mitglieder der FICCI sind nicht „Führer der alten Garde“ wie das IBRP behauptet. Keiner war „Gründungsmitglied von Révolution Internationale“ (die Vorfahren der IKS zusammen mit unserer Sektion in Venezuela) wie sie es überall erzählt haben um sich mit einer unglaublichen Behauptung zu brüsten. Selbst der Älteste von ihnen, der unsichtbare Mann im Hintergrund (und „Ziehvater“ der FICCI), der Bürger Jonas: Er hatte die Organisation unmittelbar nach dem Rückfluss der Bewegung vom Mai 1968 verlassen und ist erst einige Jahre später, Mitte der 70er Jahre, in die Organisation zurückgekehrt.
Um eine Klarheit über ihre Machenschaften innerhalb der IKS zu verhindern verneinen die Mitglieder der FICCI ein Ehrentribunal. Die Helden dieser illustren Bande die sich für Superman oder Supergirl halten fahren weiter damit fort alle an der Nase herum zu führen welche, wie das IBRP, an ihre Kindergeschichten glauben. Weil sie während vielen Jahren Mitglieder der Organisation und in die Zentralorgane gewählt waren, sind sie keine „Führer der alten Garde“.
Die FICCI und das IBRP schmieren sich gegenseitig Honig um den Mund: Das IBRP schickt Blumen an die FICCI indem es sie als „die Führer der alten Garde der IKS“ nennt und die FICCI erwidert damit das IBRP als „den einzigen seriösen Pol der Umgruppierung der Kommunistischen Linken“ zu bezeichnen. So sieht der diplomatische Tauschhandel zwischen dem IBRP und der FICCI aus!
Antwort an das IBRP bezüglich der Unterstützung der Verleumdungskampagne gegen die IKS
- 2499 reads
An die Genossen der IKS,
wir kennen Euch als revolutionäre Organisation teilweise schon über Jahre hinweg.
Die Veranstaltungen, die wir besucht und manchmal mit Euch gemeinsam zu vielen wichtigen Fragen der internationalen Arbeiterbewegung gemacht haben, wurden stets in einem offenen und wertschätzenden Klima gehalten. Gerade auch politische Differenzen wurden selbst- kritisch solidarisch und lebendig diskutiert. Neuen Teilnehmern, die zögerten, sich zu Wort zu melden oder jenen, die kontroverse Positionen zu bestimmten Fragen vertreten haben, wurde Mut gemacht, sich rege an den Diskussionen zu beteiligen.
All dies entlarvt den gegen Euch auf der IBRP (Internationales Büro für die Revolutionäre Partei) Website durch den argentinischen „Circulo de Comunistas Internationalistas“ (Zirkel internationalistischer Kommunisten) erhobenen Vorwurf, Ihr würdet „stalinistisch“ arbeiten und auftreten als pure Verleumdung mit dem Ziel der Diskreditierung einer in vielen Ländern der Welt tätigen revolutionären Organisation.
Wir schätzen Eure offene Art und begrüßen Euren Schritt, die gegen Euch -und letztlich auch gegen uns- inszenierte Kampagne ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen.
Diese Haltung hat eine lange Tradition im Kampf der Arbeiterklasse.
Leider auch die Versuche von Elementen oder Staatsorganen, den Kampf der Arbeiterklasse und ihrer revolutionären Organisationen durch Verunglimpfungen, erfundene Beschuldigungen und Beschmutzungen zu torpedieren oder zumindest zu schwächen nach
dem Motto: Auch wenn die Verleumdungen erlogen oder erfunden sind, irgendwas vom Dreck und Güllegeruch wird schon hängen bleiben.
Um so beschämender empfinden wir es, dass sich das IBRP, ohne jede Rücksprache mit Euch und ohne den Inhalt der Verunglimpfung zu prüfen, vor einen solchen reaktionären Kampagnekarren spannen lässt und seine Presse, seine Website, seinen Namen und seinen Ruf hierfür zur Verfügung stellt.
Lasst nicht nach, wir unterstützen Euren Kampf!
Wir bitten Euch, die Briefe an Euch und an das IBRP international zu veröffentlichen.
Mit revolutionären Grüßen
Einige Genossen und Teilnehmer der öffentlichen Veranstaltung vom November 2004 in Köln.
Mit revolutionären Grüßen
Genossen und Teilnehmer der öffentlichen Veranstaltung vom November 2004 in Köln.
Anbei unser Brief an die Adresse des IBRP (Resolution der öffentlichen Veranstaltung der IKS in Köln, im November 04)
Die gemeinsame Verantwortung der Alliierten und der Nazis für den Holocaust
- 3167 reads
Bis jetzt unveröffentlichte Dokumente wurden ausgegraben, um erneut die von den Deportierten erlittenen Gräuel und die unvorstellbare Grausamkeit der Folterungen und Morde der Nazis zu zeigen. Aber es ist bestimmt kein Zufall, dass die Suche nach Wahrheit und Authentizität sofort aufhört, sobald die Realität das „demokratische Lager“ zu kompromittieren beginnt. Die Alliierten, die völlig im Bilde waren über die Realität des Holocausts, taten nichts, um die Ausführung des makabren Plans der Nazis zu verhindern. Es ist an den Revolutionären, dies ans Tageslicht zu bringen, wie wir es nun mit der erneuten Publikation von Ausschnitten aus einem Artikel tun, der seinerzeit in der International Review Nr. 89 (engl./frz./span. Ausgabe) unter dem Titel „Die Alliierten und die Nazis sind gemeinsam für den Holocaust verantwortlich“ veröffentlicht wurde.
Zudem befand sich das demokratischen Lager während des 2. Weltkrieges, was den Horror und Zynismus betrifft, mit dem sie ihre Verbrechen begingen, im Einklang mit dem faschistischen Lager: Die Bombardierung Dresdens und Hamburgs, oder die nukleare Zerstörung des bereits geschlagenen Japans. Deswegen sagen wir, zusammen mit den Genossen der Gauche Communiste de France (in ihrem Flugblatt vom Juni 1945, das wir unten publiziert haben: „Buchenwald, Maidaneck: Eine makabre Demagogie“), dass nicht der deutsche, amerikanische oder britische Arbeiter verantwortlich war für einen Krieg, den er nie wollte, sondern die Bourgeoisie und der Kapitalismus.
Von 1945 bis heute stellt die Bourgeoisie ständig die obszönen Bilder von den angehäuften Leichen aus, die in den Vernichtungslagern der Nazis gefunden wurden, oder von den ausgehungerten Körpern derjenigen, die diese Hölle überlebten. Demgegenüber waren die Alliierten während des Krieges sehr zurückhaltend in Bezug auf die Lager, ja diese wurden eigentlich in der Kriegspropaganda des „demokratischen Lagers“ gänzlich ausgeblendet.
Die Alliierten verheimlichen die Existenz der Lager
Ist dies nicht durch die Unwissenheit der Alliierten zu erklären? Sie wussten zwar vielleicht von der Existenz der Lager, aber von deren Einsatz für die systematische Austrottung ab 1942-43? Spionagesatelliten gab es zu jener Zeit ja noch nicht ... Diese Märchen können auch der oberflächlichsten historischen Faktenlage nicht standhalten. Die Geheimdienste existierten zu dieser Zeit bereits und waren schon sehr aktiv und effizient, wie wir dies an gewissen Episoden des Krieges erkennen können, wo sie eine entscheidende Rolle spielten, und die Existenz der Todeslager konnte der Aufmerksamkeit der Geheimdienste nicht entgangen sein. Dies ist in den Werken von vielen Historikern des 2. Weltkrieges belegt.
So lesen wir denn auch in der französischen Zeitung Le Monde vom 27. September 1996: „Ein Massaker, welches im Lager verübt wurde, dessen weitläufige und systematische Natur in einem Bericht der jüdischen sozialdemokratischen Partei, des Polnischen Bundes, beschrieben wurde, bestätigten die amerikanischen Behörden offiziell durch das bekannte Telegramm vom 8. August 1942, das G. Riegner abschickte, ein Vertreter des Jüdischen Weltkongresses in Genf, der sich auf Informationen eines deutschen Industriellen aus Leipzig namens Eduard Scholte stützte. Wir wissen, dass zu jenem Zeitpunkt die meisten der dem Tode geweihten europäischen Juden noch am Leben waren.“ Folglich ist es klar, dass die alliierten Regierungen spätestens ab 1942 über den sich vorbereitenden Genozid genau Bescheid wussten, und zwar aus verschiedenen Quellen, und weiterhin taten die Führer des demokratischen Lagers Roosevelt, Churchill und deren Kumpane alles, um diese Tatsachen zu verheimlichen, indem sie diese Informationen nicht in die Öffentlichkeit trugen, sondern vielmehr der Presse klare Anordnungen gaben, diesbezüglich eine extreme Diskretion zu wahren. Tatsächlich rührten sie nicht einen Finger, um Millionen von zum Tode Verurteilten zu retten. Dies wird durch denselben Artikel von Le Monde bestätigt, wo geschrieben steht: „... in den 80er Jahren wies der amerikanische Autor D. Wyman in seinem Buch The Desertion of the Jews nach, dass mehrere Hunderttausend Leben hätten gerettet werden können, wenn da nicht die Apathie oder sogar aktive Behinderung durch gewisse Organe der US-Verwaltung (wie des State-Depatments) und der Alliierten im Allgemeinen gewesen wären.“ Dieser Auszug des klar bürgerlichen und demokratischen Le Monde bestätigt nur, was die kommunistische Linke schon immer sagte. Trotz all dem lauten und virtuosen Geschrei nach 1945 um die Menschenrechte und um den Horror des Holocausts zeigt das Schweigen der Alliierten während des Krieges, wie viel ihnen diese Rechte eigentlich wert sind.
Ist dieses Schweigen mit einem latenten Antisemitismus gewisser Führer der Alliierten zu erklären, wie gewisse jüdische Nachkiegs-Historiker behaupten? Der Antisemitismus ist gewiss kein Monopol faschistischer Regierungen, aber er ist nicht der wahre Grund für das Schweigen der Alliierten, von denen einige Führungspersonen ja selbst jüdisch waren oder einer jüdischen Organisation nahe standen (z.B. Roosevelt). Nein, der wahre Grund hinter dieser bemerkenswerten Diskretion liegt in den Gesetzen des kapitalistischen Systems, ob sich diese nun unter demokratischem oder totalitärem Deckmantel durchsetzen. Wie auch im feindlichen Lager wurden auch alle alliierten Ressourcen für den Krieg mobilisiert. Kein unnützer Esser, alle müssen beschäftigt sein, ob an der Front oder in der Waffenproduktion. Eine Immigration von Massen aus den Lagern, von Kinder und alten Leuten, die weder an die Front noch in die Kriegsproduktion geschickt werden können, von kranken und erschöpften Männern und Frauen, die nicht in die Kriegsanstrengungen integriert werden können, hätte nur die Organisation der Letzteren beeinträchtigt. Deshalb wurden die Grenzen geschlossen und die Einwanderung mit allen Mitteln verhindert. 1943 - mit anderen Worten zu einer Zeit, in der die angelsächsische Bourgeoisie bestens Bescheid wusste über die Realität der Lager - entschied Anthony Eden, Minister seiner gnädigen und demokratischen britischen Majestät auf Bitte Churchills, dass kein Schiff der Vereinten Nationen benutzt werden dürfe für den Transport der Flüchtlinge Europas, während Roosevelt anfügte, dass der Transport so vieler Menschen die Kriegsanstrengungen stören würde (Churchill, Memoiren, Band 10). Dies sind die wahren und elenden Gründe dieser akkreditierten Antifaschisten und Demokraten, weshalb sie schwiegen zu den Vorgängen in Dachau, Buchenwald und anderen Orten der schrecklichen Erinnerung. Die humanitären Bestrebungen, die eigentlich die Alliierten hätten antreiben müssen, gemeinsam gegen die Faschisten zu kämpfen, hatten keinen Platz im Rahmen ihrer elenden kapitalistischen Interessen und der Kriegsmaschinerie.
Aber das demokratische Lager war nicht bloß Komplize des Holocausts wegen „Böswilligkeit“ oder der Faulheit der Bürokratie, wie es das bürgerliche Blatt behauptet. Wie wir sehen werden, war diese Komplizenschaft eine völlig bewusste. Zu Beginn waren die Deportationslager hauptsächlich Arbeitslager, wo die deutsche Bourgeoisie Nutzen aus der billigen Arbeitskraft ziehen konnte, die gänzlich ihrer Bereicherung diente und in die Kriegsproduktion floss. Obwohl die Vernichtungslager bereits bestanden, bildeten sie zu dieser Zeit eher die Ausnahme als die Regel. Aber nach den ersten ernsthaften militärischen Rückschlägen, v.a. gegen die fürchterliche Kriegsmaschine der USA, konnte der deutsche Imperialismus seine eigenen Truppen und die Bevölkerung nicht mehr richtig ernähren. Die Grausamkeit der Mörder, die sorgsam alle Zähne, Haare und Fingernägel ihrer Opfer sammelten, um die deutsche Kriegsmaschine zu füttern, war der Reflex des auf Grund gelaufenen deutschen Imperialismus, der an jeder Front zurückgeworfen wurde und in die Irrationalität des imperialistischen Krieges abstürzte. Aber obwohl das Naziregime und seine Untergebenen den Holocaust ohne Skrupel durchsetzten, brachte er dem deutschen Kapital nur wenig Nutzen, welches verzweifelt versuchte, die erforderlichen Mittel zusammen zu kratzen, um dem unerbittlichen Vorsprung der Alliierten Stand zu halten. In diesem Kontext gab es mehrere Versuche, meist direkt von der SS ausgeführt, um einen Profit aus diesen Hundertausenden, gar Millionen Gefangenen zu schlagen, indem sie sie den Alliierten verkaufen oder gegen etwas anderes austauschen wollten.
Die bekannteste Episode dieses grausigen Handels war der Annäherungsversuch gegenüber Joel Brand, einem Führer einer halb-klandestinen Organisation der ungarischen Juden, über welche Geschichte im Buch von A. Weissberg berichtet worden ist und worauf auch in der Broschüre Auschwitz oder das große Alibi Bezug genommen wird. Er wurde nach Budapest gebracht, um den für die Judenfrage verantwortlichen SS-Offizier, Adolf Eichmann, zu treffen, der ihn anwies, mit den britischen und amerikanischen Regierungen die Befreiung von einer Million Juden gegen 10.000 LKWs auszuhandeln, wobei klargestellt wurde, dass es einen Verhandlungsspielraum dahingehend gab, dass man auch weniger oder andere Güter akzeptieren würde. Um den guten Willen und die Ernsthaftigkeit des Angebots zu unterstreichen, schlug die SS sogar vor, 100.000 Juden zu befreien, sobald Brand eine grundsätzliche Einigung erzielt gehabt hätte, auch ohne dass es bereits zum Austausch gekommen wäre. Während seiner langen Reise machte Brand sogar Bekanntschaft mit den britischen Gefängnissen im Nahen Osten, und die alliierten Regierung setzten alles daran, ein offizielles Treffen mit ihm zunächst zu verhindern und dann zu verzögern, bis er doch den Antrag Lord Moyne, dem Repräsentanten der britischen Regierung, vortragen konnte. Dass dieser das Angebot Eichmanns ablehnte, lag keineswegs an Moynes Charakter, vielmehr folgte er schlicht und einfach den Anweisungen der britischen Regierung. Ebenso wenig war die Ablehnung ein moralischer Protest gegen eine Erpressung, die als widerlich empfunden worden wäre. Wenn wir den Bericht Brands lesen, bleibt kein Raum für Zweifel: "Er bat ihn, ihm mindestens eine Vereinbarung zu unterschreiben, selbst wenn er sie nicht einhalten würde, damit wenigstens 100.000 Leben gerettet werden könnten. Moyne fragte dann, was die Gesamtzahl sein würde. Brand antwortete, dass Eichmann von einer Million gesprochen hatte. ‚Aber wie stellen Sie sich dies vor, Herr Brand? Was würde ich mit einer Million Juden anfangen? Wo würde ich sie unterbringen? Wer würde sie aufnehmen?’ Verzweifelt beschwor Brand ihn: ‚Wenn auf der Erde für uns kein Platz mehr ist, so werden wir schlicht ausgerottet’“. Wie Auschwitz oder das große Alibi in Bezug auf diese glorreiche Episode des Zweiten Weltkrieges richtig feststellt: "Leider gab es zwar ein Angebot, aber keine Nachfrage! Nicht nur die Juden, sondern sogar die SS gingen der humanitären Propaganda der Alliierten auf den Leim! Die Alliierten wollten diese Million Juden nicht! Weder für 10.000 LKWs, noch für 5.000, nicht einmal umsonst ".
Demokratische Propaganda um das Proletariat zu verwirren
Eine gewisse neuere Geschichtsschreibung hat versucht aufzuzeigen, dass diese Ablehnung vor allem auf das Veto Stalins zurückzuführen gewesen sei. Dies ist ein weiterer Versuch, die direkte Mitverantwortung der "großen Demokratien" am Holocaust zu verschleiern und zu mindern, was durch das Missgeschick des naiven Brand aufgedeckt wurde, dessen Ehrlichkeit niemand ernsthaft in Frage stellen kann. Abgesehen davon kann man darauf verweisen, dass sich während des Krieges weder Churchill noch Roosevelt von Stalin irgendetwas vorschreiben ließen. Vielmehr waren sie in diesem bestimmten Punkt auf der gleichen Wellenlänge wie das "Väterchen der Völker" und legten die gleichen Brutalitäten und denselben Zynismus während des Krieges an den Tag. Der sehr „humanistische“ Roosevelt lehnte übrigens einen weiteren ähnlichen Vorschlag der Nazis ab, als diese Ende 1944 versuchten, Juden an die "Organisation der amerikanischen Juden" zu verkaufen und ihren guten Willen damit bewiesen, dass sie 2000 Juden in die Schweiz überführten, wie dies Y. Bauer in seinen Buch Juden zu verkaufen in allen Einzelheiten geschildert hat (Juifs à vendre, veröffentlicht von Liana Levi).
Diese Tatsachen sind nicht ein zufälliges Ereignis, ebenso wenig sind sie auf die Verwirrung gewisser Regierungen zurück zu führen, die durch die schrecklichen Opfer, die der Krieg gegen die wilde faschistische Diktatur erforderte, gefühllos geworden wären, wie dies uns die Bourgeoisie glauben machen will. Der Antifaschismus drückte nie einen realen Antagonismus zwischen einem demokratischen Lager und seinen Werten einerseits und einem totalitären Lager andererseits aus. Er war nie etwas anderes als ein "roter Lappen", mit dem vor den Augen der Arbeiter gewedelt wurde, um den kommenden Krieg zu rechtfertigen, indem sein klassisch imperialistischer Charakter als Krieg verschleiert wurde, bei dem es wie immer nur darum ging, die Welt unter den großen imperialistischen Haifischen neu aufzuteilen. Die Kommunistische Internationale hatte bereits zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Versailler Vertrages darauf hingewiesen, dass dieser Krieg unvermeidlich sein würde; es galt, diese Warnung aus dem Gedächtnis der Arbeiter zu löschen. Der Antifaschismus war vor allem das Mittel, um die Arbeiter auf das größte Gemetzel in der Geschichte vorzubereiten und sie dafür zu mobilisieren. Während es in den Kriegsjahren notwendig war, die Grenzen dicht zu halten gegenüber all jenen, die versuchten, der Hölle der Nazis zu entfliehen, um die Krieganstrengungen nicht durcheinander zu bringen, so war dies nach dem Krieg plötzlich ganz anders. Die große Aufmerksamkeit, die nun nach 1945 den Todeslagern gegeben wurde, war Wasser auf die Mühlen der alliierten Propagandamaschine. Indem der Scheinwerfer auf diese schreckliche Wirklichkeit der KZs gelenkte wurde, konnten die Alliierten von ihren eigenen unzähligen Verbrechen ablenken und das Proletariat an die Verteidigung einer Demokratie binden, die von allen bürgerlichen Parteien, von den Rechten bis zu den Stalinisten, als fester und unbestreitbarer Wert aller Bourgeois und Arbeiter gefeiert wurde, den es unbedingt zu verteidigen gelte, um neue Holocausts zu verhindern.
Buchenwald, Maidaneck: Makabre Demagogie
L'Etincelle (Der Funke) Nr. 6, Juni 1945
Die Rolle der SS, der Nazis und ihrer industriellen Todeslagers bestand darin, allgemein all diejenigen auszurotten, die sich gegen das faschistische Regime wehrten, und insbesondere die revolutionären Militantanten, die immer an der Spitze des Kampfes gegen die kapitalistische Bourgeoisie standen, unabhängig davon, welche Form diese annahm: ob autokratisch, monarchistisch oder "demokratisch", und unabhängig davon, wer ihr Chef war: ob Hitler, Mussolini, Stalin, Leopold III., Georg V., Vittorio Emmanuele, Churchill, Roosevelt, Daladier oder De Gaulle.
Als die Russische Revolution im Oktober 1917 ausbrach, versuchte die internationale Bourgeoisie sie mit allen möglichen und erdenklichen Mitteln zu zerschlagen; 1919 warf sie die Deutsche Revolution mit einer noch nie da gewesenen Brutalität nieder; und im Blut ertrank sie den Aufstand des chinesischen Proletariats. Die gleiche Bourgeoisie finanzierte die faschistische Propaganda in Italien, dann diejenige von Hitler in Deutschland; die gleiche Bourgeoisie setzte in Deutschland denjenigen Mann an die Macht, den sie zum Gendarmen von Europa auserkoren hatte. Und heute schließlich gibt die gleiche Bourgeoisie Millionen aus, "um eine Ausstellung über die Verbrechen Hitlers zu veranstalten", mit Fotos und Filmen über die "deutschen Gräueltaten", während die Opfer dieser Gräueltaten immer noch sterben, oft ohne irgendeine ärztliche Behandlung, und diejenigen, die ihnen entfliehen konnten, ohne irgendwelche Mittel zum Überleben nach Hause zurückkehren.
Es ist die gleiche Bourgeoisie, die einerseits die Wiederaufrüstung Deutschlands bezahlte, andererseits das Proletariat vergewaltigte und mit der antifaschistischen Ideologie in den Krieg zerrte; es war diese Bourgeoisie, die Hitler zur Macht verhalf und sich seiner bediente, um das deutsche Proletariat zu schlagen und es in den blutigsten Krieg, die niederträchtigste Schlächterei zu ziehen, die man sich überhaupt vorstellen kann.
Es ist die gleiche Bourgeoisie, die heute ihre Vertreter mit Blumensträußen heuchlerisch zu den Gräbern der Toten schickt, damit sie sich verbeugten, während sie selber diese Toten verursacht hat, da sie unfähig ist, diese Gesellschaft noch zu regieren, und weil der Krieg ihre Lebensform geworden ist.
Diese Bourgeoisie klagen wir an!
Wir klagen sie an für die Millionen von Toten, die sie verursacht hat und die leider nur die ohnehin schon viel zu lange Liste der Märtyrer "der Zivilisation" verlängern, einer im Zerfall begriffenen kapitalistischen Gesellschaft.
Es sind nicht die Deutschen, die für die Verbrechen Hitlers verantwortlich sind. Sie waren die ersten, die 1934 für die bürgerliche Repression Hitlers mit 450.000 Menschenleben bezahlten und weiter diese gnadenlose Unterdrückung zu erleiden hatten, während sie schon ins Ausland exportiert wurde. Ebenso wenig sind die Franzosen, die Briten, die Amerikaner, die Russen oder die Chinesen für die Grausamkeiten eines Krieges verantwortlich, den sie nicht wünschten, sondern ihnen von ihrer Bourgeoisie aufgezwungen wurde.
Millionen von Männer und Frauen starben langsam in den Konzentrationslagern der Nazis; sie wurden entsetzlich gequält, und jetzt verrotten ihre Körper irgendwo. Millionen starben in den Kämpfen des Krieges oder verbrannten im Bombenhagel der „Befreier“. Diese Millionen von Leichen - verstümmelt, amputiert, zerfetzt, entstellt, im Boden begraben oder auf dem Feld verrottend - diese Millionen von Toten, Soldaten, Frauen, alter Leute, Kinder, alle schreien nach Rache. Und sie schreien nach Rache nicht an den Deutschen, die immer noch bezahlen, sondern an dieser abscheulichen, heuchlerischen und skrupellosen Bourgeoisie, die für den Krieg nicht bezahlte, sondern im Gegenteil davon profitierte. Mit ihren fetten Schweinsgesichtern provozieren sie ihre immer noch hungrigen Sklaven.
Die einzige proletarische Position besteht nicht darin, den demagogischen Aufrufen zu folgen, die darauf abzielen, den Chauvinismus mittels antifaschistischer Komitees fortzusetzen und zu steigern, sondern den direkten Klassenkampf zur Verteidigung der Interessen der Arbeiterklasse, ihres Rechts zum Leben aufzunehmen: den alltäglichen und andauernden Kampf bis zur Zerstörung dieses ungeheuren Regimes, des Kapitalismus.
Geographisch:
- Europa [12]
Historische Ereignisse:
- Zweiter Weltkrieg [13]
Theoretische Fragen:
- Imperialismus [3]
Korrespondenz zwischen der IKS und dem IBRP: Epilog vom 3.11.04
- 2476 reads
Am 2. November erschien auf der Site des IBRP endlich die Stellungnahme, die wir von ihm als "Recht der Gegendarstellung" verlangt hatten, d.h. elf Tage nachdem wir unsere erste diesbezügliche E-mail geschickt hatten (siehe vorhergehende Briefe). Wir nehmen zur Kenntnis, dass das IBRP schließlich unserer Aufforderung nachgekommen ist.
Die Frage stellt sich aber, warum das IBRP so viel Zeit verstreichen ließ, um zu reagieren, und damit zuließ, dass die "ekelerregende" Erklärung des so genannten „Circulo“ mit voller Unterstützung des IBRP publiziert wurde.
Man könnte annehmen, dass es an einem bloß technischen Problem lag: E-mail Adresse nicht zugänglich, der für die E-mails verantwortliche Genosse „vergesslich“ oder krank usw. Um diese Risiken möglichst zu vermeiden, schickten wir unsere E-mails an sechs verschiedene Adressen (Italien, Großbritannien, Frankreich, Kanada, Vereinigte Staaten, Kolumbien). Aber anscheinend handelte es sich nicht um ein solches Problem, denn wir erhielten eine E-mail des IBRP vom 24. Oktober (die allerdings aus irgendeinem Grund erst am 31. Oktober versandt wurde), die auf einen Teil unseres Schreibens vom 22. Oktober (zu einem weniger dringenden Thema) antwortete. Offensichtlich wurde unsere Nachricht vom 22. Oktober durch das IBRP frühzeitig empfangen. Trotzdem verliert diese erste Antwort des IBRP nicht ein Wort zu unserer Anfrage betreffend Veröffentlichung der "Gegendarstellung".
Effektiv veröffentlichte das IBRP unsere Stellungnahme drei Tage, nachdem wir auf unserer eigenen Website den dritten Brief an diese Organisation publiziert hatten, der wie folgt endete: "In Anbetracht eures Schweigens und eurer Haltung, die darauf hinweist, dass ihr euch weigert, unsere Stellungnahme zu verbreiten, sehen wir uns gezwungen, unsere früheren Briefe an euch auf unserer Webseite zu veröffentlichen. Genossen, wir möchten noch einmal unterstreichen, dass euer fortgesetztes Schweigen gleichbedeutend ist mit der Unterstützung für die infamen Verleumdungen des ‚Zirkels‘ gegen unsere Organisation." Diese unsere Absicht setzten wir sofort in die Tat um.
Abgesehen davon scheint es uns, dass es noch eine weitere Erklärung für das plötzliche Erwachen des IBRP nach einer Woche des Schlummerns gibt: Das IBRP versteht langsam, dass der sogenannte "Circulo", in welchen es so große Hoffnungen gesetzt hatte (und dessen üble Erklärung vom 12. Oktober zu publizieren dem IBRP so großes Vergnügen bereitete), nichts als ein elender Betrug ist, der von einer Einzelperson von A bis Z aufgezogen worden war, die nicht einmal den Unterschied zwischen der Kommunistischen Linken und dem Stalinismus zu kennen scheint. Dies ist der Punkt, den wir in unserem Text "Circulo de Comunistas Internacionalistas: Betrug oder Wirklichkeit?" nachwiesen, der am 27. Oktober auf unserer Website publiziert wurde. Möglicherweise konnte dieser Text die Augen der Militanten des IBRP öffnen.
Auf jeden Fall bedauern wir es sehr, dass so viel Zeit verstrich, bis das IBRP sich nach all den Eskapaden dessen, der sich "der Zirkel" nennt, und nach nicht weniger als drei Briefen unsererseits endlich dazu entschloss, diese elementare Geste der guten Nachbarschaft zwischen zwei Organisationen zu vollziehen, die sich zur Kommunistischen Linken zählen. Diese Haltung des IBRP ist kein Ruhmesblatt.
IKS, 3. November 2004
Politische Strömungen und Verweise:
Resolution der öffentlichen Veranstaltung der IKS in Köln (November 04)
- 2205 reads
Einleitung:
Diese Resolution wurde am Ende der öffentlichen Veranstaltung der IKS im November in Köln mit Thema 'Anton Pannekoek - Vordenker der Revolution' von einem Teilnehmer vorgeschlagen, als ein Teil der Veranstaltungsteilnehmer - Zirkelmitglieder aus Ostwestfalen - schon wegen der längeren Reise abgereist war. Die verbliebenen Teilnehmer stimmten einstimmig für die Resolution.
An die Genossen des IBPR,
wir, Genossen und Teilnehmer einer öffentlichen Veranstaltung der IKS in Deutschland haben mit großer Bestürzung und Empörung von der schmutzigen Verleumdungskampagne gegen die IKS erfahren.
Wir verurteilen aufs Schärfste, dass Ihr Eure Website für eine solche Dreckschleuderei zur Verfügung stellt und dass Ihr ohne jeden Kommentar, Prüfung oder Rücksprache erlaubt, dass die IKS durch den argentinischen Zirkel „Circulo de communistas Internationalistas” als eine stalinistische Organisation beschimpft wird, die mit ekelerregenden Methoden arbeite.
Wir finden es politisch völlig richtig und in einem hohen Maß verantwortungsbewusst, dass die IKS: Mitglieder aus der Organisation und von Versammlungen ausschließt, die sich des Diebstahls von Abonnentendateien schuldig gemacht haben und mit übelsten bürgerlichen Methoden ohne jeden Nachweis, ein leitendes Mitglied der Organisation als „Bullen” beschuldigen.
Wir fordern von Euch, auf den Boden der proletarischen Form und Prinzipien der Auseinandersetzung zurückzukehren, das heißt:
- umgehende Veröffentlichung unseres Briefes sowie der Stellungnahme der IKS zu den - Vorgängen in Eurer Presse und auf Eurer Website.
- Mit Eurer Beteiligung die Einrichtung einer unabhängigen Klärungs- und Prüfungskommission aus dem linkskommunistischen Lager zu den Vorwürfen gegen die IKS.
- Abbruch jeder Zusammenarbeit mit den ehemaligen Leuten aus der IKS, die sich in und um die IFIKS (sogenannte „Interne Fraktion der IKS”) gruppieren.
- Denunzierung und öffentliche Bekämpfung ihrer Methode des Diebstahls von Geldern und Kontaktdateien sowie der Hetzkampagnen gegen die IKS:
Stellt Euch endlich der kollektiven Verantwortung, die Ihr gegenüber dem internationalen Proletariat habt. Setzt Euch mit der IKS und anderen Revolutionären an einen Tisch und diskutiert öffentlich die zentralen Fragen der Arbeiterbewegung, des Kapitalismus und seiner Uberwindung.
Mit revolutionären Grüßen
Genossen und Teilnehmer der öffentlichen Veranstaltung der IKS in Köln/Deutschland November 2004.
Solidaritätsbrief einer Genossin gegenüber der IKS
- 2335 reads
November 2004
Liebe Genossinnen und Genossen der IKS,
seit einigen Jahren lese ich regelmäßig und mit Interesse Eure Presse und besuche Eure öffentlichen Diskussionsveranstaltungen. Natürlich habe ich neben den politischen Einschätzungen und Debatten auch Euren Kampf für die Verteidigung der eigenen revolutionären proletarischen Organisation gegenüber der sog. „Internen Fraktion“ der IKS (IFIKS) aufmerksam verfolgt. Mehr noch, in dieser schweren Zeit sollt Ihr, die Ihr für die Befreiung der Arbeiterklasse und damit für die Befreiung der gesamten Menschheit mitkämpft, auch von anderen Teilen der Klasse die aktive Klassensolidarität zu spüren bekommen.
Die Methoden und Machenschaften der IFIKS sind unglaublich verabscheuungswürdig. Wer mit Verhaltensweisen wie Diebstahl, Aufhetzung, Verleumdung und Lügen operiert, der ist kein Teil der revolutionären Arbeiterbewegung. Die Arbeiterklasse und schon gar nicht ihr bewusstester Teil, die revolutionären proletarischen Organisationen, dürfen ein solches Verhalten dulden!
Das Motto der Jesuiten „Das Zweck heiligt die Mittel“ darf nicht das Leitmotiv der Arbeiterklasse und erst recht nicht das ihrer politischen Strömungen sein. Die Arbeiterklasse kann für ihr Endziel, den Kommunismus, nur Mittel einsetzen, die im Einklang mit ihm stehen. Die Arbeiterklasse kann die Weltrevolution, d.h. die Befreiung der gesamten Menschheit, nur in einem ehrlichen, solidarischen und kollektiven Klassenkampf erringen. Was aber könnte es Gefährlicheres geben als eine Bande von Halunken, die im Namen der Verteidigung der Interessen der Arbeiterklasse nur eine Botschaft haben: blanken Hass und Zerstörung?
Eine andere ganz aktuelle Entwicklung aber macht mich fast noch wütender, auf jeden Fall ist sie noch enttäuschender: das Verhalten des IBRP. Seit Jahren lehnt es gemeinsame Aufrufe mit der IKS gegen imperialistische Kriege ab. Die programmatischen Unterschiede seien zu gravierend. Die massiven Angriffe der IFIKS gegen die IKS, die generelle Angriffe gegen die Sache des Proletariats sind, seien nur „interne Angelegenheiten“ der IKS, da mische man sich nicht ein. Aber siehe da: plötzlich gibt es eine gemeinsame Veranstaltung des IBRP und der IFIKS in Paris. Wie ist es möglich, dass eine linkskommunistische Organisation wie das IBRP mit solchen Klassenfeinden zusammenarbeitet? Wie kann man solche Verhaltensweisen der IFIKS gegenüber der IKS tolerieren und, indem man mit solchen Leuten zusammenarbeitet, auch so auch noch signalisiert, dass ein solches Verhalten akzeptabel sei?
Es tun sich große Schwächen innerhalb des IBRP auf, wenn es dies nicht erkennt. Aber es geht noch weiter: Auf ihrer Website veröffentlicht es kommentarlos (!) einen Artikel, in dem die IKS als „stalinistisch, opportunistisch, kamarillahaft, Ekel erregend“ bezeichnet wird. Der Artikel wurde im Namen des Zirkels CCI aus Argentinien verfasst.
Es stellten sich mir gleich zwei zentrale Fragen:
1) Wieso werden hier solch eklatante Vorwürfe umkommentiert vom IBRP veröffentlicht?
2) Und wieso wird dieser Artikel nicht von der Website entfernt (und zwar mit Begründung), wo sich doch schon längst herausgestellt hat, dass diese Vorwürfe unwahr sind und dass dieser „Zirkel“ in Wirklichkeit aus einem einzigen Individuum des NCI besteht, das ohne Wissen und entgegen der Auffassung der anderen Mitglieder des einzig tatsächlich existierenden Zirkels, nämlich des NCI (die sich nämlich mit der IKS solidarisch erklärten und die Machenschaften der IFIKS verurteilten), diese Verleumdungen in Umlauf brachte. Dieser offensichtlich machtgeile Einzelne hat zu den gleichen Methoden wie die IFIKS gegriffen: Lügen über Lügen!
Solcherlei veröffentlicht das IBRP ohne jeglichen Kommentar, ohne jede Einschätzung. Angesichts dessen kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass das IBRP gegenüber der IKS an unglaublichen Minderwertigkeitskomplexen leidet und daher insgeheim die Angriffe auf die IKS gutheißt - nach dem Motto: Was meinem Konkurrenten schadet, kann mir doch nur zugute kommen. Dies ist kein proletarisches Verhalten, sondern ein vom bürgerlich-kapitalistischen Konkurrenzdenken durchtränktes Verhalten. Statt zu verstehen, dass die IKS und das IBRP sich als Vertreter des linkskommunistischen proletarischen Milieus gemeinsam gegen diese der Arbeiterklasse feindlich gesonnenen Eindringlinge zur Wehr setzen müssen, droht es unter der Last seines Opportunismus erdrückt zu werden, indem es jeden in sein Boot holt, einerlei ob Klassenfreund oder Klassenfeind.
Wieso versteht das IBRP dies nicht? Es liegt in der Schwäche seiner Theorie. Denn um es mit den treffenden Worten Rosa Luxemburgs über den Opportunismus zu sagen: „…unsere ‚Theorie’, d.h. die Grundsätze des wissenschaftlichen Sozialismus, setzen der praktischen Tätigkeit ebenso in bezug auf die angestrebten Ziele wie auf die anzuwendenden Kampfmittel wie endlich selbst auf die Kampfweise sehr feste Schranken.“ (Sozialreform oder Revolution?) Eins ist klar, diese umherlavierenden, opportunistischen und heuchlerischen Verhaltensweisen des IBRP sind nicht die Mittel zum Zweck des Kommunismus, sondern schlicht das Gegenteil. An die Stelle von Eifersucht und Konkurrenzdenken auf Seiten des IBRP sollten die proletarischen Kampfformen der Solidarität und der Prinzipienfestigkeit treten. Dass dies möglich und notwendig ist, sehe ich im Kampf der IKS.
Wie um alles in der Welt sollen wir als Menschheit jemals die Weltrevolution und die klassenlose Gesellschaft erreichen, wenn man sang- und klanglos Verhaltensweisen innerhalb revolutionärer Organisationen des Proletariats duldet, die dem Verhalten und der Methoden unserer Gegner entsprechen?
Abschließend möchte ich noch einmal betonen, dass im Gegensatz zu dem, was das IBRP herablassend und überheblich über die Sympathisanten der IKS geschrieben hat, wir nicht blind die Worte irgendwelcher angeblicher „Anführer“ nachbeten, sondern uns kritisch mit allen Fragen beschäftigen, die uns alle als Teil der Arbeiterklasse angehen.
Im Bewusstsein der Wichtigkeit dieser Auseinandersetzung erkläre ich entschieden meine Solidarität gegenüber der IKS und kann nur an alle diejenigen, die auch über diese offenen oder verdeckten Angriffe empört sind, appellieren, Eure Empörung öffentlich kundzutun. Unsere Klassenbrüder und -schwestern brauchen unsere Unterstützung!
Solidarische Grüße
von einer Genossin aus dem Rheinland
PS. Bitte schickt diesen Brief auch an das IBRP!
Politische Strömungen und Verweise:
- Parasitismus [14]
IKSonline - 2005
- 3774 reads
Januar 2005
- 688 reads
Debatte mit der ungarischen anarcho-kommunistischen Gruppe Barikád Kollektíva
- 2677 reads
Im Oktober 2004 trafen sich je eine Delegation der ungarischen Gruppe Barikád Kollektíva und der Internationalen Kommunistischen Strömung für eine Diskussion über die folgenden Punkte:
– Russische Revolution, Rolle und Charakter der Bolschewiki und der Linken Fraktionen der Komintern
– Dekadenz des Kapitalismus
– Aktualität: Imperialismus und Klassenkampf
Trotz großer inhaltlicher Divergenzen in praktisch allen Fragen war die Diskussion freundschaftlich und offen. Die jeweiligen Standpunkte kamen ausführlich zur Sprache. Dies war sicher zu einem wesentlichen Teil dem Umstand geschuldet, dass beide Gruppen das gleiche Ziel erreichen wollen, nämlich die klassenlose Gesellschaft, und sich beide auch darüber einig sind, dass dies nur auf dem Weg der revolutionären Überwindung des Kapitalismus auf Weltebene geschehen kann.
Auch darüber hinaus gibt es eine Reihe von programmatischen Gemeinsamkeiten:
– Die einzige Klasse, die heute in der Lage ist, eine solche Revolution durchzuführen, ist das Proletariat.
– Das Proletariat kann auf seinem Weg zur Revolution keine Bündnisse mit der Bourgeoisie oder Teilen von ihr eingehen.
– Angesichts des imperialistischen Krieges verteidigen die Revolutionäre eine internationalistische Haltung.
– Die so genannten nationalen Befreiungsbewegungen und der Antifaschismus sind bürgerliche Anliegen, die nichts mit dem proletarischen Kampf zu tun haben.
– Die Arbeiterklasse ist über alle Grenzen hinweg eine Einheit. Die Revolutionäre haben diese einheitlichen und allgemeinen Interessen der Arbeiterklasse hervorzuheben.
– Ein Ausdruck der Einheit der Arbeiterklasse ist ihre Tendenz zur Zentralisierung des Kampfes.
Es hier aus Platzgründen nicht möglich, über alle Diskussionspunkte des Treffens zu berichten und eine umfassende Bilanz zu ziehen (1). Wir konzentrieren uns auf zwei Punkte, die in der heutigen Zeit besonders wichtig sind: Einerseits die Verteidigung der historischmaterialistischen Methode und damit die Frage der objektiven und subjektiven Voraussetzungen der proletarischen Revolution; andererseits die Verantwortung der Revolutionäre, schonungslos die Ausweglosigkeit der heutigen kapitalistischen Realität aufdecken.
Zur Marxistische Methode
Einer der vorgesehenen Diskussionspunkte war die Frage der Dekadenz des Kapitalismus. Die ungarischen Genossen lehnen die von der IKS vertretene Auffassung ab, wonach jede bisherige Produktionsweise eine aufsteigende und eine niedergehende Phase durchlaufen hat. Die IKS verteidigt bekanntlich die Ansicht, dass der Kapitalismus vor rund 90 Jahren aufgehört hat, für die Weiterentwicklung der Produktivkräfte günstige Bedingungen darzustellen; dass vielmehr umgekehrt der I. Weltkrieg mit seiner Zerstörungswut den Eintritt in die Dekadenz der kapitalistischen Produktionsweise offenbart hat. Dies war auch die Auffassung der meisten Revolutionäre zur damaligen Zeit und in den darauf folgenden Kämpfen der Arbeiterklasse (in Russland, Deutschland, Ungarn etc.), das heißt in der revolutionären Welle von 1917–23.
Die Kommunistische Arbeiter-Partei Deutschlands (KAPD) beispielsweise stellte 1920 in ihrem Programm fest: „Die aus dem Weltkrieg geborene Weltwirtschaftskrise mit ihren ungeheuerlichen ökonomischen und sozialen Auswirkungen, deren Gesamtbild den niederschmetternden Eindruck eines einzigen Trümmerfeldes von kolossalem Ausmaß ergibt, besagt nichts anderes, als dass die Götterdämmerung der bürgerlichkapitalistischen Weltordnung angebrochen ist. Nicht um eine der in periodischem Ablauf eintretenden, der kapitalistischen Produktionsweise eigentümlichen Wirtschaftskrisen handelt es sich heute, es ist die Krise des Kapitalismus selbst (…) Immer deutlicher zeigt sich, dass der sich von Tag zu Tag noch verschärfende Gegensatz zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten, dass der auch den bisher indifferenten Schichten des Proletariats immer klarer bewusst werdende Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit innerhalb des kapitalistischen Wirtschaftssystems nicht gelöst werden kann. Der Kapitalismus hat sein vollständiges Fiasko erlebt, er hat im imperialistischen Raubkriege sich selbst historisch widerlegt, er hat ein Chaos geschaffen, dessen unerträgliche Fortdauer das internationale Proletariat vor die welthistorische Alternative stellt: Rückfall in die Barbarei oder Aufbau einer sozialistischen Welt.
(…)
In Verfolg ihrer maximalistischen Absichten entscheidet sich die KAPD auch für die Ablehnung aller reformistischen und opportunistischen Kampfmethoden, in denen sie nur ein Ausweichen vor ernsten und entscheidenden Kämpfen mit der bürgerlichen Klasse sieht. Sie will diesen Kämpfen nicht ausweichen, sie fordert sie vielmehr heraus. In einem Staat, der alle Merkmale der eingetretenen Periode des kapitalistischen Zerfalls aufweist, gehört auch die Beteiligung am Parlamentarismus zu den reformistischen und opportunistischen Kampfmethoden.“
Die Genossen des Barikád-Kollektivs dagegen sind der Meinung, dass eine solche Aufteilung der Geschichte in aufsteigende und niedergehende Phasen keinen Sinn mache, sondern vielmehr mechanistisch sei. Mit dem Auftauchen des Privateigentums habe es immer auch schon Unterdrückte gegeben, die sich gegen die Ausbeutung und die herrschende Klasse zur Wehr gesetzt hätten; der Spartacus-Aufstand der Sklaven im Alten Rom oder die Bauernkriege in Deutschland im 16. Jahrhundert seien Beweise dafür. So wie es ständig Klassenkampf gebe, sei grundsätzlich auch die revolutionäre Überwindung der herrschenden Klassenverhältnisse jederzeit möglich. Es sei eine Ablenkung von dieser revolutionären Aufgabe, wenn man behaupte, dass die proletarische Revolution 1871, zur Zeit der Pariser Kommune, noch nicht möglich gewesen sei.
Da sich das Barikád-Kollektiv sonst bei seinen Positionen auch und insbesondere auf Marx und Engels bezieht, versuchte die Delegation der IKS herauszufinden, inwieweit (wenn überhaupt) es in dieser Frage eine Übereinstimmung mit den Begründern der dialektisch-materialistischen Geschichtsauffassung gibt. Für Marx und Engels war der Parlamentarismus im 19. Jahrhundert eine notwendige Waffe im Arsenal der Arbeiterklasse; sie unterstützten zu jener Zeit auch verschiedene nationale Kämpfe als wichtig für die Reifung der Voraussetzungen der proletarischen Revolution. Im niedergehenden Phase des Kapitalismus hingegen sind diese Mittel und Kämpfe nicht nur nutzlos, sondern auch konterrevolutionär. Die ungarischen Genossen hielten dazu fest, dass Marx’ und Engels’ Unterstützung von gewissen nationalen Kämpfen eine „Sünde“ gewesen sei. Das Barikád Kollektíva erachte die Methode von Marx und Engels nicht als gültig.
Auch für die IKS sind Namen und Personen für sich allein nicht ausschlaggebend. Wir sind nicht der Meinung, dass jeder Satz von Marx oder anderen Revolutionären als richtig unterschrieben werden muss. Das ist schon deshalb nicht möglich, weil sie sich manchmal selber widersprochen und frühere Ansichten als Irrtümer oder als an eine bestimmte Zeit gebunden anerkannten. Die einen konnten mehr zur Weiterentwicklung der revolutionären Theorie beitragen als andere, ohne dass letztere allein wegen ihren Fehlern als konterrevolutionär betrachtet werden müssten. Was aber die historische und materialistische Methode von Marx und Engels betrifft, so erscheint sie uns als unabdingbar, wenn es darum geht, die vergangenen und gegenwärtigen Klassenverhältnisse im Hinblick auf ihre revolutionäre Überwindbarkeit zu analysieren. Marx stellte nach den Kämpfen von 1848 zurecht fest, dass er und die anderen Genossen des Kommunistischen Bundes die Möglichkeiten einer Revolution überschätzt hatten: „Bei dieser allgemeinen Prosperität, worin die Produktivkräfte der bürgerlichen Gesellschaft sich so üppig erst entwickeln, wie dies innerhalb der bürgerlichen Verhältnisse überhaupt möglich ist, kann von einer wirklichen Revolution überhaupt keine Rede sein. Eine solche Revolution ist nur in den Perioden möglich, wo diese beiden Faktoren, die modernen Produktivkräfte und die bürgerlichen Produktionsformen, miteinander in Widerspruch geraten.“ (Marx, Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850, MEW Bd. 7 S. 98)
Damit eine Revolution erfolgreich sein kann, müssen verschiedene objektive und subjektive Bedingungen erfüllt sein. Die alte Ordnung, die überwunden werden soll, muss aufgehört haben, eine Perspektive anzubieten, an der es sich lohnt festzuhalten. Sie muss ihre Vitalität verloren haben und so hinfällig und überlebt erscheinen, dass selbst die Herrschenden sie nicht mehr verteidigen können. Gleichzeitig muss eine Klasse vorhanden sein, die eine neue Perspektive, die zukünftige Gesellschaft verkörpert und die auch in der Lage und willens ist, den revolutionären Umsturz an die Hand zu nehmen. Vom Allgemeinen zum Besonderen fortschreitend kann man mindestens vier geschichtliche Bedingungen für den Erfolg einer revolutionären Bewegung unterscheiden:
a) Die alte Gesellschaftsordnung muss für die Weiterentwicklung der Produktivkräfte zu eng geworden sein.
b) Die Herrschenden haben ihre Legitimität zur Fortsetzung der Herrschaft verloren. Sie können nicht mehr regieren.
c) Die revolutionäre Klasse ist nicht mehr bereit, sich länger unterdrücken zu lassen. Sie will nicht mehr regiert werden.
d) Im maßgeblichen geographischen Rahmen verschiebt sich das Kräfteverhältnis zwischen der herrschenden und der revolutionären Klasse so stark zugunsten der letzteren, dass der Sieg der letzteren auch militärisch zu halten ist (wobei die proletarische Revolution eine Weltrevolution ist, so dass das Kräfteverhältnis im Weltmaßstab zugunsten des Proletariats kippen muss).
Es liegt in der Natur der Sache, dass die verschiedenen Bedingungen zueinander in einem Verhältnis stehen und nicht völlig voneinander getrennt werden können. Aber man kann diese Faktoren voneinander unterscheiden und feststellen, dass eine Revolution scheitern muss, wenn auch nur eine dieser vier Voraussetzungen nicht erfüllt ist. Marx und Engels erkannten sowohl nach 1848 als auch 1871, dass der Kapitalismus seine historische Mission noch nicht zu Ende gebracht hatte; es lag also an der ersten Voraussetzung, dass der Juni-Aufstand 1848 und die Kommune in Niederlagen endeten.
Die Revolutionen in Deutschland und Ungarn 1919/20 können natürlich auch nicht isoliert betrachtet werden; sie waren Teil der weltrevolutionären Welle. Aber entscheidend bei ihrem Scheitern war der dritte Faktor: Der Wille und die Fähigkeit der revolutionären Klasse und ihrer Avantgarde, die begonnene Umwälzung zu Ende zu führen, waren nicht genügend weit entwickelt, so dass es der herrschenden Klasse gelang, sich mit einer neuen Regierung wieder fest zu etablieren (zweiter Faktor).
Für das Scheitern der Russischen Revolution war schließlich der vierte Faktor ausschlaggebend: ein Land allein kann die proletarische Revolution nicht vollenden. Das Kräfteverhältnis hätte international kippen müssen. In Russland konnte die kapitalistische Produktionsweise nie abgeschafft werden. Das Gegenteil zu behaupten, war Etikettenschwindel und in der Konsequenz (stalinistische) Konterrevolution.
Wenn die Marxisten mit dieser historisch-materialistische Methode die Bedingungen der Revolution untersuchen, so hat dies überhaupt nichts mit einer mechanistischen Herangehensweise zu tun. Die oben erwähnten Beispiele zeigen zur Genüge, dass wir nicht allein objektive, sondern auch subjektive Faktoren betrachten. Letztlich hängt alles vom Proletariat ab, von seinem Bewusstsein, seinem Willen und der Einheit. Von der Dekadenz der Kapitalismus als einer notwendigen Voraussetzung für die proletarische Revolution zu sprechen, hat insbesondere nichts zu tun mit einem Fatalismus, demzufolge die kapitalistische Gesellschaftsordnung von allein zusammenbrechen würde. Es braucht den bewussten Akt der Arbeiterklasse, um diesem System ein Ende zu bereiten. „Der Zusammenbruch des Kapitalismus bei Marx hängt in der Tat von dem Willen der Arbeiterklasse ab; aber dieser Wille ist nicht Willkür, nicht frei, sondern selbst vollkommen bestimmt durch die ökonomische Entwicklung.“ (Anton Pannekoek, Die Zusammenbruchstheorie des Kapitalismus)
Illusionen über die gegenwärtigen Lage
Für Barikád Kollektíva und für die IKS war es ein wichtiges Anliegen, auch über die Einschätzung der aktuellen Lage zu diskutieren. Aus Zeitgründen konzentrierten wir uns auf die Frage des Imperialismus.
Auch hier waren die Auffassungen kontrovers. Beide Gruppierungen vertreten zwar gegenüber den imperialistischen Kriegen einen internationalistischen Standpunkt, demzufolge in all den imperialistischen Konflikten keine kriegführende Partei unterstützt werden kann: weder Israel noch Palästina, keine Fraktion in den irakischen Wirren, in Tschetschenien oder anderswo – das Proletariat hat in all diesen Kriegen nichts zu gewinnen. Einig waren wir uns auch, dass Pazifismus nicht weiterhilft, sondern der Kapitalismus als solcher überwunden werden muss, damit auch die Kriege aufhören.
Was hingegen die konkreten Hintergründe in den einzelnen imperialistischen Auseinandersetzungen betrifft, hörten die Gemeinsamkeiten schnell auf. Während die IKS davon ausgeht, dass es reale Widersprüche zwischen den verschiedenen Kriegsgegnern und insbesondere zwischen den Großmächten gibt, die sich gegenseitig Schaden zufügen und ihre eigene Macht ausbauen wollen, vertritt das Barikád-Kolletiv die Auffassung, dass diese Widersprüche nur die Oberfläche darstellen würden und die Kriege im Grunde genommen gegen die Arbeiterklasse gerichtet seien. Der Kapitalismus leide an einer Überproduktion, und zwar v.a. an einer Überproduktion der Arbeiterklasse. Die Bourgeoisie ziele mit ihren dauernden Kriegen vor allem auf die Eliminierung der Proletarier ab. Diese seien ja auch die Opfer der Massaker auf dem Balkan, in Afrika und im Nahen Osten. Der II. Weltkrieg sei eine Antwort der Weltbourgeoisie auf die Kämpfe der Arbeiterklasse in den 1930er Jahren gewesen, die in Spanien, Frankreich und China stattgefunden hätten. Für die Vernichtung der Juden in den Konzentrationslagern seien bekanntlich nicht allein die Nazis, sondern auch die Alliierten verantwortlich. Auch bei der Niederschlagung des Aufstands im Warschauer Ghetto habe sich die Komplizenschaft der verschiedenen Imperialisten, konkret von Hitler und Stalin, gezeigt.
Die IKS antwortete darauf mit einer Kritik auf zwei Schienen: Einerseits unterschätzt das Barikád-Kollektiv die Ernsthaftigkeit des Zustandes der kapitalistischen Welt, andererseits überschätzt es die Fähigkeit der Bourgeoisie, den Absturz ins Chaos zu kontrollieren bzw. ad infinitum hinauszuschieben. Es trifft natürlich zu, dass die Bourgeoisie gegenüber dem Proletariat geeint auftreten kann und dies auch immer dann tut, wenn es für die herrschende Ordnung gefährlich wird oder werden könnte. Die Arbeitsteilung zwischen den Nationalsozialisten und der Roten Armee gegenüber dem Aufstand im Warschauer Ghetto ist ein Beispiel; die Komplizenschaft der Bourgeoisien aller Länder gegenüber dem kämpfenden Proletariat im November 1918 ist ein weiteres – der Krieg wurde sofort beendet, damit die herrschende Klasse in Deutschland, Österreich und Ungarn die Hände frei hatte zur Bekämpfung der entstehenden Rätemacht. Und für die IKS gibt es natürlich keinen Zweifel daran, dass die Alliierten und die Nazis für den Holocaust gemeinsam verantwortlich waren; schon 1945 stellten unsere politischen Vorgänger von der Kommunistischen Linken Frankreichs (Gauche Communiste de France) die gesamte internationale Bourgeoisie für deren makabre Demagogie im Zusammenhang mit den Konzentrationslagern an den Pranger (2).
Doch diese Einigkeit der Bourgeoisie gegenüber dem Proletariat darf uns nicht über die Tatsache hinweg täuschen, dass die herrschende Klasse an den Nationalstaat gebunden bleibt und die Widersprüche zwischen den einzelnen Staaten nicht überwinden kann. Erst die Arbeiterklasse ist eine wahrhaft internationale Klasse, die über alle Grenzen hinweg die gleichen Interessen hat. Die Bourgeoise dagegen funktioniert immer nach den Gesetzen der Konkurrenz: jeder gegen jeden. Insbesondere seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts, seit der Weltmarkt grundsätzlich aufgeteilt ist und keine bedeutenden außerkapitalistischen Märkte mehr erobert werden können, spitzte sich diese Konkurrenz zu einem mörderischen Kampf zu, in dem jeder Nationalstaat dauernd darauf bedacht sein muss, seine Einflusssphäre gegen alle Rivalen zu verteidigen bzw. möglichst zu vergrößern. Genau aus diesem Grund werden seither so zahlreiche und so zerstörerische Kriege geführt wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Die ganze Barbarei der dekadenten kapitalistischen Ausbeutungsordnung kommt nicht allein in der Hölle der Produktionsstätten und im Massenelend zum Ausdruck, sondern auch in den unkontrollierbaren Konflikten zwischen den Nationalstaaten. Es ist eine gefährliche Illusion zu meinen, dass es hinter diesem Abschlachten des Proletariats in all den Kriegen, die seit 1914 geführt worden sind und immer noch werden, eine ökonomische Rationalität gebe.
Die Situation ist äußerst ernst. Und nur die bewusste, geeinte Tat des Proletariats kann den Untergang der Menschheit (und vielleicht jeden Lebens auf dem Planeten) aufhalten (3). Sich darüber Illusionen zu machen, wäre nicht nur dumm, sondern verantwortungslos. Denn die Zeit läuft gegen uns: Wenn die Barbarei der Massaker, der kriegerischen Zerstörung, des Raubbaus an der Natur noch lange fortdauert, wird ein Punkt eintreten, an dem es kein Zurück mehr gibt und die Perspektive einer klassenlosen Gesellschaft definitiv verloren geht, weil schlicht der Boden, auf dem eine solche Gesellschaft wachsen sollte, zerstört ist – im wörtlichen und im übertragenen Sinn.
Wie Pannekoek im bereits zitierten Aufsatz sagte: Die Beseitigung alter Illusionen ist die erste Aufgabe der Arbeiterklasse!
31.01.05
Fußnoten:
1) Die beiden Delegationen vereinbarten, dass jede eine Bilanz verfassen und diese vor der Veröffentlichung der anderen zur Vermeidung allfälliger Missverständnisse beim Zitieren der Position der anderen Gruppe unterbreiten sollte. Die Bilanz von Barikád Kollektíva befindet sich auf dem Internet unter anarcom.lapja.hu (auf Englisch und Ungarisch)
2) Vgl. dazu den Artikel „Die gemeinsame Verantwortung der Alliierten und der Nazis für den Holocaust“.
3) Wenn das Proletariat nicht geschlagen ist, kann die Bourgeoisie auch nicht einen Weltkrieg lostreten. Deshalb ist die Analyse von Barkikád, wonach der 2. Weltkrieg eine Antwort auf die Kämpfe der Arbeiterklasse in Spanien, Frankreich und China in den 1930er Jahren gewesen sei, falsch. Das Gegenteil trifft zu: Nur aufgrund der Niederlage der Arbeiterklasse nach der revolutionären Welle konnte die Bourgeoisie der verschiedenen Staaten in den verallgemeinerten Krieg ziehen (vgl. unser Buch The Italian Communist Left 1926–1945, auf Englisch, Französisch oder Italienisch bzw. Auszüge in Broschürenform auf Deutsch).
Politische Strömungen und Verweise:
Theoretische Fragen:
- Imperialismus [3]
Erbe der kommunistischen Linke:
Juli 2005
- 685 reads
Antwort an einen Leserbriefschreiber zum Thema: Rassismus und Spaltung der Arbeiterklasse
- 2419 reads
Lieber Genosse,
Dein Leserbrief dreht sich um die Themen Rassismus und Spaltung der Arbeiterklasse, und zwar anhand der Protestkundgebungen von Roma in der Ostslowakei im Frühjahr 2004. Die Roma protestierten gegen die Kürzung der Sozialhilfe um die Hälfte. Die Demonstration wurde von der Polizei auseinandergejagt, wobei es zahlreiche Verletzte und auch einen Toten (natürlich unter den Roma) gab. Du schreibst, dass für Dich grotesk gewesen sei, „dass die ‚slawischen’ Arbeiter einfach zusahen, obwohl viele von ihnen ebenfalls von dieser Halbierungsmaßnahme hart getroffen werden“. Du gehst weiter gestützt auf verschiedene Quellen davon aus, dass der Rassismus gegen Roma in Osteuropa weit verbreitet ist und sagst, dass Du es für nötig hältst, dass „Kommunisten dazu Stellung beziehen und eine Taktik gegenüber dem Rassismus entwickeln (...)
Lieber Genosse,
Dein Leserbrief dreht sich um die Themen Rassismus und Spaltung der Arbeiterklasse, und zwar anhand der Protestkundgebungen von Roma in der Ostslowakei im Frühjahr 2004. Die Roma protestierten gegen die Kürzung der Sozialhilfe um die Hälfte. Die Demonstration wurde von der Polizei auseinandergejagt, wobei es zahlreiche Verletzte und auch einen Toten (natürlich unter den Roma) gab. Du schreibst, dass für Dich grotesk gewesen sei, „dass die ‚slawischen’ Arbeiter einfach zusahen, obwohl viele von ihnen ebenfalls von dieser Halbierungsmaßnahme hart getroffen werden“. Du gehst weiter gestützt auf verschiedene Quellen davon aus, dass der Rassismus gegen Roma in Osteuropa weit verbreitet ist und sagst, dass Du es für nötig hältst, dass „Kommunisten dazu Stellung beziehen und eine Taktik gegenüber dem Rassismus entwickeln (...) Lenin soll etwa zu Anfang des 20. Jahrhunderts einmal in der Immigrantenfrage - in Russland gab es das ‚Problem’, dass aus allen vor allem den östlichsten Regionen des Zarenreiches wandernde Proletarier in die eher westlichen Zentren drängten - gesagt haben: ‚Lasset sie kommen, auf dass wir sie organisieren!’ Es hat tatsächlich einen fortschrittlichen Charakter, wenn Proletarier aus der Provinz und der Peripherie in die Zentren des Kapitalismus wandern, weil sie hier die proletarische Armee stärken, ganz besonders dann, wenn wir Kommunisten sie ihrer Diskriminierung, ihrer Assimilierung und Integrierung durch den bürgerlichen Staat zum Trotz, wenn wir sie agitieren. Der Kampf gegen Rassismus ist kein gesonderter Teil des Kampfes, sondern integraler Teil des Gesamtkampfes gegen den Kapitalismus. (...) Wenn in einem bürgerlichen Staat Schutzgesetze gegen Diskriminierung ... gegen Folter bestehen, fordern wir deren Einhaltung und denunzieren deren Nichteinhaltung und deren Alibifunktion.“ Im Anhang zu Deinem Brief weist Du weiter auf die Gefahr hin, dass sich Arbeitsimmigranten mit ihrem Herkunftsstaat identifizieren, was sich als politisches Hindernis auf dem Weg zur Kooperation mit der proletarischen Weltgemeinschaft erweise. Schliesslich kommst Du noch auf Gefahren für die Proletarier der Roma-Minderheit zu sprechen: „Die Proletarier der Roma dürfen nicht den Fehler machen, sich politisch mit den Minderheiten-Organisationen zu identifizieren. Sie müssen sich politisch auf das internationale Klassenterrain begeben. Nur auf dem internationalen Klassenterrain können sie ihre Klassenschwestern und -Brüder finden. (...) Auch in der Roma-Minderheit-Gruppe gibt es die Spaltung in Proletarier und Bourgeois.“
Wir möchten mit unserer Antwort gleich mit diesem letzten Gedanken beginnen, da er letztlich den Rahmen für die Stellungnahme zu den übrigen Ausführungen gibt: Entscheidend ist bei jedem Kampf, bei jedem Protest, bei jeder Bewegung, auf welchem Klassenterrain sie sich befinden. Ist der Kampf ein proletarischer oder ein Klassen übergreifender? Die Arbeiterklasse hat ihre spezifischen Interessen. Sie muss in ihren Kämpfen darauf achten, dass sie die Kontrolle über ihre Mittel und Ziele nicht verliert; sie muss ihre Selbständigkeit gegenüber anderen Klassen (Bourgeoisie, Kleinbürgertum, Lumpenproletariat) und gegenüber den Organen des Staates (Gewerkschaften) verteidigen. Über diese Grundsätze sind wir uns wahrscheinlich einig.
Weniger klar ist aufgrund der vorhandenen Informationen der genaue Charakter der Proteste der Roma vor gut einem Jahr. Es spricht aber vieles dafür, dass sich die Roma als Leute, die die gleiche Sprache sprechen, zur Wehr setzten, und nicht als Arbeiter. Aus den Zeitungsberichten, die Du uns seinerzeit zukommen liessest, ergibt sich nicht, dass sich primär die Roma-Arbeiter an den Protestkundgebungen versammelt hätten. Vielmehr veranstalteten anscheinend die Roma-Familien als Roma, eben klassenübergreifend, den Protest. Dass beispielsweise irgendwo Arbeiter in einen Streik getreten wären, liess sich den Meldungen aus der Presse (die natürlich die bürgerliche ist und mit Vorsicht genossen werden muss) nicht entnehmen. Es ist ohnehin davon auszugehen, dass sich primär Sozialhilfeempfänger an diesen Protestaktionen beteiligten, die zwar zum grösseren Teil zur Arbeiterklasse gehören dürften, aber ohne Beteiligung von Arbeitern, die noch im Produktionsprozess stehen, einen schweren Stand haben mussten. Dies erklärt wohl auch zu einem guten Teil, weshalb anscheinend nur Roma an den Kundgebungen teilnahmen, denn wenn sich Arbeiter in den Betrieben gegen Angriffe auf die Lebensbedingungen zur Wehr setzen, spielen Hautfarbe und Muttersprache meistens keine Rolle mehr.
Wenn sich Roma als Volksgruppe zur Wehr setzen, kann auch kein Gefühl einer Klassenidentität aufkommen, selbst wenn die meisten Proletarier wären (was im konkreten Fall alles andere als verbürgt ist). Dies ist in der heutigen Zeit die grosse Herausforderung für die Arbeiterklasse, nicht nur am östlichen Rand von Mitteleuropa, sondern selbst dort, wo sich die starken Konzentrationen der Arbeiterklasse befinden: Deutschland, Frankreich, Italien, Grossbritannien etc. Die Arbeiter müssen sich wieder als Klasse wahrnehmen, begreifen und Vertrauen in ihre Stärke gewinnen. Dieser Prozess wird aber voraussichtlich zuerst in den Zentren der kapitalistischen Wirtschaft in Gang kommen - er ist bereits in Gang, wenn auch erst schüchtern und uneinheitlich. Die Proteste von verarmten Bauern in Bolivien, von Arbeitslosen in Argentinien, von Roma in der Ostslowakei sind zwar verständlich, aber meist nicht nur ohnmächtig, sondern darüber hinaus dazu verdammt, auf dem Roulette-Tisch der Bourgeoisie von Gewerkschaften, Piqueteros, der Mafia, NGOs etc. hin- und hergeschoben zu werden (vgl. dazu auch den Artikel des NCI in der neusten Internationalen Revue Nr. 35 „Die Mystifikation der Piqueteros in Argentinien“). Es sind diese bürgerlichen Organisationen, die daraus ihren Nutzen ziehen, manchmal die einen, manchmal die anderen - in jedem Fall jede gegen jede.
Wir teilen Deine Empörung gegenüber dem Rassismus, gegenüber jeder Art von Pogrommentalität. Wir haben bereits im letzten längeren Brief (vom 20. Februar) auf die Wichtigkeit einer proletarischen Ethik hingewiesen. Aber für die Lage der Roma in Osteuropa ist der „Rassismus der Slawen“ (Du sagst es zwar nicht so, aber den Gedanken konsequent zu Ende geführt, bedeutet er dies) weder der Kern des Problems noch der Ansatzpunkt für eine Lösung. Der Schlüssel liegt vielmehr, wie Du richtig mit Deinem Hinweis auf den Internationalismus vermutest, in der Erkenntnis der Arbeiter welcher Zunge auch immer, dass sie alle Arbeiter sind und ein gemeinsames Interesse haben: dasjenige an der Abschaffung der Lohnsklaverei und der Profitlogik.
Zu den „Schutzgesetzen gegen Diskriminierung und Folter“: Wir sind damit einverstanden, dass eine revolutionäre Organisation die Nichteinhaltung dieser Gesetze und deren Alibifunktion entlarven muss. Aber „deren Einhaltung“ zu „fordern“, ist nicht unsere Funktion - im Gegenteil: Dies würde die Illusion nähren, dass ihnen doch irgendwie noch eine positive, progressive Funktion zukomme. Und genau diese Lüge müssen wir ja schonungslos als solche beleuchten und zerreissen. Die Demokratie gehört auf den Müllhaufen der Geschichte, sie soll nicht mehr eingefordert werden, nicht einmal in Teilaspekten.
Was den von Dir zitierte Satz Lenins betrifft, so darf man nicht vergessen, dass der Kapitalismus zur damaligen Zeit (Anfang des 20. Jahrhunderts) noch eine andere Dynamik hatte als heute. Die relativ hoch entwickelte Industrie im Westen des Zarenreichs, war noch in der Lage, die anströmenden proletarisierten oder sich proletarisierenden Bauern in den Produktionsprozess zu integrieren, ihnen Arbeit zu geben und sie als Arbeitskräfte auszubeuten. Die Putilov-Werke in St. Petersburg waren die grösste Fabrik der Welt. Wie fürchtet sich dagegen das deutsche Kapital heute vor einer Öffnung der EU-Tore für die türkischen Arbeiter! Heute findet gewissermassen der umgekehrte Prozess statt: Es sind nicht mehr die Bauern aus der Peripherie, die sich in den Zentren proletarisieren, sondern Arbeiter von überall, die auch im Zentrum keine Anstellung mehr finden und in der Konsequenz der absoluten Verarmung preisgegeben sind. Der Kapitalismus ist in seiner Endphase angelangt, wo er sein „letztes Wort“ spricht - in seiner Zerfallsphase: „Man begreift die Narrheit der ökonomischen Weisheit, die den Arbeitern predigt, ihre Zahl den Verwertungsbedürfnissen des Kapitals anzupassen. Der Mechanismus der kapitalistischen Produktion und Akkumulation passt diese Zahl beständig diesen Verwertungsbedürfnissen an. Erstes Wort dieser Anpassung ist die Schöpfung einer relativen Überbevölkerung oder industriellen Reservearmee, letztes Wort das Elend stets wachsender Schichten der aktiven Arbeiterarmee und das tote Gewicht des Pauperismus.“ (Marx, Kapital, MEW 23, 674)
Die Zeit des Kapitalismus ist abgelaufen; doch nicht nur dies - sie läuft mittlerweile auch gegen die Arbeiterklasse. Die Bedingungen für die proletarische Revolution werden nicht besser, sondern mit jedem Tag schwieriger. Dies war vor 100 Jahren wesentlich anders. Insofern gilt auch für den von Dir zitierten Satz Lenins: Es gibt keine ewigen Wahrheiten. Oder wie Engels sagte: „Darin aber grade lag die wahre Bedeutung und der revolutionäre Charakter der Hegelschen Philosophie (...), dass sie der Endgültigkeit aller Ergebnisse des menschlichen Denkens und Handelns ein für allemal den Garaus machte.“ (MEW 21, 267) Eine Invarianz ist dem Marxismus fremd, zutiefst zuwider.
Wir möchten diesen Brief hiermit einstweilen abschliessen. Vielleicht hat es andere wichtige Aspekte in Deinem Schreiben, auf die wir noch nicht eingegangen sind. Wir haben nicht zu jedem Punkt, mit dem wir einverstanden sind, ausdrücklich Stellung genommen, sondern sind eher auf diejenigen Fragen eingegangen, die für uns in Deinem Brief unklar oder mit denen wir nicht einverstanden sind. Schreib uns aber gerne, wenn Du auch eine Stellungnahme zu anderen, hier nicht behandelten Themen wünschst. Und selbstverständlich sind wir an Deiner Replik auf unsere Antwort interessiert.
Mit den besten Wünschen und Grüssen
IKS
Erbe der kommunistischen Linke:
- Teilbereichskämpfe [17]
„Weltführer“ und „internationale Terroristen“ – sie alle massakrieren die Arbeiter!
- 2813 reads
Wer waren die ersten Opfer der terroristischen Angriffe im Zentrum Londons am 7. Juli 2005? Wie in New York 2001 und Madrid 2004 richteten sich die Bomben bewusst gegen Arbeiter, Menschen, die U-Bahn und Busse auf ihrem Weg zur Arbeit benutzten. Al Qaida, das die Verantwortung für diesen Massenmord übernommen hat, sagt, dass es aus Rache für die „britischen militärischen Massaker im Irak“ gehandelt habe. Doch das endlose Gemetzel an der Bevölkerung im Irak ist nicht die Schuld der arbeitenden Menschen in Großbritannien; es geht auf das Konto der herrschenden Klasse Großbritanniens, Amerikas – nicht zu vergessen die Terroristen des so genannten „Widerstandes“, die Tag für Tag ihren eigenen Part beim Töten unschuldiger Arbeiter und Zivilisten in Bagdad und anderen irakischen Städten spielen.
Wer waren die ersten Opfer der terroristischen Angriffe im Zentrum Londons am 7. Juli 2005? Wie in New York 2001 und Madrid 2004 richteten sich die Bomben bewusst gegen Arbeiter, Menschen, die U-Bahn und Busse auf ihrem Weg zur Arbeit benutzten. Al Qaida, das die Verantwortung für diesen Massenmord übernommen hat, sagt, dass es aus Rache für die „britischen militärischen Massaker im Irak“ gehandelt habe. Doch das endlose Gemetzel an der Bevölkerung im Irak ist nicht die Schuld der arbeitenden Menschen in Großbritannien; es geht auf das Konto der herrschenden Klasse Großbritanniens, Amerikas – nicht zu vergessen die Terroristen des so genannten „Widerstandes“, die Tag für Tag ihren eigenen Part beim Töten unschuldiger Arbeiter und Zivilisten in Bagdad und anderen irakischen Städten spielen. Die Architekten des Krieges gegen den Irak, die Bushs und Blairs, sind dagegen gut aufgehoben; darüber hinaus verschaffen ihnen die Gräueltaten der Terroristen die perfekte Ausrede, ihr nächstes militärisches Abenteuer in Angriff zu nehmen, so wie sie es in Afghanistan und im Irak im Kielwasser des 11. Septembers gemacht haben.
All dies befindet sich in der Logik des imperialistischen Krieges: Kriege, die im Interesse der kapitalistischen Klasse ausgefochten werden, Kriege um die Vorherrschaft über den Planeten. Die weite Mehrheit der Opfer solcher Kriege sind die Ausgebeuteten, die Unterdrückten, die Lohnsklaven des Kapitals. Die Logik des imperialistischen Krieges rührt nationalen und rassischen Hass auf und macht ganze Völker zu „Feinden“, die beleidigt, angegriffen und vernichtet werden. Sie hetzt Arbeiter gegen Arbeiter auf und macht es ihnen unmöglich, ihre gemeinsamen Interessen zu verteidigen. Schlimmer noch, sie ruft die Arbeiter dazu auf, sich hinter der Nationalfahne und dem Nationalstaat einzureihen, um bereitwillig in den Krieg zu ziehen für Interessen, die nicht die ihren sind, sondern die Interessen ihrer Ausbeuter sind.
In seiner Stellungnahme zu den Bombenanschlägen in London auf dem Treffen der Reichen und Mächtigen anlässlich des G8-Gipfels sagte Blair: „Es ist jedoch wichtig, dass jene, die sich am Terrorismus beteiligen, erkennen, dass unsere Entschlossenheit, unsere Werte und unseren Lebenswandel zu verteidigen, größer ist als ihre Entschlossenheit, unschuldigen Menschen Tod und Zerstörung zu bringen“.
Die Wahrheit ist, dass Blairs Werte und Bin Ladens Werte exakt dieselben sind. Beide sind gleichermaßen bereit, bei der Verfolgung ihrer schmutzigen Absichten unschuldigen Menschen Tod und Zerstörung zu bringen. Der einzige Unterschied zwischen beiden besteht darin, dass Blair ein großer imperialistischer Gangster und Bin Laden ein kleiner ist. Wir sollten entschieden all jene zurückweisen, die uns auffordern, für die eine oder die andere Seite Partei zu ergreifen.
Alle Solidaritätserklärungen der „Weltführer“ mit den Opfern der Londoner Bombenanschläge sind pure Heuchelei. Sie sind die Führer eines Gesellschaftssystems, das im letzten Jahrhundert in zwei barbarischen Weltkriegen und zahllosen anderen Konflikten, von Korea bis zum Golfkrieg, von Vietnam bis Palästina, zig Millionen Menschenleben auslöschten. Und im Gegensatz zu den Illusionen, mit denen Geldof, Bono und der Rest hausieren gehen, sind sie die Führer eines Systems, das schon wegen seines eigentlichen Charakters die Armut nicht „zu Geschichte machen“ kann, sondern Hunderte von Millionen zu wachsendem Elend verurteilt und bei der Verteidigung seiner Profite fleißig den Planeten vergiftet. Die Solidarität, die die Weltführer wollen, ist eine falsche Solidarität, die nationale Einheit zwischen Klassen, die es ihnen erlauben wird, künftig neue Kriege auszulösen.
Die einzig wahre Solidarität ist die internationale Solidarität der Arbeiterklasse, die auf gemeinsamen Interessen beruht, die von den Ausgebeuteten aller Länder geteilt wird. Eine Solidarität, die über alle rassischen und religiösen Teilungen hinweg schreitet und die die einzige Kraft ist, die der kapitalistischen Logik des Militarismus und Krieges widerstehen kann.
Die Geschichte hat die Macht einer solchen Solidarität gezeigt: 1917-18, als Meutereien und Revolutionen in Russland und Deutschland dem Blutbad des Ersten Weltkrieges ein Ende gemacht haben. Und die Geschichte zeigte auch, welch fürchterlichen Preis die Arbeiterklasse zahlte, als diese Solidarität erneut von nationalem Hass und der Loyalität gegenüber der herrschenden Klasse ersetzt wurde: der Holocaust des Zweiten Weltkrieges. Heute verbreitet der Kapitalismus erneut Krieg über die Erde. Wenn wir ihn dabei aufhalten wollen, uns mit Chaos und Zerstörung zu überziehen, müssen wir all die patriotischen Appelle unserer Herrscher zurückweisen, für die Verteidigung unserer Interessen als Arbeiter kämpfen und uns gegen diese sterbende Gesellschaft, die uns nichts anderes anzubieten hat als Tod und Schrecken in ständig wachsenden Dimensionen, vereinen.
Internationale Kommunistische Strömung
7. Juli 2005
Geographisch:
- Großbritannien [18]
Theoretische Fragen:
- Terrorismus [19]
August 2005
- 731 reads
Antwort auf eine „rätistische Bilanz“ der russischen Revolution
- 2941 reads
Wir veröffentlichen im Folgenden eine Antwort auf den Brief eines unserer Kontakte, der uns schrieb, um die, wie der Genosse sie nannte, „rätistische Bilanz der russischen Revolution“ zu verteidigen. Seit dem Verschwinden der holländischen Gruppe um „Daad en Gedachte“ gibt es innerhalb der proletarischen Bewegung keinerlei organisierten Ausdruck des Rätismus mehr. Nichtsdestotrotz erfreut sich die rätistische Position innerhalb der gegenwärtigen revolutionären Bewegung großer Beliebtheit.
Wie soll man mit dem „Russischen Rätsel“ umgehen?
Wir veröffentlichen im Folgenden eine Antwort auf den Brief eines unserer Kontakte, der uns schrieb, um die, wie der Genosse sie nannte, „rätistische Bilanz der russischen Revolution“ zu verteidigen. Seit dem Verschwinden der holländischen Gruppe um „Daad en Gedachte“ gibt es innerhalb der proletarischen Bewegung keinerlei organisierten Ausdruck des Rätismus mehr. Nichtsdestotrotz erfreut sich die rätistische Position innerhalb der gegenwärtigen revolutionären Bewegung großer Beliebtheit.
Der Rätismus verwirft einerseits liberale, anarchistische und sozialdemokratische Positionen, andererseits aber auch die Positionen der „Leninisten“, Stalinisten und Trotzkisten. Dies sieht auf den ersten Blick sehr attraktiv aus.
Den Kern der rätistischen Position bildet das so genannte „russische Rätsel“, eine Fragestellung von großer Bedeutung für die gegenwärtige und zukünftige Arbeiterbewegung. In ihr wird die Frage aufgeworfen, ob die russische Revolution einen Versuch darstellt, der – kritisch betrachtet, wie es die Art des Marxismus ist - als Grundlage für die nächste revolutionäre Welle dienen kann, oder ob sie - wie die Bourgeoisie, durch den Anarchismus und indirekt durch den Rätismus bestärkt, sagt - völlig abgelehnt werden müsse, da das Monster des Stalinismus seinen Ursprung im „Leninismus“ habe. [1]
Aus unserer Sicht ist es wichtig und notwendig, den Brief des Genossen zu beantworten, denn diese Debatte erlaubt uns, einerseits die rätistische Position zu widerlegen und andererseits zur Klärung innerhalb der revolutionären Bewegung beizutragen.
Werter Genosse,
zu Beginn deines Textes wirfst Du eine Frage auf, die wir vollständig teilen: „Das Verständnis von der Verteidigung der Russischen Revolution ist eine fundamentale Frage für die Arbeiterklasse, denn wir leben noch immer unter der Last des Scheiterns der revolutionären Welle, die mit der Russischen Revolution begonnen hatte: Dies vor allem, weil die Konterrevolution nicht die klassische Form der militärischen Wiederherstellung der alten Herrschaft annahm, sondern die des Stalinismus, der sich selbst ‚kommunistisch’ nannte. Dies bedeutete einen fürchterlichen Schlag für das internationale Proletariat. Die Bourgeoisie hat diesen Vorteil vollständig ausgeschlachtet, um unter den Arbeitern Verwirrung und Demoralisierung zu säen und den Kommunismus als historische Perspektive der Menschheit zu leugnen. Deshalb müssen wir eine historische Bilanz ziehen, die auf dem historischen Versuch der Arbeiterklasse und der wissenschaftlichen Methode des Marxismus beruht, so wie es die Fraktionen der Kommunistischen Linken während der 50 Jahre der Konterrevolution taten. Eine Bilanz, die wir an eine neue Generation von Arbeitern weitergeben können“.
Völlig richtig! Die Konterrevolution wurde nicht im Namen der „Wiederherstellung des Kapitalismus“ durchgeführt, sondern unter dem Banner des „Kommunismus“. Es war nicht die Weiße Armee, die die kapitalistische Herrschaft in Russland errichtete, sondern dieselbe Partei, die einst die Vorhut der Revolution gewesen war.
Dieses Ergebnis hat die gegenwärtigen Generationen von Arbeitern und Revolutionären traumatisiert und dazu verleitet, an der Fähigkeit ihrer Klasse und der Gültigkeit ihrer revolutionären Traditionen zu zweifeln. Trugen Lenin und Marx nicht, wenn auch unbeabsichtigt, zur stalinistischen Barbarei bei? Gab es wirklich eine authentische Revolution in Russland? Besteht nicht die Gefahr, dass „politisches Denken“ das, was die Arbeiter errichtet haben, zerstört?
Die Bourgeoisie hat diese Ängste mit ihren permanenten Verleumdungskampagnen gegen die Russische Revolution, den Bolschewismus und gegen Lenin, die alle von den stalinistischen Lügen genährt wurden, geschürt. Die demokratische Ideologie, die die Bourgeoisie auf hohem Niveau das 20. Jahrhundert hindurch propagiert hat, verstärkt diese Ressentiments durch das Beharren auf der „Unabhängigkeit des Individuums“ sowie dem „Respekt vor jedermanns Meinung“ und die Zurückweisung von „Dogmatismus“ und „Bürokratie“.
Der Begriff der Zentralisierung, die Klassenpartei und die Diktatur des Proletariats, die die Früchte des blutigen Kampfes, das Resultat enormer Bemühungen um politische und theoretische Klärung sind, sind vom schändlichen Stigma des Argwohns besudelt worden. Nicht zu vergessen Lenin, der total abgelehnt wird und dessen Beitrag einem hartnäckigen Scherbengericht ausgesetzt ist, in welchem Phrasen aus ihrem Zusammenhang gerissen werden, wie jene wohl bekannteste, wonach das Bewusstsein von außen komme! [2]
Diese Kombination von Befürchtungen und Zweifeln auf der einen sowie dem Druck der bürgerlichen Ideologie auf der anderen Seite beinhaltet die Gefahr, die Verbindung mit der historischen Kontinuität unserer Klasse, mit ihrem Programm und ihrer wissenschaftlichen Methode, ohne die keine neue Revolution möglich ist, zu verlieren.
Der Rätismus ist Ausdruck dieses Gewichts und zeigt sich durch seine Fixierung auf das Unmittelbare, Lokale und Ökonomische – auf Dinge, die als nahe liegend und am besten kontrollierbar betrachtet werden. Gleichzeitig weist er ostentativ all das zurück, was nach Politik und Zentralisierung riecht, gilt dies doch seit jeher als abstrakt, weit weg und feindlich.
Richtigerweise sprachst Du von „den Beträgen der Fraktionen der Kommunistischen Linken, die gegen den Strom während der 50 Jahre Konterrevolution gerichtet waren“. Wir stimmen damit völlig überein. Doch der Rätismus gehört nicht zu diesen Bemühungen, er steht außerhalb von ihnen.
In diesem Zusammenhang ist es notwendig, zwischen dem Rätekommunismus und dem Rätismus zu unterscheiden. [3] Der Rätismus ist ein extremer Ausdruck der Entartung jener theoretischen Fehler, die in den 1930ern inmitten der originären Bewegung des Rätekommunismus begangen wurden. Er ist ein unverhohlen opportunistischer Versuch, Positionen zur Frage der Russischen Revolution, der Diktatur des Proletariats, der Partei, der Zentralisierung etc., die die Bourgeoisie schon Tausende Male aggressiv vertreten hat und die vom Anarchismus wiedergekäut wurden, in ein marxistisches Gewand zu kleiden.
Indem wir uns fest auf die russische Erfahrung stützen, sehen wir, dass der Rätismus hauptsächlich zwei Pfeiler des Marxismus angreift: den internationalen und den grundsätzlich politischen Charakter der proletarischen Revolution.
Im Folgenden konzentrieren wir uns auf zwei Fragen: Wie bildet sich das Klassenbewusstsein?
Und: Worin besteht die Rolle der Partei und wie sehen ihre Verbindungen zur Klasse aus?
Selbstverständlich gibt es noch viele andere Fragen, die es zu beantworten lohnt. Jedoch können wir aus Platzgründen nicht auf alle eingehen. Vor allem diese beiden, die Du hervorgehoben hast, scheinen uns allerdings für die Lösung des ‚russischen Rätsels‘ besonders entscheidend zu sein.
Weltrevolution oder „Sozialismus in einem Land“?
An verschiedenen Stellen Deines Textes warnst Du davor, die Weltrevolution als Entschuldigung für die Vertagung des Kampfes für den Kommunismus auf unbestimmte Zeit und als Rechtfertigung für die Diktatur der Partei zu nehmen. „Es gibt diejenigen, die alle bürokratischen Entartungen der Revolution mit dem Bürgerkrieg und seinen Verwüstungen, mit der Isolation der Revolution .wegen des Ausbleibens einer Weltrevolution und dem rückständigen Charakter der russischen Ökonomie entschuldigen wollen. All dies erklärt aber nicht die innere Degeneration der Revolution. Warum wurde sie nicht von außen, auf dem Schlachtfeld, sondern vielmehr von innen heraus zerstört? Die einzige Erklärung, die uns solche Entschuldigungen geben, ist, dass wir unsere Wünsche dahingehend formulieren, dass die nächste Revolution doch in den hochentwickelten Ländern stattfinden und nicht isoliert bleiben soll“ Ein wenig später äußerst Du: „Die Revolution kann sich nicht bis zum Sieg der Weltrevolution mit der Verwaltung des Kapitalismus begnügen. Sie muss die kapitalistischen Produktionsverhältnisse (Lohnarbeit und Warenwirtschaft) abschaffen“.
Die bürgerlichen Revolutionen waren nationale Revolutionen. Der Kapitalismus entstand zunächst in den Städten und existierte lange Zeit inmitten einer bäuerlichen Welt, die durch den Feudalismus beherrscht wurde; seine sozialen Beziehungen konnten sich isoliert von anderen Ländern in einem Land entwickeln. So konnte die Bourgeoisie in England 1640 triumphieren, während auf dem übrigen Kontinent noch das Feudalregime herrschte.
Kann das Proletariat denselben Weg gehen? Kann das Proletariat damit anfangen, „kapitalistische Produktionsverhältnisse in einem Land abzuschaffen“, ohne auf die „weit entfernte“ Weltrevolution zu warten?
Wir sind uns sicher, dass Du Stalins Position des „Sozialismus in einem Land“ nicht teilst. Doch wenn Du forderst, dass das Proletariat beginnen soll, Lohnarbeit und Warenwirtschaft abzuschaffen, ohne auf den Sieg der Weltrevolution zu warten, dann lässt Du diese Auffassung durch die Hintertür wieder hinein. Es gibt keinen Mittelweg zwischen der weltweiten Errichtung des Kommunismus und dem Aufbau des „Sozialismus in einem Land“.
Es gibt einen grundsätzlichen Unterschied zwischen den bürgerlichen und den proletarischen Revolutionen. Erstere sind in ihren Wegen, Mitteln und Zielen national. Auf der anderen Seite steht die proletarische Revolution. Sie ist die erste weltweite Revolution der Geschichte und dies sowohl bezogen auf ihr Ziel, den Kommunismus, wie auch in Bezug auf ihre Mittel (den internationalen Charakter sowohl der Revolution selbst wie auch der Errichtung der neuen Gesellschaft).
Die Arbeiter haben kein Vaterland, da mit ihnen„die Großindustrie eine Klasse schuf, die in allen Ländern dasselbe Interesse hat, womit jede Nationalität schon tot ist“ (Deutsche Ideologie, Seite 78, englische Studienausgabe). „Die große Industrie hat schon dadurch, dass sie den Weltmarkt geschaffen hat, alle Völker der Erde, und namentlich die zivilisierten, in eine solche Verbindung miteinander gebracht, dass jedes einzelne Volk davon abhängig ist, was bei einem andern geschieht. Sie hat ferner in allen zivilisierten Ländern die gesellschaftliche Entwicklung so weit gleichgemacht, dass in allen diesen Ländern Bourgeoisie und Proletariat die beiden entscheidenden Klassen der Gesellschaft, der Kampf zwischen beiden der Hauptkampf des Tages geworden ist. Die kommunistische Revolution wird daher keine bloß nationale, sie wird eine in allen zivilisierten Ländern, d.h. wenigstens in England, Amerika, Frankreich und Deutschland gleichzeitig vor sich gehende Revolution sein“ (Grundsätze des Kommunismus, 1847, MEW, Bd. 4, S. 374).
Gegen diese internationalistische Denkweise propagierte Stalin 1926-1927 die These vom „Sozialismus in einem Land“ – eine These, die Trotzki und alle Tendenzen der Kommunistischen Linken (einschließlich der Deutsch-Holländischen Kommunisten) als Verrat betrachteten und die die italienische Linksgruppierung Bilan als Todesurteil der Kommunistischen Internationalen charakterisierte.
Der Anarchismus für seinen Teil argumentiert im Wesentlichen ähnlich wie der Stalinismus. Mit seiner Gegnerschaft zum Prinzip der Zentralisierung grenzt er sich zwar einerseits von der Position des „Sozialismus in einem Land“ ab, aber andererseits propagiert er durch Begrifflichkeiten wie „Autonomie“ und „Selbstverwaltung“ den Sozialismus in einem Dorf oder in einer Fabrik Sicherlich erwecken solche Formulierungen einen „demokratischeren“ Anschein, setzen sie doch auf die Initiative der Massen. Doch letztendlich führen sie genauso wie der Stalinismus zur Verteidigung der kapitalistischen Ausbeutung und des bürgerlichen Staates. [4] Natürlich ist der Weg verschieden: Während der Stalinismus zum Mittel der brutalen bürokratischen Hierarchie griff, zieht es der Anarchismus vor, demokratische Vorstellungen wie die „Souveränität“ und „Autonomie“ des „freien“ Individuums auszubeuten und zu fördern sowie die Arbeiter dazu zu verleiten, ihr eigenes Elend durch lokale und sektorale Organe selbst zu verwalten.
Was ist die Position des Rätismus? Wie wir schon eingangs sagten, hat es eine Entwicklung der verschiedenen Komponenten dieser Strömung gegeben. So führten die von der GIK vertretenen „Thesen des Bolschewismus“ [5] zwar zu großen Verwirrungen. Jedoch stellte die GIK nie die Natur der weltweiten proletarischen Revolution offen in Frage, auch wenn ihre Betonung des angeblich ökonomischen Charakters der Revolution der Abwendung von diesem Prinzip Tür und Tor öffnet. Die nachfolgenden rätistischen Gruppen, besonders jene aus den 1970er Jahren, erörterten hingegen offen die These von der Errichtung eines „lokalen und nationalen“ Sozialismus. Wir haben dies in verschiedenen Polemiken unserer Internationalen Revue bekämpft und uns in etlichen Artikeln gegen die Auffassungen verschiedener rätistischer Gruppen über Fragen wie die der Drittwelttheorien und der Selbstverwaltung gewandt. [6]
Im Gegensatz zu dem, was Du uns zu verstehen gibst, ist der proletarische Internationalismus kein frommer Wunsch oder eine Möglichkeit unter anderen, sondern vielmehr die konkrete Antwort auf die historische Entwicklung des Kapitalismus.
Seit 1914 haben alle Revolutionäre verstanden, dass die einzige Revolution, die auf der Tagesordnung stand, nur die sozialistische, internationale und proletarische sein konnte. „Aber nicht unsere Ungeduld, nicht unsere Wünsche, sondern die vom imperialistischen Krieg erzeugten objektiven Bedingungen haben die Menschheit in eine Sackgasse geführt und sie vor das Dilemma gestellt: entweder zulassen, dass weitere Millionen Menschen zugrunde gehen und die ganze europäische Kultur endgültig vernichtet wird, oder in allen zivilisierten Ländern die Macht dem revolutionären Proletariat übergeben, die sozialistische Umwälzung verwirklichen“ (Lenin, Abschiedsbrief an die Schweizer Arbeiter, April 1917, Gesammelte Werke, Bd. 23, S. 384).
Es ist nicht nur die Reife der historischen Situation, die die Weltrevolution auf die Tagesordnung setzt. Auch die Analyse des Kräfteverhältnisses der Klassen im Weltmaßstab erlaubt diese Schlussfolgerung. Die frühest mögliche Gründung der Internationalen Partei des Proletariats ist auch ein grundlegendes Element, die Balance des Kräfteverhältnisses mit dem Feind zugunsten des Proletariats zu verändern. Denn die rasche Gründung einer internationalen Partei erschwert es der Bourgeoisie, die revolutionären Brennpunkte zu isolieren. Schon vor der Machtübernahme 1917 kämpfte Lenin in den Reihen der Zimmerwalder Linken daher um die unverzügliche Konstituierung einer neuen Internationalen: „Gerade wir müssen, gerade jetzt, ohne Zeit zu verlieren, eine neue revolutionäre, proletarische Internationale gründen, oder richtiger gesagt, wir dürfen uns nicht fürchten, vor aller Welt zu erklären, dass sie schon gegründet ist und wirkt“.
(„Die Aufgaben des Proletariats in unserer Revolution“, 1917. Gesammelte Werke, Bd. 24, S. 68)
Im September 1917 stellte Lenin in einem Brief an den bolschewistischen Kongress der nördlichen Region (8. Oktober 1917) die Notwendigkeit der Machtübernahme fest, wobei er sich auf eine Analyse des internationalen Kräfteverhältnisses zwischen dem Proletariat und der Bourgeoisie stützte: „Unsere Revolution macht eine im höchsten Maße kritische Zeit durch. Diese Krise fällt zusammen mit der großen Krise des Heranreifens der sozialistischen Weltrevolution und ihrer Bekämpfung Durch den Weltimperialismus (...) Die Sowjets der beiden Hauptstädte [müssen] die Macht ergreifen“ (Brief an die Genossen Bolschewiki, 8. Okt. 1917, Lenin, Werke, Bd. 26, S. 169) „Dadurch retten sie sowohl die Weltrevolution (...) wie auch die russische Revolution“ (ebenda, 1. Okt. 1917, S. 125) Die Revolution in Russland befand sich nach dem Fehlschlag des Kornilow-Putsches in einer delikaten Lage: Wenn die Sowjets nicht in die Offensive gegangen wären (die Machtübernahme), hätten Kerenski und seine Freunde neue Anstrengungen unternommen, sie zu lähmen und später zu liquidieren, um auf diese Weise die Revolution zu zerstören.
Dies hatte eine noch größere Bedeutung für Deutschland, Österreich, Frankreich, England etc., wo die Unzufriedenheit der Arbeiter entweder einen mächtigen Impuls durch die russische Revolution erhielt oder im Gegenteil Gefahr lief, sich in einer Reihe von Einzelgefechten aufzureiben.
Die Machtübernahme in Russland wurde überall als ein Beitrag zur Weltrevolution betrachtet und nicht als eine Aufgabe nationalen Wirtschaftsmanagements. Einige Monate nach jenem Oktober sprach Lenin auf der Konferenz der Fabrikkomitees in der Moskauer Region in diesem Sinne „Die russische Revolution ist nur ein Kontingent der internationalen sozialistischen Armee, von deren Aktion der Erfolg und der Triumph unserer Revolution abhängt. Dies ist ein Fakt, den niemand von uns aus den Augen verlieren darf (…) Angesichts der Isolation ihrer Revolution ist sich das russische Proletariat sehr wohl bewusst, dass eine wesentliche Bedingung und eine zentrale Erfordernis für ihren Sieg die gemeinsame Aktion der Arbeiter der ganzen Welt ist“.
Ökonomische oder politische Revolution?
Indem Du Dir die rätistische Position zu Eigen machst, betrachtest Du als die treibende Kraft die Durchführung der kommunistischen ökonomischen Maßnahmen vom ersten Tag der Revolution an. Du bringst das in zahlreichen Passagen deines Textes zum Ausdruck, so wenn Du schreibst „… im April 1918 veröffentlichte Lenin ‚Die unmittelbaren Aufgaben der Sowjetmacht’, worin er die Idee der Errichtung eines Staatskapitalismus unter der Kontrolle der Partei mit dem Ziel untersucht, die Produktivität, Rentabilität und Arbeitsdisziplin zu erhöhen sowie um der kleinbürgerlichen Mentalität und dem anarchistischen Einfluss ein Ende zu bereiten, und wo er ohne Zweifel bürgerliche Methoden propagierte wie zum Beispiel: den Einsatz bürgerlicher Spezialisten, Akkordarbeit, die Anwendung des Taylorismus, Ein-Mann- Management [7]… Als ob die Methoden der kapitalistischen Produktion neutral seien und ihre Anwendung durch die Arbeiterpartei ihren sozialistischen Charakter garantieren würde. Der Zweck des sozialistischen Aufbaus rechtfertigt die Mittel.“ Als eine Alternative schlägst Du vor, dass sich „die Revolution nicht selbst auf die Verwaltung des Kapitalismus beschränken darf bis zum weit entfernt liegenden Triumph der Revolution, sie muss die kapitalistischen Produktionsverhältnisse (wie Lohnarbeit und Warenwirtschaft) abschaffen“, indem „sie die Vergesellschaftung der Produktionsverhältnisse mit der Berechnung der notwendigen, gesellschaftlichen Arbeit für die Herstellung der Güter“ entwickelt.
Der Kapitalismus hat die Bildung des Weltmarktes mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts abgeschlossen. Dies bedeutet, dass das Wertgesetz in der ganzen Weltwirtschaft wirksam ist und sich kein Land oder keine Ländergruppe diesem Gesetz entziehen kann. Die proletarische Bastion (das Land oder die Länder, in denen die Revolution gesiegt hat) bildet darin keine Ausnahme. Die Machtergreifung in der proletarischen Bastion bedeutet nicht die Bildung eines „befreiten Gebietes“. Im Gegenteil, dieses Gebiet wird solange dem Feind gehören, wie es weiterhin dem Wertgesetz der kapitalistischen Welt unterworfen ist.[8] Die Macht des Proletariats ist hauptsächlich politisch und die wesentliche Rolle des Gebietes, das gewonnen wurde, besteht darin, als Brückenkopf der Weltrevolution zu agieren.
Der Kapitalismus hat der Menschheitsgeschichte zwei Vermächtnisse hinterlassen: die Bildung des Proletariats und den objektiv internationalen Charakter der Produktivkräfte. Diese zwei Vermächtnisse werden von der Theorie der „unmittelbaren Vergesellschaftung der Produktionsverhältnisse“ grundsätzlich angegriffen: so durch die vermeintliche „Abschaffung“ der Lohnarbeit und die Errichtung eines Marktes auf der Ebene der Fabrik, der Stadt oder des jeweiligen Landes. Einerseits kehrt dies die Produktion um in eine Mischung kleiner, autonomer Einheiten, wodurch sie zum Gefangenen der Tendenz zur Explosion und Fragmentierung wird, die den Kapitalismus in dieser Phase der Dekadenz prägt und in dramatischer Art und Weise in ihrer Endphase des Zerfalls konkretisiert wird. [9] Andererseits führt es zur Spaltung des Proletariats, wenn es an die Interessen und Bedürfnisse einzelner lokaler, sektoraler oder nationaler Einheiten gebunden wird, die von den kapitalistischen Produktionsverhältnissen „befreit“ sind.
Du sagst weiter, dass „in Russland sich seit 1917 ein revolutionärer Zyklus geöffnet hat, der sich 1937 schloss. Die russischen Arbeiter waren zwar fähig, die Macht zu übernehmen, aber nicht dazu fähig, sie für eine kommunistische Umwandlung zu nutzen. Rückständigkeit, Krieg, ökonomischer Zusammenbruch und internationale Isolation als solche erklären aber nicht den Rückfluss. Diese Erklärung wäre eine politische, die die Macht fetischisiert und von der ökonomischen Umwandlung abgekoppelt ist, welche von den Klassenorganen durchgeführt wird: Versammlungen und Räte, in denen die Spaltung zwischen politischen und gewerkschaftlichen Aufgaben überwunden ist. Die leninistische Konzeption überschätzt die Frage der politischen Macht, die in ihren Augen die Vergesellschaftung der Wirtschaft und die Umwandlung der Produktionsverhältnisse bestimmt: Der Leninismus ist die bürokratische Krankheit des Kommunismus. Wenn die Revolution in erster Linie eine politische ist, dann beschränkt sie sich selbst darauf, den Kapitalismus in der Hoffnung auf die Weltrevolution zu verwalten. Damit stärkt sie eine Macht, die keine andere Aufgabe hat als die Unterdrückung und den Kampf gegen die Bourgeoisie. Ein Kampf, der dazu führt, dass diese Macht sich verewigt, zunächst mit dem Anspruch, die Perspektive der Weltrevolution zu verfolgen, dann um sich selbst zu erhalten“.
Der wahre Grund, warum Du so verzweifelt „kommunistische, wirtschaftliche Maßnahmen“ in den Mittelpunkt stellst, ist Deine Furcht davor, dass die proletarische Revolution „auf der politischen Ebene steckenbleiben könnte“ und sie in eine hohle Phrase verwandelt, die keinerlei bedeutsame Veränderung in den Bedingungen der Arbeiterklasse erbringt.
Die bürgerliche Revolution war in erster Linie ökonomischer Natur und schloss die Aufgabe der Ausmerzung der politischen Macht der alten Feudalklasse ab oder erreichte zumindest eine Verständigung mit ihr. „ Jede dieser Entwicklungsstufen der Bourgeoisie war begleitet von einem entsprechenden politischen Fortschritt. Unterdrückter Stand unter der Herrschaft der Feudalherren, bewaffnete und sich selbst verwaltende Assoziation in der Kommune; hier unabhängige städtische Republik (…) dort dritter steuerpflichtiger Stand der Monarchie (…), dann zur Zeit der Manufaktur Gegengewicht gegen den Adel in der ständischen oder in der absoluten Monarchie, Hauptgrundlage der großen Monarchien überhaupt, erkämpfte sie sich endlich seit der Herstellung der großen Industrie und des Weltmarktes im modernen Repräsentativstaat die ausschließliche politische Herrschaft“. („Kommunistisches Manifest“, 1848, MEW, Bd. 4, S. 464) Die Bourgeoisie erlangte im Verlauf von drei Jahrhunderten eine unumstrittene Position auf ökonomischem Gebiet (Handel, Kreditwesen, Manufaktur, Großindustrie), was sie schließlich in die Lage versetzte, die politische Macht durch die Revolution zu erobern, wofür Frankreich 1789 beispielhaft stand.
Diese historische Entwicklung entspricht ihrem Wesen als eine ausbeutende Klasse (wobei sie eine neue Form der Ausbeutung anstrebt, nämlich die „freie“ Lohnarbeit als Gegenstück zur feudalen Leibeigenschaft) und den Charakteristiken ihrer Produktionsweise: private und nationale Aneignung des Mehrwertes.
Soll das Proletariat in seinem Kampf für den Kommunismus etwa denselben Weg folgen? Sein Ziel ist nicht die Schaffung einer neuen Form der Ausbeutung, sondern die Abschaffung jedweder Ausbeutung. Das bedeutet, es darf nicht danach streben, innerhalb der alten Gesellschaft eine ökonomische Machtposition zu errichten, von der aus es zur Eroberung der politischen Macht startet. Vielmehr muss es den entgegengesetzten Weg verfolgen: die Ergreifung der politischen Macht auf Weltebene und von hier aus den Aufbau einer neuen Gesellschaft.
Die Ökonomie bedeutet die Unterwerfung des menschlichen Lebens unter die objektiven Gesetze, unabhängig von ihrem Willen. Die Ökonomie bedeutet Ausbeutung und Entfremdung. Marx sprach nicht von einer „kommunistischen Wirtschaft“, sondern von der Kritik der politischen Ökonomie. Kommunismus bedeutet die Herrschaft der Freiheit anstatt der Herrschaft der Notwendigkeit, die die Geschichte der Menschheit unter der Ausbeutung und Unterdrückung bestimmt hat. Der grundsätzliche Irrtum der „Prinzipien der Kommunistischen Produktion und Verteilung“ [10], ein zentraler Text für die Rätebewegung, besteht in dem Versuch, die Arbeitszeit als neutralen und unpersönlichen Automatismus darzustellen, der die Produktion reguliert. Marx kritisierte diese Idee in der „Kritik des Gothaer Programms“, indem er aufzeigte, dass sich die Vorstellung „gleiche Arbeit für gleiches Geld“ durchaus noch im Rahmen des bürgerlichen Rechtsraumes bewegt. Lange zuvor hatte er bereits im „Elend der Philosophie“ betont: „In einer zukünftigen Gesellschaft, wo der Klassengegensatz verschwunden ist, wo es keine Klassen mehr gibt, würde der Gebrauch nicht mehr von dem Minimum der Produktionszeit abhängen, sondern die Produktionszeit, die man den verschiedenen Gegenständen widmet, würde bestimmt durch die gesellschaftliche Nützlichkeit“. (MEW, Bd. 4, S. 93) „Die Konkurrenz führt das Gesetz durch, nach welchem der Wert eines Produktes durch die zu seiner Herstellung notwendige Arbeitszeit bestimmt wird. Die Tatsache, dass die Arbeitszeit als Maß des Tauschwertes dient, wird auf diese Art zum Gesetz einer beständigen Entwertung der Arbeit “. (idem, Seite 94 f) [11]
In Deinem Text stellst Du den „Leninismus“ als „Fetischisierung“ des Politischen dar. Demnach hätte sich die gesamte Arbeiterbewegung, bei Marx angefangen, dieses „Fehlers“ schuldig gemacht. Aber es war gerade Marx in seiner Polemik gegen Proudhon (siehe den oben angeführten Band 4) der aufzeigte, dass „der Gegensatz zwischen dem Proletariat und der Bourgeoisie ein Kampf Klasse gegen Klasse (ist), ein Kampf, der, auf seinen höchsten Ausdruck gebracht, eine totale Revolution bedeutet. Braucht man sich übrigens zu wundern, dass eine auf dem Klassengegensatz gegründete Gesellschaft, auf den brutalen Widerspruch hinausläuft auf den Zusammenstoß Mann gegen Mann als seine letzte Lösung?“.
Man sage nicht, dass die gesellschaftliche Bewegung die politische ausschließt. Es gibt keine politische Bewegung, die nicht gleichzeitig auch eine gesellschaftliche wäre.
Nur bei einer Ordnung der Dinge, wo es keine Klassen und keinen Klassengegensatz gibt, werden die gesellschaftlichen Entwicklungen aufhören, politische Revolutionen zu sein. Bis dahin wird am Vorabend jeder allgemeinen Neugestaltung der Gesellschaft das letzte Wort der Gesellschaftswissenschaft stets lauten:
„Kampf oder Tod, blutiger Krieg oder das Nichts. So ist die Frage unerbittlich gestellt.“ (aus der Einleitung zu Georg Sands historischem Roman: „Jean Ziska“) (MEW, Bd. 4, S. 182)
Die Rätebewegung begründet die Verteidigung des ökonomischen Charakters der proletarischen Revolution mit folgendem Syllogismus: Da die Grundlage der Ausbeutung des Proletariats die Ökonomie ist, ist es erforderlich, kommunistisch-ökonomische Maßnahmen zu ergreifen, um sie zu beseitigen.
Um auf diesen Sophismus zu antworten, ist es nötig, den schlüpfrigen Boden der formalen Logik zu verlassen und sich stattdessen auf den festen Boden der historischen Entwicklung zu begeben. In der Geschichte der menschlichen Entwicklung haben zwei, sich eng aufeinander beziehende, aber auch voneinander unabhängige Faktoren eine wesentliche Rolle gespielt: einerseits die Entwicklung der Produktivkräfte sowie die Ausgestaltung der Produktionsverhältnisse (der ökonomische Faktor) und andererseits der Klassenkampf (der politische Faktor). Die Aktionen der Klasse basieren sicherlich auf der Entwicklung des ökonomischen Faktors, aber sie sind beileibe keine bloße Widerspiegelung dessen; sie sind nicht bloße Antworten auf ökonomische Impulse in der Art der Pawlowschen Hunde. Wir haben in der Geschichte der menschlichen Entwicklung eine klare Tendenz zu einem wachsenden Gewicht des politischen Faktors (dem Klassenkampf) gesehen: Die Auflösung des alten primitiven Kommunismus und sein Ersatz durch die Skavenhaltergesellschaft war ein von Grund auf gewaltsamer, objektiver Prozess, das Produkt Jahrhunderte langer Entwicklungsgeschichte. Der Übergang von der Sklavenhaltergesellschaft zum Feudalismus entstand aus dem allmählichen Prozess des Niederganges der alten Ordnung und der Herausbildung einer neuen, wobei der bewusste Faktor nur ein begrenztes Gewicht hatte. Dagegen hatten in der bürgerlichen Revolution die Aktionen der Klassen ein größeres Gewicht, obgleich „die Bewegung der übergroßen Mehrheit im Interesse einer Minderheit stattfand“. Nichtsdestoweniger wurde, wie wir oben gezeigt haben, die Bourgeoisie von der überwältigenden Stärke der enormen ökonomischen Umwälzung getragen, die in großen Teilen das Produkt eines objektiven und unvermeidlichen Prozesses war. Das Gewicht des ökonomischen Faktors war immer noch erdrückend.
Andererseits ist die proletarische Revolution das Endergebnis des Klassenkampfes zwischen dem Proletariat und der Bourgeoisie, was von Anfang an ein hohes Maß an Bewusstsein und eine aktive Teilnahme erfordert. Diese fundamentale und grundlegende Dimension des subjektiven Faktors (das Bewusstsein, die Einheit, die Solidarität, das Vertrauen der Arbeiterklasse) kennzeichnet den Vorrang des politischen Charakters der proletarischen Revolution, die die erste wirklich massenhafte und bewusste Revolution in der Geschichte ist.
Du bevorzugst eine proletarische Revolution, die durch die aktive und bewusste Teilnahme der großen Mehrheit der Arbeiter getragen wird, was sich durch ein Maximum an Einheit, Solidarität, Bewusstsein, Hingabe und kreativen Willen ausdrückt. Gut, genau darin liegt der politische Charakter der proletarischen Revolution.
„Die ökonomische Revolution“ des Rätismus in der Praxis.
Deine Bilanz der russischen Revolution kann wie folgt zusammengefasst werden: Wenn sie statt der Fetischisierung des Politischen und der doch „so weit entfernten Weltrevolution“ die Abschaffung der Lohnarbeit und des Warentausches in Angriff genommen hätte, dann hätte sie keinen „Bürokratismus“ hervorgebracht und die Revolution wäre vorangeschritten. Diese Lehre übte einen großen Reiz auf den Rätekommunismus aus und wird vom heutigen Rätismus vulgarisiert.
Indem der Rätismus diese Position bezieht, bricht er mit der Tradition des Marxismus und verbindet sich mit dem Anarchismus und dem Ökonomismus. Diese Position des Rätismus ist nicht neu: Proudhon vertrat sie – und wurde von Marx in seiner Kritik auseinandergenommen. Später wurde sie von der Theorie der Genossenschaften einverleibt und anschließend vom Anarchosyndikalismus und revolutionären Syndikalismus, sowie in Russland vom Ökonomismus vertreten. 1917-1923 wurde sie durch den Austromarxismus [12] sowie von Gramsci und seiner „Theorie“ der Fabrikräte wiederbelebt; [13] Otto Rühle und einige Theoretiker der AUUD schlugen denselben Weg ein. Trotz richtiger Argumente, wie jene von der Gruppe Demokratischer Zentralismus, verfiel Kollontais Arbeiteropposition in Russland denselben Ideen. 1936 kürte der Anarchismus die spanischen „Kollektive“ zur großen Alternative zur bolschewistischen [14] „Bürokratie und zum Staatskommunismus“.
Das Gemeinsame all dieser Anschauungen – und damit auch die Wurzel des Rätismus- ist eine Konzeption von der Arbeiterklasse als eine rein ökonomische und soziologische Kategorie. Sie betrachtet die Arbeiterklasse nicht als geschichtliche Klasse, geprägt durch die Kontinuität ihres Kampfes und ihres Bewusstseins, sondern als Summe von Individuen, die durch die beschränktesten ökonomischen Interessen motiviert werden [15].
Die Rechnung des Rätismus ist die folgende: Um die Revolution zu verteidigen, müssen die Arbeiter „sicherstellen“, dass es unmittelbare Erfolge gibt, dass sie sich der Früchte der Revolution bemächtigen. Darunter wird ihre „Kontrolle“ der Fabriken verstanden, die ihnen erlaubt, sich selbst zu verwalten. [16]
„Fabrikkontrolle“? Welche Kontrolle soll es geben, wo doch die Produktion den Kosten und der Profitrate unterworfen ist, die Ausdruck der Konkurrenz auf dem Weltmarkt ist?
Entweder - oder: Entweder verkündet man die Autarkie und bewirkt damit einen Rückschritt unkalkulierbaren Ausmaßes, was die ganze Revolution vernichten würde, oder man arbeitet inmitten eines kapitalistischen Weltmarktes, wobei man sich seinen Gesetzmäßigkeiten zu unterwerfen hat.
Der Rätismus proklamiert die “Aufhebung der Lohnarbeit“ durch Beseitigung der Löhne und ihren Ersatz durch „Arbeitszeitgutscheine“. Dies umgeht das Problem mit schön klingenden Worten: Es ist notwendig, eine bestimmte Anzahl von Stunden zu arbeiten und wie korrekt auch immer die Arbeitszeitgutscheine sind, es fallen immer Stunden an, die bezahlt werden, und Stunden, die unbezahlt bleiben - der so genannte Mehrwert. Die Losung: „ein gerechtes Tagewerk für einen gerechten Lohn“ ist Teil des bürgerlichen Gesetzes und beinhaltet die schlimmsten Ungerechtigkeiten, wie Marx schon aufzeigte.
Der Rätismus proklamiert die „Abschaffung der Warenwirtschaft“ und ihren Ersatz durch die „Buchhaltung zwischen den Fabriken“. Aber auch hier befinden wir uns in demselben Dilemma: Was produziert wird, muss sich nach dem Tauschwert richten, den die Konkurrenz auf dem Weltmarkt vorgibt.
Der Rätismus versucht das Problem der revolutionären Umgestaltung der Gesellschaft durch „Formen und Namen“ zu lösen, vermeidet es aber, das Problem an der Wurzel zu packen.
„Herr Bray ahnte nicht, dass dieses egalitäre Verhältnis, dieses Verbesserungsideal, welches er in die Welt einführen will, selbst nichts anderes ist als der Reflex der gegenwärtigen Welt und dass es infolgedessen total unmöglich ist, die Gesellschaft auf einer Basis rekonstruieren zu wollen, die selbst nur der verschönerte Schatten dieser Gesellschaft ist. In dem Maße, wie der Schatten Gestalt annimmt, bemerkt man, dass diese Gestalt, weit entfernt, ihre erträumte Verklärung zu sein, just die gegenwärtige Gestalt der Gesellschaft ist.“ („Das Elend der Philosophie“, MEW, Bd. 4, S. 105).
Die Vorstellungen des Anarchismus und Rätismus zur „ökonomischen Revolution“ gehen in dieselbe Richtung wie die des Herrn Bray: Wenn dieser Schatten Gestalt annimmt, wird deutlich, dass er nichts anderes als die aktuelle Gestalt der bestehenden Gesellschaft ist. 1936 tat der Anarchismus mit seinen Kollektiven nichts anderes, als ein Regime von extremer Ausbeutung im Dienst der Kriegswirtschaft zu errichten. Das Ganze versuchte er mit den Ideen von der „Selbstverwaltung“, der „Abschaffung des Geldes“ und anderem Unsinn zu verschönern.
Wie dem auch sei, es gibt einige sehr ernste Konsequenzen aus diesen rätistischen Vorstellungen: Sie verleiten die Arbeiterklasse dazu, ihre historische Mission für einen Apfel und ein Ei, für die „sofortige Beschlagnahme der Fabriken“ zu verraten.
In Deinem Text hast Du betont, dass „Klasse und Partei nicht die gleichen Absichten haben. Die Bestrebungen der Arbeiter gehen in Richtung der Übernahme der Führung der Fabriken und ihrer Produktionsleitung“. „Übernahme der Führung der Fabriken“ bedeutet, dass jeder Teil der Arbeiterklasse seinen Teil der Beute an sich nimmt, die dem Kapitalismus zuvor entrissen worden war, und ihn nun, natürlich in Koordination mit den Arbeitern anderer Fabriken, zu seinem Nutzen verwendet. Das heißt, wir kommen vom Eigentum des Kapitalisten zum Eigentum des einzelnen Arbeiters. Nur den Kapitalismus, den haben wir nicht überwunden!
Schlimmer noch, es bedeutet, dass jene Arbeitergeneration, die die Revolution macht, die Reichtümer, die sie zuvor dem Kapitalismus genommen hat, konsumieren wird, ohne auch nur einen Gedanken an die Zukunft zu „verschwenden“. Dies führt die Arbeiterklasse dazu, ihre historische Aufgabe, den Kommunismus im Weltmaßstab zu errichten, zu verleugnen und stattdessen der Illusion zu verfallen, „alles sofort zu haben“.
Die Versuchung, die Fabriken „unter sich aufzuteilen“, stellt eine reale Gefahr für den nächsten revolutionären Versuch dar, weil der heutige Kapitalismus in seine letzte Phase, die des Zerfalls, getreten ist.[17] Zerfall bedeutet Chaos, Auflösung, Zusammenbruch der Wirtschaft und Zersplitterung der gesellschaftlichen Strukturen in ein aus den Fugen geratenes Mosaik von Fragmenten, und auf der ideologischen Ebene den Verlust einer historischen, weltweiten und einheitlichen Sichtweise, die die bürgerliche Ideologie als „Totalitarismus“ und „Bürokratie“ zu verunglimpfen sucht. Die Kräfte der Bourgeoisie tun dies im Namen der „demokratischen Kontrolle“, der „Selbstverwaltung“ und anderer ähnlicher Phrasen. Es besteht die Gefahr, dass die Klasse aufgrund des völligen Verlustes der historischen Perspektive geschlagen und in die einzelne Fabrik oder Lokalität eingesperrt wird.
Dies wird nicht nur eine fast endgültige Niederlage sein, sondern bedeutet auch, dass die Arbeiterklasse durch den Mangel an einer historischen Perspektive, durch den Egoismus, den Drang zur Unmittelbarkeit und die völlige Abwesenheit von Zielen zermürbt wird. Genau das ist es, was von der gesamten bürgerlichen Ideologie in der gegenwärtigen Phase des Zerfalls propagiert wird.
Die wirklichen Lehren der Russischen Revolution
Die proletarische Bastion wird inmitten eines brutalen und quälenden Widerspruchs geboren: Einerseits führt der Kapitalismus einen Kampf auf Leben und Tod gegen diese Bastion mit wirtschaftlichen, militärischen und imperialistischen Mitteln (militärische Invasion, Blockade, den Zwang, Warenhandel selbst zu den ungünstigsten Bedingungen zu betreiben, um zu überleben). Andererseits muss die Arbeiterklasse das Eisen um ihren Hals mit den einzigen Waffen, die sie hat, brechen: die Einheit und das Bewusstsein der gesamten Klasse sowie die weltweite Ausdehnung der Revolution.
Dies zwingt sie dazu, eine komplexe, zeitweilig widersprüchliche Politik zu betreiben, um eine Gesellschaft, die vom Zerfall bedroht ist, über Wasser zu halten (Versorgung, minimales Funktionieren des Produktionsapparates, militärische Verteidigung) und gleichzeitig den Hauptteil ihrer Kräfte auf die Ausdehnung der Revolution und die Auslösung weiterer proletarischer Aufstände zu richten.
In den ersten Jahren der Räteherrschaft verfolgten die Bolschewiki diese Politik standhaft. In ihrer kritischen Studie der russischen Revolution verdeutlichte Rosa Luxemburg dies: „Die Revolution Russlands war in ihren Schicksalen völlig von den internationalen (Ereignissen) abhängig. Dass die Bolschewiki ihre Politik gänzlich auf die Weltrevolution des Proletariats stellte, ist gerade das glänzendste Zeugnis ihres politischen Weitblicks und ihrer grundsätzlichen Treue, des kühnen Wurfs ihrer Politik“ (Rosa Luxemburg, „Zur russischen Revolution“, Werke Bd. 4, S. 334).
So stellte die Resolution des territorialen Moskauer Büros der Bolschewistischen Partei vom Februar 1918 bezüglich der Brest-Litowsk-Debatte fest „Im Interesse der internationalen Revolution gehen wir das Risiko des Verlustes der Macht der Räte ein, die zu etwas rein Formalen gemacht werden; heute wie gestern gilt das Ziel der Ausdehnung der Revolution auf alle Länder.[18]
Innerhalb dieser Politik begingen die Bolschewiki eine Reihe von Fehlern. Und dennoch konnten diese Fehler korrigiert werden, solange die Kräfte der Revolution weiterlebten. Erst von 1923 an, als der Revolution in Deutschland ein tödlicher Schlag versetzt worden war, setzte sich die Tendenz der Bolschewiki, sich zum Gefangenen des russischen Staatsapparates zu machen und sich damit endgültig in einen nicht lösbaren Widerspruch zum internationalen Proletariat zu begeben, endgültig durch. Die bolschewistische Politik fing, an, zu einem bloßen Sachwalter des Kapitals zu werden.
Eine marxistische Kritik dieser Fehler hat nichts gemein mit der Kritik, wie sie vom Rätismus vorgetragen wird. Die rätistische Kritik führt zum Anarchismus und zur Bourgeoisie, während die marxistische Kritik die Stärkung der proletarischen Positionen ermöglicht. Viele Fehler wurden vom Rest der internationalen Arbeiterbewegung (Luxemburg, Bordiga, Pannekoek) geteilt. Unser Ziel hier ist es nicht, die Bolschewiki von „ihren Sünden rein zu waschen“, sondern einfach aufzuzeigen, dass dies ein Problem der gesamten internationalen Arbeiterklasse war und nicht das Produkt des „Bösen“, des „Machiavellismus“ und des „versteckten bourgeoisen Charakters der Bolschewiki“, wie die Rätisten annehmen.
Wir können hier nicht die marxistische Kritik der bolschewistischen Fehler darlegen, aber wir haben ausführlich dazu in der Presse unserer Strömung geschrieben. Wir möchten besonders die folgenden Texte hervorheben:
- die Artikelserien zum Kommunismus in der englischen Ausgabe der Internationalen Revue
- die Broschüre „Die Übergangsperiode vom Kapitalismus zum Kommunismus,
- die Broschüre „Die Russische Revolution“.
Diese Dokumente könnten als Grundlage für die Fortsetzung der Diskussion dienen.
Wir hoffen, einen Beitrag zu einer klaren und brüderlichen Debatte geleistet zu haben.
Mit kommunistischen Grüßen
Accion Proletaria/Internationale Kommunistische Strömung
Fußnoten:
[1] Die extremsten Vertreter des Rätismus lassen es nicht dabei bewenden, Lenin in Frage zu stellen. Sie machen auch vor Marx nicht Halt und umarmen dabei Proudhon und Bakunin. Tatsächlich folgen sie der unerbittlichen Logik einer Position, die behauptet, es gäbe eine Kontinuität zwischen Lenin und Stalin. Siehe hierzu unseren Artikel „Zur Verteidigung des proletarischen Charakters des Oktobers 1917“ in der Internationalen Revue, Nr. 5 und 6, der ein grundsätzlicher Artikel für die Diskussion über die russische Frage ist.
[2] Natürlich weisen wir die Kampagne der Bourgeoisie gegen Lenin auf das Schärfste zurück. Dies bedeutet aber nicht, dass wir alle seine Positionen blind akzeptieren. Im Gegenteil, in verschiedenen Texten haben wir seinen Irrtümern und Verwirrungen bezüglich des Imperialismus sowie bezüglich des Verhältnisses von Partei und Klasse Rechnung getragen. Solche Kritik stellt einen Teil der revolutionären Tradition dar. (Sie ist für uns, wie Rosa Luxemburg sagt, die notwendige Luft zum Atmen). Aber die revolutionäre Kritik hat eine Methode und eine Zielrichtung, die den Lügen und Verdrehungen der Bourgeoisie und der Parasiten diametral entgegengesetzt ist.
[3] Wir wollen hier die Frage nicht vertiefen. Wir haben Dir das Buch über die deutsch-holländische Linke, das wir auf Französisch und Englisch herausgegeben haben, zugeschickt.
[4] Siehe hierzu unseren Artikel „Der Mythos der anarchistischen Kollektive“, veröffentlicht in der Internationalen Revue, Nr.4, und in unserem Buch „1936: Franco y la Republica aplastan al proletariado“. Leider können wir hier die Frage nicht vertiefen: Verglichen mit dem vermeintlich bürokratischen und autoritären russischen „Modell“, galt das spanische Modell von 1936 demgegenüber als „demokratisch“, „selbst bestimmt“ und „auf der autonomen Initiative der Massen basierend“.
[5] Im Rahmen dieser Antwort können wir die Schlüsselbehauptung der „Thesen zum Bolschewismus“ – in denen von der bürgerlichen Natur der Russischen Revolution die Rede ist - nicht widerlegen. Wir haben jedoch in der International Review, Nr. 12, 13 (s. Fußnote 1) und in der„Antwort von Pannekoek auf Lenin als Philosoph“ in: International Review Nr.25, 27 und 30 auf diesen Punkt ausreichend geantwortet. Dieser Artikel Pannekoeks stellt einen Bruch mit der früheren Position dar, die von vielen Mitgliedern der Rätebewegung einst vertreten worden war: 1921 stellte Pannekoek fest, dass „die Taten der Bolschewiki von unermesslichem Nutzen für die Revolution in Westeuropa sind. Sie haben dem Weltproletariat erstmalig mit der Machtergreifung ein Beispiel gegeben. Durch ihre Praxis haben sie das große Prinzip des Kommunismus aufgezeigt: Diktatur des Proletariats und das System der Räte oder die Räteversammlungen (zitiert aus unserem Buch „Die deutsche und holländische kommunistische Linke“, Fußnote 69, S. 194 in der englischen Ausgabe).
[6] siehe hierzu „Die Epigonen des Rätismus in der Praxis“ in der International Review, Nr.2, „Brief an Arbetamarket“ in der International Review, Nr.15, „Die rätistische Gefahr“ in der International Review, Nr.40, sowie den Artikel „Die Armut des modernen Rätismus“ in der International Review, Nr. 42.
[7] Wir haben immer wieder deutlich gemacht, dass wir gewisse Produktionsmethoden, die von Lenin befürwortet wurden, kritisieren und dass sie auch innerhalb der Partei von Gruppen wie die Gruppe Demokratischer Zentralismus kritisiert wurden. Siehe hierzu den Artikel aus der Serie zum Kommunismus veröffentlicht in der International Review, Nr.99.
[8] Das proletarische Bollwerk muss Nahrungsmittel, Medizin, Rohstoffe, Industriegüter etc. zu hohen Preisen kaufen. Zudem wird es mit Blockaden und, was ebenso wahrscheinlich ist, mit einem äußerst schlecht organisierten Transportwesen zu tun haben. Dies war nicht allein ein Problem des rückständigen Russlands. Wie wir in unserer Broschüre „Russland 1917:Der Beginn der Weltrevolution“ aufgezeigt haben, wird uns dieses sehr schwerwiegende Problem gerade auch in zentralen Ländern wie Deutschland oder England begegnen. Hinzu kommt der Kampf, den die Bourgeoisie gegen die proletarische Bastion führen wird, die Handelsblockaden, militärische Kriege, Sabotage etc. Und schlussendlich werden die zukünftigen revolutionären Versuche des Proletariats mit der schweren Last der Konsequenzen des dahinsiechenden, verfaulenden Kapitalismus konfrontiert sein: mit dem Zusammenbruch der Infrastruktur, der chaotischen Kommunikation und Versorgung, den verheerenden Folgen einer endlosen Reihe regionaler Kriege, mit der Umweltzerstörung.
[9] All das gegenwärtige Gerede über die „Globalisierung“ des Kapitalismus, das sowohl von den Anhängern des „Neoliberalismus“ als auch von seinen Gegnern, der „Antiglobalisierungsbewegung“, geteilt wird, leugnet die Tatsache, dass sich der Weltmarkt vor einem Jahrhundert gebildet hat und dass das Problem, vor dem das System heute steht, seine unheilbare Tendenz zur Explosion und brutaler Selbstzerstörung vor allem durch imperialistische Kriege ist.
[10] Wir können an dieser Stelle keine Kritik der ‚Grundprinzipien‘ entwickeln. Wir möchten, wie bereits geschehen, nochmals auf unser Buch zur Geschichte der Deutsch-Holländischen Linken verweisen: hier die Seiten 248 bis 269 in der englischen Ausgabe.
[11] Pannekoek formulierte aus gutem Grund ernsthafte Bedenken gegen die ‚Grundprinzipien‘, siehe unser o.g. Buch.
[12] siehe den Artikel „Vom Austromarxismus zum Austrofaschismus“ in der International Review, Nr.2.
[13] siehe hierzu die deutliche Kritik, die Bordiga an Gramscis Spekulationen übt, in dem Buch „Debatte um die Betriebsversammlungen“.
[14] siehe Fußnote [4].
[15] Es ist keineswegs paradox, dass der Rätismus denselben Fehler begeht, den Lenin in „Was tun?“ macht. Nämlich zu sagen, dass die Arbeiter nur zu einem gewerkschaftlichen Bewusstsein in der Lage wären. Und doch gibt es eine ganze Welt von Unterschieden zwischen Lenin und den Rätisten: Obwohl Lenin seinen Fehler korrigieren konnte, und zwar nicht, wie Du ihm unterstellst, aus taktischen Gründen, sind die Rätisten nicht in der Lage, dies anzuerkennen.
[16] Bei allen Differenzen und ohne den Vergleich zu übertreiben, sehen die Rätisten die Arbeiter in derselben Rolle wie die Bauern in der Französischen Revolution. Letztere wurden vom Joch des Feudalismus sowie von der bäuerlichen Armut befreit und wurden zu enthusiastischen Soldaten in der revolutionären Armee, besonders in der napoleonischen. Abgesehen von dieser Einschätzung wird hier eine Sichtweise deutlich, die das Proletariat gering schätzt und als ‚bewusstlos‘ betrachtet. Sie widerspricht allen Plädoyers für die „Teilnahme“ und die „Initiative“ der Massen, die der Rätismus hält. Was aber noch ernster zu nehmen ist, ist, dass vergessen wird, dass, während die Bauern durch eine Umverteilung des Landbesitzes befreit werden können, sich die Arbeiter niemals durch einen Besitzerwechsel der Fabriken befreien können. Die proletarische Revolution besteht nicht lediglich aus der lokalen und juristischen Befreiung vom kapitalistischen Herrn, sondern vielmehr aus der Befreiung des Proletariats und der ganzen Menschheit vom Joch der globalen und objektiven gesellschaftlichen Verhältnisse, die über die persönlichen und die Eigentumsverhältnisse hinaus wirken: die Verhältnisse der kapitalistischen Produktion, basierend auf der Warenwirtschaft und der Lohnarbeit.
[17] siehe Internationale Revue, Nr. 12, „Thesen zum Zerfall des Kapitalismus“.
[18] Unter Bezug auf den Vertrag von Brest-Litowsk sagst Du, „die Zurückweisung des revolutionären Krieges, obwohl dieser in der kurzen Zeit den vorläufigen Verlust der Städte bedeutete, habe die Entwicklung eines Volkskrieges mit der Herausbildung von Milizen auf dem Lande und des Zusammenschlusses der revolutionären Arbeiter mit den Bauern unmöglich gemacht. Dabei hätte genau das, wie die Bolschewistische Linke behauptete, die Chancen der Herausbildung einer kommunistischen Produktionsform begünstigt“. Wir können diese Frage hier nicht vertiefen, verweisen aber auf unsere französische Broschüre, siehe Fußnote [8]. Wie dem auch sei, Deine Überlegungen werfen einige Fragen auf. An erster Stelle: Was ist die „bäuerliche Revolution?“. Welche „Revolution“, die mit dem „revolutionären Arbeiter“ verschmelzen muss, können die Bauern machen? Die Bauern sind keine Klasse, sondern eine soziale Schicht, in der verschiedene Gesellschaftsklassen mit völlig entgegengesetzten Interessen vorkommen: Gutsbesitzer, mittlere und kleine Landbesitzer, Tagelöhner…
Andererseits: wie soll auf Basis des Guerillakrieges auf dem Lande und mit Städten, in denen der Feind herrscht, eine „kommunistische Produktionsform“ aufgebaut werden?
Politische Strömungen und Verweise:
- Rätismus [20]
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Erbe der kommunistischen Linke:
Einleitung der IKS zur Erklärung des NCI vom 27. Oktober 2004
- 1697 reads
Wir veröffentlichen nachfolgend eine Erklärung des ‚Nucleo Comunista Internacional‘ (NCI – Kern internationaler Kommunisten) aus Argentinien, in der dieser gegenüber den drei Erklärungen des ‚Circulo de Comunistas Internacionalistas‘ (Zirkel internationalistischer Kommunisten) Stellung bezieht, die einen Frontalangriff auf die IKS sind (). Wie der Text zeigt, „Der NCI erklärt förmlich, dass der Inhalt dieser Erklärungen (des ‚Zirkels‘) eine Reihe von Lügen und schändlichen Verleumdungen gegen die IKS ist“.
Wir veröffentlichen nachfolgend eine Erklärung des ‚Nucleo Comunista Internacional‘ (NCI – Kern internationaler Kommunisten) aus Argentinien, in der dieser gegenüber den drei Erklärungen des ‚Circulo de Comunistas Internacionalistas‘ (Zirkel internationalistischer Kommunisten) Stellung bezieht, die einen Frontalangriff auf die IKS sind[1]. Wie der Text zeigt, „Der NCI erklärt förmlich, dass der Inhalt dieser Erklärungen (des ‚Zirkels‘) eine Reihe von Lügen und schändlichen Verleumdungen gegen die IKS ist“.
Da der ‚Zirkel‘ sich auf seiner Webseite als der ‚Nachfolger der NCI‘ vorstellt, wollen wir kurz untersuchen, welche Verbindung tatsächlich zwischen den beiden besteht.
Welche Verbindung gibt es zwischen dem ‚Zirkel‘ und dem NCI?
Der NCI ist eine Gruppe von suchenden Leuten, die mit dem Trotzkismus gebrochen hatten und im Internet 2002 Organisationen der Kommunistischen Linken entdeckt haben. Im Oktober 2003 hat er Kontakt mit der IKS aufgenommen. In dieser Zeit haben sie Diskussionen über die Positionen der IKS geführt und schliesslich eine Plattform ausgearbeitet (die sich in groben Zügen auf die der IKS stützt) und den NCI gebildet.
Im April 2004 hat eine erste Delegation der IKS den NCI in Buenos Aires getroffen. Gemeinsam entscheiden der NCI und die IKS, dass die Presse der IKS (auf spanisch und in anderen Sprachen) von dem NCI verfasste Artikel zu verschiedenen Aspekten der Lage in Argentinien oder zu internationalen Fragen (insbesondere zur Bewegung der ‚piqueteros‘) veröffentlichen wird.
Im Mai 2004 hat der NCI von den Bulletins der selbsternannten ‚Internen Fraktion der IKS’ (IFIKS) erfahren. Er beschließt einstimmig, der IKS eine ‚Stellungnahme‘ zu schicken (Datum 22. Mai), in der er unterstreicht, dass er „die IFIKS als außerhalb der Arbeiterklasse stehende Organisation bezeichnet, deren Ausschluss und Herausschmiss aus den Reihen des Proletariats wir aufgrund ihres bürgerlichen Verhaltens befürworten.“ Auf unserer Website und in unserer französischen und spanischen Presse haben wir auszugsweise diese ‚Stellungnahme‘ veröffentlicht.
Im August 2004 fand ein zweites Treffen zwischen der IKS und dem NCI in Argentinien statt. Am 27. August wurde die erste öffentliche Diskussionsveranstaltung der IKS in Buenos Aires durchgeführt (über die wir in unserer territorialen Presse auf französisch und spanisch berichteten).
Unmittelbar nach der Ankunft der Delegation der IKS drängt ein Mitglied der NCI, B., auf Biegen und Brechen, dass die IKS sofort in einem Kommuniqué mitteilt, dass der NCI in die IKS eintreten werde.
Die anderen Genossen der NCI waren jedoch der Auffassung (und wir haben uns dieser Auffassung angeschlossen), dass solch ein Integrationsprozess nicht überstürzt stattfinden sollte.
In der ganzen Zeit, als sich unsere Delegation vor Ort aufhielt, hat B. zu keinem Zeitpunkt die geringste Divergenz gegenüber den Positionen der IKS geäußert.
Im Laufe des Monats September schickt B. der IKS mehrere provozierende E-mails mit dem Ziel, dass die IKS dazu verleitet wird, mit ihm und dem NCI zu brechen (in dessen Namen er spricht, während die anderen Genossen der NCI nicht einmal über die Korrespondenz zwischen B. und der IKS informiert sind).
Erst am Vorabend der Diskussionsveranstaltung des IBRP in Paris am 2. Oktober hat die IKS zufällig anhand eines Links auf der Webseite des IBRP von der Existenz eines ‚Kollektiv Internationalistischer Kommunisten‘ erfahren, bei dem es sich um unseren berühmten ‚Zirkel‘ handelt.
Ein Schwindler – unter dringendem Verdacht
Während unsere Delegation sich Ende August noch in Buenos Aires aufhielt, war der Bürger B. schon umgeschwenkt, aber er hatte weder den Mut noch die Ehrlichkeit, uns über die ‚Änderung‘ seiner Meinung zu informieren. Darüber hinaus ist es sehr wahrscheinlich, dass er bereits seit einiger Zeit heimlich mit der IFIKS Kontakt aufgenommen hatte, während er uns gleichzeitig hinters Licht führte und gar überstürzt die Integration des ganzen Kerns der NCI in die IKS anstrebte. Das Doppel- (oder dreifache?) Spiel dieses Individuums (und seine unglaubliche Dreistigkeit) wurden von der IKS erst Anfang Oktober entdeckt. Nachdem die IFIKS die erste Erklärung des Zirkels veröffentlicht hat, die im Namen des NCI abgegeben worden war, hat die IKS angefangen, das undurchsichtige Verhalten des Treibens dieses angeblichen ‚Zirkels‘ öffentlich zu machen[2].
Es hat sich herausgestellt, dass:
– dieser ‚Zirkel‘ nur aus einer einzigen Person besteht, dem Element B, der Mitglied des NCI war und mit der IKS gebrochen (ohne jedoch irgendeine Divergenz zum Ausdruck gebracht zu haben), sich der IFIKS und dem IBRP genähert hat;
– die anderen Mitglieder der NCI haben nicht mit der IKS gebrochen, wie das die IFIKS und das IBRP auf ihren Websites behaupten.
Deshalb haben wir diesen Schwindler entlarven können. Durch unsere Telefonanrufe (die Herrn B. zufolge „die ekelerregenden Methoden der IKS“ offenbaren) haben wir erfahren, dass die anderen Genossen der NCI überhaupt nicht informiert waren über die Existenz dieses „Zirkels“, der sie angeblich repräsentieren sollte! Sie wussten nicht einmal etwas von dessen ekelerregenden „Erklärungen“ gegen die IKS, welche – so wird in den ‚Erklärungen‘ immer mit Nachdruck wiederholt – „kollektiv“, „einstimmig“ und nach „Befragung“ aller Mitglieder der NCI gefällt wurden. Es handelt sich um eine reine Lüge.
Das Element B. hatte ganz allein (mit einstimmigen Votum der Abwesenden!) diese verleumderischen ‚Erklärungen‘ gegen die IKS verfasst.
Wie konnte er so hinter dem Rücken der NCI handeln?
Dieses Element besaß als einziger das Passwort für die Informatikwerkzeuge des NCI (E-Mail Adresse, Website), was ihm ermöglichte, hinter dem Rücken der Genossen des NCI eine „fiktive Gruppe“ (den berühmten ‚Zirkel‘) zu proklamieren, der im Namen und an Stelle des NCI sprach (siehe unseren Artikel im Internet auf französisch und spanisch „Schwindel oder Wirklichkeit“?). Die Militanten des NCI, die über keine Möglichkeiten des Zugangs zum Internet verfügten, konnten diese Manöver nicht aufdecken.
Sie haben von den in ihrem Namen veröffentlichten Texten sowie von der Korrespondenz zwischen der IKS und dem NCI (in Wirklichkeit nur B., da er die E-Mails für sich behielt) erst erfahren, nachdem die IKS ihnen diese Dokumente per Briefpost geschickt hat.
Welche Bedeutung haben diese ‚ekelerregenden Methoden‘ dieses Schwindlers?
Offensichtlich handelt es sich bei dessen undurchsichtigen Handeln um die Aktvitäten eines Manipulators, der keine wirkliche politische Überzeugung besitzt und der genauso wenig wie die IFIKS etwas im proletarischen Lager zu suchen hat. Seine plumpen Lügen sowie sein fieberhaftes Treiben im Internet hatten uns dazu bewogen ,noch bevor der NCI seine ‚Erklärung‘ abgab, zu sagen, dass „nur diejenigen, die keinen Verstand im Kopf haben“ diesen Unfug glauben könnten (siehe unsere französische oder spanische Website – „Circulo de Comunistas Internacionlistas – eine neue, seltsame Erscheinung“).
Genau das ist mit der IFIKS und dem IBRP geschehen, die den Lügen des ‚Zirkels‘ Glauben geschenkt haben, indem sie öffentlich ankündigten, dass der NCI mit der IKS gebrochen habe, und vor allem indem sie auf ihren Websites (in mehreren Sprachen) dessen ‚Erklärung‘ vom 12. Oktober veröffentlichten, die angeblich die „ekelerregenden Methoden“ der IKS „aufdeckt“.
Mit Hilfe seiner Computertricks hat dieser Webmaster (und große Lügner!) es geschafft, einen Preis als internationaler Superstar einzuheimsen, indem er nicht nur von der IFIKS sondern auch vom IBRP groß ins Rampenlicht gestellt wurde.
Dass die IFIKS solch eine enthusiastische Allianz mit dem Bürger B. eingegangen ist, überrascht nicht. Wer sich ähnelt, schließt sich zusammen. Aber viel schwererwiegend ist die Tatsache, dass eine Organisation der Kommunistischen Linken, das IBRP, dem Element B. einen nützlichen Dienst erwiesen hat und seine ‚ekelerregenden Methoden‘ unterstützt[3].
Dieser ‚Zirkel kommunistischer Internationalisten‘ (Mehrzahl!) ist nichts anderes als ein gewaltiger Schwindel.
Es ist unsere Verantwortung, ihn als solchen zu entblößen und das gesamte proletarische politische Milieu vor dem Treiben dieses besonders heimtückischen ‚Zirkels‘ zu warnen!
IKS, 3. November 2004
[1]Die Erklärungen vom
– 2. Okt., in der der ‚Zirkel‘ sich mit der IFIKS solidarisiert (die auf der Website der IFIKS veröffentlicht wurde)
– 12. Oktober „gegen die ekelerregende Methode der IKS“ (die auf der Websites der IFIKS und des IBRP veröffentlicht wurde)
– 21. Oktober „Antwort auf die Beilage von Révolution Internationale aus Frankreich“, die bis dato nur auf Spanisch auf der Website des ‚Zirkels‘ existiert.
[2]Siehe unsere drei Artikel im Internet auf Französisch und spanisch über den „Zirkel Internationalistischer Kommunisten“ (Circulo de Comunistas Internacionalistas)
– „Eine seltsame Erscheinung“
– „Eine neue, seltsame Erscheinung“
– „Schwindel oder Wirklichkeit?“
[3]Andere Leute und Gruppen in Lateinamerika (insbesondere in Mexiko und Brasilien) wurden ebenfalls durch den „Circulo“ kontaktiert, der vorgab, Nachfolger des NCI zu sein, und Verleumdungen über die IKS verbreitete. Doch die Haltung dieser kontaktierten Leute und Gruppen war eine ganz andere: Sie informierten umgehend die IKS, einige brachten auch ihre Zweifel an der Zugehörigkeit dieses „Zirkels“ zum Lager der Kommunistischen Linken zum Ausdruck.
Erklärung des Nucleo Comunista Internacional
- 1636 reads
Erklärung des Nucleo Comunista Internacional (Kern internationaler Kommunisten) zu den Erklärungen des “Circulo de Comunistas Internacionalistas” (Zirkel internationalistischer Kommunisten)
1) Der NCI hat die drei ‘Erklärungen’ des ‘Circulo de Comunistas Internacionalistas’ vom 2., 12. und 21. Oktober gelesen. Der NCI erklärt förmlich, dass der Inhalt dieser Erklärungen eine Reihe von Lügen und schändlichen Verleumdungen gegen die IKS ist.
2) Der NCI erklärt sich mit diesen Erklärungen des sog. ‘Zirkels’ nicht einverstanden, welche hinter dem Rücken und ohne Absprache mit dem NCI von einer Einzelperson gemacht wurden, die der NCI angehörte, aber die der Kern heute nicht mehr als Mitglied akzeptiert.
3) Der NCI hält seine Erklärung vom Mai 2004 aufrecht, in der er die IFIKS und ihr Verhalten verurteilt. Er steht weiterhin zu seinen Analysen, insbesondere zu den Ereignissen in Argentinien 2001 und hinsichtlich der Frage der Dekadenz des Kapitalismus.
4) Der NCI setzt die Diskussionen mit dem Ziel der politischen Klärung mit Unterstützung der IKS fort.
5) Lügen, Verleumdungen sind unwürdige Verhaltensweisen, die die Arbeiterklasse verwerfen muss.
6) Der NCI verpflichtet sich, eine Zusammenfassung seines Werdegangs von seiner Entstehung bis heute zu verfassen.
Beschlossen von dem NCI auf seinem Treffen am 27. Okt. 2004.
Achtung: Die alte E-Mail-Adresse des NCI ist für diesen nicht mehr zugänglich. Er wird so bald wie möglich eine neue Kontaktadresse mitteilen.
Volksaufstände in Lateinamerika:
- 1969 reads
Der Ausbruch von massiven Klassenkämpfen im Mai 1968 in Frankreich und in der Folge auch in Italien, Grossbritannien, Spanien, Polen und anderswo setzte der konterrevolutionären Periode ein Ende, die seit der Niederschlagung der revolutionären Welle 1917–23 so schwer auf der internationalen Arbeiterklasse gelastet hatte. Der proletarische Riese ist auf der historischen Szene wieder aufgestanden. Diese Kämpfe hatten auch in Lateinamerika ein grosses Echo, zuerst 1969 im „Cordobaza“ in Argentinien. Zwischen 1969 und 1975 führten die Arbeiter in der ganzen Region, vom Süden Chiles bis nach Mexiko an der Grenze zu den USA, einen erbitterten Kampf gegen die Versuche der Bourgeoisie, die Kosten der Wirtschaftskrise auf sie abzuwälzen. Und in den folgenden Kampfwellen, von denen jene von 1977–80 im polnischen Massenstreik kulminierte und jene von 1983–89 von umfangreichen Bewegungen in Belgien, Dänemark und bedeutenden Kämpfen in zahlreichen anderen Ländern gekennzeichnet war, setzte auch das Proletariat Lateinamerikas den Kampf fort, wenn auch nicht auf dieselbe spektakuläre Weise. Es zeigte, dass die Arbeiterklasse einen einzigen und gleichen Kampf gegen den Kapitalismus führt, dass sie eine einzige und gleiche internationale Klasse ist, was auch immer die Unterschiede in den Bedingungen seien.
Heute erscheinen diese Kämpfe in Lateinamerika wie ein ferner Traum. Die aktuelle gesellschaftliche Situation in der Region kennt keine massiven Kämpfe und ähnliche Manifestationen oder gar bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen dem Proletariat und den Repressionskräften. Sie ist von einer allgemeinen gesellschaftlichen Instabilität gekennzeichnet. Der „Aufstand“ in Bolivien im Oktober 2003, die massiven Strassendemonstrationen, die im Dezember innert weniger Tage fünf argentinische Präsidenten aus dem Amt spülten, die venezolanische „Volksrevolution“ von Chavez, der in den Medien breitgetretene Kampf der Zapatistas in Mexiko, all diese und ähnliche Ereignisse haben die gesellschaftliche Bühne dominiert. In diesem Mahlstrom allgemeiner Unzufriedenheit, der sozialen Revolte gegen die sich ausbreitende Verarmung und Verelendung erscheint die Arbeiterklasse als eine unzufriedene Schicht unter anderen, die zu ihrer Verteidigung gegen die Verschlechterung ihrer Lage an der Revolte der anderen unterdrückten und verarmten Schichten der Gesellschaft teilnimmt und in ihnen aufgeht. Angesichts dieser Schwierigkeiten der Arbeiterklasse dürfen die Revolutionäre nicht einfach die Arme verschränken, sondern sie müssen unbeugsam die Unabhängigkeit der Arbeiterklasse verteidigen.
„Die Autonomie des Proletariats gegenüber allen Klassen der Gesellschaft ist die erste Vorbedingung für die Entwicklung des Klassenkampfs hin zur Revolution. Alle Bündnisse mit anderen Klassen oder Schichten und insbesondere jene Bündnisse mit Fraktionen der Bourgeoisie können nur zur Entwaffnung des Proletariats gegenüber seinen Feinden führen, da diese Bündnisse die Arbeiterklasse zur Aufgabe der einzigen Grundlage führen, wo das Proletariat seine Kräfte stärken kann: auf der Grundlage seines Kampfes als Klasse.“(1)
Da einzig die Arbeiterklasse eine revolutionäre Klasse ist, trägt auch nur sie eine Perspektive für die gesamte Menschheit in sich. Doch heute ist sie von Manifestationen des anwachsenden gesellschaftlichen Zerfalls des dahinsiechenden Kapitalismus umzingelt und hat grosse Schwierigkeiten, den Kampf als autonome Klasse mit eigenständigen Interessen aufzunehmen. Mehr denn je muss man in dieser Zeit an Marx erinnern, der schrieb: „Es handelt sich nicht darum, was dieser oder jener Proletarier oder selbst das ganze Proletariat als Ziel sich einstweilen vorstellt. Es handelt sich darum, was es ist und was es diesem Sein gemäss geschichtlich zu tun gezwungen sein wird.“ (2)
Der Klassenkampf in Lateinamerika von 1969 bis 1989
Die Geschichte des Klassenkampfes in Lateinamerika in den letzten 35 Jahren ist Teil des internationalen Klassenkampfes. Sie ist eine Geschichte harter Kämpfe, gewaltsamer Zusammenstösse mit dem Staatsapparat, zeitweiliger Siege und bitterer Niederlagen. Die spektakulären Bewegungen vom Ende der 60er und dem Beginn der 70er-Jahre haben eine Phase von schwierigeren und schmerzhafteren Kämpfen eröffnet. In dieser Phase stellte sich die fundamentale Frage, wie die Klassenautonomie zu verteidigen und zu entwickeln sei, mit noch grösserer Schärfe.
Der Kampf der Arbeiter 1969 in der Industriestadt Cordoba war besonders wichtig. Er manifestierte sich in einer einwöchigen bewaffneten Auseinandersetzung zwischen dem Proletariat und der argentinischen Armee. Die Kämpfe in ganz Argentinien, in Lateinamerika, ja der ganzen Welt sind dadurch stimuliert worden. Es handelte sich um den Beginn einer Kampfwelle, die in Argentinien 1975 mit dem Kampf der Metallarbeiter von Villa Constitución, dem bedeutendsten Zentrum der Stahlproduktion des ganzen Landes, den Höhepunkt erreichte. Die Arbeiter von Villa Constitución waren mit der gesamten Macht des Staatsapparates konfrontiert; denn die herrschende Klasse wollte mit der Niederschlagung dieses Kampfes ein Exempel statuieren. Daraus ergab sich ein sehr hohes Niveau der Auseinandersetzung zwischen Bourgeoisie und Proletariat: „Die Stadt wurde unter militärische Besetzung durch 4.000 Mann gestellt (...) Jedes Viertel wurde systematisch durchkämmt und es wurden Verhaftungen vorgenommen, was aber nur die Wut der Arbeiter provozierte: 20.000 Arbeiter sind in den Streik getreten und haben Fabriken besetzt. Trotz Mordanschlägen und Bombardierungen von Arbeiterhäusern hat sich sofort ein aussergewerkschaftliches Kampfkomitee gebildet. Viermal wurde die Streikführung eingekerkert, aber jedes Mal entstand sofort ein neues Komitee. Wie in Cordoba 1969 haben bewaffnete Arbeitergruppen die Verteidigung der Arbeiterquartiere übernommen und haben den Aktivitäten der paramilitärischen Banden ein Ende bereitet.
Die Aktion der Stahl- und Metallarbeiter, die eine Lohnsteigerung um 70 Prozent forderten, hat sehr schnell von der Solidarität der Arbeiter in anderen Betrieben des Landes – in Rosario, in Cordoba und Buenos Aires – profitiert. In Buenos Aires haben beispielsweise die Arbeiter von Propulsora, die aus Solidarität in einen Streik getreten waren und die ihre ganzen Lohnforderungen (130.000 Pesos monatlich) durchsetzen konnten, entschieden, die Hälfte ihres Lohnes den Arbeitern von Villa Constitución zu spenden.“ (3)
Aus dem gleichen Grund haben die Arbeiter in Chile zu Beginn der 70er-Jahre ihre Klasseninteressen verteidigt und es abgelehnt, sie zugunsten der Volksfront-Regierung Allendes zu opfern: „Der Widerstand der Arbeiter gegen Allende begann 1970. Im Dezember 1970 traten 4.000 Minenarbeiter in Chuquicamata in den Streik und forderten höhere Löhne. Im Juli 1971 legten 10.000 Minenarbeiter in Lota Schwager ihre Arbeit nieder. Beinahe zur gleichen Zeit breitete sich eine Streikwelle in den Minen von El Salvador, El Teniente, Chuquicamata, La Exotica und Rio Blanco aus. Überall wurden höhere Löhne gefordert (...) Im Mai/Juni 1973 setzten sich die Minenarbeiter erneut in Bewegung. In den Minen von El Teniente und Chuquicamata traten 10.000 Arbeiter in den Streik. Die Minenarbeiter von El Teniente forderten eine Lohnerhöhung um 40 Prozent. Allende setzte die Provinzen O’Higgins und Santiago unter Militärkontrolle, weil die von El Teniente ausgehende Lähmung eine ernsthafte Bedrohung für die Wirtschaft darstellte.“ (4)
Wichtige Arbeiterkämpfe haben sich auch in anderen bedeutenden Arbeiterkonzentrationen Lateinamerikas zugetragen. In Lima, Peru, brachen 1976 aufstandsartige Streiks aus. Sie wurden blutig unterdrückt. Einige Monate später traten die Minenarbeiter von Centramin in den Streik. In Riobamba, Ecuador, fand ein Generalstreik statt. Im Januar des gleichen Jahres brach in Mexiko eine Streikwelle aus. 1978 gab es erneut Generalstreiks in Peru. Nach zehn ruhigen Jahren setzten sich 200.000 Metallarbeiter in Brasilien an die Spitze einer Streikbewegung, die von Mai bis Oktober dauerte. In Chile kam es 1976 zu Streiks der Metro-Angestellten von Santiago und der Minenarbeiter. In Argentinien brachen trotz des Terrors der Militärjunta 1976 Streiks in den Elektrizitätswerken und in der Automobilindustrie aus, die in gewaltsame Zusammenstösse zwischen Arbeitern und der Armee mündeten. Die 70er-Jahre waren auch von wichtigen Kampfepisoden in Bolivien, Guatemala und Uruguay gekennzeichnet.
Auch in den 80er-Jahren hat das Proletariat Lateinamerikas an der internationalen Kampfwelle teilgenommen, die 1983 in Belgien begonnen hatte. Die entwickeltsten dieser Kämpfe waren von den entschiedenen Anstrengungen seitens der Arbeiter gekennzeichnet, die Bewegung auszuweiten. So kämpften beispielsweise die Angestellten des Bildungssektors in Mexiko für eine Erhöhung der Gehälter: „Die Forderung der Arbeiter des Erziehungswesens stellte bereits von Beginn an die Frage nach der Ausweitung der Kämpfe, denn es herrschte eine allgemeine Unzufriedenheit gegenüber den Austeritätsplänen. Auch wenn die Bewegung gerade schwächer wurde, als jene im Erziehungswesen begann, streikten und demonstrierten doch 30.000 Angestellte des öffentlichen Sektors ausserhalb der gewerkschaftlichen Kontrolle. Sie erkannten, dass die Ausdehnung und Einheit des Kampfes notwendig waren: Zu Beginn haben die Arbeiter aus dem Süden von Mexiko City Delegierte zu anderen Beschäftigten des Bildungssektors entsandt und sie dazu aufgerufen, sich dem Kampf anzuschliessen. Sie sind auch auf die Strassen gegangen und haben Kundgebungen durchgeführt. Sie haben sich dagegen gewehrt, den Kampf einzig auf die Lehrer einzugrenzen, und haben alle Arbeiter des Erziehungswesens (Lehrer, Verwaltungsangestellte, Handarbeiter) in den Massenversammlungen zusammengerufen, um den Kampf zu kontrollieren.“ (5)
Die gleichen Tendenzen haben sich auch in anderen Teilen Lateinamerikas gezeigt: „Selbst die bürgerlichen Medien haben von einer ‚Streikwelle’ in Lateinamerika gesprochen, mit Kämpfen in Chile, Peru, Mexiko (...) und auch in Brasilien, wo Arbeiter aus Banken, von den Docks, aus dem Gesundheits- und Bildungssektor gleichzeitig gegen das Einfrieren der Löhne protestierten.“ (6)
Die Arbeiterklasse Lateinamerikas hat von 1969 bis 1989 trotz aller Rückschläge, Schwierigkeiten und Schwächen gezeigt, dass sie vollumfänglich am historischen Wiederaufschwung der internationalen Arbeiterklasse teilnahm.
Der Fall der Berliner Mauer und die darauf folgende Propagandaflut der Bourgeoisie über den „Tod des Kommunismus“ haben einen tiefgreifenden Einbruch in den Klassenkämpfen auf internationaler Ebene herbeigeführt. Das hat sich vor allem im Verlust der Klassenidentität des Proletariats gezeigt. Dieser Rückschlag zeitigte bei den Arbeitern Südamerikas weit schädlichere Auswirkungen, da die Entwicklung der Krise und des gesellschaftlichen Zerfalls die verarmten, unterdrückten und verelendeten Massen in den Strudel der interklassistischen Revolten zogen. Das erschwert die schwierige Aufgabe, sich als autonome Klasse zu behaupten und die Distanz gegenüber der „Volksmacht“ und den Volksaufständen zu wahren.
Die schädlichen Auswirkungen des kapitalistischen Zerfalls und der interklassistischen Revolten
Der Zusammenbruch des Ostblocks war sowohl Produkt als auch Beschleunigungsfaktor des Zerfalls des Kapitalismus vor dem Hintergrund einer sich vertiefenden Wirtschaftskrise. Lateinamerika wurde davon mit voller Wucht getroffen. Millionen von Menschen wurden dazu gezwungen, ihr Dorf zu verlassen und sich auf der verzweifelten Suche nach inexistenten Arbeitsplätzen in die Slumsiedlungen der grossen Städte zu begeben, während gleichzeitig Millionen von jungen Arbeitern aus dem Lohnarbeitsprozess ausgeschlossen wurden. Dieses Phänomen ist seit 35 Jahren wirksam und erfuhr in den letzten zehn Jahren eine brutale Verschärfung. Es hat zu einem massiven Wachstum jener Gesellschaftsschichten geführt, die zur nichtausbeutenden und keinen Lohn empfangenden Schichten der Bevölkerung gehören. Diese dem Verhungern nah überlassenen Teile der Gesellschaft, die um ihr tagtägliches Brot kämpfen müssen, nehmen ständig zu.
In Lateinamerika leben 221 Millionen Menschen (41 Prozent der Bevölkerung) in Armut. Diese Zahl ist allein im letzten Jahr um sieben Millionen (von denen sechs Millionen in eine extreme Armut absanken) und in den letzten zehn Jahren um 21 Millionen angestiegen. Gegenwärtig leben 20 Prozent der lateinamerikanischen Bevölkerung in äusserster Armut. (7)
Die Verschärfung des gesellschaftlichen Zerfalls zeigt sich im Wachstum der informellen, scheinselbstständigen Wirtschaft des Strassenverkaufs. Das Ausmass dieses Sektors variiert entsprechend der Wirtschaftskraft eines Landes. In Bolivien übertraf im Jahr 2000 die Zahl der Scheinselbstständigen die der Lohnempfänger (47,8 zu 44,5 Prozent der aktiven Bevölkerung), während in Mexiko das Verhältnis noch 21:74,4 beträgt.
Auf dem ganzen Kontinent leben 128 Millionen Menschen oder 33 Prozent der städtischen Bevölkerung in Elendsquartieren. Diese Millionenmassen leben beinahe ohne jegliche sanitäre Installationen und elektrischen Strom. Ihr Leben ist geprägt von Kriminalität, von Drogen und vom Bandenwesen. In den Elendsvierteln von Rio finden seit Jahren Kämpfe zwischen rivalisierenden Gangs statt, eine Situation, die im Film La Ciudade de Deus anschaulich porträtiert wurde. Die Arbeiter Lateinamerikas und insbesondere jene in den Elendsquartieren sind mit den weltweit höchsten Kriminalitätsraten konfrontiert. Die Zerstörung der familiären Bindungen hat zu einer massiven Zunahme von ihrem Schicksal überlassenen Strassenkindern geführt.
Millionen von Bauern haben immer grössere Schwierigkeiten, dem Boden auch nur die miserabelsten Subsistenzmittel zu entreissen. In einigen tropischen Gebieten hat, neben der Holzindustrie, dies zu einer Beschleunigung der Umweltzerstörung geführt, da die landhungrigen Bauern dazu gezwungen sind, auf den Boden des Regenwaldes vorzudringen. Diese Lösung bringt jedoch nur eine kurze Atempause, da die dünne Humusschicht des Regenwaldes schnell ausgelaugt ist, und endet in einer Spirale der Entwaldung.
Die Zunahme der Schicht der Verelendeten hatte eine bedeutende Auswirkung auf die Fähigkeit des Proletariats, die eigene Klassenautonomie zu verteidigen. Das hat sich ganz klar Ende der 80er-Jahre gezeigt, als in Venezuela, Argentinien und Brasilien Hungerrevolten ausbrachen. Mit Hinweis auf den Aufstand in Venezuela, in dem mehr als Tausend Menschen umkamen und ebenso viele verletzt wurden, warnten wir damals vor den Gefahren solcher Aufstände für das Proletariat: „Die treibende Kraft dieser gesellschaftlichen Tumulte war eine blinde, perspektivlose Wut, die sich über lange Jahre systematischer Angriffe gegen die Lebens- und Arbeitsbedingungen jener, die noch eine Arbeit hatten, aufgestaut hatte. In ihnen entluden sich die Frustrationen von Millionen von Arbeitslosen, von Jungen, die nie gearbeitet haben und die von der Gesellschaft gnadenlos in den Sumpf der Verelendung getrieben wurden. Die Länder der Peripherie des Kapitalismus sind unfähig, diesen Menschen auch nur die geringste Lebensperspektive aufzuzeigen (...)Aufgrund des Mangels einer politischen Orientierung auf eine proletarische Perspektive sind diese Strassenunruhen mit den Brandschatzungen von Autos, den ohnmächtigen Konfrontationen mit der Polizei und später mit den Plünderungen von Lebensmittel- und Elektrowarengeschäften einzig von der Wut und der Frustration angetrieben worden. Die Bewegung, die als Protest gegen die wirtschaftlichen Massnahmen entstanden war, hat sich also sehr rasch in Plünderungen und perspektivlosen Zerstörungen aufgelöst.“ (8)
In den 90er-Jahren wurde die Verzweiflung der nicht-ausbeutenden Schichten in zunehmendem Masse von Teilen des Bürgertums und des Kleinbürgertums ausgenutzt. In Mexiko haben sich die Zapatistas mit ihren Ideen über die „Volksmacht“ und ihrer Eigendarstellung als Repräsentant eben dieser Macht anfangs als Meister darin ausgewiesen. In Venezuela hat Chavez die nicht-ausbeutenden Schichten, vor allem die Bewohner der Elendsviertel, hinter der Idee einer „Volksrevolution“ gegen das alte, korrumpierte System mobilisiert.
Diese Volksbewegungen hatten reale Auswirkungen auf das Proletariat, insbesondere in Venezuela, wo nach wie vor die Gefahr einer teilweisen Verstrickung in einem blutigen Bürgerkrieg zwischen den rivalisierenden Fraktionen der Bourgeoisie besteht.
Die Morgendämmerung des 21. Jahrhunderts hat keine Verminderung der zerstörerischen Auswirkungen der Verzweiflung der nicht-ausbeutenden Schichten mit sich gebracht. Im Dezember 2001 ist das argentinische Proletariat – es ist eines der ältesten und erfahrensten der lateinamerikanischen Arbeiterklasse – in einen Volksaufstand gerissen worden, der in einem Zeitraum von 15 Tagen fünf Präsidenten hintereinander von der Macht weggeputzt hatte. Im Oktober 2003 ist der Hauptsektor der bolivianischen Arbeiterklasse, die Minenarbeiter, ebenfalls in einen blutigen, vom Kleinbürgertum und den Bauern angeführten Volksaufstand verstrickt worden, in dem es zahlreiche Tote und Verletzte gab – und dies alles im Namen der Verteidigung der bolivianischen Gasreserven und der Legalisierung der Koka-Produktion!
Die Tatsache, dass bedeutende Teile des Proletariats von diesen Revolten erfasst worden sind, ist von grosser Bedeutung, weil dies offenbart, dass die Arbeiterklasse die Klassenautonomie weitgehend verloren hat. Anstatt sich als Proletarier mit eigenen Interessen zu verstehen, haben sich die Arbeiter Boliviens und Argentiniens als Bürger verstanden, die gemeinsame Interessen mit den kleinbürgerlichen und nicht-ausbeutenden Schichten der Gesellschaft teilen.
Die absolute Notwendigkeit einer revolutionären Klarheit
Mit der Verschärfung der Lage wird es weitere Aufstände dieses Typs geben, in denen es, wie das bereits in Venezuela der Fall war, auch blutige Bürgerkriege und Massaker geben kann, die bedeutende Teile der internationalen Arbeiterklasse physisch und ideologisch vernichten können. Angesichts dieser düsteren Perspektive ist es die Pflicht der Revolutionäre, ihre Intervention auf die Notwendigkeit auszurichten, dass das Proletariat einen Kampf zur Verteidigung der eigenen, spezifischen Klasseninteressen führen muss. Unglücklicherweise befinden sich nicht alle revolutionären Organisationen diesbezüglich auf der Höhe der eigenen Verantwortung. Das Internationale Büro der revolutionären Partei (IBRP) verlor gegenüber dem Gewaltausbruch der argentinischen Bevölkerung jeglichen politischen Kompass und schätzte die Lage völlig falsch ein: „Spontan sind die Arbeiter auf die Strassen gegangen und haben die Jungen, Studenten und bedeutende Teile des proletarisierten und wie sie selber verarmten Kleinbürgertums mit sich gezogen. Gemeinsam haben sie ihre Wut gegen die heiligen Stätten des Kapitalismus gerichtet: gegen Banken, Büros, aber hauptsächlich gegen Kaufhäuser und allgemein gegen Geschäfte, die ebenso angegriffen wurden wie die Bäckereien in den mittelalterlichen Brotaufständen. Die Regierung entfesselte eine blutige Repression mit Dutzenden von Toten und Tausenden Verletzten und hoffte so, die Rebellen einzuschüchtern. Das hat aber kein Ende der Revolte herbeigeführt, sondern sie ist im Gegenteil auf den Rest des Landes ausgedehnt worden und nahm immer mehr einen Klassencharakter an. Selbst die Regierungsgebäude, Symbole der Ausbeutung und der finanziellen Plünderung, sind angegriffen worden.“ (9)
Erst kürzlich hat Battaglia Comunista angesichts des sozialen Aufruhrs in Bolivien, der in den blutigen Ereignissen vom Oktober 2003 kulminierte, einen Artikel veröffentlicht, der die indianischen Ayllu (Gemeinderäte) pries: „Die Ayllu hätten nur eine Rolle in der revolutionären Strategie spielen können, wenn sie den gegenwärtigen Institutionen den proletarischen Inhalt der Bewegung entgegengestellt und die archaischen und lokalistischen Aspekte überwunden hätten, d.h. also nur, wenn sie als wirksamer Mechanismus für eine Einheit zwischen Indianern, weissen und farbigen Proletariern zur Errichtung einer Front gegen die Bourgeoisie und jenseits jeglicher rassischer Rivalitäten gewirkt hätten (...) Die Ayllu hätten ein Ausgangspunkt für die Vereinigung und Mobilisierung des indianischen Proletariats sein können, aber das ist noch unzureichend als Grundlage für die Errichtung einer vom Kapitalismus emanzipierten Gesellschaft.“ Dieser Artikel von Battaglia Comunista wurde im November 2003 veröffentlicht, also nachdem sich die blutigen Ereignisse vom Oktober zugetragen hatten, in denen just das indianische Kleinbürgertum das Proletariat und insbesondere die Minenarbeiter zu einer hoffnungslosen Auseinandersetzung mit den Armeekräften verleitete. Ein Massaker, in dem Proletarier geopfert wurden, damit die indianische Bourgeoisie und das indianische Kleinbürgertum ein grösseres „Stück vom Kuchen“ ergattern konnten bei der Neuverteilung von Macht und Profiten, die aus der Ausbeutung der Bergarbeiter und Landarbeiter stammen. Wie einer ihrer Führer, Alvero Garcia, freimütig zugab, haben die Indianer keine verschwommenen Träume über die Ayllu als Ausgangspunkt für eine bessere Gesellschaft.
Der Enthusiasmus des IBRP bezüglich der Ereignisse in Argentinien ist die logische Folge seiner Analyse über die „Radikalisierung des Bewusstseins“ der nicht-ausbeutenden Schichten in den peripheren Ländern: „Die Diversität der sozialen Strukturen, die Tatsache, dass das Aufzwingen der kapitalistischen Produktionsweise das alte Gleichgewicht umkippt und dass die Aufrechterhaltung ihrer Existenz auf die Grundlage und Ausweitung der Verelendung von immer grösseren Massen von Proletarisierten und Enterbten fusst, die politische Unterdrückung und Repression, die notwendig zur Unterjochung der Massen sind, all das führt zu einem grösseren Potenzial für die Radikalisierung des Bewusstseins in den peripheren Ländern als in den Metropolen (...) In vielen dieser (peripheren) Länder ist die ideologische und politische Integration des Individuums in die kapitalistische Gesellschaft noch kein Massenphänomen wie in den Ländern der Metropolen.“ (10)
Gemäss diesem Standpunkt sind diese massiven und gewaltsamen Volksaufstände positiv. In der Vorstellung des IBRP ist das Untertauchen des Proletariats in der Welle des Interklassismus nicht der Ausdruck einer sterilen und zukunftslosen Revolte, sondern die Konkretisierung „einer Radikalisierung des Bewusstseins“. Infolgedessen hat sich das IBRP als völlig unfähig erwiesen, die wirklichen Lehren aus Ereignissen wie die des Dezembers 2001 in Argentinien zu ziehen.
Sowohl in den „Thesen“ als auch in den Analysen der konkreten Situationen begeht das IBRP zwei Fehler, die gewisse Allgemeinplätze der Linken und der Antiglobalisierungsbewegung widerspiegeln. Der erste Fehler ist die theoretische Ansicht, dass die Bewegungen zur Verteidigung nationaler, bürgerlicher oder kleinbürgerlicher Interessen, die mit denen des Proletariats unvereinbar sind (wie die Ereignisse in Bolivien oder der Aufstand vom Dezember 2001 in Argentinien), in Arbeiterkämpfe umgewandelt werden könnten. Der zweite, eher empirische Fehler besteht in der Einbildung, dass diese wundersame Umwandlung auch tatsächlich stattgefunden hat und dass Bewegungen, die vom Kleinbürgertum und von nationalistischen Sprüchen dominiert werden, wirkliche Arbeiterkämpfe sind.
Wir sind bereits in einem Artikel in der Internationalen Revue Nr. 30 („Volksaufstand in Argentinien: Nur auf dem Klassenterrain des Proletariats kann die Bourgeoisie zurückgedrängt werden“) mit dem IBRP bezüglich seiner politischen Desorientierung angesichts der Ereignisse in Argentinien ins Gericht gegangen. Am Ende dieses Artikels fassen wir unseren Standpunkt zusammen: „Unsere Analyse bedeutet absolut nicht, dass wir die Kämpfe des Proletariats in Argentinien und in anderen Zonen, wo der Kapitalismus schwächer ist, mit Verachtung strafen oder unterschätzen. Sie bedeutet einfach, dass Revolutionäre, als die Vorposten des Proletariats und mit einer klaren Vision von der Marschrichtung der proletarischen Bewegung als Ganzes ausgestattet, die Verantwortung haben, deutlich und exakt auf die Stärken und Grenzen des Arbeiterkampfes hinzuweisen, darauf, wer die Verbündeten sind und welche Richtung sein Kampf einschlagen sollte. Um dem gerecht zu werden, müssen sich Revolutionäre mit all ihrer Kraft der opportunistischen Versuchung – durch Ungeduld, Immediatismus oder einen historischen Mangel an Vertrauen in das Proletariat – entgegenstemmen und dürfen nicht eine Klassen übergreifende Revolte (wie wir sie in Argentinien gesehen haben) mit einer Klassenbewegung verwechseln.“ (11)
Das IBRP hat auf unsere Kritik geantwortet (12) und die Position, wonach das Proletariat diese Bewegung angeführt hatte, verteidigt und gleichzeitig die Auffassung der IKS verurteilt: „Die IKS unterstreicht die Schwächen des Kampfes und weist auf die interklassistische und heterogene Natur und die linksbürgerliche Führung hin. Sie beklagt sich über die Gewalt innerhalb der Klasse und über die vorherrschenden bürgerlichen Ideologien wie den Nationalismus. Für die IKS macht der Mangel an kommunistischem Bewusstsein aus dieser Bewegung eine ‚sterile Revolte ohne Zukunft’.“Es ist klar, dass das IBRP unsere Analyse nicht verstanden hat, oder besser: sie ziehen es vor, sie als das zu betrachten, als was sie sie betrachten wollen. Wir können die Leser nur dazu ermutigen, unseren Artikel zu lesen.
Im Gegensatz zu diesem Standpunkt analysiert der Nucleo Comunista Internationalista (NCI) – eine Gruppe, die sich in Argentinien Ende des Jahres 2003 gebildet hat – diese Ereignisse ganz anders und zieht entsprechend auch andere Schlussfolgerungen. In der zweiten Nummer seines Bulletins führte der NCI eine Polemik mit dem IBRP über die Natur der Ereignisse in Argentinien: „Das IBRP sagt fälschlicherweise, dass das Proletariat Studenten und andere soziale Schichten hinter sich gerissen habe. Das ist ein grosser Irrtum, den es mit den Genossen der GCI12 teilt. Tatsache ist, dass die Arbeiterkämpfe, die während des Jahres 2001 stattgefunden haben, die Unfähigkeit des argentinischen Proletariats aufgezeigt haben, nicht nur die Führung der Gesamtheit der Arbeiterklasse, sondern auch der auf den Strassen protestierenden sozialen Bewegung zu übernehmen und alle nicht ausbeutenden Schichten hinter sich zu scharen. Im Gegenteil waren es nicht-proletarische Schichten, die sich in den Ereignissen vom 19. und 20. Dezember an die Spitze stellten. Also können wir sagen, dass die Entwicklung dieser Bewegungen keine historische Zukunft aufwiesen, was sich auch im darauf folgenden Jahr bestätigt hat.“ (13)
Die GCI sagt bezüglich der Verstrickung von Proletariern in Plünderungen Folgendes: „Es gab mehr als nur den Willen, den Unternehmen und Banken soviel Geld wie möglich zu klauen. Es handelte sich um einen allgemeinen Angriff auf die Welt des Geldes, des Privateigentums, der Banken und des Staates, gegen diese Welt, die eine Beleidigung für das menschliche Leben ist. Das ist nicht nur eine Frage der Enteignung, sondern auch eine Behauptung des revolutionären Potenzials, des Potenzials zur Zerstörung einer Gesellschaft, die die Menschen zerstört.“ (14)
Der NCI stellt sich gegen eine solche Sichtweise und präsentiert eine ganz andere Analyse über die Beziehung zwischen diesen Ereignissen und der Entwicklung des Klassenkampfes:
„Die Kämpfe in Argentinien in der Periode 2001–2002 sind kein isoliertes Ereignis, sie waren das Produkt einer längeren Entwicklung, die wir in drei Teile aufteilen können:
a) Erstes Element 2001: Wie wir bereits weiter oben gesagt haben, war 2001 von einer Serie von Kämpfen für typische Arbeiterforderungen geprägt. Ihr gemeinsamer Nenner war die Isolierung gegenüber anderen Abteilungen des Proletariats und die Prägung der Konterrevolution: die Vermittlung, die von der Hegemonie der politischen Führung der Gewerkschaftsbürokratie gesichert war.
Trotz dieser Begrenztheit konnte man bedeutende Manifestationen von Arbeiterselbstorganisation erkennen wie beispielsweise der Minenarbeiter von Rio Turbio im Süden des Landes, in Zanon und in Norte de Salta (zusammen mit den Bauarbeitern und arbeitslosen, ehemaligen Erdölarbeitern). Diese kleinen Arbeiterabteilungen bildeten die Avantgarde, die die Notwendigkeit der Einheit der Arbeiterklasse und der streikenden Proletarier zur Debatte stellten.
b) Zweitens die zwei Tage vom 19. und 20. Dezember: Wir wiederholen, dass dies weder eine von Teilen der Arbeiterklasse noch eine von Arbeitslosen angeführte Revolte war, sondern ein interklassistischer Aufstand. Das Kleinbürgertum war darin das zentrale Element, denn die ökonomischen Angriffe der Regierung De La Rua waren direkt gegen seine Interessen und auch, mit dem Dekret vom Dezember 2001 zur Einfrierung der Bankguthaben, gegen ihre Wählerbasis und politische Unterstützung gerichtet ( ...)
c) Drittens muss man vorsichtig sein und sich davor hüten, die so genannten Volksversammlungen zu verherrlichen, die sich in den kleinbürgerlichen Vierteln von Buenos Aires, weit ab von den Arbeitervierteln, an die Spitze der Bewegung stellten. Dennoch gab es in dieser Zeit eine Entwicklung von sehr bescheidenen Kämpfen auf dem Terrain der Arbeiterklasse, die im Begriff waren zu wachsen: Gemeindearbeiter und Lehrer demonstrierten, forderten die Auszahlung ihrer Löhne; Industriearbeiter kämpften gegen die Entlassungen durch die Unternehmerorganisationen (z.B. die Lastwagenfahrer).
Damals besassen die beschäftigten und unbeschäftigten Arbeiter die Möglichkeit nicht nur einer wahren Einheit, sondern auch der Aussaat einer späteren autonomen Klassenorganisation. Dagegen hat die Bourgeoisie versucht, die Arbeiterklasse mit Hilfe der neuen Bürokratie der Piqueteros zu spalten und irrezuführen. Damit ist die Erfahrung, die eine bedeutende Waffe in den Händen der Arbeiter war, verschmäht worden, wie im Fall der so genannten Nationalversammlung der beschäftigten und unbeschäftigten Arbeiter.
Aus diesen Gründen denken wir, dass es ein Fehler ist, die Kämpfe, die sich 2001 und 2002 hindurch ereigneten, mit den Ereignissen vom 19. und 20. Dezember 2001 zu identifizieren, denn sie unterscheiden sich und das eine ist nicht die Konsequenz des anderen.
Die Ereignisse vom 19. und 20. Dezember hatten absolut keinen proletarischen Charakter, da sie weder von Arbeitenden noch von Arbeitslosen angeführt worden waren. Letztere lieferten die Munition für die Slogans und Interessen des Kleinbürgertums von Buenos Aires, die vollständig verschieden sind von den Zielen des Proletariats ( ...)
Dies zu erwähnen ist sehr wichtig, weil in der Periode der Dekadenz des Kapitalismus das Proletariat Gefahr läuft, die Klassenidentität und das Vertrauen in die eigene Rolle als Subjekt der Geschichte und entscheidende Kraft der gesellschaftlichen Umwandlung zu verlieren. Das ist ein Ergebnis des Rückflusses des Klassenbewusstseins, der wiederum das Resultat des Zusammenbruchs des stalinistischen Blocks und des Gewichts der kapitalistischen Propaganda über die Niederlage des Klassenkampfs auf das Denken der Arbeiter ist. Darüber hinaus hat die Bourgeoisie den Arbeitern eingeredet, dass es keinen Klassengegensatz gebe, dass die Leute vielmehr durch die Beteiligung am bzw. den Ausschluss vom Markt vereint oder getrennt würden. Sie versucht also, den blutigen Graben zwischen Proletariat und Bourgeoisie einzuebnen.
Diese Gefahr hat man in Argentinien während der Ereignisse vom 19. und 20. Dezember 2001 gesehen, in denen die Arbeiterklasse nicht fähig war, sich in eine autonome Kraft im Kampf für die eigenen Interessen zu verwandeln. Sie ist vielmehr in den Strudel der interklassistischen Revolte unter der Führung von nicht-proletarischen Schichten gerissen worden ...“ (s.o.)
Der NCI stellt die Ereignisse in Bolivien in denselben Rahmen: „Natürlich muss man den kämpfenden bolivianischen Arbeitern Respekt zollen und sie voll und ganz unterstützen, dennoch ist es notwendig, die Tatsache klarzustellen, dass die Kampfbereitschaft der Klasse nicht das einzige Kriterium zur Bestimmung des Kräfteverhältnisses zwischen Bourgeoisie und Proletariat ist, da die Arbeiterklasse in Bolivien nicht fähig war, eine massive und vereinte Bewegung zu entwickeln, die hinter sich den Rest der nicht-ausbeutenden Schichten der Gesellschaft hätte vereinigen können. Das Gegenteil hat sich zugetragen: Die Bauern und die Kleinbürger haben diese Revolte angeführt.
Das bedeutet, dass die bolivianische Arbeiterklasse sich in einer interklassistischen ‚Volksbewegung’ aufgelöst hat. Wir behaupten dies aus verschiedenen Gründen:
a) Die Bauernschaft hat diese Revolte mit zwei Zielsetzungen angeführt: die Legalisierung des Kokaanbaus und die Verweigerung des Verkaufs von Erdgas an die USA.
b) Es wurde die Forderung nach einer konstituierenden Versammlung als Mittel erhoben, um aus der Krise herauszukommen und ‚die Nation wieder aufzubauen’.
c) Nirgendwo hat diese Bewegung den Kampf gegen den Kapitalismus zuvorderst gestellt.
Die Ereignisse in Bolivien weisen eine grosse Ähnlichkeit mit denen in Argentinien 2001 auf, wo das Proletariat ebenfalls durch die Slogans des Kleinbürgertums aufgerieben worden ist. Diese ‚Volksbewegungen’ enthielten tatsächlich einen ziemlich reaktionären Aspekt, indem sie den Wiederaufbau der Nation oder den Rauswurf der ‚Gringos’ und die Rückgabe der Rohstoffe an den bolivianischen Staat propagierten (...) Die Revolutionäre müssen Klartext sprechen und sich illusionslos und ohne Selbsttäuschung auf die Tatsachen des Klassenkampfs stützen. Es ist notwendig, eine proletarische, revolutionäre Position einzunehmen, denn es wäre ein ernster Fehler, eine soziale Revolte mit einem engen politischen Horizont mit einem proletarischen antikapitalistischen Kampf zu verwechseln.“ (15)
Diese Analyse des NCI stützt sich auf die wirklichen Tatsachen und zeigt ganz klar auf, dass das IBRP die eigenen Wünsche zur Realität erhebt, wenn es die Idee der „Radikalisierung des Bewusstseins“ unter den nicht-ausbeutenden Schichten propagiert. Die konkrete Situation in der Peripherie ist die wachsende Zerstörung der gesellschaftlichen Beziehungen, die Propagierung des Nationalismus, des Populismus und anderer ähnlich reaktionärer Ideologien, die alle sehr ernste Folgen für die Fähigkeit des Proletariats haben, die eigenen Klasseninteressen zu verteidigen.
Glücklicherweise scheint diese Tatsache doch nicht vollständig unbemerkt von gewissen Publikationen des IBRP zu bleiben. Die Nummer 30 der Revolutionary Perspectives (Organ der Communist Workers Organisation, der Gruppe des IBRP in Grossbritannien) präsentiert im Editorial „Die imperialistischen Rivalitäten spitzen sich zu, der Klassenkampf muss sich zuspitzen“ ein der Realität viel näheres Bild der Ereignisse in Argentinien und in Bolivien: „Wie in Argentinien waren diese Proteste interklassistisch und ohne klare soziale Zielsetzung. Wir haben dies im Fall Argentiniens gesehen, wo die gewaltsame Agitation vor zwei Jahren den Weg für die Austerität und Verarmung geebnet hatte (...) Während der Ausbruch der Revolte die Wut und die Verzweiflung der Bevölkerung in vielen peripheren Ländern aufzeigt, können solche Ausbrüche gleichwohl keinen Ausweg aus der dort existierenden katastrophalen gesellschaftlichen Lage finden. Der einzige Weg nach vorn ist der Klassenkampf und seine Verbindung mit den Arbeiterkämpfen der Metropolen.“
Der Artikel denunziert indessen unglücklicherweise nicht die Rolle des Nationalismus oder der indianischen Kleinbourgeoisie in Bolivien. So bleibt die offizielle Position des IBRP bezüglich dieser Frage notwendigerweise jene, die von Battaglia Comunista vertreten wird, wonach „die Ayllu ein Ausgangspunkt für die Vereinigung und die Mobilisierung des indianischen Proletariats sein könnten“. Die Realität ist, dass die Ayllu der Ausgangspunkt für die Mobilisierung des indianischen Proletariats hinter dem indianischen Kleinbürgertum, den Bauern und Kokapflanzern in ihrem Kampf gegen die regierende Fraktion der Bourgeoisie waren.
Diese Verirrung von Battaglia Comunista, den „indianischen Gemeinderäten“ ein Potenzial bei der Entwicklung des Klassenkampfes zuzuschreiben, ist vom NCI nicht unbemerkt geblieben. Er sah es als notwendig an, Battaglia zu dieser Frage zu schreiben. Nachdem er betont hatte, was die Ayllu tatsächlich sind, nämlich „ein Kastensystem zur Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Unterschiede zwischen der Bourgeoisie, gleich, ob weiss, mestizisch oder eingeboren, und dem Proletariat“, richtet der NCI in seinem Brief (datiert vom 14. November 2003) folgende Kritik an Battaglia: „Unserer Ansicht nach handelt es sich bei dieser Position um einen schwerwiegenden Irrtum, da sie dieser traditionellen eingeborenen Institution die Fähigkeit zuspricht, Ausgangspunkt für die Arbeiterkämpfe in Bolivien zu sein, auch wenn sie in der Folge ihre Grenzen aufzeigt. Wir betrachten die Aufrufe der Anführer der Volksrevolte zur Wiederherstellung der mythischen Ayllu als Spaltung zwischen den weissen und den indianischstämmigen Arbeitern. Dies ist auch der Fall bei der Forderung an die herrschende Klasse nach einem grösseren Anteil am Kuchen, der vom Mehrwert, das aus dem bolivianischen Proletariat, gleich, welcher Herkunft, herausgepresst wurde, produziert wird.
Jedoch glauben wir fest daran, dass im Gegensatz zu eurer Erklärung der ‚Ayllu’ niemals als ‚ein Beschleuniger und Integrator in einem einzigen und gemeinsamen Kampf’ wird wirken können, da er von reaktionärer Natur ist und die ‚eingeborene’ Annäherung eine Idealisierung (eine Verfälschung) der Geschichte dieser Gemeinden darstellt, da ‚im Inkasystem die Gemeindeelemente des Ayllu in ein unterdrückerisches Kastensystem im Dienste der Oberschicht, der Inkas, eingebunden waren’ (Osvaldo Coggiola, „L’indigénisme bolivarien“). Aus diesem Grund ist es ein schwerwiegender Fehler zu meinen, dass der Ayllu als Beschleuniger und Integrator der Kämpfe wirken könnte.
Es ist wahr, dass die bolivianische Rebellion von eingeborenen Gemeinschaften von Bauern und Kokapflanzern angeführt worden ist, aber gerade hier liegt auch der grosse Schwachpunkt und nicht etwa die Stärke, da es sich um eine einfache und simple Volksrebellion handelt, in der die Arbeiter nur eine zweitrangige Rolle spielen. Die bolivianische interklassistische Revolte leidet also an der Abwesenheit einer revolutionären Arbeiterperspektive. Im Gegensatz zu den Gedanken gewisser Strömungen des trotzkistischen und guevaristischen Lagers kann man diese Revolte keinesfalls als ‚Revolution’ bezeichnen. Die eingeborenen Bauernmassen setzten sich in keinem Augenblick den Umsturz des kapitalistischen Systems in Bolivien zum Ziel. Im Gegenteil: Wir haben bereits gesagt, dass die Ereignisse in Bolivien sehr stark vom Chauvinismus geprägt sind: Verteidigung der nationalen Würde, Verweigerung des Erdgasverkaufs an Chile, Widerstand gegen die Ausmerzung der Kokapflanze.“
Die Rolle der Ayllu in Bolivien findet in der mexikanischen AZLN (Zapatistische Armee der nationalen Befreiung) ein Ebenbild: Sie hat die eingeborenen Gemeindeorganisationen zur Mobilisierung der indianischen Kleinbourgeoisie, der Bauern und Proletarier von Chiapas und anderen Regionen Mexikos im Kampf gegen die Hauptfraktion der mexikanischen Bourgeoisie gebraucht. Dieser Kampf stand auch im interimperialistischen Spannungsfeld zwischen den USA und gewissen europäischen Mächten.
Diese Sektoren der indianischen Bevölkerung Lateinamerikas sind weder ins Proletariat noch in die Bourgeoisie integriert worden und sind einer extremen Armut und Marginalisierung ausgeliefert. Diese Situation „hat Intellektuelle und gewisse Strömungen des Kleinbürgertums und der Bourgeoisie dazu veranlasst, nach Argumenten zu suchen, weshalb die Indianer ein gesellschaftlicher Körper mit einer historischen Alternative seien und wie sie als Kanonenfutter für den so genannten Kampf für die ethnische Verteidigung zu gebrauchen seien. Tatsächlich befinden sich hinter diesen Kämpfen aber die Interessen der Bourgeoisie. Man hat das nicht nur in Chiapas, sondern auch in Ex-Jugoslawien gesehen, wo die ethnischen Fragen von der Bourgeoisie manipuliert wurden, um einen formellen Vorwand für den Kampf der imperialistischen Mächte zu liefern.“ (16)
Die vitale Rolle der Arbeiterklasse in den zentralen Ländern des Kapitalismus
Das Proletariat ist mit einer sehr ernsthaften Verschlechterung der gesellschaftlichen Umwelt konfrontiert, in der es leben und kämpfen muss. Seine Fähigkeit, ein Vertrauen in sich selbst zu entwickeln, ist vom zunehmenden Gewicht der Hoffnungslosigkeit der nicht-ausbeutenden Schichten bedroht. Die bürgerlichen und kleinbürgerlichen Kräfte nutzen diese Situation für ihre eigenen Zwecke aus. Es wäre eine sehr schwerwiegende Vernachlässigung unserer Verantwortung, wenn wir diese Gefahr unterschätzen würden.
Nur durch die Entwicklung der Unabhängigkeit als Klasse und die Behauptung der Klassenidentität, durch die Stärkung des Vertrauens in die Fähigkeiten zur Verteidigung der eigenen Interessen wird das Proletariat zu einer Kraft werden, der es möglich ist, die anderen nicht-ausbeutenden Schichten der Gesellschaft hinter sich zu scharen.
Die Geschichte des Arbeiterkampfes in Lateinamerika zeigt, dass die Arbeiterklasse eine lange und reiche Erfahrung aufweist. Die Anstrengungen der argentinischen Arbeiter 2001 und 2002 zur Wiederaufnahme von unabhängigen Klassenkämpfen (beschrieben in den Zitaten vom NCI (17)) zeigen, dass die Kampfbereitschaft der Arbeiterklasse intakt ist. Sie trifft jedoch auf grosse Schwierigkeiten, die Ausdruck von bereits langanhaltenden Schwächen des Proletariats in der Peripherie des Kapitalismus und der enormen materiellen und ideologischen Kraft des Zerfallsprozesses in diesen Regionen sind. Es ist kein Zufall, wenn die bedeutendsten Ausdrücke der Klassenautonomie in Lateinamerika in den 60er- und 70er-Jahren liegen, mit anderen Worten: vor dem Prozess des Zerfalls und seiner negativen Auswirkungen auf die Klassenidentität des Proletariats. Eine solche Situation verstärkt nur die historische Verantwortung des Proletariats in den industriellen Konzentrationen im Herzen des Kapitalismus. Dort befinden sich die am weitesten vorangeschrittenen und die gegenüber den zersetzenden Auswirkungen des Zerfalls widerstandsfähigsten Teile der Arbeiterklasse. Das Signal zur Beendigung der fünfzigjährigen konterrevolutionären Phase Ende der 60er-Jahre war in Europa ertönt und das Echo hallte in Lateinamerika wider. Aus demselben Grunde wird die Rekonstituierung der Arbeiterklasse als historisches Gegengift zum kapitalistischen Verfall notwendigerweise von den konzentriertesten und politisch erfahrensten Bataillonen der Arbeiterklasse ausgehen, an erster Stelle von jenen in Westeuropa. Das bedeutet nicht, dass die Arbeiter Lateinamerikas keine vitale Rolle in der zukünftigen Generalisierung und Internationalisierung der Kämpfe spielen werden. Von allen Sektoren der Arbeiterklasse in der Peripherie des Systems sind sie gewiss die politisch am fortgeschrittensten. Das beweist die Existenz einer revolutionären Tradition in diesem Teil der Welt und auch das gegenwärtige Auftauchen von neuen Gruppen auf der Suche einer revolutionären Klarheit. Diese Minoritäten sind der Gipfel eines proletarischen Eisbergs, der die unsinkbare Titanic des Kapitals zum Sinken bringt.
Phil
Fußnoten:
1 s. Punkt 9 der Plattform der IKS.
2 Friedrich Engels/Karl Marx, Die heilige Familie, in: MEW, Bd. 2, S. 38.
3 s. Argentinien sechs Jahre nach Cordoba“, in: World Revolution, Nr. 1, 1975, S. 15f.
4 s. Der unaufhaltsame Fall von Allende, in: World Revolution Nr. 268.
5 s. Mexiko: Arbeiterkämpfe und revolutionäre Intervention, in: World Revolution, Nr. 124, Mai 1989.
6 Der schwierige Weg zur Vereinheitlichung des Klassenkampfes, in: World Revolution Nr. 124, Mai 1989.
7 nach Angaben der Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (ECLAC).
8 s. Kommuniqué an die gesamte Arbeiterklasse, in: Internacionalismo, Organ der IKS in Venezuela, zit. nach: World Revolution Nr. 124, Mai 1989.
9 s. Lektionen aus Argentinien: Positionsbezug des IBRP: Entweder die revolutionäre Partei und der Sozialismus oder die verallgemeinerte Armut und der Krieg, in: Internationalist Communist, Nr. 21, Herbst/Winter 2002.
10 s. Thesen über die kommunistischen Taktiken für die Peripherie des Kapitalismus, siehe: www.ibrp.org [11]. Die IKS kritisiert diese Thesen in: Der Kampf der Arbeiterklasse in den peripheren Ländern des Kapitalismus, in: Revue Internationale Nr. 100.
11 s. Volksaufstand in Argentinien: Nur auf dem Klassenterrain des Proletariats kann die Bourgeoisie zurückgedrängt werden, in: Internationale Revue, Nr. 30, November 2002.
12 s. Arbeiterkämpfe in Argentinien: Polemik mit der IKS“, in: Internationalist Communist, Nr. 21, Herbst/Winter 2002.
13 s. Zwei Jahre nach dem 19. und 20. Dezember, in: Revolucion Comunista, Nr. 2.
14 s. A propos Klassenkampf in Argentinien, in: Communismo, Nr. 49.
15 Die bolivianische Revolte, in: Revolucion Comunista, Nr. 1.
16 s. Einzig die proletarische Revolution kann die Indianer befreien, in: Revolucion Mundial, Nr. 64, September/Oktober 2001. Organ der IKS in Mexiko.
17 s. Révolution Internationale, Nr. 315, September 2001.
September 2005
- 737 reads
Hurrikan „Katrina“: Der Kapitalismus reißt die Menschheit in die Katastrophe
- 2664 reads
So wie beim Erdbeben im iranischen Bam vor zwei Jahren, das Zehntausende von Menschen tötete, oder beim Tsunami im Dezember, der Hunderttausende von Toten in der Region des Indischen Ozeans hinterließ, so hat auch in New Orleans, Mississippi und Alabama das kapitalistische System eine Naturkatastrophe in ein soziales Desaster verwandelt. So wie beim Erdbeben im iranischen Bam vor zwei Jahren, das Zehntausende von Menschen tötete, oder beim Tsunami im Dezember, der Hunderttausende von Toten in der Region des Indischen Ozeans hinterließ, so hat auch in New Orleans, Mississippi und Alabama das kapitalistische System eine Naturkatastrophe in ein soziales Desaster verwandelt.
Die albtraumartigen Szenen, die sich derzeit in den USA abspielen, machen dies deutlicher denn je. Hier handelt es sich nicht um etwas, was durch ein vages Gerede über die Unterentwicklung und globale Armut wegdiskutiert werden kann. Diese Katastrophe, deren Todes- und Zerstörungsrate noch nicht kalkuliert werden kann, ereignet sich in der reichsten, mächtigsten Nation der Welt. Sie beweist, dass die herrschende Gesellschaftsordnung trotz all ihrer technologischen und materiellen Ressourcen die Menschheit nur in den Ruin treiben kann.
Die Katastrophe, die vom Hurrikan „Katrina“ ausgelöst wurde, ist in jedem einzelnen ihrer Aspekte eine Anklage gegen Kapitalismus und Klassengesellschaft.
Zu den Ursachen der Katastrophe. Die Katastrophe, die nichts Geringeres als die City von New Orleans zerstört hat - eine einzigartige Erinnerung an all dem, was das Beste der amerikanischen Kultur ausmacht -, ist seit langer Zeit vorausgesagt worden. Eine Umweltstudie über die Zerstörung des Schwemmlandes rings um New Orleans, das Schutz bieten könnte gegen die riesigen Wassermassen, die die City von New Orleans umgeben, kam zu dem Schluss, dass die City schon durch einen ganz „normalen“ Hurrikan verwüstet werden könnte, ganz zu schweigen von einem Orkan der Stärke 5. Im Jahr 2003 änderte die US-Regierung ihre bisherige Politik, einen Nettoverlust von Schwemmland zu vermeiden, und öffnete die Tür für eine massive „Entwicklung“ und eine auf schnelles Geld ausgerichtete Bebauung von Schwemmland. Es wurde auch vor dem gefährlichen Zustand der Dämme gewarnt, die zum Schutz der Stadt errichtet worden waren. Auch darüber wurden Studien angefertigt, doch auch hier hatte der Staat andere Prioritäten. Die Times-Picayune berichtete am 2. September: „Jene zweite Studie sollte vier Jahre dauern und ungefähr 4 Mio. Dollar kosten, sagte Al Naomi, Projektleiter des Ingenieurskorps der Armee. Ungefähr 300.000 Dollar Bundesmittel waren für den Etat von 2005 avisiert, und der Staat hatte zugesagt, diesen Betrag aufzubringen. Doch seinem Vernehmen nach zwangen die Kosten des Irakkrieges die Bush-Administration, dem Distrikt von New Orleans anzuweisen, keine neue Studien zu beginnen, und auch der Etat von 2005 enthielt nicht mehr die benötigten Gelder.“
Gar nicht erst zu reden über das Thema der globalen Erwärmung: Es gibt wachsende Hinweise darauf, dass die Erwärmung der Weltmeere – das Produkt eines dem Kapitalismus innewohnenden Bedürfnisses nach einem ungehemmten Wirtschaftswachstum – die Ursache für die sich häufenden extremen Wetterlagen ist, die überall auf der Welt zu spüren sind. Doch die US-Regierung ist nicht einmal bereit, die Existenz dieses Problem zur Kenntnis zu nehmen, geschweige denn, Maßnahmen dagegen zu ergreifen.
Zum Fiasko der „Evakuierung“ vor dem Sturm. Es enthüllt einen völligen Mangel an Planung und ein totales Versagen, die ärmsten und prekärsten Teile der Bevölkerung zu versorgen. Alles, was die lokalen und nationalen Behörden angesichts des kommenden Sturms taten, war, die Menschen aufzufordern, aus New Orleans und Umgebung zu fliehen. Nicht ein Gedanke wurde daran verschwendet, wie die Armen, die kein Auto und nicht genug Geld für Zug- oder Bustickets besaßen, wegkommen sollten. Noch vielsagender war die Aufgabe ganzer Krankenhäuser und Altenheime. Der Anblick von älteren Patienten, die unter offenem Himmel zurückgelassen wurden, und jener, die verzweifelt versuchten, ihnen zu helfen, gehört zu den erschütternsten Bildern dieser Katastrophe. Dies ist der Preis dafür, alt und arm zu sein im 21. Jahrhundert.
Zur Farce der „Hilfsaktion“ nach dem Sturm. Tagelang waren jene, die zurückgelassen wurden, höllischen Bedingungen auf den Straßen, in den Ruinen und im Superdome, wo sie Schutz suchen sollten, ausgesetzt. Es fehlte an Nahrungsmitteln, Trinkwasser, Schutz vor der drückenden Schwüle und an den einfachsten Sanitäreinrichtungen, während die mächtigen US-Behörden unfähig schienen, sie über Land oder über See zu erreichen. Die Administration selbst erklärte diese Verzögerungen als „inakzeptabel“, bot aber bisher keine weitergehende Erklärung an. Und einmal mehr bestimmte die Klassenzugehörigkeit die Überlebenschancen, wie am Gegensatz zwischen den Bedingungen, denen die Superdome-Flüchtlinge ausgesetzt waren, und den Umständen einer privilegierten Gruppe von Gästen des Hyatt-Hotels deutlich wird: „Gordon Russell von der Times-Picayune wies treffend darauf hin, dass diese höllischen Bedingungen ‚in starkem Kontrast standen zu jenen von Leuten im nahe gelegenen, Zugangsbeschränkten Centre- und Hyatt-Hotel aus New Orleans’. Eine Reihe von Staatspolizisten, mit Gewehren in Anschlag, fuhr die Menge von Zuflucht suchenden Flüchtlingen vom Hoteleingang zu den Einrichtungen.“ Später stellte dieselbe Polizei sicher, dass diesen VIPs Vorrang vor den anderen Überlebenden gewährt wurde, als die Evakuierung begann; und es stellte sich heraus, dass die meisten von ihnen Funktionäre des Bürgermeisters, Ray Nagin, waren.
Als aber die Evakuierung des Superdomes begann, gab es keinerlei Anzeichen von Großzügigkeit. Laut der World Socialist Website stieg, „während Bush seine Runde machte, (…) die Todesrate in New Orleans weiterhin rapide an. Nach der Ankunft eines riesigen, von der Nationalgarde eskortierten Konvois von Lastwagen, beladen mit Nahrungsmitteln und Trinkwasser, und Hunderten von Bussen, begann die Massenevakuierung aus dem Louisiana-Superdome, dem größten Notlager für die obdachlosen Menschen. Doch die Busse setzten viele Flüchtlinge nur einige Meilen entfernt, an einer Kreuzung von Zufahrten zur Interstate 10, aus, wo Tausende von obdachlosen Flüchtlingen der brütenden Sonne ausgesetzt waren. Von mindestens einem halben Dutzend Toten unter den sich selbst überlassenen Flüchtlingen wurde berichtet.“ (3.9.2005)
Zu den künftigen ökonomischen und ökologischen Konsequenzen dieser Katastrophe: Schon ist viel von der Aufgabe des „Wiederaufbaus“ dieser Region – ein Gebiet, größer als Großbritannien und mit einigen der ärmsten Landstriche in den USA – die Rede, doch die USA ist bereits vor dem Sturm unaufhaltsam in die offene Wirtschaftskrise geschlittert, und die Katastrophe wird diese - alles deutet darauf hin – noch verschlimmern. Dies hat sich bereits in dem abrupten Anstieg des Ölpreises gezeigt, der aus den enormen Engpässen in der Versorgung resultiert. Der Sturm hat ein Loch in die Erdöl-Infrastruktur gerissen: Totalverluste von 30 Ölplattformen, weitere 20 aus ihren Verankerungen gerissen und stillgelegte Raffinerien. Dies hinderte die Erdölkonzerne nicht daran, eine schnelle Mark zu machen – ihre Börsennotierungen stiegen unmittelbar nach dem Sturm. Doch die langfristigen Auswirkungen dieses Anstiegs des Ölpreises bereiten den Wirtschaftsexperten der Bourgeoisie bereits erhebliche Sorgen.
Der Hurrikan beschwört noch weitere ökonomische Kalamitäten herauf: Die Küstenregion war bereits vor dem Sturm wegen der Konzentration von Raffinerien und Chemiefabriken als mit dem Krebs „im Bunde“ bekannt. Nun sind diese durch den Sturm übel zugerichtet worden, und ganze Gebiete von New Orleans drohen dadurch unbewohnbar zu werden. Kommentatoren sprechen von einem „Hexengebräu“ von toxischem Müll, der von den Wasserfluten davongetragen wurde und für die gestrandeten Überlebenden zu einem schnell wachsenden Krankheitsherd wird.
Zur Abzweigung von gesellschaftlichen Ressourcen für den Krieg: Eine Frage, die die Opfer immer wieder stellten: Wie kann es sein, dass die USA zwar eine Armee mobilisieren können, um in ein Tausende von Kilometern entferntes Land einzumarschieren, aber nicht im Stande sind, andere Amerikaner zu retten? Die grausame Priorität, die dem Krieg gegenüber dem Schutz von menschlichem Leben eingeräumt wird, fand ihren Ausdruck in der Tatsache, dass Gelder aus dem Etat für die Verbesserung von Schutzeinrichtungen für New Orleans abgezogen wurden, um das Irak-Abenteuer zu finanzieren; auch große Mengen an Ausrüstung und Manpower der Nationalgarde wurden für den Irak abgeschöpft, was teilweise als Erklärung für die Langsamkeit der Rettungsbemühungen herhalten muss.
Zur Tatsache, dass Privateigentum vor Menschenleben gesetzt wird: Und wie viele Truppen, die vom Irak-Krieg verschont blieben, wurden nach New Orleans geschickt, um „Recht und Ordnung“ wiederherzustellen, statt den Bedürftigen Hilfe zu bringen? Natürlich erschienen die Repressionsorgane noch vor den Helfern. Sie wurden von einer riesigen Medienkampagne über Plünderungen, Schießereien und Vergewaltigungen begleitet. Kein Zweifel, kriminelle Banden versuchten, Nutzen aus dieser Situation zu schlagen; kein Zweifel, die Verzweiflung trieb manchen zu irrationalen und zerstörerischen Handlungen. Doch der Zynismus der herrschenden Klasse erreichte neue Höhen, als sie systematisch eine Medienkampagne in Gang setzte, um die Aufmerksamkeit vom Versagen des Staates auf allen Ebenen auf jene Menschen zu lenken, die verzweifelt versuchten, in den Ruinen von New Orleans zu überleben. Plötzlich wurden die Opfer für ihr eigenes Leid verantwortlich gemacht, und statt Hilfe zu schicken, nahm dies die herrschende Klasse zum Vorwand, New Orleans dichtzumachen, die Rettungsbemühungen einzustellen und statt Trinkwasser und Lebensmittel Waffen, bewaffnete Fahrzeuge und Truppen zu schicken.
Damit über eins Klarheit besteht: Die Mehrheit der „Plünderer“ waren gewöhnliche Menschen, die vom Verhungern und von der schlimmsten Not bedroht waren und die sich aus den verwaisten Geschäften nahmen, was sie konnten; in vielen Fällen verteilten sie uneigennützig die Waren, die sie gefunden hatten. Web-Tagebücher, die aus erster Hand informiert waren, erzählten von zahllosen Akten der elementaren menschlichen Solidarität von Menschen, die selbst alles verloren hatten, gegenüber Mitmenschen, die sich aufgrund ihres Alters, von Verletzungen oder Krankheit in einer noch schlechteren Lage befanden. Und auch wenn die Katastrophe allgemeines Chaos bewirkte, so gab es dennoch auch Bemühungen von Menschen, auf der Stelle provisorische Hilfe zu leisten. So gab es im Fernsehen Bilder von „Plünderern“, die Nahrungsmittel ausgaben. Eine Gruppe von Ärzten einer HIV-Konferenz organisierte eine Klinik in einem der betroffenen Gebiete. In den Krankenhäusern arbeiteten die Angestellten weiter, um trotz fürchterlicher Umstände ein Mindestmaß an Pflege aufrechtzuerhalten. Wir sehen also, dass die Arbeiterklasse und die Besitzlosen die Solidarität gegenüber den Leidenden über die eigene Sicherheit stellten, während die herrschende Klasse nichts als plumpe Schaunummern und Repression anbieten konnte.
Das Problem ist nicht Bush
Ströme von Spott haben sich sowohl innerhalb wie außerhalb Amerikas über Bush und seine Kumpane wegen der unpassenden Reden, leeren Gesten und der zeitlupenartigen Reaktion auf die Katastrophe ergossen. Und sicherlich fügt sich die neue Krise in das Elend einer Administration ein, die bereits zuvor in wachsendem Maße unpopulär geworden ist. Doch der „Anti-Bushismus“ ist äußerst vereinfachend und kann leicht von anderen bürgerlichen Parteien in den USA und von den imperialistischen Rivalen Amerikas vereinnahmt werden. Dabei spiegeln die Exzesse der gegenwärtigen Bande im Weißen Haus – ihre Inkompetenz, Korrumpierung, Irrationalität und Abgestumpftheit – nur die ihnen zugrunde liegende Realität des US-Kapitalismus wider: eine zerfallende Supermacht, die die Aufsicht über eine „Weltordnung“ führt, welche im Chaos versinkt. Und diese Situation reflektiert ihrerseits den im Endstadium befindlichen Niedergang des Kapitalismus als Gesellschaftssystem, das den ganzen Planeten beherrscht. Wir leben in einer Produktionsweise, deren Weiterbestehen das Überleben der menschlichen Spezies bedroht. So sehr er auch Bush oder Amerika kritisiert, der Rest der herrschenden Klasse hat keine Alternative zum blinden Marsch in die Zerstörung durch Krieg, Hungersnot und ökologische Katastrophen. Die Hoffnung für die Menschheit verbirgt sich nicht in irgendeiner Fraktion der ausbeutenden Klasse, sondern wird von jenen verkörpert, die stets die ersten Opfer der Kriege und Katastrophen des Systems sind: die ausgebeutete Klasse, das Proletariat. Unsere Solidarität, unsere Empörung, unser kollektiver Widerstand, unsere Bemühungen, den wirklichen Charakter des gegenwärtigen Systems zu begreifen – dies ist die Saat für eine Gesellschaft, in der Arbeit, Wissenschaft und menschliche Kreativität nicht mehr im Dienst von Krieg und Profit stehen, sondern dem Leben und seiner Verbesserung dienen. World Revolution, 3.9.05
Geographisch:
- Vereinigte Staaten [23]
Theoretische Fragen:
- Umwelt [24]
Wie das Proletariat sich organisiert, um den Kapitalismus zu stürzen
- 1754 reads
In den vorherigen Artikeln dieser Serie haben wir gesehen:
- warum der Kommunismus heute nicht nur für das Gedeihen der Menschheit, sondern auch für ihr nacktes Überleben notwendig ist;
- warum er zum ersten Mal in der Geschichte nicht mehr nur ein schöner Traum, sondern – aufgrund der Tatsache, dass die Menschheit heute die materiellen Bedingungen besitzt, um diesen riesigen Schritt nach vorn zu machen –eine reelle Möglichkeit ist;
-- warum der Mensch wirklich fähig ist, solch eine Gesellschaft in Gang zu setzen und in ihr zu leben;
-- warum es trotz der Entfremdung, die auf dem Bewusstsein des Menschen lastet, eine Klasse in der Gesellschaft gibt - das Proletariat - die in der Lage ist, ihren Kampf gegen die Ausbeutung und Unterdrückung in einen Kampf für die Etablierung einer neuen Ordnung zu verwandeln, der Ausbeutung, Unterdrückung und alle Klassenteilungen abschafft.
In diesem Artikel setzen wir unsere Untersuchung der Perspektiven des Kommunismus fort und betrachten, wie das Proletariat sich selbst organisieren kann, um die Revolution durchzuführen.
Lange Zeit haben die Revolutionäre gemeinsam mit dem Proletariat in seiner Gesamtheit nach einer Antwort auf die Frage gesucht, wie sich die Arbeiter selbst organisieren können, um die Revolution durchzuführen. Zunächst wurden (von Babeuf bis Blanqui) kleine konspirative Sekten bevorzugt. Danach schienen unterschiedliche Arbeitergesellschaften wie Gewerkschaften und Kooperativen oder jene in der Internationalen Arbeiterassoziation (die Erste Internationale, 1864 gegründet) versammelten Gruppierungen diese Selbstorganisation der Arbeiterklasse mit dem Ziel ihrer Emanzipation zu repräsentieren. Anschließend stellten sich die großen Massenparteien, die in der Zweiten Internationalen (1889 – 1914) versammelt waren, und die ihnen angeschlossenen Gewerkschaften als Hebel der gesellschaftlichen Umwandlung dar. Doch die Geschichte zeigte, dass, auch wenn diese Organisationsformen die Arbeiterklasse in bestimmten Entwicklungsstufen in die Lage versetzten, gegen die Ausbeutung zu kämpfen und sich über die Ziele dieses Kampfes bewusst zu werden, keine von ihnen dazu geeignet war, ihre historische Aufgabe tatsächlich zu vervollständigen: die Zerstörung des Kapitalismus und die Etablierung des Kommunismus. Erst als die historischen Bedingungen des Kapitalismus selbst die proletarische Revolution auf die Tagesordnung setzten, fand die Arbeiterklasse die geeignete Organisationsform, um diese Mission auszuführen: die Arbeiterräte. Ihr Erscheinen in Russland 1905 bedeutete einen Wendepunkt in der Geschichte der kapitalistischen Gesellschaft, das Ende ihrer progressiven Epoche, ihren Eintritt in die Dekadenz, in die “Ära der imperialistischen Kriege und proletarischen Revolutionen”, wie die Revolutionäre nach und nach begriffen. Auch wenn seit Blanqui die Revolutionäre bereits die Notwendigkeit der Errichtung der Diktatur des Proletariats als einen Hebel zur gesellschaftlichen Umwandlung kannten, konnte die konkrete Form dieser Diktatur erst mit der Erfahrung der Klasse selbst und noch dazu mit Verspätung deutlich werden. In die Fußstapfen der alten Konzepte von Marx und Engels tretend, schrieb Trotzki noch 1906, fünfundzwanzig Jahre nach 1871: “Der internationale Sozialismus meint, dass die Republik die einzig mögliche Form für die sozialistische Befreiung ist, vorausgesetzt, dass das Proletariat sie aus den Händen der Bourgeoisie reißt und umwandelt’ von einer Maschine zur Unterdrückung einer Klasse durch eine andere’, damit sie zu einer Waffe für die sozialistische Emanzipation der Menschheit wird”.
Die Arbeiterräte: die Diktatur des Proletariats in Gestalt
So wurde lange Zeit eine “wahrhaft demokratische Republik”, in der die proletarische Partei eine führende Rolle spielen sollte, als Gestalt und Form der Diktatur des Proletariats betrachtet. Erst mit der Revolution von 1917 begriffen die Revolutionäre und insbesondere Lenin wirklich, dass die “endlich gefundene Form” der Diktatur des Proletariats nichts anderes als die Macht der Arbeiterräte war, jenen Organen, die im Verlauf der revolutionären Kämpfe in Petrograd 1905 spontan entstanden waren und die sich auszeichneten durch:
-ihr Zustandekommen auf der Grundlage allgemeiner Versammlungen
-die Wahl und jederzeitige Abwählbarkeit der Delegierten
-die Einheit zwischen Beschlussfassung und –ausführung (Abschaffung der Trennung zwischen Legislative und Exekutive);
-die Umgruppierung und Zentralisierung nicht auf der Basis der Industrie oder Gewerkschaft, sondern im territorialen Rahmen (so sollen sich die Arbeiter nicht nach Berufszweigen sammeln, sondern mit allen anderen Arbeitern der Fabrik, der Stadt, der Region etc., um die Delegierten des Arbeiterrats dieses Gebietes zu wählen).Diese besondere Form der Organisation der Arbeiterklasse ist direkt den Aufgaben angepasst, die das Proletariat in der Revolution erwarten.Denn sie ist an erster Stelle eine allgemeine Organisation der Klasse, die alle Arbeiter in sich sammelt. Alle früheren Formen, einschließlich der Gewerkschaften, gruppierten nur einen Teil der Klasse um sich. Zwar reichte dies für die Arbeiterklasse, um zur Verteidigung ihrer Interessen innerhalb des Systems Druck auf den Kapitalismus auszuüben, doch erst durch ihre Selbstorganisation in toto ist die Klasse im Stande, die Zerstörung des Kapitalismus einzuleiten und den Kommunismus zu etablieren. Als die Bourgeoisie ihre Revolution machte, reichte es aus, dass lediglich ein Teil dieser Klasse die Macht übernahm. Deshalb bildete sie einen kleinen Teil der Bevölkerung, deshalb war sie eine ausbeutende Klasse und deshalb konnte sich nur eine Minderheit der Bourgeoisie über die Interessenskonflikte erheben, die aus den wirtschaftlichen Rivalitäten zwischen den vielfältigen Bereichen herrührten. Innerhalb der Arbeiterklasse herrschen solche Rivalitäten nicht. Da die Gesellschaft, die etabliert werden soll, alle Ausbeutung und alle Klassenteilungen abschafft, ist die Bewegung, die dahin führt, “Die proletarische Bewegung ist die selbständige Bewegung der ungeheuren Mehrzahl im Interesse der ungeheuren Mehrzahl”(Kommunistisches Manifest) Daher ist nur die Selbstorganisation der Klasse in ihrer Gesamtheit geeignet, diese historische Aufgabe zu erfüllen.
An zweiter Stelle drücken Wahl und sofortige Abwählbarkeit der Amtsträger den eminent dynamischen Charakter des revolutionären Prozesses aus – die unaufhörliche Umwälzung der gesellschaftlichen Bedingungen und die konstante Entwicklung des Klassenbewusstseins. So sind jene, die für diese oder jene Aufgabe oder aufgrund der Tatsache nominiert werden, dass ihr Maß an Verständnis einem bestimmten Bewusstseinsniveau entspricht, nicht immer notwendigerweise auf der Höhe der Zeit, wenn neue Aufgaben auftauchen oder das Bewusstseinsniveau steigt.
Wahl und Abwählbarkeit von Delegierten drücken gleichermaßen die Negation aller definitiven Spezialisierungen durch die Klasse aus, aller Teilungen zwischen den Massen und den “Führern”. Die wesentliche Aufgabe Letzterer (die meist entwickelten Elemente der Klasse) ist es tatsächlich, alles zu tun, um die Bedingungen zu eliminieren, die ihr Auftreten veranlassen: die Heterogenität des Bewusstseins innerhalb der Klasse.
Wenn in den Gewerkschaften ständige Funktionäre existieren konnten, auch als Erstere noch Organe der Arbeiterklasse waren, so war dies der Tatsache geschuldet, dass die Verteidigungsorgane der Arbeiterinteressen innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft gewisse Charakteristiken der Gesellschaft in sich trugen. Gleichermaßen reproduzierte das Proletariat, wenn es spezifisch bürgerliche Instrumente wie das allgemeine Wahlrecht und das Parlament benutzte, gewisse Züge seines bürgerlichen Feindes. Die statische gewerkschaftliche Organisationsform drückte die Kampfmethode der Arbeiterklasse aus, als die Revolution noch nicht möglich war. Die dynamische Form der Arbeiterräte ist das Ebenbild der Aufgabe, die letztlich zur ersten Pflicht wird: die kommunistische Revolution.
Gleichermaßen drückt die Einheit zwischen Entscheidung und Ausführung die gleiche Negation aller institutionalisierten Spezialisierungen durch die revolutionäre Klasse aus. Sie zeigt, dass die gesamte Klasse nicht nur die wesentlichen Beschlüsse fasst, die sie betreffen, sondern auch an der praktischen Umwandlung der Gesellschaft teilnimmt.
An dritter Stelle drückt eine Organisation auf territorialer (und nicht gewerkschaftlicher oder industrieller) Grundlage die unterschiedliche Natur der proletarischen Aufgaben aus. Als es allein darum ging, Druck auf eine Arbeitgebervereinigung auszuüben, um Lohnerhöhungen oder Verbesserungen der Arbeitsbedingungen durchzusetzen, machten gewerkschaftliche oder branchenmäßige Organisationen noch Sinn. Selbst eine Organisation, die so archaisch war wie die Berufsgewerkschaft, wurde von den Arbeitern wirksam gegen die Ausbeutung benutzt; sie hinderte die Bosse insbesondere daran, andere Arbeiter einzustellen, wenn es einen Streik gab. Die Solidarität der Drucker, Zigarrenmacher oder (Bronzegießer war das Embryo der realen Klassensolidarität, eine Stufe in der Vereinigung der Arbeiterklasse. Selbst unter dem Gewicht der kapitalistischen Unterschiede und Spaltungen war die Gewerkschaftsorganisation ein wirkungsvolles Mittel des Kampfes innerhalb des Systems. Andererseits: wenn es darum geht, sich nicht nur gegen diesen oder jenen Sektor des Kapitalismus zu erheben, sondern Letztgenannten in seiner Totalität zu konfrontieren, ihn zu zerstören und eine andere Gesellschaft zu errichten, kann die spezifische Organisation der Drucker oder der Gummiindustriearbeiter keinen Sinn machen. Um die Leitung der gesamten Gesellschaft zu übernehmen, muss sich die Arbeiterklasse auf territorialer Basis organisieren, auch wenn die Basisversammlungen auf der Ebene der Fabrik, des Büros, des Krankenhauses oder des Industriegebiets abgehalten werden.
Eine solche Tendenz ist heute bereits in den Tageskämpfen gegen die Ausbeutung zu erkennen. Hier gibt es eine tiefe Neigung, aus der Gewerkschaftsform auszubrechen und sich in souveränen allgemeinen Versammlungen zu organisieren, gewählte und jederzeit abwählbare Streikkomitees zu formen, um sich der berufsmäßigen oder industriellen Grenzen zu entledigen und sich auf territorialer Ebene auszuweiten.
Diese Tendenz drückt die Tatsache aus, dass der Kapitalismus in seiner Dekadenzperiode eine immer statischere Form annimmt. Unter diesen Umständen erweist sich die alte Unterscheidung zwischen den politischen Kämpfen (die in der Vergangenheit das Privileg der Arbeiterparteien waren) und den ökonomischen Kämpfen (für die die Gewerkschaften verantwortlich waren) als immer weniger sinnvoll. Jeder ernsthafte ökonomische Streik wird politisch und konfrontiert den Staat, entweder seine Polizei oder seine Repräsentanten in der Fabrik – die Gewerkschaften. Dies weist auch auf die tiefe Bedeutung der gegenwärtigen Kämpfe als Vorbereitung auf die entscheidenden Konfrontationen der revolutionären Periode hin. Selbst wenn es ökonomische Faktoren (Krise, unerträgliche Verschärfung der Ausbeutung) sind, die die Arbeiter in diese Konfrontationen schleudern, sind die Aufgaben, die sich ihnen später stellen, eminent politisch: frontale und bewaffnete Angriffe gegen den bürgerlichen Staat, die Etablierung der proletarischen Diktatur.
Die proletarische Revolution: politische Macht als Grundlage für die gesellschaftliche Umwandlung
Diese Einheit zwischen Politik und Ökonomie, die ihren Ausdruck in der Organisierung des Proletariats in den Arbeiterräten findet, erfordert eine Erklärung. Welcher der beiden Gesichtspunkte ist vorrangig?
Seit Babeuf haben die Kommunisten erkannt, dass in der proletarischen Revolution der politische Gesichtspunkt zuerst kommt und die Ökonomie bedingt. Dies ist ein Schema, das völlig jenem widerspricht, das in der bürgerlichen Revolution vorherrschte. Die kapitalistische Ökonomie entwickelte sich innerhalb der feudalen Gesellschaft, sozusagen in ihren Rissen. Die neue revolutionäre Klasse, die Bourgeoisie, konnte also die Wirtschaftsmacht in der Gesellschaft erobern, während die politischen und administrativen Strukturen noch immer mit dem Feudalismus verknüpft waren (Absolutismus, wirtschaftliche und politische Privilegien für den Adel etc.). Erst als die kapitalistische Produktionsweise dominierend wurde, erst als sie die Gesamtheit des Wirtschaftslebens bestimmte (einschließlich jener Bereiche, die nicht direkt kapitalistisch waren, wie die landwirtschaftliche und handwerkliche Kleinproduktion), richtete die Bourgeoisie ihre Angriffe gegen die politische Macht des Feudalismus. Dies befähigte sie umgekehrt, die politische Macht ihren besonderen Bedürfnissen anzupassen und das Fundament für eine neue wirtschaftliche Expansion zu legen. Dies war es, was sie tat, besonders in der Englischen Revolution in den 1640er Jahren und in der Französischen Revolution 1789. In diesem Sinn vervollständigte die bürgerliche Revolution eine ganze Periode des Übergangs, in deren Verlauf die Bourgeoisie sich innerhalb der feudalistischen Gesellschaft entwickelte, bis sie an den Punkt gelangte, Letztere auf der Basis einer neuen wirtschaftlichen Organisation der Gesellschaft zu verdrängen. Das Schema der proletarischen Revolution ist völlig anders. In der kapitalistischen Gesellschaft besitzt die Arbeiterklasse keinerlei Eigentum, kein etabliertes materielles Sprungbrett für ihre zukünftige Dominierung der Gesellschaft. Alle Versuche, die von Utopisten oder Proudhonisten angeregt worden waren, waren gescheitert: Das Proletariat kann keine “Inseln” des Kommunismus innerhalb der gegenwärtigen Gesellschaft schaffen. Alle Arbeiterkommunen oder Kooperativen wurden entweder zerstört oder vom Kapitalismus einverleibt. Im Gegensatz zu den Utopisten, Proudhon und den Anarchisten begriffen Babeuf, Blanqui und Marx dies. Das Ergreifen der politischen Macht durch das Proletariat ist der Ausgangspunkt seiner Revolution, der Hebel, mit dem es Zug um Zug das Wirtschaftsleben der Gesellschaft umwandeln wird, mit der Perspektive der Abschaffung aller Ökonomie. “Die Revolution überhaupt - der Umsturz der bestehenden Gewalt und die Auflösung der alten Verhältnisse - ist ein politischer Akt. Ohne Revolution kann sich aber der Sozialismus nicht ausführen. Er bedarf dieses politischen Aktes, soweit er Zerstörung und der Auflösung bedarf. Wo aber seine organisierende Tätigkeit beginnt, wo sein Selbstzweck, seine Seele hervortritt, da schleudert der Sozialismus die politische Hülle weg. (Marx, Kritische Randglossen, 31.7.1844)
Da der Kapitalismus seine ökonomische Basis bereits vor der bürgerlichen Revolution geschaffen hatte, war Letztere im Wesentlichen politisch. Die Revolution des Proletariats beginnt im Gegensatz dazu mit einem politischen Akt, der die Entwicklung nicht nur der ökonomischen Aspekte, sondern auch und vor allem ihrer gesellschaftlichen Aspekte bedingt.
Somit sind die Arbeiterräte keineswegs Organe des “Selbstmanagements”, Organe für das Management der kapitalistischen Wirtschaft (d.h. des Elends). Sie sind politische Organe, deren vorrangige Aufgabe es ist, den kapitalistischen Staat zu zerstören und die proletarische Diktatur auf Weltebene zu errichten. Doch sie sind auch Organe für die ökonomische und soziale Umwandlung der Gesellschaft, und dieser Aspekt macht sich von Anbeginn des revolutionären Prozesses bemerkbar (Enteignung der Bourgeoisie, Organisierung einer ausreichenden Versorgung der Bevölkerung etc.). Mit der politischen Niederlage der Bourgeoisie kommt die ökonomische und soziale Dimension immer mehr zur Geltung.
(aus: Revolution International, Nr. 64)
Oktober 2005
- 847 reads
Anton Pannekoek – Denker der Revolution
- 1481 reads
Buchbesprechung zu Cajo Brendels "Anton Pannekoek – Denker der Revolution"
In letzter Zeit haben uns mehrere Sympathisanten angesprochen, um unsere Meinung zu Cajo Brendels Buch über Anton Pannekoek zu erfahren. Die deutsche Ausgabe dieses vor ca. 30 Jahren auf niederländisch geschriebenen Buches von Brendel ist 2001 im ¸a ira Verlag erschienen. Die Genossen, die uns darauf ansprachen, haben das Buch durchweg begrüßt und gelobt. Zum einen waren sie erfreut darüber, weil dadurch Pannekoeks Beitrag zum Marxismus einem breiteren deutschsprachigen Publikum wieder bekannt gemacht wird. Zum anderen waren sie daran interessiert, durch dieses Buch die Gedankenwelt Cajo Brendels näher kennenzulernen. Brendel gilt als der letzte Vertreter des sog. Rätekommunismus der Nachkriegsjahre in den Niederlanden. Diese politische Strömung, welche sich vornehmlich durch die Ablehnung einer spezifischen politischen Organisation der Revolutionäre auszeichnet, beruft sich gern auf Pannekoek als eine Art theoretischer Ziehvater.
Eine nützliche Einführung in das Werk Pannekoeks
Auch wir begrüßen das Erscheinen dieses Buches. Denn es bietet eine wertvolle Anregung, sich mit dem Lebenswerk eines der größten marxistischen Theoretiker des 20. Jahrhunderts zu befassen. Zwar gab es vor und nach dem 1. Weltkrieg eine besonders enge Zusammenarbeit und gegenseitige Beeinflussung der Revolutionäre in Deutschland und den Niederlanden. Pannekoek selbst lebte und wirkte einige Jahre lang in Deutschland. Er verfasste einige seiner wichtigsten Schriften ursprünglich auf Deutsch. Auch die meisten seiner anderen wichtigeren Schriften, mit Ausnahme seines Buches über die Arbeiterräte, sind ins Deutsche übersetzt worden. Doch die meisten dieser Ausgaben (von denen mehrere unter der Mitarbeit von Cajo Brendel erschienen) sind längst vergriffen und leider auch in Vergessenheit geraten. Brendels jetzt erschienenes Buch enthält eine nützliche Bibliographie der Bücher, Broschüren und Artikel Pannekoeks, von denen ein Teil durch öffentliche Bibliotheken angefordert oder auch im Internet abgerufen werden kann. Darüber hinaus fasst Brendel auch einige der Hauptideen in den Schriften Pannekoeks zusammen, welche dem Leser sonst unzugänglich geblieben wären, die des Holländischen nicht mächtig sind. So sind etwa die Kapitel Brendels "Betrachtungen über die Entstehung des Menschen und der Einfluß Josef Dietzgens", "Der Beitrag Pannekoeks zur Imperialismusdebatte" oder seine Beiträge zum Verständnis der Gewerkschaftsfrage unbedingt lesenswert. Auch die Ausführungen über die von Pannekoek angewandte wissenschaftliche Methode enthalten viel Wertvolles.
Pannekoek: Produkt und Vorkämpfer der organisierten Arbeiterbewegung
Keine Frage: Brendel kennt die Schriften sowie den Werdegang Pannekoeks wie kaum ein zweiter. Außerdem arbeitet er sehr gewissenhaft mit den vorhandenen Quellen. Und dennoch liefert Brendel teilweise ein sehr verzerrtes Bild des jahrzehntelangen Wirkens Anton Pannekoeks in der organisierten Arbeiterbewegung. Dies hängt mit der ahistorischen, unmarxistischen Sichtweise des "Rätekommunismus" zusammen. Die Folge: Pannekoek bleibt als Vorkämpfer der marxistischen Linken in einer Zeit des historischen Umbruchs im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts außen vor. Pannekoek als Produkt der organisierten Arbeiterbewegung wird überhaupt nicht sichtbar. Statt dessen präsentiert uns Brendel einen Pannekoek, der angeblich jahrelang Mitarbeiter einer bürgerlichen Reformbewegung war. Schon im zweiten Absatz der Einleitung zu seinem Buch (S. 9) behauptet Brendel, dass die Sozialdemokratie, welcher sich Pannekoek Ende des 19. Jahrhunderts anschloss, von Anfang an kein Ausdruck der Arbeiterklasse war. "In Wahrheit aber war sie doch nur der radikalste Flügel der sich konsolidierenden Bourgeoisie", behauptet Brendel. Er erweckt den Eindruck, als ob Pannekoek schon immer der einsame, nicht organisiert arbeitende Theoretiker gewesen sei, der er gegen Ende seines Lebens unter dem Eindruck der historischen Niederlage der Arbeiterbewegung tatsächlich wurde. Er zeichnet ein Bild des großen Theoretikers, das ihn als isoliertes Individuum darstellt, welches allein, im stillen Kämmerlein, seinen Beitrag zum Marxismus geleistet hätte. Und zwar so gut, dass seine angebliche Mitarbeit in einer bürgerlichen Organisation diesem Beitrag offensichtlich nichts anhaben konnte. Es entsteht der Eindruck, als ob Pannekoek mit seiner theoretischen Weiterentwicklung sich immer mehr aus der organisierten Arbeiterbewegung zurückgezogen habe, als ob er erkannt habe, dass sie per se bürgerlich und die theoretische Arbeit das Werk von Einzelnen ist. Dies scheint offenbar die Meinung Brendels zu sein. Die Auffassung Pannekoeks war es jedenfalls nicht. In seinen in Amsterdam während der deutschen Besatzungszeit bei Kerzenschein niedergeschriebenen Erinnerungen ("Herinneringen uit de arbeidersbeweging") schildert er sein Mitwirken an der damaligen Arbeiterbewegung keineswegs als eine Irrfahrt ins Klassenlager der Bourgeoisie. Vielmehr vertrat er die Ansicht, welche er bereits im Verlauf des 1. Weltkriegs - angesichts des Überlaufens der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften auf die Seite des Kapitals - dargelegt hat, dass die Massenorganisationen aus der Zeit der II. Internationale zunächst durchaus den Bedürfnissen eines bestimmten Zeitabschnitts des Arbeiterkampfes entsprachen. Die naive, ahistorische Annahme des späteren "Rätismus", die Kapitulation von Arbeiterorganisationen vor den Interessen des Kapitals sei Beweis genug dafür, dass diese Organisationen "schon immer" bürgerlich gewesen seien, teilte Pannekoek nicht. Kein Wunder, denn gerade Pannekoek lieferte eine der ersten und fundiertesten marxistischen Analysen des Opportunismus: das Phänomen der Anpassung proletarischer Organisationen an die Ideologie und an die Realität der bürgerlichen Gesellschaft, welche ihren späteren Verrat vorbereitet. In "Die taktischen Differenzen in der Arbeiterbewegung" (1), einem Standardwerk zu diesem Thema, führt Pannekoek den Opportunismus auf die Auflösung der dialektischen Einheit zwischen dem Endziel und der Bewegung der Arbeiterklasse zurück. Dabei zeigt er die fundamentalen Gemeinsamkeiten zwischen dem offen reformistischen und dem anarchistischen Opportunismus innerhalb der damaligen Arbeiterbewegung auf. Beide wollen den Klassenkampf ohne die wissenschaftliche Waffe des Marxismus führen. Beide verherrlichen die individuelle Freiheit und fühlen sich abgestoßen durch das kollektive Wesen des Arbeiterkampfes. Beide bringen die Ungeduld und die schwankende Haltung des Kleinbürgertums zum Ausdruck. Somit hat Pannekoek bereits 1909 die tieferen Wurzeln des späteren Verrats sowohl der Sozialdemokratie im 1. Weltkrieg als auch der CNT im Spanischen Bürgerkrieg aufgedeckt. Der spätere Rätekommunismus hingegen hat zwar die gesamte Sozialdemokratie vor 1914 (und damit auch ihren linken revolutionären Flügel) in Bausch und Bogen verurteilt, andererseits aber den Anarchismus als legitimen, wenn auch theoretisch schwachen Ausdruck des revolutionären Proletariats angesehen. Das kommt daher, dass dieser Rätismus vom Schlage eines Cajo Brendels selbst eine Spielart des Opportunismus innerhalb der Arbeiterbewegung darstellt - und zwar eine Art "Zentrismus", d.h. eine schwankende Haltung zwischen Marxismus und Anarchismus.
Weit entfernt davon, abgeschieden von der Arbeiterbewegung seine Weltsicht auszuarbeiten, bildete sich der große Theoretiker Pannekoek in und durch die politischen Kämpfe der Arbeiterklasse heraus. Neben Rosa Luxemburg war er der leidenschaftlichste und tiefsinnigste Vertreter der Position der revolutionären Linken in der sog. Massenstreikdebatte, gegen das "Zentrum" um Kautsky, innerhalb der deutschen Arbeiterpartei. Zusammen mit Lenin, Trotzki und anderen Vertretern der internationalen Linken bezog Pannekoek Stellung gegen den um sich greifenden Opportunismus, welcher bestritt, dass die revolutionären Lehren aus dem Massenstreik von 1905 in Rußland allgemeine, weltweite Gültigkeit besaßen. Im Verlauf dieser Debatte war Pannekoek - wie Lenin später in "Staat und Revolution" anmerkte - der erste, der die von Marx und Engels aus der Erfahrung der Pariser Kommune gezogenen Lehren von der Notwendigkeit der vollständigen Zertrümmerung des bürgerlichen Staates wiederherstellte. Wenn Pannekoek in seiner 1912 in der "Neuen Zeit" erschienenen Polemik gegen Kautsky - "Massenaktion und Revolution" - gegen die Auffassung Stellung bezog, dass die Arbeiterpartei und ihre Kriegskasse bzw. die Gewerkschaftskasse reiner Selbstzweck seien, der sogar das Ausweichen vor dem Kampf rechtfertigen würde, tat er dies keineswegs aus Geringschätzung gegenüber dem Kampf um die Organisation und ihrer Finanzierung, sondern als ein Parteigenosse, welcher bereits in den Niederlanden die besonders verantwortliche Stellung des Schatzmeisters bekleidet hatte. "Die Organisation des Proletariats", schrieb er, "die wir als sein wichtigstes Machtmittel bezeichnen, ist nicht zu verwechseln mit der Form der heutigen Organisationen und Verbände, worin sie sich unter den Verhältnissen einer noch festen bürgerlichen Ordnung äußert. Das Wesen dieser Organisation ist etwas Geistiges, ist die völlige Umwälzung des Charakters der Proletarier."(2)
Dieser Kampf gegen den Opportunismus vor 1914 gehört zu den größten Leistungen Pannekoeks. Er führte diesen Kampf als aktiver Bestandteil der organisierten Arbeiterbewegung in Holland, in Bremen, als Mitarbeiter der Parteischule in Deutschland, als Vordenker der linken Opposition innerhalb der 2. Internationale. Und im Rahmen dieses Kampfes entwickelte er seine Grundüberzeugungen über die marxistische Methode, vertiefte er sein Verständnis der proletarisch-materialistischen Auffassung, wobei er auf den großen Beitrag Dietzgens hinwies, und entwickelte Fragen der Philosophie sowie der Ethik weiter.
Der zweite große Kampf, welchen Pannekoek führte, war die Verteidigung des proletarischen Internationalismus im 1. Weltkrieg. In enger Zusammenarbeit mit den deutschen Spartakisten, den russischen Bolschewiki und anderen Internationalisten gehörte Pannekoek, wie sein nicht weniger berühmter niederländischer Mitstreiter Herman Gorter, zu den Wegbereitern der Oktoberrevolution in Russland, des Kampfes um die Rätemacht in Europa und der 1919 gegründeten Kommunistischen Internationalen.
Doch der vielleicht wichtigste Beitrag Pannekoeks zum Marxismus war sein Mitwirken bei der Ausarbeitung der Konsequenzen des Eintritts des Kapitalismus in seine Niedergangsphase für die Kampfbedingungen des Proletariats. Indem er besonders klar erkannte, dass der Parlamentarismus sowie die Gewerkschaften keine Bühne des Klassenkampfes mehr sein konnten, wurde er einer der bedeutendsten Vordenker der Kommunistischen Linken. Aber auch diesen Beitrag leistete er nicht allein, sondern als Mitstreiter im Kampf der Kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands (KAPD) sowie der sich formierenden Tradition der "deutsch-holländischen Linken" gegen den wachsenden Opportunismus innerhalb der Kommunistischen Internationalen, vor allem innerhalb der russischen und der deutschen Partei.
Pannekoeks Regression zu einem sterilen Anti-Leninismus als Folge der Konterrevolution
Im Gegensatz hierzu gehören die späteren politischen Werke Pannekoeks wie "Lenin als Philosoph" (1938) oder "Die Arbeiterräte" (1946) trotz mancher Vorzüge theoretisch zu seinen schwächeren Leistungen. In den Augen von Cajo Brendel und anderer "Rätisten" hingegen stellen diese Werke die Krönung des Pannekoekschen Lebenswerks dar. Brendels Schilderung eines sich stets fortentwickelnden Pannekoeks, der sein Weltbild ununterbrochen perfektionierte und dessen Sicht gegen Ende seines Lebens immer klarer wird, bleibt nicht ohne Reiz. Brendel führt diese angebliche Vervollkommnung außerdem auf die stete Fortentwicklung des Arbeiterkampfes sowie des Kapitalismus zurück. "Dass die Ergebnisse seiner Analyse verschieden ausgefallen sind, je nach dem Zeitpunkt, zu dem er sie vornahm, liegt nicht an dieser Methode, auch nicht an ihm, der sich ihrer bediente, sondern an der Tatsache, dass der Kampf der Arbeiter so wie das kapitalistische System nun einmal durch eine große Dynamik gekennzeichnet sind." (S. 14) Hier erblickt man erneut die große Schwäche von Brendels Analyse. Erstens verläuft der Prozess der Höherentwicklung selten geradlinig. Zweitens zeichnete sich die Entwicklung des Kapitalismus im 20. Jahrhundert nicht so sehr durch eine vorwärts gerichtete "Dynamik" als vielmehr durch einen Rückfall in die Barbarei aus. Drittens wurde die "Dynamik" des Klassenkampfes nach der Niederlage der proletarischen Revolution Anfang der 20er Jahre jahrzehntelang durch die längste Konterrevolution der Geschichte unterbrochen. All das hatte schwerwiegende Konsequenzen für die politische Entwicklung Pannekoeks. Zum einem ist es besonders schwer, in einer Zeit der allgemeinen Niederlage der Arbeiterklasse dem Druck der bürgerlichen Ideologie standzuhalten. Zum anderen löste Pannekoek in dieser Zeit der Niederlage tatsächlich allmählich seine Verbindung zur organisierten revolutionären Bewegung auf. Da aber die proletarische theoretische Arbeit, wie der Arbeiterkampf insgesamt, einen zutiefst kollektiven Charakter aufweisen, führte seine wachsende Isolierung zwangsläufig zu einem gewissen theoretischen Rückschritt Pannekoeks gegenüber bestimmten Fragen. Hier gibt es einige Parallelen zwischen Pannekoek und Amadeo Bordiga, dem Begründer der Tradition des "italienischen Linkskommunismus". Beide sind der Sache des Proletariats bis zu ihrem Lebensende treu geblieben. Beide betrieben ihre theoretische Arbeit im Verlauf der 30er und 40er Jahre in zunehmender Isolation. Beide vollzogen dabei in gewissen Fragen eine theoretische Regression, welche bei Bordiga mit einem sterilen Rückgriff auf eine Leninsche "Orthodoxie", bei Pannekoek mit einem ebenso sterilen "Anti-Leninismus" einhergingen.
Während Pannekoek zurecht in seiner Schrift "Lenin als Philosoph" darauf hinwies, dass Lenin in seinem 1908 verfassten Werk "Materialismus und Empiriokritizismus" den Unterschied zwischen bürgerlichem und proletarischem Materialismus ungenügend begriffen hatte, war es mehr als an den Haaren herbeigezogen, daraus schlusszufolgern, dass Lenin ein bürgerlicher Politiker gewesen sei, und dass die damals bevorstehende Revolution in Russland notwendigerweise eine bürgerliche Revolution werden müsse.
Cajo Brendel übernimmt natürlich dieses Argument. Schließlich handelt es sich bei der Ablehnung des proletarischen Charakters der Oktoberrevolution um die Frage, wo die "Rätekommunisten" sich am meisten berechtigt sehen, sich zumindest auf den späteren Pannekoek berufen zu können.
Doch gerade hier springt die Armseligkeit der Argumentationslinie sowohl von Brendel wie von Pannekoek von 1938 förmlich ins Auge. Denn das ungenügende Verständnis des proletarischen Materialismus war vor 1914 kein ausschließlich russisches Phänomen, sondern weit verbreitet innerhalb der damaligen II. Internationalen. Pannekoek selbst hat stets und zu Recht eine der Ursachen dieses Unvermögen in einer ungenügenden Würdigung der Bedeutung Hegels durch die damalige Arbeiterbewegung erblickt. Doch gerade Lenin hat sich am Vorabend der russischen Revolution vertieft mit Hegel befasst. Genau so wie Marx, bevor er den ersten Band des Kapitals schrieb, besann sich Lenin auf die Methode Hegels, bevor er Staat und Revolution verfasste. Sowohl "Das Kapital" wie "Staat und Revolution" stellen daher Musterbeispiele der Anwendung der dialektisch-materialistischen Methode des Proletariats dar.
Das andere Hauptargument von "Lenin als Philosoph" war, dass es im Russland von 1917 noch bedeutende Überreste des Feudalismus bzw. der zersplitterten Kleinproduktion gab. Doch dies traf auch auf Deutschland zu, wo die Bourgeoisie bis November 1918 die Macht mit dem preußischen Militäradel teilen musste. Ja, im Grunde wurde die Macht der Krautjunker innerhalb des deutschen Militärs erst unter den Nationalsozialisten gebrochen.
Tatsächlich stellte die Annahme, dass man zuerst in jedem einzelnen Land die Aufgaben der bürgerlichen Revolution gewissermaßen zu Ende führen müsste, bevor man zur proletarischen Revolution übergehen könne, eine alte Konfusion innerhalb der Arbeiterbewegung vor 1917 dar. So stand es auch im alten Programm der Bolschewiki geschrieben, worauf sich die Mehrheit des Zentralkomitees der Partei nach dem Sturz des Zarenregimes im Februar 1917 berief, um die "Duldung" der linksbürgerlichen, "provisorischen" Regierung und die "kritische Unterstützung" der Fortsetzung des imperialistischen Krieges zu rechtfertigen.
Es waren Lenins berühmte "Aprilthesen" von 1917, die diese letztendlich nationale Sichtweise verwarfen. In ihnen wies Lenin nach, dass die proletarische Revolution nicht erst dann zur Notwendigkeit wird, wenn alle Aufgaben der bürgerlichen, "demokratischen" Revolution erledigt sind, sondern dann auf die geschichtliche Tagesordnung kommt, wenn die weltweiten Widersprüche des Kapitalismus einen bestimmten Reifegrad erreicht haben.
Dass Pannekoek diese Lehre später vergaß, kann nur im Zusammenhang mit der Enttäuschung und Konfusion auf Grund der Niederlage der Weltrevolution und des Absterbens der Revolution in der isolierten russischen Bastion verstanden werden. Schließlich war Pannekoek (wie auch Rosa Luxemburg bis zu ihrer Ermordung 1919) noch Anfang der 1920er Jahre ein zwar kritischer, aber stets leidenschaftlicher Befürworter der russischen Oktoberrevolution.
Dennoch muss man feststellen, dass Pannekoek sich selbst weniger klar als beispielsweise Lenin darüber war, dass die Oktoberrevolution in Russland nur als Auftakt, als Anstoß zur proletarischen Revolution in Europa verstanden werden konnte. Durch das Ausbleiben der Revolution in Westeuropa enttäuscht und entmutigt, überschätzte er maßlos die Rolle Russlands nicht nur in der Durchführung der Revolution, sondern noch mehr beim Aufbau einer kommunistischen Gesellschaft. Während Lenin und Trotzki im proletarischen Russland v.a. eine ausgehungerte, ohne die Rettung durch eine baldige Weltrevolution hoffnungslos ausgelieferte Bastion sahen, setzte Pannekoek Anfang der 20er Jahre seine Hoffnungen umgekehrt auf die illusorische Perspektive, dass der Ausbau einer kommunistischen Wirtschaftsordnung im Osten die Klassenherrschaft der Bourgeoisie im Westen untergraben würde. In seiner ansonsten großartigen Schrift "Weltrevolution und kommunistische Taktik", welche eine erste bedeutende Kritik des wachsenden Opportunismus der Bolschewiki enthält, schreibt hierzu Pannekoek:
"Zur selben Zeit, als Westeuropa mühsam sich aus seiner bürgerlichen Vergangenheit emporringt, wirtschaftlich stagniert, blüht im Osten, in Russland, die Wirtschaft in der kommunistischen Ordnung empor. (...)
Inzwischen erhebt sich im Osten die Wirtschaft unbehindert im kräftigen Aufschwung, eröffnet neue Wege, sich stützend auf die höchste Naturwissenschaft - die der Westen nicht zu gebrauchen weiß - vereint mit der neuen Sozialwissenschaft, der neu gewonnenen Herrschaft der Menschheit über ihre eigenen gesellschaftlichen Kräfte. Und diese Kräfte, hundertfach gesteigert durch die neuen Energien, die aus der Freiheit und Gleichheit entsprießen, werden Russland zum Zentrum der neuen kommunistischen Weltordnung machen." (Hervorhebung durch die IKS).
Um diese völlig irreale, Russland-fixierte Sichtweise zu untermauern, welche die marxistischen Lehren über den internationalen Charakter der Revolution vergisst, unternimmt der Pannekoek von 1920 sogar einen Ausflug in die Natur. "Es besteht sogar ein dementsprechendes Gesetz in der organischen Natur, das als Gegenstück zu Darwins ‚das Überleben der Passendsten' mitunter als ‚survival of the unfitted', das ‚Überleben der Nichtangepassten' bezeichnet wird." (4)
Die Tatsache, dass Pannekoek seine ursprüngliche Unterstützung der russischen Revolution später revidierte und den Oktober 1917 im Nachhinein als bürgerliche Revolution bezeichnete, muss sicherlich als Reaktion auf die stalinistische Konterrevolution verstanden werden. Doch gewisse Wurzeln dieser Fehler waren bereits 1920 in der marxistisch unhaltbaren Erwartung angelegt, dass in der belagerten Festung Russland auf Dauer etwas anderes blühen könnte als Not und Niedergang. Die theoretischen Rückschritte, welche diese falsche Analyse mit sich brachte, waren gravierend. Zum einem wurde das Verständnis getrübt, welche alle echten Revolutionäre 1917 teilten, dass der Kapitalismus nunmehr ein niedergehendes Gesellschaftssystem geworden war, so dass allein die proletarische Revolution auf der Tagesordnung stand. Zum anderen öffnete die Infragestellung der proletarischen Oktoberrevolution Tür und Tor für die Idee, dass die gesamte Arbeiterbewegung, welche in den Jahrzehnten zuvor die Oktoberrevolution vorbereitet hatte, ebenfalls bürgerlich war. Diesen Weg, welchen Bilan, das Organ der italienischen Linken Anfang der 30er Jahre, als eine Art "proletarischen Nihilismus" bezeichnete, ging Pannekoek zwar nicht, aber seine späteren rätistischen Epigonen beschritten ihn ohne Bedenken.
Doch diese Schwächen schmälern die Bedeutung Pannekoeks und seine Relevanz für heute nicht grundlegend. Im zweiten, abschließenden Teil dieses Artikels werden wir nachweisen, welch tiefer Gegensatz zwischen Pannekoeks marxistischer Sicht der aktiven Rolle der Theorie und der revolutionären Begeisterung im Klassenkampf sowie dem platten, ökonomistischen Vulgärmaterialismus eines Cajo Brendels besteht. Urs
(1) Die taktischen Differenzen in der Arbeiterbewegung. Reprint Verlag. 1973.
(2) Massenaktion und Revolution. In "Die Massenstreikdebatte." Europäische Verlagsanstalt. 1970. S. 274.
(3) Lenin als Philosoph. Europäische Verlagsanstalt. 1969.
(4) Weltrevolution und kommunistische Taktik. 1920. Wiederveröffentlicht in Pannekoek, Gorter: Organisation und Taktik der proletarischen Revolution. Verlag Neue Kritik. 1969. S. 157f
Antwort auf einen Leserbriefschreiber zum Thema Irrationalität
- 2587 reads
Wir veröffentlichen hier unsere Antwort auf einen Brief von einem Kontakt aus Norddeutschland zum Thema Irrationalität.
In deinem Brief entwickelst Du verschiedene Argumente gegen die Annahme der IKS, dass der imperialistische Krieg der Gegenwart Ausdruck einer zunehmenden Irrationalität des kapitalistischen Systems ist. Dabei gehst Du davon aus, dass die Annahme der Irrationalität dieser Kriege notwendigerweise zu der Schlussfolgerung führen muss, „dass der Kapitalismus auch ohne Kriege leben kann.“...
Lieber Genosse,
es tut uns Leid, dass wir dich solange haben warten lassen auf unsere Antwort zu deinem Brief über die Frage der Irrationalität im Kapitalismus. Wir möchten dabei nicht verhehlen, dass uns eine Antwort auf deine Fragen nicht leicht gefallen ist. Schließlich mutet es auf den ersten Blick etwas paradox an, die Frage der Irrationalität, wörtlich: Unvernunft, mit den Kategorien der Vernunft zu klären.
In deinem Brief entwickelst Du verschiedene Argumente gegen die Annahme der IKS, dass der imperialistische Krieg der Gegenwart Ausdruck einer zunehmenden Irrationalität des kapitalistischen Systems ist. Dabei gehst Du davon aus, dass die Annahme der Irrationalität dieser Kriege notwendigerweise zu der Schlussfolgerung führen muss, „dass der Kapitalismus auch ohne Kriege leben kann.“
Somit stellst Du die Frage auf einer sehr grundsätzlichen Ebene – was sehr zu begrüßen ist. Deswegen ist es zunächst erforderlich, deutlicher zu machen, was wir unter „Irrationalität“ verstehen.
Du sagst völlig zu Recht, dass die „Sichtweise des Rationalen und Irrationalen (…) aus verschiedenen Sichtweisen gesehen werden (muss). Verschiedene Klassenideologien, Interessensgemeinschaften und Meinungen haben andere (unterschiedliche) Einstellungen zum Rationalen und Irrationalen.“ In der Tat war es eine der wesentlichen Erkenntnisse der bürgerlichen Aufklärung, dass sowohl die Individuen als auch die gesellschaftlichen Klassen von ihren materiellen Interessen geleitet werden, und nicht, wie es bis dahin Glaube war, von bloßen Ideen bzw. der „göttlichen Vorsehung“. Dass es dabei zu unterschiedlichen Betrachtungsweisen der verschiedenen Interessen oder – wie du sagst – zu „verschiedenen Klassenideologien, Interessensgemeinschaften und Meinungen“ kommt, liegt auf der Hand. Und dass es dabei zu Konfrontationen zwischen den verschiedenen Interessen in Gestalt von antagonistischen Gesellschaftsklassen, kurz: zum Klassenkampf kommt, der seinerseits das antreibende Moment der Geschichte ist, ist nicht erst seit Marx gesicherte Erkenntnis.
Somit liegt es auf der Hand, dass es Dinge geben kann, welche vom Standpunkt der Bourgeoisie rational und vom Standpunkt des Proletariats irrational (oder umgekehrt) erscheinen oder auch sind. So entlassen die Unternehmer immer wieder Arbeitskräfte, um die Produktion zu „rationalisieren“, während es den betroffenen Proletariern gar nicht einleuchten will, weshalb die Vernichtung so vieler Existenzgrundlagen bei gleichzeitiger Auspowerung der verbleibenden Arbeitskräfte etwas mit Rationalität zu tun haben soll.
Wenn die IKS aber von der Irrationalität des Krieges in der Niedergangsphase des Kapitalismus spricht, so ist damit nicht gemeint, dass diese Kriege vom Standpunkt der Bourgeoisie rational, aber vom Standpunkt des Proletariats irrational sind. Betrachtet man die Haltung der Marxisten zur Kriegsfrage im Verlauf der Geschichte, so wird man feststellen, dass die Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert zwar die Barbarei der kapitalistischen Kriegsführung anprangerte, aber dennoch viele dieser Kriege für „rational“ hielt, nicht nur vom Standpunkt der Bourgeoisie, sondern vom Standpunkt des Proletariats d.h. vom übergeordneten Standpunkt des geschichtlichen Fortschritts. M.a.W. solange die Bourgeoisie eine fortschrittliche gesellschaftliche Kraft darstellte, waren Kriege möglich, welche sowohl den Interessen der Bourgeoisie als auch dem gesellschaftlichen Fortschritt dienten. Diese Kriege waren somit im konkreten und umfassenden Sinne zweckdienlich. Unsere These lautet also, dass in der Dekadenzphase des Kapitalismus der imperialistische Krieg nicht nur vom Standpunkt des Proletariats oder vom übergeordneten Standpunkt des geschichtlichen Fortschritts, sondern vom Standpunkt der Bourgeoisie selbst immer weniger zweckdienlich ist. Der Hauptzweck der Produktion im Kapitalismus ist nicht mehr (wie in vorkapitalistischen Klassengesellschaften) die Befriedigung der Konsum- und Luxusbedürfnisse der herrschenden Klasse, sondern das Profitbestreben: Die Akkumulation des Kapitals. Da der moderne imperialistische Krieg immer weniger imstande ist, dieses Grundbedürfnis des Kapitals zu befriedigen, fühlen wir uns berechtigt, von einer zunehmenden Irrationalität zu sprechen. Diese Kriege können weiterhin selbstverständlich für einzelne Unternehmen äußerst gewinnträchtig sind. Vom Standpunkt des Gesamtsystems, und zunehmend auch vom Standpunkt der kriegsführenden Mächte selbst, ist dies jedoch immer weniger der Fall. Wir werden im weiteren Verlauf konkrete Beispiele hierfür anführen. Wir wollen jedoch nicht übersehen, dass man vom marxistischen Standpunkt aus schwerwiegende Bedenken grundsätzlicher Art gegen diese Vorstellung erheben kann. Das eine lautet: Ist das Konzept der Irrationalität überhaupt vereinbar mit der marxistischen Vorstellung, dass die Verfolgung der materiellen Interessen gesellschaftlicher Klassen den Motor der heutigen Geschichte darstellt? Das andere lautet: Kann man überhaupt von einer solchen Irrationalität des Krieges sprechen, ohne Tür und Tor zu öffnen für die pazifistische Annahme, dass es im besten Interesse der Bourgeoisie selbst läge, keinen Krieg zu führen? V.a. diesen zweiten Einwand hast du in deinem Brief erhoben.
Tatsächlich bildet die Einsicht, dass die ökonomischen Klasseninteressen die mächtigsten Triebfedern der gesellschaftlichen Entwicklung darstellen, eine wesentliche und unverzichtbare Grundlage des historischen Materialismus. Berechtigt uns diese Annahme aber zu der Schlussfolgerung, dass jede Handlung einer gesellschaftlichen Klasse sozusagen automatisch den materiellen Interessen dieser Klasse dient? Oder anders ausgedrückt: Lehrt uns der Marxismus, dass die Klassen in der Verfolgung ihrer materiellen Interessen stets erfolgreich sind?
Dies war beispielsweise die Annahme des bürgerlichen Materialismus. Bereits vor dem Marxismus begann die revolutionäre Bourgeoisie zu erkennen, welche Rolle die materiellen Interessen im Leben der Einzelnen wie der gesellschaftlichen Klassen spielt. Der Marxismus hat sich sogar auf diese Errungenschaften der revolutionären Bourgeoisie stützen können. Jedoch besaß die aufsteigende Bourgeoisie eine nicht nur unvollständige, sondern auch sehr mechanistische, primitive Auffassung des Zusammenhangs zwischen Interessenslage und Handlungsweise der Menschen. So argumentierte z.B. die Philosophie des Utilitarismus, dass der Mensch stets egoistisch handelt. Diese einseitige, undialektische Sichtweise verstand nicht, dass neben dem Egoismus auch der Altruismus eine große Rolle im persönlichen wie im gesellschaftlichen Leben spielt. Außerdem schloss diese mechanistische Herangehensweise die Augen vor der Erkenntnis – welche die moderne Psychologie beispielsweise bestätigt hat – dass die Menschen oft auf Grund von Wahnvorstellungen oder anderer krankhafter Veranlagungen systematisch ihren eigenen Interessen zuwider handeln können.
Während der Marxismus also die positiven Errungenschaften des bürgerlichen Materialismus bereitwillig übernahm, war er zugleich bestrebt, seine mechanistischen und einseitigen Veranlagungen zu überwinden und zu bekämpfen. Denn Überreste solcher Veranlagungen lebten in den Reihen der Arbeiterbewegung fort. Dieses Problem wurde z.B. in der 1915 geschriebenen Einleitung thematisiert, welche Henriette Roland-Holst für die niederländische Ausgabe von Trotzkis Schrift “Der Krieg und die Internationale“ schrieb. Was dort sichtbar wird, ist, dass viele Revolutionäre unter anderem deshalb so überrascht und überrollt waren von der Begeisterung, mit der die Arbeiter sich für den imperialistischen Krieg zunächst mobilisieren ließen, weil sie angenommen hatten, der historische Materialismus schließe aus, dass eine Klasse sich so sehr für fremde Interessen einspannen lassen könne. Diese Revolutionäre hatten eben nicht verstanden, dass der Marxismus keineswegs davon ausgeht, dass die Klassen immer und automatisch in ihrem eigenen Interesse handeln. Denn wie Marx festgestellt hat: Die herrschende Ideologie ist in der Regel die Ideologie der herrschenden Klasse. Was bedeutet, dass die ausgebeuteten Klassen oft dazu neigen, anstatt den eigenen Interessen den Interessen ihrer Ausbeuter zu dienen.
Dies unterstreicht, dass das Verhältnis zwischen Interesse und Handlungsweise auch bei gesellschaftlichen Klassen komplizierter ist als der Vulgärmaterialismus gemeinhin annimmt. Tatsächlich handeln die Proletarier zutiefst irrational, wenn sie bereitwillig in den imperialistischen Weltkrieg marschieren, um ihre eigenen Klassenbrüder- und Schwestern abzuschlachten. Wenn aber die Bourgeoisie solche Kriege vom Zaun bricht, denn kann die von uns unterstellte Irrationalität wohl kaum darin liegen, dass sie, ohne es zu wissen, fremden Klasseninteressen dient. Diese Art der Irrationalität ist eine Eigenschaft ausgebeuteter Klassen, während die Ausbeuter umgekehrt darin spezialisiert sind, andere für ihre eigenen Interessen einzuspannen
Wie kann es also überhaupt dazu kommen, dass die Bourgeoisie in der Verfolgung ihrer Interessen nicht immer erfolgreich sein muss? Es ist nicht schwer zu begreifen, dass dieses Schicksal einzelne Kapitalisten ereilen kann. Schließlich ergeben sich solche „Schicksale“ wie eine Naturnotwendigkeit aus dem Konkurrenzcharakter des Kapitalismus und der Anarchie des Marktes von selbst. Aber kann dies ganzen nationalen Bourgeoisien oder gar der gesamten Kapitalistenklasse passieren?
Wir meinen ja – bestimmte geschichtliche Bedingungen vorausgesetzt. Die bei weitem wichtigste dieser Bedingungen ist der Niedergang der Produktionsweise, welche diese Ausbeuterklasse vertritt. Dazu Marx: „Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb derer sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um.“ Da der Kapitalismus die bisher dynamischste Produktionsform der Menschheitsgeschichte ist, fällt dieser Zusammenstoß zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen um so zerstörerischer aus. Insbesondere der Widerspruch zwischen dem internationalen Charakter der Produktion und der auf der Grundlage von Nationalstaaten organisierten und geschützten privaten Aneignung führt zu immer zerstörerischen Kriegen. Da diese Kriege in der Dekadenzphase nicht mehr vornehmlich gegen vorkapitalistische Gesellschaften und um die Eroberung neuer Märkte, sondern zwischen kapitalistischen Mächten um eine bereits aufgeteilte Welt geführt werden, werden sie immer kostspieliger und zerstörerischer, während die daraus zu erzielenden wirtschaftlichen Vorteile immer bescheidener ausfallen.
Daraus wird deutlich: Nicht der Krieg „an sich“ wird irrational, sondern der Kapitalismus insgesamt. Die Irrationalität des Krieges ist somit nur eine Folge – allerdings einer der gravierendsten Folgen – der historischen Sackgasse des Systems insgesamt. Darin liegt auch der Grund, weshalb aus der Tatsache, dass die imperialistische Kriegsführung immer weniger gewinnträchtig wird, keineswegs folgt, dass die herrschende Klasse gut beraten wäre, den imperialistischen Krieg zu unterlassen. Sie kann den imperialistischen Krieg schon deshalb nicht unterlassen, weil sie sich historisch unentrinnbar in einer Situation des „fressen oder gefressen werden“ befindet. Wird die Kriegsführung zunehmend gefährlich, so wird die Nicht-Kriegsführung nicht weniger gefährlich, und oft noch viel gefährlicher.
Im Kapitalismus hat diese Irrationalität eine Dimension erreicht, die nicht Hochkulturen oder Herrschaftssysteme in Frage stellt, sondern die Lebensgrundlage der Menschheit schlechthin bedroht. Es ist in diesem Zusammenhang geradezu ein Witz, wenn die bürgerlichen Ideologen anlässlich des 60. Jahrestages des Abwurfs der Atombombe auf Hiroshima und Nagasaki behaupten, es sei die Vernunft der Herrschenden gewesen, die die Eskalation des Kalten Krieges in einen Nuklearkrieg verhindert habe. Die unzähligen Angriffs- und Verteidigungspläne, die in den Schubläden der Militärs auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs auf ihre Umsetzung warteten, und die Entwicklung immer raffinierterer Variationen der Atombombe (wie die Neutronenbombe) sowie so genannter taktischer Atomwaffen sprechen eine andere Sprache. Sie machen deutlich, dass die Herrschenden in Ost und West durchaus willens waren, entgegen aller Vernunft ihre eigene und die Existenz der gesamten Menschheit aufs Spiel zu setzen. Ganz abgesehen von den monströsen ökonomischen Kosten dieses nuklearen Wettlaufs, die den einen Blockführer, die Sowjetunion, in den Zusammenbruch trieben und den anderen, die USA, zum Hauptschuldner der Weltwirtschaft machten. Es war nicht die angebliche Rationalität der Herrschenden, die letztendlich den III. Weltkrieg verhindert hat, sondern in erster Linie der Unwillen der Arbeiterklasse auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs, sich für diesen Wahnsinn mobilisieren zu lassen.
Die Irrationalität des dekadenten Kapitalismus drückt sich nicht nur in selbstzerstörerischen Kriegen aus, sondern auch in der Zerstörung der natürlichen Grundlagen des Planeten durch die kapitalistische Warenproduktion. Obwohl sich die seriösen Wissenschaftler dieser Welt nur noch darum streiten, um wie viel Grad die Erderwärmung zunehmen wird, und die großen Versicherungskonzerne bereits die zu erwartenden gigantischen Kosten aus den durch die Klimaänderung verursachten Schäden in ihre Kalkulationen aufnehmen, steuert die Weltbourgeoisie die Menschheit und sich selbst wider besseren Wissens in die ökologische Katastrophe.
Du fragst: „Wer ist auf diese Schlussfolgerung gekommen, dass Militäreinsätze irrationaler oder rationaler Natur sind?“ Nun, es mag sein, dass niemand so dezidiert die Irrationalität des Krieges im dekadenten Kapitalismus betont wie die IKS. Doch der Aspekt der Irrationalität im Kapitalismus an sich ist keine „Erfindung“ der IKS. Bereits Rosa Luxemburg hat in ihre Juniusbroschüre darauf hingewiesen. „Heute funktioniert der Krieg nicht als eine dynamische Methode, dem aufkommenden jungen Kapitalismus zu den unentbehrlichsten politischen Voraussetzungen seiner „nationalen“ Entfaltung zu verhelfen....Auf seinen objektiven historischen Sinn reduziert, ist der heutige Weltkrieg als Ganzes ein Konkurrenzkampf des bereits zur vollen Blüte entfalteten Kapitalismus um die Weltherrschaft, um die Ausbeutung der letzten Reste der nichtkapitalistischen Weltzonen. Daraus ergibt sich ein gänzlich veränderter Charakter des Krieges selbst und seiner Wirkungen. (...) All das zusammen ergibt als die Wirkung des Krieges noch vor jeder militärischen Entscheidung über Sieg oder Niederlageein in den früheren Kriegen der Neuzeit unbekanntes Phänomen: den wirtschaftlichen Ruin aller beteiligten und in immer höherem Masse auch der formell unbeteiligten Länder“. (Luxemburg Werke Band 4, Seite 153, 154).
Außerdem: Schon Marx und Engels haben wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass der Kapitalismus sich – im Gegensatz zu allen früheren Gesellschaften – zwar anschickte, den blinden, unkontrollierten Gewalten der Natur die Zügel anzulegen, dass er sich gleichzeitig aber neuen, ebenso blinden Gesetzen unterwarf, die sich außerhalb seiner Kontrolle befinden. „… jede auf Warenproduktion beruhende Gesellschaft hat das Eigentümliche, dass in ihr die Produzenten die Herrschaft über ihre eigenen gesellschaftlichen Beziehungen verloren haben. Keiner weiß, wie viel von seinem Artikel auf den Markt kommt, wie viel davon überhaupt gebraucht wird, keiner weiß, ob sein Einzelprodukt einen wirklichen Bedarf vorfindet, ob er seine Kosten herausschlagen oder überhaupt wird verkaufen können. Es herrscht Anarchie der gesellschaftlichen Produktion.“ (F. Engels, MEW, Bd. 42, S. 721f.) An anderer Stelle drückt sich Engels noch pointierter aus, wenn er sagt, dass nicht der Kapitalist das Produkt beherrscht, sondern umgekehrt das Produkt den Kapitalisten.
Wenn die Unkontrollierbarkeit der Marktmechanismen, die jeder Vernunft eigentlich Hohn sprachen, zu Lebzeiten von Marx und Engels noch nicht in eine selbstzerstörerische Irrationalität umschlug, dann lag dies daran, dass der Kapitalismus damals noch ein junges, entwicklungsfähiges Gesellschaftssystem war. Zwar führte die von Engels beschriebene Anarchie der Produktion regelmäßig zu Wirtschaftskrisen, die ganz Europa erschütterten und Millionen von Arbeitern in die vorübergehende Arbeitslosigkeit stürzten, doch konnte der Kapitalismus den momentanen Engpass für sein (völlig planlos akkumuliertes) Kapital schnell durch die Eroberung neuer Märkte zuhause und in Übersee überwinden. Und nicht nur das: Erst die planlose, ungezügelte Konkurrenz, eben die Anarchie der Produktion, verlieh dem Kapitalismus in seinem Aufstieg jene Dynamik, mit der er die Welt eroberte.
Es ist die Epoche der Dekadenz, des Eintritts des Kapitalismus in seine Niedergangsphase, in der die im kapitalistischen Gesellschaftssystem von Anbeginn wurzelnde Irrationalität zu einer quasi autoagressiven, selbstzerstörerischen Kraft in der Gesellschaft wurde. Dabei müssen wir uns von der Vorstellung verabschieden, dass die Welt von heute sich in einem Zyklus von Krise-Krieg-Wiederaufbau befindet, der, falls die Arbeiterklasse nicht eingreift, sich ewig wiederholt und die Bourgeoisie nach einem jeden Krieg wie Phönix aus der Asche emporsteigen lässt. Wir sind vielmehr Zeuge (und Opfer) einer Entwicklung, die – statt an einem Kreislauf – an eine Spirale erinnert, eine Spirale, die mit jeder weiteren Drehung, mit jeder weiteren Krise, mit jedem weiteren Krieg die menschliche Zivilisation dem endgültigen point of no return ein Stück näher bringt. Was wir heute erleben, ist nicht der ewige und rationale Gleichklang von Zerstörung und Wiederaufbau, sondern die Eskalation einer Irrationalität, die neben der Arbeiterklasse zunehmend auch die Existenz der Bourgeoisie gefährdet
„Die Intensität des Krieges muss steigen, nicht fallen, weil umso größer der Kapitaleinsatz ist, um so größer ist auch die kriegerische Auseinandersetzung (…) Je größer der Schaden eines Krieges, umso florierender das kapitalistische Geschäft.“ Wenn du damit behauptest, dass der Krieg das „kapitalistische Geschäft“ ankurbelt, dann geben wir dir insofern Recht, als es beispielsweise dem Rüstungshersteller nur zu gut in seinem Kram passt, wenn irgendwo auf der Welt Krieg geführt wird. In der Tat kann es dem einzelnen Kapitalisten herzlich egal sein, welches Produkt sich zu Geld machen lässt. Ob Lebensmittel, Maschinen, Luxusgüter oder eben Waffen – für den einzelnen Kapitalisten beschränkt sich der Nutzen einer Ware lediglich auf ihre Verwertbarkeit, sprich: Realisierbarkeit. Doch wie bereits Rosa Luxemburg in ihrem bahnbrechenden Werk Die Akkumulation des Kapitals feststellte: „Was dem Einzelkapitalisten völlig Hekuba (Redewendung für: gleichgültig), wird für den Gesamtkapitalisten ernste Sorge. Während für den Einzelkapitalisten gehupft wie gesprungen ist, ob die von ihm produzierte Ware Maschine, Zucker, künstlicher Dünger oder ein freisinniges Intelligenz ist, vorausgesetzt nur, dass er sie an den Mann bringt, um sein Kapital nebst Mehrwert herauszuziehen, bedeutet es für den Gesamtkapitalisten unendlich viel, dass sein Gesamtprodukt eine ganz bestimmte Gebrauchsgestalt hat, und zwar, dass in diesem Gesamtprodukt dreierlei Dinge vorzufinden sind: Produktionsmittel zur Erneuerung des Arbeitsprozesses, einfache Lebensmittel zur Erhaltung der Arbeiterklasse und bessere Lebensmittel mit dem nötigen Luxus zur Erhaltung des Gesamtkapitalisten selbst.“ (Gesammelte Werke, Bd. 5, S. 55)
So Gewinn bringend also die Ankurbelung der Kriegswirtschaft und die Auslösung von Kriegen für einzelne Bereiche des Kapitals sind, so Verlust bringend sind sie für das Gesamtkapital, so kontraproduktiv sind sie für die gesamtgesellschaftliche Akkumulation. Panzer und Militärjets kann man nicht essen, sie dienen nicht der „Erneuerung des Arbeitsprozesses“, und bis auf ein paar Snobs, die sich gern mit ausrangiertem Militärgerät schmücken, entsprechen sie auch nicht den Luxusbedürfnissen der Bourgeoisie. Ihr einziger ökonomischer Sinn verbirgt sich in der Widersinnigkeit, Kapital zu vernichten.
Das Phänomen der Kriegswirtschaft, das erstmals im Verlauf des 1. Weltkriegs auftauchte, und ab den 30er Jahren zu einem ständigen Phänomen wurde, sorgte zunächst durchaus für eine gewisse Belebung der krisengeschüttelten Wirtschaften Europas. Gerade in Hitlerdeutschland wurde durch die forcierte Kriegsproduktion das Millionenheer der Arbeitslosen binnen kurzer Zeit nahezu in Vollbeschäftigung umgewandelt. Dieses Strohfeuer der wirtschaftlichen Wiederbelebung durch die Kriegsproduktion stürzte auch einen Teil der italienischen Linkskommunisten rund um Bilan in einige Verwirrung. So behauptete Vercesi, ein führendes Mitglied der italienischen Fraktion der Kommunistischen Linken, dass die Steigerungen des staatlichen Rüstungsetats per Kredit „doch den Interessen des Kapitalismus dienen (können), vor allem indem sie den ökonomischen Kollaps verhinderten“.
Doch die Geschichte hat gezeigt, dass diese Art von wirtschaftlicher Stimulans schnell verpuffte und, schlimmer noch, die Krise des Systems letztendlich um ein Vielfaches verschlimmerte sowie den Marsch in den Krieg nur noch mehr beschleunigte. Lassen wir einen bürgerlichen Historiker sprechen, um das Dilemma des Hitlerregimes bei seiner imperialistischen Aufrüstungspolitik zu veranschaulichen: „Die Aufrüstung und erst recht der Krieg funktionierten fortan als politisch-militärische Spekulationsbasis, als Schneeballsystem, das in dem Moment auffliegen musste, in dem die Expansion an Grenzen stieß. Deshalb konnte Hitler-Deutschland zu keinem Zeitpunkt – nicht einmal nach der Niederlage Frankreichs – einen komfortablen Sieg-Frieden eingehen. Denn selbst ein solcher, gewiss räuberischer Friedensschluss hätte den Bankrott des Reiches sofort sichtbar werden lassen.“ (Götz Aly, aus: Der Spiegel, Nr. 10 / 2005)
Nein, die Kriegsproduktion ist vom Standpunkt des Gesamtkapitals (in Gestalt des staatskapitalistischen Regimes oder in der abstrakteren Form des Weltkapitals) beileibe kein Ausweg aus der Krise des dekadenten Kapitalismus und die Schäden, die der Krieg anrichtet, kein Expansionsfeld für eine neue Runde in der Akkumulation des Gesamtkapitals. Die Wiederaufbauperiode nach dem II. Weltkrieg mitsamt ihres Booms in den 50er und 60er Jahren müssen in diesem Zusammenhang eher als eine historische Ausnahme betrachtet werden, die der Tatsache geschuldet ist, dass es damals mit den USA noch eine Großmacht gab, die – anders als heute – schuldenfrei und somit in der Lage war, den Wirtschaftsboom im Europa der Wiederaufbauperiode mit gewaltigen Krediten zu finanzieren. Vor allem aber erlaubte die internationale Koordination der Wirtschaftspolitik der Nationalstaaten auf der Ebene der imperialistischen Blöcke die wirkungsvolle Erschließung der weltweit noch vorhandene, vorkapitalistische Märkte.
Die Regel war vielmehr finanzielle, wirtschaftliche und politische Zerrüttung der Krieg führenden Länder, unabhängig davon ob sie zu den Siegern oder den Verlierern zählen. So verhielt es sich mit dem I. Weltkrieg, der ein Europa hinterließ, das vollständig aus den Fugen geraten war und dessen Vormachtstellung in der Welt aufs Schwerste erschüttert war. So erging es auch den unzähligen Ländern, die Schauplatz jener lokalen und regionalen Kriege waren, welche nach dem II. Weltkrieg nahezu ununterbrochen im Gange waren. Kaum einer dieser Kriege mündete in einem Wiederaufbau, der dem in Europa nach dem II. Weltkrieg auch nur im Entferntesten ähnelte. Fast jeder dieser Kriege vergrößerte lediglich das Elend der betroffenen Länder und legte die Saat für den nächsten Krieg. Jüngstes Beispiel ist der Irak-Krieg. Während das Land Tag für Tag immer tiefer in die Anarchie versinkt, erweist sich das Irak-Abenteuer für die USA selbst als ein finanzielles Fass ohne Boden, das riesige Löcher in den US-Haushalt reißt (allein 2004 erwirtschaftete der Haushalt der US-Administration ein Defizit von 422 Milliarden Dollar) und auch die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft zu ziehen droht. Und was das Irak-Abenteuer endgültig irrational macht: Statt den Irak unter ihre Kontrolle zu bringen und ihrer Disziplin zu unterwerfen, muss die US-Bourgeoisie mehr oder weniger hilflos mit ansehen, wie das Land unaufhaltsam in das Chaos des Terrorismus und des Religionskrieges abdriftet.
Du kommst zur Schlussfolgerung: „Wer aus diesen Fakten immer noch behauptet, dass Kriege irrational sind, geht einer falschen Theorie nach: dass der Kapitalismus auch ohne Kriege leben kann.“ Wir hingegen sagen: Gerade die Tatsache, dass der dekadente Kapitalismus trotz dessen kontraproduktiven Charakters nicht mehr ohne den Krieg existieren kann, macht ihn ja so irrational. Diese Irrationalität ist keine frei gewählte Attitüde der Bourgeoisie, sondern – wie wir weiter oben bereits erwähnt hatten – die Manifestation der Beherrschung der Bourgeoisie durch eine außerhalb ihrer Kontrolle stehenden Macht, die sich ihr in Gestalt von so genannten Sachzwängen aufdrängt und keine andere Wahl lässt. In diesem Sinn möchten wir auf deine Frage, ob die Bourgeoisie weiß, was sie tut, antworten, dass, selbst wenn sie die Tragweite ihres irrationalen Handelns erkennen könnte, sie unfähig wäre, zur Vernunft zurückzukehren
Kommen wir zum Schluss: Wir hoffen, dass wir mit diesem Brief etwas zur Klärung dieses doch recht komplexen Themas beigetragen haben. Vieles haben wir nur angesprochen, und sicherlich ist auch Etliches unerwähnt geblieben. Wir würden uns daher freuen, wenn wir diese Diskussion mit dir (und anderen?) fortsetzen und vertiefen könnten, und hoffen auf eine Antwort von dir
IKS, August 2005
Theoretische Fragen:
- Krieg [25]
Erbe der kommunistischen Linke:
Ehrung des Genossen Robert
- 1638 reads
Am 28.Dezember 2003 starb der Genosse Robert im Alter von 90 Jahren. Robert war seit über 28 Jahren ein wirklicher Lebensgefährte unserer Organisation.
Seit der Gründung der IKS nahm er als Beobachter an zahlreichen Konferenzen und Kongressen sowie als regelmäßiger Teilnehmer an unseren öffentlichen Veranstaltungen in Belgien teil. Trotz reeller Differenzen identifizierte er sich mit der grundsätzlichen Orientierung unserer Organisation und unterstützte sie nach besten Kräften.
Heute erweisen wir mit Robert nicht nur einem Genossen die Ehre, den Loyalität, Hingabe und Leidenschaft für die revolutionäre Sache des Proletariats auch in den dunkelsten Kapiteln der Geschichte auszeichnete. Wir ehren ihn auch als Mitglied einer ganzen Generation von Militanten der Arbeiterklasse in Belgien, die nun zusammen mit ihm ausstirbt.
Robert war der letzte überlebende revolutionäre Kommunist einer Generation von Militanten, die auch in der schlimmsten Periode der Konterrevolution, die die Arbeiterklasse zwischen den 30ern und 60er Jahren heimsuchte, das Banner des Internationalismus hochhielt.
In seiner Jugend erlebte Robert in den Arbeitervierteln von Brüssel die ganzen Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaft; hier wurde er zum ersten Mal mit der harten Realität des Klassenkampfes konfrontiert. 1930 war Brüssel das politische Zentrum Belgiens, der Brennpunkt der meisten wichtigen politischen Debatten. Diese Diskussionen trugen zu Roberts revolutionärem Werdegang bei. In den Diskussionen ging es darum zu klären, ob es an der Zeit sei, eine neue Kommunistische Partei zu gründen oder besser die Arbeit als Fraktion fortzusetzen. Ferner um die Klärung des Wesens des Krieges in Spanien, darum, ob die Gründung der trotzkistischen 4. Internationale richtig war, um den Klassencharakter der UdSSR, den Aufstieg des Faschismus sowie die Verteidigung des Internationalismus angesichts des drohenden Weltkrieges.
Die wichtigsten Bestandteile des damaligen revolutionären Milieus waren die „trotzkistischen“ Gruppen der internationalen Linksopposition (PSR, Contre le Courant, etc) und die internationale, kommunistische Linke (die italienische Fraktion um die Zeitschrift Bilan und die belgische Fraktion um Communisme).
Robert entschied, sich der trotzkistischen Opposition um Vereeken (Contre le Courant) anzuschließen, die gegen die Gründung der 4. Internationale war. Sie erkannte die Voreiligkeit dieser Gründung und wies darauf hin, dass Trotzki zu den Schwierigkeiten und der Zersplitterung der wenigen revolutionären Kräfte beigetragen habe. Diese Gruppe denunzierte das sozialpatriotische Auftreten der offiziellen Trotzkisten während des 2.Weltkrieges und praktizierte eine Politik des revolutionären Defätismus gegenüber allen sich bekämpfenden imperialistischen Mächten.
Bei Kriegsausbruch am 1.September 1939, entschieden sich einige Militante, konfrontiert mit Verhaftungen und schwerster Repression, ins Exil zu gehen und dort die politische Arbeit fortzusetzen. Robert floh zunächst nach Paris, dann nach Marseille, einer Stadt, die zeitweilig vielen Revolutionären Asyl bot. Viele von ihnen verloren in den kritischsten Momenten ihre Überzeugung. Robert hingegen vertraute auf die Arbeiterklasse und verteidigte standfest die internationalistische Position gegenüber beiden Krieg führenden Lagern.
Durch seine politischen Beziehungen mit dem internationalistischen Milieu kam Robert mit jenem Zirkel in Kontakt, der unter dem Einfluss unseres alten Genossen Marc stand. Letzterer hatte von 1940 an versucht, die politische Arbeit der Fraktion der internationalen Linkskommunisten wiederzubeleben, die angesichts des Krieges zum Stillstand gekommen war. Von 1941 an kam es immer wieder zu Diskussionen und Kontakten.
Im Mai 1942 konstituierte sich der französische Kern der internationalen kommunistischen Linken. Es nahmen verschiedene neue Elemente daran teil, unter ihnen Robert. Durch ihn kam es zur Zusammenarbeit mit der Gruppe RKD, einer österreichischen Gruppe, die mit dem Trotzkismus gebrochen hatte, sowie den Communistischen Revolutionären, ihrer Schwestergruppe in Frankreich. Tatsächlich war es die RKD über ihre Kontakte mit der Vereekengruppe, auf die er stieß, durch die er das Interesse der RKD an den politischen Positionen des französischen Kerns der kommunistischen Linken weckte.
Die Charakterisierung der UdSSR als Ausdruck einer generellen Tendenz zum Staatskapitalismus, die Haltung des proletarischen Internationalismus gegenüber dem Krieg und die Kritik an der trotzkistischen 4. Internationale - all dies waren gemeinsame Positionen, die die politischen Bande stärkte. Es wurden gemeinsame Aktionen und Propaganda an die Adresse der Arbeiter und Soldaten aller Nationen einschließlich der deutschen Arbeiter in Uniform gegen den imperialistischen Krieg durchgeführt. Im Dezember 1944 fragte der Kern als französische Fraktion der internationalen kommunistischen Linken um die Aufnahme im Internationalen Büro der Fraktion nach.
Die Maikonferenz der Fraktion entschied 1945 in Folge der Ankündigung der Gründung einer kommunistischen Partei in Italien sowie des politischen Wiedererscheinens von Bordiga die Auflösung der italienischen Fraktion und forderte ihre Mitglieder auf, als Individuen dieser neuen Partei beizutreten. Unser Genosse Marc bekämpfte diesen unverantwortlichen Schritt, der ohne jede vorherige Diskussion oder ein politisches Abwägen stattfand, auf das Schärfste; er war völlig gegen die Integration in eine Partei, deren politische Positionen nicht einmal der Fraktion bekannt waren. Gleichzeitig wurde der Aufnahmeantrag des französischen Kerns abgelehnt und eine Namensänderung in Gauche Communiste de France erzwungen. Auf der anderen Seite vereinigte sich die belgische Fraktion, die sich nach dem Krieg wieder um Vercese rekonstruiert hatte, mit der PCInt um Damen, Maffi und Bordiga.
Nach dem Krieg kehrte Robert wieder nach Belgien zurück. Da er politisch nicht auf sich allein gestellt sein wollte, beschloss er, die belgische Fraktion wiederzubeleben, ohne jene Überzeugung über Bord zu werfen, zu der er in der Periode des französischen Kerns gekommen war.
Er hielt Kontakt mit der GCF, insbesondere mit Marc. Die Gruppe in Belgien blieb den wesentlichen Positionen Bilans vor dem Krieg treu und stand faktisch in Widerspruch zur PCInt. Die belgische Fraktion öffnete sich, so wie sie es vor dem Krieg getan hatte, zunehmend den internationalen Diskussionen. Ende 1945, Anfang 1946 fragte die belgische Fraktion nach weiteren Erläuterungen der Gründe für die Nichtaufnahme der GCF in die Reihen der Kommunistischen Linken. Es scheint, dass Robert sehr vehement diese Anfrage unterstützt hat. Die belgische Fraktion schlug ebenfalls vor, ein theoretisches Organ gemeinsam mit den belgischen Trotzkisten um Vereeken herauszugeben. Dies zu einem Zeitpunkt, bevor diese Gruppe endgültig an die 4. Internationale verloren wurde. Dieser Vorschlag wurde von der PCInt abgelehnt.
Im Mai 1947 nahm die belgische Fraktion auch an einer internationalen Konferenz teil, die vom holländischen kommunistischen Spartacusbond organisiert worden war. Ihr wohnten Gruppen bei, die ebenso wie die belgische Fraktion der Gruppe Spartacus in Belgien nahe standen. Mit dabei waren die GCF, die CR, die RKD, die Schweizer Gruppe Lutte de Classe und die autonome Turiner Fraktion der PCInt.
1950-52 zerschlugen sich die Hoffnungen auf eine revolutionäre Nachkriegswiederbelebung des Klassenkampfes, ähnlich jener nach dem 1. Weltkrieg. Viele revolutionäre Organisationen gerieten in die Isolation, die GCF eingeschlossen. Robert unterhielt mit Marc, der nun in Venezuela lebte, regelmäßigen Briefkontakt, worin er ihn über die Situation des revolutionären Milieus informierte.
Nach Vercesis Tod 1957 weigerte sich die belgische Fraktion, sich den Positionen der bordigistischen PCI zu unterwerfen, aber tatsächlich fiel sie allmählich noch dahinter zurück.
Robert nahm weiter an verschiedenen organisatorischen Ausdrücken der Kommunistischen Linken teil, so auch an dem Studienzirkel um Roger Dangevilles Zeitschrift „Le Fil du Temps“ (einem Ableger der PCI, der eine Zeitlang an einem Diskussionszirkel teilnahm, der auf Initiative von Maximilian Rubel entstanden war, seinerseits ehemaliges Mitglied der GCF).
Schließlich kam er nach 1968 über Marc mit der Gruppe Révolution International in Frankreich in Kontakt. Trotz deutlicher Meinungsverschiedenheiten in Fragen des historischen Kurses und der Partei war Robert sich der politischen Bedeutung der revolutionären Organisation und der Notwendigkeit der Verteidigung des revolutionären Erbes sehr bewusst.
Eben deshalb verhielt er sich loyal gegenüber der Internationalen Kommunistischen Strömung (IKS). Er unterstützte uns auch während der schwierigsten Perioden, indem er Stellung für unsere Verteidigung bezog.
Die Militanten der IKS, die den revolutionären Kampf, für den er lebte und kämpfte, fortsetzen, erbieten ihm die letzte Ehre. Sie werden sein Andenken in lebendiger Erinnerung behalten.
Flüchtlingsdrama in Melilla und Ceuta: Die Heuchelei der Bourgeoisie
- 2664 reads
Während der letzten beiden Wochen waren wir Zeugen einer Reihe von aufsehenerregenden Szenen an der Südgrenze der Europäischen Union. Zunächst der massenhafte Ansturm auf die Sperranlagen, die von der spanischen Regierung errichtet worden waren, welche von Tausenden von Migranten überwunden werden konnten, auch wenn sich zahlreiche dabei verletzten und die Kleider zerrissen. Danach der Kugelhagel, der 5 Migranten das Leben raubte; Schüsse, die wahrscheinlich – obwohl die Medien davon ablenken wollen – von den Truppen der sehr “demokratischen und friedensliebenden” Regierung des Herrn Zapatero abgefeuert wurden, welcher sich gerne als ein Unschuldslamm darstellt.
Während der letzten beiden Wochen waren wir Zeugen einer Reihe von aufsehenerregenden Szenen an der Südgrenze der Europäischen Union. Zunächst der massenhafte Ansturm auf die Sperranlagen, die von der spanischen Regierung errichtet worden waren, welche von Tausenden von Migranten überwunden werden konnten, auch wenn sich zahlreiche dabei verletzten und die Kleider zerrissen. Danach der Kugelhagel, der 5 Migranten das Leben raubte; Schüsse, die wahrscheinlich – obwohl die Medien davon ablenken wollen – von den Truppen der sehr “demokratischen und friedensliebenden” Regierung des Herrn Zapatero abgefeuert wurden, welcher sich gerne als ein Unschuldslamm darstellt. Danach folgte der massive Aufmarsch der Truppen der Legion und der Guardia Civil mit der Anweisung, auf “menschliche Art und Weise”[1] die Migranten zurückzuhalten.
Am 6. Oktober trat dann - nach hinter den Kulissen geführten Verhandlungen zwischen der spanischen und marokkanischen Regierung - eine Wende ein: 6 Emigranten wurden auf marrokanischem Territorium niedergeschossen und tödlich verletzt. Diese Erschießungen lösten eine Reihe von immer brutaleren Handlungen aus: Südlich von Uxda, im marokkanischen Wüstengebiet, wurden Migranten am 7. Oktober ausgesetzt und ihrem Schicksal überlasen, umfangreiche Polizeirazzien in den marokkanischen Städten mit hohem Bevölkerungsanteil von Migranten, zwangsweise Rückführungen von mit Handschellen gefesselten Männern und Frauen nach Mali und in den Senegal; dann folgte die Nachricht, dass wieder zahlreiche Migranten per Bus in die Sahara verfrachtet und dort einfach ausgesetzt worden waren.
Vom 6. Oktober an übernahm die Regierung Zapatero wieder die Rolle des “Meisters der Verwandlung”. Es folgte eine lautstarker “Protest” gegenüber Marokko wegen der “unmenschlichen” Behandlung der Migranten; schließlich wurde in den Medien das Projekt eines “hochmodernen” Grenzzauns vorgestellt (in Wirklichkeit handelt es sich um drei übereinander angebrachte Sperrzäune), welche die Migranten am Eindringen hindern sollten, “ohne dass ihnen irgendein Kratzer zugefügt” werde. Andere Länder der EU reihten sich schnell in den Chor des “demokratischen Protestes” gegenüber den marokkanischen Ausschweifungen ein, und verlangen, dass die “Migranten respektvoller behandelt werden” und sie plärren mit dem üblichen Geschwätz von Europa als Aufnahmegebiet für Hilfsbedürftige und von der Notwendigkeit, die “Entwicklung” afrikanischer Länder stärker zu fördern. Der spanische Außenminister, ein Experte in scheinheiligem Lächeln, kündigt mit ernster Miene an, “Spanien wird keine illegale Zuwanderung dulden, und das ist durchaus vereinbar mit dem Respekt vor den Migranten”[2]
Bei dieser Krise erkennt man die beiden Gesichter der demokratischen Staaten. Vom 6. Oktober an will die Regierung Zapatero bei ihrem schmutzigen Krieg gegen die Migranten, nachdem sie zuvor Marokko mit gewissen Aufgaben beauftragt hat, ihr übliches Engelsgesicht zeigen, wonach sie den “Frieden”, die “Menschenrechte”, und den “Schutz der Personen” fördere. Das ist das Gesicht des Zynismus, der Lügen und der Manöver der übliche Deckmantel, den sich die “großen Demokratien” anlegen; es ist die widerwärtigste Heuchelei.
Denn in den Tagen zuvor trat die Regierung Zapatero mit einem anderen Gesicht auf: massiver Schusswaffeneinsatz, Guardia Civil, Misshandlungen eines Emigranten, Sperrzäune und umherfliegende Hubschrauber, Abschiebungen in afrikanische Staaten...
Eine Maske, die den Schleier des Geredes über die “Menschenrechte” und die “Freiheiten” zerreißt und die Tatsache nicht verheimlichen kann, dass der “Sozialist" Zapatero die Migranten genauso behandelt wie Sharon, der den Sperrzaun in den Palästinensergebieten und im Gaza-Streifen errichten ließ und dafür beschimpft wird, und die ostdeutschen Stalinisten Ulbricht und Honecker, die die Berliner Mauer bauen ließen.
Aber die beiden Gesichter, das der demokratischen Heuchelei und des Bluthundes, sind in Wirklichkeit keine Gegensätze, sondern ergänzen sich.
Sie stellen eine untrennbare Einheit bei der Herrschaftsform des Kapitalismus dar, ein Gesellschaftssystem, das eine zahlenmäßige, ausbeutende Minderheit unterhält, die Bourgeoisie, dessen Überleben immer mehr im Gegensatz zu den Interessen und Notwendigkeiten des Proletariats und der großen Mehrheit der Bevölkerung steht.
Das tragische Problem der Zuwanderung verdeutlicht, dass der Kapitalismus, der immer mehr und tiefer in eine Krise versinkt, und die in Kontinenten wie Afrika extremste Formen annimmt, nicht mehr dazu in der Lage ist, einer immer größeren Anzahl von Menschen ein Mindestmaß an Überlebensmöglichkeiten sicherzustellen, welche vor dem tödlichen Inferno des Hungers, der Kriege und Epidemien flüchten.
Bei ihrer Flucht werden sie von den Polizeikräften und den Mafia-Banden der Länder, die sie durchqueren, verprügelt und bestohlen, welche immer mit der Duldung durch die jeweiligen Staaten tätig sind, und wenn sie am ersehnten Ziel ankommen, stoßen sie auf eine neue Mauer der Schande, auf Sperrzäune, Kugeln, Abschiebungen...
Mit einer immer größeren Krise konfrontiert, sind die Länder der Europäischen Union immer weniger ein “Refugium des Friedens und des Wohlstands”, welches sie uns vorgaukeln wollen. Die Wirtschaft dieser Länder kann nur wenige Tropfen dieses gewaltigen Ozeans an Menschenmassen aufnehmen, während sich gleichzeitig die Ausbeutungsbedingungen in diesen Ländern immer mehr verschlechtern und sich immer mehr den Bedingungen der Länder nähern, aus denen die Migranten flüchten.
Diese Ereignisse finden statt auf dem Hintergrund wachsender imperialistischer Spannungen zwischen den Staaten, wobei jeder versucht, den anderen Schläge zu versetzen oder Erpressungsmittel in die Hand zu bekommen. Dadurch werden die Migranten zu einer leichten Beute für die Manipulationen der jeweiligen Regierungen. Marokko versucht Spanien zu erpressen, womit die Arbeit der Schlepperbanden erleichtert wird. Und Spanien wiederum versucht einen so hohen Preis wie möglich für seine Dienste als bissiger Wachhund aufgrund seiner Lage als Einfallstor am Südzipfel der Europäischen Union auszuhandeln.
Dieses blutige Spiel der Aufschneider und Betrüger wird auf Kosten des Lebens von Hunderttausenden Menschen betrieben, die zu einer tragischen Odyssee verdammt sind. Die stärksten Staaten wollen gegenüber der Welt das Bild vermitteln, sie seien die “menschlichsten und solidarischsten Gesellschaften”, ganz einfach, weil es ihnen bei diesem Kuhhandel gelungen ist, dass die weniger starken Teile unter ihnen die schmutzigsten Aufgaben übernehmen. Marokko erscheint in diesem Film als der Bösewicht (die Tradition wildester Brutalität seiner Polizeikräfte und seines Militärs verstärken dabei die Wirkung dieses Tricks), während Spanien und die anderen Mitglieder der Europäischen Union, ihre unverschämten Nachäffer, die Frechheit besitzen, ihnen Lehren der Demokratie und der Menschenrechte erteilen zu wollen.
Aber die wachsenden Widersprüche des Kapitalismus, die Vertiefung seiner historischen Krise, der Zerfallsprozess, der allmählich alles untergräbt, die langsame Zuspitzung des Klassenkampfes, führt dazu, dass diese großen Staaten, die geschickte Teilnehmer des Schauspiels der Demokratie sind, immer mehr ihr Gesicht als Bluthunde zeigen müssen. Vor 3 Monaten sahen wir, wie die britische Polizei, die ‚demokratischste Polizei der Welt”, kaltblütig einen jungen Brasilianer ermordete (2), vor weniger als einem Monat sahen wir, wie US-amerikanische Polizei und Militär auf die Bevölkerung einprügelte anstatt Lebensmittel zu verteilen und Hilfe für die Opfer des Hurrikans Katrina zu bringen; heute sehen wir, wie die Regierung Zapatero Migranten umbringt, Truppen mobilisiert und eine neue Mauer der Schande errichtet.
Es gibt keinen Kapitalismus mit menschlichem Antlitz. Die Interessen der Menschheit sind mit den Bedürfnissen dieses Systems nicht vereinbar. Damit die Menschheit überleben kann, muss der Kapitalismus verschwinden. Den kapitalistischen Staat überall zu zerstören, die Grenzen und Ausbeutung des Menschen durch den Menschen abzuschaffen, dies ist die Orientierung, die das Proletariat in seinem Kampf einschlagen muss, damit die Menschheit auch nur anfängt zu leben.
Internationale Kommunistische Strömung 11.10.05
[1] In den letzten Tagen haben die Regierungsstellender EU den Marokkanischen Behörden die grossen Kredite in Erinnerung gerufen, die an Marokko gezahlt wurden, damit das Land seine Gendarmenrolle übernimmt, welche das Land bislang vernachlässigt hatte
Geographisch:
- Afrika [27]
Theoretische Fragen:
- Zerfall [8]
Irak - Naher Osten: Der Kapitalismus versinkt in der Barbarei des Krieges
- 1687 reads
Nach dem Anschlag vom 11. September 2001 in New York hat der US-amerikanische Staat die Notwendigkeit, dem Irak den Krieg zu erklären, mit drei Argumenten begründet. Das erste war die Gefahr, die von den „Massenvernichtungswaffen“ ausging, die es offensichtlich nicht gab. Das zweite war, dass man im Irak eine Demokratie nach dem Vorbild der USA herstellen müsse - die bürgerliche Demokratie im Irak rudert heute aber in der politischen Anarchie eines unregierbaren Landes. Drittens schließlich und vor allem hieß es, der militärische Angriff auf den Irak sei deshalb unbedingt notwendig, um einen totalen und erbarmungslosen Krieg gegen den internationalen Terrorismus führen zu können. Dabei wurde insbesondere unterstellt, dass es eine enge Verbindung zwischen dem Henker Saddam Hussein und der Organisation Al Kaida von Usama Bin Laden gebe. Seither ist die Welt weiter im blutigen Chaos versunken. Kein Tag vergeht in Afghanistan, im Irak, im Nahen Osten, in Afrika, ohne dass neue Massaker verübt würden. Die auf Video aufgenommene Köpfung von Geiseln ist eine Waffe im Krieg geworden, die ohne jede Hemmung und jenseits von jeder Menschlichkeit eingesetzt wird. Doch darüber hinaus werden nun die Zivilbevölkerung, auch Frauen und Kinder, von allen möglichen schwachen oder mächtigen imperialistischen Cliquen, die sich gegenseitig zerfetzen, als Geiseln genommen.
Nach dem terroristischen Attentat am 11. März 2004 in Madrid, das die arbeitende Bevölkerung, die sich gerade zur Arbeit begab, im Mark traf, hörte der Terrorismus nie auf, weitere Verheerung anzurichten. In den ersten Tagen des Monats August gab es im Irak nicht weniger als sechs Autobomben, die in Bagdad und Mossul die christliche Gemeinde zum Ziel hatten und mindestens zehn Tote und mehrere Dutzend Verletzte forderten. Die ersten zwei Anschläge galten in Bagdad einer armenischen bzw. einer altsyrischen Kirche, eine weitere Bombe explodierte bei einer chaldäischen Stätte. In Palästina fallen die Bomben mit einer alltäglichen Selbstverständlichkeit auf die Häuser von Leuten, die eh schon ohne jede Reserve im nackten Elend leben. Am 11. August nahmen Anschläge in der Türkei Hotels und ein Gaslager aufs Korn. Eine Gruppe, die sich „Abu-Hafa-Al-Masri-Brigade“ nannte, übernahm gemäss der englischen Tageszeitung The Independent die Verantwortung für sie. Diese Gruppe soll auf dem Internet erklärt haben: „Istanbul ist nur der Anfang eines blutigen Krieges, den wir den Europäern versprochen haben.“ Welches auch immer die wirklichen Urheber der Gräuel in Istanbul, Bagdad oder Madrid waren, diese blutigen Anschläge verfolgten das planmäßige Ziel, Angst und Schrecken zu verbreiten. Der Terrorismus tendiert dazu, sich als Kriegswaffe allgemein durchzusetzen. Gestern noch war sie die Waffe der schwächsten imperialistischen Staaten wie Syriens oder Libyens, heute wird sie zum bevorzugten militärischen Strandgut, das alle Kriegsherren und -cliquen, die mit der zunehmenden Schwächung der Nationalstaaten aus dem Boden schießen, einsammeln und -setzen. Diese allgemeine Tendenz der in Auflösung begriffenen Gesellschaft setzt sich als barbarische Wirklichkeit des Weltkapitalismus im Zerfall durch.
Südasien am Rande des Chaos
Unter der Führung des amerikanischen Imperialismus haben sich die politischen und religiösen Führer des Iraks am Sonntag, 15. August, in Bagdad versammelt, um eine erste Sitzung der Nationalkonferenz abzuhalten, die zum offiziellen Ziel gehabt hätte, die Abhaltung von Wahlen in diesem Land im Zeitraum 2005 zu organisieren. Die New York Times schreibt: “Die Amerikaner und die gegenwärtige irakische Regierung wollten mit dieser Konferenz aufzeigen, das die Vorbereitung dieser Wahlen ihren Lauf nimmt trotz der Gewaltakte, die das Land erschüttern.“ Diese Wahlperspektive ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Zum Beweis dafür hält die New York Times folgendes fest: „Am Tag der Eröffnung der Konferenz war viel mehr von Aufrufen zur Beendigung der Kämpfe in Najaf zu hören als von den kommenden Wahlen.“ In der Tat gingen zwei Granaten in unmittelbarer Nähe der Konferenz nieder, kaum hatte sie begonnen, so dass sie gleich unterbrochen werden musste. Seit dem 5. August dieses Jahres nehmen Gewalt und Chaos im ganzen Land wieder stark zu. An diesem Datum erklärte der radikale Schiitenführer Muktada Sadr „den Jihad (Heiligen Krieg) gegen die amerikanischen Besetzer und gegen die britischen Truppen, nachdem diese am Vortag vier seiner Männer verhaftet hatten“, berichtet Al Hayat (Courrier internationale vom 6.8.04). Darauf begann die Belagerung der Stadt Najaf mit Billigung des Bürgermeisters der Stadt, Al Zorfi. Zur Zeit, wo wir diese Zeilen schreiben, haben sich die Männer Muktada Sadrs um das Mausoleum des Imams Ali verschanzt, welches für die Schiiten der ganzen Welt die heiligste ihrer Stätten ist, was Scheich Jawad Al-Chalessi, den Imam der großen Moschee von Kadimiya, zwingt klar zu stellen: „Weder dieser Pseudo-Bürgermeister, dieser ehemalige Übersetzer der amerikanischen Armee, der nur deshalb ausgewählt wurde, weil er für seine Fähigkeit, den verrücktesten Anordnungen zu folgen, bekannt ist, noch sonst jemand, und zwar inbegriffen die höchsten religiösen Würdenträger, haben das Recht, den Ungläubigen den Zutritt zum Mausoleum von Ali zu gestatten.“ Die Kämpfe weiteten sich in der Folge aus auf Kut, Amara, Diwaniya, Nassiriya und Basra, wie auch auf das schiitische Quartier Sadr City in Bagdad. Bis zur Stunde soll es auf Seiten der schiitischen Milizen mehrere Hundert Tote geben, und lediglich deren zwei auf Seiten der Amerikaner, berichtet ein Communiqué der amerikanischen Armee. Demonstrationen für Sadr und gegen die Amerikaner breiten sich auf das ganze Land aus. Der Irak taucht ab ins Chaos, und es gibt nichts, was ihn da rausziehen könnte; nicht einmal die höchstpersönliche Intervention des höchsten religiösen Oberhaupts der schiitischen Gemeinde, Al Sistani, zugunsten eines Waffenstillstandes, der nur vorübergehend sein kann. Die USA werden so, ob sie es wollen oder nicht, in eine kriegerische Flucht nach vorne gedrängt, was nur zum Ausdruck bringt, wie sehr sie je länger je weniger fähig sind, die Lage auch nur einigermaßen zu kontrollieren. Die USA sind sich bewusst, dass der Widerstand gegen sie zunimmt, und haben versucht, einen Vorschlag des Außenministers Colin Powell umzusetzen, den dieser in Saudi-Arabien diskutiert hatte und der darauf abzielte, im irakischen Pulverfass islamische Staaten militärisch einzusetzen. Dieser Versuch zeigt noch einmal die totale Sackgasse auf, in der sich der amerikanische Imperialismus befindet, und ist unweigerlich zum Scheitern verurteilt. Der ägyptische Außenminister hat sofort klar gestellt, dass Ägypten keine Truppen entsenden werde. Der Rückzug der amerikanischen Truppen aus Najaf wäre ein vollumfängliches Eingeständnis ihrer Ohnmacht und ein gewaltiger Ansporn für alle, die gegen die USA Krieg führen. Wenn sie umgekehrt Najaf und die schiitische Kultstätte einnähmen, würde ein wahrhaftes Erdbeben in der ganzen schiitischen und islamischen Welt ausgelöst. Dies wäre unweigerlich ein sehr bedeutender Faktor der Beschleunigung der anti-amerikanischen Bewegung, des Krieges, des Chaos und des Terrorismus in der ganzen Region. Wie auch immer die Fortsetzung der Ereignisse in und um Najaf aussieht, ist der amerikanische Imperialismus einer noch größeren Radikalisierung der Gewalt und des Widerstandes der Schiiten nicht nur im Irak ausgesetzt, sondern in allen arabischen Ländern, in denen sie präsent sind. Angesichts dieses Schlangennestes, wo jeder nur gerade auf die Verteidigung seiner eigenen imperialistischen Interessen schaut, muss man davon ausgehen, dass der Iran sowohl politisch wie auch militärisch mit dem schiitischen Aufstand im Irak zu tun hat. Aus diesem Grund gab es in der letzten Zeit eine Reihe von Drohungen aus Washington an die Adresse von Teheran. Colin Powell selber beschuldigte am 1. August in Bagdad den Iran, sich in die irakischen Angelegenheiten einzumischen. Der Krieg im Irak betrifft die ganze Region, von Kurdistan über den Iran bis zur Türkei: Das ganze Gebiet wird immer mehr in einen Prozess der Destabilisierung und des Chaos hineingezogen. Im Irak demonstrieren die USA vor den Augen der ganzen Welt die immer größere Schwächung ihrer imperialistischen Macht. Dieser Sachverhalt freut natürlich ihre Hauptkonkurrenten auf der internationalen Bühne, nämlich Frankreich, Deutschland und auch Russland, und stärkt deren Entschlossenheit. Die Kampagne, die die USA gegen den Iran führen und von Israel unterstützt wird, betrifft auch die Frage des iranischen Atomprogramms. Während einer Pressekonferenz im August erklärte Verteidigungsminister Rumsfeld: „Der Iran war während mehreren Jahren auf der Liste der terroristischen Staaten, und eine große Besorgnis in der Welt betrifft die Verbindungen zwischen einem terroristischen Staat, der Massenvernichtungswaffen besitzt, und terroristischen Netzen. Es ist verständlich, dass die Nationen nicht nur in der Region, sondern auf der ganzen Welt tief beunruhigt sind.“ Man kann die Möglichkeit nicht ausschließen, dass der amerikanische Imperialismus auf seiner kriegerischen Flucht nach vorn einen nächsten Schritt im Iran macht. Auch wenn die USA, die besonders geschwächt sind, ein Interesse daran hätten, sich in Zukunft auf den Iran abstützen zu können, schließen sie sich immer mehr der selbstmörderischen und je länger je barbarischeren Politik des israelischen Staates an; ein Artikel der Sunday Times vom 15. Juli zitierte „israelische Quellen“, wonach Israel „seine Warnungen eines Schlages gegen den Iran nicht länger wiederholen“ werde und „in keinem Fall zulassen wird, dass iranische Reaktoren, insbesondere derjenige von Bushehr, der mit Hilfe Russlands gebaut wird, eine kritische Schwelle überschreiten ... Wenn im schlimmsten Fall die internationalen Bemühungen scheitern, sind wir zuversichtlich, dass wir notfalls mit einem gezielten Schlag die nuklearen Ambitionen der Ayatollahs vernichten können.“
Der schleichende Zerfall der palästinensischen Behörde ist unumkehrbar
Diese kriegerische Politik einer Flucht nach vorn zeigt sich auf barbarische Weise auch im Nahen Osten. Eine gewichtigere Folge der Entfaltung des Chaos in diesem Teil der Welt ist der Zerfall der palästinensischen Regierungsbehörde. Ihre Gründung geht auf die Oslo-Abkommen zurück, die 1993 einen Embryo eines autonomen Gebietes auf palästinensischem Territorium vorsahen. Dieses Gebiet stellte den Ausgangspunkt für den zukünftigen palästinensischen Staat dar, der dann am Ende einer fünfjährigen Übergangszeit gegründet werden sollte. Diese illusorische Perspektive einer Stabilisierung des Nahen Ostens hat sich mit den Massakern, Morden, Bombardierungen und permanenten Attentaten ins radikale Gegenteil gekehrt, dem auch ein palästinensischer Staat nicht entrinnen kann. Die palästinensische Regierung verliert unter dem Druck des fortgeschrittenen Zerfalls in diesem Teil der Welt sowie der expansionistischen und kriegerischen Politik Israels ihre letzte Macht. Auch wenn Arafat noch versucht, seine Stellung als Präsident zu retten, so wird dies seine Helfershelfer nicht daran hindern, sich auf immer gewalttätigere Weise um die Machtbrocken zu zanken. Die von Korruption unterwanderte palästinensische Regierung lässt so den internen Spannungen freien Lauf, was nur die totale Ohnmacht der palästinensischen Behörde ausdrückt. Und auch wenn sich der „Krach“ zwischen dem palästinensischen Führer Yassir Arafat und seinem gegenwärtigen Premierminister Achmed Kurai gelegt hat, wird in Zukunft nichts das Auseinanderbrechen der palästinensischen Regierung sowie die weitere Stärkung von radikalisierten und bewaffneten Armeen verhindern, die die Verzweiflung der Bevölkerung für ihre selbstmörderischen und blindwütigen terroristischen Taten gebrauchen werden. Der israelische Staat unter der Fuchtel der Administration Sharon kann gar nicht anders als seine kriegerische Politik mit dem Ziel fortsetzen, jeglichen palästinensischen Widerstand auszuradieren und die totale Kolonisierung des Westjordanlandes anzustreben. Deshalb beschleunigt der israelische Staat den Bau der Mauer um das Westjordanland: Es wird in ein riesiges Konzentrationslager verwandelt. Die Angriffe auf Sharon aus seiner eigenen Partei und sein Wunsch, die israelische Linke mit S. Perez an der Regierung zu beteiligen, um so den geschwächten Zusammenhalt der israelischen Staatsstruktur anzugehen, werden die kriegerische Politik des hebräischen Staats nicht ändern. Die Ereignisse im Nahen Osten enthalten alle Ingredienzien für eine weitere Destabilisierung der gesamten Region: von Jordanien über Libanon und alle Staaten am Persischen Golf bis nach Ägypten. Weiter zeigt aber auch der Zank zwischen dem Präsidenten Frankreichs, Jacques Chirac, und Sharon um die Bedrohung der jüdischen Gemeinschaft in Frankreich, dass die zunehmenden imperialistischen Spannungen auch die Beziehungen zwischen Frankreich und Israel ernsthaft betreffen, was sich mit den Spannungen zwischen Frankreich und den USA überschneidet.
Im Rahmen das Kapitalismus gibt es keine andere Perspektive als die Verallgemeinerung des Chaos und des Elends
Die zunehmende Schwächung der USA als erste imperialistische Weltmacht ermutigt die anderen Mächte, in erster Linie Franreich und Deutschland, ihre eigenen Interessen zu verteidigen, indem sie versuchen, die USA so stark wie möglich in die Klemme zu treiben, wie dies gegenwärtig im Irak der Fall ist. Die gegenwärtige Situation der Herausbildung stets neuer Kriegsschauplätze, von Massakern, Genoziden und Attentaten ist bereits ein beschleunigender Faktor des Chaos auf der ganzen Welt und somit des Zerfalls der kapitalistischen Gesellschaft. Kein Regierungswechsel in Israel oder den USA oder anderswo kann diese Perspektive verändern. Eine allfällige Wahl Kerrys als Präsident der USA würde an dieser Realität - Politik der Flucht nach vorn - nichts ändern. „Das Ankreiden der Inkompetenz von diesem oder jenem Regierungschef als Kriegsursache, erlaubt der Bourgeoisie, die Realität zu verzerren, die schreckliche Verantwortung des dekadenten Kapitalismus und mit ihm der Bourgeoisie auf der ganzen Welt zu verstecken“ (Der wirklich Schuldige ist der Kapitalismus, in: Revue Internationale, Nr. 115). Angesichts der beschleunigten Wirtschaftskrise versinkt der gesamte Kapitalismus unerbittlich in Zerfall und Chaos.
Tino (26. August)
Warum das Proletariat der Träger der kommunistischen Revolution ist
- 5017 reads
In den ersten beiden Artikeln (s. Weltrevolution Nr. 124 und 125) hielten wir zunächst einmal fest, dass der Kommunismus nicht nur ein alter Traum der Menschheit oder das bloße Produkt des menschlichen Willens ist, sondern dass die Notwendigkeit und die Möglichkeit des Kommunismus direkt auf den materiellen Bedingungen beruht, die der Kapitalismus entwickelt hat; zweitens, dass entgegen aller Vorurteile über die "menschliche Natur", die es der Menschheit unmöglich mache, in solch einer Gesellschaft zu leben, der Kommunismus wirklich die Gesellschaftsform ist, die am besten geeignet ist, jedem Individuum seine vollständige Entfaltung zu ermöglichen. Wir müssen uns nun noch mit einer weiteren Frage hinsichtlich der Möglichkeit des Kommunismus befassen. ‚Gut, der Kommunismus ist notwendig und materiell möglich. Männer und Frauen könnten in einer solchen Gesellschaft durchaus leben. Doch heute ist die Menschheit derart entfremdet in der kapitalistischen Gesellschaft, dass sie niemals die Stärke aufbringen wird, um eine solche Transformation in Angriff zu nehmen, die so gigantisch wie die kommunistische Revolution ist.' Wir werden nun versuchen, darauf zu antworten.
Ist der Kommunismus unvermeidbar?
Bevor wir uns direkt mit der Frage der Möglichkeit des Übergangs vom Kapitalismus zum Kommunismus befassen, müssen wir uns Klarheit verschaffen hinsichtlich der Idee, wonach der Kommunismus gewiss und unvermeidlich sei.
Ein Revolutionär wie Bordiga konnte einst schreiben: "Die kommunistische Revolution ist so sicher, als wäre sie bereits geschehen." (eigene Übersetzung) Dies ist natürlich eine verzerrte Sichtweise des Marxismus. Während der Marxismus bestimmte Entwicklungsgesetze von Gesellschaften destillierte, lehnte er entschieden jeglichen Gedanken an einer Art menschliches Schicksal ab, das im Voraus im Großen Buch der Natur geschrieben steht. Genauso wie die Entwicklung von Arten keine Finalität beinhaltet, d.h. keine Bewegung der zielstrebigen Annäherung an irgendeine Art von vollkommenem Modell ist, bewegen sich auch die menschlichen Gesellschaften nicht auf ein Modell zu, das bereits im Voraus geschaffen wurde. Solch eine Sichtweise gehört dem Idealismus an: So meinte der Philosoph Hegel zum Beispiel, dass jede Gesellschaftsform ein weiterer Schritt zur Verwirklichung des "absoluten Ideals" sei, das über Mensch und Geschichte schwebe. Auch der Jesuit Teilhard de Chardin dachte, dass der Mensch sich zu einem "Omega-Punkt" entwickle, der für alle Zeiten feststehe. Während uns das Studium der Geschichte in die Lage versetzen kann, die allgemeinen Gesetze der gesellschaftlichen Evolution im Verhältnis zur Entwicklung der Produktivkräfte zu begreifen, lernen wir auch, dass die Geschichte voller Beispiele von Gesellschaften ist, die sich so gut wie gar nicht weiterentwickelt haben; Gesellschaften, die - weit davon entfernt, den Anstoß zu fortschrittlicheren Formen der Gesellschaftsentwicklung zu geben - entweder seit einigen tausend Jahren stagnieren, wie die asiatischen Gesellschaften, oder einfach zu Staub zerfallen sind, wie die antike griechische Gesellschaft. Als allgemeine Lehre lässt sich sagen, dass die bloße Tatsache, dass eine Gesellschaft in ihrer Gesamtheit in die Dekadenz eingetreten ist, keineswegs bedeutet, dass sie in sich die Basis für eine höhere soziale Form enthält; sie kann ganz leicht in der Barbarei kollabieren und die meisten kulturellen Errungenschaften und Produktionstechniken verlieren, die ihre frühere Entwicklung bestimmt und begleitet haben.
Der Kapitalismus ist eine sehr besondere Art von Gesellschaft, eine Gesellschaft, die sich auf den Ruinen der Feudalgesellschaft Westeuropas entwickelt und die (als dynamischste Gesellschaftsform, die jemals existiert hat) die materiellen Bedingungen für den Kommunismus auf Weltebene geschaffen hat. Doch der Kapitalismus ist, wie viele andere Gesellschaften, nicht immun gegen die Gefahr des Niedergangs und Zerfalls, der Vernichtung aller Fortschritte, die er erzielt hat, und der Katapultierung der Menschheit um etliche Jahrhunderte oder Jahrtausende zurück. Es ist unschwer zu erkennen, dass dieses System die Mittel für die Selbstzerstörung der gesamten Menschheit geschaffen hat, eben weil es seine Vorherrschaft über den gesamten Planeten ausgebreitet und solch einen Grad an technischer Meisterschaft erreicht hat. Wie wir bereits gesehen haben, sind die Bedingungen, die den Kommunismus möglich und notwendig machen, auch die Umstände, die die Menschheit mit einem Rückfall in die Steinzeit oder mit der totalen Zerstörung bedrohen.
Revolutionäre sind keine Scharlatane; sie denken nicht daran, die unaufhaltsame Morgendämmerung eines Goldenen Zeitalters anzukündigen, das wir getrost abwarten können. Ihre Rolle ist es nicht, einer Menschheit in Nöten tröstende Worte zu predigen. Doch auch wenn sie keine Gewissheit über das Zustandekommen des Kommunismus haben (genau deshalb sind sie sich nicht sicher, ob sie ihr Leben für einen Kampf opfern, der am Ende die Möglichkeit des Kommunismus auch Wirklichkeit werden lässt), so müssen sie auf die echte Möglichkeit einer solchen Gesellschaft bestehen - nicht nur auf der Ebene der materiellen Möglichkeiten oder der theoretischen Kapazität der menschlichen Wesen, um in einer solchen Gesellschaft zu leben, sondern auch in Hinsicht auf die Fähigkeit der Menschheit, diesen entscheidenden Sprung vom Kapitalismus zum Kommunismus, die kommunistische Revolution, tatsächlich zu vollziehen.
Das Subjekt der kommunistischen Revolution
Aus dem Scheitern der vergangenen Revolutionen, ob sie zerschlagen wurden wie jene in Deutschland und Ungarn 1919 oder ob sie degenerierten wie in Russland, zieht der Durchschnittsbourgeois die Schlussfolgerung, dass die Revolution unmöglich ist. Er hat eine grimmige Warnung für all jene parat, die sich auf solche Unternehmen einlassen wollen: "Schlimmes widerfährt dem, der aufzubegehren versucht! Und wenn du es dennoch machst - schau, was in Russland passiert ist!" Es ist völlig verständlich, wenn die Bourgeoisie so denkt: Es befindet sich in einer Linie mit ihren Interessen als eine privilegierte, ausbeutende Klasse. Doch dies bedeutet nicht, dass die Bourgeoisie selbst etwa nicht entfremdet ist. Im Gegenteil, wie Marx und Engels schrieben: "Die besitzende Klasse und die Klasse des Proletariats stellen dieselbe menschliche Selbstentfremdung dar. Aber die erste Klasse fühlt sich in dieser Selbstentfremdung wohl und bestätigt, weiß die Entfremdung als ihre eigne Macht und besitzt in ihr den Schein einer menschlichen Existenz; die zweite fühlt sich in ihrer Entfremdung vernichtet, erblickt in ihr ihre Ohnmacht und die Wirklichkeit einer unmenschlichen Existenz." (Marx/Engels, Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik, MEW Bd. 2, S. 37)
Doch auch die Arbeiter sind, wie furchtbar ihre Ausbeutung, wie unmenschlich ihre Lebensbedingungen auch immer sein mögen, von solchen Argumenten beeindruckt worden, was so weit ging, dass sie eigentlich jegliche Hoffnung auf ihre eigene Emanzipation haben fahren lassen. Diese Verzweiflung hat alle Arten von Theorien aufblühen lassen, besonders jene von Professor Marcuse (1), derzufolge die Arbeiterklasse nicht mehr eine revolutionäre Klasse sei, sondern in das System integriert sei, so dass die einzige Hoffnung für die Revolution in den Randschichten liege, bei jenen, die aus der heutigen Gesellschaft ausgeschlossen sind, wie die ‚die Jungen', ‚die Farbigen', ‚Frauen', ‚Studenten' oder die Völker der Dritten Welt. Andere gelangten zur Idee, dass die Revolution das Werk einer ‚universellen Klasse' sei, die nahezu jeden in der Gesellschaft um sich sammelt.
Was sich wirklich hinter den Theorien über die "Integration" der Arbeiterklasse verbirgt, das ist eine kleinbürgerliche Geringschätzung der Klasse (daher der Erfolg dieser Theorien im Milieu des intellektuellen und studentischen Kleinbürgertums). Für die Bourgeois und für die Kleinbürger, die in den Fußstapfen Ersterer folgen, sind die Arbeiter nichts anderes als arme Blödmänner, denen es am Willen oder am Intellekt fehlt, um etwas aus ihrem Leben zu machen. Sie würden ihr ganzes Leben lang verroht werden: Statt aus ihren Umständen auszubrechen, vertrödelten sie ihre Freizeit in der Kneipe oder vor dem Fernseher, das Einzige, was ihr Interesse wecke, sei das Pokalfinale oder der letzte Skandal. Und wenn sie etwas forderten, dann sei es eine lumpige Lohnerhöhung, damit sie durch die "Konsumgesellschaft" noch entfremdeter werden.
Es ist klar, dass angesichts des offenkundigen Fehlens von Bewegungen der Randschichten, die angeblich die herrschende Ordnung umstürzen sollen, jene, die solchen Theorien anhingen, heute jegliche Perspektive einer Gesellschaftsänderung aufgegeben haben. Die Klügsten unter ihnen werden zu "neuen Philosophen" oder Funktionären der sozialdemokratischen Parteien, die weniger gut Bemittelten driften in den Skeptizismus, die Demoralisierung, Drogen oder in den Selbstmord ab. Hat man einmal begriffen, dass es nicht von "allen gut gesinnten Menschen" (wie die Christen glauben), von der universellen Klasse (wie Invarianz (2) glaubt), von den hoch gerühmten Randschichten oder von den Bauern der Dritten Welt abhängt, wie Mao und Che Guevara behaupteten, dann ist man in der Lage zu sehen, dass die einzige Hoffnung auf eine Regeneration der Gesellschaft in der Arbeiterklasse liegt. Da sie aber eine statische Sichtweise von der Arbeiterklasse haben, glauben die Skeptiker von heute nicht, dass die Arbeiterklasse imstande ist, eine Revolution zu machen.
Schon 1845 entgegneten Marx und Engels auf solche Einwände mit folgenden Worten: "Es handelt sich nicht darum, was dieser oder jener Proletarier oder selbst das ganze Proletariat als Ziel sich einstweilen vorstellt. Es handelt sich darum, was es ist und was es diesem Sein gemäß geschichtlich zu tun gezwungen sein wird." (Die heilige Familie..., S. 38)
Wenn man sich die Arbeiterklasse lediglich als eine Summe dessen vorstellt, was die einzelnen Glieder heute sind, dann - nein - wird eine Revolution niemals möglich sein. Doch solch eine Ansicht übersieht dabei zwei fundamentale Aspekte der Realität:
- Das Ganze ist stets mehr als eine Summe seiner Einzelteile.
- Realität ist Bewegung. Die Naturelemente sind genauso wenig wie die Elemente der menschlichen Gesellschaften unveränderlich. Aus diesem Grund sollte man es vermeiden, ein Photo von der gegenwärtigen Situation zu machen und anzunehmen, dies sei ewige Realität. Im Gegenteil, man muss begreifen, was genau dieses "historische Sein" des Proletariats ist, das es zum Kommunismus drängt.
Ausgebeutete Klasse und revolutionäre Klasse
Marx und Engels versuchten in Die heilige Familie, auf diese Frage zu antworten: "Wenn die sozialistischen Schriftsteller dem Proletariat diese weltgeschichtliche Rolle zuschreiben, so geschieht dies keineswegs, wie die kritische Kritik zu glauben vorgibt, weil sie die Proletarier für Götter halten. Vielmehr umgekehrt. Weil die Abstraktion von aller Menschlichkeit, selbst von dem Schein der Menschlichkeit, im ausgebildeten Proletariat praktisch vollendet ist, weil in den Lebensbedingungen des Proletariats alle Lebensbedingungen der heutigen Gesellschaft in ihrer unmenschlichsten Spitze zusammengefasst sind, weil der Mensch in ihm sich selbst verloren, aber zugleich nicht nur das theoretische Bewusstsein dieses Verlustes gewonnen hat, sondern auch unmittelbar durch die nicht mehr abzuweisende, nicht mehr zu beschönigende, absolut gebieterische Not - den praktischen Ausdruck der Notwendigkeit - zur Empörung gegen diese Unmenschlichkeit gezwungen ist, darum kann und muss das Proletariat sich selbst befreien." (S.38) Jedoch ist diese Antwort nicht ganz ausreichend. Diese Beschreibung der kapitalistischen Gesellschaft kann auch auf alle anderen Klassengesellschaften angewendet werden; sie gilt für alle ausgebeuteten Klassen. Diese Passage erklärt, warum das Proletariat, wie alle anderen ausgebeuteten Klasse auch, gezwungen ist aufzubegehren, doch sagt sie nicht, warum diese Revolte zur Revolution führen kann und muss, d.h. zum Sturz der einen Gesellschaft und ihrer Ersetzung durch eine andere, kurzum: warum die Arbeiterklasse eine revolutionäre Klasse ist.
Wie Skeptiker aller Art gerne hervorstreichen, reicht es nicht aus, eine ausgebeutete Klasse zu sein, um revolutionär zu sein. Und in der Tat war in der Vergangenheit das Gegenteil der Fall gewesen. Zu ihren Zeiten waren der Adel, der gegen die Sklavengesellschaft kämpfte, und die Bourgeoisie, die gegen den Feudalismus kämpfte, revolutionäre Klassen. Dies machte sie aber längst nicht zu ausgebeuteten Klassen: Im Gegenteil, sie waren beide ausbeutende Klassen. Andererseits mündeten die Aufstände der ausgebeuteten Klassen in diesen Gesellschaften - Sklaven und Leibeigene - nie in eine Revolution. Eine revolutionäre Klasse ist eine Klasse, deren Vorherrschaft über die Gesellschaft sich in Übereinstimmung mit der Etablierung und Ausweitung der neuen Produktionsverhältnisse befindet, die durch die Weiterentwicklung der Produktivkräfte ermöglicht wurden, zum Schaden der alten, verkümmernden Produktionsverhältnisse.
Da sowohl die Sklavengesellschaft als auch die Feudalgesellschaft nur weitere ausbeuterische Gesellschaften hervorrufen konnten - entsprechend dem Entwicklungsgrad der Produktivkräfte in jenen Epochen -, konnte die Revolution nur angeführt werden:
- von einer ausbeutenden Klasse und
- von einer Klasse, die nicht zu den Besonderheiten der niedergehenden Gesellschaft zählte, während jene Klassen, die es waren, nicht revolutionär sein konnten, entweder weil sie ausgebeutet wurden oder weil sie Privilegien zu verteidigen hatten.
Im Gegensatz dazu kann im Kapitalismus, der die Bedingungen entwickelt hat, die die Eliminierung aller Ausbeutung sowohl möglich als auch notwendig machen, die Revolution nur gemacht werden:
- von einer ausgebeuteten Klasse,
- von einer Klasse, die eine Besonderheit der kapitalistischen Gesellschaft ist.
Das Proletariat ist die einzige Klasse in der heutigen Gesellschaft, auf die beide Kriterien zutreffen; es ist die einzige revolutionäre Klasse in der heutigen Gesellschaft. Somit können wir nun auf den zentralen Einwand antworten, den zu behandeln sich der Artikel vorgenommen hat. Ja, das Proletariat ist eine entfremdete Klasse, betroffen von dem ganzen Gewicht der herrschenden bürgerlichen Ideologie; doch weil es die Masse des gesellschaftlichen Reichtums produziert und weil ihm immer mehr Bürden der kapitalistischen Krise aufgehalst werden, wird es zur Revolte gezwungen sein. Und im Gegensatz zu den Aufständen früherer ausgebeuteter Klassen ist der Aufstand des Proletariats kein verzweifelter: Er enthält in sich selbst die Möglichkeit von Revolution und Kommunismus.
Es könnte der Einwand erhoben werden, dass es Versuche einer proletarischen Revolution bereits gegeben habe, doch dass alle scheiterten. Aber genauso wenig wie die Tatsache, dass die Pest Jahrhunderte lang die Menschheit dezimierte, bedeutete, dass die Menschheit ewig an dieser Geißel litt, kann uns das Scheitern vergangener Revolutionen zum Schluss führen, dass die Revolution unmöglich ist. Was die revolutionäre Welle von 1917-23 hauptsächlich aufhielt, war die Tatsache, dass das Bewusstsein des Proletariats hinter seiner materiellen Existenz hinterher hinkte: Obwohl seine alten Kampfbedingungen obsolet geworden waren, nachdem der Kapitalismus erst einmal seinen Höhepunkt überschritten hatte und in seine dekadente Phase eingetreten war, war sich die Klasse damals dessen nicht bewusst. Daher durchschritt sie eine fürchterliche Konterrevolution, die sie jahrzehntelang zum Schweigen verurteilte.
Und auch wir können nicht so tun, als sei der Sieg sicher. Doch selbst wenn es auch nur den Hauch einer Chance gibt zu gewinnen, ist das, was in den heutigen Kämpfen auf dem Spiel steht, so folgenschwer, dass es, fern jeder Demoralisierung, die Energien all jener mobilisieren sollte, die aufrichtig eine andere Gesellschaftsform anstreben. Fern jeglicher Verachtung, Ignoranz oder Unterschätzung des gegenwärtigen Kampfes der Arbeiterklasse müssen wir die entscheidende Bedeutung dieser Schlachten verstehen. Da das Proletariat sowohl eine ausgebeutete als auch eine revolutionäre Klasse ist, bereiten seine Kämpfe gegen die Auswirkungen der Ausbeutung den Weg zur Abschaffung der Ausbeutung vor; seine Kämpfe gegen die Auswirkungen der Krise ebnen den Weg zur Zerstörung einer Gesellschaft, die sich in der Agonie befindet; und die Einheit und das Bewusstsein, die in diesen Kämpfen geschmiedet werden, sind der Ausgangspunkt für die Einheit und das Bewusstsein, die das Proletariat in die Lage versetzen, den Kapitalismus zu stürzen und eine kommunistische Gesellschaft zu erschaffen. FM
(1) Marcuse war in den 60er Jahren ein Guru der Studentenbewegung und des Drittwelt-Radikalismus.
(2) Invarianz war eine Gruppe, die in den 70er Jahren aus dem Bordigismus entstand und die Idee einer universellen Klasse entwickelte, die an Stelle des Proletariats die Revolution machen solle.
Was steckt hinter dem Mythos des 'vereinten Europas'?
- 1600 reads
Die lang erwartete Erweiterung der EU auf 25 Länder fand nun am 1. Mai 2004 statt. Und mit ihr natürlich auch grosse Festlichkeiten in den europäischen Hauptstädten. Wie nach dem Gipfel von Maastricht 1991 gab man uns Erklärungen über dieses grosse Europa, “ein Kontinent der endlich in seiner Ganzheit vereint ist” und über seinen Pazifismus(1). Und wegen der Wahlen vom 13. Juni konnten die Fanfaren der Bourgeoisie erneut erklingen. Gepriesen als historische Wende verkörpere die Vergrösserung der EU eine “wunderbare Maschine für den Export von Frieden und Stabilität”, die “prinzipiellen Errungenschaften” und “die bewundernswerte Vollendung Europas”(2).
Dass sich die Bourgeoisie selbst feiert, darf nicht Anlass für Illusionen sein. Wenn die Bourgeoisien sich untereinander verstehen, geschieht das auf Kosten der Arbeiter, ansonsten denken sie ausschliesslich daran sich zu bekämpfen.
Das Voranschreiten der europäischen Integration, welches vom allgemeinen Interesse der Regierungen Osteuropas verlangt wird, um eine Lasur von relativer Stabilität zu schaffen, damit das soziale und wirtschaftliche Chaos, welches durch die Implosion des Ostblocks entstanden ist, gedämmt werden kann, ist weit davon entfernt eine “ Einheit” zu sein. Als Hauptschauplatz von zwei Weltkriegen bildet Europa das Epizentrum der imperialistischen Spannungen, es gab nie die reelle Möglichkeit der Errichtung einer wirklichen Einheit, welche es erlauben würde, die gegensätzlichen Interessen der verschiedenen nationalen Bourgeoisien zu umgehen. Aufgrund seiner geographischen Situation ist Europa in Tat und Wahrheit im 20. Jahrhundert zum Schlüssel des imperialistischen Kampfes um die globale Herrschaft geworden(3).
Die EU, Ausdruck der imperialistischen Spannungen nach dem Zweiten Weltkrieg...
Zu einer gewissen Zeit gab die Teilung der Welt in zwei imperialistische Blöcke Europa eine gewisse Stabilität, als der EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) das Instrument der USA und des Westblocks gegen seinen russischen Rivalen war. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Errichtung der Europäischen Union von den USA unterstützt, um einen Wall gegen die Ansprüche der UdSSR in Europa zu bilden und um den Zusammenhalt des Westblocks zu verstärken. Obwohl vom amerikanischen “leadership” zusammengehalten und diszipliniert aufgrund der Notwendigkeit der Front gegen den gemeinsamen Feind, haben die bedeutsamen Spaltungen unter den wichtigsten europäischen Regierungen nie aufgehört zu existieren.
Der Zusammenbruch des Ostblocks 1989 hatte die Auflösung des gegnerischen Blocks und die Wiedervereinigung Deutschlands zur Folge, das nun zu einem höheren Rang unter den imperialistischen Mächten aufstieg und dazu entschlossen ist, von dieser Möglichkeit zu profitieren und sich an die Spitze eines potenziellen neuen Blocks gegen die USA zu stellen. Die Gründe für die Staaten des Westblocks “zusammen zu marschieren” sind jedoch unterschiedlich und dieses Phänomen hat seit 15 Jahren gravierend zugenommen. Und, entgegen allem Geschwätz über das unaufhaltsame Streben zur Vereinigung eines grossen Europas, ist die Tendenz viel eher hin zu einer Steigerung der Spannungen und unterschiedlichen Interessen innerhalb Europas.
Die historische Umgestaltung hat erneut den Kampf um die globale Hegemonie und die Neuverteilung der Karten auf dem Kontinent entfacht. Dieser erbitterte Kampf unter den Meistern des Friedens und der Demokratie um die Verteilung der Überreste des ehemaligen Ostblocks führte zum ersten Mal seit 1945, zur Rückkehr des Krieges in Europa Anfang der 90er Jahre in Ex-Jugoslawien (und zur Bombardierung einer europäischen Hauptstadt durch die Mächte der NATO, nämlich Belgrad 1999). Damals stellten sich Frankreich, Grossbritannien und die USA, die untereinander selbst Rivalen sind, zusammen gegen eine deutsche Expansion Richtung Mittelmeer via Kroatien. Auch der Krieg im Irak hat das vollständige Fehlen einer Einheit und die grundsätzlichen Uneinigkeiten und Rivalitäten zwischen den europäischen Nationen gezeigt.
...die sich nach dem Kalten Krieg noch verstärken
Seit 1989 meldet Deutschland unter dem Deckmantel des europäischen Aufbaus unaufhörlich seine imperialistischen Ansprüche auf sein traditionelles Ausdehnungsgebiet “Mitteleuropa” an. Deutschland setzt auf sein wirtschaftliches Gewicht, dem gegenüber die Länder in Osteuropa nichts Gleichwertiges in die Waagschale werfen können, und auf die durch die Erweiterung geschaffene institutionelle Annäherung, um diese Länder an seine Einflusssphäre anzukoppeln. Die deutsche Bourgeoisie stösst dabei aber einerseits auf das Gesetz des Jeder-für-sich, nach welchem sich jede dieser Nationen richtet, andererseits auf die Entschlossenheit der USA, selber auf dem Umweg über die NATO ihren Einfluss geltend zu machen. “Fünf der neuen Mitglieder - Estland, Lettland, Litauen, Slowakei und Slowenien - sind am 29. März in Washington mit grossem Pomp in die NATO aufgenommen worden, ein Monat vor ihrem Beitritt zur EU. Ungarn, Polen und die Tschechische Republik sind schon seit 1999 Teil der Allianz. Die USA führen bereits eine Kampagne zugunsten eines EU-Beitritts von Bulgarien und Rumänien, der beiden weiteren Partner der NATO.” (4) Die USA setzen auf die Länder des “neuen Europa”, um ihren gefährlichsten Rivalen zu lähmen und rechnen damit, dass “sich die EU umso weniger vertiefen wird, je mehr sie sich vergrössert, und dies wird die Bildung eines politischen Gegengewichts zur amerikanischen Vormacht erschweren”(4), wie dies das Tauziehen um die bevorstehende Annahme der EU-Verfassung beweist.
Während Deutschland im Osten trotz des herrschenden Jeder-für-sich seine Möglichkeiten zur Ausdehnung des imperialistischen Einflusses verstärkt, stösst es umgekehrt im Westen sowohl auf Frankreich als auch auf Grossbritannien, die auf die potenzielle Entwicklung des deutschen Imperialismus reagieren müssen.
Grossbritannien hat seinerzeit die Maastrichter Verträge abgelehnt und spielt seither die Rolle des Wasserträgers der USA; es unternimmt alles, um Zwietracht unter den europäischen Mächten zu säen. Grossbritannien ist der wichtigste Beistand der amerikanischen Intervention im Irak, hat aber dadurch nicht nur die Konsequenzen des Misserfolgs der USA mitzutragen, sondern wird in Europa auch zusehends isolierter. Die Entwicklung des irakischen Fiaskos hat die “pro-amerikanische” Koalition zwischen London, Madrid und Warschau zerschlagen, die eigentlich ein Gegengewicht zu den französisch-deutschen Ambitionen hätte darstellen sollen. Das Umschwenken der neuen Regierung von Zapatero auf einen pro-europäischen Kurs und der entsprechende Rückzug der spanischen Truppen aus dem Irak beraubten die Koalition des wichtigsten Partners in Europa. Dieses Überlaufen führte dazu, dass Polen, das gespalten und hin- und hergerissen ist bei der Wahl seiner imperialistischen Ausrichtung, in eine Regierungskrise gestürzt wurde, die mit dem Rücktritt des Ministerpräsidenten und dem faktischen Zusammenbruch der Regierungspartei endete. Trotz aller Schwierigkeiten wird Grossbritannien gezwungen sein, seine Sabotagearbeit gegenüber jedem dauerhaften Bündnis auf dem europäischen Festland fortzusetzen.
Frankreich träumte seit den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts davon, sich der amerikanischen Vormundschaft zu entledigen, und wird nie akzeptieren, dass sich Deutschland ein Europa nach seinen Wünschen zusammenzimmert. Erst recht wird sich Frankreich nicht mit der untergeordneten Rolle abfinden, die ihm Deutschland im Rahmen der europäischen Erweiterung vorbehalten will. Deshalb hofft Frankreich, dass es in der Verstärkung und Erweiterung der EU die Mittel finden wird, um eine “gemeinschaftliche” Kontrolle sicherzustellen, die den deutschen Ehrgeiz zügelt. Aus diesem Grund knüpft Frankreich auch wieder die “historischen” Verbindungen zu Polen und Rumänien und greift neuerdings ebenfalls auf die Beziehungen zu Russland zurück, die bereits entstanden waren, als es darum ging, sich gemeinsam der amerikanischen Intervention im Irak zu widersetzen. Russland ist übrigens absolut an diesem “Bündnis” mit Frankreich interessiert, da es selber Anlass zur Besorgnis angesichts des Verlustes seiner Einflusssphäre in Osteuropa hat; die EU und die NATO haben sich ja mittlerweile bis an die russischen Staatsgrenzen ausgeweitet. So zielt es darauf ab, Deutschland vom Westen und vom Osten her in die Zange zu nehmen. Innerhalb der EU mobilisiert sich Frankreich, um den Einfluss auf die südeuropäischen Länder, insbesondere Spanien, angesichts der Vormachtstellung Deutschlands zurück zu gewinnen. Und wenn Frankreich die britischen Angebote zur Entwicklung der europäischen Verteidigung und zum gemeinsamen Bau eines Flugzeugträgers annimmt, so geschieht dies mit der Absicht, den Trumpf der militärischen Stärke, welche Deutschland eben nicht hat, diesem Land gegenüber in den Händen zu behalten.
Wie passen diese Umstände zur ganzen Kampagne über die “europäische Einheit”? Die Propaganda ist ideologischer Natur und soll die Illusionen über die kapitalistische Welt aufrecht erhalten, die in Tat und Wahrheit aus allen Poren nach Verwesung und Elend stinkt.
Der Sog zum Chaos und das Gesetz des “Jeder-für-sich” sind keineswegs ein den Ländern des ehemaligen Ostblocks und der “Dritten Welt” vorbehaltenes Schicksal. Mit dem Verschwinden der beiden Blöcke wurde das Tor zu einer Entfesselung von neuen Kriegen aufgestossen, in denen jeder gegen jeden kämpft; Europa befindet sich im Zentrum der imperialistischen Gegensätze, was schon für sich allein jeden Gedanken an eine Einheit der verschiedenen nationalen Kapitale illusorisch macht. Vielmehr führt die Logik der geschilderten Entwicklung dazu, dass Europa letztlich der Schauplatz der imperialistischen Auseinandersetzung bleiben wird: Auf der einen Seite steht die Entschlossenheit der USA, ihre Überlegenheit auf der ganzen Welt um jeden Preis aufrecht zu erhalten, wobei Grossbritannien zur eigenen Interessenwahrung im Kielwasser der USA fährt; auf der anderen Seite wächst die Macht von Deutschland an, das sich je länger je mehr als Rivale der USA emporarbeitet.
(1) Le Monde, 2/3. Mai 2004
(2) Le Monde 4. Mai 2004
(3) siehe Internationale Revue Nr. 31, “Europa: Wirtschaftsbündnis und Terrain imperialistischer Manöver”
(4) Le Monde vom 29. April 2004
Scott (aus Révolution Internationale Nr. 347)
Öffentliche Diskussionsveranstaltung des IBRP in Paris (2. Teil)
- 1600 reads
Öffentliche Diskussionsveranstaltung des IBRP in Paris (2. Teil) Politische Leere und mangelnde Methode des IBRP
In dem ersten Teil dieses Artikels zur öffentlichen Veranstaltung des IBRP in Paris am 2. Oktober zum Thema „Warum der Krieg im Irak?“ (unsere Leser finden den ersten Teil auf unserer Webseite im Internet) haben wir aufgezeigt, wie die prinzipienlose Umgruppierungspolitik des IBRP diese linkskommunistische Organisation dazu geführt hat, dass das IBRP von einer parasitären Gruppe (einer selbsternannten ‚Internen Fraktion der IKS‘) als Geisel genommen wird (). In diesem zweiten Teil des Artikels wollen wir über die Debatte zum Irakkrieg berichten.
Öffentliche Diskussionsveranstaltung des IBRP in Paris (2. Teil) Politische Leere und mangelnde Methode des IBRP
In dem ersten Teil dieses Artikels zur öffentlichen Veranstaltung des IBRP in Paris am 2. Oktober zum Thema „Warum der Krieg im Irak?“ (unsere Leser finden den ersten Teil auf unserer Webseite im Internet) haben wir aufgezeigt, wie die prinzipienlose Umgruppierungspolitik des IBRP diese linkskommunistische Organisation dazu geführt hat, dass das IBRP von einer parasitären Gruppe (einer selbsternannten ‚Internen Fraktion der IKS‘) als Geisel genommen wird[1]. In diesem zweiten Teil des Artikels wollen wir über die Debatte zum Irakkrieg berichten.
Wir haben (insbesondere in unserer Presse) immer die Notwendigkeit betont, dass die Organisationen, welche sich auf die Kommunistische Linke berufen, eine öffentliche Debatte führen, ihre jeweiligen Positionen den anderen gegenüberstellen, damit die nach einer Klassenperspektive suchenden Leute sich eine klare Vorstellung von den verschiedenen im proletarischen Lager vorhandenen Positionen machen können.
Eine Analyse mit variabler Geometrie?
Obgleich das IBRP (wie die Organisationen, die es gegründet haben, die IntKP und die CWO) immer den proletarischen Internationalismus gegenüber den schlimmsten, von der Bourgeoisie verübten nationalistischen Horrortaten verteidigt hat, erfasste seine Analyse der verschiedenen kriegerischen Konflikte während der letzten 20 Jahre überhaupt nicht das Wesentliche. Bezüglich des gegenwärtigen Irakkrieges hat das IBRP in seinem Einleitungsreferat die Analyse wiederholt, der zufolge dieser neue Krieg auch eine ökonomische Rationalität verfolge (die Ölrente und die Kontrolle der Ölquellen durch die USA). Diese Analyse hatte das IBRP schon in der Vergangenheit vertreten, insbesondere während des Afghanistankrieges 2001.
„Die USA brauchen den Dollar als gültige Währung im internationalen Handel, wenn sie ihre Stellung als globale Supermacht bewahren wollen. Vor allem sind die USA verzweifelt darum bemüht sicherzustellen, dass der internationale Ölhandel auch weiterhin primär in Dollars abgewickelt wird. Dies bedeutet, bei der Bestimmung der Routen für die Öl- und Gaspipelines und vor allem bei der Beteiligung von kommerziellen US-Interessen an der Ausbeutung der Quellen das letzte Wort zu haben. Dies steckt dahinter, wenn offen kommerzielle Entscheidungen durch die sie überwölbenden Interessen des US-Imperialismus als Ganzes gemäßigt werden, wenn der amerikanische Staat politisch und militärisch für langfristige Ziele eingespannt wird, Ziele, die sich oft gegen die Interessen anderer Staaten und in steigendem Maße gegen jene ihrer europäischen ‚Verbündeten‘ richten. Mit anderen Worten, dies ist der Kern der imperialistischen Konkurrenz im 21. Jahrhundert“ (zitiert aus Revolutionary Perspectives Nr. 23, in Internationale Revue Nr. 29, S. 29).
Auch während des ersten Golfkrieges 1991 hatte das IBRP eine ähnliche Analyse verfochten: „Die Golfkrise ist wirklich wegen des Öls und der Frage, wer das Öl kontrolliert, ausgebrochen. Ohne billiges Öl werden die Profite fallen. Die Profite des westlichen Kapitalismus werden bedroht, und aus diesem Grund – und keinem anderen – bereiten die USA ein neues Blutbad im Mittleren Osten vor“ (International Review Nr. 64, engl. Ausgabe).
In Anbetracht der nicht zu leugnenden Entwicklung der Wirklichkeit ist das IBRP aber hinsichtlich des Irak-Kriegs dazu gezwungen gewesen, seine Analyse ein wenig zu ändern. So hat das IBRP in seinem Einleitungsreferat drei Hauptgründe erwähnt, die die Auslösung dieses neuen Krieges erklären sollen:
1)geostrategische Gründe;
2)die Verteidigung des Dollars als dominante Währung und die Ölrente;
3)die Kontrolle der Ölförderung während der nächsten 20 Jahre.
Nach dem Einleitungsreferat hat die IKS das Wort ergriffen, um aufzuzeigen, dass die amerikanische Offensive hauptsächlich strategische Ziele verfolgt. Während die Frage des Öls eine wichtige Rolle spielt, ist dies hauptsächlich nicht auf ökonomische Faktoren zurückzuführen, sondern vornehmlich auf strategische und militärische. Wir haben daran erinnert, dass das Öl nicht erst seit heute und auch nicht erst seit den 1960er Jahren strategisch wichtig ist, sondern seit der Zeit vor dem 1. Weltkrieg, als die Armeen mechanisiert wurden.
In unseren Redebeiträgen haben wir unterstrichen, dass das Einleitungsreferat des IBRP insofern einen gewissen Fortschritt des IBRP darstellt, als dieses bei der Liste der Ursachen der amerikanischen Offensive im Irak an erster Stelle „geostrategische“ Faktoren nannte. Trotz seiner mechanistischen und reduktionistischen Auffassung hinsichtlich der Verbindung zwischen Wirtschaftskrise und Krieg (ein Merkmal des Vulgärmaterialismus), kann das IBRP nicht völlig die Augen verschließen vor nicht zu leugnenden Tatsachen: Mehr als 10 Jahre später sind die Transportwege des Öls im Afghanistan durch den Krieg nicht sicherer geworden, sondern im Gegenteil zum Teil zerstört.
Leider waren wir ein wenig zu optimistisch, als wir behaupteten, dass das IBRP bei seinen Analysen einen gewissen Fortschritt gemacht habe.
Der Genosse des IBRP, der das Einleitungsreferat vorgetragen hatte, hat unseren Redebeitrag ‚korrigiert‘, als er behauptete, wir hätten den Inhalt des Einleitungsreferates nicht richtig gehört (oder nicht richtig verstanden), denn egal in welcher Reihenfolge die Ursachen erläutert worden seien, die ‚strategischen Ursachen‘ der US-Offensive im Irak seien aus der Sicht des IBRP zweitrangig. Der Genosse meinte gar, das IBRP hätte uns das Einleitungsreferat schriftlich zur Verfügung stellen sollen, damit wir jedes ‚Missverständnis‘ vermeiden. Nach der Diskussionsveranstaltung hat das IBRP auf seiner Webseite dieses Einleitungsreferat veröffentlicht. Dort kann der Leser nachlesen und sich davon überzeugen, dass der Hauptfaktor, den das IBRP als Erklärung vorgetragen hatte, sehr wohl der ist, den wir vernommen hatten: „Wenn das schwarze Gold bei den Überlegungen Washingtons gegenüber dem Irak einfließt, dann eher aus strategischen als aus ökonomischen Gründen. Durch diesen Krieg soll eher die US-Hegemonie verewigt – und somit Garantien für die Zukunft aufgebaut werden – als sofort die Gewinne von Exxon zu steigern.“ Das kann man klarer nicht ausdrücken (und wir sind mit dieser Analyse voll einverstanden)!
So hat dieser kleine Winkelzug des IBRP, zu behaupten, die IKS habe „schlecht gehört“ oder „schlecht verstanden“, es dem IBRP während der ganzen Diskussion ermöglicht, der Frage der „strategischen Ursachen“ des Irakkriegs auszuweichen. In Wirklichkeit versuchte das IBRP dadurch zu vertuschen, dass seine Analysen „geometrisch variabel“ sind oder dass die Genossen des IBRP nicht alle mit den 'offiziellen‘ Analyen ihrer eigenen Organisation einverstanden sind.
Die Argumente der IKS
In unseren Redebeiträgen haben wir betont, dass der Krieg seit dem Beginn der Dekadenz des Kapitalismus anfangs des 20. Jahrhunderts jegliche ökonomische Rationalität für das Kapital als Ganzes, aber auch mehr und mehr für jeden einzelnen Staat verloren hat. Wir haben daran erinnert, dass das Konzept der Dekadenz keine Erfindung der IKS ist, da auch die Kommunistische Internationale 1919 dieses Konzept vertreten hat. Auch ist die Analyse der Irrationalität des Krieges im Zeitraum der Dekadenz keine tolle Erfindung der ‚Idealisten‘ der IKS. Schon die Kommunistische Linke Frankreichs (Gauche Communiste de France – GCF), auf die sich die IKS immer berufen hat, hatte diese Analyse schon vertreten, als sie behauptete, dass in der Niedergangsphase des Kapitalismus "die Produktion im Wesentlichen auf die Produktion von Zerstörungsmitteln ausgerichtet ist, d.h. im Hinblick auf den Krieg. Der Niedergang der kapitalistischen Gesellschaft spiegelt sich am deutlichsten in der Tatsache wider, dass die Kriege nicht mehr wie in der aufsteigenden Phase des Kapitalismus die wirtschaftliche Entwicklung fördern, sondern dass die Wirtschaft in der Dekadenz hauptsächlich auf den Krieg ausgerichtet ist“ (Bericht auf der Konferenz der GCF, Juli 1944, zitiert in „Der historische Kurs“, Internationale Revue Nr. 5).[2]
Wir haben ebenso verdeutlicht, wie das IBRP, wenn es das – auf ökonomischer Ebene - irrationale Wesen des Krieges in der Dekadenz und ihre zunehmende Irrationalität in der Endphase dieses Niedergangs (die Zerfallsphase des Kapitalismus) verwirft, keinen Unterschied mehr macht zwischen der Funktion der Kolonialkriege und dem Aufbau der Nationalstaaten im 19. Jahrhundert einerseits und den Kriegen, die seit 1914 die Welt verwüstet haben, andererseits.
Wir haben daran erinnert, dass im 19. Jahrhundert die Kriege „rentabel“ waren. Sie erfüllten eine ökonomische Rationalität (da sie die Ausdehnung des Kapitalismus auf den ganzen Erdball ermöglichten), während sie im 20. Jahrhundert einen immer irrationaleren Charakter annahmen. Und dies ist heute noch offensichtlicher: Mit dem Eintritt des Kapitalismus in seine Zerfallsphase (die mit dem Auseinanderbrechen der beiden, aus dem 2. Weltkrieg hervorgegangenen imperialistischen Blöcke eröffnet wurde) hat diese Irrationalität auf wirtschaftlicher Ebene eine höhere Stufe erreicht, wie die Lage auf dem Balkan oder in Tschetschenien zeigt.
So wird die 1945 auf der Konferenz von Jalta festgelegte Weltordnung heute ersetzt durch einen Zeitraum des weltweiten Chaos, wo auf imperialistischer Ebene ‚jeder für sich‘ kämpft.
Die Kurzsichtigkeit des IBPR führt dazu, dass es nicht sieht, wie die imperialistische Logik des Kapitalismus in seiner Niedergangsphase immer mehr nur der eigenen Logik folgt: Der grenzenlosen Flucht nach vorn in den Krieg und eine wachsende Barbarei.
Die Redebeiträge der IKS haben ebenso die Folgen der Analyse des IBRP aufgezeigt, der zufolge der Krieg der USA gegen den Irak noch eine ökonomische Rationalität besäße (insbesondere die berühmte ‚Ölrente‘). Diese Auffassung lässt in Wirklichkeit das IBRP die wirklichen Gefahren der gegenwärtigen historischen Lage (das blutige Chaos entfaltet sich immer mehr) unterschätzen und damit das, was für die Arbeiterklasse und die Zukunft der Menschheit auf dem Spiel steht.
Wir haben in dieser Diskussionsveranstaltung ebenso an den Rahmen erinnert, anhand dessen die IKS die Ursachen dieses neuen Krieges im Irak festmacht: „Auf dem Hintergrund des Bankrotts des Kapitalismus und des Zerfalls der bürgerlichen Gesellschaft zeigt uns die Wirklichkeit, dass die einzige mögliche Politik einer jeden Großmacht darin besteht, den anderen Schwierigkeiten zu bereiten, um zu versuchen, ihnen die eigenen Interessen aufzuzwingen. Dies sind die kapitalistischen Gesetze. So sind diese sich immer mehr ausdehnende Instabilität, die wachsende Anarchie und das Chaos keine Besonderheit dieses oder jenes exotischen oder rückständigen Gebietes der Erde, sondern das Ergebnis des Kapitalismus in der gegenwärtigen unumkehrbaren Zerfallsphase. Und da der Kapitalismus die Welt beherrscht, wird die ganze Welt mehr und mehr diesem Chaos unterworfen“ (Internationale Revue, Nr. 118).
Die mangelnde Ernsthaftigkeit der Argumente des IBRP
Das IBRP war nicht in der Lage, auf unsere Argumente mit einem Mindestmaß an Ernsthaftigkeit zu antworten. Was unsere Analyse des Zerfalls des Kapitalismus angeht, war das einzige politische Argument, das man vom IBRP hören konnte, dass es erneut den ‚Idealismus‘ der IKS mit einem unpassenden Sarkasmus anprangerte, als einer ihrer Vertreter sagte, „mit eurer Analyse des Zerfalls findet man alles zusammengeworfen in einem Topf, Chaos, Gott, die Engel...“!
Aber das ist nicht alles. Wir waren verblüfft, Argumente zu hören, bei denen sich Marx und Engels im Grabe herumgedreht hätten.
1) Wir stellten die Frage: „Vertritt das IBRP heute noch den Standpunkt, wenn ein Dritter Weltkrieg vor dem Zusammenbruch des Ostblocks nicht stattgefunden hat, dann deshalb, weil es Atombomben und ein ‚Gleichgewicht des Schreckens‘ gab?“ Anfänglich wollte kein Mitglied des IBRP auf unsere Frage antworten. Und erst nachdem wir die Frage zum dritten Mal gestellt hatten, hat ein Genosse des IBRP die Güte gehabt uns sehr knapp zu antworten, ohne auch nur irgendein Argument zu liefern: Das Gleichgewicht des Schreckens sei ‚einer der Faktoren‘, der erklärt, weshalb die Bourgeoisie einen dritten Weltkrieg nicht auslösen konnte... Kurzum, die klassische Analyse der herrschenden bürgerlichen Kreise, die jahrzehntelang gegenüber den Arbeitern den furchtbaren Rüstungswettlauf im Namen des ‚Schutzes des Friedens‘ gerechtfertigt haben. Wir verzichten auf jeden Kommentar!
Alle bei dieser Diskussionsveranstaltungen anwesenden suchenden Leute, die Zeuge wurden, wie das IBRP die Allgemeinheiten der bürgerlichen Propaganda wiederkäute, kamen bei diesem Treffen nicht auf ihre Kosten. Am Ende des Treffens waren sie nicht schlauer darüber, was „die anderen Faktoren“ waren, die ein Hindernis für die Auslösung eines dritten Weltkriegs darstellten (und vor allem, welcher ausschlaggebend ist). Dagegen hat die IKS auf dem Treffen unterstrichen, dass der Hauptfaktor darin besteht, dass seit dem Ende der 1960er Jahre ein neuer historischer Kurs (hin zu verstärkten Klassenzusammenstößen) eröffnet wurde, womit der lange Zeitraum der Konterrevolution zu Ende ging, unter der das Proletariat nach der Niederlage der revolutionären Welle von Kämpfen 1917-23 gelitten hat. Wenn ein dritter Weltkrieg nicht ausgebrochen ist, dann nicht, weil es Atomwaffen und ein ‚Gleichgewicht des Schreckens‘ gab, sondern weil die Arbeiterklasse nicht bereit war, ihr Leben für ein Vaterland zu opfern.
2)Hinsichtlich der marxistischen Analyse der Dekadenz des Kapitalismus antwortete uns ein Sprecher des IBRP folgendes: „Ich habe genug davon, seit 25 Jahren mit der IKS zu diskutieren.“ Tatsächlich ist die IKS so ‚engstirnig‘, dass sie immer noch nicht das ABC des Marxismus begreifen will, der uns (nach der Aussage des Sprechers des IBRP) lehrt, dass „man im Kapitalismus zwei Dinge unterscheiden muss: die Gesellschaftsformation und die Produktionsform. Man kann sagen, dass es eine Dekadenz der Gesellschaftsformation gibt (auch wenn ich den Begriff ‚Dekadenz‘ nicht mag), aber die Produktionsform ist nicht dekadent. Denn wenn es keine gesellschaftliche Revolution gibt, werden die beiden weiterhin fortbestehen, mit einem Versinken der Gesellschaft in der Barbarei.“
Vorsichtig formuliert (es stimmt, wenn es zu keiner Revolution kommt, versinkt die Gesellschaft in der Barbarei) hat das IBRP in aller Ruhe behauptet, dass der Kapitalismus als ‚Gesellschaftssystem‘, d.h. auf der Ebene des Überbaus (herrschende Ideologie, Kultur, Freizeit, Sitten, Moral usw.) dekadent sein könnte, aber nicht als ‚Wirtschaftssystem‘, d.h. auf der Ebene der Basis (auf der Ebene der Produktionsform und der Art und Weise, wie die Menschen sich organisiert haben, um für ihre Existenz zu produzieren).
Im Namen des Marxismus, des ‚Materialismus‘ und natürlich gegen die ‚idealistische‘ Auffassung der IKS, wurde der IKS solch eine Lektion der ‚Dialektik‘ erteilt. Wir wollen es Marx überlassen, solchen Unfug zu widerlegen: „Hieraus geht hervor, dass eine bestimmte Produktionsweise oder industrielle Stufe stets mit einer bestimmten Weise des Zusammenwirkens oder gesellschaftlichen Stufe vereinigt ist, und diese Weise des Zusammenwirkens ist selbst eine ‚Produktivkraft (...) Die Produktion der Ideen, Vorstellungen, des Bewussteins ist zunächst unmittelbar verflochten in die materielle Tätigkeit und den materiellen Verkehr der Menschen, Sprache des wirklichen Lebens “ (Deutsche Ideologie, MEW, Bd 3, S. 30 u. S. 26). So scheint das IBRP die „Sprache des wirklichen Lebens“ zu ignorieren. Aber wie Spinoza meinte, ist „Unwissenheit kein Argument“!
Aus marxistischer Sicht beeinflusst der Aufstieg wie der Niedergang einer Produktionsform alle Aspekte der Gesellschaft, denn der Zustand der Basis (die Wirtschaft) bestimmt den des Überbaus (das Gesellschaftsleben), auch wenn die Entwicklung oder der Rückschritt einer Zivilisation sich nicht gleichmäßig in allen Bereichen entfaltet. Das Gegenteil zu behaupten ist weder materialistisch noch marxistisch. Damit verfällt man dem dümmsten Idealismus.
3)Während der Diskussion hat einer unserer Sympathisanten das IBPR gefragt: „Wenn man eurer Analyse des Zyklus „Krise, Expansion, neue Krise usw. folgt, was haltet ihr von den nationalen Befreiungskämpfen? Wären sie heute noch unterstützenswert? Heißt dies, dass die Gewerkschaften noch Arbeiterorganisationen sind?“
Auf die Frage nach den nationalen Befreiungsbewegungen hat das IBRP überhaupt nicht geantwortet. Dagegen hat ein Genosse des Präsidiums behauptet, wenn das IBRP keine Arbeit in den Gewerkschaften befürwortet, dann „weil die Erfahrung bewiesen hat, dass man da nichts ausrichten kann, aber nicht weil der Kapitalismus dekadent wäre.“ Wir haben danach das IBRP gefragt, ob es damit die Position der IntKP von 1947 verwirft, die in ihren „Thesen zu den Gewerkschaften heute und kommunistische Aktivitäten“ (die auf dem 4. Kongress der IntKP verabschiedet wurden) unterstrich: „In der gegenwärtigen Phase der Dekadenz der kapitalistischen Gesellschaft sind die Gewerkschaften ein wesentliches Instrument der konservativen Politik und deshalb übernehmen sie genau die Funktion eines staatlichen Organismus“ (von der IKS hervorgehoben).
Der Genosse des Präsidiums, der auf die Frage nach dem Wesen der Gewerkschaften geantwortet hatte, schien sehr überrascht zu sein, dass das IBRP oder die IntKP solch eine Auffassung vertreten konnte. Offensichtlich schien er diese programmatische Position seiner eigenen Organisation erst zu entdecken (obwohl diese doch auch auf der Webseite des IBRP veröffentlicht ist)!
Jedenfalls kann die Infragestellung der Analyse der Dekadenz des Kapitalismus, so wie sie von der Kommunistischen Internationale formuliert wurde, das IBRP nur dazu bringen, gewisse Positionen seiner eigenen Plattform zu ‚revidieren‘.
Die mangelnde Ernsthaftigkeit in der Debatte
Abgesehen von unseren Redebeiträgen in der Debatte und den von unseren Sympathisanten gestellten Fragen (auf die das IBRP entweder nicht oder zumindest sehr konfus geantwortet hat) wollen wir auf den Redebeitrag eines Anhängers des rätistischen Milieus (den wir seit langem kennen) hinweisen. Er kritisierte vor allem unsere Auffassung von der Dekadenz des Kapitalismus (die sich auf die Theorie der Sättigung der Märkte, wie sie von Rosa Luxemburg in der „Akkumulation des Kapitals“ entwickelt wurde, stützt). Auch er wollte uns erneut eine „Lektion in Marxismus“ erteilen, indem er behauptete, dass der Kapitalismus heute noch in der Phase der erweiterten Akkumulation stecke, wie beispielsweise die beeindruckende Entwicklung in China zeige.
Dieser Analyse (die heute von den ‚Experten‘ der herrschenden Klasse weit verbreitet wird) wurde von Seiten des IBRP nicht kritisiert. Die IKS hat deshalb das Wort ergriffen, um aufzuzeigen, dass die angebliche „wirtschaftliche Expansion“ Chinas auf Sand gebaut ist (siehe dazu den Artikel in Weltrevolution Nr. 127).
Einer der beiden Anhänger der IFIKS wollte in seinem langen (unverständlichen und völlig zusammenhanglosen) Beitrag aufzeigen, dass die Analyse der IKS (und auch der Komintern) von der Dekadenz des Kapitalismus absurd sei und außerhalb des Marxismus stünde.
Ebenso aufschlussreich waren die ‚Leistungen‘ der beiden ‚Tribunen‘ der IFIKS, die alles daran setzten, nicht zur Analyse des IBRP, wie sie vom Präsidium vertreten wurde, Stellung zu beziehen, sondern versuchten, die IKS-Analyse ‚auseinander zu nehmen‘[3].
Die mangelnde Ernsthaftigkeit der IFIKS wurde erneut durch das Verhalten von zwei ihrer Mitglieder (und ihrer beiden Anhänger) unter Beweis gestellt, die anstatt das Wort zu ergreifen, um eine politische Argumentation zu entwickeln, sich während des ganzen Treffens damit zufrieden gaben, zu grinsen und eine sarkastische Haltung an den Tag zu legen (und gar Beifall gegenüber den Kritiken an der IKS zu spenden, als ob diese Leute gekommen wären, um einem Fußballspiel beizuwohnen!). Diese mangelnde Ernsthaftigkeit hat übrigens auf dem Treffen die Teilnehmer, die sich auf der Suche nach Klärung befinden, zutiefst schockiert. Einer von ihnen hat das Wort ergriffen und gesagt, dass solch eine Haltung auf einem politischen Treffen ihn nicht dazu „ermutigt habe, sich an der Diskussion zu beteiligen“.
Es liegt auf der Hand: Wenn die IKS nicht anwesend gewesen wäre und keinen Diskussionsstoff geliefert hätte, hätte es keine kontroverse Debatte gegeben, keine Auseinandersetzung über die verschiedenen Positionen. Die IFIKS (die behauptet, „die wahre Verteidigerin der Plattform der IKS“ zu sein), hat sich davor gehütet, irgendeine Divergenz oder irgendeine Kritik an den Analysen des IBRP zur Sprache zu bringen. Zum Konzept der Dekadenz (das das IBRP ‚neu definiert‘, tatsächlich aber verwirft) haben die Mitglieder der IFIKS keinen Ton gesagt. Genauso haben sie schamhaft jede Auseinandersetzung mit dem IBRP zur Frage, warum die Bourgeoisie vor dem Zusammenbruch des Ostblocks keinen dritten Weltkrieg auslösen konnte, vermieden.
Deshalb ist die angebliche Öffnung hin zur öffentlichen Debatte, für die ‚Klärung‘ und die ‚Auseinandersetzung‘ der verschiedenen Standpunkte innerhalb des proletarischen Lagers, den die IFIKS beansprucht, nur ein Bluff, angereichert mit einer entsprechenden Portion Heuchelei. In Wirklichkeit ziehen das IBRP und die IKIKS, die eine ‚Einheitsfront gegen die IKS‘ errichten wollen, es vor, ihre Divergenzen zu verheimlichen und sie in ‚privaten‘ Treffen zu besprechen!
Wenn wir uns auf überhaupt keine ‚Debatte‘ mit den Leuten von der IFIKS (trotz ihrer provozierenden Redebeiträge) einlassen wollten, dann weil die IKS zu einer Veranstaltung des IBRP gegangen ist, und weil wir diese Leute der IFIKS daran hindern wollten, dass sie die Debatte sabotieren. Deshalb haben wir das Wort ergriffen, um auf die Argumente des IBRP zu antworten, nicht aber auf die der selbsternannten ‚Fraktion‘, die sich wie eine Diebesbande verhält (indem sie Material und Geld von der IKS gestohlen haben).
Und weil die IKS keine Angst vor der öffentlichen Auseinandersetzung über die Divergenzen mit dem IBRP hat, haben wir uns an dem Treffen beteiligt. Deshalb stimmen wir nicht mit der Position des IBRP überein (die auch am Ende des Treffens wiederholt wurde), der zufolge die Debatte zwischen der IKS und dem IBRP ‚zu nichts dient‘. Wir vertreten die Auffassung, dass öffentliche Debatten kein Wettkampf zwischen den Gruppen der Kommunistischen Linken sind, um zu wissen, wer der ‚Stärkere‘ ist oder wer am meisten Leute ‚erobert‘. Wenn wir für die öffentliche Debatte dieser Divergenzen eintreten, tun wir dies, um den suchenden Leuten zu ermöglichen, dass sie nicht nur die Positionen der IKS kennen, sondern auch die anderer Gruppen des proletarischen Lagers. Nur so können sie für sich selbst eine Klärung herbeiführen und auch entscheiden, in welcher Gruppe sie als Militante mitarbeiten wollen.
Gegenüber den nach einer Klassenperspektive suchenden Leuten ist es die Aufgabe der revolutionären Organisationen, Antworten auf all ihre Fragen zu liefern, sie mit einem Höchstmaß an Klarheit und Ernsthaftigkeit zu überzeugen. Ebenso müssen sie in ihren öffentlichen Veranstaltungen die Ernsthaftigkeit der politischen Debatte verteidigen, indem sie jegliche parasitäre Haltung verwerfen, die darin besteht, die Debatten durch Sarkasmen, Gekicher oder Beifall zu stören.
IKS, 18. 10.2004
Fußnoten:
1. Aus Platzgründen und um das Gleichgewicht unserer Zeitung nicht zu beeinträchtigen, veröffentlichen wir in unserer Zeitung nicht den ersten Teil des Artikels „Das IBRP – von Dieben als Geisel genommen“ (den wir auf unserer Webseite veröffentlicht haben). Wenn jedoch jemand keinen Zugang zum Internet hat, können wir ein gedrucktes Exemplar des ersten Teils des Artikels zuschicken. Wir schicken dann ebenfalls eine Kopie der Antwort, die das IBRP auf seiner Webseite mit dem Titel „Antwort auf eine auseinanderbrechende Organisation“ veröffentlicht hat.
2. Ein Mitglied der IFIKS versuchte in einem Redebeitrag unsere Auffassung von der Irrationalität des Krieges ‚lächerlich‘ zu machen, indem er uns ‚Revisionismus‘ vorwarf und uns gar vorhielt, wir seinen „Kautskyaner“! In Wirklichkeit sind diese Leute von der angeblichen ‚Fraktion‘ die wahren ‚Revisionisten‘, da sie heute die von der GCF entwickelte Analyse, auf die sich die IKS immer berufen hat, verwerfen. Somit verwerfen heute diese Renegaten, die von sich behaupten, ‚die wahren Verteidiger der programmatischen Positionen der IKS‘ zu sein, diese Grundposition unserer Plattform (um dem IBRP zu schmeicheln), auf den sich unser Rahmen der Analyse der Dekadenz des Kapitalismus stützt.
3. Und um die ‚kautskyschen‘ und ‚revisionistischen‘ Analysen der IKS zu bekämpfen, hörte man diejenigen, die das IBRP als die ehemaligen „Führer der alten Garde der IKS“ (sic!) bezeichnet, ‚Argumente‘ vorbringen, die an Kretinismus grenzen. So konnte man (neben anderen ‚Perlen‘ aus dem Mund der IFIKS) vernehmen: „Der Krieg im Irak stellt einen enorm wichtigen ökonomischen Gewinn für die USA dar“!; Im irakischen Morast „verstärkt die US-Armee ihre Position“. „Bevor es die Frage des Krieges begreifen kann, muss das Proletariat unter dem Krieg leiden und ihn an seinem eigenen Leib erleben“. Ohne Kommentar!
Öffentliche Veranstaltung des IBRP in Paris (1. Teil)
- 1687 reads
Am Samstag, 2. Oktober, wurde in Paris eine öffentliche Veranstaltung des IBRP zum Thema „Warum der Krieg im Irak?“ durchgeführt. Die IKS begrüßte diese Initiative des IBRP, wie sie auch die Abhaltung der öffentlichen Veranstaltungen in Berlin begrüßt hatte, über die wir in unserer Presse berichteten (vgl. Weltrevolution Nr. 124 und 125). Aber diese öffentliche Veranstaltung des IBRP in Paris stellte eine Besonderheit dar im Vergleich zu denjenigen, die in Deutschland durchgeführt worden waren: Ihre Abhaltung wurde nämlich beschlossen und organisiert durch eine parasitäre Gruppe, die sich selbst „Interne Fraktion der IKS“(IFIKS) nennt und dies lauthals in der in der Öffentlichkeit kundtut.
Am Samstag, 2. Oktober, wurde in Paris eine öffentliche Veranstaltung des IBRP[1] zum Thema „Warum der Krieg im Irak?“ durchgeführt. Die IKS begrüßte diese Initiative des IBRP, wie sie auch die Abhaltung der öffentlichen Veranstaltungen in Berlin begrüßt hatte, über die wir in unserer Presse berichteten (vgl. Weltrevolution Nr. 124 und 125). Aber diese öffentliche Veranstaltung des IBRP in Paris stellte eine Besonderheit dar im Vergleich zu denjenigen, die in Deutschland durchgeführt worden waren: Ihre Abhaltung wurde nämlich beschlossen und organisiert durch eine parasitäre Gruppe, die sich selbst „Interne Fraktion der IKS“(IFIKS) nennt und dies lauthals in der in der Öffentlichkeit kundtut.
Es ist diese Besonderheit, die es rechtfertigt, dass wir zunächst, d.h. vor dem Bericht über den Verlauf der Debatte und über die ausgetauschten Argumente zwischen IBRP und IKS betreffend die Analyse des Irakkrieges, einen ersten Teil dieses Artikels der Frage der „Zusammenarbeit“ zwischen IBRP und IFIKS widmen, die im Bulletin Nr. 27 der IFIKS (vgl. den „Bericht über eine Diskussion zwischen IBRP und der Fraktion“) angekündigt wurde.
Diese Frage zu behandeln scheint uns umso wichtiger, als der auf ihrer Website veröffentlichte Aufruf diese Veranstaltung wie folgt ankündigte:
„Seit dem Beginn der Krise, die die IKS gegenwärtig durchmacht und die die Gelegenheit der Bildung der „internen Fraktion“ dieser Organisation dargestellt hat, haben wir immer wieder eine peinliche Tatsache zu unterstrichen - eine ernsthafte Schwächung eines wichtigen proletarischen politischen Pols -, die sich vor allem in der Region von Paris darin ausgedrückt hat, dass die angeblich für das Publikum „offenen“ Veranstaltungen verödet oder für gewisse Leute verboten und insbesondere keine Orte der Debatte und der Konfrontation der Gesichtspunkte in der Arbeiterklasse mehr sind.
Wir haben auch unterstrichen, dass die Verstärkung und Umgruppierung der revolutionären Kräfte des proletarischen Lagers, die angesichts der Herausforderungen der gegenwärtigen Lage nötig sind, heute nur noch um den einzigen ernsthaften Pol: das IBRP stattfinden kann (...)
Auf unseren Vorschlag hin und mit unserer politischen und materiellen Unterstützung, wird das IBRP in Paris eine öffentliche Veranstaltung durchführen (von der wir hoffen, dass es lediglich die erste von mehreren sein wird), an der teilzunehmen wir unsere Leser aufrufen.“ (Hervorhebungen von uns)
Es fällt auf, dass es die IFIKS mit diesem öffentlichen Aufruf nicht für nötig befunden hat, auch nur einen Satz der Analyse oder Ablehnung des Irakkrieges zu schreiben (im Gegensatz zu dem, was im Einladungs-Flugblatt des IBRP stand). Dieser Aufruf ist vielmehr nur einer einzigen Frage gewidmet: Wie kann man in der französischen Hauptstadt nach dem (gemäss IFIKS) verifizierten Zusammenbruch der IKS wieder einen Umgruppierungspol der Revolutionäre bilden, da angeblich unsere öffentlichen Veranstaltungen „verödet“ und nicht mehr Orte der Debatte sind (was eine glatte Lüge ist, wie all jene Sympathisanten der IKS bestätigen können, die regelmäßig an unsere Veranstaltungen kommen und von denen auch etwa zehn an derjenigen des IBRP teilnahmen).
Das IBRP: einziger „ernsthafter Pol“ des politischen proletarischen Milieus?
An dieser öffentlichen Veranstaltung waren abgesehen von der Delegation des IBRP und vier Mitgliedern der IFIKS (von dieser war nur Jonas nicht da):
- zwei Unterstützer der IFIKS (wovon einer ein ehemaliges Mitglied der IFIKS ist);
- einer, der sich seit langem im rätistischen, gegen jede Partei eingestellten Milieu bewegt (den wir seit mehr als dreißig Jahren kennen).
Drei weitere Personen schauten herein und verschwanden gleich wieder aus dem Saal, ohne sich an der Debatte zu beteiligen.
So wäre diese öffentliche Veranstaltung, die (gemäss der Darstellung der IFIKS) den Beweis dafür hätte liefern sollen, dass das IBRP heute der „einzig ernsthafte Pol“ zum Diskutieren und Bezugspunkt der Kommunistischen Linken sei, ein totales Fiasko geworden, wenn nicht die IKS gekommen wäre und ihre Kontakte eingeladen hätte, ebenfalls teilzunehmen. Effektiv waren eine große Delegation der IKS und etwa zehn Sympathisanten unserer Organisation anwesend.
Die IFIKS hat also trotz ihrer großmäuligen Ankündigung dieser öffentlichen Veranstaltung vor allem eines bewiesen: Sie hat um sich herum eine Leere hergestellt. Es waren die IKS und ihre Sympathisanten, die mehr als zwei Drittel der Teilnehmer ausmachten und den Saal füllten. Dies war so offensichtlich, dass
- vor der Einführung ein Mitglied des IBRP zu einem unserer Genossen kam, um zu fragen: „Warum seid ihr so zahlreich gekommen?“[2]
- sich am Schluss der Veranstaltung das Präsidium genötigt fühlte, die Frage zu stellen: „Wer von den Anwesenden gehört denn nun nicht zur IKS?“ - Abgesehen von unseren Sympathisanten und den Mitgliedern der IFIKS … erhoben sich gerade drei Hände!
Die Zusammensetzung der Teilnehmer dieser öffentlichen Veranstaltung bewies, dass die IFIKS (und vielleicht auch das IBRP?) ihre Wünsche für die Wirklichkeit hält: Die IKS ist als „ernsthafter Pol“ des proletarischen Lagers noch nicht tot und begraben. Gerade weil öffentliche Veranstaltungen der IFIKS total öde wären, organisiert sie keine eigenen und hat keine andere Politik anzubieten als sich wie ein Blutegel an diejenigen der linkskommunistischen Gruppen zu hängen!
Doch noch wichtiger ist die Frage: Warum wurde diese öffentliche Veranstaltung, die die IFIKS mit Fanfaren als das große Ereignis ankündigte, von den Lesern des IFIKS-Bulletins und von unseren Abonnenten boykottiert?
Dies geschah genau deshalb, weil sie erfuhren, dass die Veranstaltung der IBRP auf „Anregung“ und mit der „politischen und materiellen Unterstützung“ dieser parasitären Gruppe organisiert worden war, deren Hauptaktivität darin besteht, die schlimmsten Verleumdungen über die IKS zu verbreiten!
Die einzigen Leute, die die IFIKS anziehen konnte, waren ihre eigenen Supporter, und das Beispiel hat gezeigt, dass es davon nicht gerade viele gibt.
Wenn die IFIKS nicht von allen Dächern geschrieen hätte, dass das IBRP diese öffentliche Veranstaltung mit der „politischen und materiellen Unterstützung“ des IFIKS organisierte, wären bestimmt weitere an Klärung interessierte Leute (die übrigens nicht alle mit unseren Positionen einverstanden sind) gekommen, um an der Debatte teilzunehmen.
Diese Lehre wird das IBRP aus der peinlichen Affäre ziehen müssen: Man ist nie besser bedient, als wenn man sich auf die eigenen Kräfte verlassen kann. Das Bündnis mit der IFIKS, die tonnenweise Verleumdungen über die IKS verbreitet hat, die sich offen wie eine Gruppe von Spitzeln aufgeführt und Material und Geld der IKS gestohlen hat - dies hat offensichtlich eine abstoßende Wirkung auf die ernsthaften Leute, die mit der Kommunistischen Linken sympathisieren, gehabt.
Die übertriebene Umarmung durch die IFIKS (wie auch die ganze Pomade, die sie dabei verwendete) haben dem IBRP nicht mehr gebracht, als es der Lächerlichkeit preis zu geben.
Was die IFIKS mit ihrem Einladungsschreiben vor allem beweisen wollte war, dass ohne sie das IBRP - eine Organisation der Kommunistischen Linken, die international besteht und seit Jahrzehnten präsent ist - nicht imstande gewesen wäre, die Initiative für diese öffentliche Veranstaltung zu ergreifen und sie durchzuführen!
Es ist bedauerlich, dass das IBRP nicht bemerkte, wie die IFIKS ihm eine lange Nase drehte, als sie in ihrem Bulletin Nr. 27 behauptete, dass sie, diese angebliche „Fraktion“, in der Frage des Parteiaufbaus „strengere Positionen als das IBRP verteidige“ („Bericht über eine Diskussion zwischen dem IBRP und der Fraktion“)! Dies bedeutet, dass die IKIKS vorgibt, viel „radikalere“ Positionen zu vertreten, und sich damit links des IBRP einordnen will.
In Tat und Wahrheit geht es aber dieser parasitären Gruppierung nur darum, ihre eigene Werbung zu betreiben (und sich ein „Respekts“-Zeugnis ausstellen zu lassen), wenn sie das IBRP als Aushängeschild benützt und gleichzeitig so tut, als hänge das IBRP am Rockzipfel des IFIKS! Das IBRP weigerte sich, dies zu erkennen (obwohl wir es davor gewarnt hatten), bevor es mit der IFIKS Hochzeit feierte. Wenn es die IKS ernst genommen hätte, wäre nicht diese Erfahrung nötig gewesen, um zu erkennen, dass (wie die Fabel von La Fontaine sagt) „jeder Schmeichler auf Kosten seines Zuhörers lebt“.
Warum ging das IBRP der IFIKS in die Falle?
Indem die IFIKS dem IBRP ihre „politische und materielle Unterstützung“ zur Durchführung dieser öffentlichen Veranstaltung zur Verfügung stellte, versuchte sie offensichtlich, sich als Gruppe anerkennen zu lassen, die dem politischen proletarischen Milieu angehöre. Leider hat diese Heirat zwischen IFIKS und IBRP noch andere Folgen gehabt als die, das IBRP der Lächerlichkeit preis zu geben. Sie hat auch dazu beigetragen, eine Organisation der Kommunistischen Linken in Verruf zu bringen, die bis jetzt nicht so weit gegangen ist, eines der Grundprinzipien der Arbeiterbewegung mit den Füssen zu treten: nämlich das Prinzip, jede Praxis des Diebstahls von Material anderer revolutionärer Organisationen abzulehen.
So verlangte die IKS im Verlaufe der öffentlichen Veranstaltung das Wort, um einen Brief vorzulesen, den einer unserer Abonnenten an das IBRP geschrieben und den zu veröffentlichen er uns gebeten hatte. Dieser Genosse (und er war nicht der einzige) hatte tatsächlich das Einladungsflugblatt des IBRP an seine persönliche Adresse zugeschickt erhalten. Er teilte uns sein Erstaunen mit (wie auch andere Abonnenten, denen das gleiche passiert war): Wie ist das IBRP zu seiner Adresse gekommen, wenn er sie doch zuvor nur der IKS gegeben hatte? Nach diesen Fragen von mehreren unserer Abonnenten entschloss sich die IKS am Vorabend dieser öffentlichen Veranstaltung, einen Protestbrief an das IBRP zu richten (und wir hoffen, dass er nicht zurückgewiesen wird, wie es mit anderen Briefen schon geschehen ist).
Sobald wir die Frage des Diebstahl unserer Adresskartei aufwarfen, versuchte das Präsidium, uns mit dem Argument das Wort abzuschneiden, dass das IBRP zwischen der IKS und der IFIKS nicht Partei ergreifen wolle, denn dies sei eine „interne“ Angelegenheit unserer Organisation. Auf unseren Protest hin versicherte uns das Präsidium zweimal, dass das IBRP die Adresskartei der Abonnenten nicht habe, und fügte hinzu: „Auch wenn man es uns vorgeschlagen hätte, hätten wir auf jeden Fall abgelehnt.“ Daraufhin fragten wir die Genossen des IBRP: „Bedeutet dies, dass ihr den Diebstahl der Adresskartei verurteilt?“ Trotz unseres Nachhakens hat das Präsidium nicht darauf geantwortet und stattdessen erklärt: „Wir werden diese Frag nach der öffentlichen Veranstaltung unter uns und mit der IFIKS klären.“
Dieser Zwischenfall ruft nach mehreren Bemerkungen:
1) Das IBRP verkauft uns für dumm, wenn es die Unverfrorenheit hat zu behaupten, nicht in einer „internen“ Angelegenheit der IKS „Partei ergreifen“ zu wollen. Wenn diese erste öffentliche Veranstaltung des IBRP in Paris mit der „materiellen und politischen Unterstützung“ der IFIKS organisiert wurde, wenn wir zur Kenntnis nehmen (im Bulletin 27 der IFIKS), dass das IBRP und die IFIKS begonnen haben, die „Grundlage für eine gemeinsame Arbeit zu legen“, wenn das IBRP mehr als sieben Jahre jegliche gemeinsame Arbeit mit der IKS ablehnte (unter dem fadenscheinigen Vorwand, dass unsere Divergenzen zu schwerwiegend seien), dann muss man schon blind und taub sein, um nicht zu erkennen, dass das IBRP vollständig für die IFIKS Partei ergriffen hat!
2) Was den Diebstahl der Adresskartei der IKS anbelangt, so weiß das IBRP sehr wohl, dass es sich hier nicht um eine „interne“ Angelegenheit der IKS handelt, denn seit zwei Jahren verurteilen wir ihn in unserer Presse; wir haben diese Angelegenheit also öffentlich abgehandelt!
3) Wenn das IBRP behauptet, dass es „auf jeden Fall abgelehnt hätte“, selbst wenn die IFIKS ihm unsere Adresskartei hätte geben wollen, so bedeutet dies ganz einfach, dass es den Diebstahl des Materials der IKS anerkennt und verurteilt. Wenn das IBRP kohärent sein will, muss es auch die sich aufdrängenden Schlussfolgerungen ziehen: Es hat die Grundlagen für die Zusammenarbeit mit Dieben gelegt.
4) Das IBRP hat erklärt, dass es diese Angelegenheit nach der Veranstaltung mit der IFIKS „klären“ würde. Wir sind der Meinung, dass diese Klärung keine „interne Angelegenheit“ des IBRP bleiben darf, sondern öffentlich kundgetan werden soll, denn:
- es ist in den Diebstahl von Material der IKS verstrickt, da dieses für den Versand des Aufrufs des IBRP zu seiner Veranstaltung verwendet wurde;
- es muss gegenüber unseren Abonnenten Rechenschaft ablegen, die die Frage stellten, wie denn der Aufruf des IBRP in ihrem Briefkasten gelandet sei.
Was uns anbetrifft, so können wir nur Kenntnis von der Erklärung nehmen, wonach das IBRP es niemals akzeptiert hätte, wenn die IFIKS „ihre Kriegsbeute“ als Mitgift in die Ehe gebracht hätte.
Auf jeden Fall (und wir glauben den Genossen des IBRP aufs Wort, wenn sie uns bestätigen, dass sie unsere Adresskartei nicht besitzen) begingen die Mitglieder der IFIKS hinter dem Rücken des IBRP eine schändliche Tat (so wie sie es unaufhörlich getan hatten, als sie sich noch in unserer Organisation befunden und geheime Versammlungen mit dem Ziel unserer „Destabilisierung“ abgehalten hatten!)[3]
Wir hoffen, dass das IBRP in der Lage sein wird, die Lehren aus dieser peinlichen Erfahrung zu ziehen. Wir haben mit unseren Ermahnungen zur Vorsicht vergeblich versucht, es davor zu bewahren. Wenn man einen Hund ins Bett nimmt[4], darf man sich nicht zu wundern, wenn man mit Flöhen erwacht.
Der Handel des IBRP mit der IFIKS ist offensichtlich ein Betrug. Das IBRP hat mit der Annahme der Dienstleistungen der sog. „Fraktion“, dadurch, dass es den Schmeicheleien erlegen und all die fetten Lügen für bare Münze genommen hat, das Risiko auf sich genommen, nicht nur jegliche Glaubwürdigkeit zu verlieren, sondern auch die Ehre einer zur Kommunistischen Linken gehörenden Gruppe.
Wir laden das IBRP ein, Stellung zu unseren „Thesen über den Parasitismus“ (Internationale Revue Nr. 22) zu beziehen, in denen wir darlegten, dass die Hauptaktivität von parasitären Gruppierungen die Diskreditierung der kommunistischen Organisationen ist. Diese Filzläuse machen je nach Lage von der Schmeichelei oder der Verleumdung Gebrauch und leben einzig auf Kosten der Gruppen des proletarischen Lagers, indem sie sein Blut saugen. Es scheint nun klar zu sein, dass sich die parasitäre Aktivität der IFIKS nicht auf die IKS begrenzt. Diese angebliche „Fraktion“ ist nicht nur ein Parasit der IKS, sondern der gesamten Kommunistischen Linken, wenn sie das IBRP benutzt, um sich Achtung zu verschaffen (wie sie es mit Le Prolétaire schon 2002 tat)[5], und es damit in Misskredit bringt.
Wenn das IBRP seine gemeinsame Arbeit mit der IFIKS fortsetzen und es weiterhin den Einfaltspinsel spielen will, können wir es bestimmt nicht daran hindern. Jedoch kann die IKS es nicht tolerieren, dass es Diebstahl (wenn auch nur indirekt mit seinem Handel mit der IFIKS) und Verleumdung gegen unsere Organisation und gegen unsere Militanten gebraucht, um seine Umgruppierungspolitik zu verfolgen.
Wo führt der Opportunismus des IBRP hin?
Die IKS hat den Opportunismus des IBRP schon immer gebrandmarkt, der es seit seiner Gründung zu einer prinzipienlosen Umgruppierungspolitik geführt hat. Wiederholt haben wir es vor der Gefahr gewarnt, die im Umgang mit Elementen und Gruppen der extremen Linken des Kapitals (wie der iranischen Gruppe SUCM) oder mit solchen, die nur einen unvollständigen Bruch mit der Linken (wie die Los Angeles Workers’ Voice) vollzogen haben, liegt. Die opportunistische Zusammenarbeit des IBRP mit der IFIKS offenbart heute die Gefahr, die dieser Organisation der kommunistischen Linken droht. Das IBRP riskiert mit der opportunistischen Anwendung linker Rekrutierungsmethoden (ohne offene und loyale Klärung von politischen Divergenzen), sich mehr und mehr von den Methoden und der Tradition der kommunistischen Linken zu entfernen und sich derjenigen des Trotzkismus anzunähern.[6] Das IBRP war der Meinung, dass es sich der IFIKS bedienen könne, um an dieser öffentlichen Veranstaltung einen fetten Fisch an Land zu ziehen. Das hat sich jetzt als großer Irrtum herausgestellt, aber weiter musste das IBRP auch Federn lassen.
Weit schlimmer ist noch die Tatsache, dass die opportunistische Abweichung des IBRP zu einer dem Proletariat vollständig fremden Praxis führt, die auf Diebstahl und Verleumdung beruht. Wenn diese Methoden klingende Münze bei den bürgerlichen Gruppen sind, so sind sie von den Organisationen des proletarischen Lagers immer verworfen und verurteilt worden.
Der Opportunismus ist „die Abwesenheit jeglichen Prinzips“ (Rosa Luxemburg). Das IBRP hat mit der Allianz mit Individuen, die diese bürgerlichen Methoden (Diebstahl von Material der IKS) gebrauchen, dieses Prinzip vollständig aus den Augen verloren, das es noch in der Lage war zu verteidigen, als es selbst Opfer der Gaunereien einer fiktiven Gruppe in der Ukraine (die ihm Geld stehlen wollte) wurde. Damals schrieb das IBRP: „Wenn das Ziel und die Mittel getrennt werden ... ist der Weg für die Konterrevolution offen“ (Erklärung des IBRP zu den „Radikalen Kommunisten der Ukraine“, 9.9.2003).
Die Revolutionäre haben in ihrem Kampf für die Überwindung des Kapitalismus die bürgerliche Moral der Jesuiten, gemäß der „das Ziel die Mittel gerechtfertige“, verworfen. Sie haben ihr die proletarische Ethik entgegengestellt, die konform mit dem Wesen derjenigen Klasse ist, die den Kommunismus errichten wird (wie dies u.a. Trotzki in seiner Broschüre „Ihre Moral und unsere“ bereits aufgezeigt hatte). Deshalb müssen die proletarischen Organisationen strikt jegliche Umgruppierung verwerfen, die den Diebstahl von anderen kommunistischen Organisationen gehörendem Material begehen.
Diese schändliche Geschichte hat gezeigt, dass das IBRP eine Geisel von einer Bande von Dieben geworden ist (und man muss sich die Frage stellen, wie sich das IBRP von der IFIKS befreien wird). Wir hoffen, dass es zumindest dazu gezwungen wird, das Brett vor den Augen zu entfernen, um endlich die Natur dieser angeblichen „Fraktion“ zu verstehen.[7]
Nicht nur das Programm bestimmt die proletarische Natur einer politischen Gruppierung, sondern auch das politische Verhalten, d.h. die auf Prinzipien beruhende Praxis. Diese unsere Sichtweise hat rein gar nichts mit „Psychologie“ zu tun (wie die IFIKS behauptet). Und zwar deshalb weil, wie Marx in den Feuerbachthesen sagt, der Mensch „in der Praxis die Wahrheit, i.e. Wirklichkeit und Macht, Diesseitigkeit seines Denkens beweisen“ muss.
Gegenüber dieser gefährlichen Abgleitung des IBRP ist es die Pflicht der kommunistischen Militanten, die Genossen dieser Organisation auf ihre Verantwortung aufmerksam zu machen. Sie müssen Maßnahmen ergreifen für die Zukunft der revolutionären Organisationen: jegliche opportunistische Zusammenarbeit mit parasitären Gruppen, mit Abenteurern, mit Dieben oder mit Phantomgruppen, die nur im Internet existieren, verwerfen.
Wenn die IKS zur Verteidigung ihrer Prinzipien den Parasiten, die sich wie Spitzel aufgeführt haben, weiterhin den Eintritt in ihre öffentlichen Veranstaltungen verbieten wird, so ist sie doch der Auffassung, nicht der einzige Bezugspunkt der Kommunistischen Linken zu sein. Deshalb bleiben unsere Türen für das IBRP auch immer offen und wir laden es herzlich zur Teilnahme ein.
IKS (10.10.2004)
Fußnoten:
1. Internationales Büro für die Revolutionäre Partei, das aus den beiden linkskommunistischen Organisationen „Battaglia Communista“ (BC) in Italien und „Communist Workers’ Organisation“ (CWO) in Großbritannien besteht.
2. Wie wir im zweiten Teil dieses Artikels sehen werden, drehte sich die Debatte zum Krieg auch nicht um die Analyse des IBRP, sondern um diejenige der IKS.
3. Gemäß den eigenen Worten von Olivier, einem Mitglied der IFIKS, in einer dieser geheimen Versammlungen (von der wir nur per Zufall das Protokoll fanden).
4. Wir geben hier zu, dass der Vergleich der IFIKS mit Hunden doch eher beleidigend ist ... für die Hunde!
5. Siehe unseren Artikel : A propos d’un article publié dans Le Prolétaire 463, Le Parti communiste internationale à la remorque de la ‚fraction’ interne du CCI, in: Révolution Internationale, Nr. 328.
6. Wie wir bereits vor vier Jahren aufgezeigt haben, in: Die marxistische und die opportunistische Sichtweise in der Politik des Parteiaufbaus, Internationale Revue Nr. 26.
7. Die Methoden der IFIKS offenbaren sich noch klarer im Vokabular (siehe auf ihrer Homepage den Artikel: „L’ignominie n’a pas de limite!“, der eine Pogromaufruf gegen unsere angeblichen „Schweinereien“ enthält und unsere Genossen als „Dreckskerle“ bezeichnet!). Wenn die Masken fallen, enthüllt die angebliche „Fraktion“ ihr wahres Gesicht.
November 2005
- 734 reads
Ausschreitungen in den französischen Vorstädten
| Attachment | Size |
|---|---|
| 29.66 KB |
- 2864 reads
Mehr als 6.000 ausgebrannte Fahrzeuge: Privatautos, Busse, Feuerwehrfahrzeuge; Dutzende von abgefackelten Gebäude: Geschäfte, Lagergebäude, Werkstätten, Fitness-Studios, Schulen, Kindergrippen; mehr als Tausend Festgenommene und bereits mehr als ein Hundert Aburteilungen zu Gefängnisstrafen; etliche Hundert Verletzte - Aufrührer, aber auch Polizisten und einige Dutzend Feuerwehrleute; Schüsse auf die Polizei. Seit dem 27. Oktober sind Hunderte von Bezirken in allen Landesteilen Nacht für Nacht davon betroffen. Bezirke und Gegenden, die zu den ärmsten des Landes zählen, wo Millionen von Arbeitern und ihre Familien, eingepfercht in finsteren Wohntürmen, hausen, die große Mehrheit von ihnen aus Nordafrika und Schwarzafrika.
Lade das Flugblatt als PDF herunter und verbreite es [28]
Nur der Klassenkampf bietet den Verzweifelten eine Zukunft
Mehr als 6.000 ausgebrannte Fahrzeuge: Privatautos, Busse, Feuerwehrfahrzeuge; Dutzende von abgefackelten Gebäude: Geschäfte, Lagergebäude, Werkstätten, Fitness-Studios, Schulen, Kindergrippen; mehr als Tausend Festgenommene und bereits mehr als ein Hundert Aburteilungen zu Gefängnisstrafen; etliche Hundert Verletzte - Aufrührer, aber auch Polizisten und einige Dutzend Feuerwehrleute; Schüsse auf die Polizei. Seit dem 27. Oktober sind Hunderte von Bezirken in allen Landesteilen Nacht für Nacht davon betroffen. Bezirke und Gegenden, die zu den ärmsten des Landes zählen, wo Millionen von Arbeitern und ihre Familien, eingepfercht in finsteren Wohntürmen, hausen, die große Mehrheit von ihnen aus Nordafrika und Schwarzafrika.
Die Gewalt der Verzweiflung
Was an diesen Aktionen, abgesehen vom Ausmaß der Schäden und der Gewalt, am meisten auffällt, ist ihre totale Absurdität. Es ist durchaus nachvollziehbar, warum junge Immigranten aus den ärmsten Gegenden die Polizei konfrontieren wollen. Tagtäglich sind sie Opfer grober und aufdringlicher Identitätskontrollen und Leibesvisitationen; es ist völlig logisch für sie, die Bullen als ihre Peiniger zu betrachten. Doch hier sind die Hauptopfer ihrer Gewalt: ihre jüngeren Brüder und Schwestern, die nicht mehr auf die Schule gehen können, Eltern, die ihre Autos verloren haben, für die sie die niedrigsten Versicherungssummen erhalten, da diese alt und billig sind, und die nun weiter entfernt einkaufen müssen, da die näher gelegenen und billigeren Geschäfte ausgebrannt sind. Die Jugendlichen wüteten nicht in den reichen Gegenden, wo ihre Ausbeuter wohnhaft sind, sondern in ihren eigenen schlimmen Vorstädten, die nun noch unbewohnbarer sind, als sie es ohnehin schon waren. Gleichermaßen sind die Verletzungen, die sie den Feuerwehrleuten zufügten, Leuten also, deren Job es ist, andere oft unter Risiko ihres eigenen Lebens zu beschützen, genauso schockierend wie die Verletzungen, die Passagieren eines Busses zugefügt wurden, der in Brand gesetzt wurde, oder der Tod eines 60jährigen Mannes, der von einem jungen Mann erschlagen wurde, anscheinend weil er versucht hatte, ihn von irgendeiner Gewalttat abzuhalten.
In diesem Sinn haben die Verwüstungen, die Nacht für Nacht in den armen Wohngegenden begangen werden, rein gar nichts mit dem Kampf der Arbeiterklasse zu tun. Sicherlich ist die Arbeiterklasse in ihrem Kampf gegen den Kapitalismus gezwungen, Gewalt anzuwenden. Die Überwindung des Kapitalismus ist notwendigerweise ein gewaltsamer Akt, da die herrschende Klasse mit all den Repressionsmitteln, die sie zur Verfügung hat, mit Zähnen und Klauen ihre Macht und ihre Privilegien verteidigen wird. Die Geschichte hat uns besonders seit der Pariser Kommune von 1871 - um nur ein Beispiel zu nennen - gelehrt, in welchem Maß die Bourgeoisie dazu bereit ist, mit ihren Füßen auf den eigenen großen Prinzipien der „Demokratie“, der „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ herumzutrampeln, wenn sie sich bedroht fühlt. In einer einzigen, blutigen Woche wurden 30.000 Pariser Arbeiter massakriert, weil sie versucht hatten, die Macht in ihre eigenen Hände zu nehmen. Und selbst bei der Verteidigung ihrer unmittelbaren Interessen sieht sich die Arbeiterklasse häufig der Repression durch den bürgerlichen Staat und der Privatarmeen der Bosse ausgesetzt – einer Repression, der sie ihre eigene Klassengewalt entgegensetzen muss.
Doch was jetzt in Frankreich passiert, hat nichts mit der proletarischen Gewalt gegen die ausbeutende Klasse zu tun: Die Hauptopfer der jüngsten Gewalt sind die Arbeiter selbst. Abgesehen von jenen, die direkt unter dem angerichteten Schaden leiden, ist die gesamte Arbeiterklasse des Landes davon betroffen: Das mediale Sperrfeuer rund um die jüngsten Ereignisse verdeckt sämtliche Angriffe, welche die Bourgeoisie gerade jetzt unternimmt, und überschattet gleichzeitig die Kämpfe, die Arbeiter gegen diese Angriffe zu führen versuchen.
Die Antwort der herrschenden Klasse
Was die Kapitalisten und die Staatsführer, die ruhig in ihren piekfeinen Wohngegenden sitzen, angeht, so nutznießen sie von der gegenwärtigen Gewalt, indem sie den Repressionsapparat stärken. So bestand die wichtigste Maßnahme, die von der französischen Regierung ergriffen wurde, um der Lage Herr zu werden, darin, am 8. November einen Ausnahmezustand auszurufen, eine Maßnahme, die zuletzt vor 43 Jahren praktiziert wurde und die auf einem Gesetz basiert, das vor über 50 Jahren, während des Algerienkrieges, verabschiedet worden war. Das Hauptelement in diesem Dekret ist ein Ausgangsverbot, ein Verbot, ab einer bestimmten Stunde die Straße zu betreten, wie während der Tage der deutschen Besatzung zwischen 1940 und 1944 oder wie beim Belagerungszustand in Polen 1981. Doch das Dekret erlaubt noch weitere Eingriffe in die klassische „Demokratie“, wie Hausdurchsuchungen zu Tag und zu Nacht, die Kontrolle der Medien oder der Einsatz von Militärgerichten. Jene Politiker, die die Verhängung des Ausnahmezustands beschlossen hatten oder ihn unterstützen (wie die Sozialistische Partei), versichern uns, dass dies nur Ausnahmemaßnahmen seien und dass sie nicht missbraucht werden. Jedoch soll hiermit ein Präzedenzfall geschaffen werden, an dem sich die Bevölkerung – und besonders die Arbeiter – gewöhnen soll. So wird es morgen, angesichts der Arbeiterkämpfe, die die Angriffe des Kapitals zwangsläufig hervorrufen, leichter sein, Zuflucht in ähnlichen Maßnahmen zu suchen und die Waffen der bürgerlichen Repression als eine Selbstverständlichkeit erscheinen zu lassen.
Die gegenwärtige Situation verheißt weder den Jugendlichen, die Autos anzünden, noch der Arbeiterklasse in ihrer Gesamtheit Gutes. Allein die Bourgeoisie kann bis zu einem gewissen Umfang davon künftig profitieren.
Dies heißt nicht, dass die herrschende Klasse die jüngste Gewaltwelle bewusst provoziert hat.
Es ist richtig, dass sich einige ihrer politischen Sektoren, wie die rechtsextreme Nationale Front, berechtigt Hoffnung machen, bei den nächsten Wahlen die Früchte aus diesen Ereignissen zu ernten. Es trifft sicherlich auch zu, dass Sarkozy, der davon träumt, bei den nächsten Präsidentschaftswahlen Stimmen aus dem rechtsextremen Lager zu gewinnen, Öl ins Feuer goss, als er sagte, dass man Feuerwehrschläuche benutzen sollte, um die rebellischen Wohngegenden „auszumisten“, und als er die Unruhestifter als „Pöbel“ bezeichnete, als die Gewalt begann. Doch es ist ebenfalls klar, dass die Hauptsektoren der herrschenden Klasse, beginnend mit der Regierung bis hin zur Linken, die im Allgemeinen die am meisten betroffenen Stadtverwaltungen stellt, dadurch in eine höchst prekäre Lage geraten sind. Dies zum Teil wegen der wirtschaftlichen Kosten der Gewalt. So hat der Boss der französischen Unternehmer, Laurence Parisot, am 7. November in Radio Europe erklärt, dass „die Lage schwerwiegend, ja sehr schwerwiegend ist“ und dass dies „ernste Konsequenzen für die Wirtschaft haben wird.“
Aber vor allem auf politischer Ebene äußert sich die Sorge der Bourgeoisie. Es gestaltet sich nämlich als schwierig, die „Ordnung wiederherzustellen“, ohne die Glaubwürdigkeit der Institutionen ihrer Herrschaft zu untergraben. Auch wenn die Arbeiterklasse keinerlei Nutzen aus der gegenwärtigen Situation ziehen kann, auch ihr Klassenfeind, die Bourgeoisie, hat es zunehmend schwieriger, die „republikanische Ordnung“ aufrechtzuerhalten, die er benötigt, um seinen Platz an der Spitze der Gesellschaft zu rechtfertigen.
Und diese Beunruhigung findet nicht nur in der französischen Bourgeoisie ihren Ausdruck. In anderen Ländern, in Europa wie auch am anderen Ende der Welt, wie in China zum Beispiel, wird die Situation in Frankreich auf den ersten Seiten der Zeitungen behandelt. Selbst in den USA, einem Land, in dem die Presse im Allgemeinen wenig darüber berichtet, was in Frankreich vor sich geht, verdrängten Bilder von Autos und Gebäude in Flammen die Schlagzeilen.
Für die US-Bourgeoisie lässt sich durch die Hervorkehrung der Krise, die die armen Gegenden in den französischen Städten trifft, eine Scharte auswetzen: Französische Medien und Politiker hatten sich lautstark über das Versagen des amerikanischen Staates ausgelassen, mit Hurrikan Katrina fertig zu werden. Heute gibt es eine gewisse Schadenfreude in der amerikanischen Presse und unter einigen ihrer Führer, die sich über die „Arroganz Frankreichs“ lustig machten. Dieser Austausch von Freundlichkeiten entspricht dem Kurs zweier Länder, die sich auf diplomatischer Ebene in einem ständigen Gegensatz, besonders in der Frage des Irak, befinden. Dennoch zeichnet sich der Tonfall in der europäischen Presse durch eine wirkliche Besorgnis aus, auch wenn sie ein paar Spitzen gegen das „französische Modell“ richtet, das Chirac so oft gegenüber dem „angelsächsischen Modell“ gerühmt hat. So schrieb am 5. November die spanische Tageszeitung La Vanguardia, dass „niemand seine Hände reibt; die Herbststürme in Frankreich könnten das Vorspiel zu einem europäischen Winter sein.“ Dasselbe lässt sich auch über die politischen Führer sagen: „Die Bilder, die aus Paris kommen, sind eine Warnung an alle Demokratien, dass die Integrationsbemühungen nie als abgeschlossen betrachtet werden können. Im Gegenteil, wir müssen ihnen neuen Vorrang einräumen (...) Die Situation hier ist nicht vergleichbar, doch ist es klar, dass eine der Aufgaben der nächsten Regierung sein muss, die Integration zu beschleunigen.“ (Thomas Steg, ein deutscher Regierungssprecher, 5. November) „Wir dürfen nicht denken, dass wir hier so anders sind hier als Paris, es ist nur eine Frage der Zeit.“ (Romano Prodi, Führer der Mitte-Links-Opposition in Italien und ehemaliger Präsident der Europäischen Kommission) „Jeder ist besorgt darüber, was passiert.“ (Tony Blair)
Diese Besorgnis enthüllt, dass die herrschende Klasse sich ihres eigenen Bankrotts bewusst wird. Selbst in Ländern, wo es eine anders geartete Herangehensweise an die Probleme der Integration gegeben hat, sieht sich die Bourgeoisie immer noch Problemen gegenüber, die unüberwindbar sind, da sie aus einer unüberwindbaren Wirtschaftskrise herrühren, die in den letzten 30 und mehr Jahren herrschte und herrscht.
Heute erklären die „guten Jungs“ der französischen Bourgeoisie und selbst die Regierung, die es bis jetzt vorgezogen hatte, zur Peitsche statt zum Zuckerbrot zu greifen, dass „etwas getan werden muss“ für die verarmten Wohnquartieren. Sie sprechen von der Sanierung der heruntergekommenen Vorstädte, die von jenen bewohnt werden, die nun revoltieren. Sie rufen nach mehr Sozialarbeiter, mehr Kultur-, Sport- und Freizeitzentren, wo Jugendliche anderen Beschäftigungen nachgehen können, als Autos in Brand zu setzen. Alle Politiker geben zu, dass eine der Ursachen für die gegenwärtige Malaise unter den Jungen der hohe Grad der Arbeitslosigkeit ist, unter der sie leiden: Sie beträgt in diesen Gebieten mehr als 50 Prozent. Die Rechte sagt, dass es den Unternehmen leichter gemacht werden müsse, sich in diesen Gebieten niederzulassen, insbesondere durch eine Senkung der Steuern. Die Linke fordert mehr Lehrer und bessere Schulen. Doch keine von beiden kann das Problem lösen.
Die grundlegenden Ursachen der Revolte
Die Arbeitslosigkeit wird nicht weniger werden, nur weil sich ein Unternehmen in dem einen statt in dem anderen Quartier niederlässt. Der Bedarf an Lehrerpersonal und Sozialarbeitern, um sich den Hunderttausenden von verzweifelten Jugendlichen zu widmen, ist derart groß, dass der Staatsetat dafür nicht ausreicht. Dasselbe gilt für alle anderen Länder, wo der Staat dazu gezwungen ist, die „Sozial“ausgaben zu kürzen, um die Fähigkeit der nationalen Wirtschaft zu fördern, auf einem übersättigten Weltmarkt konkurrenzfähig zu bleiben. Und selbst wenn es einen Haufen mehr Sozialarbeiter oder Lehrer gäbe, so würde dies nicht die fundamentalen Widersprüche lösen, die die kapitalistische Gesellschaft niederdrückt und die die wahre Quelle der Entfremdung sind, die die Jugendlichen betrifft.
Wenn die Jungen aus den Vorstädten mit völlig absurden Methoden rebellieren, so liegt dies daran, dass sie sich in einer tiefen Verzweiflung befinden. Im April 1981 schrieben die Jugendlichen, die in Brixton, einem Gebiet von London mit einem großen Anteil von Immigranten, auf ähnliche Weise aufbegehrt hatten, den Ruf „No Future“ an die Wände. Es ist dieses No-Future-Gefühl, dass heute Hunderttausende von Jugendliche in Frankreich wie in anderen Ländern ergreift. Sie fühlen es jeden Tag in ihren Bäuchen, wegen der Arbeitslosigkeit, wegen der Diskriminierung und Geringschätzung, mit der sie behandelt werden. Aber sie sind nicht allein. In vielen Teilen der Welt ist die Lage noch schlimmer, und die Antwort der Jugendlichen nimmt noch absurdere Formen an: In Palästina ist es der Traum vieler Kinder, „Märtyrer“ zu sein, und eines der beliebtesten Spiele 10jähriger Kinder ist, sich einen Spielzeug-Bombengürtel anzulegen.
Doch diese etwas extremen Beispiele sind nur die Spitze eines Eisbergs. Nicht nur die ärmsten Jugendlichen sind von Verzweiflung erfasst. Ihre Hoffnungslosigkeit und ihre absurden Aktionen enthüllen einen vollkommenen Mangel an Perspektive nicht nur für sich selbst, sondern auch für die gesamte Gesellschaft in allen Ländern. Eine Gesellschaft, die immer tiefer in einer Wirtschaftskrise steckt, die nicht gelöst werden kann, weil die Widersprüche der kapitalistischen Produktionsweise in sich selbst unlösbar geworden sind. Eine Gesellschaft, die immer mehr verwüstet wird von Kriegen, Hungersnöte, unkontrollierbaren Epidemien, von einer dramatischen Zerstörung der natürlichen Umwelt, von Naturkatastrophen, die sich in unermessliche menschliche Tragödien verwandeln, wie der Tsunami im vergangenen Winter oder die Überflutung New Orleans‘ Ende des vergangenen Sommers.
In den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts durchschritt der Kapitalismus eine Krise, die mit der heutigen vergleichbar ist. Die einzige Antwort des Kapitalismus war der Weltkrieg. Es war eine barbarische Antwort, doch sie erlaubte es der Bourgeoisie, die Gesellschaft rund um dieses Ziel zu mobilisieren. Heute besteht die einzige Antwort der herrschenden Klasse auf die Sackgasse ihrer Ökonomie erneut im Krieg: Daher sind wir Zeuge eines Kriegs nach dem anderen, Kriege, die zunehmend die entwickeltsten Länder erfassen, denen lange Zeit die direkten Folgen eines Kriegs erspart geblieben waren (wie die USA oder gar bestimmte europäische Länder wie Jugoslawien in den 90er Jahren). Jedoch kann die Bourgeoisie nicht den Weg zu einem neuen Weltkrieg beschreiten. An erster Stelle, weil, als sich die ersten Auswirkungen der Krise Ende der 60er Jahre bemerkbar machten, die Arbeiterklasse besonders in den Industrieländern mit einem solchen Nachdruck reagierte (Generalstreik in Frankreich im Mai 68, der „heiße Herbst“ in Italien 1969, Polen 1970-71, etc.), dass klar war, dass sie zu dieser Zeit nicht bereit war, als Kanonenfutter den imperialistischen Ambitionen ihrer Bourgeoisie zu dienen. An zweiter Stelle, weil mit dem Verschwinden der beiden großen imperialistischen Blöcke nach dem Zusammenbruch des Ostblocks 1989 die diplomatischen und militärischen Voraussetzungen für einen neuen Weltkrieg nicht mehr existieren, auch wenn dies keinesfalls verhindert, dass die lokalen Kriege unvermindert fortgesetzt und vervielfacht werden.
Die einzige Perspektive: Der Kampf des Proletariats
Der Kapitalismus hat keine Perspektive anzubieten, außer immer barbarischere Kriege, noch größere Katastrophen, immer mehr Armut für die große Mehrheit der Weltbevölkerung. Die einzige Möglichkeit für die Gesellschaft, der Barbarei der gegenwärtigen Welt zu entkommen, ist der Sturz des kapitalistischen Systems. Und die einzige Kraft, die imstande ist, den Kapitalismus zu stürzen, ist die Weltarbeiterklasse. Weil die Arbeiterklasse bis heute nicht die Stärke hatte, diese Perspektive durch die Entwicklung und Ausweitung ihrer Kämpfe zu bekräftigen, sind viele ihrer Kinder der Verzweiflung anheimgefallen, drücken ihr Aufbegehren auf absurde Weise aus oder suchen Zuflucht in den Wundern der Religion, die ihnen das Paradies nach dem Tod verspricht. Die einzig wahre Lösung der „Krise der enterbten Wohngegenden“ ist die Weiterentwicklung des proletarischen Kampfes bis zur Revolution. Allein dieser Kampf kann der ganzen Revolte der jungen Generation eine Bedeutung und eine Perspektive verleihen.
Internationale Kommunistische
Strömung, 8. November 2005
www.internationalism.org [29]
[email protected] [30]
[email protected] [31]
Geographisch:
- Frankreich [32]
Theoretische Fragen:
- Entfremdung [33]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Teilbereichskämpfe [17]
Dezember 2005
- 726 reads
Die Montagsdemonstrationen in Ostdeutschland
- 1494 reads
Nachdem mitten in der Sommerzeit, und stets an einem Montag, einige Tausend Menschen mehrere Male vor allem in Magdeburg gegen die nach dem VW-Manager Hartz benannten „Arbeitsmarktreformen“ der Bundesregierung demonstriert hatten, berief der aus den Ferien zurückkehrende Kanzler Schröder sofort eine Sitzung seiner Ministerriege ein. Dass es sich dabei demonstrativ um ein „Krisensitzung“ des Kabinetts handelte, wurde durch die Tatsache unterstrichen, dass dafür Wirtschaftsminister Clement und Finanzminister Eichel aus ihren Ferien nach Berlin zitiert wurden. Das Ergebnis dieses Treffens war eine „Abschwächung“ des bereits beschlossenen Maßnahmenkatalogs gegen die Erwerbslosen. Und zwar eine, welche den öffentlichen Haushalt nach Schätzungen um fast zwei Milliarden Euro zusätzlich belasten wird.
Auch wenn die offizielle Verlautbarung der Bundesregierung das Wort „Korrektur“ peinlichst vermied, sprachen die Medien von einem „Rückzieher“ Schröders, von einer „Demütigung“ des Wirtschaftsministers und von einer „schweren Belastung“ des Finanzministers. Mehr noch: Obwohl der Kanzler verkündete, dass nach dieser „Klarstellung“ die Arbeitsmarktreformen nunmehr „ohne Abstriche“ umgesetzt werden sollten, lösten die Beschlüsse von Berlin scheinbar erdrutschartig Forderungen nach weiteren „Nachbesserungen“ aus. Von allen Seiten, von den Gewerkschaften wie den ostdeutschen Ministerpräsidenten, aus den Reihen der Regierungskoalition und der christlich-demokratischen Opposition, von links und von rechts wurden jetzt „Korrekturen“ der „gröbsten Ungerechtigkeiten“ und „handwerklichen Fehler“ der Hartz-Angriffe verlangt.
Diese fast schon demonstrative „Nachgiebigkeit“ verschaffte den ostdeutschen „Montagsdemos“ gegen „Hartz IV“ erst recht eine unerhörte öffentliche Aufmerksamkeit. Ab Mitte August überboten sich die Fernsehanstalten in der Ausstrahlung von Reportagen und Sondersendungen über die Proteste der Arbeitslosen v.a. in Ostdeutschland. Solcher Art ermutigt, erreichten die Demonstrationen eigentlich erst jetzt eine ansehnliche Größe und – zumindest im Osten – eine größere Verbreitung. Am 16. August demonstrierten mehr als zehntausend Menschen nicht nur in Magdeburg, sondern erstmals auch in Leipzig und in der Hauptstadt Berlin. Und selbst in westdeutschen Großstädten wie Gelsenkirchen oder Köln, wo nur einige hundert Demonstranten zur „Montagsdemo“ erschienen, war der Medienrummel groß. Dort gab es teilweise mehr Attac-Aktivisten als Erwerbslose und beinahe mehr Reporter und Kameraleute als Demonstranten.
Demokratische Protestkultur statt Arbeiterkampf?
Wie ist nun diese spektakulär inszenierte „Nachgiebigkeit“ der Bundesregierung zu verstehen? Reichte es tatsächlich, dass 6.000 Menschen in Magdeburg, dass einige Hundert in Sachsen Anfang August auf der Strasse gingen, um das Kapital zum Teilrückzug zu zwingen? Wie kann man dann aber erklären dass - erst wenige Wochen zuvor - die Streiks und Proteste von bis zu 160.000 Beschäftigten bei Daimler-Chrysler gegen die Forderungen der Arbeitgeber überhaupt nichts ausrichten konnten? Zu Erinnerung: Dort wurde die Forderung der Unternehmensleitung nach „Einsparungen“ von einer halben Milliarde Euro demonstrativ ohne Abstriche durchgesetzt. Als „Gegenleistung“ erhielten die Mercedesarbeiter lediglich ein Arbeitsplatzgarantie bis 2012, welche das Papier nicht Wert ist, auf dem es geschrieben steht (dazu die Frankfurter Allgemeine Zeitung von 24 Juli: „Wer weiß schon, wie sich die Konjunktur in den kommenden sieben Jahren entwickeln wird. Wasserdicht ist solch eine Garantie wohl nicht, denn außergewöhnliche Ereignisse erfordern außergewöhnliche Maßnahmen“).
Wenn aber den Arbeitsniederlegungen und Umzügen der Arbeiter beim größten europäische Industrieunternehmen, im Herzen der vielleicht wichtigste Zusammenballung des Industrieproletariats in Deutschland – dem Norden Baden-Württembergs mit rund einer Million Metallarbeitern – kein Erfolg beschieden war, wie lässt es sich erklären, dass die „Montagsdemos“ den kapitalistischen Staat scheinbar dazu bringen konnten, Abstriche von weit über einer Milliarde Euro gegenüber dem ursprünglichen Angriffsplan vorzunehmen?
Darauf haben die bürgerlichen Medien eine einfache und scheinbar einleuchtende Antwort. Während beispielsweise bei Daimler-Chrysler ausschließlich die „klassischen“ Mittel des Arbeiterkampfes wie Streiks, Demonstrationen und aktive Solidarität zum Einsatz kamen, soll die „Wirksamkeit“ der „Montagsdemos“ darauf zurückzuführen sein, dass sie Bestandteil einer angeblich neuen „demokratischen Protestkultur“ sind. Es versteht sich von selbst, dass die bezahlten Medien die „alten“ Mittel des Arbeiterkampfes als überholt gelten lassen wollen. Die Montagsdemos hingegen sollen die Herrschenden das Fürchten gelehrt haben, indem sie sich nicht scheuen, sich als Teil einer „Bürgerbewegung“ zu sehen, die sich der Protestmittel bedient, welche die Demokratie zur Verfügung stellt. Insbesondere sollen diese Proteste den Boden dafür bereitet haben, dass die Regierungsparteien bei den kommenden Landtags- und Kommunalwahlen einen saftigen Denkzettel verpasst bekommen.
So finden die Medien rasch ihre Erklärungen für die „Nervosität“ der rot-grünen Bundesregierung. Mal soll es um die Angst der SPD vor dem Machtverlust bei den kommenden Landtagswahlen in Brandenburg gehen; mal um das eigene Abschneiden bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. Da Oskar Lafontaine angesichts der „Hartz-Reformen“ mit der baldigen Gründung einer neuen Partei links von der SPD gedroht haben soll, wird sogar das Szenario eines bevorstehenden Sturzes der jetzigen Regierung an die Wand gemalt. Sollte es Lafontaine gelingen – so das Argument - mindestens drei Bundestagsabgeordnete der SPD für eine eventuelle Parteineugründung abzuwerben, würde die derzeitige Regierungskoalition ihre „Kanzlermehrheit“ verlieren und damit regierungsunfähig werden. Die Drohungen Lafontaines aber – so heißt es allenthalben – seien ein Ergebnis der Montagsdemos. In der Titelgeschichte des Spiegels von 16. August „Angst vor der Armut“ heißt es beispielsweise dazu: „Im Kanzleramt und in der Berliner SPD-Zentrale hat man den Aufstand der Arbeitslosen nicht für möglich gehalten ... Doch spätestens seit der Kampfansage des früheren SPD-Chefs Oskar Lafontaine ist die SPD-Führung alarmiert. Nun fürchten sie, Lafontaine könne auf dem Nährboden des Volkszorns über Hartz IV sein Comeback starten. (...) Kaum hatte Lafontaine vergangene Woche im Spiegel über seinen möglichen Wechsel zur linken „Wahlalternative“ gesprochen, brach Panik aus in der SPD-Führung.“
Darüber hinaus soll die Bewegung gegen „Hartz“ beide großen „Volksparteien“ – also nicht nur die SPD sondern auch die Union - erschrocken haben durch die Perspektive der Abwanderung von Protestwählern zum linken und zum rechten Rand. Jüngsten Umfragen zufolge könnte bei den Landtagswahlen in Brandenburg die PDS stärkste Partei werden, könnte der Wähleranteil der rechtsradikalen DVU zweistellig werden.
So soll die gegenwärtige Lage in Deutschland den erneuten Beweis dafür liefern, dass in der Demokratie radikale Reformen sich „nicht durchsetzen lassen“, da die Betroffenen – also auch die Arbeiter – sich der demokratischen Spielregeln ebenfalls bedienen können, um sich erfolgreich zu wehren. Die Botschaft ist klar: Angesichts nie da gewesener Angriffe gegen ihre Lebenslage sollen die Lohnabhängigen dem „traditionellen“ Arbeiterkampf den Rücken kehren und sich stattdessen an den Wahlen – und sei es als Protestwähler - beteiligen. In diesem Sinne werben nicht nur die Wahlplakate der rechtsextremen NPD in Sachsen mit dem Slogan „Quittung für Hartz IV“. Auch die bürgerlichen Linksradikalen wollen die Beschäftigten und Erwerbslosen für die Wahlurne mobilisieren. Mit der Parole „Hartz IV – Verarmung per Gesetz“ will uns die PDS weismachen, dass man die kapitalistische Verarmung „per Gesetz“ wieder rückgängig machen könne. Und bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen will uns eine Wahlliste „Gemeinsam gegen Sozialabbau“ glauben lassen, dass man mit dem Wahlzettel „Widerstand gegen Sozialabbau“ leisten kann.
Stimmt das? Und stimmt es, dass die Bundesregierung derzeit wegen einer „demokratischen Protestkultur“ mit dem Rücken zur Wand steht, vielleicht schon ins Wanken gerät?
Wie die Herrschenden die Verzweifelung vieler Arbeitslosen ausschlachten
Keine Frage: Es ist die nackte Existenzangst, welche die Arbeitslosen und andere Lohnabhängige derzeit auf die Straße treibt. Hie und da kommt auch schon Wut und Widerstandswillen der Erwerbslosen zum Ausdruck. Sofern dies zutrifft, handelt es sich um die ersten öffentlich wahrnehmbaren Kampfaktionen der Arbeitslosen in Deutschland seit Mitte der 80er Jahre. Solche Konkretisierungen des Kampfeswillens reihen sich somit ein in die international bereits wahrnehmbare, ganz allmählich wieder anziehende Kampfbereitschaft der Arbeiterklasse.
Das unter dem Namen Hartz firmierende Gesetzeswerk ist nicht nur ein seit Jahrzehnten nicht mehr da gewesener Angriff gegen die Erwerbslosen. Es handelt sich darüber hinaus um eine „Arbeitsmarktreform“, d.h. um ein Instrument der Erpressung und Disziplinierung der noch Beschäftigten, und um einen mächtigen Hebel zur Senkung ihre Löhne. Als solche bildet es ein zentraler Bestandteil eines Generalangriffs, der aufs Engste verknüpft ist mit der Demontage sämtlicher Sozialleistungen (beispielsweise im Gesundheitswesen), mit der Verlängerung der Arbeitszeit, mit der Intensivierung der Ausbeutung usw. Diese Angriffe wiederum sind nicht Auswüchse „egoistisch“ gewordener oder durch „Neoliberalismus“ oder andere Ideologien „verblendeter“ Kapitalisten oder Politiker, sondern Ausdruck der immer auswegloser werdenden Krise des Kapitalismus.
Es ist auch kein Zufall, dass sich derzeit vor allem im Osten vornehmlich die Erwerbslosen, die Rentner und die besonders prekär Beschäftigten den Protesten anschließen. Auf dem Gebiet der ehemaligen DDR herrschen teilweise Arbeitslosenraten, welche fast so hoch sind wie zur Zeit der Weltwirtschaftskrise Anfang der 30er Jahre. Darüber hinaus gibt es hier überdurchschnittlich viele Langzeitarbeitslose: die Kategorie der Arbeiterklasse, welche mit „Hartz“ besonders brutal in die absolute Verarmung gestoßen wird.
Es ist dennoch nicht zu übersehen, dass wir zur Zeit von der Entstehung und Entwicklung einer kämpferischen – geschweige denn einer eigenständigen - Bewegung der Erwerbslosen noch meilenweit entfernt sind. Die Situation auf dem Gebiet der ehemaligen Bundesrepublik – im Kernbereich des „wiedervereinigten“ deutschen Kapitalismus – spricht Bände. Dort beteiligen sich nur eine Handvoll Leute an den sog. Montagsdemos. Und auch im Osten – wir haben es bereits angedeutet – erhielten die Proteste erst dann größeren Zulauf, nachdem sie so stark ins Rampenlicht der bürgerlichen Medien gerieten, v.a. aber nachdem die Regierung Schröder jenen gegenüber Teilgeständnisse zu machen schien.
Natürlich fürchten die Herrschenden, dass die Lohnabhängigen sich in anbetracht ihrer beschleunigten Verelendung vermehrt zur Wehr setzen werden. Noch mehr befürchten sie, dass Teile der Arbeiterklasse beginnen könnten, den Kapitalismus insgesamt in Frage zu stellen. Bei Daimler-Chrysler hat es vor einigen Wochen nicht nur eine erste Kostprobe dieser langsam zunehmenden Kampfkraft gegeben. Darüber hinaus hat dieser Kampf ansatzweise die angeblich der Vergangenheit angehörende Frage der Arbeitersolidarität wieder aufgeworfen. Mehr noch: Dieser Kampf hat das Potential eines allmählich wieder erwachenden Klassenbewusstseins durchschimmern lassen. Die Ansätze eines tieferen politischen Nachdenkens wurden im Anschluss an diesen Kampf auch sichtbar, als die IKS ein Flugblatt verteilte, um die Lehren aus der Bewegung bei Daimler-Chrysler zu ziehen. Noch nie hat ein Flugblatt der IKS, seit es unsere Organisation in Deutschland gibt, d.h. seit rund einem Vierteljahrhundert, eine solch offene, z.T. enthusiastische Aufnahme von Seiten der Arbeiter erfahren wie dieses, und zwar nicht nur bei Daimler-Chrysler oder anderen Großbetrieben, sondern auch vor den Arbeitsämtern.
Doch die herrschende Klasse schaut dieser Entwicklung nicht tatenlos zu. Zugleich ist sie sehr wohl in der Lage, den Gang der Dinge realistisch einzuschätzen. Einerseits weiß sie, dass längerfristig größere Kämpfe der Erwerbslosen unvermeidbar sind. Auch weiß sie, dass gerade die Massenarbeitslosigkeit vielleicht mehr als irgendeine andere Frage auf Dauer dazu geeignet ist, die Notwendigkeit der Klassensolidarität und der Infragestellung des Kapitalismus zu verdeutlichen. Denn heute trifft die Massenarbeitslosigkeit im Gegensatz zu den 30er Jahren nicht eine bereits geschlagene und demoralisierte Arbeiterklasse.
Andererseits weiß die herrschende Klasse aber auch, dass die Zeit für größere, eigenständige Kämpfe der Arbeitslosen noch nicht reif ist. Das hängt damit zusammen, dass die Arbeiterklasse zwar nicht wie 1929 geschlagen ist, dafür aber stark beeinflusst wird von der herrschenden gesellschaftlichen Atmosphäre der Entsolidarisierung, des „Jeder-für-sich“, welche der heute perspektivlose, zerfallende Kapitalismus verbreitet.
Der beschwerliche Weg zur Wiederentstehung eines eigenständigen Kampfes der Erwerbslosen
Aufgrund dieses geschichtlichen Rahmens wäre eine viel höhere Ebene der Empörung und des Bewusstseins des Proletariats insgesamt erforderlich als in der Vergangenheit, um einen solchen eigenständigen Beitrag der Erwerbslosen zum Arbeiterkampf zu ermöglichen. In der Zwischenzeit ist gerade unter den Arbeitslosen das Gefühl der Isolierung, der Perspektivlosigkeit und der Verzweifelung besonders stark. Das kommt nicht nur daher, dass dieser Teil der Klasse besonders verarmt ist, sondern ist auch eine Folge davon, dass es beim Ausbleiben größerer Klassenkämpfe vom kollektiven Leben des Proletariats in der Produktion ausgeschlossen bleibt. Dabei wiegt die jetzige Perspektivlosigkeit im Osten womöglich noch schwerer, weil dieser Teil noch mehr von der Ideologie der Gleichsetzung von Kommunismus mit Stalinismus beeinflusst wird, welche nach 1989 eine führende Rolle bei der Untergrabung der Klassenidentität des Proletariats gespielt hat.
So verwundert es nicht, dass in diesem Teil der Klasse beispielsweise das Verhalten des Protestwählens derzeit besonders ausgeprägt ist. Und auch die klassischen Protestparteien, ob von links oder rechts, ob PDS oder DVU, üben hier vermehrt ihren Einfluss aus.
Aus diesem Kontext heraus kann man schon verstehen, dass die herrschende Klasse, trotz langsam zunehmender Kampfkraft und Bewusstseinsentwicklung der Arbeiterklasse, gegenwärtig keine Angst haben muss, die Arbeitslosen auf der Strasse demonstrieren zu lassen. Wir glauben vielmehr, dass die Bourgeoisie zur Zeit diese „Bewegung“ schürt. Der Versuch des Wirtschaftsministers Wolfgang Clement, unter dem Vorwand der Verlegung des Auszahlungstermins der Erwerbslosen-Stütze von Monatsende auf Monatsanfang im Jahr 2005 das Geld statt 12- nur 11-mal auszuzahlen, hätte wahrscheinlich nicht mal vom Gesichtspunkt der bürgerlichen Legalität Bestand gehabt. Es war eine gezielte Provokation. Es war eine dieser vordergründigen Maßnahmen, welche von vornherein eingeplant werden, um sie anschließend wieder zurück zu nehmen. Und zwar diesmal mit den Ziel, die Proteste zu ermuntern, sowie um andere, viel dauerhafter wirkende Teile des Angriffs mehr oder weniger unbemerkt durchboxen zu können. Man wollte die Arbeitslosen darüber im Unklaren lassen, dass die Maßnahmen der Regierung – nicht weniger als die „Sparziele“ bei Daimler-Chrysler – ohne Abstriche durchgesetzt werden. Die Arbeiter bei Mercedes waren sich darüber im Klaren, dass sie eine Niederlage erlitten. Das schafft aber günstige Bedingungen, um illusionslos die Lehren daraus zu ziehen. So war es bezeichnend, dass die Arbeiter, welche während ihres Kampfes niemals die Rolle der Gewerkschaften in Frage gestellt hatten, am Ende stinksauer auf die Gewerkschaften waren. Im Falle der „Montagsdemos“ war die Bourgeoisie jetzt um so entschlossener, die Niederlage der Arbeiter als einen Sieg erscheinen zu lassen – und damit das Bewusstsein der Klasse zu vernebeln.
Auch die penibel in die Breite getretene „öffentliche Debatte“ darüber, ob die Arbeitslosenproteste an die „heilige Tradition“ der „Montagsdemos“ anknüpfen dürfen, welche angeblich 1989 die DDR zum Einsturz brachten, diente der öffentlichen Bekanntmachung der jetzigen Proteste. Darüber hinaus dient diese Leier der bürgerlich-demokratischen Pervertierung des Anliegens der Arbeitslosen, indem man die Sache so dreht: „Natürlich“ sei der „Montag“ von 2004 kein Kampf gegen eine Diktatur wie damals unter Honecker (als ob der Kampf gegen das Kapital nicht immer ein Kampf gegen ein diktatorische Macht wäre, Demokratie hin oder her!). Vielmehr gehöre der Protest des „kleinen Mannes“ zur Demokratie und soll den Weg zu Reformen und zur Wahlurne bitte schön ebnen.
Die Notwendigkeit einer eigenständigen Klassenperspektive
Mit den derzeitigen Protesten will die herrschende Klasse nicht nur vorzeitig Dampf ablassen: bevor eine allgemeine Kampfstimmung unter den Arbeitslosen aufkommt, bevor ein verbreitetes Bedürfnis des Anschlusses an den Kampf der gesamten Arbeiterklasse empfunden wird. Vor allem soll der zarte Keim des eigenständigen politischen Nachdenkens innerhalb der Arbeiterklasse erstickt werden. Dazu soll das Proletariat an der Wiederaneignung der eigenen Kampftraditionen gehindert werden, indem stattdessen eine scheinbar aussichtsreichere, klassenübergreifende Protestform angeboten wird, welche die Arbeiterklasse in der bürgerlichen Gesellschaft auflöst, an Illusionen in die Reformierbarkeit des Systems bindet, und als Stimmvieh dem demokratischen Klassenstaat unterordnet. Damit soll die unklar aufdämmernde Vorahnung zurückgedrängt werden, dass jede kapitalistische Regierung, egal welcher Couleur, die Angriffe gegen die Arbeiterklasse fortsetzen wird, und dass alle Parteien des demokratischen Wahlzirkus, von der DVU bis zur PDS, sich zumindest darin einig sind, dass die Folgen der Krise des Kapitalismus auf die Ausgebeuteten abgewälzt werden müssen.
Auch wenn die Wahlerfolge der Protestparteien von links und rechts eine Folge des Zerfalls der kapitalistische Gesellschaft sind und langfristig die politische Stabilität selbst eines mächtigen Staates wie Deutschland beeinträchtigen können – das Kapital ist ausgezeichnet in der Lage, die Verfaulung des eigenen Systems gegen die arbeitende Bevölkerung zu wenden. Durch die Profilierung dieser Parteien „gegen Hartz“ kann es die Arbeiterproteste auf den bürgerlich-demokratischen Boden der Wahlen lenken, um anschließend für die „Verteidigung der Demokratie gegen die Extremisten“ zu werben.
In Tat und Wahrheit zeigt die Geschichte, dass die bürgerliche Demokratie den wirkungsvollsten Rahmen bietet, um die Durchsetzung der Angriffe des Kapitals beim geringst möglichen Widerstand des Proletariats zu ermöglichen.
Natürlich macht das Kapital stets allgemeine Propaganda in diesem Sinne. Aber heute, angesichts der Schärfe der Wirtschaftskrise und des allmählichen Wiedererwachens des Proletariats reicht das nicht mehr. Das Gedankengut der bürgerlichen Demokratie muss heute unmittelbar verknüpft werden mit Bildern von Arbeitern, die für die eigenen Anliegen demonstrieren; nur so kann die Bourgeoisie ihr Ziel erreichen, die Klassenidentität des kämpfenden Proletariats im Keim zu ersticken.
Nicht durch demokratische Proteste, nicht durch die Unterstützung einiger bürgerlicher Parteien gegen andere, nicht im Kampf Ost gegen West, Beschäftigte gegen Erwerbslose, Deutsche gegen Ausländer, sondern nur durch das „traditionelle“ Mittel des Arbeiterkampfes können wir eine Antwort auf die kapitalistische Krise finden. Durch Streiks, durch Massendemonstrationen, durch direkte und eigenständige Aktionen der Arbeitslosen gegen Kürzungen, Repression und behördliche Einschüchterung, durch die Vereinigung der Arbeiterkämpfe, durch bewusste Klassensolidarität, vor allem durch die Entwicklung einer revolutionäre Perspektive zur Überwindung des Systems können wir unsere eigenständige Klassenantwort auf die Krise des Systems finden.
20.08.2004.
Streik bei Connex-SL: Um ihre Klasseninteressen verteidigen zu können, muss die Arbeiterklasse die Gewerkschaften bekämpfen
- 2843 reads
Aus „Internationell Revolution“ nr. 105 (Zeitung der IKS in Schweden)
Seit Frühjahr 2003 haben wir ein Wiederauftauchen von Klassenkämpfen in einer Reihe von kapitalistischen Kernländern gesehen. 2003 fanden große Streiks und Demonstrationen in Frankreich statt, wo 100000 Arbeiter gegen deutliche Verschlechterungen im Rentensystem protestierten, ebenso kam in Österreich ähnliche Bewegung auf.
2004 sahen wir in Deutschland umfassende Streiks innerhalb der Autoindustrie(GM/Opel, Mercedes/Chrysler), aber auch in anderen Branchen. Alle diese Streiks schoben die Frage von Solidarität in den Vordergrund, als Waffe zur Verteidigung gegen Entlassungen und Lohnsenkungen.
Jetzt im Sommer 2005, mittendrin in schlimmsten Antiterrorkampagnen, haben wir wilde Streiks auf dem Flughafen in London-Heathrow in Großbritannien gesehen, Streiks gegen die Entlassung Hunderter Arbeiter eines Flughafen-Catering-Unternehmens. Die Arbeiter des Catering-Unternehmens und die Arbeiter von British Airways traten gemeinsam in den wilden Streik, um die entlassenen Arbeiter zu verteidigen.
In Schweden sehen wir einen zunehmenden Zorn gegen Entlassungen, Lohnsenkungen und unmenschliche Arbeitsbedingungen. Wir haben Aktionen von Arbeitern in Krankenhäusern in Umeo und in Malmö gesehen, wir haben kürzlich einen wilden Streik der Bauarbeiter auf der Preems Raffinerie in Stenungsund gesehen, wo Hunderte als Subunternehmer angestellte Arbeiter in einen Streik gegen furchtbare Arbeitsverhältnisse traten.
Jetzt sehen wir, wie der Zorn immer stärker bei den Arbeitern bei Connex-SL wird. Wir haben gesehen, wie man sich dort gegen die Entlassung eines Gewerkschafters gewehrt hat. Der Gewerkschafter wurde von Connex provokativ mit der Begründung gekündigt, dass „er das Unternehmen geschädigt hätte und er ihm gegenüber unloyal gewesen wäre“, weil er den Medien kritische Kommentare über Arbeitssicherheit im Unternehmen weitergegeben hätte. Die Arbeitsumstände haben sich bei Connex-SL verschlechtert, genauso wie bei anderen Unternehmen und in anderen Branchen auch, es besteht kein Zweifel, dass schon vor Jahren ein U-Bahnfahrer entlassen wurde und an einem Arbeitsplatzunfall für schuldig befunden wurde, wobei ein Arbeiter starb. Die wirkliche Ursache für diesen Unfall war aber die mangelhafte Sicherheit am Arbeitsplatz, wofür das Unternehmen verantwortlich ist.
Aber dieser Fall war es weder für SEKO (Gewerkschaftsverband) noch für eine andere Gewerkschaft wert, in den Streiks oder andere Aktionen dagegen zu machen. Dies zeigt die Heuchelei der Gewerkschaften, wenn sie heute groß die Trommel rühren für „Solidarität“ für ihren Gewerkschaftsrepräsentanten Per Johansson. Aber das unterstreicht nur die Notwendigkeit, gegen die täglichen Attacken und gegen Willkür am Arbeitsplatz seitens der Arbeitgeber und der Gewerkschaften zu kämpfen.
Um etwas zu erreichen, müssen die Arbeiter die Gewerkschaften bekämpfen!
Aber, wenn man glauben darf, was die Gewerkschaft und die Medien der Bourgeoisie sagen, könnte die Situation gelöst werden, indem man den Vorsitzenden von SEKO wiedereinstellt. Dann müsste man die Frage stellen, sind es nicht gerade die Gewerkschaften, darunter auch SEKO, die bei allem mitmacht und alle Verschlechterungen, die das Kapital der Arbeiterklasse aufzwingt, mitunterschreibt? Sind es nicht die Vertreter SEKO´s, die sagen, sie wären stolz auf SL (öffentliches Verkehrsunternehmen), aber kritisieren die Art, wie Connex (Privatfirma) den Auftrag für SL ausführt. Ist es nicht so, dass das „öffentliche Unternehmen SL“ den Rahmen bestimmt, wie die „private“ Connex den Betrieb betreibt? Ist es nicht so, dass auch die Sozialisten im Management von SL die Handlungsweise von Connex voll unterstützen? Dieselben Sozialisten, die in Stockholms Landsting grünes Licht für „Regelungen“ gegeben haben, den Gesamtverkehr von SL in 5 miteinander konkurrierende Unternehmen zu zerlegen (von denen auch Connex eines ist)? Die selben Sozialisten, die im Führungsstab von SEKO (LO) behaupten, sie würden die Interessen von Arbeiter verteidigen?? Die selben Sozialisten, die seit Jahrzehnten mit in der Regierung sind und ständig die Arbeiterklasse angreifen. Ist es nicht so, dass die Gewerkschaften auf der gleichen Seite wie die Arbeitgeber und der Staat stehen???
Gleichzeitig, wo wir einen immer größeren Zorn und eine immer größere Kampfbereitschaft in der Arbeiterklasse in einer Reihe von Ländern sehen, was ein Ausdruck dafür ist, dass die Arbeiterklasse sich selbst gegen die Folgen der kapitalistischen Krise verteidigt, die die Bourgeoisie auf unsere Schultern zu wälzen versucht, sagen die Massenmedien und die Gewerkschaften, dass der Konflikt bei Connex-SL eine Frage des „Rechts auf freie Meinungsäußerung“ ist, als ob die Arbeiterklasse irgendein „Recht“ in der kapitalistischen Gesellschaft haben könnte!
Die Gewerkschaft und die Medien, besonders die linken Zeitungen, erwecken den Eindruck, als ob die Gewerkschaft angegriffen oder bedroht wäre. Der Vorsitzende von SEKO äußert sich in Medien und besteht darauf, dass „die Entlassung bei Connex ein Angriff gegen die ganze Gewerkschaftsbewegung wäre“, oder dass der Verteidigungskampf der Arbeiter genauso eine Verteidigung der „Meinungsfreiheit“ und der sogenannten „demokratischen Rechte sein könnte. Sie versuchen den echten und berechtigten Zorn der Arbeiter gegen die schon Jahre dauernden Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen in eine Verteidigung der Gewerkschaft und des „demokratischen Staates“ umzuwandeln. Dies geschieht um zu verbergen, dass gerade die Gewerkschaften zusammen mit dem „demokratischen Staat“ die Arbeiterklasse angreifen und hindern. Entweder dadurch, dass die Gewerkschaften das Lohndiktat des Kapitals durch Verträge, die sie abschließen, legitimieren, oder dass der „demokratische Staat“ juristische Repressionen gegen die sogenannten „wilden Streiks“ ausübt.
Dass SEKO jetzt und ganz ungewohnt von einem „politischen Streik“ spricht, dann nur deswegen um ihre tatsächliche Sabotage der wirklichen Streikbewegung zu verbergen. Eine Streikbewegung, die alle Arbeiter vereinen kann, beginnend mit allen Arbeitern innerhalb des ganzen Verkehrsverbundes, mit der Perspektive alle Arbeiter zu erfassen, sowohl des privaten wie auch des öffentlichen Sektors, um ihre Klasseninteressen zu verteidigen.
Trotz bombastischer Rhetorik kann SEKO nicht verbergen, dass sie alles so eingefädelt hatte, dass der Streik, der am 6. Oktober stattfand, ein 3-Stunden Streik bleiben sollte, um von der langangestauten Unzufriedenheit bei den Connex-SL-Angestellten abzulenken, und gleichzeitig konnte SEKO sich „arbeiterfreundlich“ präsentieren, ohne irgendeine juristische Verantwortung zu übernehmen. Den Schlag entgegen zu nehmen, überließen sie, wie gewöhnlich, den Arbeitern.
Der Kampf der Arbeiterklasse und ihre Streiks sind immer politisch, weil sie die Kapitalistenklasse und ihren Staat angreifen.
Es ist die kapitalistische Krise, die die Bourgeoisie zwingt anzugreifen
Verschlechterungen am Arbeitsplatz, Angriffe auf die Arbeitsbedingungen und auf Löhne der Arbeiterklasse, Entlassungen oder die Bedrohung von Entlassungen, ist wirklich nicht etwas, was nur die Arbeiter bei Connex-SL trifft, die Bedrohung könnte nicht minder sein, wenn SL den Betrieb in eigener Regie führen würde, ohne Subunternehmen, wie Connex, Citypendeln oder Swebus!
Die Linken und die Gewerkschaft versuchen uns vorzuflunkern, dass die Situation so viel besser sein könnte, sowohl für die Arbeiter in dem Unternehmen, als auch für die Verkehrsteilnehmer, wenn SL immer noch den Betrieb in sogenannter „öffentlicher Regie“ führen könnte. Als ob die Arbeiter, zum großen Teil in Krankenhäusern, die nach wie vor in „öffentlicher Regie“ geführt werden, bessere Arbeitsbedingungen hätten. Unmutsaktionen, wie neulich bei den Krankenhäusern in Malmö und Umeo, widerlegen erneut diesen Mythos.
Ein anderer Mythos, den die Bourgeoisie verbreitet, dass die Arbeiter im „privaten Sektor“, besonders Industriearbeiter, es so gut hätten(!), überbezahlt wären, und ihnen die Arbeitsbedingungen der Arbeiter im öffentlichen Sektor gleichgültig wären. Natürlich ist diese Art von Gerüchteverbreitung dazu da, um die Arbeiterklasse zu spalten!
Es ist aber so, dass man gerade im „privaten Sektor“ die Arbeiter sehr hart angreift. Wir hören täglich Ankündigungen von Entlassungen, die letzten sind, dass 1500 Arbeiter bei Volvo Personenwagen gehen dürfen, dass Arbeiter bei der Elektrolux Fabrik in Mariestad auf die Straße fliegen und die Fabrik geschlossen wird. Jeden Monat werden Tausende von Arbeitern entlassen!
All dies macht es notwendig, dass die Arbeiterklasse über die katastrophalen Perspektiven nachdenkt, die der Kapitalismus der Arbeiterklasse und der ganzen Menschheit „anbietet“. Von 1968 bis Ende der 80er Jahre kämpften Arbeiter weltweit gegen die kapitalistische Krise. Kennzeichen für diesen Kampf waren, dass er oft die Gewerkschaften und ihre Spaltung von Arbeitern in verschiedene Berufskategorien direkt herausforderte, und dass die Arbeiter den Versuch der Gewerkschaften und Linken, die Arbeiter im öffentlichen Sektor gegen die Arbeiter im „privaten Sektor“ zu stellen, attackierten. Was für diesen Kampf kennzeichnend war, war, dass die Arbeiterklasse ihren Kampf über die lokalen Branchen und Sektoren hinaus auf andere Arbeiterkategorien zu verbreiten versuchte. Dieser Kampf forderte wirklich die Macht der Bourgeoisie und ihres gewerkschaftlichen Anhangs heraus.
Die Arbeiterklasse müsste diese Erfahrung wieder aufnehmen! Die Arbeiter müssten einen vereinigten Kampf gegen die Angriffe des Kapitals und gegen die Verschlechterungen führen.
Die Frage der Solidarität ist lebenswichtig für uns, faktisch eine Frage um Leben oder Tod, aber man kann die nicht den Gewerkschaften überlassen und sie kann auch nicht in der Unterstützung der Gewerkschaften Ausdruck finden, die ja unseren Kampf fesseln!
Flugblatt der Sektion der IKS in Schweden, 16. Okt. 05
Geographisch:
- Schweden [34]
Erbe der kommunistischen Linke:
IKSonline - 2006
- 3201 reads
Februar 2006
- 757 reads
AEG Nürnberg: Internationale Arbeitersolidarität gegen nationalistische Hetze
- 3102 reads
Während wir schreiben, beginnt bei AEG in Nürnberg die dritte Streikwoche. Nach einem Beschluss des schwedischen Mutterkonzerns Elektrolux vom 12.12.05 soll das Werk in Nürnberg bis Ende 2007 geschlossen und die 1750 Beschäftigten entlassen werden. Nach einer von der IG Metall am 18. Januar durchgeführten Urabstimmung wurde drei Tage später am Eingangstor Muggenhoferstrasse mit einem unbefristeten Streik begonnen. Über 96% der Wahlbeteiligten hatten für den Streik gestimmt.
Während wir schreiben, beginnt bei AEG in Nürnberg die dritte Streikwoche. Nach einem Beschluss des schwedischen Mutterkonzerns Elektrolux vom 12.12.05 soll das Werk in Nürnberg bis Ende 2007 geschlossen und die 1750 Beschäftigten entlassen werden. Nach einer von der IG Metall am 18. Januar durchgeführten Urabstimmung wurde drei Tage später am Eingangstor Muggenhoferstrasse mit einem unbefristeten Streik begonnen. Über 96% der Wahlbeteiligten hatten für den Streik gestimmt.
Eine beispielhafte Kampfbereitschaft
Der Kampf bei AEG beweist, dass die Arbeiterklasse angesichts von Massenentlassungen, der stets um sich greifenden Arbeitslosigkeit und der unablässigen Angriffe auf unsere Lebens- und Arbeitsbedingungen zum Kampf entschlossen ist. Die Entschlossenheit der Beschäftigten, Entlassungen und Werksschließung nicht tatenlos, sozusagen als unvermeidliches Naturereignis hinzunehmen, sondern als gesellschaftliche Frage, als Gegenstand des Klassenkampfes aufzufassen, ist beispielhaft. Die Arbeiterklasse ordnet sich der Logik des Kapitalismus nicht unter, weil diese Logik mit den Lebensinteressen der Lohnabhängigen nicht vereinbar ist.
Anders die Konzernleistung und die Politiker, anders auch die IG Metall. Als die Verwalter und Nutznießer der bürgerlichen Gesellschaft besteht die Rolle der Unternehmer, der Staatsvertreter und der Gewerkschaften darin, diesen Gesetzmäßigkeiten den Weg zu ebnen. So erklärt es sich, dass der offizielle Streik erst so spät einsetzte. Keine der ordnungspolitischen Instanzen, welche jetzt so wohlfeil ihre „Solidarität“ verkünden, dachte auch nur eine Sekunde daran, etwas zu unternehmen, um der Durchführung des Schließungsbeschlusses aus Stockholm Steine in den Weg zu legen. Ob IG Metall oder SPD, ob der Betriebsrat der AEG oder der Oberbürgermeister von Nürnberg, alle gehen davon aus, dass die Attraktivität des kapitalistischen „Standorts Deutschland“ entscheidend davon abhängt, dass deutsche wie ausländische Investoren nach Belieben Werke gründen können und auch jederzeit ohne „Belästigungen“ wieder schließen können, wenn woanders höhere Dividenden winken.
Es waren die Arbeiterinnen und Arbeiter selbst, welche dem Kapital den Kampf aufgezwungen haben. Seit Mitte Dezember, als die Schließungsabsicht öffentlich wurde, herrscht im AEG Werk in Nürnberg so etwas wie der Ausnahmezustand. Die Empörung der Beschäftigten war schier grenzenlos. Schon Wochen vor dem Streik forderten die Betroffenen Kampfmaßnahmen. Seitdem wird immer wieder die Arbeit unterbrochen, um zu diskutieren und zu protestieren. Der Krankenstand schnellte auf 20% hoch.
Betriebsrat und IGM wollten den Kampf nicht
Betriebsrat und IG Metall, an der Leitung des Konzerns mitbeteiligt, müssten lange vorher von der Schließung gewusst oder es zumindest geahnt haben. Es heißt sogar, dass von 20 Werken des Elektroluxkonzerns 13 als Kandidaten gelten, geschlossen zu werden. Trotzdem wurde nichts unternommen, um die Betroffenen auf einen frühzeitigen Kampf einzustimmen. Das Gegenteil war der Fall. Die Gewerkschaften stellten die Schließung des Werkes zunächst als eine bereits feststehende Tatsache hin, an der nicht mehr zu rütteln sei, und versuchten die Wut der Betroffenen wegzulenken auf die Frage eines „Sozialplans“.
Diese Vorgehensweise der Gewerkschaften hat Methode. Sie wurde kurz zuvor schon bei Infineon in München genauso praktiziert. Die Proletarier hingegen haben nie akzeptiert, dass das Werk dichtgemacht wird. Sie dachten dabei nicht nur an sich, sondern an die Millionen von Erwerbslosen, welche jetzt schon der Verarmung preisgegeben sind. Und sie dachten an die kommende Generation, welche jetzt schon zum bedeutenden Teil keine andere Zukunft sieht als Ausgrenzung und permanente Unsicherheit. Die Hauptforderungen der Streikenden „ Einrichtung einer Beschäftigungsgesellschaft bis Ende 2010 bei voller Lohnfortzahlung“ und – „Abfindungen in Höhe von 3 Monatsgehältern pro Beschäftigungsjahr“ sind Ausdruck dieses Willens. Sie zielen darauf ab (wie die Streikenden selbst immer wieder beteuern), das Dichtmachen des Werkes kostspieliger zu machen als die Aufrechterhaltung der Produktion.
Mercedes, Opel, AEG
Die Auseinandersetzung in Nürnberg ist der dritte große Kampf des Proletariats in Deutschland in weniger als zwei Jahren gegen Massenentlassungen und gegen die damit verbundenen Erpressungen. Zwar hat es in dieser Zeit viele andere Protestaktionen gegen Entlassungen und Schließungen gegeben: so bei der Telekom, der Deutschen Bank, bei Continental in Hannover oder eben bei Infineon. Dennoch fanden die Kämpfe bei Daimler, Opel und bei AEG ein besonderes Echo innerhalb der gesamten Arbeiterklasse – und zwar nicht nur in Deutschland, sondern international. Dies erklärt sich dadurch, dass es sich in diesen drei Fällen um jeweils Tausende von Betroffenen handelt; um Großbetriebe mitten in städtischen und industriellen Ballungsgebieten; sowie um international operierende Konzerne. Die bedeutendste Gemeinsamkeit liegt jedoch darin, dass man mit großer Entschlossenheit und unter Einsatz der Streikwaffe auf die Angriffe des Kapitals antwortete.
Wir beobachten heute eine steigende Kampfbereitschaft der Arbeiterklasse, nicht nur in Deutschland, sondern international. So hat es in den letzten Wochen z.B. wilde Streiks gegen Entlassungen bei der VW Tochter SEAT in Barcelona gegeben. Diese allmählich anlaufende Kampfeswelle beendet eine sehr lange Phase der zurückgehenden Kampfkraft und des zurückgehenden Klassenbewusstseins nach dem Fall der Berliner Mauer, als man uns mit einigem Erfolg eintrichterte, dass Arbeiterklasse und Klassenkampf nur noch Relikte der Geschichte seien. Jetzt, wo der Klassenkampf wieder auflebt, müssen wir uns wieder daran gewöhnen, nicht nur entschlossen in den Kampf zu treten, sondern auch das Handeln der Gegenseite zu untersuchen und dabei an die Lehren aus den Kämpfen der 70er und 80er Jahre wieder anzuknüpfen. Es ist dabei sehr wichtig, nicht nur die Gemeinsamkeiten zwischen den Kämpfe zu sehen – v.a. die großartige Kampfbereitschaft –sondern auch die Unterschiede. Tun wir dies, so fällt sofort auf, dass die Herrschenden gegenüber Daimler oder Opel sehr darauf aus waren, die Kämpfe möglichst rasch zu beenden. Wovor die Bürgerlichen Angst hatten, war die Solidarität der Arbeiterklasse. Diese Frage stand von Anfang an im Mittelpunkt bei Mercedes im Juli 2004, weil die Beschäftigten in Bremen aus Solidarität mit ihren Kolleginnen und Kollegen in Stuttgart mit in den Streik getreten waren.. Als dann im Oktober 2004 bei Opel Bochum gestreikt wurde, und sowohl im gesamten Ruhrgebiet wie in ganz Europa unter den Opel-Beschäftigten das Gefühl der Solidarität groß war, weigerte sich die IG Metall, diesen Streik offiziell zu unterstützen. So stand diese spontane Arbeitsniederlegung und Werksbesetzung von Anfang bis zum Ende als illegale Aktion unter der Drohung der Repression. Denn die Herrschenden fürchteten ernsthaft, dass das Beispiel der Solidarität bei Daimler hier Schule machen konnte. Auch gegenüber dem U-Bahnstreik in New York Anfang des Jahres, wo die Jetzt-Beschäftigten streikten, um die Pensionen der Neu-Einzustellenden zu verteidigen, ging man mit Hetztiraden, Geldstrafen und Gewaltdrohungen vor, um eine möglichst schnelle Wiederaufnahme der Arbeit zu erzwingen.
Anders bei der AEG in Nürnberg. Dort erleben wir, wie die IG Metall nicht nur die Durchführung des Streiks in die eigenen Händen nahm, sondern sich von vorn herein auf einen Arbeitskampf von mindestens einem Monat festlegte. Wir erlebten, wie der bayerische Ministerpräsident Stoiber sofort nach Nürnberg eilen wollte, um seine „Solidarität“ zu verkünden. Diese Geste eines der mächtigsten Politiker Deutschlands machte sofort klar, dass die Herrschenden zu dem Zeitpunkt nicht daran dachten, gewaltsam gegen die Betriebsbesetzung vorzugehen. Es hat den Eindruck, als ob die Bourgeoisie es diesmal gar nicht so eilig hat, die Flammen des Klassenkampfes auszutreten. Aber warum?
Wie die Herrschenden die Arbeitersolidarität bei der AEG zu zerstören trachten
Des Rätsels Lösung liegt unserer Ansicht nach in der Kombination zweier Faktoren. Einerseits handelt es sich bei AEG in Nürnberg, anders als bei Mercedes oder Opel, nicht nur um Personalabbau, sondern um eine Werksschließung. Dort, wo das Werk ohnehin dicht gemacht werden soll, ist es für die Beschäftigten schwieriger, sich wirksam zur Wehr zu setzen. Das heißt nicht, dass es in solch einer Lage nicht möglich wäre, erfolgreich zu kämpfen. Aber ein solcher Kampf würde einen höheren Grad an Bewusstsein und an Solidarität verlangen, als die kämpfende Klasse im Durchschnitt in der heutigen Zeit schon erreicht hat. Es würde insbesondere bedeuten, die Arbeitersolidarität als ein internationales Prinzip aufzufassen, so dass die Beschäftigten beispielsweise in Polen, wohin die jetzt in Nürnberg angesiedelte Produktion ausgelagert werden soll, nicht als Rivalen, sondern als Kampfgenossen verstanden werden.
Andererseits handelt es sich bei AEG in Nürnberg bekanntlich um ein Werk, das noch schwarze Zahlen schreibt. So können die Besitzenden den „Fall AEG“ ausschlachten, um die vor millionenfacher Arbeitslosigkeit und vor ohne Unterlass rollenden Entlassungswellen stehende Arbeiterklasse daran zu hindern, den Kapitalismus als System dafür verantwortlich zu machen. Man tut so, als ob es im Kapitalismus „pervers“ wäre, sich nicht mit weniger Profit zufrieden zu geben. Es ist aber ein Gesetz des Kapitalismus, dass der Profit, mit dem man sich zufrieden geben muss, vom Markt bzw. von der Konkurrenzsituation diktiert wird. Konzerne nehmen manchmal Verluste über längere Zeit in Kauf, um ihre Rivalen durch Dumpingspreise nieder zu konkurrieren. Andererseits nehmen sie niemals magere Profite hin, wenn die Konkurrenten fettere einstreichen.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass die besitzende Klasse normalerweise kein Interesse daran haben kann, Kampfmassnahmen gegen Entlassungen oder Schließungen zuzulassen. Der Schaden für den kapitalistischen „Standort“ Deutschland, welcher durch die Behinderung einer „ordnungsgemäßen Abwicklung“ eines Betriebes durch Arbeiterkämpfe entsteht, kann dennoch manchmal aufgewogen werden durch ein politisches Ergebnis, welches künftige Entlassungen auf breiter Front leichter durchsetzbar macht.
Im Klartext: Die Kapitalistenklasse nutznießt die verzweifelte Lage der Lohnabhängigen von AEG, um eine trügerische, bürgerliche Sichtweise des Klassenkampfes in der gesamten Arbeiterklasse zu verbreiten. Sie profitiert dabei von der gegenwärtigen Isolation der Betroffenen vom Rest ihrer Klasse. Es instrumentalisiert diesen Kampf, um die längst bürgerlich gewordenen gewerkschaftlichen Methoden anzupreisen und zu verbreiten. Am Beispiel der AEG will die Kapitalistenklasse uns vorführen, dass der moderne Arbeiterkampf darin besteht, in einem einzigen Betrieb so lange zu streiken, bis die Kapitalseite nachgibt. Um die Beschäftigten bei AEG bei der Stange zu halten, hat man beispielsweise am 13. Streiktag im Streikzelt erzählt, dass unlängst bei Marseille eine Belegschaft erfolgreich die Werkschließung verhindert habe durch einen 21 Monate währenden Ausstand. Als diese Nachricht nicht durch Jubel, sondern mit entsetztem Stöhnen quittiert wurde, holte man rasch etwas anderes aus der Trickkiste. Man kündigte eine Anzeigenkampagne in der Bildzeitung an, um Geld zu sammeln für einen langen Streik in Nürnberg. Die „AEGler“, so die gewerkschaftliche Drohung, sollen sich „warm anziehen“.
Abgesehen davon, dass die Bildzeitung vermutlich der finanzielle Hauptnutznießer einer solchen „Solidarität“ wäre, zeigte die Reaktion der Streikenden, dass manche von ihnen erste Zweifel an der Wirksamkeit langer, isolierter Streiks bekommen. Solche Mittel waren wirksam zu einer Zeit, als die Arbeiter einzelnen Kapitalisten gegenüber standen, und nicht wie heute mächtigen Unternehmerverbänden, dem Staatsapparat, ja dem kapitalistischen Weltsystem insgesamt.
Die Kehrseite des isolierten Kampfes, der nichts anderes bedeutet als eine sichere Niederlage, ist die Verzweiflung und Perspektivlosigkeit der Betroffenen. Auf der bereits erwähnten Betriebsversammlung lobten Betriebsrat und IGM das Beispiel von Elektrolux in Spanien, wo im vorigen Jahr die Beschäftigten auf die Werksschließung mit der Zerstörung von Firmeneigentum reagierten. Allein: Auch diese scheinradikalen Aktionen haben das Aus nicht verhindern können.
Proletarier aller Länder, vereinigt euch!
Was den Besitzenden Angst einjagen kann, ist einzig und allein die rasche und selbstständige Ausdehnung des Kampfes, die Entwicklung der Arbeitersolidarität, sowie die politische Infragestellung des Kapitalismus. Weil die Besitzenden dies ganz genau wissen, versuchen sie bei AEG, die Arbeiter gegen einander zu hetzen, sie zu einem Schulterschluss mit ihren eigenen Ausbeutern zu bewegen. So verkünden die Gewerkschafter in Nürnberg immer wieder, der eigentliche Erfolg des Kampfes bei AEG bestünde darin, die Beschäftigten und „ihre Politiker“ zusammenzubringen gegen die international operierenden Konzerne. So erweist sich die scheinradikale Ideologie der „Globalisierungsgegner“ als nationalistische Hetze, welche jetzt dankbar von den Gewerkschaften und der Sozialdemokratie gegen die kämpfenden Arbeiter eingesetzt wird. Sie sehen den „Erfolg“ des Kampfes bei AEG darin, ein Stück weit die „nationale Handlungsfähigkeit der Politik“ zurückerobert zu haben. Sie weisen darauf hin, dass während Stoiber am ersten Streiktag sich anbot, um in „Vermittlungsmission“ nach Stockholm zu reisen, die Elektroluxleitung mittlerweile anfragt, ob sie in München bei der Regierung Hilfe bekommen könne. Was das im Klartext bedeutet, ist folgendes: Man soll sich nicht als Arbeiter gegen die Angriffe des Kapitals zur Wehr setzen, sondern als braver, steuerzahlender Bürger, der sich darüber ereifert, dass „unsere“ Steuern von der EU verwendet werden, um „unsere“ Arbeitsplatze zu vernichten bzw. nach Polen auszulagern (wobei verschwiegen wird, dass Unternehmer auch subventioniert werden, wenn sie Betriebe aus Polen nach Deutschland verlagern, was oft genug vorkommt). Sie wollen nicht, dass wir als Arbeiter an die großartigen Massenstreiks des polnischen Proletariats in den 70er und 80er Jahren denken, und daran ein Beispiel nehmen. Sie wollen nicht, dass die Kämpfenden bei AEG daran denken, dass es andere von Entlassungen Bedrohte in ihrer unmittelbaren Umgebung gibt, dass nicht ein Werk, sondern dreizehn Elektroluxwerke vor dem Aus stehen, dass es 5 Millionen Erwerbslose allein in Deutschland gibt und kaum weniger in Polen: lauter potentielle Mitstreiter gegen das Kapital
Wie sehr diese nationalistische Hetze die Atmosphäre bei AEG bereits vergiftet hat, zeigte der 14. Streiktag am 22. Februar. Erst einen Tag, nachdem er eine raschere Einführung der Heraufsetzung des Rentenalters durchgesetzt hatte, kam der SPD Spitzenpolitiker und derzeitige „Sozialminister“ Müntefering ins Nürnberger Streikzelt – und es wurde ihm zugejubelt.
Nicht die EU Subventionen, nicht besonders raffgierige Einzelkapitalisten, und nicht die internationalen Konzerne, sondern das unsinnig gewordene, zerstörerische Konkurrenzsystem des Kapitalismus ist verantwortlich für der unerträgliche Armut und Unsicherheit der Lohnabhängigen. Nicht der Staat mit seinen Politikern und Gewerkschaften, sondern die anderen Arbeiter sind die Verbündeten des kämpfenden Proletariats. Die Solidarität der Arbeiterklasse ist international.
Internationale Kommunistische Strömung. 03.02.2006.
Geographisch:
- Deutschland [36]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Proletarischer Kampf [37]
Streiks im öffentlichen Dienst
- 2439 reads
Streik im Öffentlichen Dienst
Wofür kämpfen wir? Wer sind unsere Gegner?
Streik im Öffentlichen Dienst
Wofür kämpfen wir? Wer sind unsere Gegner?
Der erste größere Streik im öffentlichen Dienst Deutschlands seit gut einem Jahrzehnt kommt nicht überraschend. Zu brutal sind die Angriffe des Staates, als dass sie ohne weiteres durchgesetzt werden könnten angesichts des Unmuts der Lohnabhängigen. Dazu gehören die Heraufsetzung der Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden, die drastische Kürzung bzw. Streichung von Weihnachts- und Urlaubsgeldern sowie die weitere Flexibilisierung und Intensivierung der Arbeit.
Um diese brutalen Angriffe auf den Lebensstandard und die Gesundheit der Beschäftigten durchzusetzen, greift „Vater Staat“ als Machtorgan der kapitalistischen Klassenherrschaft zu genau denselben Mittel wie die Privatunternehmen: Verleumdung und Repression. So werden die bei Wind und Wetter schuftenden, vielen Gefahren ausgesetzten Müllabfuhrleute oder das Tag und Nacht, an Wochenenden und Feiertagen antretende Krankenpflegepersonal als Faulenzer verunglimpft, weil sie nicht „18 Minuten am Tag“ länger arbeiten wollen. Beinahe das gesamte Pflegepersonal wurde zum Notdienst verpflichtet, was bedeutet, dass sie fristlos entlassen werden, wenn sie streiken. In vielen Bereichen wird den Streikenden unverhohlen damit gedroht, dass man sie dauerhaft durch die Dienste von Privatfirmen ersetzen würde, wenn sie sich nicht dem Diktat der Kapitalseite unterwerfen. Die hetzerischen „freien Medien“ verbreiten Lügen, dass sich die Balken biegen. Obwohl regelmäßig Krankenhäuser geschlossen und andere Dienste des Staates ersatzlos gestrichen werden, wird frech behauptet, die Arbeiter und Angestellten des öffentlichen Dienstes seien privilegiert, da sie sichere Arbeitsplätze hätten!
Die Frage der Arbeitszeit und der Arbeitsplätze
Sowohl die Bosse als auch die Gewerkschaften (vornehmlich Ver.di und der Deutsche Beamtenbund) haben die Frage der Arbeitszeiten in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gestellt. Die Bosse tun dies, um die Öffentlichkeit gegen die Beschäftigten zu hetzen. Dabei handelt es sich keineswegs um ein paar Minuten am Tag länger, die niemandem weh tut, sondern um mehrere Wochen im Jahr, welche unentgeltlich abgearbeitet werden sollen.
Auf Seiten der Gewerkschaften wiederum ist die Frage der Arbeitszeiten ein sehr sensibles Thema. Denn Jahre lang musste die Arbeitszeitverkürzung zwischen 38.5 Stunden im öffentlichen Dienst und der 35 Stundenwoche etwa im Metallbereich als Beweis dafür herhalten, dass trotz Wirtschaftskrise die Gewerkschaften noch imstande seien, etwas für die Arbeiterklasse herauszuholen. Diese Behauptung war eine Lüge. Denn die Arbeitszeitverkürzung ging einher nicht mit Neueinstellungen – wie von den Gewerkschaften versprochen – sondern mit einen verstärkten Stellenabbau, so dass immer weniger Beschäftigte immer mehr in weniger Zeit schaffen müssen. Jetzt aber, da es nicht mehr um Kürzung, sondern die Arbeitszeitverlängerung geht, wird das ganze Ausmaß der hohlen Nichtigkeit der gewerkschaftlichen „Errungenschaften“ sichtbar. Die Vorstellung, dass man mittels von „Reformen“ dieser Art das Dasein der Lohnabhängigen im Kapitalismus erträglicher machen kann, verliert zusehends an Glaubwürdigkeit. Vor allem die Behauptung, der zufolge die Arbeitzeitverkürzung zu Neubeschäftigung und damit zu einer Verminderung der Massenarbeitslosigkeit führen würde, ist durch die Wirklichkeit von fünf Millionen Erwerbslosen widerlegt worden.
Heute ist die „Debatte“ zwischen den Bossen und den Gewerkschaften eine andere geworden. Heute sind es die sog. Arbeitgeber, die ein Mittel parat haben wollen, um die Arbeitsplätze, wenn nicht zu vermehren, so zumindest zu „sichern“. Dieses Wundermittel ist nicht mehr die Verkürzung, sondern die Verlängerung der Arbeitszeit. Aber auch dieses Versprechen der Arbeitsplatzsicherung ist längst widerlegt worden. In unzähligen Betrieben der Privatwirtschaft wurde in jüngster Zeit das unentgeltliche länger Arbeiten im Rahmen von „Beschäftigungspakten“ vereinbart. Ob bei der AEG in Nürnberg oder bei Volkswagen AG, nirgends wurde die Beschäftigung gesichert. Es gibt keinen erkennbaren Grund anzunehmen, dass es im öffentlichen Dienst anders sein wird.
Jetzt argumentieren im öffentlichen Dienst die Gewerkschaften, dass die Arbeitszeitverlängerung vielmehr zu einem weiteren, massiven Personalabbau führen wird. Das ist richtig. Es fragt sich allerdings, weshalb der DGB und seine Betriebsräte dann „Beschäftigungspakte“ munter weiter abschließen und gegenüber den betroffenen Arbeitern propagieren? Es fragt sich außerdem, weshalb die Gewerkschaften im öffentlichen Dienst so sicher sein können, dass die berühmten „18 Minuten“ zum radikalen Personalabbau führen werden? Schließlich wird der einzelne Beschäftigte nicht überflüssig, bloß weil er etwas länger am Arbeitsplatz verweilt. Die Antwort ist ganz einfach: Weil die Gewerkschaften selbst die Voraussetzungen dafür mit geschaffen haben, dass längere Arbeitszeiten der einzelnen Arbeiter direkt in Personalabbau umgesetzt werden können. Das Zauberformel dafür heißt Flexibilisierung. In letzter Zeit wurde es fast durchweg im öffentlichen Dienst durchgesetzt, dass die Beschäftigten nach Bedarf von einem Arbeitsplatz zum anderen springen müssen. Dadurch konnten etliche Jobs vernichtet werden. Die Gewerkschaften und Personalräte haben diesen Prozess aktiv befürwortet und mitgestaltet – natürlich um die „Arbeitsplätze zu sichern“! Jetzt gilt, dass die auf diese Weise erreichte „Ausdünnung der Personaldecke“ „ausgeschöpft“ sei. Durch die Arbeitszeitverlängerung könnte es allerdings verstärkt weitergehen!
Die staatlichen Unternehmer, gemeinsam mit Ver.di und dem DBB, benutzen außerdem die Frage der Arbeitszeiten, um andere Angriffe in den Hintergrund zu schieben, welche noch mehr den Unmut der Lohnabhängigen hervorrufen – wie die Kürzung der Gehälter. Denn nach jahrelanger Senkung der Reallöhne bedeuten die jetzigen Angriffe auf diesem Gebiet die Überschreitung einer Grenze. Sollten die vorgesehenen Maßnahmen Wirklichkeit werden, so würde dies für viele echte Verarmung bedeuten. Da schnappt die Schuldenfalle zu, oder die Bezahlung der Miete wird nicht mehr gewährleistet usw. Darüber legen Bosse und Gewerkschaften die Hülle des Schweigens.
Der Versuch, die Arbeiter an die Interessen des Kapitalismus zu ketten
Aber insgesamt benutzen die „Tarifparteien“ die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, um publikumswirksam darüber zu streiten, welche Tarifpolitik am ehesten die kapitalistische Wirtschaft beflügeln könne. Die Bosse plädieren für rücksichtsloses „Sparen“ auf Kosten der Beschäftigen und auf Kosten der gesamten lohnabhängigen Bevölkerung – insofern deren wirtschaftliches Überleben von Leistungen des Staats abhängt. Das Argument: Die Verschuldung des Staates lasse keinen anderen Weg offen. Tatsächlich hat die Verschuldung des Staates Ausmaße erreicht, wo die Bedienung dieser Last längst zum zweitgrößten Posten des öffentlichen Haushalts geworden ist. Aber das Vorhaben, den Staatshaushalt auf Kosten der Bevölkerung zu „sanieren“, ist nicht nur für die Arbeiterklasse nicht hinnehmbar. Es ist auch eine lächerliche Utopie. Zwar wird in Deutschland gerne darauf hingewiesen, dass in anderen Ländern (das Paradebeispiel sind die USA) die Neuverschuldung des Staates in den letzten Jahren auf Null gedrückt werden konnte. Was dabei verschwiegen wird, ist erstens, dass damit der gesamte, über Jahrzehnte aufgehäufte Schuldenberg keineswegs abgetragen wurde, und zweitens, dass die US Regierung bei der laufenden Neuverschuldung inzwischen neue Rekorde bricht. Außerdem ist nicht nur der Staat, sondern sind die Mehrzahl der Unternehmen und immer mehr Privathaushalte hoffnungslos überschuldet. Diese Überschuldung ist der historische Ausdruck des Bankrotts des kapitalistischen Systems insgesamt, das jahrzehntelang auf Pump, d.h. auf Kosten der Zukunft überlebt hat. Die Abschaffung des Kapitalismus ist die einzige realistische Lösung dieses Problems. Sollte die Arbeiterklasse sich durch das Argument der notwendigen Haushaltssanierung breitschlagen lassen, würde sie nicht nur eine bodenlose Verelendung freiwillig auf sich nehmen, sondern dieses „Opfer“ wäre auch noch völlig sinnlos.
Die Gewerkschaften hingegen argumentieren z. Zt., dass die „leeren Staatskassen“ kein Argument für Reallohnsenkungen seien, da eine „sozial ausgewogenere“ Steuerpolitik auf Kosten der Reichen mit Leichtigkeit die Staatssäckel wieder füllen könne. Sie verschweigen dabei, dass der Kapitalismus ein weltweites Konkurrenzsystem ist, und dass der Wettlauf der nationalen „Standorte“ um die Senkung der Steuerlast der Unternehmen und Investoren längst dazu gehört.
Kurzum: Bosse und Gewerkschaften instrumentalisieren den Streik im öffentlichen Dienst, um der arbeitenden Bevölkerung vorzutäuschen, dass der Kapitalismus keineswegs bankrott ist, sondern lediglich einer „vernünftigen“ Politik und auch Tarifpolitik bedarf, um wieder zu florieren. Dazu passt auch der publikumswirksam ins Szene gesetzte Streit darum, ob Lohnerhöhungen und Lohnsenkungen für die Konjunktur besser seien. Dabei kann weder das Eine noch das Andere die Krise des Kapitalismus überwinden oder auch nur abmildern. Lohnsenkungen dienen einzig und allein den Kapitalisten, die sie durchsetzen – und auch nur solange, bis die Konkurrenz ihre Löhne ebenfalls gesenkt hat. Dass ist für die Arbeiterklasse nichts als ein Teufelskreis nach unten in die absolute Verelendung. Selbstverständlich wächst dadurch die Nachfrage nicht. Im Gegenteil: Der Absatzmarkt schrumpft abermals.
Haben die Gewerkschaften also recht mit ihrer Behauptung, dass Reallohnsteigerungen die Konjunktur beleben würden? Dann fragt sich aber, weshalb die Gewerkschaften überall maßgeblich dabei sind, um die Löhne zu senken? Als Verwalter und Verteidiger des Kapitalismus und deren Arbeitsmarkt sind die Gewerkschaften bzw. die Betriebs- und Personalräte jeweils auf Gedeih und Verderb an bestimmte Unternehmen bzw. Nationalstaaten gebunden, deren Interessen sie dienen. Zwar könnten Lohnerhöhungen beispielsweise in Deutschland vorübergehend durchaus die Konjunktur beleben. Aber der Hauptnutznießer wäre die ausländische Konkurrenz, da das deutsche Kapital einen Teil seiner Konkurrenzfähigkeit dadurch einbüßen würde. Und das ist der Grund, weshalb die Lohnforderungen von Ver.di und von der IG Metall nichts als verlogene Scheinradikalität darstellen.
Lohnerhöhungen sind unbedingt notwendig! Nicht aber, weil sie für den Kapitalismus gut wären, sondern weil sie für die Arbeiterklasse gut und notwendig sind! Die Interessen von Lohnarbeit und Kapital sind entgegengesetzt. Dass ist es, was die „Tarifparteien“ und die Medien gemeinsam vertuschen wollen.
Das Verheerende der gewerkschaftlichen Methoden
Die Art und Weise, wie der Streik im öffentlichen Dienst derzeit geführt wird, dient in Wahrheit nicht der Abwehr der Angriffe, sondern deren Durchsetzung. Die „Arbeitgeberseite“ juckt es wenig, wenn in Stuttgart der Mull sich auftürmt, oder wenn in den Universitätskliniken Patienten möglicherweise weniger gut versorgt werden. Schließlich ist der Staat selbst unablässig damit beschäftigt, öffentliche Leistungen auf Kosten der Sauberkeit, der Hygiene, der Sicherheit und der Gesundheit der Bevölkerung zusammenzustreichen. Vielmehr dient der Streik den Gewerkschaften dazu, ein Gefühl der Hilflosigkeit unter den Betroffenen zu verbreiten, so dass die Angriffe erst recht als unabwendbar erscheinen.
Außerdem benutzen Ver.di und der DBB die Lage, um Einfluss und neue Mitglieder zu gewinnen – nachdem sie in den letzten Jahren eine halbe Million Mitglieder verloren haben. Nicht nur die beteiligten Gewerkschaften haben großes Interesse daran, dass die Angriffe durchgesetzt werden, ohne dass ihr eigenes Ansehen darunter leidet. Der Kapitalismus braucht starke „Verhandlungspartner“, welche nicht nur unterschreiben, was die Ausbeuter brauchen, sondern das, was vereinbart wird, auch gegenüber den Beschäftigten durchsetzen können. Dass im öffentlichen Dienst der Grad der gewerkschaftlichen Organisierung besonders niedrig ist, kann für den Staat v.a. langfristig zu einem Problem werden. Schließlich werden die Angriffe nicht weniger, sondern mehr und heftiger!
Die Idee, dass die Kapitalisten starke Gewerkschaften brauchen, mag überraschen. Ist es nicht Ver.di, welche den jetzigen Streik organisiert und anführt? Nein, es waren die Gewerkschaften, beispielsweise des öffentlichen Dienstes, welche eifrig mitgeholfen haben, seit Anfang der 1990er Jahre zwei Millionen Stellen abzubauen. Wenn sie jetzt publikumswirksam gegen weiteren Abbau „opponieren“, dann nur, um vergessen zu machen, was sie noch in der jüngsten Vergangenheit auf diesem Gebiet alles geleistet haben.
Das Wohlwollen der Bosse und v.a. des Staat gegenüber den Gewerkschaften erklärt sich dadurch, dass die gewerkschaftliche Handlungsweise für die Arbeiterklasse längst unzulänglich und unnutz geworden ist – ja schlimmer noch, geradezu verheerend. Nützlich waren diese Methoden in der Anfangszeit der Arbeiterbewegung, als man nur Einzelkapitalisten gegenüberstand. Was nutzt es aber heute, wenn, wie beim jetzigen Streik, die Beschäftigten von Krankenhäusern oder Autobahnmeistereien sich gegen die ganze Macht des kapitalistischen Staates durchzusetzen versuchen, indem jeder in seiner Ecke nach Möglichkeit versucht, den Verkauf der eigenen Arbeitskraft zu verweigern. Wer da am längeren Hebel sitzen mag? Der moderne Klassenkampf ist nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine politische Angelegenheit. Der Lohn- und Personalabbau sowie die Kürzungen und Streichungen im öffentlichen Dienst betreffen die gesamte Arbeiterklasse, machen die Mobilisierung aller Betroffenen – ob Beschäftigten oder Erwerbslosen – erforderlich. Nicht nur streiken, sondern gemeinsam streiken, dazu noch gemeinsam mächtig demonstrieren – tut Not! Es ist nicht die Arbeitsverweigerung allein, sondern die rasche Ausdehnung und Geschlossenheit des Kampfes, welche die Herrschenden wirklich in Zugzwang bringen werden. Möglichst große Teile der Klasse müssen sich für den Kampf mobilisieren – was ohne Eigenaktivität und Selbstorganisierung nicht einmal denkbar wäre. Dieses Durchbrechen der Passivität erfordert, die Führung des Kampfes aus den Händen der Gewerkschaften zu nehmen und sie in die Hände von souveränen Vollversammlungen zu legen. Beim jetzigen Arbeitskampf gibt es bestreikte Betriebe, wo fast niemand streikt, wo Funktionäre von Ver.di am Haupttor eine lautstarke Streikkulisse nach der Art potemkinscher Dörfer bilden!
Während die Gewerkschaften für die Arbeiterklasse unbrauchbar geworden sind, sind sie für die herrschende Klasse unentbehrlich geworden. Auch das wird in der jetzigen Situation sichtbar. Die Gewerkschaften verhindern einen gemeinsamen Kampf der Betroffenen. Sie verhindern die Ausdehnung des Kampfes. Sie verhindern die Selbstorganisierung des Kampfes durch Vollversammlungen und gewählte Delegierte. Sie verhindern alles, was die Kampfleidenschaft der betroffenen Arbeiter entfachen könnte. Sie zwängen den Klassenkampf in das erstickenden Korsett der gesetzlich vorgeschriebenen Wege und des tarifrechtlichen Dschungels, wo man ein Rechtsanwalt sein müsste, um überhaupt herauszufinden, für welche Forderungen man kämpfen darf. So wissen scheinbar die wenigsten „Bediensteten“ der Länder z.B., dass sie für die Durchsetzung von Vereinbarungen streiken, welche beim Bund und in den Kommunen bereits gelten, und im Namen der Modernisierung des Dienstrechts die Flexibilisierung und die Konkurrenz der Arbeiterinnen und Arbeiter untereinander steigern werden. Ein Teil des Lohns soll als Prämierung an den Fleißigsten (oder Unterwürfigsten) ausbezahlt werden. Diese Vereinbarung – das muss man wissen – baut die bisher bezahlten Ortszuschläge ab und erlaubt Einstiegslöhne von 1200 Euro monatlich!
Nur die Entwicklung einer Kultur des selbständigen, gemeinsamen, selbstorganisierten, auf die Interessen des Kapitalismus keinerlei Rücksicht nehmenden Kampfes wird die Arbeiterklasse imstande setzen, sich wirkungsvoll gegen solche Angriffe zur Wehr zu setzen.
Internationale Kommunistische Strömung
17.02.2006
Erbe der kommunistischen Linke:
April 2006
- 826 reads
1 MAYIS İŞÇİ SINIFININ ENTERNASYONAL MÜCADELE GÜNÜDÜR
| Attachment | Size |
|---|---|
| 10.19 KB |
- 4886 reads
1 Mayıs uzun bir süredir işçi sınıfı için hiçbir şey ifade etmeyen anlamsız bir gösteriye dönüştürülmüş durumda. Köken olarak 1 Mayıs işçi sınıfının gerçek uluslararası dayanışmasının günü olmasına rağmen, bugün 1 Mayıs eylemlerinde gördüğümüz tek şey çeşitli renklerden sol grupların işçi sınıfını o veya bu ulusalcılıkları desteklemeye çağırmasından ibaret. Bu gösteride bir yanda Türkiye’nin NATO üyesi bir ülke olduğu gerçeğini görmezden gelerek “bağımsız bir Türkiye” den ve üstelik “emperyalistlere” karşı mücadeleden bahseden Türk ulusalcı solu duruyor. Diğer yanda ise Devletin güneydoğuda uyguladığı barbarca şiddete karşı, sanki onlar Türk milliyetçiliğinin aynı ölçüde vahşi bir yansıması değilmiş gibi Kürt milliyetçiliği yanında saf tutanlar konumlanmış durumda. Bütün bu maskeli baloya Ortadoğu emekçilerinin kanı üzerinden yükselen ve İslami-kapitalist diktatörlüklerin yanında saf tutan kaypak bir anti-amerikancılığa tutunmuş her türden İslamcı, milliyetçi ve sol akım da katılıyor. Peki bütün bunlar ne için? Kendi “özbeöz” Türk veya Kürt patronlarımıza sahip olabilmemiz için. Biz bütün bu gösteriden nefret ediyoruz Fakat, işçi sınıfının enternasyonalist dayanışma ilkelerinin bugün için yalnızca küçük bir azınlık tarafından savunuluyor olması, sınıflar arasındaki mücadelenin bu temel niteliğini değiştirmiyor.
Biz, ABD’ye baktığımızda sadece Bush’u değil, aynı zamanda, ırkçı, göçmen düşmanı yasaya karşı 10 Mart günü Şikago’da yürüyen 100.000 işçiyi de görüyoruz.
Sadece savaşa yürüyen dev bir emperyalist yıkım makinesini değil, “kendi ülkelerinin çıkarları” için Irak’ta savaşmayı reddedip Kanada sınırından kaçarak ulusal ordularını terk eden 6000’i aşkın amerikan askerini de görüyoruz.
İngiltere’ye baktığımızda sadece Blair’i değil, Londra sokaklarında savaşa karşı yürüyen 1.000.000 insanı da görüyoruz.
Biz sadece İngiliz hükümetinin Amerika’ya itaatini değil, 14 şubat’ta Irak’a gitmeyi reddettiği için hapse atılan İngiliz kraliyet hava gücü subayı Malcolm Kendall’ı da görüyoruz.
Benzer şekilde Irak’a baktığımızda gördüğümüz sadece milliyetçi ve İslamcı direniş değil, Kerkük’te ağır yaşam koşulları ve yüksek elektrik ve benzin fiyatlarına karşı ayaklanan binlerce işçidir de.
İran’a baktığımızda sadece başkan Mahmut Ahmedinecat ve devletin “emperyalizme karşı” nükleer silahlanma hamlesini değil, İran’ı boydan boya saran ve otobüs şoförleri, tekstil işçileri, madenciler ve otomobil sanayi işçilerinin katıldığı grev dalgasını da görüyoruz..
Emekçiler, Fransa’daki son grevlere, genç işçilerin işten atılmasını kolaylaştırmaya çalışan yasaya karşı mücadele eden grevci işçilere ve eylem yapan öğrencilere bakın. Britanya’da 80 yıldan beri gerçekleşen en büyük greve, 1.000.000’un üzerinde işçinin emeklilik hakları için yürüttüğü mücadeleye bakın. İran’a, rejimin baskılarına rağmen devlete ve sermayeye karşı mücadele eden işçilere bakın. Baktığınızda göreceğiniz şey şu veya bu ulusalcı, milliyetçi hareket değil kendi ulusal sermaye sahiplerine, kendi patronlarına ve kendi ordularına karşı savaşan işçilerden başka bir şey olmayacaktır. İşçi sınıfı mücadelesinin tek gerçekliği uluslarüstüdür, enternasyonaldir. Çünkü;
İşçi Sınıfının Vatanı Yoktur
YAŞASIN ENTERNASYONALİZM VE EMEKÇİLERİN MÜCADELESİ
Enternasyonalist Kömunist Sol: Solkomü[email protected] [39]
Bu bildiri, Turkiye, Britanya ve Almanya’da dagitiliyor. Britanya ve Almanya’da dagitim, bildirinin savundugu entrernasyonalist bakis açisini sahiplenen Enternasyonal Komünist Akım (Internationale Kommunistische Strömung) tarafından saglaniyor.
Die Solidarität der Studentenbewegung: Ein Vorbild für die gesamte Arbeiterklasse
- 3273 reads
Die Studentenbewegung in Frankreich gegen den CPE (das neue Gesetz über den „Erstanstellungsvertrag“) ist Teil des Kampfes der weltweiten Arbeiterklasse. Diese Bewegung bricht mit dem vorwiegend klassenübergreifenden Charakter der vorangegangenen Bewegungen der studentischen Jugend. Angesichts des harschen Angriffs gegen die jungen Arbeitergenerationen, wobei die Unsicherheit im Namen des „Kampfes gegen die Unsicherheit“ institutionalisiert wird, erkannten die StudentInnen auf Anhieb den Klassencharakter ihres Kampfes.
Während Teile der Bewegung spezifisch studentische Forderungen - etwa der Rückzug des „LMD“ (Licence-Master-Doctorat, die europäische Norm des Universitätslehrgangs) - mit der zentralen Forderung des Rückzugs des CPE verbinden wollten, setzten sich in den studentischen Vollversammlungen nur diejenigen Forderungen durch, welche die gesamte Arbeiterklasse betreffen.
Die Kraft dieser Bewegung kam durch den entschiedenen Kampf auf dem Klassenterrain der Unterdrückten gegen die Unterdrücker zustande. Die Methoden und Prinzipien des Kampfes entstammen der Arbeiterklasse. Das erste dieser Prinzipien ist die Solidarität: An die Stelle des „Jeder-für-sich“ und der Idee „eines erfolgreichen Studiums, zwei disziplinierte Jahre, um sich anschliessend durch zu lavieren“ trat die einzig mögliche Haltung der Arbeiterklasse, um die Angriffe des Kapitalismus abzuwehren: der vereinte Kampf. Die Studenten solidarisierten sich nicht nur untereinander, sondern wandten sich von Anbeginn an die Lohnarbeiter, nicht nur, um ihre Solidarität zu gewinnen, sondern weil die Gesamtheit der Arbeiterklasse betroffen ist. Durch ihre Dynamik, ihre Kampfbereitschaft und ihre Aufrufe konnten die Studenten in manchen Fakultäten die Lehrerschaft und das Verwaltungspersonal für den Kampf gewinnen und gemeinsame Vollversammlungen abhalten.
Ein weiterer deutlich proletarischer Zug der Bewegung besteht im Willen, das Bewusstsein innerhalb der Bewegung zu entwickeln. Am Anfang des Streiks der Universitäten standen die Blockaden. Diese wurden aber nicht als „Kräfteschlag“ verstanden, bei dem eine „Minderheit von Verrückten der Mehrheit ihren Willen aufdrängt“. Es sind dies Vorwürfe, wie sie von kleinen Gruppen von „Anti-Blockierern“ in weißen Erstkommunionsgewändern jeden Sonntag nach der Messe ertönen. Tatsächlich aber sind diese Blockaden das Mittel der Studenten, die sich der Bedeutung ihres Kampfes bewusst sind und ihre Entschlossenheit demonstrieren wollen, um möglichst viele Studenten für die Vollversammlungen zu gewinnen. Hier konnten viele zögernde StudentInnen, die sich der Ernsthaftigkeit der Regierungsangriffe nicht bewusst waren, mittels Debatten und Argumenten von der Notwendigkeit des Kampfes überzeugt werden.
Diese Vollversammlungen sind durchaus der Arbeiterklasse eigene Kampfmittel. Durch sie wurde eine zunehmende Organisierung möglich und sie sind zum Motor der Bewegung geworden. Sie bildeten Streikkomitees und Kommissionen, die jenen gegenüber verantwortlich sind. Bei üblichen Gewerkschaftsversammlungen sind im Allgemeinen nur Leute aus demselben Betrieb oder allerhöchstens Befugte aus anderen Betrieben oder höheren Gewerkschaftsinstanzen zugelassen. Ganz anders bei diesen Vollversammlungen: Sie sind nach außen offen und nicht in sich abgeschlossen, studentische Delegationen wurden an die Vollversammlungen anderer Universitäten geschickt. Dadurch wurde nicht nur die Solidarität und das Vertrauen in die eigene Stärke gefördert, auch konnten einige Vollversammlungen ihre kämpferische Atmosphäre auf andere übertragen, so dass von den Vorsprüngen der am weitesten entwickelten Vollversammlungen profitiert werden konnte. Dies ist ein wichtiges Merkmal der Dynamik von Arbeiterversammlungen innerhalb einer Bewegung, in der die Klasse ein fortgeschrittenes Niveau im Bewusstsein und bei der Organisierung erreicht hat. Die Öffnung der Vollversammlungen nach außen beschränkte sich nicht auf Studenten anderer Universitäten, sondern bot auch Leuten außerhalb des universitären Betriebs die Möglichkeit mitzukämpfen. Vor allem Arbeiter oder Rentner, Eltern oder Grosseltern der kämpfenden Studenten oder Gymnasiasten wurden im Allgemeinen von den Versammlungen mit Begeisterung und Interesse empfangen, wenn sie für eine Verstärkung und Ausweitung der Bewegung, v.a. zugunsten der Lohnabhängigen, eintraten.
Diese beispielhafte Mobilisierung der Studenten, die auf dem Terrain und mit den Methoden der Arbeiterklasse zustande kam, sah sich einer heiligen Allianz der verschiedenen Pfeiler der kapitalistischen Ordnung gegenüber: der Regierung, der Repressionskräfte, der Medien und der Gewerkschaftsorganisationen.
Die Strategie der Zermürbung durch Gewalt
Die Regierung hatte mehrere Tricks versucht, um ihr verruchtes Gesetz in Kraft zu setzen. Vor allem der Entscheid, es in den Schulferien vom Parlament annehmen zu lassen, zeugt von grossem „Feingefühl“. Aber die Absicht schlug fehl: die studentische Jugend liess sich nicht demoralisieren und demobilisieren. Die jetzt umso aufgebrachtere studentische Jugend verstärkte ihre Mobilisierung. In einem zweiten Eindämmungsversuch sollte verhindert werden, dass die Sorbonne gleich anderen Universitäten den kämpfenden Studenten als Treffpunkt und Ort der Umgruppierung dienen kann. Zu diesem Zweck sollte die Kampfbereitschaft der Studentenschaft aus der Pariser Region um dieses Symbol polarisiert werden. Zuerst gerieten einige in diese Falle. Bald aber zeigte sich die Reife der Mehrheit der Studenten, indem sie sich nicht auf die täglichen Provokationen der schwer bewaffneten CRS-Truppen (Polizei-Spezialeinheit) inmitten des Quartier Latin einließen. Sodann kam die nächste Falle von Seiten der Regierung, in Verbindung mit den Gewerkschaften, mit denen die Demonstrationsstrecken vereinbart werden: Die Pariser Demonstranten wurden an der Demonstration vom 16. März, als der Demonstrationszug seinen Endpunkt erreicht hatte, von Polizeikräften eingekesselt. Zwar liessen sich die Studenten nicht auf diese Provokation ein, aber die Jugend aus den Banlieues verstrickte sich in Gewaltakte und war damit ein gefundenes Fressen für die Fernsehsender. Die Gewaltakte verlagerten sich am späteren Abend zur Sorbonne, ein nicht zufälliger Ort zur Isolierung der Demonstranten. Die Gewalttätigkeit sollte diejenigen einschüchtern, die an der für zwei Tage später geplanten großen Demonstration teilnehmen wollten. Auch diesmal ging die Rechnung der Regierung nicht auf: die Teilnahme an der nächsten Demonstration war immens. Schließlich wurden an der Demonstration vom 23. März die „Randalierer“ sogar mit dem Segen der Polizeikräfte auf die Demonstranten losgelassen, damit sie diese zu berauben oder schlagen. Viele Studenten wurden durch diese Gewalt demoralisiert: „Wenn die CRS uns verprügelt, so gibt es sofort Leute, die sich mit uns solidarisieren, sind es aber die Jugendlichen aus den Banlieues, für die wir ja auch kämpfen - das demoralisiert.“ Die Komplizenschaft der Polizei bei der Gewalttätigkeit der Jugendlichen aus den Banlieues war aber so offensichtlich, dass sich die Wut nichtsdestotrotz hauptsächlich gegen die Behörden richtete. Daher auch das Versprechen Sarkozys, die Polizei würde keine weiteren Aggressionen dieser Art gegen die Demonstranten dulden. Offensichtlich setzt die Regierung auf die Karte der „Zermürbung“. Dabei setzt sie vor allem auf die Verzweiflung und die blinde Gewalt einiger Jugendlicher aus den Banlieues, die Opfer eines Systems sind, welches sie mit extremer Gewalt aufreibt. Auch hier war die Reaktion vieler Studenten lobenswert und verantwortungsbewusst: Anstatt sich auf weitere Gewaltaktionen gegen die jungen „Randalierer“ einzulassen, wurden – beispielsweise an der Uni Censier – eine „Banlieue-Kommission“ gegründet, um das Gespräch mit jenen Jugendlichen aus den verfallenen Bezirken zu suchen. Es sollte erklärt werden, dass der Kampf der Studenten und Gymnasiasten auch für jene Jugendlichen steht, die unter massiver Arbeitslosigkeit und Ausgrenzung leiden.
Die Medien im Dienste Sarkozys
Auf verschiedene Versuche der Regierung, die kämpferischen Studenten zu demoralisieren oder sie in ständigen Konfrontationen mit der Polizei „leer laufen“ zu lassen, antworteten die Studenten sehr besonnen und vor allem würdig. Von Würde ist dagegen bei den Medien nicht zu sprechen. Diese haben sich in ihrer kapitalistischen Propaganda selbst übertroffen. Im Fernsehen wurden Gewaltszenen, zu denen es am Ende einiger Demonstrationen kam, bis zum Gehtnichtmehr in den Nachrichten gezeigt, wohingegen die Vollversammlungen, die Organisation und die bemerkenswerte Reife der Bewegung verschwiegen wurden. Da aber die Gleichsetzung von kämpfenden Studenten und „Randalierern“ keineswegs überzeugt, macht sogar Sarkozy wiederholt eine klare Unterscheidung zwischen den gesitteten Studenten und den „Ganoven“. Dies hindert die Medien nicht, ihre Palette von obszönen Gewaltszenen zu zeigen, wobei Bilder von Paris gleich vor weitere Gewaltszenen wie dem israelischen Angriff auf das Gefängnis in Jericho oder etwa einem Terrorattentat in Irak gestellt werden. Nach dem Misserfolg der genannten Regierungsmaschen ist nun die Zeit für die Spezialisten psychologischer Manipulation gekommen. Es geht um die Erweckung von Angst, Abscheu und die unbewusste Assimilierung der Gleichsetzung von Demonstration und Gewalt, wenn auch die offizielle Botschaft das Gegenteil behauptet.
Die Rolle der Gewerkschaften
Die Mehrheit der Studenten und Arbeiter haben diese Fallen und Manipulationen als solche erkannt. Daher musste die 5. Kolonne des bürgerlichen Staates, die Gewerkschaften, sich der Sache wieder annehmen und zu härteren Mitteln greifen. Die Regierung unterschätzte die Kampfbereitschaft und das Bewusstsein der jungen Kämpfer der Arbeiterklasse und manövrierte sich selbst in eine Sackgasse. Sie kann nicht zurückweichen. Raffarin sagte es schon 2003: „Nicht die Straße regiert.“ Eine Regierung, die in die Defensive gegenüber der Straße gerät, verliert ihre Autorität und öffnet die Türe für noch viel bedrohlichere Bewegungen. Dies gilt in der jetzigen Situation umso mehr, da enorme Unzufriedenheit in den Rängen der Arbeiterklasse, gründend auf steigender Arbeitslosigkeit, Unsicherheit und täglichen Angriffen auf die Lebensbedingungen herrscht. Seit Ende Januar haben die Gewerkschaften „Aktionstage“ gegen den CPE organisiert. Und seitdem die Studenten den Kampf aufgenommen haben und die Lohnabhängigen ihrerseits zum Kampf aufgefordert haben, treten die Gewerkschaften in einer lange nicht gesehenen Einigkeit auf. Sie präsentieren sich als die treuesten Alliierten der Bewegung. Aber man darf sich nicht von der scheinbaren Unnachgiebigkeit täuschen lassen: Von den Gewerkschaften gehen keine wirklichen Bemühungen aus, um die Gesamtheit der Arbeiterklasse zu mobilisieren.
Während im Fernsehen öfters radikale Töne von Thibault, Mailly und Konsorten zu vernehmen sind, so herrscht auf Betriebsebene Funkstille. Oft erreichen – wenn überhaupt - Flugblätter mit Streikaufrufen die Betriebe erst am genannten Streiktag selbst, oder gar am Tag danach. Die wenigen von den Gewerkschaften organisierten Vollversammlungen fanden in Betrieben statt, wo die Macht der Gewerkschaften ausgesprochen gut verankert ist (z.B. EDF und GDF), sodass sie nicht befürchten müssen, überstimmt zu werden. Diese Versammlungen haben außerdem mit jenen seit einem Monat in den Universitäten gehaltenen Vollversammlungen nichts gemein. In den gewerkschaftlichen Versammlungen sind die Arbeiter gehalten, artig nickend die ermattenden Reden der permanenten Gewerkschafter über sich ergehen zu lassen, damit jene ihre Rekrutierungstournee in Hinsicht der nächsten Wahlen für das Betriebskomitee oder der „Personaldelegierten“ durchführen können. Nicht umsonst bestand Bernard Thibault bei seinem Fernsehauftritt vom 26. März in der „Grand Jury RTL“ darauf, dass die Lohnabhängigen ihre eigenen Kampfmethoden hätten, dass diese sich von denjenigen der Studenten unterscheiden würden und dass daher keine der beiden Seiten als Vorbild für die andere dienen könne. Kein Wunder, denn würden die Lohnabhängigen die Methoden der Studenten übernehmen, so würden die Gewerkschaften die Kontrolle verlieren und damit auch ihre Rolle als Hüter der herrschenden sozialen Ordnung! Eben darin besteht aber ihre Hauptrolle innerhalb der kapitalistischen Ordnung. Ihre Reden, mögen sie in der jetzigen Situation auch radikale Töne enthalten, sind nur dafür da, das Vertrauen der Arbeiter zu bewahren und auf diesem Wege ihre Kämpfe zu sabotieren, in einer Situation, in der Regierung und die Arbeitgeber in Gefahr geraten können.
Diese Tatsache müssen sich nicht nur die Studenten, sondern die Gesamtheit der Arbeiter auch für die zukünftigen Kämpfe vor Augen halten.
Zum jetzigen Zeitpunkt kann die weitere Entwicklung der Situation nicht vorhergesehen werden. Eines steht fest: Auch wenn die Heilige Allianz zwischen den Beschützern der kapitalistischen Ordnung dem beispielhaften Kampf der Studentenschaft ein Ende zu setzen vermag, dürfen die Studenten ebenso wie die übrigen Teile der Arbeiterklasse nicht der Demoralisierung verfallen. Schon zwei sehr wichtige Siege konnten sie verbuchen: Einerseits wird die Bourgeoisie in nächster Zeit für ihre eigene Sicherheit ihre Angriffe begrenzen müssen. Andererseits ist dieser Kampf eine nicht zu überschätzende Erfahrung für eine neue Generation von Kämpfern für die Sache der Arbeiterklasse.
Vor über anderthalb Jahrhunderten hiess es im Kommunistischen Manifest: „Von Zeit zu Zeit siegen die Arbeiter, aber nur vorübergehend. Das eigentliche Resultat ihrer Kämpfe ist nicht der unmittelbare Erfolg, sondern die immer weiter um sich greifende Vereinigung der Arbeiter.“ Die Errungenschaften des gegenwärtigen Kampfes bestehen in der Solidarität und Dynamik des Kampfes, in seiner kollektiven Aufnahme durch die Vollversammlungen. Diese Errungenschaften sind Wegweiser für zukünftige Kämpfe der gesamten Arbeiterklasse.
Internationale Kommunistische Strömung, 28. März 2006
Geographisch:
- Frankreich [32]
Aktuelles und Laufendes:
- Arbeiterkampf [40]
In Deutschland wie in Frankreich wird die Zukunft vorbereitet
- 2649 reads
Während der große Kampf der proletarischen Jugend in Frankreich gegen die Abschaffung des Kündigungsschutzes (das „CPE“) die Sympathie und teilweise die aktive Unterstützung der dortigen Arbeiterklasse gewonnen hat, liest sich die Berichterstattung der bürgerlichen Medien über die soziale Lage im Nachbarland Deutschland wie ein Bericht von einem anderen Stern. In Anbetracht des sich seinem Ende zuneigenden Streiks der Müllwerker und anderer Beschäftigter des öffentlichen Dienstes, der Ärztestreiks im ganzen Land und der ersten Warnstreiks und Protestkundgebungen der Metaller „beklagen“ die Schreiberlinge der herrschenden Klasse das „Ende der Solidarität“, das „Jeder für sich“ der Lohnabhängigen in Deutschland.
Während der große Kampf der proletarischen Jugend in Frankreich gegen die Abschaffung des Kündigungsschutzes (das „CPE“) die Sympathie und teilweise die aktive Unterstützung der dortigen Arbeiterklasse gewonnen hat, liest sich die Berichterstattung der bürgerlichen Medien über die soziale Lage im Nachbarland Deutschland wie ein Bericht von einem anderen Stern. In Anbetracht des sich seinem Ende zuneigenden Streiks der Müllwerker und anderer Beschäftigter des öffentlichen Dienstes, der Ärztestreiks im ganzen Land und der ersten Warnstreiks und Protestkundgebungen der Metaller „beklagen“ die Schreiberlinge der herrschenden Klasse das „Ende der Solidarität“, das „Jeder für sich“ der Lohnabhängigen in Deutschland. Es wird darauf hingewiesen, dass, während im öffentlichen Dienst gestreikt wird, um eine Verlängerung der Wochenarbeitszeit über 38,5 Stunden hinaus zu verhindern, die Ärzte die Arbeit niederlegen, um Arbeitszeiten bis zu 60 Stunden - nicht gekürzt, sondern bezahlt - zu bekommen. Und während es im öffentlichen Dienst nur noch darum zu gehen scheint, um wie viel die Gehälter gekürzt werden, fordern die Metaller 5% mehr Lohn, die Ärzte sogar 30%.
Somit wird die derzeitige soziale Lage in Frankreich und in Deutschland folgendermaßen von den Kommentatoren analysiert: Während der Kampfgeist und die Solidarität westlich des Rheins als Überbleibsel einer längst vergangenen „Revolutionsromantik“ eingeordnet wird, welche den noch nicht in der Moderne angekommenen Franzosen eigen sein soll, hat man den Berufsegoismus als Hauptmerkmal der Lage in Deutschland, und als das eigentlich zeitgemäße und zukunftsträchtige Verhalten ausgemacht.
Bestandteile einer internationalen Reifung
Was stimmt nun wirklich an dieser Lagebeschreibung, welche - oberflächlich betrachtet - mit einigen wohlbekannten Tatsachen übereinzustimmen scheint? Es ist eine Tatsache, dass der Klassenkampf in Frankreich für gewöhnlich rascher einen explosiven und offen politischen Charakter annimmt als in Deutschland. Es stimmt auch, dass dieser Unterschied mit der Geschichte zu tun hat, wobei die heutigen Kämpfe in Frankreich weniger mit der großen bürgerlichen Revolution von 1789 zu tun haben als mit der langen Tradition der Aufstände und Massenkämpfe des französischen Proletariats – vom Juniaufstand 1848 und der Pariser Kommune 1871 bis zum Massenstreik von Mai/Juni 1968. Richtig ist auch, dass das unmittelbare Potenzial für eine Ausdehnung der Arbeiterkämpfe in Deutschland heute im Vergleich zu Frankreich als sehr gering erscheint. Während in Deutschland alle - ob öffentlicher Dienst, Ärzteschaft oder Metaller - für sich in ihrer Ecke im Rahmen der traditionellen, regelmäßig wiederkehrenden Tarifverhandlungen agieren und dabei von den Gewerkschaften sorgfältig kontrolliert und auseinandergehalten werden, gewann der Kampf der proletarischen Jugend an den Schulen und Universitäten Frankreichs schnell den Charakter einer Massenbewegung. Während diese Jugend wochenlang um die Ausdehnung ihres Kampfes auf die Beschäftigten in den Betrieben rang, gibt es in Deutschland derzeit selbst dort, wo unterschiedliche Berufssparten in ein und demselben Unternehmen zur selben Zeit zum Streik aufgerufen werden (wie die Ärzte und das Pflegepersonal in den Universitätskliniken) nicht mal Ansätze eines gemeinsamen Kampfes. Und während in Frankreich die Bewegung vor allem am Anfang selbstorganisiert war, gibt es in der Bundesrepublik momentan nirgendwo sich selbstbestimmende Vollversammlungen der Streikenden.
Das sind die Tatsachen oder besser: einige der Tatsachen. Was aber sind die ausschlaggebenden Tatsachen? Die ausschlaggebende Tatsachen sind der immer offensichtlichere Bankrott des Kapitalismus, die Verschärfung der Angriffe gegen die Arbeiterklasse aller Länder sowie die internationale Wiedererstarkung des Klassenkampfes. Hat man dies erst begriffen, wird das Gemeinsame der sozialen Lage in Frankreich und Deutschland verständlich. Da die Arbeiterkämpfe von heute mit einer unterirdischen, aber punktuell immer wieder an die Oberfläche tretenden Bewusstseinsreifung einhergehen und inzwischen immer mehr von einer neuen Generation mitgetragen werden, tragen sie zu einer Entwicklung bei, welche zukünftige Massenstreiks ankündigt und vorbereitet. Das „Geheimnis“ der jetzigen Lage sowohl in Frankreich als auch in Deutschland liegt in der – noch embryonalen – Reifung der Bedingungen des Massenstreiks als typischer Kampfform des Proletariats in der Niedergangsphase des Kapitalismus. Die Vorbereitung dieser Entwicklung wird in Frankreich erkennbar anhand der Massivität der Kämpfe sowie dem Drang der Studentinnen und Studenten, ihre Bewegung auf die gesamte Klasse auszudehnen. Die diesbezügliche Vorbereitung in Deutschland erkennen wir wiederum in der Gleichzeitigkeit der Kämpfe verschiedener Sektoren, in der Einbeziehung bisher nie im Streik erprobter Bereiche wie der Ärzteschaft sowie in der herausragenden Rolle, welche gerade in Deutschland das Industrieproletariat im Kampfgeschehen immer noch spielt. Am wichtigsten aber ist heute die Gleichzeitigkeit des Kampfes dieser beiden zentralen Abteilungen des kontinentaleuropäischen Proletariats im Kontext der weltweiten Wiedererstarkung des Arbeiterkampfes. Denn während links and rechts des Rheins gekämpft wird, streikten über eine Million kommunaler Beschäftigter in Großbritannien gegen die Streichung von Rentenansprüchen, demonstrierten katholische und protestantische Postangestellte gemeinsam in Belfast, protestierten Hunderttausende eingewanderter Proletarier in den USA gegen ihren Status als Illegale. Erst im vergangenen Jahr gab es die große Streikbewegung in Argentinien, die spektakulären Arbeitsniederlegungen bei der U-Bahn in New York und Stockholm und am Flughafen Heathrow in London sowie zum Jahreswechsel die Proteste gegen Massenentlassungen bei der AEG in Nürnberg und bei Seat in Barcelona usw. Wie bereits am Anfang des 20. Jahrhunderts (mit Schwerpunkt 1905 in Russland) am Ende des 1. Weltkriegs oder ab 1968 mit der Beendigung der stalinistischen Konterrevolution tritt der Massenstreik nicht nur als internationale Erscheinung auf, sondern wird schon zuvor im Weltmaßstab durch eine Reihe mehr oder weniger bedeutsamer Scharmützel vorbereitet.
Der Streik im öffentlichen Dienst
Nach fast neun Streikwochen und der Tarifeinigung für die baden-württembergischen Kommunen scheint der längste Arbeitskampf der Nachkriegsgeschichte im öffentlichen Dienst zumindest auf kommunaler Ebene zu Ende zu gehen. Demnach werden die etwa 220.000 Kommunalbeschäftigten im Südwesten ab dem 1. Mai eine 39-Stunden-Woche haben. Derzeit steht allerdings ein Abschluss auf Länderebene immer noch aus. Obwohl die Gewerkschaften versuchen, das negative Ergebnis herunterzuspielen oder gar als Sieg der Streikenden darzustellen, ist es klar, dass in puncto Arbeitszeit für das Kapital ein Dammbruch erzielt wurde. Ab sofort werden die Ausbeuter sich bemühen, über die bereits erreichte Ausdehnung hinaus die Arbeitszeit noch weiter zu verlängern bzw. sie auf die gesamte Arbeiterklasse auszudehnen.
Abgesehen davon liegt die Bedeutung dieses Konfliktes vor allem darin, dass der Streikaufruf der Gewerkschaft Ver.di nur von relativ wenigen Beschäftigten befolgt wurde. In den ersten Streikwochen bildeten die Müllwerker die Vorhut der Bewegung. Als sich aber nach fünf Streikwochen noch immer keine Aussicht auf Erfolg abzeichnete, begannen auch diese sehr kampferfahrenen Arbeiter, auf breiter Front die Arbeit wieder aufzunehmen. Dabei äußerten viele von ihnen das Gefühl, dass man sie schnurstracks in eine Niederlage führe, so dass ein weiterer Ausstand das Ausmaß ihrer Niederlage nur vergrößern würde. Seitdem hat dieser Streik sozusagen einen potemkinschen (oder, moderner gesprochen, einen virtuellen) Charakter angenommen. Je deutlicher es wird, dass in den meisten angeblich bestreikten Betriebe so ziemlich der übliche Geschäftsablauf herrscht, umso mehr Streikplakate der Gewerkschaft werden ausgehängt. Es ist, als ob Ver.di mit Papier das eigene Unvermögen, die Arbeiter zu mobilisieren, zu überkleistern versucht.
Wenn die Welt nicht so ein komplizierter Ort wäre, könnte man sich zu der Annahme berechtigt fühlen, dass die Streikunlust der Proletarier dem Kapital zum Vorteil gereichen müsste. Es kommt aber sehr darauf an, weshalb die Lohnarbeiter zögern, in den Kampf zu treten. In diesem Fall hängt dies in erster Linie damit zusammen, dass Ver.di eindeutig die Frage der Wochenarbeitszeit in den Mittelpunkt gestellt hat. Dabei ging es der Gewerkschaft keineswegs um die Einschränkung der Dauer der Ausbeutung. Nein, es ging um die Aufrechterhaltung reformistischer Illusionen innerhalb der Klasse, sprich: der Mär, dass es innerhalb des Kapitalismus beispielsweise durch Arbeitszeitverkürzung möglich wäre, der Massenarbeitslosigkeit Herr zu werden. Während die in dieser Hinsicht geradezu fanatischen Gewerkschaftsfunktionäre diesen Reformismus hochhalten, hat es sich rasch herausgestellt, dass kaum ein Beschäftigter bereit war, für eine solche Illusion zu streiken. Kein Wunder, nachdem die letzte Arbeitzeitverkürzung im öffentlichen Dienst vom Abbau von mehr als einer Million Arbeitsplätze begleitet wurde!
Dabei bestand einer der Hauptziele der Bourgeoisie bei diesem Streik darin, die Präsenz der Gewerkschaften in diesem Teil der Arbeiterklasse massiv zu verstärken. Denn während im Metallbereich ein gewerkschaftlicher Organisationsgrad von teilweise über 80% herrscht, ist die Verankerung der wichtigsten Kontrollorgane des Kapitals im öffentlichen Dienst aus der Sicht der Bourgeoisie erschreckend niedrig. Zwar konnte Ver.di sich in einzelnen Bereichen etablieren, wie etwa bei der Müllabfuhr, indem man sich als wirksames Bollwerk gegen die Folgen einer Privatisierung präsentierte (eine Illusion, die auch bald platzen wird). Aber gerade dort, wo die junge Generation die große Mehrheit bildet, wie beim Pflegepersonal der Krankenhäuser, werden die Agitatoren der Gewerkschaft fast wie Wesen von einem anderen Stern bestaunt und es wird ihnen auch misstraut. Hier zeigt sich eine deutliche Parallele zur Entwicklung in Frankreich, wo die junge Generation aus Mangel an Erfahrung den antiproletarischen Charakter der Gewerkschaften noch nicht durchschaut, sie aber bereits als etwas Überholtes, Dinosaurierartiges empfindet.
Die besorgte Bourgeoisie beginnt bereits, Konsequenzen aus diesem Versagen Ver.dis zu ziehen, indem die Möglichkeit reiner Fachgewerkschaften nach dem Modell der Pilotenvereinigung Cockpit oder der Gewerkschaft der Lokführer öffentlich erörtert wird. Denn die herrschende Klasse weiß aus Erfahrung, wie oft in der Geschichte eine ungebrochene Arbeiterklasse, die es unterlassen hat, einem Aufruf der Gewerkschaften Folge zu leisten, später für die eigene Sache sehr wohl in den Kampf treten kann.
Der Streik der Ärzte
Bei diesem Streik erleben wir tatsächlich, wie eine reine Fachgewerkschaft – in diesem Fall der Marburger Bund – sehr wirksam das Geschehen im Krankenhaus beeinflussen kann. Der Streik wird nicht nur auf die Welt der Mediziner reduziert, sondern auf reformistische Illusionen ausgerichtet. So wird behauptet, dass die Lohnforderungen der Ärzte mit den Interessen des nationalen Kapitals vereinbar sind, indem der Abwanderung ins Ausland Einhalt geboten wird.
Die Lage der Mediziner widerlegt allerdings die Lüge der bürgerlichen Propaganda, derzufolge die hohe Gehaltsforderung das immer größere Auseinanderklaffen der Löhne und der Entsolidarisierung der Beschäftigten untereinander bekräftigen würde. Das Gegenteil ist der Fall. Vielmehr waren die Einschnitte in diesem Bereich so brutal, dass nicht einmal eine Lohnsteigerung von 30% reichen würde, um sie auszugleichen. Da die meisten Assistenzärzte viele Überstunden gratis leisten müssen, bekommen sie einen Stundenlohn, der ohnehin oft niedriger ist als der des Pflegepersonals.
Neben der Tatsache, dass in Deutschland diese Berufsgruppe zum ersten Mal überhaupt kämpft, liegt die Bedeutung dieses Streiks in der Art und Weise, wie sich in ihnen die Frage der Solidarität äußert. Obwohl dieser Streik in den großen Krankenhäusern ein erhebliches Chaos und eine entsprechende Mehrbelastung verursacht hat, gibt es allem Anschein nach weder unter dem sonstigen Krankenhauspersonal noch unter den Patienten irgendjemanden, der Negatives über die Ärzte zu sagen hat. Unter dem Pflegepersonal wird sogar geäußert, dass man für dieselbe Forderung – 30% mehr Lohn – durchaus bereit wäre, mit den Ärzten zusammen zu kämpfen. Denn das drückendste Problem der Pflegenden ist momentan nicht die Arbeitszeit, sondern vielmehr das Verbot von Überstunden, was für viele zu Einkommenseinbußen von bis zu 25% geführt hat.
Die Behauptung von Ver.di, dass die Bereitschaft der Ärzte an den Universitätskliniken, weiterhin sehr lange Arbeitszeiten hinzunehmen, aber darauf zu bestehen, dass diese auch bezahlt werden, ein Schlag ins Gesicht der anderen Krankenhausbeschäftigten sei, welche die 38,5-Stunden-Woche verteidigen, ist eine gemeine Lüge. Diese Ärzte arbeiten länger, weil sie ihre Patienten betreuen und gleichzeitig Wissenschaft und Forschung betreiben. Ihre Forderung, diese Arbeitszeit bezahlt zu bekommen, ist eine proletarische Forderung. Die Sympathie der Bevölkerung mit diesem Anliegen ist unübersehbar. Das große Herz der Arbeiterklasse spürt, dass gerade die Assistenzärzte nicht nur für sich, sondern auch für die Gesundheit der Bevölkerung kämpfen. Auch hier liegt ein Keim der künftigen revolutionären Kämpfe: die Realisierung, dass der Kampf der produzierenden Klasse dieser Gesellschaft ein Kampf für die Durchsetzung der Interessen der gesamten Menschheit ist.
Dagegen hetzt jetzt schon die Reaktion, wie etwa Ver.di. So lesen wir in der Streikzeitung für die Beschäftigten des Klinikums der Universität zu Köln, Ausgabe 25: „Eure Forderungen unterstützen wir zum Teil, aber ihr wisst – wie wir – es gibt im Krankenhaus nur einen Kuchen zu verteilen und da geht es nicht, wenn sich eine Gruppe den halben Kuchen nimmt.“
Die Warnstreiks der Metaller
Noch ist es zu früh, darüber zu spekulieren, ob es zu einem großen Streik in diesem Schlüsselsektor der deutschen und europäischen Arbeiterklasse kommen wird. Fest steht jedenfalls, dass die Metaller ebenfalls herbe Einkommensverluste in den letzten Jahren erlitten haben und nicht mehr bereit sind, dies noch lange hinzunehmen. Klar ist vor allem, dass die Militanz der Metaller schon jetzt einen bedeutenden Faktor der sozialen Lage bildet. Allein in Baden-Württemberg, gleichermaßen das Hauptzentrum der deutschen Maschinenbauindustrie und die Vorhut der kämpfenden deutschen Arbeiterklasse in den letzten Jahren, gibt es heute noch über eine Million zumeist hochqualifizierte Metallarbeiter. Baden-Württemberg liegt auch unmittelbar an der Grenze zu Frankreich, so dass es gerade dort der Bourgeoisie kaum möglich war, die Massenbewegung jenseits des Rheins ganz zu verschweigen. Angesichts des gewaltigen Kampfpotenzials des deutschen Proletariats nimmt es nicht wunder, dass eine der Auswirkungen der Kämpfe in Frankreich darin lag, dass ein ganz ähnlicher Angriff gegen das Kündigungsschutz für Jugendliche in Deutschland fallen gelassen wurde, noch bevor sein Pendant in Frankreich zurückgezogen wurde.
Bereits in der Ära Kohl, als es darum ging, die Abschaffung der bestehenden Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zu verhindern, haben die Großbetriebe der Metallindustrie, allen voran die Mercedesarbeiter in Stuttgart, ihre Bereitschaft unter Beweis gestellt, ausdrücklich im Interesse aller Arbeiter zu kämpfen. Diese Idee tauchte im Sommer 2004 beim Mercedesstreik in Stuttgart und Bremen wieder auf.
Und tatsächlich: Auch wenn die jetzigen Konflikte im Gesundheitswesen erneut bestätigen, dass es nicht möglich ist, die Krankenhäuser vollständig zu bestreiken, ohne die Gesundheit der Bevölkerung zu gefährden, schwächt dies keineswegs die Abwehrmöglichkeiten der betroffenen Arbeiter, sobald die Klasse als Einheit kämpft. Auch diese Idee ist ein Bestandteil des Massenstreiks. Im Gegensatz zum gewerkschaftlichen, v.a. von den Anarchisten gepriesenen Generalstreik, wo an einem Tag alle die Arbeit niederlegen, geht es beim Massenstreik, wie er sich 1905 in Russland zum ersten Mal ereignete, nicht nur um die Lahmlegung der kapitalistischen Wirtschaft und von Teilen des Machtapparates, sondern zugleich um die Aufrechterhaltung aller für die Bevölkerung bzw. die Streikführung lebensnotwendigen Dienstleistungen.
Die Elemente der künftigen Kämpfe der Arbeiterklasse als geschlossener Einheit sind heute nur im Keim vorhanden. Dennoch gehört es zu den dringendsten Aufgaben von heute, diese Keime zu erkennen und zu pflegen.
11.04.2006
Universitätsstudenten und Hochschüler, künftige Arbeitslose, künftige Teilzeit- und Gelegenheitsarbeiter:
- 3424 reads
Alle vereint im Kampf gegen den Kapitalismus
Seit Anfang Februar haben sich trotz der Schulferien Studenten von Universitäten und Hochschulen in den meisten großen französischen Städten in Bewegung gesetzt, um ihren Ärger über die wirtschaftlichen Angriffe durch Regierung und Bosse und über den CPE (Contrat Première Embauche) Ausdruck zu verleihen. Und dies geschah trotz des Blackouts der Medien (besonders des Fernsehens), die es stattdessen vorzogen, ihre Aufmerksamkeit auf die schlimmen Taten der so geannten „barbarischen Bande“ zu lenken.
Alle vereint im Kampf gegen den Kapitalismus
Seit Anfang Februar haben sich trotz der Schulferien Studenten von Universitäten und Hochschulen in den meisten großen französischen Städten in Bewegung gesetzt, um ihren Ärger über die wirtschaftlichen Angriffe durch Regierung und Bosse und über den CPE (Contrat Première Embauche)[1] [41] Ausdruck zu verleihen. Und dies geschah trotz des Blackouts der Medien (besonders des Fernsehens), die es stattdessen vorzogen, ihre Aufmerksamkeit auf die schlimmen Taten der so geannten „barbarischen Bande“ zu lenken.[2] [41]
Die Studenten der Universitäten und Hochschulen sind zu Recht zornig!
Das Bildungssystem (Schulen zur weiterführenden Bildung, Hochschulen, Universitäten...) ist eine Fabrik zur Herstellung von ungelernten Arbeitern geworden, um ein Reservoir an billiger Arbeitskraft zu schaffen. Weil sie dies begriffen haben, entsendeten Massenversammlungen der Studenten, wie jene in Caen, Delegationen zu den Arbeitern in den benachbarten Fabriken und zu den arbeitslosen Jugendlichen in den Gemeindeeinrichtungen (in the council estates), um sie dazu aufzurufen, sich dem Kampf anzuschließen. Der CPE ist nichts anderes als organisierte Prekarisierung. Doch diese Prekarisierung betrifft nicht nur die Jugend. Jede Generation ist von der Arbeitslosigkeit, der Prekarisierung und Armut betroffen. Daher sind in einigen Universitäten wie in Paris III Censier die Lehrer und das Wartungspersonal aus Solidarität mit den Studenten ebenfalls in den Streik getreten.
Der CPE ist ein Ausdruck des Bankrotts des Kapitalismus!
Die herrschende Klasse und ihre Regierung haben als Antwort auf die Riots, die in den Vorstädten im vergangenen November ausgebrochen waren, die Ordnung wiederhergestellt, indem sie ein Ausgangsverbot durchsetzten und junge Immigranten, die den Respekt vor ihrer „neuen Heimat“ versagten, des Landes verwiesen. Heute wollen unserer Herrscher damit fortfahren, die Kinder der Arbeiterklasse mit dem „Hochdruckreiniger zu bearbeiten“, und kein Spruch ist ihnen zu zynisch: Sie beabsichtigen, den CPE mit seiner Prekarisierung und seinen Niedriglöhnen im Namen der.... „Chancengleichheit“ durchsetzen. Mit dem CPE sehen sich jene, die in der glücklichen Lage sind, am Ende ihres Studiums bzw. ihrer Ausbildung einen Job zu bekommen, der Gnade ihrer Chefs ausgesetzt, ohne jegliche Hoffnung, eine Wohnung zu finden, eine Familie zu gründen oder ehrbar Kinder großzuziehen. Sie werden jeden Tag mit der Furcht zur Arbeit gehen, jenes Formschreiben zu erhalten, das das schlimme Urteil der ENTLASSUNG verkündet! Dies bedeutet Lohnsklaverei! Dies bedeutet Kapitalismus!
Die einzige „Gleichheit“, die vom CPE angeboten wird, ist die Gleichheit der Armut, des Schicksals, in einen Zustand zu sinken, in dem man von der Hand in den Mund lebt, sich von einem Zeitjob zum nächsten hangelt, von der Arbeitslosenunterstützung oder dem RML[3] [41] lebt. Dies ist die „glänzende Zukunft“, die die herrschende Klasse und ihr „demokratischer“ Staat den Kindern der Arbeiterklasse anbietet!
Die Eltern dieser Kinder sind jene, die 2003 gegen die Reform des Rentensystems auf die Straße gingen. Und es war Premierminister Villepins Vorgänger Raffarin, der die Frechheit besaß zu sagen: „Es ist nicht die Straße, die herrscht!“
Nach den Hammerschlägen gegen die „alten“ Arbeiter und künftigen Rentner sind nun die „jungen“ und künftigen Arbeitslosen das Ziel! Mit dem CPE zeigt der Kapitalismus sein wahres Gesicht: jenes eines dekadenten Systems, das den neuen Generationen nichts anzubieten hat. Eines Systems, das gezeichnet ist von einer unlösbaren Wirtschaftskrise. Eines Systems, das schon seit dem II. Weltkrieg gigantische Summen in die Produktion von immer raffinierteren und tödlicheren Waffen steckt. Eines Systems, das nicht aufgehört hat, spätestens seit dem Golfkrieg von 1991 eine Blutspur über den Planeten zu ziehen. Es ist dasselbe bankrotte System, dieselbe verzweifelte kapitalistische Klasse, die hier Millionen zu Arbeitslosigkeit und Armut verurteilt und im Irak, im Nahen Osten und in Elfenbeinküste tötet![4] [41]
Tag für Tag demonstriert das herrschende kapitalistische System, dass es überwunden werden muss. Und weil sie beginnen, dies zu verstehen, unterstützte ein Massentreffen von Studenten in Paris Tolbiac einen Antrag, der erklärte: „Es ist Zeit, dem Kapitalismus ein Ende zu bereiten“! Daher luden am 3. März die Studenten von Paris Censier eine Theatergruppe ein, um revolutionäre Lieder vorzutragen. Die rote Fahne wehte, und viele Hundert Studenten, Professoren und Wartungspersonal sangen zusammen die Internationale. Das Kommunistische Manifest von Karl Marx und Friedrich Engels wurde verteilt. Das Wort von der REVOLUTION ging auf dem Universitätsgelände herum. Es begannen Diskussionen über den Klassenkampf, wir vernahmen Gespräche über die Russische Revolution von 1917 und über jene großen Figuren der Arbeiterbewegung, wie Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, die von Totschlägern ermordet wurden, welche von der an der Macht befindlichen sozialdemokratischen Partei gedungen waren. Wenn sie die „barbarische Bande“ in Nadelstreifenanzügen, die über uns herrschen, konfrontieren wollen, dann müssen sich die jungen Generationen der Erfahrung der Älteren vergegenwärtigen. Und insbesondere sollten sie sich erinnern, was im Mai 1968 geschah.
Der Massenstreik vom Mai 1968 zeigt uns den Weg nach vorn
Im Schlepptau der Bewegungen, die über die Universitäten der meisten Industrieländer, insbesondere in den Vereinigten Staaten und in Deutschland, hinwegschwappte, gingen französische Universitätsstudenten im Mai 1968 massenhaft auf die Straße. Ihre Mobilisierung nahm eine völlig neue Dimension an, als sich die gesamte Arbeiterklasse, mit neun Millionen Arbeiter im Ausstand, dem Kampf anschloss! Daraufhin gingen die militantesten und bewusstesten Studenten über ihre spezifischen Forderungen hinaus und verkündeten, dass ihr Kampf der Kampf der Arbeiterklasse sei. Sie riefen die Arbeiter dazu auf, zu den besetzten Universitäten zu kommen und die Lage sowie ihre Perspektiven zu diskutieren. Überall war die Revolution und die Notwendigkeit, den Kapitalismus zu stürzen, Gegenstand der Debatten.
Der Mai 1968 führte nicht zur Revolution. Er konnte nicht dazu führen, denn der Kapitalismus befand sich erst am Anfang seiner Krise. Doch die Bourgeois fürchteten um ihr Leben. Und wenn es der Regierung gelang, die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen, so nur dank der Gewerkschaften, die alles taten, was sie konnten, um die Streikenden wieder zurück zur Arbeit zu schicken, und dank der linksextremistischen Parteien, jener Parteien, die vorgaben, die Interessen der Arbeiter zu vertreten, aber gleichzeitig zur Teilnahme an den Wahlen aufriefen, welche von De Gaulle ausgerufen worden waren.[5] [41]
Mai 68 zeigte, dass die Revolution nicht irgendein verstaubtes Museumsstück ist, eine Ideologie aus ferner Vergangenheit, sondern die einzig mögliche Zukunft für die Gesellschaft. Darüber hinaus zeigte die riesige Arbeiterbewegung der herrschenden Klasse, dass sie die Ausgebeuteten dieser Gesellschaft nicht mehr hinter das Banner des Nationalismus abkommandieren kann, dass sie keine freie Hand in ihrem Bemühen hat, einen dritten Weltkrieg auszulösen, wie sie es 1914 und 1939 getan hatte. Wenn die Wirtschaftskrise nicht zu einem weltweiten Gemetzel führte, wie es in den 30er Jahren geschah, dann nur dank der Kämpfe der Arbeiterklasse.
Die Zukunft befindet sich in den Händen der jungen Generation
Die Bewegung der Jugend gegen den CPE zeigt, dass der Samen einer neuen Gesellschaft in den Eingeweiden des sterbenden Kapitalismus keimt. Die Zukunft liegt in den Händen dieser neuen Generationen. Die Studenten der Universitäten und Hochschulen beginnen zu realisieren, dass die weite Mehrheit von ihnen zur Arbeiterklasse gehört, sei es als Arbeitslose oder als prekär Beschäftigte. Zu einer ausgebeuteten Klasse, die der Kapitalismus immer mehr aus dem Produktionsprozess ausschließt. Einer Klasse, der nichts anders bleibt, als ihre Kämpfe weiterzuentwickeln, ihre Lebensbedingungen und die Zukunft ihrer Kinder zu verteidigen. Einer Klasse, die keine andere Wahl hat, als den Kapitalismus zu stürzen und der Konkurrenz, Armut, Ausbeutung und Barbarei ein Ende zu bereiten. Der einzigen Klasse, die eine neue Welt errichten kann, die nicht mehr auf Konkurrenz, Ausbeutung und Profitstreben beruht, sondern auf der Befriedigung der Bedürfnisse der gesamten Menschheit.
1914 wurden die Kinder der Arbeiterklasse – die große Mehrheit von ihnen noch nicht erwachsen – als Kanonenfutter in die Schützengräben geschickt. Blut triefend, mähte der Kapitalismus die junge Generation nieder, die Rosa Luxemburg „die edle Blume des Proletariats“ nannte.
Im heutigen 21. Jahrhundert wird diese „edle Blume des Proletariats“ die Verantwortung haben, den dekadenten Kapitalismus zu zerstören, der die Kinder der Arbeiterklasse massakrierte, als er sie 1914 und auch 1939 an die Front schickte. Sie wird dies tun, indem sie ihren Kampf zusammen mit allen Generationen der Arbeiterklasse entwickelt.
An der Universität von Vitoria da Conquista in Brasilien äußerten die Studenten erst kürzlich den Wunsch, über die Geschichte der Arbeiterbewegung zu diskutieren.[6] [41] Sie haben begriffen, dass sie nur, wenn sie von den Erfahrungen der vergangenen Generationen lernen, in der Lage sein werden, die Fackel des Kampfes aufzunehmen, den ihre Eltern, Großeltern und Urgroßeltern ausgefochten hatten. Diese Studenten wollten jenen zuhören, die ihnen die Vergangenheit übermitteln können, eine Vergangenheit, die sie zu ihrer eigenen machen müssen und auf deren Fundamente die jungen Generationen die Zukunft erbauen können. Sie haben entdeckt, dass die Geschichte des Klassenkampfes, lebendige Geschichte, nicht nur in Büchern gelernt werden kann, sondern auch im Gefechtsfeuer der Tat. Sie wagten es, frei zu sprechen, zu fragen, ihr Nichteinverständnis zum Ausdruck zu bringen und ihre Argumente in die Auseinandersetzung zu werfen.
An den Universitäten Frankreichs wird es Zeit, die Hörsäle und die Massenversammlungen all jenen – Arbeiter, Arbeitslose und Revolutionäre – zu öffnen, die dem Kapitalismus ein Ende machen wollen.
Es gibt nur einen Weg nach vorn: Einheit und Solidarität der gesamten ausgebeuteten Klasse!
Seit einigen Monaten wird überall die Welt der Arbeit von Streiks im staatlichen wie auch im privaten Bereich erschüttert, so in Deutschland, Spanien, den Vereinigten Staaten, Indien und Lateinamerika. Überall haben sich die Streikenden in ihrem Kampf gegen Arbeitslosigkeit und Entlassungen dem Bedürfnis nach Solidarität zwischen den Generationen, zwischen den Arbeitslosen und jenen, die noch Arbeit haben, verschrieben.
Studenten! Euer Zorn über den CPE wird nicht mehr als nur eine kurzlebige Sensation sein, wenn Ihr euch hinter den Gemäuern der Universitäten und Schulen isolieren lasst! Ihr seid aus dem Produktionsprozess ausgeschlossen und habt keine Mittel, Druck auf die herrschende Klasse auszuüben, etwa durch die Lähmung der kapitalistischen Ökonomie.
Arbeiter, Arbeitslose und Rentner! Es ist Zeit, sich in Bewegung zu setzen, es sind Eure Kinder, die da angegriffen werden! Ihr seid diejenigen, die den Reichtum der Gesellschaft produziert habt und immer noch produziert. Ihr seid die treibende Kraft des Klassenkampfes gegen den Kapitalismus!
Arbeitslose Jugendliche der Vorstädte! Ihr seid nicht die einzigen, die „ausgeschlossen“ sind! Heute nennen die Kapitalisten Euch „Gesindel“: 1968 wurde Eure Eltern, die gegen die kapitalistische Ausbeutung revoltierten, „Saboteure“ genannt.
Die einzige Hoffnung für die Zukunft liegt nicht in blinder Gewalt und brennenden Autos, sondern im vereinten Kampf und in der Solidarität der gesamten Arbeiterklasse, jeder Generation! Es sind die Streiks, die Massenversammlungen, die Diskussionen am Arbeitsplatz und in den Schulen sowie Fachschulen, die Straßendemonstrationen, in denen wir uns ALLE ZUSAMMEN VEREINIGEN müssen, um unseren Zorn über die Arbeitslosigkeit, unsichere Jobs und Armut zu artikulieren!
Weg mit der CPE! Nieder mit dem Kapitalismus! Die Arbeiterklasse hat nichts außer ihre Ketten zu verlieren. Sie hat eine Welt zu gewinnen.
Internationale Kommunistische Strömung, 6. März 2006
(Flugblatt, veröffentlicht und verteilt von der IKS-Sektion in Frankreich)
[1] [41] Eine neue Form des Arbeitsvertrages für junge Arbeiter (jünger als 26 Jahre), die von der Regierung Villepin vorgeschlagen wird. Die bemerkenswerteste Maßnahme, die dieser Vertrag enthält, ist die zweijährige „Probefrist“, in der die Arbeitgeber das Recht haben, einen Arbeiter ohne Kommentar und ohne jede Begründung zu feuern. Dieselbe Maßnahme wird bereits im „Contrat Nouvelle Embauche“ (CNE) für Arbeiter allen Alters in kleinen Unternehmen (mit weniger als 25 Beschäftigten) angewendet. Tatsächlich zielen beiden neuen Arbeitsverträge zusammen mit dem „CDD Séniors“ (einem Probevertrag für ältere Arbeiter) darauf ab, die gesamte existierende französische Arbeitsgesetzgebung und die beschränkten Rechte, die diese den Arbeiter gegenwärtig noch gewährt, zu schleifen.
[2] [41] Eine Bande von Schlägern, die eine besonders schreckliche Entführung und Ermordung eines jungen Ladenangestellten begingen, um seine Familie zur Herausgabe von Geld zu erpressen.
[3] [41] „Revenue Minimum d’Insertion“: Mindesteinkommen für Arbeitslose, gegenwärtig 433 Euros pro Monat und pro Person – mit anderen Worten: nicht einmal die Höhe einer Monatsmiete.
[4] [41] Wo die französische Armee zurzeit „die Ordnung aufrechterhält“.
[5] [41] damaliger Präsident Frankreichs;
[6] [41] Siehe unseren Artikel node/1711.
Geographisch:
- Frankreich [32]
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Erbe der kommunistischen Linke:
Mai 2006
- 766 reads
Der 1. Mai ist der Tag der internationalen Arbeiterklasse
- 2525 reads
Dieses Flugblatt wurde von Enternasyonalist Kömunist Sol (Internationale Kommunistische Linke) einer neuen proletarischen Gruppe in der Türkei, verfasst. Es wurde in der Türkei, Großbritannien und Deutschland verteilt. In Großbritannien und Deutschland wurde es von Mitgliedern und Sympathisanten der IKS verteilten. Die IKS unterstützt die internationalistischen Ansichten des Textes. Das Flugblatt kann als PDF Datei heruntergeladen werden.
Dieses Flugblatt wurde von Enternasyonalist Kömunist Sol (Internationale Kommunistische Linke) einer neuen proletarischen Gruppe in der Türkei, verfasst. Es wurde in der Türkei, Großbritannien und Deutschland verteilt. In Großbritannien und Deutschland wurde es von Mitgliedern und Sympathisanten der IKS verteilten. Die IKS unterstützt die internationalistischen Ansichten des Textes. Das Flugblatt kann als PDF Datei heruntergeladen werden.
Zu lange ist der 1. Mai ein für die Arbeiterklasse sinnloses Ritual geblieben. Der 1. Mai war ursprünglich als ein Tag der internationalen Arbeitersolidarität auserkoren worden, aber heute sieht man bei den Mai-Demonstrationen hauptsächlich linksextreme Gruppen verschiedenster Couleur, die die Arbeiterklasse dazu aufrufen, verschiedene nationalistische Gruppierungen zu unterstützen. Ob die türkische nationalistische Linke, die zu einer „unabhängigen Türkei“ aufruft, und gegen die Imperialisten protestieren, während sie gleichzeitig außer Acht lassen, dass die Türkei selbst ein NATO-Mitgliedsstaat ist, oder diejenigen, die über die Barbarei des Staates im Südosten gegenüber den kurdischen Nationalisten empört sind, und ihr niederträchtiges Spiegelbild des türkischen Nationalismus, oder gar die Amerika-feindlich eingestellten linken Gruppen, die lauthals fordern „Yankee go home“. Wozu dient das alles? Nur damit, unsere Bosse „nette“ türkische Bosse sind? All das macht uns wütend. Leider muss nur eine gleiche Gruppe von Internationalisten die Prinzipien der internationalen Arbeitersolidarität verteidigen.
Wenn wir auf die USA schauen, sehen wir nicht nur Bush, sonder auch die 100.000 Arbeiter, die am 10. April in Chicago gegen die Einwanderungsgesetze protestierten. Wenn wir auf England schauen, sehen wir nicht nur Blair, sondern auch die 1.000.000 Demonstranten, die seinerzeit gegen den Irak-Krieg protestierten.
Wir sehen nicht nur, wie die britische Regierung den USA gehorcht, sondern auch Malcolm Kendall-Smith, der am 14. April ins Gefängnis gesteckt wurde, weil er sich weigerte, in den Irak zu gehen.
Und wenn wir auf den Irak schauen, sehen wir nicht nur nationalistischen und islamischen Widerstand, sondern wir sehen auch Tausende von Arbeiter, die in Kirikuk gegen die hohen Preise und den Mangel an Strom und Benzin protestierten.
Und wenn wir auf den Iran schauen, sehen wir nicht nur den Präsidenten Mahmound Ahmadinejad und die Bestrebungen des Staates zum Erwerb von Atomwaffen, sondern wie sehen auch die massive Streikwelle im Iran, an der sich Busfahrer, Textilarbeiter, Bergarbeiter und Automobilarbeiter beteiligt haben.
Arbeiter – schaut auf die jüngsten Streiks in Frankreich; dort haben Tausende Studenten neben streikenden Arbeitern demonstriert, um ein Gesetz zu bekämpfen, das die Entlassungen jugendlichen Beschäftigten erleichtern soll. Schaut auf Großbritannien, wo 1000.000 Beschäftigten im größten Streik seit 80 Jahren gegen die Verschlechterungen der Rentenansprüche protestierten. Schaut auf die Beschäftigten im Iran, die mutig gegen Kapitalismus ankämpfen, und sich gegen den Staat stellen trotz der Unterdrückung durch das Regime. Schaut auf die Arbeiterklasse, - nicht auf die Nationalisten egal welcher Couleur.
Die Arbeiter haben kein Vaterland. Für den Internationalismus und den Arbeiterkampf.
Aktuelles und Laufendes:
- Arbeiterkampf [40]
Die Bewegung gegen den CPE: Eine reiche Erfahrung für zukünftige Kämpfe
| Attachment | Size |
|---|---|
| 20.15 KB |
- 2840 reads
Der Bewegung der Studenten in Frankreich ist es gelungen, die Bourgeoisie zurückzudrängen, welche gezwungen wurde, ihren CPE am 10. April zurückzunehmen. Die Regierung wurde jedoch zum Rückzug gezwungen, auch und vor allem weil die Arbeiter sich aus Solidarität mit den Kindern der Arbeiterklasse mobilisiert haben, wie dies bei den Demonstrationen am 18. und 28. März und am 4. April deutlich wurde.
Trotz der 'Sabotagestrategie', die von der Regierung beschlossen wurde, um ihren 'Vertrag zur Verarschung' (CPE = Contrat pour se faire enturber – Wortspiel 'Vertrag zur Verarschung') gewaltsam durchzusetzen, haben sich die Studenten durch das System der kapitalistischen Einschüchterung mit seinen Polizisten, Lakaien und Spitzeln nicht beeindrucken lassen. Aufgrund ihrer Entschlossenheit, ihres exemplarischen Mutes, ihres tiefen Verständnisses der Solidarität, ihres Vertrauens in die Arbeiterklasse, haben es die kämpfenden Studenten (und die reifsten und bewusstesten Gymnasiasten) geschafft, die Arbeiter zu überzeugen, mit ihnen in den Kampf zu treten. Zahlreiche Beschäftigte aus allen Branchen, sowohl aus dem öffentlichen Dienst als auch aus der Privatwirtschaft, waren bei den Demonstrationen vertreten. Diese Solidaritätsbewegung der gesamten Arbeiterklasse hat in den Reihen der Weltbourgeoisie eine große Besorgnis hervorgerufen. Deshalb haben die Medien systematisch die Wirklichkeit entstellt, und auch deshalb wurde die deutsche Bourgeoisie gezwungen, eine ähnliche Maßnahme wie den französischen CPE in Deutschland abzuschwächen. Deshalb ist die internationale Ausstrahlung des Kampfes der Studenten in Frankreich einer der größten Siege der Bewegung.
Die miserabelsten Schreiberlinge des Kapitals (wie die der Zeitung Libération, die in ihrer 'rosaroten' Tageszeitung ankündigten, dass der „große Abend“ der Kinder der „Mittelschichten“ zu einer „frühen Morgenstunde“ werden würde) können immer noch ihre frommen Wünsche zum Ausdruck bringen oder die Marseillaise singen: Der Kampf gegen den CPE war kein aufrührerisches Bündnis von Halsabschneidern, die von Jakobinern der heutigen Zeit angeführt wurde, noch war sie eine 'orangefarbene Revolution', die von den Fans der 'Yeah-yeah-Lieder' orchestriert wurde.
Auch wenn die große Mehrheit der kämpfenden Studenten aufgrund ihrer mangelnden Erfahrung, ihrer Naivität und ihrer mangelnden Kenntnis der Geschichte der Arbeiterbewegung noch kein klares Bewusstsein hat über die historische Bedeutung ihres Kampfes, hat sie eine Tür zur Zukunft aufgestoßen. Diese Studenten haben die Flamme der älteren Generation weitergetragen: Der älteren Generation, die den Ersten Weltkrieg durch die Entfaltung der internationalen Solidarität der Arbeiterklasse auf den Schlachtfeldern beendet hat, die in der Illegalität die Prinzipien des proletarischen Internationalismus während des 2. Holocaustes weiterhin verteidigt hat, die ab dem Mai 1968 den langen Zeitraum der stalinistischen Konterrevolution (siehe den Artikel zu Mai 1968 auf unserer Webseite) zu Ende gebracht hat, und der es somit gelang, die Auslösung eines dritten Weltkrieges zu verhindern.
Die Gewerkschaften eilen der Regierung zu Hilfe ... und umgekehrt
Die Bourgeoisie wurde auch zum Rückzug gezwungen, weil sie das Ansehen der Gewerkschaften retten wollte. Die herrschende Klasse (die sich auf die 'Solidarität‘ der ganzen Kapitalistenklasse der größten Staaten Europas und Amerikas stützen konnte) hat schließlich begriffen, dass es besser wäre, vorübergehend 'das Gesicht‘ zu verlieren, als ihren gewerkschaftlichen Kontrollapparat zu entblößen. Um das Schlimmste zu verhindern, hat das Oberhaupt der Unternehmer Laurence Parisot (die in dieser Angelegenheit ihre 'Vermittler- und Partnerrolle‘ des sozialen Friedens gespielt hat) mit dem Gewerkschaftsbündnis 'verhandelt'. Wenn die Regierung schließlich dem Druck der Straße nachgab, tat sie dies, weil in den meisten Betrieben immer mehr kritische Fragen gegenüber der Haltung der Gewerkschaften aufkamen. Diese haben nämlich nichts unternommen, um die Solidaritätsbekundungen der Beschäftigten mit den Studenten zu begünstigen – im Gegenteil. In den meisten Betrieben des öffentlichen Dienstes und der Privatwirtschaft haben die Gewerkschaften kein Flugblatt mit einem Aufruf zur Beteiligung am 18. März herausgebracht. Die Streikankündigungen für die „Aktions- und Mobilisierungstage“ des 28. März und 4. April wurden von den Gewerkschaftsführungen erst im letzten Moment, dazu noch in der größten Verwirrung bekannt gemacht. Darüber hinaus haben die Gewerkschaften alles unternommen, damit keine souveränen Vollversammlungen der Beschäftigten stattfinden; dies begründeten sie damit, dass die Beschäftigten nicht „die gleichen Kampfmittel haben wie die Studenten“ (so der CGT-Führer Bernard Thibault in einer Fernsehsendung von RTL am 26. März). Und was ihre Drohung der Auslösung eines „jeweils verlängerbaren Generalstreiks“ am Ende der Bewegung angeht, erscheint dies in den Augen vieler Beschäftigten wie ein Bluff im Kasperletheater. Der einzige Bereich, in dem die Gewerkschaften viel Werbung für einen Streikaufruf zum 28. März und 4. April gemacht haben, war der Transportbereich. Aber diese Mobilisierungsaufrufe dienten nur dazu, die Solidaritätsbewegung der ganzen Klasse gegen den CPE zu sabotieren. Tatsächlich ist die totale Blockierung des Transportwesens ein klassisches Manöver der Gewerkschaften (insbesondere der CGT), um den Streik unbeliebt zu machen und die Beschäftigten gegeneinander auszuspielen. Die Tatsache, dass die gewerkschaftlichen Aufrufe zur Blockade des Transportwesens wenig befolgt wurden, ermöglichte die Anreise vieler Beschäftigter zu den Demonstrationen. Dies spiegelt auch einen Verlust der Glaubwürdigkeit der Gewerkschaften in den Betrieben wider. Das wurde zum Beispiel anhand der Tatsache deutlich, dass viele Beschäftigte sich auf den Bürgersteigen versammelten und den Demonstrationen zuschauten und sich so fern ab wie möglich von den gewerkschaftlichen Fahnenträgern aufhielten. Weil die Beschäftigten der Privatwirtschaft (wie die von SNECMA und Citroën in der Paris Region) anfingen, sich aus Solidarität mit den Studenten zu mobilisieren, zwangen sie die Gewerkschaften, der Bewegung 'nachzulaufen‘, damit sie nicht die Kontrolle über die Arbeiter verloren. Deshalb hat das Unternehmerlager Druck auf die Regierung ausgeübt, um den Rückzug anzutreten, bevor es zu größeren spontanen Streiks in wichtigen Betrieben der Privatwirtschaft käme. Um zu verhindern, dass die Gewerkschaften ihr Gesicht völlig verlieren und von einer unkontrollierbaren Bewegung der Beschäftigten überrannt werden, hatte die französische Bourgeoisie keine andere Wahl als den Gewerkschaften zu Hilfe zu eilen, indem der CPE nach der Demonstration vom 4. April so schnell wie möglich zurückgezogen wurde. Die klügsten Journalisten hatten richtigerweise festgestellt, als sie am 7. März im Fernsehen sagten: „Es gibt überall die Gefahr von Explosionen“ (Nicolas Domenach). In dieser Hinsicht hat Premierminister Villepin teilweise die Wahrheit gesagt, als er vor den Schauspielern der Nationalversammlungen am Tag nach diesem 'Aktionstag‘ erklärte, dass sein Hauptanliegen nicht der Schutz seines persönlichen Stolzes wäre, sondern die Verteidigung des „allgemeinen Interesses" (d.h. des nationalen Kapitals).
In Anbetracht dieser Lage haben die am wenigsten dummen Teile der herrschenden Klasse Alarm geschlagen, als sie die Entscheidung trafen, einen „schnellen Ausweg“ aus der Krise nach dem Aktionstag des 4. April zu suchen, an dem Millionen von Demonstranten (unter ihnen viele Beschäftigte der Privatwirtschaft) auf die Straße gegangen waren. Trotz der eklatanten 'Solidaritätsbekundung‘ des kapitalistischen Staates mit den Gewerkschaften haben die Gewerkschaften viele Federn gelassen, bei ihrem Bemühen die Arbeiterklasse mit ihren 'radikalen Sprüchen‘ hinters Licht zu führen. Um die ganze soziale Front abzudecken und in Schach zu halten, wurde erneut die altbekannte Karte der 'Spaltung der Gewerkschaften‘ zwischen den alten Gewerkschaftsverbänden (CGT, CFDT, FO, CGC, UNEF) und den 'radikalen‘ Gewerkschaften (SUD und CNT) am Ende der Bewegung gespielt. Und bei der 'nationalen Koordination‘ konnte man am Ende der Bewegung klar erkennen, dass ihr Hauptziel darin bestand, die Studenten zu erschöpfen, sie zu demoralisieren und vor den Fernsehkameras lächerlich zu machen (wie z.B. in Lyon am Wochenende des 8./9. April, wo die studentischen Delegierten, die aus ganz Frankreich zusammengekommen waren, die ganze Zeit damit verbrachten darüber abzustimmen... dass sie abzustimmen haben!).
Das Mitwirken der Extremen Linken bei der Sabotage
Gegenüber dem Verlust der Glaubwürdigkeit der Gewerkschaften traten öffentlich die wechselnden Schauspieler des Spektakels der französischen Komödie auf die Bühne: Nach den großen Gewerkschaftszentralen reihten sich die Freunde und Freundinnen von Arlette Laguiller (Trotzkisten der Organisation Lutte Ouvrière) in den Tanz bei der Demonstration vom 11. April ein, um sich wichtig zu machen (während die Mitglieder von Lutte Ouvrière (LO) auf der Demonstration am 18. März auf den Bürgersteigen Luftballons aufbliesen und emsig jedem Sticker mit der Aufschrift „LO“ anhefteten, der sich ihnen näherte!). Während die Regierung und die „Sozialpartner“ beschlossen hatten, in Verhandlungen über einen „ehrenhaften“ Ausweg aus der Krise zu treten, und der CPE am 10. April zurückgezogen wurde, spielte sich LO in der Begräbnisdemonstration vom 11. April in Paris groß auf. An jenem Tag hatte LO möglichst viele draufgängerische Studenten und Gymnasiasten mobilisiert, um die Bewegung zu 'radikalisieren‘ und sie für LO zu vereinnahmen (sie marschierten neben den blau-weißen Fahnen von SUD und den schwarz-roten Fahnen der CNT). Alle linksradikalen oder anarchistisch orientierten Grüppchen stimmten auf bewegende einstimmige Weise an: „Rücknahme des CPE, des CNE und des 'Gesetzes über Chancengleichheit‘“ oder „Villepin tritt zurück!“. Die erfahrendsten Arbeiter kennen sehr wohl das Ziel dieses Getöses. Es geht darum, die nach einer politischen Perspektive suchenden Studenten mit einem vorgetäuschten Radikalismus hinters Licht zu führen, denn hinter ihrer Politik steckt in Wirklichkeit eine kapitalistische Sicht. Diese falschen Revolutionäre (tatsächlich sind sie geschickte Saboteure des Klassenkampfes) spielen auch die Karte des 'Basissyndikalismus‘ und der 'Radikalisierung der Gewerkschaften‘, um die Sabotierung der Bewegung abzuschließen. Die Gruppen der Extremen Linken und die erregtesten Anarchisten haben in Rennes, Nantes, Aix-en-provence oder auch in Toulouse versucht, die unnachgiebigsten Studenten zu gewaltsamen Zusammenstößen mit ihren Kommilitonen zu drängen, die anfingen, für die Beendigung der Blockierung der Universitäten zu stimmen. Der 'Basissyndikalismus‘ und die 'Radikalisierung der Gewerkschaften‘ ist nur ein geschickt eingefädelter Schachzug bestimmter Teile des Staates, der dazu dient, die kämpferischsten Studenten und Beschäftigten für die reformistische Ideologie zu gewinnen. Mittlerweile versuchen die professionellen Saboteure des Klassenkampfes der Gruppen Lutte Ouvrière, SUD (die 1988 aus einer Abspaltung von der Gewerkschaft CFDT im Postbereich entstand) und vor allem LCR (die immer die Universitäten als ihr eigenes 'Jagdgebiet‘ betrachtet und die Gewerkschaften unaufhörlich gedeckt hat, indem sie die Studenten dazu aufrief, „Druck auf die Gewerkschaftsführung auszuüben“, damit diese wiederum die Arbeiter zur Aufnahme des Kampfes bewegen sollten) jegliches Nachdenken abzuwürgen. All die 'radikalen‘ Fraktionen des Kontrollapparates der Arbeiterklasse versuchen unaufhörlich die Bewegung der Studenten zu entstellen oder sie zu vereinnahmen, indem sie die Bewegung auf den Wahlkampf hin orientieren (all dieses Gesindel stellt Kandidaten für die Wahlen auf), d.h. sie legen sich für die Verteidigung der 'Legalität‘ und der bürgerlichen 'Demokratie‘ ins Zeug. Gerade weil der CPE ein Symbol des historischen Bankrotts der kapitalistischen Produktionsform ist, versucht die ganze 'radikale‘ Linke (ob mit den Farben rosa, rot oder grün) sich nun hinter dem großen Chamäleon ATTAC zu verstecken, um uns glauben zu machen, dass das 'Beste auf der Welt‘ innerhalb einer Welt errichtet werden könnte, die auf den wahnwitzigen Gesetzen des Kapitalismus fußt, d.h. der Ausbeutung und der Jagd nach Profiten. Sobald die Beschäftigten anfingen, ihre Solidarität mit den Studenten zu zeigen, fingen die Gewerkschaften, die linken Parteien und die Gruppen der extremen Linken an, das Terrain zu besetzen, um zu versuchen, die Studenten für die klassenübergreifende Ideologie des Kleinbürgertums zu gewinnen. Der große Supermarkt des Reformismus öffnete in den Diskussionsforen seine Tore: Jeder konnte das Gedankengut des Pfuschwarenhändlers José Bové, Chavez (Oberst, Präsident Venezuelas und Schwarm der LCR) oder von Bernard Kouchner und anderen „Ärzte ohne Grenzen“ kosten (die regelmäßig in den Medien auftreten und unter den Arbeitern Schuldgefühle erwecken wollen, indem sie Glauben machen wollen, dass ihre „humanitären“ Spendengelder die Hungersnöte oder die Epidemien in Afrika überwinden könnten).
Und die Beschäftigten, die gegen den CPE auf den Plan getreten waren, sollen jetzt den Gewerkschaften vertrauen, dass sie die einzigen sind, die über das Streikmonopol verfügten (die vor allem Experten für Geheimverhandlungen mit der Regierung, den Unternehmerverbänden und dem Innenminister sind).
Welche Perspektiven nach der Rücknahme des CPE?
In den Vollversammlungen, die nach den Ferien stattgefunden haben, haben die Studenten eine große Reife bewiesen, indem sie mehrheitlich für die Beendigung der Blockierung der Unis und die Wiederaufnahme des Lehrbetriebs stimmten. Gleichzeitig haben sie ihre Absicht bekundet, weiter über die gewaltige Solidaritätsbewegung nachzudenken, die sie zustande gebracht haben. Es stimmt, dass viele von denjenigen, die die Blockierung der Universitäten fortsetzen wollen, sich nun frustriert fühlen, denn letztendlich ist die Regierung nur einen kleinen Schritt zurückgewichen, indem sie einen Artikel ihres Gesetzes über die „Chancengleichheit“ verändert hat. Aber der Hauptgewinn des Kampfes liegt auf politischer Ebene, denn die Studenten haben es geschafft, die Arbeiter für eine große Bewegung der Solidarität unter allen Generationen zu gewinnen. Viele Studenten, die für die Fortsetzung der Blockierung eintreten, denken gewissermaßen nostalgisch zurück an diese Mobilisierung, als „alle zusammenkämpften, als man vereint und solidarisch handelte“. Aber die Einheit und die Solidarität im Kampf sind auch möglich durch das gemeinsame Nachdenken, denn in allen Universitäten und Betrieben sind Verbindungen aufgebaut worden zwischen Studenten und Beschäftigten. Die Studenten und die bewusstesten Beschäftigten wissen genau, „wenn wir allein bleiben, jeder für sich in seiner Ecke, machen sie morgen uns alle einzeln platt“, egal welche Partei zukünftig an der Regierung sein wird (war es nicht der sozialistische Minister Allègre, der betonte, es sei notwendig, den „Mammuth des Bildungswesens abzuspecken“?). Deshalb müssen alle Studenten und mit ihnen die ganze Arbeiterklasse die Notwendigkeit begreifen, eine klare Bilanz aus dem Kampf zu ziehen. Bei dieser Bilanz stehenden folgende Fragen im Mittelpunkt: Was war die Stärke dieser Bewegung? In welche Fallen durfte man nicht hineinlaufen? Warum haben die Gewerkschaften sich so gesträubt, die Bewegung zu unterstützen, und wie ist es ihnen gelungen, sie in den Griff zu kriegen? Welche Rolle haben die „Koordinationen“ gespielt? Um dieses Nachdenken kollektiv zu leisten und die zukünftigen Kämpfe vorzubereiten, müssen die Studenten und Beschäftigten zusammenkommen, um weiterhin gemeinsam nachzudenken. Sie müssen sich weigern, von denen vereinnahmt zu werden, die nur nach der Macht streben und 2007 in den Matignon oder den Elysée-Palast einziehen wollen (oder ganz einfach bei den Wahlen 2007 gute Wahlergebnisse erzielen wollen). Sie dürfen nicht vergessen, dass diejenigen, die sich heute als ihre besten Verteidiger brüsten, in Wirklichkeit zunächst versucht haben, die Solidarität der Arbeiterklasse zu sabotieren, indem sie hinter dem Rücken der Bewegung die Solidarität durch die Sackgasse der gewaltsamen Auseinandersetzungen sabotieren wollten (war es nicht das Gewerkschaftsbündnis gewesen, das mehrfach die Studenten zur Sorbonne schicken wollte und es den Banden von manipulierten „Krawallmachern“ ermöglichte, die Studenten anzugreifen?).
Die gegen den CPE gerichtete Bewegung zeigt die Notwendigkeit auf, dass die jungen Generationen der Arbeiterklasse sich gegenüber dem Zynismus der Bourgeoisie und dem Gesetz über die „Chancengleichheit“ politisieren müssen. Man braucht nicht 'Das Kapital‘ von Karl Marx zu studieren, um zu begreifen, dass „die Gleichheit“ im Kapitalismus nichts als eine Täuschung ist. Man muss ein Vollidiot sein, auch nur einen Augenblick zu glauben, dass die arbeitslosen Arbeiterkinder in den Vororten eine akademische Ausbildung in den Eliteschulen ENA oder Sciences Po erhalten könnten. Und was die „Chancengleichheit“ angeht, weiß die Arbeiterklasse ganz genau, dass diese nur im Lotto oder in anderen Glücksspielen existiert. Deshalb ist dieses niederträchtige Gesetz nur ein Mittel der Verdummung in den Händen der Herrschenden. Die studentische Jugend konnte dies nur als eine reine Provokation der Regierung empfinden. Die Dynamik der Politisierung der neuen Generationen von Proletariern kann sich nur voll entfalten, wenn sie eine globale, historische und internationale Sicht der Angriffe der Bourgeoisie gewinnt. Und um den Kapitalismus zu überwinden, eine neue Gesellschaft aufzubauen, müssen die neuen Generationen der Arbeiterklasse notwendigerweise all die Fallen umgehen, die die Wachhunde des Kapitals in den Universitäten wie in den Betrieben errichten, um ihre Bewusstwerdung über den Bankrott des Systems zu vereiteln. Die Stunde ist gekommen, damit die „Kiste sinnloser Aktionen“ der Gewerkschaften, Anarchisten und Extremen Linken geschlossen und die „Ideenkiste“ der Studenten wieder geöffnet wird, so dass die ganze Arbeiterklasse überall nachdenken und gemeinsam über die Zukunft diskutieren kann, die die neue Generation im Kapitalismus erwartet. Nur dieses Nachdenken wird es den neuen Generationen ermöglichen, morgen wieder zum Kampf zurückzufinden, der noch stärker und vereinter sein muss in Anbetracht der unaufhörlichen Angriffe der Bourgeoisie.
Internationale Kommunistische Strömung (23. 4. 06)
Thesen über die Studentenbewegung in Frankreich im Frühling 2006
- 4335 reads
Diese Thesen wurden von der IKS angenommen, als die Studentenbewegung noch im Gange war. Die Demonstration vom 4. April zerschlug die Hoffnung der Regierung auf eine weniger rege Beteiligung als an der Demonstration vom 28. März. Insbesondere befanden sich mehr Arbeiter aus den privaten Sektoren auf der Straße. Präsident Chirac hatte in seiner Rede vom 31. März groteskerweise versucht, in einem Atemzug sowohl die Anwendung des „Chancengleichheits“gesetzes anzukündigen als auch zu fordern, dass der 8. Artikel des Gesetzes (über den Contrat Première Embauche, den Erstanstellungsvertrag) nicht in Kraft tritt. Weit davon entfernt, die Bewegung zu schwächen, wurde sie durch dieses pathetische Sichwinden nur noch weiter angespornt. Wie 1968 stieg die Wahrscheinlichkeit von spontanen Ausständen. Die Regierung musste einsehen, dass es ihren jämmerlichen Manövern nicht gelungen war, die Bewegung zu brechen. Am 10. April zog sie als Konsequenz daraus, aber nicht ohne einige letzte Verrenkungen, den CPE zurück. Die Thesen gingen noch davon aus, dass die Regierung nicht nachgibt. Dennoch bestätigt der Epilog der Krise, in dem wir Zeuge des Rückzuges der Regierung wurden, die zentrale Idee dieser Thesen: die Tiefe und die Bedeutung der Mobilisierung der jungen Generation der Arbeiterklasse in den Frühlingstagen von 2006.
Jetzt, wo die Regierung den CPE zurückgenommen hat und damit der Hauptforderung der Bewegung nachgekommen ist, hat Letztere an Dynamik verloren. Bedeutet dies, dass alles wieder „zur Normalität zurückkehrt“, wie sämtliche Fraktionen der Bourgeoisie offenkundig hoffen? Gewiss nicht. Wie die Thesen sagen, kann die Bourgeoisie nicht „all die Erfahrungen unterdrücken, die von Zehntausenden künftiger Arbeiter während der Wochen des Kampfes gemacht wurden, ihr erwachendes Interesse an der Politik und ihr sich entwickelndes Bewusstsein. Dies wird eine wahre Goldgrube für die zukünftigen Kämpfe des Proletariats sein, ein vitales Element in seiner Fähigkeit, den Weg zur kommunistischen Revolution fortzusetzen.“ Es ist von größter Bedeutung, dass die Akteure dieses großartigen Kampfes diesen Schatz auch heben, indem sie all die Lehren aus diesen Erfahrungen ziehen, sowohl aus ihren Stärken als auch aus ihren Schwächen. Vor allem müssen sie die Perspektive, die der Gesellschaft bevorsteht, ans Tageslicht holen, eine Perspektive, die bereits in dem Kampf enthalten war, den sie ausgefochten hatten: Angesichts der immer gewaltsameren Angriffe, die der Kapitalismus in seiner Todeskrise notgedrungen gegen die ausgebeutete Klasse entfesseln wird, ist die einzig mögliche Antwort der Letztgenannten, ihren Widerstand zu intensivieren und die Überwindung des Systems vorzubereiten. Wie der Kampf, der sich nun seinem Ende zuneigt, so muss auch der Denkprozess kollektiv vollzogen werden, durch die Debatte, durch neue Versammlungen, Diskussionszirkel, die so offen sind, wie es die allgemeinen Versammlungen allen jenen gegenüber, die teilnehmen wollten, und besonders gegenüber den politischen Organisationen waren, die den Kampf der Arbeiterklasse unterstützen.
Dieses kollektive Nachdenken wird nur möglich sein, wenn ihre Akteure das brüderliche Verhalten der Einheit und Solidarität beibehalten, das auch den Kampf dominiert hatte. In diesem Sinne ist sich die große Mehrheit jener, die am Kampf teilgenommen hatten, darüber bewusst, dass dieser in seiner bisherigen Form vorbei ist, dass es nicht die Zeit für Nachhutgeplänkel, für ultra-minoritäre Streikaktionen „bis zum bitteren Ende“ ist, die zum Scheitern verurteilt sind und riskieren, Spaltungen und Spannungen unter jenen zu provozieren, die wochenlang einen beispielhaften Kampf der Arbeiterklasse geführt hatten.
18. April 2006
Der proletarische Charakter der Bewegung
1) Die gegenwärtige Mobilisierung der Studenten in Frankreich gehört schon jetzt zu den wichtigsten Ereignissen im Klassenkampf der letzten 15 Jahre. Sie ist mindestens genauso wichtig wie die Kämpfe im Herbst 1995 gegen die Reform der sozialen Sicherungssysteme und wie die Auseinandersetzungen im öffentlichen Dienst im Frühjahr 2003 anlässlich der Rentenfrage. Diese Feststellung mag paradox klingen, da sich heute nicht die Lohnarbeiter mobilisieren (außer jene, die sich an dem einem oder anderen Aktionstag und an den Demonstrationen am 7. Februar, 7., 18. und 28. März beteiligt hatten), sondern ein Gesellschaftsbereich, der noch nicht ins Arbeitsleben getreten ist, junge Leute in der Weiterbildung. Jedoch stellt dies keineswegs den durch und durch proletarischen Charakter dieser Bewegung in Frage. Dies hat folgende Gründe:
· In den vergangenen Jahrzehnten haben die Veränderungen in der kapitalistischen Ökonomie zu einer verstärkten Nachfrage nach gebildeteren und qualifizierteren Arbeitskräften geführt. Ein großer Teil der Studenten (die vorwiegend aus den Technologieinstituten der Universitäten kommen, die für die Schaffung von relativ kurzen Ausbildungskursen für künftige „Techniker“, in Wahrheit qualifizierte Arbeiter, verantwortlich sind) wird nach Abschluss des Studiums den Reihen der Arbeiterklasse beitreten. Dies ist nicht mehr allein den klassischen Industriearbeitern vorbehalten, sondern umfasst auch Büroangestellte und Arbeitnehmer im mittleren Management von Privatfirmen wie auch das Krankenpflegepersonal, die breite Mehrheit der Lehrer in Grund- und weiterführenden Schulen und andere Beschäftigte im öffentlichen Dienst.
· Gleichzeitig hat sich die gesellschaftliche Herkunft der Studenten maßgeblich verändert, mit einem beträchtlichen Anstieg in der Zahl von Studenten, die aus der Arbeiterklasse kommen (in Übereinstimmung mit den o.g. Kriterien), was umgekehrt dazu führt, dass immer mehr Studenten (ungefähr 50 %) arbeiten müssen, um zu studieren oder wenigstens ein Minimum an Unabhängigkeit gegenüber ihren Familien zu erlangen.
· Die Hauptforderung der Studenten ist die Rücknahme eines wirtschaftlichen Angriffs (das neue Gesetz, „Contrat de Première Embauche“, kurz: CPE), der die gesamte Arbeiterklasse trifft und nicht nur die heutigen Studenten (d.h. die morgigen Arbeiter) oder die heutigen jungen Lohnarbeiter, da die Anwesenheit von Arbeitskräften am Arbeitsplatz, die in den ersten beiden Jahren ihrer Anstellung unter dem Damoklesschwert der sofortigen Entlassung ohne Begründung leben, nur Druck auf die anderen Arbeiter ausüben kann.
Von Anbeginn hat sich der proletarische Charakter der Bewegung gezeigt, als die meisten Vollversammlungen ausschließlich „studentische Forderungen“ (wie die Forderung nach Rücknahme des LMD, des europäischen Diplomsystems, das erst kürzlich in Frankreich durchgesetzt wurde und bestimmte Studenten bestraft) aus der Liste ihrer Forderungen strichen. Diese Entscheidung entsprach dem von Anfang an von der großen Mehrheit der Studenten geäußerten Wunsch, nicht nur die Solidarität der gesamten Arbeiterklasse zu suchen (so wurde der Begriff „Lohnarbeiter“ allgemein in den Vollversammlungen benutzt), sondern auch zu versuchen, dieselbe zum Eintritt in den Kampf zu bewegen.
Die Vollversammlungen im Zentrum der Bewegung
2) Der wirklich proletarische Charakter der Bewegung wurde auch durch die praktizierte Kampfform demonstriert, insbesondere durch die souveränen Vollversammlungen, die voller Leben waren und nichts mit den Karikaturen der allgemeinen Versammlungen zu tun haben, die so häufig von den Gewerkschaften einberufen werden. Es gab sicherlich eine große Heterogenität unter den verschiedenen Universitäten. Einige Versammlungen ähnelten immer noch in vielerlei Hinsicht den Gewerkschaftsversammlungen, während andere dank des hohen Grads an Engagement und Reife der Teilnehmer das Kraftzentrum eines intensiven Denkprozesses bildeten. Jedoch ist es trotz dieser Heterogenität bemerkenswert, dass es vielen Versammlungen gelang, nach den ersten Tagen - als sie sich mit Themen wie „die Abstimmung darüber, ob über eine besondere Frage abgestimmt wird oder nicht“ (z.B. über die Präsenz von Leuten von außerhalb der Universität oder darüber, ob diese auch sprechen dürfen oder nicht) im Kreis drehten, was zum Weggang einer ganzen Reihe von Studenten führte – diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Es erwies sich auch als problematisch, dass wichtige Beschlüsse von Mitgliedern der Studentengewerkschaft oder politischer Organisationen gefasst wurden. Im Laufe der ersten beiden Wochen ging die Tendenz jedoch in Richtung einer immer zahlreicheren Präsenz der Studenten in den Versammlungen, die, verbunden mit einer entsprechenden Verminderung der Interventionen der Gewerkschaftsmitglieder und der politischen Organisationen, sich immer aktiver an den Diskussionen beteiligten. Die Tatsache, dass die Versammlungen in wachsendem Maße die Kontrolle über ihre eigenen Aktivitäten übernahmen, wurde deutlich sichtbar in dem Umstand, dass das Präsidium, das die Debatten organisierte, immer weniger von Studenten mit gewerkschaftlichen oder politischen Verbindungen und immer mehr von Individuen ohne jegliche Verbindungen oder irgendeiner Erfahrung vor Beginn der Bewegung gestellt wurde. Auch wurden in den am besten organisierten Versammlungen das Präsidium (üblicherweise aus drei Mitgliedern bestehend), das für die Leitung und Animierung der Debatten verantwortlich war, täglich gewechselt, während die weniger lebhaften und organisierten Versammlungen täglich vom gleichen Team „geleitet“ wurden, das dabei oft genug von den Anforderungen übermannt wurde. Es ist wichtig festzustellen, dass der zweite Versammlungstyp zunehmend vom erstgenannten ersetzt wurde. Eines der wichtigen Aspekte dieser Entwicklung war die Teilnahme von Studentendelegierten einer Universität an den Versammlungen anderer Universitäten. Neben der Verstärkung des Gefühls der Stärke und der Solidarität zwischen den verschiedenen Versammlungen hat dies jenen Versammlungen, die etwas zögerlicher waren, ermöglicht, sich von den Fortschritten anderer Versammlungen anregen zu lassen.[i] [45] Dies ist ebenfalls ein wichtiger Faktor in der Dynamik von Arbeiterversammlungen und setzt ein beträchtliches Maß an Bewusstsein und Verständnis innerhalb der Klassenbewegung aus.
3) Einer der Hauptausdrücke des proletarischen Charakters der Versammlungen in den Universitäten während dieser Zeitspanne ist die Tatsache, dass sie nicht nur den Studenten anderer Universitäten offen standen, sondern sich sehr schnell auch Leuten öffneten, die keine Studenten waren. Von Anfang an riefen die Versammlungen auch das Universitätspersonal (Lehrer, Techniker, etc.) dazu auf, sich an ihnen zu beteiligen und ihrem Kampf anzuschließen, doch gingen sie noch weiter. Besonders Arbeitende und Rentner, Eltern und Großeltern der Studenten und Schüler, die sich im Kampf befanden, wurden im allgemeinen aufs wärmste von den Versammlungen willkommen geheißen, wann immer sie Interventionen machten, die zur Ausweitung der Bewegung insbesondere auf die Lohnarbeiter ermutigten.
Die Öffnung der Versammlungen gegenüber Menschen, die zunächst einmal nicht zum unmittelbar betroffenen Bereich gehören, und dies nicht nur als Beobachter, sondern auch als aktive Teilnehmer, stellt einen äußerst wichtigen Aspekt in der Arbeiterbewegung dar. Es ist klar, dass im Falle einer Abstimmung es durchaus notwendig sein kann, dass sich nur jene daran beteiligen dürfen, die zu dem Bereich gehören, den die Versammlung repräsentiert. Damit wird verhindert, dass professionelle Organisatoren der Bourgeoisie und andere ihr zu Dienste stehenden Elemente den Versammlungen die Luft abschnüren. Zu diesem Zweck griffen viele Studentenversammlungen zu dem Mittel, nur jene Teilnehmer beim Zählen der Stimmen zu berücksichtigen, die eine Studentenkarte (die sich von Universität zu Universität unterscheidet) in ihren Händen hielten. Die Frage der Öffnung der Versammlungen ist eminent wichtig für den Kampf der Arbeiterklasse. In „normalen“ Zeiten, d.h. außerhalb von Perioden intensiven Klassenkampfes, ist für die Organisationen der kapitalistischen Klasse (die Gewerkschaften und die linksextremistischen Parteien) der Ausschluss von Außenstehenden aus den Versammlungen ein vorzügliches Mittel, um die Kontrolle über die Arbeiter zu behalten, die Dynamik ihres Kampfes zu bremsen und somit den Interessen der Bourgeoisie zu dienen. Die Öffnung der Versammlungen erlaubt nämlich den fortgeschrittensten Elementen der Klasse und besonders den revolutionären Organisationen, zur Entwicklung des Bewusstseins der Arbeiter im Kampf beizutragen. In der Geschichte des Klassenkampfes war dies stets die Trennlinie zwischen Strömungen, die eine proletarische Orientierung vertreten, und jenen, die die kapitalistische Ordnung verteidigen. Es gibt zahllose Beispiele dafür. Zu den bedeutendsten zählt der Kongress der Arbeiterräte Mitte Dezember 1918 in Berlin, nach dem Novemberaufstand der Soldaten und Arbeiter gegen den Krieg, der die deutsche Bourgeoisie nicht nur dazu zwang, den Krieg zu beenden und den Kaiser abzusetzen, sondern auch dazu nötigte, die politische Macht an die Sozialdemokratie zu übergeben. Wegen der Unreife des Bewusstseins der Arbeiterklasse und aufgrund der Methoden bei der Ernennung der Delegierten wurde dieser Kongress von den Sozialdemokraten beherrscht, die es den Repräsentanten der revolutionären russischen Sowjets sowie Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, den wichtigsten Figuren der revolutionären Bewegung, unter dem Vorwand, sie seien keine Arbeiter, verbaten, am Kongress teilzunehmen. Dieser Kongress beschloss zu guter Letzt, all seine Macht der von der Sozialdemokratie angeführten Regierung zu überreichen, einer Regierung, die einen Monat später Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermorden lassen sollte. Ein anderes relevantes Beispiel ist die Internationale Arbeiterassoziation (IAA – die Erste Internationale). Auf ihrem Kongress von 1866 versuchten bestimmte französische Führer wie der Bronzegraveur Tolain, die Regel durchzusetzen, dass „nur Arbeitern erlaubt sein möge, auf dem Kongress abzustimmen“ – eine Regel, die sich vornehmlich gegen Karl Marx und seine engsten Genossen richtete. Zurzeit der Pariser Kommune 1871 war Marx einer ihrer glühendsten Vertreter, während Tolain sich in Versailles in den Reihen jener befand, die für das Massaker an 30.000 Arbeitern und damit für die Niederschlagung der Kommune verantwortlich zeichneten.
Im Hinblick auf die aktuelle Studentenbewegung ist es bezeichnend, dass der größte Widerstand gegen die Öffnung der Versammlungen von den Mitgliedern der Studentengewerkschaft, der UNEF (einem Anhängsel der Sozialistischen Partei), kam und dass die Versammlungen dort am offensten waren, wo der Einfluss der UNEF am wenigsten spürbar war.
Anders als 1995 und 2003 wurde die Bourgeoisie diesmal von der Bewegung überrascht
4) Eines der wichtigsten Kennzeichen in der gegenwärtigen Episode des Klassenkampfes in Frankreich ist, dass alle Sektoren der Bourgeoisie und ihres politischen Apparates (rechte wie linke Parteien und Gewerkschaftsorganisationen) fast total überrascht wurden. Dies erlaubt uns sowohl die Vitalität als auch die Tiefe der Bewegung wie auch die äußerst angespannte Lage, in der sich die herrschende Klasse derzeit befindet, zu verstehen. In diesem Zusammenhang möchten wir hier eine klare Unterscheidung zwischen der jüngsten Bewegung und den massiven Kämpfen im Herbst 1995 und im Frühjahr 2003 machen.
Die Mobilisierung der Arbeiter 1995 gegen den „Juppé-Plan“, die Reform der sozialen Sicherungssysteme, war in Wahrheit kraft einer cleveren Arbeitsteilung zwischen der Regierung und den Gewerkschaften zustandegekommen. Mit seiner typischen Arroganz verband der damalige Premierminister, Alain Juppé, die Angriffe gegen die sozialen Sicherungssysteme (die sowohl die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes als auch die des privaten Sektor betrafen) mit speziellen Attacken gegen die Renten der Arbeiter der SNCF (die französischen Eisenbahnen) und der staatlichen Transportarbeiter. Diese Arbeiter waren die Speerspitze der Mobilisierung. Einige Tage vor Weihnachten, die Streiks waren schon einige Wochen alt, zog die Regierung ihre Rentenpläne zurück, was – nach einem entsprechenden Appell der Gewerkschaften – dazu führte, dass die betroffenen Arbeiter wieder zur Arbeit zurückkehrten. Dieser Rückzug in den direkt betroffenen Sektoren bedeutete das Ende der Bewegung in allen anderen Bereichen. Die meisten Gewerkschaften (abgesehen von der CFDT) gaben sich selbst dabei sehr militant, indem sie zur Ausweitung der Bewegung aufriefen und allgemeine Versammlungen abhielten. Trotz ihres Ausmaßes endete die Arbeitermobilisierung jedoch nicht in einem Sieg, sondern mehr oder weniger in einer Niederlage, da die Hauptforderung, die Rücknahme des Juppé-Plans zur Reformierung der sozialen Sicherungssysteme, nicht erfüllt wurde. Doch durch die Rücknahme der speziellen Rentenpläne durch die Regierung waren die Gewerkschaften in der Lage, die Niederlage als einen Sieg zu verkleiden, was wiederum ihr Image aufpolierte, das durch ihre wiederholte Sabotage der Arbeiterkämpfe in den 90er Jahren Schaden genommen hatte.
Die Mobilisierung von 2003 im öffentlichen Dienst war eine Antwort auf den Beschluss der Regierung, die Mindestanzahl von Arbeitsjahren zur Erlangung der vollen Rente anzuheben. Diese Maßnahme richtete sich direkt gegen alle Staatsbeschäftigten, aber ein Teil der Lehrer und andere Beschäftigte im Bildungswesen waren, zusätzlich zum Angriff auf die Renten, auch Opfer weiterer Attacken unter dem Mantel der „Dezentralisierung“. Nicht alle Lehrer waren von letztgenannter Maßnahme betroffen, doch fühlten sich alle besonders betroffen durch den Angriff gegen ihre Kollegen und durch die Mobilisierung Letzterer. Hinzu kam, dass der Beschluss, die Minimalanzahl von Berufsjahren auf 40 Jahre - und für einige Sektoren der Arbeiterklasse, die aufgrund ihrer Ausbildungszeit erst mit 23 oder 25 Jahren ins Berufsleben treten können, auf mehr als 40 Jahre - anzuheben, bedeutete, dass sie unter noch schlimmeren und auszehrenden Bedingungen als jetzt weit über das gesetzliche Renteneintrittsalter von 60 Jahren hinaus arbeiten müssen. Auch wenn er sich in seinem Stil von Juppé unterschied, sprach Premierminister Jean-Pierre Raffarin genauso Klartext und erklärte: „Es ist nicht die Straße, die herrscht“. Letztendlich war die Bewegung trotz des Kampfgeistes der Beschäftigten im Bildungswesen und ihrer Hartnäckigkeit (einige harrten sechs Wochen lang im Streik aus), trotz Demonstrationen, die zu den größten seit Mai 68 zählten, nicht in der Lage, die Regierung zurückzudrängen. Alles, was passierte, war, dass Letztere, als die Mobilisierung sich abzuschwächen begann, entschied, sich auf besondere Maßnahmen zu beschränken, die das Nicht-Lehrer-Personal im Bildungswesen betraf, um so die Einheit zu zerstören, die sich zwischen den verschiedenen Berufsgruppen entwickelt hatte, und die Dynamik der Mobilisierung zu untergraben. Die unvermeidliche Rückkehr des Schulpersonals zur Arbeit bedeutete das Ende dieser Bewegung. Wie jene von 1995 ist es ihr nicht gelungen, den Hauptangriff der Regierung, nämlich den Angriff gegen ihre Renten, zurückzuweisen. Doch während es durchaus angebracht ist, die Episode von 1995 als einen „Sieg“ der Gewerkschaften darzustellen, der es ihnen ermöglichte, ihren Einfluss auf alle Arbeiter zu stärken, wurde 2003 die Rückkehr zur Arbeit hauptsächlich als eine Niederlage empfunden (besonders von jener großen Zahl von Lehrern, die fast sechs Wochengehälter verloren hatten). Dies hatte große Auswirkungen auf das Vertrauen der Arbeiter in den Gewerkschaften.
Die politische Schwäche der französischen Rechten
5) Wir können die Hauptmerkmale der Angriffe gegen die Arbeiterklasse 1995 und 2003 folgendermaßen zusammenfassen:
· Angesichts der Weltwirtschaftskrise und des defizitären Staatshaushaltes ergaben sich beide Angriffswellen aus der Notwendigkeit für den Kapitalismus, mit der Zerstörung des Wohlfahrtsstaates, der nach dem II. Weltkrieg errichtet wurde, und der sozialen Sicherungssysteme fortzufahren.
· Beide Angriffswellen wurden akribisch von den verschiedenen Organen des Kapitalismus, insbesondere von der rechten Regierung und den Gewerkschaftsorganisationen vorbereitet, um der Arbeiterklasse sowohl auf ökonomischer Ebene als auch auf politisch-ideologischer Ebene eine Niederlage zu bereiten.
· Bei beiden Angriffen wurde die Methode angewendet, die Angriffe auf einen spezifischen Sektor zu häufen, auf diese Weise eine allgemeine Mobilisierung provozierend, um schließlich bestimmte Angriffe gegen diesen Sektor „zurückzunehmen“, was auf eine Entwaffnung der gesamten Bewegung hinauslief.
· Jedoch war die politische Dimension der Angriffe durch die Bourgeoisie, auch wenn sie auf ähnlichen Methoden basierten, nicht dieselbe in beiden Fällen, da 1995 das Resultat der Mobilisierung als ein „Sieg“ dargestellt wurde, der den Gewerkschaften neuen Kredit verschaffte, während 2003 die Offenkundigkeit der Niederlage einen Faktor der Demoralisierung darstellte und so die Gewerkschaften diskreditierte.
Bezüglich der jüngsten Mobilisierung liegt eine Reihe von Tatsachen auf der Hand:
· Die CPE war überhaupt keine unerlässliche Maßnahme für die französische Wirtschaft: Dies wird deutlich von der Tatsache veranschaulicht, dass eine große Zahl von Arbeitgebern und rechten Abgeordneten nicht dafür war, genauso wenig wie die Mehrheit der Regierung, insbesondere die beiden direkt involvierten Minister für Arbeit (Gérard Larcher) und für „Sozialen Zusammenhalt“ (Jean-Louis Borloo).
· Abgesehen von der Tatsache, dass diese Maßnahme - vom kapitalistischen Standpunkt aus betrachtet - keineswegs unerlässlich war, gab es so gut wie keine flankierenden Maßnahmen, um sie durchzusetzen. Während die Angriffe von 1995 und 2003 durch „Diskussionen“ mit den Gewerkschaften (die in beiden Fällen soweit gingen, dass eine der Hauptgewerkschaften, die CFDT, mit ihren Verbindungen zur Sozialistischen Regierung die Regierungspläne unterstützten) von langer Hand vorbereitet wurden, war die CPE Teil einer Reihe von Maßnahmen, die unter einem Gesetz zusammengefasst wurden, das „Chancengleichheit“ getauft wurde und ohne vorherige Diskussion mit den Gewerkschaften durch das Parlament gepeitscht wurde. Einer der widerlichsten Aspekte dieses Gesetzes ist die Tatsache, dass es behauptet, für Jobsicherheit zu kämpfen, während es tatsächlich die Unsicherheit für junge Arbeiter unter 26 institutionalisiert, und dass es behauptet, dass die jungen Leute aus den „Problembezirken“, die sich im Herbst 2005 im Aufruhr befanden, davon profitierten, während es tatsächlich eine Reihe von Angriffen gegen dieselben jungen Leute enthält, wie z.B. die Absenkung des Arbeitsalters auf 14 und, unter dem Vorwand der Ausbildungserfordernisse, die Legalisierung der Nachtarbeit für Jugendliche ab 15.
6) Die Regierung war bewusst provokant aufgetreten bei dem Versuch, das Gesetz rücksichtslos durchzubringen. Sie hat dabei jene Klauseln in der Verfassung genutzt, die es ihr erlauben, das Parlament zu umgehen, und sie hatte sich ausgerechnet zu dem Zeitpunkt dazu entschieden, als die Schüler und Studenten in die Ferien entlassen wurden. Doch Villepin und die Regierung scheiterten mit ihrem „cleveren Manöver“. Statt jegliche Reaktion der Studenten zu vermeiden, machten sie Letztere erst richtig zornig und fest entschlossen, Widerstand gegen dieses Gesetz zu leisten. Auch 1995 radikalisierten die Erklärungen und das arrogante Auftreten von Premierminister Juppé die Streikaktion. Doch damals war die Provokation beabsichtigt, da die Bourgeoisie die Reaktion der Arbeiter vorausgesehen und darauf vertraut hat, mit ihr fertig zu werden. In einer Situation, in der die Arbeiterklasse noch unter dem Gewicht der andauernden ideologischen Kampagnen rund um den Zusammenbruch der so genannten „sozialistischen“ Länder litt (was die Möglichkeit einer Entwicklung von Kämpften reduzierte), war die Bourgeoisie in der Lage gewesen, diese Ereignisse zu manipulieren, um der Glaubwürdigkeit der Gewerkschaften neuen Glanz zu verleihen. Im Gegensatz dazu hat Villepin heute nicht vorausgesehen, dass er den Zorn der Studenten, ganz zu schweigen von einem großen Teil der Arbeiterklasse, gegen diese Politik erregen würde. 2005 gelang es Villepin, die CNE (Contrat Nouvelle Embauche) ohne Probleme durchs Parlament zu schleusen. Dieses Gesetz erlaubt es Betrieben mit weniger als 20 Beschäftigten, Arbeiter jeglichen Alters, die weniger als zwei Jahre beschäftigt sind, ohne Begründung zu entlassen. Man erwartete daher, dass der CPE, der die Bestimmungen des CNE sowohl auf den öffentlichen Dienst als auch auf private Gesellschaften ausdehnte, allerdings nur für Arbeiter unter 26, auf eine ähnliche Reaktion stoßen würde, wenn er in Kraft tritt. Die darauf folgenden Ereignisse haben gezeigt, dass die Regierung sich gründlich verschätzt hatte; Medien und sämtliche politischen Fraktionen der Bourgeoisie waren sich darin einig, dass sich die Regierung in einer verzwickten Lage befindet. Tatsächlich ist jedoch nicht nur die Regierung, sondern sind auch sämtliche Regierungsparteien (linke wie rechte) sowie die Gewerkschaften, die nun Villepins Methoden verurteilen, von dieser Entwicklung gänzlich überrumpelt worden. Darüber hinaus erkannte selbst Villepin seinen Fehler in gewisser Weise an, indem er einräumte, dass ihm seine Vorgehensweise „leid“ tue.
Die Regierung (und besonders Villepin) hat offensichtlich Fehler gemacht. Villepin wird von der Linken und den Gewerkschaften als „Einzelgänger“[ii] [45] und „hochmütige“ Person dargestellt, unfähig, die wahren Bedürfnisse des Volkes zu begreifen. Seine „Freunde“ auf der Rechten (besonders natürlich jene, die seinem großen Rivalen, Nicolas Sarkozy, nahe stehen) heben hervor, dass er nie in seine Ämter gewählt worden sei (anders als Sarkozy, der Abgeordneter und langjähriger Bürgermeister einer wichtiger Stadt[iii] [45] gewesen war) und dass er Schwierigkeiten hat, eine Verbindung zum gewöhnlichen Wähler und zur Basis seiner eigenen Partei herzustellen. Es wird auch gesagt, dass sein Hang zur Poesie und Literatur ihn zu einer Art „Dilettant“ mit einem amateurhaften Verständnis von Politik mache. Doch der größte Vorwurf, der auch von den Bossen gegen ihn erhoben wird, besteht darin, dass er es versäumt hatte, die „Sozialpartner“ bzw. die „vermittelnden Körperschaften“ (um die Terminologie der Medien-Soziologen zu gebrauchen), mit anderen Worten: die Gewerkschaften, zu konsultieren, bevor er mit seinem Angriff loslegte. Die größte Kritik kommt dabei von der CFDT, der moderatesten unter den Gewerkschaften, die die Angriffe der Regierung von 1995 und 2003 noch unterstützt hatte.
Wir können daher sagen, dass unter diesen Umständen die französische Rechte ihren Ruf als „dümmste“ Rechte auf der Welt aufs Neue unter Beweis gestellt hat. Darüber hinaus zeigt sich, dass die französische Bourgeoisie wieder einmal den Preis für ihre Unfähigkeit bezahlt, das politische Spiel zu beherrschen, was bereits in der Vergangenheit zu Wahl“unfällen“ führte. 1981 kam die Linke an die Regierung, weil die Rechte sich uneins war, was dem Trend in den anderen wichtigen Ländern (besonders in Großbritannien, Deutschland, Italien und in den USA), auf die eskalierende soziale Lage zu antworten, zuwiderlief. 2002 scheiterte die Linke aufgrund ihrer Uneinigkeit daran, die zweite Runde in den Präsidentschaftswahlen zu erreichen, die stattdessen mit einem Rennen zwischen Le Pen (Führer der Rechtsextremisten) und Chirac endete. Chirac wurde mit all den Stimmen der Linken wiedergewählt, die in ihm das „geringere Übel“ betrachteten. Chirac wurde also dank der Linken wiedergewählt, was ihm weniger Bewegungsspielraum verlieh, als dies der Fall gewesen wäre, wenn er den Führer der Linken, Lionel Jospin, direkt besiegt hätte. Die reduzierte Legitimität Chiracs erklärt in gewisser Weise die Schwäche dieser Regierung, der Arbeiterklasse die Stirn zu bieten und sie zu attackieren. Doch diese politische Schwäche der Rechten (und des politischen Apparats der französischen Bourgeoisie im allgemeinen) hat sie nicht daran gehindert, einen massiven Angriff gegen die Arbeiterrenten auszuführen. Im gegenwärtigen Fall erklärt diese Schwäche aber nicht das Ausmaß der aktuellen Bewegung, besonders die Mobilisierung von Hunderttausenden von jungen, künftigen Arbeitern, die Dynamik der Bewegung und ihre Aneignung wahrhaft proletarischer Kampfformen.
Ein Ausdruck der Wiederbelebung der Arbeiterkämpfe und der Entwicklung von Klassenbewusstsein
7) Auch 1968 resultierte die Studentenmobilisierung und der formidable Arbeiterstreik (neun Millionen Arbeiter etliche Wochen lang im Streik – insgesamt mehr als 150 Millionen Streiktage) teilweise aus den Fehlern des gaullistischen Regimes, das sich am Ende seiner Herrschaft befand. Das provokative Verhalten, das die Behörden gegenüber den Studenten zutage legten (die Polizei drang am 3. Mai zum ersten Mal seit 100 Jahren in die Sorbonne ein und verhaftete ein Reihe von Studenten, die versuchten, gegen die gewaltsame Räumung zu protestieren), war ein Faktor, der zur massiven Mobilisierung der Studenten in der Woche vom 3. bis zum 10. Mai führte. Nach der heftigen Repression vom 10. und 11. Mai und der Wirkung, die dies auf die öffentliche Meinung hatte, beschloss die Regierung, zwei Forderungen der Studenten zu erfüllen: die Wiedereröffnung der Sorbonne und die Freilassung der eine Woche zuvor verhafteten Studenten. Die Regierung trat zum Rückzug an, und der enorme Erfolg der Demonstration, zu der die Gewerkschaften am 13. Mai[iv] [45] aufgerufen hatten, leitete eine Reihe von spontanen Ausständen in einigen Großbetrieben wie Renault in Cléon und Sud-Aviation in Nantes ein. Einer der Gründe für diese Ausstände von hauptsächlich jungen Arbeitern war die Realisierung Letzterer, dass, wenn die Entschlossenheit der Studenten (die über keinerlei ökonomische Macht besitzen) ausreichte, um die Regierung erfolgreich zum Rückzieher zu zwingen, Letztere auch von den Arbeitern, die ein weitaus mächtigeres Mittel – den Streik - besitzen, um Druck auszuüben, zum Rückzug gezwungen werden kann. Das Zeichen, das die Arbeiter von Cléon und Nantes setzten, verbreitete sich wie ein Lauffeuer und ließ die Gewerkschaften hinter sich. Völlig überrumpelt von den Ereignissen, waren sie gezwungen, sich zwei Tage später der Bewegung anzuhängen und zu einem Streik aufzurufen, der mit der Beteiligung von neun Millionen Arbeitern das nationale Wirtschaftsleben völlig zum Erliegen brachte. Es wäre kurzsichtig anzunehmen, dass eine Bewegung solchen Ausmaßes ein rein lokales oder nationales Produkt sein kann. Sie musste das Produkt einer äußerst bedeutsamen Veränderung im Kräfteverhältnis zwischen der Bourgeoisie und dem Proletariat auf internationaler Ebene sein, und zwar zugunsten Letzterem.[v] [45] Ein Jahr später sollte dies mit der „Cordobazo“ am 29. Mai in Argentinien[vi] [45], dem „Heißen Herbst“ in Italien 1969 (auch bekannt als „wilder Mai“), schließlich mit den großen Streiks in der Ostseeregion, dem „Polnischen Winter“ von 1970/71 und vielen anderen weniger spektakulären Bewegungen bestätigt werden. All diese Bewegungen bekräftigten, dass der Mai 1968 keine Eintagsfliege war, sondern der Ausdruck eines historischen Wiedererwachens des Weltproletariats nach mehr als vier Jahrzehnten der Konterrevolution.
8) Die gegenwärtige Bewegung in Frankreich lässt sich nicht einfach aufgrund von Besonderheiten (die „Fehler“ der Regierung Villepin) oder nationalen Überlegungen erklären. Vielmehr stellt sie einen schlagenden Beweis für die Tendenz dar, die die IKS seit 2003 hervorgehoben hat, nämlich die Tendenz zur Wiederaufnahme der Kämpfe der Arbeiterklasse weltweit und zu einer Entwicklung ihres Bewusstseins:
„Die breiten Mobilisierungen vom Frühling 2003 in Frankreich und in Österreich stellen in den Klassenkämpfen seit 1989 einen Wendepunkt dar. Sie sind ein erster wichtiger Schritt in der Wiederaneignung der Kampfbereitschaft der Arbeiter nach der längsten Rückflussperiode seit 1968.“ (Internationale Revue Nr. 33, „Klassenkampfbericht“)
„Trotz all ihrer Schwierigkeiten bedeutete die Rückzugsperiode keineswegs das „Ende des Klassenkampfes“. Die 1990er Jahre waren durchsetzt mit einer ganzen Anzahl von Bewegungen, die zeigten, dass die Arbeiterklasse immer noch über unversehrte Reserven an Kampfbereitschaft verfügte (beispielsweise 1992 und 1997). Doch stellte keine dieser Bewegungen eine wirkliche Änderung auf der Ebene des Klassenbewusstseins dar. Deshalb sind die jüngeren Bewegungen so wichtig; auch wenn es ihnen am spektakulären und sofortigen Einfluss mangelt, den diejenige von 1968 in Frankreich hatte, sind sie doch ein Wendepunkt im Kräfteverhältnis zwischen den Klassen. Die Kämpfe von 2003–2005 wiesen die folgenden wesentlichen Eigenschaften auf:
– Sie bezogen bedeutende Sektoren der Arbeiterklasse in Ländern im Zentrum des weltumspannenden Kapitalismus mit ein (wie in Frankreich 2003);
– sie traten mit Sorgen auf, die ausdrücklicher auch politische Fragen in den Vordergrund stellten; insbesondere wirft die Frage der Pensionierung das Problem der Zukunft auf, welche die kapitalistische Gesellschaft allen bereit hält (...);
– die Frage der Klassensolidarität wurde nun breiter und ausdrücklicher aufgeworfen denn je in den Kämpfen der 80er Jahre, insbesondere in den jüngsten Bewegungen in Deutschland;
– sie wurden begleitet vom Auftauchen einer neuen Generation von Leuten, die nach politischer Klarheit suchen. Diese neue Generation hat sich einerseits im Auftreten von offen politisierten Leuten gezeigt, andererseits in neuen Schichten von Arbeitern, die zum ersten Mal in den Kampf getreten sind. Wie bestimmte wichtige Demonstrationen bewiesen haben, wird das Fundament gelegt für die Einheit zwischen der neuen Generation und derjenigen „von 68“ – sowohl der politischen Minderheit, welche die kommunistische Bewegung in den 60er und 70er Jahren aufgebaut hat, als auch den breiteren Schichten der Arbeiter, welche die reiche Erfahrung der Klassenkämpfe zwischen 68 und 89 in sich tragen.“ (Internationale Revue Nr. 36, „16. Kongress der IKS: Resolution über die internationale Situation“)
Diese Eigenschaften, die wir an unserem 16. Kongress hervorhoben, haben sich nun in der gegenwärtigen Bewegung der Studenten in Frankreich voll bestätigt:
So hat sich die Verbindung zwischen den Generationen von Kämpfenden spontan in den Studentenversammlungen hergestellt: Den älteren Arbeitern (unter ihnen auch Rentner) wurde es nicht nur erlaubt, in den Vollversammlungen das Wort zu ergreifen, sondern sie wurden dazu ermuntert, und mit viel Aufmerksamkeit und Wärme hörte ihnen die junge Generation zu, als sie ihre Kampferfahrung weitervermittelten[vii] [45].
Gleichzeitig steht die Sorge um die Zukunft (und nicht nur diejenige um die unmittelbare Lage) im Zentrum der Mobilisierung, bei der Jugendliche sich beteiligen, die mit dem Erstanstellungsvertrag erst in mehreren Jahren konfrontiert sein werden (bei den Mittelschülern manchmal erst in mehr als fünf Jahren). Diese Sorge um die Zukunft äußerte sich schon 2003 bei der Frage der Renten, wo zahlreiche Junge in den Demonstrationen zu sehen waren, was auch schon ein Hinweis auf diese Solidarität zwischen den Generationen der Arbeiterklasse darstellte. In der gegenwärtigen Bewegung wirft die Mobilisierung gegen die Verelendung und somit gegen die Arbeitslosigkeit zumindest implizit und für eine wachsende Anzahl von Studenten und jungen Arbeitern auch explizit die Frage nach der Zukunft auf, welche der Kapitalismus für die Gesellschaft bereit hält; eine Sorge, die auch von vielen älteren Arbeitern geteilt wird, die sich fragen: „Welche Gesellschaft hinterlassen wir unseren Kindern?“
Die Frage der Solidarität (namentlich zwischen den Generationen, aber auch unter den verschiedenen Abteilungen der Arbeiterklasse) war eine der Schlüsselfragen der Bewegung:
Solidarität der Stundenten unter sich, Wille derjenigen, die an der Spitze standen, die besser organisiert waren, ihre Kolleginnen und Kollegen, die vor schwierigen Situationen standen, zu unterstützen (Sensibilisierung und Mobilisierung der zurückhaltenderen Studenten, Organisierung und Durchführung der Vollversammlungen usw.);
Gefühl der Solidarität unter den Arbeitern, auch wenn dieses Gefühl nicht in einer Ausweitung des Kampfes mündete - außer der Beteiligung an den Aktionstagen und den Demonstrationen;
Bewusstsein bei vielen Studenten, dass sie nicht zu denjenigen gehören, die von der drohenden Verelendung am meisten betroffen sind (die viel massiver die jungen Arbeiter ohne Abschluss betrifft), sondern dass ihr Kampf noch mehr die am meisten benachteiligten Jugendlichen betrifft, insbesondere diejenigen in den Vorstädten, die im letzten Herbst „gebrannt“ haben.
Die junge Generation übernimmt die Fackel des Kampfes
9) Einer der hauptsächlichen Wesenszüge der gegenwärtigen Bewegung ist der Umstand, dass sie von der jungen Generation getragen wird. Und dies ist keineswegs ein Zufall. Seit einigen Jahren weist die IKS darauf hin, dass es bei der neuen Generation einen Prozess des vertieften Nachdenkens gibt, der zwar kein großes Aufheben macht, aber sich hauptsächlich im Erwachen einer kommunistischen Politik bei wesentlich mehr jungen Leuten als früher ausdrückt (von denen auch schon einige unseren Reihen beigetreten sind). Die IKS erblickte darin die „Spitze des Eisbergs“ in einem Prozess der Bewusstseinsreifung, der breite Teile der neuen proletarischen Generationen erfasst, die früher oder später in große Kämpfe eintreten werden:
"Die neue Generation von „suchenden Elementen“, eine Minderheit, die sich hin zu Klassenpositionen bewegt, wird in den künftigen Arbeiterkämpfen eine Rolle von unerhörter Bedeutung haben, die viel schneller und tiefer als die Kämpfe von 68–89 mit ihren politischen Auswirkungen konfrontiert werden. Diese Elemente, die bereits eine langsame, aber bedeutsame Entwicklung des Bewusstseins in der Tiefe ausdrücken, werden dazu aufgerufen sein, der massiven Ausbreitung des Bewusstseins in der gesamten Klasse Beistand zu leisten.“ (Internationale Revue Nr. 31, "15. Kongress der IKS: Resolution über die internationale Situation")
Die gegenwärtige Studentenbewegung in Frankreich bringt zeigt, dass dieser unterirdische Prozess, der vor einige Jahren begonnen hat, an die Oberfläche dringt. Sie ist das Zeichen dafür, dass der stärkste Einfluss der ideologischen Kampagnen, die seit 1989 über „das Ende des Kommunismus“, „das Verschwinden des Klassenkampfes“ (wenn nicht der Arbeiterklasse überhaupt) nun hinter uns ist.
Unmittelbar nach dem 1968 erfolgten historischen Wiederaufflammen der weltweiten Arbeiterkämpfe, stellten wir fest: "Heute ist die Lage des Proletariats jedoch eine andere als in den 30er Jahren. Einerseits sind die Mystifikationen, welche in der Vergangenheit das Bewusstsein der Arbeiter erdrückten, wie alle anderen Pfeiler der bürgerlichen Ideologie mittlerweile zum Teil verschlissen. Der Nationalismus, die demokratischen Illusionen, der Antifaschismus - sie alle haben nicht mehr den gleichen Einfluss wie vor 50 Jahren. Auch haben die neuen Arbeitergenerationen nicht derartige Niederlagen erlitten wie ihre Väter. Zwar verfügen die Arbeiter heute nicht über die gleiche Erfahrung wie die vorherigen Generationen, doch gleichzeitig sind sie bei ihren Konfrontationen mit der Krise nicht durch die Demoralisierung ihrer Väter und Vorväter belastet. Die gewaltige Reaktion, die die Arbeiterklasse gegenüber den ersten Zeichen der Krise 1968/69 an den Tag gelegt hat, bedeutet, dass die Bourgeoisie heute nicht in der Lage ist, die einzige Lösung durchzusetzen, die sie gegen die Krise anzubieten hat: einen erneuten weltweiten Holocaust. Denn zuvor muss sie die Arbeiterklasse besiegen – die heutige Perspektive indessen ist nicht der imperialistische Krieg, sondern ein allgemeiner Krieg der Klassen." (Manifest der IKS, im Januar 1976 auf dem 1. Kongress angenommen)
Am 8. Kongress, 13 Jahre später, vervollständigte der Bericht zur internationalen Lage diese Analyse, wie folgt:
"Die Generationen, die durch die Konterrevolution zwischen den 30er und 60er Jahren geprägt waren, mussten den Platz für diejenigen räumen, die sie nicht gekannt hatten, damit das Weltproletariat die nötige Kraft fand, um sie zu überwinden. Ganz ähnlich (auch wenn der Vergleich etwas angepasst werden muss, da zwischen der 68er Generation und den vorangegangenen ein historischer Bruch lag, während es zwischen den darauf folgenden eine Kontinuität gibt) wird die Generation, welche die Revolution vollbringen wird, nicht diejenige sein können, welche die wesentliche geschichtliche Aufgabe erfüllt hat, dem Weltproletariat nach der tiefsten Konterrevolution seiner Geschichte eine neue Perspektive zu eröffnen.“
Einige Monate danach sollte sich diese Voraussicht durch den Zusammenbruch der so genannt „sozialistischen“ Regime und das dadurch verursachte starke Zurückweichen der Arbeiterklasse konkretisieren. In der Tat verhält es sich bei der gegenwärtigen Wiederaufnahme der Klassenkämpfe - natürlich in anderem Maßstab - ähnlich wie seinerzeit mit der historischen Wiederaufnahme von 1968 nach 40 Jahren der Konterrevolution: Die Generationen, welche die Niederlage und insbesondere den schrecklichen Druck der bürgerlichen Verschleierung erlitten hatten, konnten keine neue Episode der Konfrontation zwischen den Klassen einleiten. So befand sich die Generation, die heute sich zuerst nach der zu Boden gefallenen Fackel des Kampfes gebückt hat, noch in der Primarschule, als dieses Sturmgewitter der bürgerlichen Ideologie losbrach, sie war ihm noch nicht unmittelbar ausgesetzt.
<<>>Das im Vergleich zu 68 viel tiefer gehende Bewusstsein darüber, der Arbeiterklasse anzugehören>
10) Der Vergleich zwischen der gegenwärtigen Studentenmobilisierung in Frankreich und den Ereignissen vom Mai 1968 erlaubt es, einige wichtige Wesenszüge der jetzigen Bewegung zu erkennen. Die Mehrheit der Studenten im heutigen Kampf behauptet sehr klar: „Unsere Kampf unterscheidet sich von demjenigen vom Mai 68.“ Das ist vollkommen richtig, aber es geht darum, die Gründe dafür zu begreifen. Der erste Unterschied, der auch grundsätzlich ist, besteht in der Tatsache, dass die Bewegung vom Mai 1968 ganz am Anfang der offenen Krise des Weltkapitalismus stattfand, wohingegen diese heute schon während vier Jahrzehnten angedauert hat (mit einer empfindlichen Verschärfung ab 1974). Von 1967 an stellte man in mehreren Ländern, namentlich in Deutschland und Frankreich, einen Anstieg bei der Anzahl von Arbeitslosen fest, was eine Grundlage war sowohl für die Unruhe, die sich unter den Studenten breit machte, als auch für die Unzufriedenheit, die schließlich die Arbeiterklasse dazu brachte, den Kampf aufzunehmen. Heute ist aber die Anzahl der Arbeitslosen in Frankreich zehnmal höher als im Mai 1968, und diese Massenarbeitslosigkeit (nach den offiziellen Zahlen in der Größenordnung von 10% der aktiven Bevölkerung) dauert schon seit mehreren Jahrzehnten an. Daraus ergibt sich eine ganze Reihe von Unterschieden.
Selbst wenn jene ersten Anzeichen der Krise 1968 einen Auslöser für die Wut der Studenten waren, so hatten sie doch noch keineswegs eine ähnliche Dimension wie heute. Damals waren die Arbeitslosigkeit und die Unsicherheit des Jobs nach dem Ende des Studiums noch bei weitem nicht die große Drohung. Die Hauptsorge der studentischen Jugend damals war, dass sie nicht mehr in der Lage sein würde, den gleichen gesellschaftlichen Status wie die vorhergehende Generation von Universitätsabsolventen zu erreichen. Die 68er Generation war in der Tat die erste, die relativ hart mit der Realität der „Proletarisierung der Kader“ konfrontiert war, mit einem Phänomen, das damals Heerscharen von Soziologen beschäftigte. Diese Erscheinung war schon einige Jahre früher aufgetreten, noch bevor die Krise offen ausbrach, und zwar durch eine beträchtliche Zunahme der Zahl von Universitätsabsolventen. Diese Zunahme war einerseits dem Bedarf der Wirtschaft geschuldet, andererseits aber auch den Hoffnungen und Wünschen der Eltern, die durch alle Nöte des Zweiten Weltkrieges hindurchgegangen waren und wollten, dass es ihren Kindern gesellschaftlich und wirtschaftlich besser gehen sollte, als es ihnen ergangen war. Diese "Massenhaftigkeit" der Studenten hatte damals schon einige Jahre vor 1968 zu einem wachsenden Unbehagen geführt, da die Strukturen und Praktiken an den Universitäten immer noch den alten Zeiten entsprachen, in denen nur eine Elite sie besuchen konnte; insbesondere herrschte eine stark autoritäre Atmosphäre. Ein weiteres Element der Unzufriedenheit bei den Studenten, das sich besonders in den USA von 1964 an äußerte, war der Vietnam-Krieg, der den Mythos der "zivilisierenden" Rolle der großen westlichen Demokratien untergrub und die studentische Jugend in Richtung der Dritt-Welt-Ideolgien Guevarismus oder Maoismus drängte. Diese Ideen wurden durch die Theorien von pseudo-revolutionären Denkern wie Herbert Marcuse genährt, der die "Integration der Arbeiterklasse" und das Auftauchen "neuer revolutionärer Kräfte" ankündigte, zu denen die „unterdrückten Minderheiten“ (Schwarze, Frauen, etc.), die Landarbeiter der dritten Welt oder eben… die Studenten gehören sollten. Viele Studenten von damals sahen sich als "Revolutionäre", ebenso wie für sie Leute wie Che Guevara, Ho Chi Minh oder Mao Revolutionäre waren. Schließlich war ein Element der damaligen Lage ein beträchtliches Auseinanderklaffen zwischen der neuen Generation und derjenigen ihrer Eltern; letztere war Zielscheibe von zahlreichen Kritiken der ersteren. Insbesondere wurde den Eltern, die hart gearbeitet hatten, um aus dem Elend und dem Hunger, die der Zweite Weltkrieg hinterlassen hatten, zu entrinnen, vorgeworfen, dass sie sich nur mit dem materiellen Wohlstand befassen würden. Deshalb waren denn auch die Phantasien über die „Konsumgesellschaft“ und Parolen wie „Arbeitet nie!“ so erfolgreich. Die Jugend der 60er Jahre war das Kind einer Generation, welche die Konterrevolution mit voller Wucht hatte erleiden müssen; sie warf ihren Eltern Anpassertum und Unterwerfung unter die Anforderungen des Kapitalismus vor. Umgekehrt verstanden viele Eltern nicht und konnten die Tatsache nicht akzeptieren, dass ihre Kinder die Opfer, die sie erbracht hatten, um ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen, so gering schätzten.
11) Die heutige Welt ist sehr verschieden von derjenigen 1968, und die Lage der gegenwärtigen Studenten hat wenig zu tun mit derjenigen der „Sixties“:
Es ist nicht einfach die Besorgnis über die Verschlechterung ihres zukünftigen Status, welche die Mehrheit der heutigen Studenten beschäftigt. Als Proletarier haben sie häufig bereits arbeiten müssen, um ihre Studien bezahlen zu können, und sie haben wenig Illusionen über die glänzenden gesellschaftlichen Privilegien, die am Ende ihrer Studien auf sie warten. Sie wissen vor allem, dass ihre Diplome ihnen das "Recht“ geben wird, sich den proletarischen Bedingungen in einer ihrer drastischeren Formen zu unterwerfen: Arbeitslosigkeit und prekäre Arbeitsbedingungen, Hunderte von Bewerbungsschreiben, auf die nicht einmal geantwortet wird, lange Warteschlangen vor den Arbeitsvermittlungsstellen; und sie wissen, dass eine vielleicht etwas stabilere Stelle, die sie allenfalls nach einer langen Durststrecke mit unbezahlten Praktika und befristeten Anstellungen erhalten, mit einiger Wahrscheinlichkeit wenig oder nichts mit ihrer Ausbildung und ihren ursprünglichen Wünschen zu tun haben wird.
Aus diesem Grund kommt die Solidarität, welche die Studenten heute gegenüber den Arbeitern fühlen, aus ihrem Bewusstsein, dass sie zur gleichen Welt gehören, der Welt der Ausgebeuteten, im Kampf gegen den gleichen Feind, die Ausbeuter. Sie ist sehr weit entfernt von der im wesentlichen kleinbürgerlichen Haltung der Studenten 1968 gegenüber der Arbeiterklasse, einer Haltung, die zu einem gewissen Teil herablassend war, selbst wenn es auch eine bestimmte Faszination gegenüber diesem mythischen Wesen, dem Arbeiter im Blaumann, dem Helden der eher schlecht verdauten Lektüre der marxistischen Klassiker oder der Autoren gab, die nicht Marxisten, sondern Stalinisten oder Krypto-Stalinisten waren. Die Mode, die 1968 aufkam und darin bestand, dass die „Etablierten“, Intellektuelle in den Fabriken arbeiten gingen, um mit der „Arbeiterklasse in Berührung“ zu kommen, wird heute kein Comeback mehr erleben.
Deshalb haben Themen wie dasjenige von der "Konsumgesellschaft", selbst wenn sie noch von einigen verspäteten Anarchoiden feilgeboten werden, unter den heutigen kämpfenden Studenten kein Echo mehr. Was die Parole "Arbeitet nie!“ betrifft, so ist sie heute keinesfalls ein „radikales“ Projekt, sondern vielmehr eine schreckliche und reale Bedrohung.
12) Auch aus diesem Grund sind, scheinbar paradoxerweise, "radikale" und "revolutionäre" Themen in den Diskussionen und Sorgen der heutigen Studenten kaum anzutreffen. Während diejenigen von 1968 die Universitäten oft in dauerhafte Foren verwandelten, wo die Frage der Revolution, der Arbeiterräte usw. debattiert wurden, dreht sich die Mehrzahl der Diskussionen, die heute geführt werden, um Fragen mit viel mehr Bodenhaftung wie den CPE und seine Auswirkungen, die Jobunsicherheit, die Methoden des Kampfes (Blockaden, Vollversammlungen, Koordinationen, Demonstrationen etc.). Doch bedeutet ihre Polarisierung um den Rückzug des CPE, die scheinbar von weniger „radikalem“ Ehrgeiz als bei der 68er Generation zeugt, keineswegs, dass die gegenwärtige Bewegung weniger Tiefgang hätte als diejenige vor 38 Jahren. Ganz im Gegenteil. Die "revolutionären" Sorgen der Studenten 1968 (effektiv jener Minderheit unter ihnen, die die "Avantgarde" der Bewegung bildete), waren zweifellos aufrichtig, aber sie waren stark durch Dritt-Welt-Ideologien (Guevarismus oder Maoismus) oder durch den Antifaschismus gekennzeichnet. Sie waren, bestenfalls sozusagen, vom Anarchismus (von der Art eines Cohn-Bendit) oder vom Situationismus geprägt. Sie hatten eine kleinbürgerlich romantische Vorstellung von der Revolution, wenn sie nicht schlicht und einfach „radikale“ Anhängsel des Stalinismus waren. Aber was auch immer diese Strömungen waren, die sich mit "revolutionären" Ideen schmückten, ob bürgerlichen oder kleinbürgerlichen Wesens, keine von ihnen hatte auch nur die geringste Ahnung vom realen Prozess der Entwicklung der Bewegung der Arbeiterklasse zur Revolution, und noch weniger von der Bedeutung der Arbeitermassenstreiks als erster Ausdruck des Ausgangs aus der Phase der Konterrevolution.[viii] [45] Heute sind die "revolutionären" Sorgen in der Bewegung noch nicht in bedeutendem Maße vorhanden, aber ihr unbestreitbares Klassenwesen und der Boden, auf dem die Mobilisierungen stattfinden: die Weigerung, sich den Anforderungen und den Bedingungen der kapitalistischen Ausbeutung zu unterwerfen (Arbeitslosigkeit, prekäre Jobs, Willkür der Chefs usw.) sind Teil einer Dynamik, die notwendigerweise in gewissen Kreisen der am gegenwärtigen Kampf Beteiligten die Bewusstwerdung darüber hervorruft, dass der Kapitalismus überwunden werden muss. Und diese Entwicklung des Bewusstseins beruht keineswegs auf Hirngespinsten wie denjenigen, die 1968 vorherrschten und die es vielen Führern der Bewegung erlaubten, in den offiziellen politischen Apparat der Bourgeoisie rezykliert zu werden (die Minister Bernard Kouchner und Joschka Fischer, Senator Henri Weber, der Wortführer des Europäischen Parlaments für die Grünen Daniel Cohn-Bendit, der Pressebaron Serge Juli usw.), wenn sie nicht in die tragischen Sackgasse des Terrorismus führte („Rote Brigaden“ in Italien, die „Rote Armee Fraktion“ in Deutschland, „Action directe“ in Frankreich). Ganz im Gegenteil. Diese Bewusstseinsentwicklung wird sich auf der Grundlage eines Verständnisses über die grundlegenden Bedingungen entwickeln, die die proletarische Revolution erfordern und ermöglichen: die unüberwindbare Wirtschaftskrise des Weltkapitalismus, die historische Sackgasse des Systems, die Notwendigkeit, die proletarischen Verteidigungskämpfe gegen die zunehmenden Angriffe der Bourgeoisie als nötige Vorbereitung für den schließlichen Umsturz des Kapitalismus aufzufassen. 1968 war der schnelle Ausbruch der „revolutionären" Sorgen in großem Ausmaß ein Zeichen ihrer Oberflächlichkeit und ihres Mangels an theoretisch-politischer Konsistenz, die ihrem grundsätzlich kleinbürgerlichen Wesen entsprach. Der Prozess, durch den der Kampf der Arbeiter radikaler wird – selbst wenn er Momente der überraschenden Beschleunigung durchlaufen kann – ist eine viel langfristigere Erscheinung, genau weil er unvergleichlich tief greifender ist. Wie Marx es sagte, „bedeutet radikal zu sein, zur Wurzel zu gehen ", und dies ist eine Haltung, die notwendigerweise Zeit braucht und auf der schöpferischen Verwertung des ganzen Erfahrungsschatzes aus den Kämpfen beruht.
Die Fähigkeit, der Falle einer blinden, von der Bourgeoisie provozierten Gewaltspirale zu entgehen
13) Die Tiefe der Studentenbewegung zeigt sich weniger in der „Radikalität“ ihrer Ziele oder in ihren Debatten, als vielmehr in den Fragen, welche durch die Forderung nach Rückzug des CPE indirekt aufgeworfen werden: Welches Ausmaß an Verelendung und Arbeitslosigkeit hält der Kapitalismus in seiner historischen und unüberwindbaren Krise für die jüngeren Generationen in Zukunft bereit? Der Tiefgang der Bewegung zeigt sich aber noch stärker in den Methoden und der Organisation des Kampfes, wie schon unter Punkt 2 und 3 erläutert: Die lebhaften Vollversammlungen, offen und diszipliniert zugleich, sind Ausdruck des Bemühens um Reflexion und kollektive Organisation zur Lenkung der Bewegung. Weiter wurden Kommissionen, Streikkomitees und den Vollversammlungen gegenüber verantwortliche Delegationen ernannt. Zentral ist auch das Bemühen, den Kampf auf alle Bereiche der Arbeiterklasse auszudehnen. Karl Marx schrieb in seiner Schrift Der Bürgerkrieg in Frankreich, dass der proletarische Charakter der Pariser Kommune sich nicht so sehr in den durch sie angenommenen wirtschaftlichen Maßnahmen zeigte (etwa die Abschaffung der Nachtarbeit für Kinder und ein Mietzinsmoratorium), sondern vielmehr in ihren Mitteln und der Organisationsform. Diese Analyse von Marx trifft auch auf die aktuelle Situation in Frankreich zu. Noch wichtiger als die von der Arbeiterklasse in bestimmten Momenten aufgestellten, zufälligen Ziele – die in darauf folgenden Kampfphasen überholt werden – ist die Fähigkeit, diese Kämpfe in die eigenen Hände zu nehmen und die Methode, mit der sich diese Aneignung vollzieht. Diese Mittel und Methoden des Kampfes sind die besten Garanten der Klassendynamik und der Fähigkeit, als Klasse auch in Zukunft voranzuschreiten. Darin liegt auch ein Hauptpunkt in Rosa Luxemburgs Schrift Massenstreik, Partei und Gewerkschaften, in der die Lehren aus der russischen Revolution von 1905 gezogen werden. Einmal abgesehen davon, dass in politischer Hinsicht weit weniger auf dem Spiel steht als 1905, sind die Mittel der gegenwärtigen Bewegung im Keime als solche des Massenstreiks erkennbar, wie es sich schon in Polen im Herbst 1980 zeigte.
14) Die Tiefe der Studentenbewegung zeigt sich auch in ihrer Fähigkeit, den Fallen der Bourgeoisie, u.a. durch Manipulation der „Vandalen“, zu entgehen. Zu diesen Fallen, welche die Studenten in gewalttätigen Situationen aufreiben sollten, gehören die polizeiliche Besetzung der Sorbonne, Die Einkesselung am Endpunkt der Demonstration vom 16. März, die polizeilichen Übergriffe vom 18. März, die Gewalt der „Vandalen“ gegen die Demonstranten vom 23. März. Wenn auch eine kleine Minderheit der Studentenschaft – vor allem jene, die von anarchistischen Ideologien beeinflusst sind -, sich auf die Konfrontationen mit der Polizei eingelassen haben, so widersetzte sich dennoch die große Mehrheit einer Zersplitterung der Bewegung durch ständige Konfrontation mit den Repressionskräften. In dieser Hinsicht ist die aktuelle Studentenbewegung viel reifer als jene von 1968. Damals war die Gewalt in Form von Konfrontationen mit den CRS und Barrikaden ein wichtiger Bestandteil der Bewegung, die zwischen dem 3. und 10. Mai und infolge der nächtlichen Repression vom 10. auf den 11. Mai sowie einiger Winkelzüge der Regierung die Türen für den immensen Massenstreik der Arbeiterklasse öffnete. Im weiteren Verlauf der Bewegung wurden die Barrikaden und die Gewalttaten dann aber zu einem Element der Vereinnahmung des Kampfes von Seiten der verschiedenen Kräfte der Bourgeoisie, d.h. der Regierung und der Gewerkschaften. Damit untergrub die Bourgeoisie die zuvor erreichte Sympathie der Studenten in der gesamten Bevölkerung und vor allem innerhalb der Arbeiterklasse. Für die Parteien der Linken und die Gewerkschaften wurde es damit ein Leichtes, diejenigen, die von der Notwendigkeit der Revolution sprachen, und jene, die Autos in Brand setzten und ständigen „Kontakt“ mit den CRS suchten, in einen Topf zu werfen. Dies umso mehr, als es oft tatsächlich dieselben waren. Für jene Studenten, die sich als „Revolutionäre“ sahen, bedeutete Mai 1968 schon die Revolution an sich. Die Tag für Tag errichteten Barrikaden wurden gleichsam als Erbe derjenigen aus den Jahren 1848 und der Pariser Kommune verstanden. Doch täuschen die auch in der aktuellen Bewegung gegenwärtigen Fragen nach allgemeinen Perspektiven des Kampfes und nach der Notwendigkeit der Revolution die Studenten nicht darüber hinweg, dass die Konfrontationen mit den Polizeikräften nicht an sich der Motor der Bewegung sind. Auch wenn solche weitgreifenden Fragen und damit auch jene der Gewalt des Proletariats als Klasse in seinem Kampf zum Umsturz des Kapitalismus noch verfrüht sind, so sah sich die aktuelle Bewegung dennoch implizit mit diesen Fragen konfrontiert. Und sie konnte im Sinne des Kampfes und der Natur des Proletariats reagieren. Seit jeher war das Proletariat der extremen Gewalt von Seiten der Bourgeoisie ausgesetzt, und im Falle einer versuchten Interessensverteidigung auch der Repression, sowohl im imperialistischen Krieg als auch durch die alltägliche Gewalt der Ausbeutung. Im Gegensatz zu den ausbeutenden Klassen ist das Proletariat keine gewalttätige Klasse von sich aus. Wenn auch das Proletariat Gewalt anwenden muss, und unter Umständen sehr entschlossen, so wird es ich nicht mit ihr identifizieren. Die notwendige Gewalt zum Umsturz des Kapitalismus muss in den Händen des Proletariats eine bewusste und organisierte Gewalt sein. Ihr muss ein Prozess des Bewusstseins und der Organisation anhand verschiedener Kämpfe gegen die Ausbeutung vorangehen. Die gegenwärtige Mobilisierung der Studenten ist - gerade wegen der Organisationsfähigkeit und der Auseinandersetzung mit diesen aufkommenden Fragen, inklusive derjenigen der Gewalt - der Revolution und also dem gewaltsamen Umsturz der bürgerlichen Ordnung viel näher als die Barrikaden vom Mai 1968 es sein konnten.
15) Die Gewaltfrage ist auch ein entscheidender Faktor zur Differenzierung zwischen den Unruhen der Banlieues vom Herbst 2005 und der Studentenbewegung vom Frühling 2006. Natürlich gibt es bei beiden Bewegungen eine gemeinsame Ursache: die unüberwindbare Krise des kapitalistischen Produktionssystems, und damit eine Zukunft in Arbeitslosigkeit und Verelendung, welche die jüngere Generation der Arbeiterklasse erwartet. Die Unruhen der Banlieues sind aber grundsätzlich ein Ausdruck der Hoffnungslosigkeit in der aktuellen Situation und können daher nicht im Geringsten als Form des Klassenkampfes verstanden werden. Vor allem fehlte es ihnen an den wichtigsten Komponenten einer proletarischen Bewegung, nämlich der Solidarität, der Organisierung, der kollektiven und bewussten Führung des Kampfes. Kein bisschen Solidarität zeigten diese Jugendlichen gegenüber den Besitzern der von ihnen in Brand gesetzten Wagen, obwohl ebendiese Besitzer Proletarier aus der Nachbarschaft sind und im selben Boot sitzen; auch sie sind Opfer der Arbeitslosigkeit und der zunehmenden Armut. Auch von dem weiteren wichtigen Faktor des Bewusstseins war nur wenig zu spüren unter den oft sehr jungen Aufrührern, die mit blinder Gewalt zerstörten, oft in Form eines Spiels. Was Organisierung und kollektive Aktionen anbetrifft, so fanden sie oft in Form von Banden statt, geführt von einem „Anführer“ (der seine Autorität oft der hohen Gewaltbereitschaft verdankt). Diese Banden traten oft im Wettstreit gegeneinander an, die größtmögliche Zahl von Autos in Brand zu setzen. Der Ablauf dieser Unruhen vom Oktober und November 2005 war nicht nur ein gefundenes Fressen für polizeiliche Manipulationen, sondern zeigt uns auch auf, wie sehr die Folgen der Zersetzung der kapitalistischen Gesellschaft dem Kampf und dem Bewusstsein des Proletariats eine Fessel sein können.
Die Überzeugungsarbeit gegenüber den Jugendlichen der Banlieues
16) Im Laufe der aktuellen Bewegung waren die Demonstrationen eine gute Gelegenheit für die Banden, ins Stadtzentrum zu kommen und sich ihrem Lieblingssport zu widmen: sich mit der Polizei prügeln und Schaufenster einschlagen. Solche Aktionen waren für die ausländischen Medien ein gefundenes Fressen – schon Ende 2005 zeigten ausländische Zeitungen und Fernsehstationen zuhauf solche Schreckensbilder. Diese Gewaltszenen dienten als passendes Mittel zur Verstärkung des Blackouts über die tatsächlichen Ereignisse in Frankreich. Lange bekamen die Proletarier außerhalb Frankreichs nur solche Bilder zu Gesicht. Die Arbeiterklasse der anderen Länder sollte von dem in Frankreich voranschreitenden Bewusstseinsprozess abgeschnitten sein. Die Gewalttaten der Banden wurden aber nicht nur gegen das Proletariat der anderen Länder ausgenützt. Auch in Frankreich selbst wurden sie in einer ersten Phase der Bewegung benutzt, um den Kampf der Studenten als eine Art „Remake“ der Gewalttaten des vorangegangenen Herbstes zu inszenieren. Aber der Schuss ging daneben: Niemand glaubte an eine solche Fabel, weshalb auch Innenminister Sarkozy sich zu einem schnellen Taktikwandel entschloss und eine deutliche Trennlinie zwischen den Studenten und den „Ganoven“ zog. Fortan wurden die Gewalttaten hochgespielt, um eine möglichst große Zahl von Arbeitern, Studenten und Gymnasiasten zu zerstreuen und um sie von der Demonstrationsteilnahme - vor allem am 18. März - abzubringen. Die starke Teilnahme an ebendieser Demonstration vom 18. März hat aber gezeigt, dass jenes Manöver ein Fehlschlag gewesen ist. Am 23. März schließlich gingen die „Ganoven“ selbst mit dem Segen der Polizeikräfte auf die Demonstranten los, um sie zu überfallen oder grundlos zu schlagen. Viele Studenten wurden durch diese Gewalttaten demoralisiert: „Wenn die CRS uns verprügelt, so gibt es sofort Leute, die sich mit uns solidarisieren, sind es aber die Jugendlichen aus den Banlieues, für die wir ja auch kämpfen - das demoralisiert.“ Auch hier bezeugten die Studenten aber ihre Reife und Bewusstsein. Vielerorts entschieden sie, Delegationen zu bestimmen, welche in die besonders vernachlässigten Quartiere gehen sollten, um mit den dortigen Jugendlichen über den Kampf der Studenten und Gymnasiasten zu diskutieren, auch im Sinne der verzweifelten, der Arbeitslosigkeit und Ausgrenzung ausgesetzten Jungendlichen. Ganz anders war das Vorgehen der Gewerkschaften, welche gewaltsame Aktionen provozierten: Ihre Ordnungsdienste haben an der Demonstration vom 28. März die Jugendlichen aus den Banlieues mit Knüppeln den Polizeikräften in die Hände getrieben. Die Mehrheit der Studenten hingegen hat mehr durch Intuition als aufgrund von angeeignetem Wissen eine der wichtigsten Lehren aus der Erfahrung der früheren Arbeiterbewegung praktisch umgesetzt: keine Gewalt innerhalb der Arbeiterklasse. Sofern es nicht um bloße Anhängsel des bürgerlichen Staates geht (wie etwa die Kommandos der Streikbrecher), sind Überzeugungsarbeit und Appell an das Klassenbewusstsein das bedeutsame Aktionsmittel, um auch jene Teile des Proletariats für die Sache der Arbeiterklasse zu gewinnen, die sich leicht in Aktionen verstricken lassen, die unseren Interessen zuwider laufen.
Eine wertvolle Erfahrung zur Politisierung der jüngeren Generationen
17) Einer der Gründe für die Reife der aktuellen Bewegung – vor allem hinsichtlich der Gewaltfrage – liegt in der hohen Beteiligung von Studentinnen und Gymnasiastinnen. In diesem Alter sind die Mädchen bekanntlich im Allgemeinen reifer als ihre männlichen Kollegen. Ebenso lassen sich die Mädchen im Allgemeinen vergleichsweise weniger schnell auf Gewalttaten ein. 1968 nahmen die Studentinnen sehr wohl an der Bewegung teil. Als aber die Barrikade zum Symbol des Kampfes geworden war, kam den Studentinnen häufig die Rolle zu, den vermummten „Helden“ an der Front der Pflastersteinschlachten Mut zu machen, die Verwundeten zu behandeln, und für die Verpflegung und Stärkung in der Pause zwischen zwei Konfrontationen mit den CRS zu sorgen. In der aktuellen Bewegung ist dies ganz anders: Bei den „Blockaden“ der Universitätseingänge sind die Studentinnen zahlreich und ihre Einstellung prägt entscheidend den Sinn, der diesen Streikposten zugesprochen wird. Gegenüber jenen, die den Unterricht besuchen wollen, wird nicht der „Schlagstock“ eingesetzt. Wichtig sind Erklärungen, Argumente und Überzeugung. Auch wenn die Studentinnen sich oft weniger durch Lautstärke bemerkbar machen und in politischen Organisationen oft weniger engagiert sind als ihre männlichen Kollegen, so sind sie in den Vollversammlungen und verschiedenen Kommissionen nichtsdestoweniger ein wichtiges Element für die Organisation, Disziplin, Effizienz und kollektive Reflexion. Die Geschichte des Kampfes des Proletariats hat gezeigt, dass die Beteiligung von Arbeiterinnen ein wichtiges Indiz für die Tiefe der Bewegung ist. Da die Proletarierinnen im Allgemeinen einer noch stärkeren Unterdrückung ausgesetzt sind als die Proletarier, sind sie in „normalen Zeiten“ oftmals weniger stark beteiligt an sozialen Konflikten. Erst in Momenten, in denen diese Konflikte an Tiefe gewinnen, steigen auch die am meisten Unterdrückten Teile des Proletariats, also auch die Arbeiterinnen, in den Kampf ein und nehmen an der Reflexion der Arbeiterklasse teil. Die sehr starke Beteiligung von Studentinnen und Gymnasiastinnen in den aktuellen Kämpfen und ihre wichtige Rolle sind also ein zusätzliches Indiz für die Tiefe der Bewegung.
18) Die aktuelle Studentenbewegung in Frankreich ist, wie bereits aufgezeigt, wichtiger Ausdruck der seit drei Jahren neu entstandenen Vitalität des Weltproletariats mit einer gewachsenen Fähigkeit zur Bewusstseinsentwicklung. Die Bourgeoisie wird natürlich alles in ihrer Macht stehende tun, um die Tragweite dieser Bewegung für die Zukunft möglichst zu begrenzen. Sollte sie die notwendigen Mittel haben, wird sie, um die französische Arbeiterklasse im Gefühl der Machtlosigkeit zu behaften, den zentralen Forderungen der Bewegung nicht nachkommen. Dies ist ihr schon im Jahr 2003 gelungen. Jedenfalls wird die Bourgeoisie alle ihre Mittel einsetzen, um zu verhindern, dass die Arbeiterklasse die so wichtigen Lehren dieser Bewegung ziehen kann. Sie wird vor allem versuchen, den Kampf durch Demoralisierung zu ersticken, oder ihn von den Gewerkschaften und den Parteien der Linken aufzufangen. Der Bourgeoisie wird es aber auch mit den besten Manövern nicht gelingen, die gesamte Erfahrung, die während Wochen von Zehntausenden von zukünftigen Arbeitern angehäuft wurde, ihre Politisierung und ihren Bewusstseinsprozess zu unterdrücken. Dies ist ein wahrer Schatz für die zukünftigen Kämpfe des Proletariats, ein Element von größter Bedeutung für die Fähigkeit, den Weg in Richtung kommunistischer Revolution zu beschreiten. Die Revolutionäre haben die Aufgabe, die Essenz aus den gegenwärtigen Erfahrungen zu ziehen und sie in den kommenden Kämpfen fruchtbar anzuwenden.
3. April 2006
[i] [45] Mit dem Ziel, den Kampf größtmöglich zu stärken und zu vereinen, haben die Studenten die Notwendigkeit eingesehen, eine « nationale Koordination » von Delegierten der verschiedenen Vollversammlungen zu schaffen. Diese Methode ist als solche absolut richtig. Doch in dem Maße, wie ein Großteil der Delegierten Mitglieder bürgerlicher Organisationen sind (so der trotzkistischen „Ligue communiste révolutionnaire“), die es auch im studentischen Milieu gibt, sind die wöchentlichen Sitzungen der Koordination oft zu einer Bühne politischer Winkelzüge dieser Organisationen geworden, die insbesondere (bisher erfolglos) versucht haben, ein „Koordinationsbüro“ auf die Beine zu stellen, das natürlich ein Instrument ihrer Politik werden sollte. Wie wir dies in unserer Presse schon oft unterstrichen haben (namentlich während der Streiks von 1987 in Italien und demjenigen der Krankenhäuser 1988 in Frankreich) kann die Zentralisierung, die in einem ausgedehnteren Kampf notwendig ist, nur dann wirklich einen Beitrag zu Entwicklung des Kampfes leisten, wenn sie auf einer starken und direkten Kontrolle durch die Vollversammlungen und einer entsprechenden Wachsamkeit derselben beruht. Man muss auch festhalten, dass eine Organisation wie die LCR versucht hat, der Studentenbewegung einen „Sprecher“ gegenüber den Medien aufzudrängen. Die Tatsache, dass die LCR nicht als Informations-Leader in Erscheinung treten konnte, ist nicht als Schwäche der Bewegung zu interpretieren, sondern vielmehr ihrer Tiefe zuzuschreiben.
[ii] [45] Man konnte am Fernsehen sogar einen « Spezialisten » der Psychologie sagen hören, dass Villepin zur Kategorie der « narzisstischen Starrköpfe » gehöre.
[iii] [45] Der Wahrheit zuliebe muss man aber festhalten, dass die hier zur Diskussion stehende Gemeinde Neuilly-sur-Seine ist, eines der Symbole einer Stadt mit bürgerlicher Bevölkerung. Es sind bestimmt nicht seine Wähler, die Sarkozy gelehrt haben « mit dem Volk zu sprechen ».
[iv] [45] Dies war ein geschichtsträchtiges Datum, denn 10 Jahre vorher, am 13. Mai 1958 fand der Staatsstreich statt, der damit endete, dass De Gaulle wieder an die Macht gelangte. Eine der Hauptparolen der Demonstration war "Dix ans, ça suffit !" (« Zehn Jahre sind genug! »)
[v] [45] Im Januar 1968 schrieb unsere Publikation Internacionalismo in Venezuela (damals die einzige Publikation unserer Strömung) über die Eröffnung einer neuen Phase von weltweiten Klassenkonfrontationen folgendes: "Wir sind keine Propheten und wir geben nicht vor zu erraten, wann und wie sich die zukünftigen Ereignisse abspielen werden. Aber wir sind uns hinsichtlich des gegenwärtigen Prozesses des Kapitalismus effektiv sicher und bewusst, dass er sich weder mit Reformen, noch mit Geldentwertungen noch irgendwelchen anderen kapitalistischen Wirtschaftsmaßnahmen aufhalten lässt und dass er direkt in die Krise führt. Und wir sind auch sicher, dass der entgegen gesetzte Prozess der Entwicklung der Kampfbereitschaft der Klasse, den wir gegenwärtig allgemein erleben, die Arbeiterklasse in einen blutigen und direkten Kampf um die Zerstörung des bürgerlichen Staates führen wird.“
[vi] [45] An diesem Tag überrannten die Arbeiter von Cordoba (der zweitgrößten Stadt Argentiniens) nach einer Reihe von Mobilisierungen in den Arbeiterstädten gegen gewaltige wirtschaftliche Angriffe und die brutale Repression der Militärjunta die Polizei und die Armee (die immerhin mit Panzern bewaffnet war) und übernahmen die Kontrolle in der Stadt. Die Regierung konnte die „Ordnung“ erst am folgenden Tag mit einem massiven Truppenaufgebot der Armee „wiederherstellen“.
[vii] [45] Dies ist eine völlig andere Haltung als diejenige von vielen Studenten 1968, welche die Älteren als „doofe Alte“ betrachteten (während diese die Jungen oft als „kleine Doofe“ behandelten).
[viii] [45] Es soll nicht verschwiegen werden, dass von dieser Blindheit gegenüber der wahren Bedeutung des Mai 68 nicht nur die Strömungen stalinistischer oder trotzkistischer Herkunft geschlagen waren, für die es natürlich keine Konterrevolution, sondern vielmehr einen Fortschritt der „Revolution“ gab mit der Herstellung einer ganzen Reihe „sozialistischer“ Staaten bzw. „degenerierter Arbeiterstaaten“ nach dem Zweiten Welt und mit den „nationalen Befreiungskämpfen“, die in der gleichen Phase begonnen hatten und sich über mehrere Jahrzehnte hinzogen. Vielmehr hat ein Großteil der Strömungen und Leute, die sich an der Kommunistischen Linken und insbesondere an der Italienischen Linken orientierten, nicht viel von dem verstanden, was 1969 abging, denn selbst heute noch meinen sowohl die Bordigisten als auch Battaglia comunista, dass wir die Konterrevolution noch nicht hinter uns hätten.
Juni 2006
- 832 reads
Streik der Metallarbeiter in Vigo, Spanien: die proletarische Kampfmethode
- 3031 reads
Wir begrüßen den Kampf, den die Metallarbeiter von Vigo in Nordwest-Spanien seit dem 3. Mai führen, und möchten unsere Solidarität mit diesem Kampf ausdrücken. Die offiziellen Medien, die Internet-Seiten der Gewerkschaften und der so genannten „radikalen“ Gruppen bewahren fast völliges Schweigen über diesen Streik. Es ist wichtig, dass wir diese Erfahrung diskutieren, mit kritischem Geist die Lehren daraus ziehen und sie in der Praxis umsetzen, da alle Arbeiter von den gleichen Probleme betroffen sind: prekäre Arbeit, in zunehmendem Maße unerträgliche Arbeitsbedingungen, horrende Preise, Entlassungen, die Ankündigung von mehr Pensionskürzungen...
Geeinter Kampf gegen die „Arbeitsreform“
Zur gleichen Zeit, als das infernale Trio aus Regierung, Chefs und Gewerkschaften unter dem Vorwand des Kampfes gegen prekäre Arbeit eine neue „Arbeitsreform“ unterzeichnete - eine „Reform“, die es sogar günstiger macht , Leute zu entlassen, und die vorsieht, die Dauer von zeitweiligen Verträgen auf zwei Jahre festzulegen -, ist in Vigo ein massiver Kampf ausgebrochen. Sein zentrales Anliegen ist genau der Kampf gegen prekäre Arbeitsbedingungen, denn ca. 70% der Beschäftigten des Sektors der Metallindustrie von kleineren und mittleren Betriebe sind prekär beschäftigt.
Der wirkliche Kampf gegen die neue „Arbeitsreform“ kann nicht durch die zahlreichen Mobilisierungen oder Protestaktionen „radikaler“ Gewerkschaften geführt werden. Die einzige wirkungsvolle Weg des Kampfes gegen die Präkarisierung ist der direkte Kampf der Arbeiter: Streiks, die von den Arbeitern gemeinsam beschlossen werden. Streiks, die sich von einem Unternehmen zum anderen ausbreiten und daher die Kräfte vereinigen können, die für die Erhebung gegen die ständigen Angriffe des Kapitals notwendig sind.
Die Stärke der Versammlungen
Der Streik der Metallarbeiter in Vigo ist massiv gewesen und hat die öffentliche Straßenversammlung als seine Form der Organisation angenommen. Eine von den Arbeitern beschlossene Versammlung sollte jenen geöffnet sein, die ihre Meinung ausdrücken wollen, ihre Unterstützung bekunden oder ihre Probleme oder Beschwerden vorbringen wollen. Mehr als 10.000 Arbeiter nahmen an den Treffen jeden Tag teil, um den Kampf zu organisieren, um zu entscheiden, welche Aktionen man aufnehmen sollte, um herauszufinden, zu welchen Betrieben man gehen soll, um die Arbeiter zur Solidarität aufzufordern und auch um zu hören, was über den Streik im Radio und in den Kommentaren der Leute gesagt wurde, und so weiter. Es ist bezeichnend, dass die Arbeiter in Vigo die gleichen Methoden wie die jüngste Bewegung der Studenten in Frankreich entwickelt haben. Dort waren die Versammlungen auch offen für Arbeiter, für Rentner und für die Eltern der Studenten. Und auch dort waren die Versammlungen die Lungen der Bewegung. Es ist auch bezeichnend, dass jetzt 2006 die Arbeiter von Vigo die Praxis des großen Streiks von 1972 wieder aufgenommen haben, als allgemeine Versammlungen der Stadt täglich stattfanden. Die Arbeiterklasse ist eine internationale und historische Klasse, und das ist ihre Stärke.
Die Stärke der Solidarität
Von Anfang an waren die Beschäftigten in Vigo bestrebt, die Solidarität anderer Arbeiter zu gewinnen, vor allem der großen Metallbetriebe, die besondere Tarifverträge haben und die daher „nicht betroffen“ sind. Es wurden große Delegationen zu den Schiffswerften, zur Automobilfabrik von Citroen und anderen Großbetrieben geschickt. Ab dem 4. Mai traten auf den Schiffswerften die Beschäftigten aus Solidarität einstimmig in den Streik. Der bürgerlichen Ideologie zufolge, die kalt und egoistisch ist, sollte sich jeder nur um seine eigenen Angelegenheiten kümmern. Deshalb ist aus ihrer Sicht ein Solidaritätsstreik ein Irrsinn; aber vom Standpunkt der Arbeiterklasse aus ist die Solidarität die beste Antwort auf die heutigen und zukünftigen Angriffe. Angesichts der heutigen Situation kann jeder einzelne Teil der Arbeiter nur dann Druck ausüben und Stärke zeigen, wenn er auf den gemeinsamen Kampf der gesamten Klasse zählen kann.
Am 5. Mai umstellten ca. 15.000 Metaller das Citroen-Werk, um zu versuchen, die Beschäftigten des Werkes für die Beteiligung am Streik zu gewinnen. Aber die Belegschaft war gespalten - einige sprachen sich für die Beteiligung am Streik, andere für die Fortführung der Arbeit aus. Schlussendlich nahmen alle die Arbeit auf. Dennoch schien die Saat, die die massiven Delegationen unter den Beschäftigten der Citroen-Werke gepflanzt hatte, langsam aufzugehen, denn am 9. Mai kam es bei Citroen und in anderen Werken doch zu Arbeitsniederlegungen.
Solidarität und die Ausdehnung des Kampfes waren auch kraftvolle Eigenschaften der Studentenbewegung in Frankreich. Anfang April, als es in großen Unternehmen wie Snecma und Citroen aus Solidarität mit den Studenten zu spontanen Streiks kam, nahm die Regierung den CPE (Contrat de Première Embauche) zurück. Solidarität und die Ausdehnung des Kampfes dominierten außerdem den Generalstreik von ganz Vigo im Jahre 1971 und erlaubten es, die mörderische Hand von Francos Diktatur zu blockieren. Hier sehen wir wieder die internationale und historische Stärke der Arbeiterklasse.
Bewaffnete Unterdrückung: eine Politik der Bourgeoisie
Am 8. Mai zogen ca. 10.000 Arbeiter in einem Demonstrationszug nach der Vollversammlung auf der Straße zum Bahnhof, mit dem Ziel, Reisende über ihren Streik aufzuklären. Die Polizei griff daraufhin die Demonstranten von allen Seiten mit ungeheuerlicher Gewalttätigkeit an. Brutal erfolgten die Polizeiattacken. Die Demonstranten wurden auseinander getrieben; in kleinen Gruppen zersplittert, wurden sie weiter von den Polizeikräften gnadenlos angegriffen. Es gab zahlreiche Verletzte und 13 Verhaftungen.
Diese Repression spricht Bände und zeigt, was die so genannte "Demokratie" und ihre schönen Reden von "Verhandlungen", "Versammlungsfreiheit", "demokratischer Vertretung für alle" in Wirklichkeit bedeuten. Wenn die Arbeiter so kämpfen, wie es ihren Interessen und ihrer Situation angemessen ist, zögert das Kapital keinen Augenblick, seinen Repressionsapparat einzusetzen. Der zynische Meister des "Dialogs", der spanische Premierminister Zapatero, zeigte sein wahres Gesicht. Und er hatte zweifellos seine Lehrer! Sein sozialistischer Vorgänger Gonzales, der in den 1980ern und 90ern Ministerpräsident war, war verantwortlich für den Tod eines Arbeiters während des Kampfes in der Marine-Schiffswerft in Gijón (1984) und den eines Arbeiters während des Kampfes von Reinosa (1987). Ein anderes Beispiel ist der von Aznar häufig zitierte Rebuplikaner Azaña, der Präsident der 2. spanischen Republik in den frühen dreißiger Jahren war. Er gab während des Massakers von Casas Viejas 1933 den direkten Befehl, den Taglöhnern „in die Eingeweide zu schießen“.
Die Polizeirepression am Bahnhof von Vigo war ein Vorgeschmack auf die folgende Politik, die darin bestand, die Arbeiter in die Falle der erschöpfenden Auseinandersetzung mit den Repressionskräften zu locken und dazu zu bringen, ihre massiven Aktionen (Massendemonstrationen, Vollversammlungen usw.) durch eine Verzettelung und Zerstreuung in Schlägereien mit den Staatskräften zu ersetzen. Die Polizei wollte die Arbeiter in sinnlose Gefechte verwickeln, damit sie die Sympathie anderer Arbeiter verlieren.
Es ist dieselbe Politik, die die Regierung gegen die Studentenbewegung eingesetzt hat: "Die Tiefe der Studentenbewegung zeigt sich auch in ihrer Fähigkeit, den Fallen der Bourgeoisie, u.a. durch Manipulation der "Vandalen", zu entgehen. Zu diesen Fallen, welche die Studenten in gewalttätigen Situationen aufreiben sollten, gehören die polizeiliche Besetzung der Sorbonne, die "Einkesselung" am Endpunkt der Demonstration vom 16. März, die polizeilichen Übergriffe vom 18. März, die Gewalt der "Vandalen" gegen die Demonstranten vom 23. März. Wenn auch eine kleine Minderheit der Studentenschaft - vor allem jene, die von anarchistischen Ideologien beeinflusst sind -, sich auf die Konfrontationen mit der Polizei eingelassen haben, so widersetzte sich dennoch die große Mehrheit einer Zersplitterung der Bewegung durch ständige Konfrontation mit den Repressionskräften." (Thesen über die Studentenbewegung in Frankreich im Frühjahr 2006)
Die Arbeiter in Vigo sind massenweise auf die Straße gegangen, um ihre inhaftierten Kollegen zu befreien. Mehr als 10.000 Arbeiter versammelten sich am 9. Mai, um für ihre Freilassung zu demonstrieren, die dann auch zugestanden wurde.
Es ist aufschlussreich, dass die nationalen "Nachrichtenmedien" (El Pais, Mundo, TVE usw.) über diesen Kampf ein vollständiges Schweigen bewahrt haben und vor allem kein Wort zu den Vollversammlungen, den Massendemonstrationen, und der Solidarität gesagt haben. Und dann erfolgte in den Medien plötzlich der große Aufschrei über die gewalttätigen Zusammenstöße am 8. Mai. Die Botschaft, die wir vernehmen sollten, war klar: "Wenn man die Aufmerksamkeit erregen will, muss man gewalttätige Auseinandersetzungen verursachen". Es ist von höchstem Interesse für das Kapital, daß sich die Arbeiter in einer Serie fruchtloser Auseinandersetzungen verfangen und erschöpfen.
Verzögerungen und Manöver der Gewerkschaften
Schon vor langer Zeit haben die Gewerkschaften aufgehört, eine Waffe für das Proletariat zu sein, und sind ein Schutzschild für das Kapital geworden, wie wir es an den Beteiligungen an den „Arbeitsreformen“ von 1988, 1992, 1994, 1997 und 2006 erkennen können. Die drei Gewerkschaften (CCOO, UGT und CIG) haben sich dem Streik von Vigo angeschlossen, um nicht die Kontrolle über ihn zu verlieren und um ihn von innen auszuhöhlen und zu schwächen. So haben sie sich der Entsendung von Massendelegationen zu anderen Unternehmen widersetzt. Stattdessen riefen sie zu einem Generalstreik der Metallarbeiter für den 11. Mai auf. Jedoch haben die Arbeiter nicht gewartet, und vor allem haben sie nicht die Gewerkschaftsmethode des eintägigen Streiks akzeptiert. Sie haben echte Arbeitermethoden entwickelt: die Bildung von Massendelegationen, das Herstellen direkter Kontakte mit anderen Arbeitern, Kollektiv- und Massenaktionen.
Jedoch am 10. Mai, nach 20 Stunden Verhandlungen, erreichten die Gewerkschaften eine Abmachung, die, obwohl sie unklar ist, einen hinterhältigen Schlag gegen die Arbeiter darstellt und einige ihrer Hauptforderungen unter den Tisch fallen lässt. Ein großer Teil der Arbeiter zeigte ihre Entrüstung, und die Abstimmung wurde bis auf den Morgen des 11. Mai aufgeschoben.
Die Arbeiter müssen klare Lehren aus diesem Manöver ziehen: Wir können Verhandlungen nicht in den Händen der Gewerkschaften lassen. Verhandlungen müssen zur Gänze von der Versammlung gesteuert werden. Die Versammlung muss die verhandelnde Kommission ernennen und diese muss der Versammlung jeden Tag über ihre Tätigkeiten berichten. Dies geschah in den Kämpfen der siebziger Jahre und wir müssen uns diese Praxis, die Gewerkschaften daran zu hindern, uns die Augen zu verbinden, wiederaneignen.
Perspektiven
Wir wissen nicht, wie sich der Kampf entwickeln wird. Trotzdem hat er uns bereits mit einer lebenswichtigen Erfahrung bereichert. Das Kapital in der Krise gewährt kein Pardon. Seit mehr als 20 Jahren hat man in jedem Land schreckliche Herabsenkungen der Lebensbedingungen der Arbeiter und immer schlimmere Angriffe erlebt. Folglich müssen wir kämpfen, müssen wir die Stärke der Arbeiterklasse unterstreichen, und in Kämpfen wie in Vigo wurde uns eine grundlegende Lehre mitgegeben: die gewerkschaftlichen Methoden des Kampfes bringen uns nichts und sie erdrücken uns durch Demoralisierung und Ohnmacht. Die proletarischen Methoden des Kampfes, die wir in Vigo gesehen haben und die wir vorher in größerem und profunderem Ausmaß in der Studentenbewegung in Frankreich sahen, geben uns die Stärke und die Einheit, die wir benötigen. Wir müssen damit aufhören, Nummern in den Händen der Gewerkschaftsführer zu sein und müssen uns in eine Kraft verwandeln, die auf den Grundlagen der Einheit und der Solidarität denkt, entscheidet und kämpft.
Internationale Kommunistische Strömung 10.5.06
Zum Tod unserer Genossin Clara
- 2659 reads
Unsere Genossin Clara ist am Samstag, den 15. April 2006, im Krankenhaus Tenon in Paris im Alter von 88 Jahren gestorben. Clara wurde am 8. Oktober 1917 in Paris geboren. Ihre Mutter, Rebecca, war russischer Herkunft. Sie war nach Frankreich gegangen, weil sie in ihrer Geburtsstadt, Simferopol auf der Krim, als Jüdin nicht Medizin studieren durfte. Schließlich wurde sie in Paris Krankenschwester. Bevor sie nach Frankreich kam, hatte sie in der Arbeiterbewegung mitgewirkt; so hatte sie sich an der Gründung der sozialdemokratischen Partei in Simferopol beteiligt. Der Vater Claras, Paul Geoffroy, war Facharbeiter, spezialisiert auf die Herstellung von Schmuckkoffern. Vor dem I. Weltkrieg war er Mitglied der CGT in der anarcho-syndikalistischen Bewegung; doch nach der russischen Revolution von 1917 näherte er sich der Kommunistischen Partei an.
So wurde Clara seit früher Kindheit in der Tradition der Arbeiterbewegung großgezogen. Zunächst trat sie im Alter von 15 Jahren der Kommunistischen Jugend (JC) bei. 1934 reiste sie mit ihrem Vater nach Moskau, um eine Schwester ihrer Mutter zu besuchen; die Mutter war gestorben, als Clara erst 12 Jahre alt war. Was sie in Russland sah, wie u.a. die Tatsache, dass die neuen Wohnungen für eine Minderheit von Privilegierten und nicht für die Arbeiter gebaut wurden, veranlasste sie dazu, sich viele Fragen über das "Vaterland des Sozialismus" zu stellen. Nach ihrer Rückkehr brach sie mit der Kommunistischen Jugend. Damals schon hatte sie zahlreiche Diskussionen mit unserem Genossen Marc Chirik geführt (den sie im Alter von 9 Jahren kennengelernt hatte, denn die Mutter Claras war die Freundin der Schwester der ersten Partnerin von Marc), obwohl ihr Vater gegen diese Diskussionen war, weil er der KP treu geblieben war und nicht mochte, dass seine Tochter Kontakt mit "Trotzkisten" hatte.
Marc war damals Mitglied der Italienischen Fraktion, und obwohl Clara ihr nicht angehörte, sympathisierte sie mit dieser Gruppe. Während des Krieges wurde Marc in die französische Armee eingezogen (obwohl er kein Franzose war und jahrelang nur im Besitz eines einzigen Identitätnachweises war - nämlich eines Ausweisungsbescheides, dessen Vollzugstermin alle zwei Wochen aufgeschoben wurde). Als die französische Armee ihr Debakel erfuhr, war er in Angouleme stationiert. Mit einem Genossen der Italienischen Fraktion in Belgien (der als Jude vor dem Vormarsch der Reichswehr geflüchtet war) war Clara aus Paris mit dem Fahrrad aufgebrochen, um Marc in Angouleme zu treffen. Bei ihrer Ankunft erfuhr sie, dass Marc (zusammen mit anderen Soldaten) von der Reichswehr verhaftet worden war. Diese hatte jedoch noch nicht erfahren, dass Marc Jude war. Clara konnte Marc (und einem anderem jüdischen Genossen) zur Flucht aus der Kaserne, in der er eingesperrt war, verhelfen, nachdem sie ihm Zivilkleidung besorgt hatte. Marc und Clara schafften es in die sog. "freie Zone", wo sie im September 1940 mit dem Fahrrad ankamen. In Marseille organisierte Marc die Italienische Fraktion neu, die am Anfang des Krieges auseinandergefallen war.
Ohne formal Mitglied derselben zu sein, beteiligte sich Clara an der Arbeit der Fraktion und an deren Diskussionen, die schließlich die Neugründung der Italienischen Fraktion ermöglichten: Trotz der Gefahren, die von den deutschen Besatzungstruppen ausgingen, schafften sie politische Dokumente, die für die anderen Genossen der Italienischen Fraktion bestimmt waren, in andere Städte. Damals wirkte Clara auch bei der OSE mit, einer Hilfsorganisation für Kinder, die sich um jüdische Kinder kümmerte und sie vor der Gestapo versteckte.
Nach der "Befreiung" konnten Marc und Clara nur knapp dem Tod entrinnen. Denn die stalinistischen "Résistance"-Mitglieder verhafteten sie in Marseille und beschuldigten sie, Verräter, Komplizen der "boches" (Schimpfwort für die Deutschen) zu sein, weil sie bei ihnen bei einer Hausdurchsuchung Texte auf Deutsch gefunden hatten. In Wahrheit handelte es sich um deutsche Hefte eines Sprachkurses, den Marc und Clara von Voline (einem russischen Anarchisten, der sich an der Revolution 1917 beteiligt hatte) erhielten. Trotz der schrecklichen Armut, in der Voline lebte, weigerte er sich, materielle Hilfe anzunehmen. Erst als Marc und Clara ihn um diesen Deutschkurs baten, akzeptierte Voline wenigstens das Essen, das sie ihm dafür brachten. Während dieser Hausdurchsuchung fanden die Stalinisten auch internationalistische Flugblätter, die auf Französisch und Deutsch verfasst worden waren und sich an die Soldaten auf beiden Seiten der Front richteten.
Dank eines gaullistischen Offiziers, der das Gefängnis leitete und dessen Frau Clara während der gemeinsamen Arbeit in der OSE kennengelernt hatte, konnten Marc und Clara gerade noch den Mördern der KPF entkommen. Zunächst verhinderte dieser Offizier, dass die Stalinisten Marc und Clara ermordeten (die Résistance-Leute der KPF äußerten gegenüber Marc: "Stalin hat dich nicht erwischt, aber wir kriegen dich"). Da der gaullistische Offizier überrascht war, dass ein Jude angeblich "Kollaborateur" der Nazis sein soll, wollte er die politische Haltung von Marc und Clara "begreifen", die Propaganda zugunsten einer Verbrüderung der französischen und deutschen Soldaten betrieben hatten. Dieser Offizier merkte, dass ihre Vorgehensweise nichts mit irgendeinem "Verrat" zugunsten des Nazi-Regimes zu tun hatte. Deshalb holte er sie mit seinem eigenen Auto heimlich aus dem Gefängnis ab und riet ihnen, Marseille so schnell wie möglich zu verlassen, bevor die Stalinisten sie erwischten. Marc und Clara gingen damals nach Paris, wo sie andere Genossen (und Sympathisanten) der Italienischen und Französischen Fraktion der Kommunistischen Linken vorfanden. Clara unterstützte die Arbeit der Kommunistischen Linken in Frankreich (der GCF - die FFGC hatte diesen Namen angenommen) bis 1952. Aufgrund der Gefahr eines neuen Weltkriegs fasste die GCF 1952 den Beschluss, dass einige ihrer Mitglieder Europa verlassen sollten, damit die Organisation am Leben blieb, falls dieser Kontinent durch einen Krieg verwüstet werden sollte. Marc reiste im Juni 1952 nach Venezuela. Clara schloss sich ihm im Januar 1953 an, nachdem er endlich eine ständige Arbeit in Venezuela gefunden hatte.
In Venezuela arbeitete Clara als Lehrerin. Mit einem Kollegen gründete sie 1955 in Caracas die Französische Schule, das Jean-Jacques Rousseau-Kolleg, in das anfangs nur zwölf Schüler gingen, hauptsächlich Mädchen, durften doch diese vor der Gründung des Kollegs die einzige französische Schule im Land nicht besuchen, da diese von Mönchen geleitet wurde. Bald wurde die Schule von mehr als 100 Schülern besucht. Clara war zu ihrer Direktorin geworden (und Marc zum Hausmeister, Gärtner und Schulbusfahrer). Einige ihrer Schüler, die von ihrer Konsequenz sowie ihren großen pädagogischen und menschlichen Fähigkeiten beeindruckt waren, sind mit Clara bis zu ihrem Tod in Kontakt geblieben. Einer ihrer ehemaligen Schüler, der sich in den USA niedergelassen hat, hat sie noch 2004 besucht.
Nach der Abreise Marcs und anderer Genossen aus Europa löste sich die GCF auf. Erst ab 1964 konnte Marc einen neuen kleinen Kern von sehr jungen Leuten bilden, die damals die Zeitschrift Internacionalismo in Venezuela herausgebrachten. Während dieser Zeit war Clara nicht direkt an den politischen Aktivitäten von Internacionalismo beteiligt, aber ihre Schule stellte die materiellen Grundlagen und war der Treffpunkt für die politischen Aktivitäten der Gruppe.
Im Mai 1968 ist Marc nach Frankreich gekommen, um sich an den sozialen Bewegungen zu beteiligen und wieder den Kontakt mit seinen ehemaligen Genossen der Kommunistischen Linken aufzunehmen. Während seines Aufenthaltes in Frankreich führte die Polizei in Venezuela eine Hausdurchsuchung im Jean-Jacques Rousseau-Kolleg durch. Dabei stieß sie auf das dort vorhandene politische Material. Das Kolleg wurde geschlossen und gar abgerissen. Clara war gezwungen, Venezuela überstürzt zu verlassen, um sich Marc anzuschließen. So ließen sich Marc und Clara erneut in Paris nieder. Ab 1968 wirkte Marc an der Arbeit der Gruppe "Révolution Internationale" mit, die sich in Toulouse gebildet hatte. Ab 1971 nahm Clara voll an den Aktivitäten von RI teil, die später Sektion der IKS in Frankreich wurde. Seitdem blieb sie eine treue Genossin unserer Organisation und beteiligte sich an allen Aktivitäten der IKS. Nach dem Tod von Marc im Dezember 1990 setzte sie ihre militanten Aktivitäten in unserer Organisation fort, der sie immer sehr verbunden blieb. Auch wenn sie sehr betroffen war durch den Austritt bestimmter alter Genossen, die bei der Gründung von RI oder gar von Internacionalismo mitgewirkt hatten, stellte die Desertierung dieser ehemaligen Mitglieder nie ihr Engagement für die IKS in Frage.
Bis zu ihrem letzten Atemzug wollte die Genossin trotz ihrer gesundheitlichen Probleme und ihres hohen Alters an den Aktivitäten der Organisation teilnehmen. Insbesondere zahlte sie mit einer großen Pünktlichkeit jeden Monat ihre Beiträge und verfolgte auch intensiv die Diskussionen, auch wenn sie nicht mehr aktiv an den Treffen teilnehmen konnte. Obwohl ihre Sehfähigkeit stark eingeschränkt war, las Clara noch so viel wie möglich Zeitung und interne Texte der IKS (wir druckten zu diesem Zweck Texte mit extra großem Schrifttyp). Jedes Mal, wenn ein Genosse sie besuchte, fragte sie nach dem Stand der Diskussionen und Aktivitäten der Organisation. Clara war eine Genossin, deren Sinn für Brüderlichkeit und Solidarität alle Genossen der IKS geprägt hat. Alle Genossen wurden stets sehr herzlich von ihr empfangen. Sie hielt auch enge Beziehungen mit alten Mitgliedern der Kommunistischen Linken aufrecht; und bei Krankheiten bewies sie stets eine große Solidarität mit den Betroffenen (wie im Falle Serge Bricianers, eines ehemaligen Mitglieds der GCF, oder im Falle Jean Malaquais, eines Sympathisanten der GCF, den sie kurz vor seinem Tod 1998 in Genf besuchte). Nach dem Tode Marcs gab sie den neuen Generationen von Militanten diese Tradition der Brüderlichkeit und Solidarität weiter, die ein Markenzeichen der früheren Arbeiterbewegung gewesen war. Mit großer Freude nahm sie wahr, wie diese Solidarität der Klasse, die Trägerin des Kommunismus ist, erneut eindrucksvoll in der Bewegung der Studenten in Frankreich wiederauflebte. Diese Bewegung hat Clara vor ihrem Tod mit Enthusiasmus aufgenommen.
Auf ihr körperliche Schwächung und die sehr belastenden gesundheitlichen Probleme hat sie mit bemerkenswerter Tapferkeit reagiert. Clara ist zu dem Zeitpunkt von uns gegangen, wo eine neue Generation die Tür zur Zukunft aufstößt. Clara gibt uns als eine Frau ein Beispiel dafür, wie man sein ganzes Leben an der Seite und innerhalb der Arbeiterklasse kämpft; sie zeichnete sich damit durch ihren außergewöhnlichen Mut aus (insbesondere als sie ihr Leben in den Jahren der Konterrevolution riskierte). Clara war eine Frau, die ihren Ideen und ihrem revolutionären Engagement bis zum Ende treu geblieben ist. Als die IKS von ihrem Tod erfuhr, haben die Sektionen (und einzelne Genossen) dem Zentralorgan der IKS eine Reihe von Kondolenzen geschickt, in denen ihre menschliche Wärme, ihre Hingabe an die Sache des Proletariats und ihr großer Mut während ihres gesamten Lebens gewürdigt wurden. Clara wurde auf dem Friedhof Ivry bestattet (auf dem gleichen Friedhof, auf dem am 31. Januar 1889 der Mann Clara Zetkins, Ossim, begraben wurde). Nach dem Begräbnis hat die IKS ein Treffen zur Würdigung der Genossin organisiert, an dem mehrere internationale Delegationen der IKS, zahlreiche Sympathisanten, die Clara persönlich kennengelernt hatten, sowie Mitglieder ihrer Familie teilgenommen haben. Wir möchten hiermit ihrem Sohn Marc, ihren Enkelkindern Miriam und Jan-Daniel unsere größte Solidarität und Sympathie zum Ausdruck bringen.
Nachfolgend veröffentlichen wir Auszüge aus dem Brief, den die IKS ihrem Sohn und seiner Familie geschickt hat.
IKS 25.04.2006
Die IKS an den Genossen Marc
Lieber Genosse Marc,
mit diesen wenigen Zeilen wollen wir Dir nach dem Tod Claras, Deiner Mutter und unserer Genossin zunächst unsere Solidarität und unsere Sympathie zum Ausdruck bringen. Wir wollen Dir damit auch unsere Anteilnahme zeigen, die all die Genossen unserer Organisation empfinden.
Die meisten von uns hatten Clara zunächst als die Partnerin von Marc, Deinem Vater, kennengelernt, der solch eine wichtige Rolle in dem Kampf der Arbeiterklasse, insbesondere während ihrer schwierigsten Phasen, und als Hauptinitiator der Gründung der IKS gespielt hat. Dies war schon ein ausreichender Grund für die Zuneigung und den Respekt für Clara: "Die Partnerin von Marc konnte nur ein sehr guter Mensch sein." Der Mut und die Würde, den sie beim Tod Deines Vaters zeigte, die gewaltige Liebe, die sie für ihn spürte, haben uns ihre große Charakterstärke bestätigt, die wir schon zuvor kennengelernt hatten und die sie bis zu ihrem letzten Tag auszeichnete. Auch aus diesem Grunde war Clara für die Mitglieder der IKS nicht nur die Partnerin Marcs; sie war weit mehr als das. Sie war eine Genossin, die bis zum Schluss ihren Überzeugungen treu blieb, die sich an all unseren Kämpfen beteiligt hat und die ungeachtet ihrer alters- und krankheitsbedingten Schwierigkeiten immer am Leben unserer Organisation teilhaben wollte. Alle Genossen waren beeindruckt von ihrem Lebensmut und die große geistige Klarheit bis zum Schluss ihres Lebens. Deshalb haben sich die Zuneigung und der Respekt, den jeder von uns ohnehin schon gegenüber ihr spürte, im Laufe der Jahre noch verstärkt.
Kurz vor seinem Tod hat uns Dein Vater von der gewaltigen Freude erzählt, die er über das Verschwinden des Stalinismus empfand, diesem Henker der Revolution und der Arbeiterklasse. Gleichzeitig verhehlte er nicht seine Sorgen vor den negativen Konsequenzen dieses Ereignisses für das Bewusstsein und den Kampf selbst. Weil Clara ihre revolutionären Überzeugungen aufrechterhalten hatte, haben diese in den letzten Tagen ihres Lebens noch einmal einen Auftrieb erhalten, als der Arbeiterkampf der neuen Generationen sich entfaltete. Für uns ist dies trotz unserer Trauer ein gewisser Trost.
Mit Clara verschwindet einer der letzten Menschen, der Zeuge und Handelnder dieser schrecklichen Jahre war, als die Revolutionäre auf eine Handvoll Leute geschrumpft waren, die weiterhin die internationalistischen Prinzipien des Proletariats verteidigten; ein Kampf, welcher insbesondere von den Mitgliedern der Italienischen Linken, der Holländischen Linken und der Gauche Communiste de France (GCF) geführt wurde und ohne den die IKS heute nicht existieren würde. Clara sprach manchmal von diesen Genossen; man spürte in ihren Worten die große Wertschätzung und die Zuneigung, die sie gegenüber diesen Genossen empfand. So war Clara nach dem Tod Deines Vaters weiterhin eine lebendige Verbindung mit dieser Generation von Kommunisten, auf die wir uns mit Stolz berufen. Diese Verbindung über die Person unserer Genossin Clara ist nun verloren gegangen (...) Wir möchten Dir nochmals, lieber Genosse Marc, unsere Solidarität bekunden, und wir bitten Dich, diese Solidarität Deinen Kindern und anderen Familienmitgliedern zu übermitteln.
IKS, 17.04.06
Ölprofite als Kriegserklärung: Ein Bluff!
- 1499 reads
“Indem sie Hand anlegen an die irakischen Ölreserven wollen die USA sich von einer zu großen Abhängigkeit von Saudi-Arabien befreien.” Diese weitverbreitete und immer wiederholte Behauptung der bürgerlichen Presse hält aber einer Überprüfung der Zahlen nicht stand. Im Jahr 2000 haben die USA ungefähr 893 Mio. Tonnen Öl verbraucht, davon wurden aber nur 125 Mio. Tonnen aus dem Nahen Osten importiert. Der Anteil Saudi-Arabiens betrug dabei zwischen 5-8% des Verbrauchs. Damit kann man noch nicht von ‚Abhängigkeit‘ sprechen! Wenn man dagegen die Versorgung asiatischer Staaten untersucht (von Indien bis Japan), stellt man 73% Anteil des Öls aus dem Nahen Osten fest, allein bei Japan betrug er 95%!. Ohne Kommentar! In Europa beträgt der Anteil 25%, da die Versorgung mehr diversifiziert ist (Westafrika, Algerien und Nordsee). Wenn es um die globale Energieabhängigkeit (Öl+Gas+Kohle +Nuklear +Wasserkraftwerke) geht, deckt die US-Produktion ungefähr 82% ihres Verbrauchs; der verbleibende Anteil wird importiert. In Europa ist der Verbrauch nur zu 61% durch ‚einheimische‘ Produktion gedeckt; und in Japan liegt er gar nur bei 18%. Die GUS hat einen Überschuss (vor allem wegen der Gasvorkommen) und bei China ist der Anteil mehr oder weniger ausgeglichen (99%). „Das Ziel der USA ist die Verdoppelung der Ölproduktion des Iraks.” 2001 hat der Irak 118 Millionen Tonnen gefördert; bei einer Gesamtölförderung auf der Welt von 3566 Millionen Tonnen beträgt der Anteil Iraks nur 3.3%. Die Verdoppelung der irakischen Erdölförderung wird aber nicht die erwartete Umwälzung bringen. Darüber hinaus lassen die verfallenen irakischen Ölförderanlagen keine unmittelbare bedeutsame Steigerung der Fördermengen zu. Sicher sind die Ölreserven Iraks enorm: 15 Milliarden Tonnen, d.h. 11% der Weltölreserven (ein Sechstel der Ölreserven des gesamten Nahen Ostens). Man versteht unter bewiesenen Reserven die Menge Kohlenwasserstoffs, die unter den gegenwärtigen ökonomischen und technologischen Bedingungen mit ziemlicher Sicherheit zugänglich ist. Weltweit betragen diese Ölreserven 140 Milliarden Tonnen, damit sind beim gegenwärtigen Jahresverbrauch die Reserven für 42 Jahre sicher. Das heißt jedoch nicht, dass es über diesen Reservezeitraum hinaus kein Gas und Öl mehr geben wird. Denn jedes Jahr erhöhen sich die weltweiten Reserven um die Fördermengen neu entdeckter Ölfelder und förderbarer neuer Mengen, die bislang nicht zugänglich waren (Offshore-Förderung in großen Meerestiefen, in der Arktis usw.) Darüber hinaus können neue Fördertechniken die Produktivität noch um das Drei- bis Fünffache erhöhen. Deshalb muss man die wahrscheinlichen und möglichen Reserven mit berücksichtigen, so dass man von einer Menge von 400 Mrd. Tonnen sprechen kann – wodurch wiederum die Wichtigkeit des Iraks abnimmt. Es wäre natürlich absurd zu leugnen, dass es im Irak Öl gibt, aber nur nach angeblichen unmittelbaren ökonomischen Vorteilen zu suchen versperrt den Blick für die weltweiten strategischen Gesichtspunkte, die diese Region darstellt, insbesondere hinsichtlich der Kontrolle der Energieversorgung der möglichen Rivalen der USA. Wir haben schon auf die Wichtigkeit der strategischen Kontrolle des Balkans hingewiesen, obwohl es dort keine bedeutsamen Bodenschätze. Was sollte man gar zur kleinen Petersilieninsel sagen, um die sich Spanien und Marokko im Sommer letzten Jahres gestritten haben? Thierry
“Indem sie Hand anlegen an die irakischen Ölreserven wollen die USA sich von einer zu großen Abhängigkeit von Saudi-Arabien befreien.” Diese weitverbreitete und immer wiederholte Behauptung der bürgerlichen Presse hält aber einer Überprüfung der Zahlen nicht stand. Im Jahr 2000 haben die USA ungefähr 893 Mio. Tonnen Öl verbraucht, davon wurden aber nur 125 Mio. Tonnen aus dem Nahen Osten importiert. Der Anteil Saudi-Arabiens betrug dabei zwischen 5-8% des Verbrauchs. Damit kann man noch nicht von ‚Abhängigkeit‘ sprechen![1] Wenn man dagegen die Versorgung asiatischer Staaten untersucht (von Indien bis Japan), stellt man 73% Anteil des Öls aus dem Nahen Osten fest, allein bei Japan betrug er 95%!. Ohne Kommentar! In Europa beträgt der Anteil 25%, da die Versorgung mehr diversifiziert ist (Westafrika, Algerien und Nordsee). Wenn es um die globale Energieabhängigkeit (Öl+Gas+Kohle +Nuklear +Wasserkraftwerke) geht, deckt die US-Produktion ungefähr 82% ihres Verbrauchs; der verbleibende Anteil wird importiert. In Europa ist der Verbrauch nur zu 61% durch ‚einheimische‘ Produktion gedeckt; und in Japan liegt er gar nur bei 18%. Die GUS hat einen Überschuss (vor allem wegen der Gasvorkommen) und bei China ist der Anteil mehr oder weniger ausgeglichen (99%). „Das Ziel der USA ist die Verdoppelung der Ölproduktion des Iraks.” 2001 hat der Irak 118 Millionen Tonnen gefördert; bei einer Gesamtölförderung auf der Welt von 3566 Millionen Tonnen beträgt der Anteil Iraks nur 3.3%. Die Verdoppelung der irakischen Erdölförderung wird aber nicht die erwartete Umwälzung bringen. Darüber hinaus lassen die verfallenen irakischen Ölförderanlagen keine unmittelbare bedeutsame Steigerung der Fördermengen zu. Sicher sind die Ölreserven Iraks enorm: 15 Milliarden Tonnen, d.h. 11% der Weltölreserven (ein Sechstel der Ölreserven des gesamten Nahen Ostens). Man versteht unter bewiesenen Reserven die Menge Kohlenwasserstoffs, die unter den gegenwärtigen ökonomischen und technologischen Bedingungen mit ziemlicher Sicherheit zugänglich ist. Weltweit betragen diese Ölreserven 140 Milliarden Tonnen, damit sind beim gegenwärtigen Jahresverbrauch die Reserven für 42 Jahre sicher. Das heißt jedoch nicht, dass es über diesen Reservezeitraum hinaus kein Gas und Öl mehr geben wird. Denn jedes Jahr erhöhen sich die weltweiten Reserven um die Fördermengen neu entdeckter Ölfelder und förderbarer neuer Mengen, die bislang nicht zugänglich waren (Offshore-Förderung in großen Meerestiefen, in der Arktis usw.) Darüber hinaus können neue Fördertechniken die Produktivität noch um das Drei- bis Fünffache erhöhen. Deshalb muss man die wahrscheinlichen und möglichen Reserven mit berücksichtigen, so dass man von einer Menge von 400 Mrd. Tonnen sprechen kann – wodurch wiederum die Wichtigkeit des Iraks abnimmt. Es wäre natürlich absurd zu leugnen, dass es im Irak Öl gibt, aber nur nach angeblichen unmittelbaren ökonomischen Vorteilen zu suchen versperrt den Blick für die weltweiten strategischen Gesichtspunkte, die diese Region darstellt, insbesondere hinsichtlich der Kontrolle der Energieversorgung der möglichen Rivalen der USA. Wir haben schon auf die Wichtigkeit der strategischen Kontrolle des Balkans hingewiesen, obwohl es dort keine bedeutsamen Bodenschätze. Was sollte man gar zur kleinen Petersilieninsel sagen, um die sich Spanien und Marokko im Sommer letzten Jahres gestritten haben? Thierry
1. Alle Zahlen aus der Zeitschrift “Oil and Gaz Journal”
Juli 2006
- 731 reads
Zwischenbilanz im Kampf bei Swissmetal in Reconvilier: Welche Lehren für die Arbeiterklasse insgesamt?
- 2682 reads
Vom 25. Januar bis Ende Februar 2006 standen die Maschinen bei Swissmetal in Reconvilier zum zweiten Mal innert 15 Monaten still. Die über 300 Arbeiter streikten erneut, nachdem sie bereits im November 2004 in den Ausstand getreten waren. Im Buntmetallwerk von Reconvilier (genannt La Boillat) beschlossen die Arbeiter spontan in Solidarität mit 27 Entlassenen den Streik und besetzten die Fabrik (vgl. Weltrevolution Nr. 128 und 135). Der erste Streik war seinerzeit beendet worden, weil die Konzernleitung zugesagt hatte, den Standort Reconvilier und die Arbeitsplätze zu erhalten. Ein Monat nach Beginn des zweiten Streiks stellte die inzwischen aktiv gewordene Gewerkschaft UNIA die kämpfenden Arbeiter vor die Alternative, den Vorschlag des von der Regierung eingesetzte Vermittlers Rolf Bloch anzunehmen oder keine Streikgelder mehr zu erhalten... Vom 25. Januar bis Ende Februar 2006 standen die Maschinen bei Swissmetal in Reconvilier zum zweiten Mal innert 15 Monaten still. Die über 300 Arbeiter streikten erneut, nachdem sie bereits im November 2004 in den Ausstand getreten waren. Im Buntmetallwerk von Reconvilier (genannt La Boillat) beschlossen die Arbeiter spontan in Solidarität mit 27 Entlassenen den Streik und besetzten die Fabrik (vgl. Weltrevolution Nr. 128 und 135). Der erste Streik war seinerzeit beendet worden, weil die Konzernleitung zugesagt hatte, den Standort Reconvilier und die Arbeitsplätze zu erhalten.
Ein Monat nach Beginn des zweiten Streiks stellte die inzwischen aktiv gewordene Gewerkschaft UNIA die kämpfenden Arbeiter vor die Alternative, den Vorschlag des von der Regierung eingesetzte Vermittlers Rolf Bloch anzunehmen oder keine Streikgelder mehr zu erhalten. Blochs Vorschlag beinhaltete im Wesentlichen, dass die Kündigungen vorübergehend aufgehoben, das Vermittlungsgespräch fortgesetzt und der Streik beendet werden sollen. Der Streik wurde dann nach dieser Erpressung durch die Gewerkschaft je nach Standpunkt ab- bzw. unterbrochen. Wir haben bereits in der April/Mai-Ausgabe dieser Zeitung darüber berichtet, wie frustriert die Arbeiter über die Gewerkschaft waren. „Es war ein Fehler, dass wir die Verhandlungen aus unseren Händen gegeben“, d.h. der Gewerkschaft überlassen haben, war eine der Lehren, die schon damals gezogen wurden.
Der Konflikt dauert an. Es wird zwar nicht mehr gestreikt. Aber Swissmetal hat Ende März trotz laufenden Vermittlungsgesprächen 112 Kündigungen ausgesprochen. Weitere Verschlechterungen sind absehbar. Die Vorschläge der so genannten Vermittler und Experten laufen alle darauf hinaus, dass man sich mit irgendwelchen Zusagen der Konzernleitung zufrieden geben soll - nachdem diejenigen vom Dezember 2004 schon nicht eingehalten wurden!
Die Gewerkschaft diskreditiert
Die Gewerkschaft UNIA hat einige Mühe, den Arbeitern weis zu machen, dass sie doch auf ihrer Seite stehe: „UNIA ist eine Bande von organisierten Dümmköpfen, ich erkläre meinen Austritt, Fabienne (gemeint ist Fabienne Blanc-Kühn, UNIA-Verantwortliche für den Industriebereich, die Red.), du verdienst das Vertrauen nicht, das wir Arbeiter in dich gesetzt haben (...). Und deine Chefs sind Haie, nicht besser als MH (Martin Hellweg, CEO von Swissmetal, die Red.), ich habe soeben mit jemandem geschwatzt, der für euch schuftet, und diese Person hat mir von euren Praktiken erzählt, wie ihr die Basis zum Schweigen bringt, von euren Drohungen gegenüber dem eigenen Personal, bravo UNIA, (...) ihr widert mich zutiefst an“ (eine Stimme vom 27.06.06 auf dem Blog https://laboillat.blogspot.com/ [46], von uns aus dem Französischen übersetzt).
„UNIA hat die Angestellten hängen lassen und verraten.“ (Zitat aus einem Brief der UNIA vom 12. Juli 2006, mit dem sie sich gegenüber den Mitgliedern rechtfertigt)
Diese Wut ist nicht nur verständlich, sondern zu begrüssen. Wir können uns weder hier noch sonst wo auf die Gewerkschaften verlassen. Im Gegenteil: Sie sind längst zu einem Teil des staatlichen Apparates geworden, sie sind Gegner der Arbeiterklasse, und nicht ihre Interessensvertreter.
Der Ausgangspunkt dieses Kampfes war eine unmittelbare Solidarisierung der Arbeiter mit Kollegen, die entlassen werden sollten. Den Streik begann die Belegschaft der Boillat am 25. Januar selbstständig, ohne Gewerkschaft. Die Arbeiter der Boillat wussten, dass jede Entlassung ein Schritt zur Stilllegung des Werks ist. Sie begannen diesen Kampf im Bewusstsein, dass sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Vom ersten Streiktag an fanden in der Fabrikhalle der Boillat täglich Streikversammlungen statt. Die Gewerkschaft UNIA schaltete sich erst nach dem Streikbeschluss ein. Dafür umso vehementer. Die UNIA entsandte eine nicht geringe Anzahl von Gewerkschaftsfunktionären, welche vor allem die organisatorischen Rahmenbedingungen ausserhalb der Streikversammlungen schnell an sich rissen. Dazu kommt, dass dieser Streik für die Gewerkschaft UNIA, abgesehen von ihrer üblichen Sabotagearbeit, ein geeignetes Mittel für ihre mediale Inszenierung und zur Steigerung ihrer „gesellschaftlichen Reputation“ war.
Die UNIA befürwortete den Abbruch des Streiks nach fast einem Monat zu Bedingungen, die ein Hohn für die Arbeiter sind.
Solange der Streik lief, wurde die Gewerkschaft UNIA in den Medien unwesentlich kritisiert. Eher wurden die Arbeiter und die Konzernleitung von Swissmetal für die „verfahrene“ Situation verantwortlich gemacht. Es gibt jedoch ein weiteres bezeichnendes Beispiel für den eigennützigen Umgang der Gewerkschaft mit diesem Streik in Reconvilier. Es ist der offensichtliche Wechsel des Tenors innerhalb der Woche, die zur Beendigung des Streiks führte. Dies kann mit zwei Interviews des SP-Nationalrates A. Daguet belegt werden. Er ist auch Mitglied der Geschäftsleitung der UNIA. Am 19. Februar äusserte er sich in der eher linksbürgerlich ausgerichteten Sonntagszeitung dahingehend: „Jede Woche, ja jeder Streiktag, der darüber hinausgeht ist gefährlich. (…) Heldentum bringt niemanden weiter.“ Da ging es ihm darum, den Streik zu beenden. Eine Woche später, nachdem er sein Ziel erreicht hatte, schmückte er sich in der bekanntermassen konservativen NZZ am Sonntag mit fremden Federn: „Stolze Arbeiterinnen und Arbeiter sind – zum Glück – aufmüpfig. Und signalisieren nicht jedes Mal mit dem Kopf Zustimmung, wenn eine Direktion über die Köpfe der Betroffenen hinweg entscheidet.“ Aber wenn die UNIA-Geschäftsleitung in derselben Woche „über die Köpfe der Betroffenen hinweg“ entscheidet, ist das anscheinend etwas ganz Anderes. Es ist etwas Anderes, wenn es die Gewerkschaft tut. Denn die Gewerkschaft spricht im Namen der Arbeiter. Oder anders gesagt: Die Arbeiter im Namen ihrer angeblich eigenen Interessen hinters Licht zu führen – das ist das Kerngeschäft der Gewerkschaften.
Welche Fragen stellen sich heute?
Die Bourgeoisie hat viele Gesichter und Institutionen, die den Arbeitern gegenüber arbeitsteilig in Aktion treten: nicht nur die Konzernleitung von Swissmetal, sondern auch die Gewerkschaften[1] [47], die Vermittler und Experten, die Regierung. Ihre ganze Strategie läuft darauf hinaus, die Arbeiter und ihren Kampfwillen zu zermürben.
Dem gegenüber fragen sich die Betroffenen und diejenigen, die sich mit ihnen solidarisieren: „Welches sind die wirklichen „Aktions“mittel, über die die Arbeiter der Boillat gegenwärtig verfügen?“ [2] [48]
Welches sind unsere Stärken? Wir haben deren zwei:
- unsere Einheit als Klasse über die Fabrik hinaus, über die Sprach- und alle anderen Grenzen hinweg;
- unser Bewusstsein, unsere Fähigkeit aus der gegenwärtigen Situation und aus der Geschichte unserer Klasse Lehren zu ziehen.
Wir können uns nur auf die eigenen Kräfte verlassen - nicht auf die Gewerkschaften, die den Kampf sabotieren und in systemverträgliche Bahnen zu lenken versuchen. Die eigenen Kräfte befinden sich aber nicht nur in der unmittelbar betroffenen Fabrik, dem Betrieb, der Branche. Wenn wir ein Kräfteverhältnis zu unseren Gunsten schaffen wollen, müssen wir den Kampf auf andere Arbeitsstätten, auf möglichst weite Teile der Arbeiterklasse ausdehnen, auf Arbeiter des privaten und des öffentlichen Sektors. In diesem Frühjahr haben es die Stundenten in Frankreich im Kampf gegen den CPE vorgemacht: Sie haben Flugblätter gedruckt und verteilt, mit denen sie die Arbeiter in den Bahnhöfen, bei den Poststellen, vor den Fabriktoren aufforderten, ebenfalls in den Kampf zu treten[3] [49]. Dieser Reflex spielte auch im Mai beim Kampf der Metallarbeiter in Vigo/Spanien: Die Streikenden entsandten massive Delegationen zu den Grossbetrieben (Schiffswerften, Citroen usw.), um sie zur Beteiligung an der Bewegung aufzurufen[4] [50]. Erst wenn die Ausdehnung der Kämpfe gelingt, schaffen wir ein Kräfteverhältnis, das die Bourgeoisie zum Nachgeben zwingen kann. Die französische Regierung hätte den CPE nicht zurückgezogen, wenn nicht die Gefahr bestanden hätte, dass sich der Kampf effektiv auf weitere Teile der Arbeiterklasse ausdehnt.
Dabei ist es auch nötig, über die Ziele unseres Kampfes zu diskutieren. Niemand macht sich Illusionen darüber, dass Swissmetal gezwungen werden kann, den Standort Reconvilier längerfristig beizubehalten. Obwohl die Produkte aus der Boillat höchste Qualität haben, ist nach der Profitlogik nicht garantiert, dass der Konzern weiterhin hier produzieren lässt. Schon lange wird deshalb die Idee diskutiert, dass der Betrieb in Reconvilier in den Konkurs fallen sollte, damit er dann von den Arbeitern in Selbstverwaltung übernommen werden kann. Doch ist dies der einzige Ausweg: als Arbeiter einen Betrieb im Kapitalismus zu führen, der dann doch der Konkurrenz standhalten und letztlich nach Rentabilitätskriterien funktionieren muss? Sollte es nicht vielmehr darum gehen, sich ganz grundsätzlich Gedanken zu machen, wie dieses System insgesamt überwunden werden kann?
Es braucht eine Politisierung der Kämpfe, ein Durchbrechen der rein ökonomischen, d.h. immer noch kapitalistischen Logik. Gerade zu diesem Zweck sind Diskussionen sehr wichtig, wie sie gegenwärtig z.B. auf dem Blog https://laboillat.blogspot.com/ [46] geführt werden.
Kein Zurück in der Haltung gegenüber den Gewerkschaften!
Gewisse Errungenschaften dieses Kampfes sollten aber nicht mehr aufgegeben werden. Eine der wichtigsten Lehren ist, dass sich die Gewerkschaften als Gegner der Arbeiter entlarvt haben.
Hüten wir uns auch vor all denen, die zwar den bestehenden Gewerkschaften oder ihrer Bürokratie kritisch gegenüberstehen, aber doch ihr Wesen verteidigen und uns die Idee verkaufen wollen, dass wir an diesen Organisationen festhalten müssten! Zu diesen linken Unterstützern der Gewerkschaften gehört beispielsweise die trotzkistische SolidaritéS, die alle zwei Wochen die gleichnamige Zeitung herausgibt. In ihrer Ausgabe vom 28. Februar 2006 veröffentlichte sie einen Artikel, in welchem sie zuerst zugibt, dass die „Bitterkeit gegen die Gewerkschaften“ bei gewissen Teilnehmern der Bewegung gross sein müsse. Dann aber fährt sie fort: „Zu behaupten, dass die Gewerkschaft UNIA verraten habe, ist nicht wahr. UNIA hat sich voll eingesetzt, um die Rücknahme der Kündigungen zu erreichen, um ohne Bedingungen Verhandlungen aufzunehmen. Diese Wut gleicht derjenigen des Arbeiters, der abends nach Hause kommt und seine Frau zusammenscheisst, weil er seinen Chef nicht mehr erträgt. (...) Eigentlich liegt der Kern des Problems darin, dass die Regierung in der Schweiz keine voluntaristische Industriepolitik hat im Gegensatz zu Frankreich, wo in solchen Fällen der Staat sofort interveniert.“ (von uns aus dem Französischen übersetzt)
Das also sind die Rezepte von SolidaritéS: Die Gewerkschaft und die Arbeiterklasse verhalten sich angeblich zueinander wie Frau und Mann in einer Ehe – wenn es mal Streit gibt, so ändert dies doch nichts daran, dass sie im Grunde zusammen gehören …
Und wenn es Krach gibt zwischen Arbeitern und den Chefs, dann soll man sich nicht bloss auf die Gewerkschaften verlassen, sondern auch gleich auf die Regierung, vorausgesetzt sie betreibt die gleiche Politik wie die französische ... Was wohl die Arbeiter auf der anderen (französischen) Seite des Juras dazu sagen würden?
Mit solchen Rezepten wollen uns diese Verteidiger des Staates an die kapitalistische Ordnung binden, damit wir sie nur ja nicht in Frage stellen. V/T, 13.07.06
[1] [51] Nebst der UNIA trat noch eine zweite Gewerkschaft in Aktion, die die Aufgabe hatte, die Arbeiter zu spalten: Der Schweizer Angestelltenverband VSAM, kritisierte im Namen der Belegschaft von Swissmetal in Dornach, dem zweiten Standort, öffentlich die Streikenden in Reconvilier und forderte sie zum Abbruch des Streiks auf.
[2] [52] Ein Diskussionsteilnehmer am 27.06.06 auf dem Blog https://laboillat.blogspot.com/ [46]
[3] [53] vgl. die "Thesen über die Studentenbewegung in Frankreich im Frühling 2006 [45]" (Beilage zur Internationalen Revue Nr. 37 bzw.)
[4] [54] vgl. den Artikel in Weltrevolution Nr. 136, oder "Streik der Metallarbeiter in Vigo, Spanien: die proletarische Kampfmethode [55]" und "Metallarbeiterstreik in Vigo Das französische Beispiel macht Schule [56]"
Geographisch:
- Schweiz [57]
Aktuelles und Laufendes:
- Arbeiterkampf [40]
Theoretische Fragen:
- Arbeiterklasse [58]
Erbe der kommunistischen Linke:
- "Selbstverwaltung" [59]
August 2006
- 676 reads
Die Arbeiterklasse in den USA kehrt zum Klassenkampf zurück
- 2429 reads
Das Proletariat in den USA ist völlig einbezogen in die allgemeine Rückkehr zum Klassenkampf, die auf internationaler Ebene seit 2003 zu beobachten ist, und bei der die Arbeiterklasse darum kämpft, aus ihrer Orientierungslosigkeit und Verwirrung wieder aufzutauchen, den Rückgang in ihrem Bewusstsein zu überwinden - eine Folge des Zusammenbruchs des Systems zweier Blöcke Ende der 1980er Jahre. Der Rückgang und die Verwirrung waren so tief greifend, dass das Proletariat in vielerlei Hinsicht große Schwierigkeiten hatte bis hin, dass es an seiner Identität zweifelte und kein Vertrauen in sich selbst als Klasse mehr hatte, sich verteidigen zu können.
Wie wir in unseren Publikationen schon aufgezeigt haben, war der deutliche Höhepunkt dieser Rückkehr in den USA der Streik der Arbeiter der New Yorker Verkehrsbetriebe im Dezember vorigen Jahres. Aber es ist wichtig zu betonen, dass dieser Streik nicht plötzlich wie aus heiterem Himmel kam, sondern vielmehr die Frucht einer schon länger vor sich gehenden Tendenz war, den Kampf wieder aufzunehmen, wie wir es beim Kampf der Arbeiter in der Lebensmittelbranche in Kalifornien, bei der Kämpfen von Boeing, von North West Airlines, im öffentlichen Verkehrwesen von Philadelphia und beim Streik der wissenschaftlichen Mitarbeiter an der New Yorker Universität gesehen haben. Wie in anderen Ländern auch sind die Arbeiter in den USA durch die Schwere der weltweiten Wirtschaftskrise und durch die daraus folgende Eskalation der Angriffe der herrschenden Klasse auf ihren Lebensstandard dazu gedrängt worden sich zu verteidigen, und die Auswirkungen des Zusammenbruchs des Ostblocks abzuschütteln. Die Hauptaufgabe, die sich den jüngsten Kämpfen in so vielen Ländern stellt, ist nicht die Ausdehnung der Kämpfe über die jeweiligen geografischen und branchenspezifischen Grenzen hinaus, sondern die Wiederaneignung eines grundlegenden Selbstbewusstseins als Klasse und sich klar zu werden über Bedeutung der Solidarität.
Die Rückkehr zum Kampf geschieht in den USA in einer gesellschaftlichen Situation, die immer weniger Platz lässt für Illusionen. Vorbei ist der Glaube an eine vorgegaukelte Realität, wie er wenigsten zeitweise während der Clinton Regierung herrschte - eine Realität mit ihren Versprechungen eines nie endenden Wachstums, mit der Luftblase des Internetbooms und mit den in die Höhe schnellenden Aktienkursen. Heute herrscht das Gefühl vor, dass die Zukunft nicht rosig ist, dass die Dinge nicht so laufen, wie sie sollten, dass es nichts zum Prahlen und Rühmen gibt, keinen Grund zum Optimismus, keine andere Alternative als den Klassenkampf, um die gegen die immer schärfer werdenden Sparmaßnahmen und Angriffe auf unseren Lebensstandard anzukämpfen. Dazu kommt, dass es heute zwei unbesiegte Arbeitergenerationen gibt, was die Entwicklung des Klassenkampfes begünstigt.
Es gibt beim gegenwärtigen Wiederaufleben des Kampfes eine Erscheinung, die eine qualitativ neue Erfahrung seit dem Wiederbeginn der Weltwirtschaftkrise in den 1960er Jahren darstellt. Ja, es gibt Unmut, sogar Wut über die Sparmaßnahmen, besonders über die Einschnitte bei den Renten und in der medizinischen Versorgung, die ja eine drastische Kürzung der Versorgungsleistungen und der Löhne bedeuten. Aber die Kämpfe, die heute entstehen, werden nicht hervorgerufen von blinder Wut und instinktiver Kampfeslust, wie das eher in den späten 1960er und in den 1970er Jahren der Fall war. Heute nehmen Arbeiter den Kampf auf mit viel größerem Bewusstsein darüber, was auf dem Spiel steht und was notwendig ist. Ein Streik heute bedeutet seinen Arbeitsplatz zu riskieren und durch Streikbrecher ersetzt zu werden. Es besteht die Gefahr, dass die Firma bankrott macht, dass Dauerarbeitsplätze verschwinden, sich wachsende Schwierigkeiten einzuhandeln, seine Familie zu versorgen und sich in ein absolutes Desaster zu bringen. Im Falle der Arbeiter der New Yorker Verkehrsbetriebe, deren Streik illegal war, kam neben dem Lohnausfall für jeden Streiktag noch eine Strafe von zwei zusätzlichen Tagen für jeden Streiktag dazu - also für den dreitätigen Streik ein Lohnverlust von 9 Tagen. Zudem drohten die Gerichte mit 25.000$ Strafe für den ersten Streiktag; diese Summe sollte sich jeden Tag verdoppeln; somit hätten die Gerichte jedem Streikenden ca. 175.000$ Strafe aufbrummen können.
Die Arbeiter waren sich all des Risikos, der Gefahren und der drohenden Strafen bewusst und haben trotzdem gestreikt, weil ihnen zunehmend klar wird, dass sie kämpfen müssen und nicht nur für sich, sondern für ihre Klasse. Die Wiederaneignung eines Klassenbewusstseins und das eng damit verbundene Wiederaufleben der Klassensolidarität sind die bedeutendste Errungenschaft des Streiks - ein Vermächtnis für künftige Kämpfe. Das bekundete sich auf vielerlei Weise, so in der Aussage eines Busfahrers, der einem unserer Genossen sagte: "Es war gut, dass wir aufstanden für die Arbeiterklasse." Oder in der unglaublichen Sympathie für den Streik in der ganzen Arbeiterklasse in New York, obwohl der Streik vielen Arbeitern große Unannehmlichkeiten bereitete. Oder darin, dass Arbeiter überall über die Notwendigkeit sprachen, dass man sich wehren müsse gegen die Verschlechterungen bei den Renten und gegen die Einführung eines zweigeteilten Rentensystems [eines für die jetzigen Arbeiter und eines viel schlechteren für die künftigen Arbeiter], das künftige Arbeiter benachteiligt. Diese Wiederkehr von Klassenbewusstsein und ~solidarität konnte auch gesehen werden in der Stimme einer älteren afrikanischen Arbeiterin im Fernsehen, die den Bürgermeister Bloomberg von New York anprangerte, weil er die streikenden Arbeiter als Schläger beschimpfte, und erklärte: "Wenn die Schläger sind, dann bin ich auch ein Schläger." Genauso drückte sich die Solidarität aus, wenn andere Arbeiter danach strebten, die Streikenden nicht allein und isoliert zu lassen, sondern ihre Unterstützung und Solidarität zu zeigen. So besuchten andere Arbeiter die Streikposten, gingen auf Demonstrationen mit, brachten Essen und heißen Kaffee bei dem extrem kalten Wetter, diskutierten mit den Streikenden. Diese Arbeiter wurden von den Streikenden herzlichst begrüßt. In einem Fall kamen mehrere Lehrer mit ihren Schülern zu den Arbeitern und boten ihre Hilfe an. Die streikenden Arbeiter des New Yorker Verkehrswesen wussten, dass sie nicht allein und isoliert waren, und das deswegen weil ihr Kampf sich gegen genau dieselben Probleme richtete und sie sich gegen dieselben sich verschlechternden Arbeits- und Lebensbedingungen wehrten, mit denen auch der Rest der Klasse konfrontiert ist.
Während der 3. Klassenkampfwelle in den frühen 1980er Jahren vertraten wir gewöhnlich die Auffassung, wirkliche Solidarität bedeutet, selbst den Kampf aufzunehmen, den Kampf auf andere Branchen auszudehnen und wenn andere Branchen sich dem Kampf anschließen, dann ihre Forderungen mit aufzunehmen. Diese Art der Verallgemeinerung, der Ausdehnung und Politisierung der Kämpfe ist unbedingt nötig und Bestandteil des revolutionären Prozesses, aber vielleicht sind die gegenwärtigen vom Proletariat ausgehenden Ausdrücke der Solidarität Ausdrücke einer noch tieferen und elementareren menschlichen Solidarität. Während der Kampfeswellen in den 1970er Jahren gab es oft eine Gleichzeitigkeit der Kämpfe, aber es gab nicht unbedingt ein starkes Gefühl der Solidarität unter den Arbeitern, die zur gleichen Zeit kämpften. Wenn heute Arbeiter den Kampf aufnehmen, geschieht dies mit einem wachsenden Bewusstsein über die Bedeutung und die Schwierigkeiten ihrer Kämpfe, mit einem wiederauftauchenden Selbstgefühl als Klasse und mit einem tiefen Gespür für die Notwendigkeit der Solidarität. Das macht die gegenwärtigen Kämpfe so bedeutsam und bringt eine neue Qualität hervor. Auch wenn die vor uns liegenden Kämpfe äußerst schwierig sein werden, besteht Grund, Zuversicht in die Perspektive des Klassenkampfes zu haben und die Verantwortung der revolutionären Minderheiten für ihre Intervention in den Klassenkampf nimmt zu.
(aus 'Internationalism' Nr. 139, Zeitung der IKS in den USA)
Leserbrief zum Thema Religion
- 4536 reads
Die Götter sind gerecht: Aus unseren Lüsten erschaffen sie das Werkzeug uns zu geißeln. Shakespeare, King Lear
DIE LEBENDIGE BLUME BRECHEN
Betrachtung über den Wert und die Verwertung eines ideellen Rauschmittels
Der Anlass
Religion ist Opium für das Volk. (!?)
Diese recht populäre, aber leider falsche Zitierweise ist wohlmöglich so alt wie die Veröffentlichung des Textes selbst, dem diese verzerrte Widergabe entnommen ist. Wie selbstverständlich wird dieses falsche Zitat bei allen möglichen Gelegenheiten gebraucht und verbraucht. Insbesondere von Leuten, welche sich in alltäglicher Gewohnheit vom Glauben distanzieren wollen. Das sei denen gegönnt. Muss man sich doch in dieser Hinsicht keine Sorgen mehr um sie machen. Für diese ist es in der Tat gleichgültig ob die Religion nun Opium für das Volk ist, oder ob sie des Volkes ist. Ihres ist es nicht, und offenbar auch nicht für sie gedacht.
Weil aber solcherlei Selbstverständlichkeiten sich auf das Selbstverständnis niederschlagen, und zugleich Ausdruck eines Selbstverständnis sind, ist dieser kleine Unterschied in der Kritik für die kommunistische Bewegung kaum zu vernachlässigen. Nun sind Zitate keine Beweise für Unfehlbarkeit. Sie sollten auch nichts Heiliges an sich haben. Schon gar nicht an dieser Stelle. Es macht jedoch einen wichtigen Unterschied ob man sich mal eben kurz vom Aberglauben abgrenzen will, oder ob man bemüht ist die wirkliche Funktionsweise von Religion zu klären.
Einer durchaus ernst zu nehmenden Organisation der kommunistischen Linken, der „Internationalen Kommunistische Strömung“ (IKS), ist es jüngst in ihrer territorialen Presse wiederfahren, der (falschen) populären Widergabe von Marx zu erliegen. Dort heißt es: „Und was den Respekt des Glaubens der anderen angeht, wollen wir Marx zitieren, ‚Religion ist Opium für das Volk’. Egal welche Religion, der Glauben wie jede andere Form des Mystizismus, sind ein ideologisches Gift, dass man in die Köpfe der Arbeiter einzuspritzen versucht. Religion ist eines der Mittel, mit dem die herrschende Klasse eine Bewusstwerdung der Arbeiterklasse zu verhindern sucht.“ [1] Es geht hier nicht darum diesen ansonsten sehr lesenswerten Artikel insgesamt zu kritisieren. Dieser Satz wirkt jedoch auf mich wie etwas Falsches im Richtigen. Er kann dadurch zum Anlass werden die Aussagen der Genossen insgesamt in Frage zu stellen. Es zeigt sich hier nämlich unterschwellig möglicherweise eine Haltung die davon ausgeht, dass den Lohnabhängigen jedwede bürgerliche Ideologie eigentlich wesensfremd sei. Dass diese Ideologien (dieses falsche Bewusstsein) erst von Außen, durch Maßnahmen der Kapitalistenklasse, unter großen Mühen, hinterhältig und in böser Absicht der Arbeiterklasse indoktriniert werden müssten. Diese Haltung blendet leider den subjektiven Zugang, die Affinität und Prädisposition der Individuen (auch innerhalb der Arbeiterklasse), gegenüber Religionen völlig aus. Diese Haltung ignoriert quasi das Vorhandensein eines Bedarfs, bzw. Bedürfnisses nach Ideologie, nach (religiöser) Verklärung im alltäglichen Überlebenskampf. Die Arbeiterklasse, in allen ihren bisherigen Erscheinungsformen, ist jedoch niemals bloß Objekt der Herrschenden gewesen.
An dieser Stelle ist es wohl angebracht die Textpassage von Marx, welche immer wieder für Fehlinterpretationen sorgt, ausführlich wiederzugeben.
„Der Mensch macht die Religion, die Religion macht nicht den Menschen. Und zwar ist die Religion das Selbstbewußtsein und das Selbstgefühl des Menschen, der sich selbst entweder noch nicht erworben oder schon wieder verloren hat. Aber der Mensch, das ist kein abstraktes, außer der Welt hockendes Wesen. Der Mensch, das ist die Welt des Menschen, Staat, Sozietät. Dieser Staat, diese Sozietät produzieren die Religion, ein verkehrtes Weltbewußtsein, weil sie eine verkehrte Welt sind. Die Religion ist die allgemeine Theorie dieser Welt, ihr enzyklopädisches Kompendium, ihre Logik in populärer Form, ihr spiritualistischer Point-d'honneur |Ehrenpunkt|, ihr Enthusiasmus, ihre moralische Sanktion, ihre feierliche Ergänzung, ihr allgemeiner Trost- und Rechtfertigungsgrund. Sie ist die phantastische Verwirklichung des menschlichen Wesens, weil das menschliche Wesen keine wahre Wirklichkeit besitzt. Der Kampf gegen die Religion ist also mittelbar der Kampf gegen jene Welt, deren geistiges Aroma die Religion ist. Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elendes und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist des Opium des Volkes.“[2] (!)
Es fällt zunächst auf, dass Marx an dieser Stelle nicht von Klassen spricht sondern vom Menschen, menschlichem Wesen, Staat, Sozietät (Gemeinwesen) und vom Volk. Man darf hier sicher unterstellen, dass er sich seiner Wortwahl wohl bewusst war. Was den Begriff Volk angeht, so brauchte Marx nicht erst die unzähligen bitteren Erfahrungen welche die Menschheit seither mit dem Völkischen als nationalistische Phrase machen musste, um zwischen Volk und Klasse schon damals klar unterscheiden zu wollen.[3] Spricht er in diesem Zusammenhang vom Menschen und vom menschlichen Wesen, oder der menschlichen Gemeinschaft (Staat, Sozietät), was einen wissenschaftlichen, historischen, sozialen und psychodynamischen Zugang zur Materie öffnet, dann tut er das vor allem aus zwei Gründen:
Weil er das Kapital als ein allgemeines Verhältnis zwischen allen Menschen auffasste, welches den gesamten Verkehr unter ihnen, bis in den Alltag der Individuen hinein, durchdringt.
Weil er wusste, dass religiöse Empfindungen und Ideen dem Kapitalismus, ja den Klassengesellschaften überhaupt vorausgingen.
Wenn Religion nach Marx das „Selbstbewusstsein und das Selbstgefühl (Identität) des Menschen“ darstellen, welcher „sich selbst entweder noch nicht erworben oder schon wieder verloren hat“, dann ist damit doch u.a. auch folgendes zum Ausdruck gebracht: Dass gerade die ausgebeuteten, unterdrückten und von sich selbst entfremdeten Proletarier, welche sich täglich selbst verlieren, indem sie innerhalb und außerhalb der Produktionsstätten des Kapitals ständig aufs neue ihre eigene Ohnmacht (und dadurch zugleich die Macht des Kapitals) produzieren, besondere Veranlassung haben ein Bedürfnis nach ideologischer Identifikation zu entwickeln. Jedenfalls so lange noch, bis sie den Kampf für die Überwindung der kapitalistischen Verhältnisse bewusst aufgenommen haben. (Dies wird allerdings in Form des Klassenkampf geschehen müssen. Als kollektive Angelegenheit mit dem Ziel der Aufhebung der Klassengesellschaft überhaupt, also auch der Selbstaufhebung des Proletariats als Klasse). Bis dahin gilt, ob uns das nun passt oder nicht: „Die tatsächliche Grundlage der religiösen Wiederspiegelung dauert also fort und mit ihr der religiöse Reflex selbst.“ [4]
Das Verhältnis der kommunistischen Bewegung zu den „anders Gläubigen“
Wenn die Genossen der IKS, so wie bereits unzählige Revolutionäre vor ihnen, vom „Glauben der Anderen“ reden mag das befremdlich klingen. Lässt es doch den Umkehrschluss zu, dass der Kommunismus selbst eine Form des Glaubens ist - und die Kommunisten somit auch Gläubige sind.
Der Kommunismus beschreibt (wie die Religion) eine Weltanschauung - eine bestimmte Anschauung der Welt. Im Gegensatz zur Religion jedoch bemüht er sich nicht um die Postulierung irgendwelcher Wahrheiten, sondern um die möglichst unverklärte Wahrnehmung der Wirklichkeit. Das vor allem seitdem die Arbeiten von Marx und Engels den Kommunisten einen wissenschaftlichen Zugang zur Erkenntnis ihrer Geschichte, und damit zur Umsetzung ihrer Ziele erlauben. Es wäre jedoch vermessen von den Kommunisten anstatt von Gläubigen - von Wissenden zu reden. Die Geschichte der kommunistischen Bewegung selbst ist anfänglichst, und über einen langen Zeitraum, von utopischen, illusionären Vorstellungen und Sehnsüchten geprägt gewesen. Voller moralischer Postulate und Ansprüche. Und sie ist es z. T. bis Heute. Zudem ändern sich Wirklichkeiten. Die Wirklichkeit ist historischer Prozess. In diesem Prozess verändert sich zugleich die Wahrnehmungsfähigkeit der Menschen (mit Hilfe der Wissenschaft). Das Verhältnis zwischen Kommunismus und Religion beschreibt nicht das Verhältnis zwischen Gläubigen und Wissenden. Es beschreibt nicht mehr und nicht weniger als das Verhältnis zweier gegensätzlicher Weltanschauungen. Die revolutionäre Theorie geht zwar davon aus, dass die Wissenschaft es sein wird welche den Sinn für religiöse Bedürfnisse und Ideen eines Tages aufheben wird. Und sie bemüht sich, seit Marx und Engels, um Wissenschaftlichkeit. Der Kommunismus ist jedoch - an und für sich - keine Wissenschaft.
Während die Vertreter eines utopischen Kommunismus, insbesondere deren radikale Flügel um Blanqui oder Bakunin, Mitte des 19ten Jahrhunderts noch der Meinung waren religiöse Ideen und Bedürfnisse vehement bekämpfen zu müssen, glaubten die Vertreter des wissenschaftlichen Kommunismus, dass sich hier ein unnötiger und kräfteverschleißender Nebenkriegsschauplatz auftut. Religionskritik war für letztere in erster Linie die Kritik der tatsächlichen Lebensbedingungen der Menschen. Wenn die revolutionäre Theorie davon spricht, dass die Kritik der Religion „die Vorraussetzung aller Kritik“[5] sei, ist damit gemeint, dass eine Kritik des wirklichen Lebens nur möglich ist, wenn ihr der religiöse Schleier genommen wird. Das hat der historische Materialismus vollbracht. Marx weiter: „Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die Forderung seines wirklichen Glücks. Die Forderung, die Illusionen über einen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusionen bedarf. Die Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des Jammertales, dessen Heiligenschein die Religion ist. [6]
Folgerichtig polemisierte Engels dann auch (1871) gegen „die Radikalen“, als es um den Umgang mit religiösen Proletariern innerhalb der Pariser Kommune ging:
„Um zu beweisen, dass sie die Allerradikalsten sind, wird Gott..... durch Dekret abgeschafft: ... ,In der Kommune ist kein Platz für den Pfaffen; jede religiöse Kundgebung, jede religiöse Organisation muss verboten werden.‘ Und diese Forderung, die Leute per Befehl von oben in Atheisten zu verwandeln, ist unterzeichnet von zwei Mitgliedern der Kommune, die doch wahrlich Gelegenheit genug hatten, zu erfahren, dass erstens man ungeheuer viel auf dem Papier befehlen kann, ohne dass es darum ausgeführt zu werden braucht, und zweitens, dass Verfolgungen das beste Mittel sind, missliebige Überzeugungen zu befördern! So viel ist sicher: Der einzige Dienst, den man Gott heutzutage noch tun kann, ist der, den Atheismus zum zwangsmäßigen Glaubensartikel zu erklären ...“[7] [8]
Der Atheismus wird, der revolutionären Theorie zufolge, ja auch keinesfalls als der Weisheit letzter Schluss betrachtet: „Atheismus ist die Kritik des Himmels. Nötig ist die Kritik der Erde. Kritik der Religion heißt nicht Atheismus, sondern Wissenschaft. Der Atheismus ist „kritische Religion, ... letzte Stufe des Theismus, ... negative Anerkennung Gottes.“ [9] „Der Atheismus, als bloße Negation der Religion und stets sich auf Religion beziehend, (ist) ohne sie selbst nichts, und daher selbst noch eine Religion...“ [10]
Ein Jahr später wandte sich August Bebel, in einer flammenden Rede im Reichstag, gegen die Ausgrenzung und Verfolgung der Jesuiten im Deutschen Reich.[11] Ohne dabei irgendeinen Zweifel daran aufkommen zu lassen, dass seine Fraktion eine vollkommen gegensätzliche Weltanschauung vertritt als die Jesuiten. Bebel zeigte vielmehr die Gemeinsamkeiten zwischen den Jesuiten und deren Widersacher (den Liberalen) auf, mit denen er genauso wenig am Hut haben wollte. Rosa Luxemburg, die ja gemeinhin dafür bekannt ist, dass sie unter Freiheit auch die Freiheit der Andersdenkenden verstanden hat, verteidigte, in dem ihr eigenen pathetischen Stil, diese Haltung Bebels später noch einmal vehement: „Schließlich wollen die Sozialisten angeblich die Religion abschaffen! Wer diesem frechen Märchen glaubt, muß schon ziemlich dumm sein, denn niemand anderes schafft die Religion ab als so ein Bismarck und diejenigen, die zusammen mit ihm den Katholiken den Krieg erklärten. Die Sozialisten dagegen waren gerade aus diesem Grunde wie auch wegen anderer Gesetzwidrigkeiten die Todfeinde Bismarcks und seiner Kumpane und verkündeten immer und überall: Jeder halte an dem Glauben und an den Überzeugungen fest, die er für richtig erachtet, niemand hat das Recht, das menschliche Gewissen zu vergewaltigen! Der beste Beweis aber dafür, wie die Sozialisten jegliche Freiheit der Religion und der Überzeugungen verteidigen, ist, daß die Sozialdemokratie im Parlament jedesmal für die Rückkehr der Jesuitenpater nach Deutschland stimmt.“ [12]
Merkwürdig mag das klingen. Insbesondere dann, wenn man ein falsches Verständnis von Religionskritik hat, und in den religiösen Ideen und Empfindungen der Menschen an sich eine große Gefahr vermutet. So war die Haltung von Bebel und Luxemburg auch keineswegs unumstritten in der alten Arbeiterbewegung.
Bereits im 19ten Jahrhunderts formierte sich in den Zentren des Kapitalismus die internationale Freidenkerbewegung, welche sich vor allem in Deutschland, parallel zum allgemeinen erstarken der Arbeiterbewegung, rasch ausbreiten, und auf die Debatten unter den Proletariern durchaus Einfluss nehmen konnte. Zunächst als allgemeine Bewegung des organisierten Atheismus entstanden, spaltete sich die Bewegung der Freidenker, als Reaktion auf einen immer sichtbarer werdenden Widerspruch in der Gesellschaft, in einen bürgerlichen und einen proletarischen Flügel. Das Schicksal der proletarischen Freidenker war eng verknüpft mit ihrem Verhältnis zur SPD (später wahlweise KPD) und den Gewerkschaften. Wenn die proletarischen Freidenkerverbände sich zunächst auch an der allgemeinen religionskritischen Praxis der Arbeiterbewegung orientierten (Aufklärung über die Funktion des Klerus, Trennung von Staat und Kirche, Religion ist Privatangelegenheit usw.) ignorierten sie doch das Moment der Kritik des Atheismus. Vor allem ließen sie nicht zu, dass die alltägliche Kritik der Lebensbedingungen in den Vordergrund zu rücken hat. Statt dessen bissen sie sich fest in der Auseinandersetzung mit der religiösen Ideenwelt. Was ein recht aufwendiges, und meist sinnloses unterfangen ist. Man überzeugt keine Gläubigen dadurch, dass man sie und ihre Ideen bloß für falsch erklärt. Nicht zuletzt deshalb, weil religiösen Welt – und Menschenbildern eine gewisse Kohärenz nicht von vorn herein abzusprechen ist. Zudem ist es für Kommunisten wahrlich müßig sich auf Spekulationen über ein Jenseits, oder anderer weltabgewandter Inhalte der Religionen einzulassen. Die Freidenker fristeten in ihrem Kampf gegen die Religion dementsprechend schon bald ein relativ isoliertes Dasein. Was sie jedoch nicht darin hinderte ihre Exklusivität gegenüber dem „Rest“ der organisierten Arbeiterbewegung immer wieder zu betonen. Das war unübersehbar auch Ausdruck verletzter Eitelkeit gegenüber der Stiefmütterlichkeit von Seiten der Parteien und Gewerkschaften. Diese hatten den Kampf für die Veränderungen der wirklichen Lebensbedingungen aufgenommen, und behaupteten, selbst unter dem Vorzeichen des Kampfes um Reformen, und ganz im Sinne von Marx, die unbedingte Priorität des Klassenkampfes gegenüber den Kampf innerhalb der Welt der Ideen. Das Selbstverständnis des Freidenkertums verkümmerte, hinter der Selbstverständlichkeit der alltäglichen Klassenauseinandersetzungen, zur Scholastik.
Der linke Sozialdemokrat (später einer der wichtigsten Theoretiker des Linkskommunismus / Rätekommunismus), Anton Pannekoek, intervenierte in die Debatte um die Rolle der Freidenker innerhalb der Arbeiterbewegung. Anlass war die Forderung des Freidenkerverbandes, gegen die religiösen Arbeiter innerhalb der Sozialdemokratie vorzugehen. Indem er die Gedanken von Marx wieder aufgriff, wurde er bald zum erbittertsten Gegner des Freidenkertums. Weil jede Idee und jedes geistige Prinzip im Kern von ökonomischen Verhältnissen abhängen, erklärt Pannekoek: „Darum irrt der bürgerliche Materialismus....,wenn er Religion durch Aufklärung zu überwinden trachtet, ohne ihren ökonomischen Wurzeln zu Leibe zu rücken.“[13] Für die Sozialisten, so Pannekoek, existiere nur das Ziel der ökonomischen Umgestaltung der Gesellschaft. Darum „können wir uns vor Kraftvergeudung und vor dem überflüssigen und gefährlichen Verfolgen von Nebenzielen hüten. Dieses ist der Grund, warum in unserer Partei die Religion als Privatsache gilt.“[14] Pannekoek beschrieb die Freidenker als „Arbeiter, die durch die gesellschaftlichen Verhältnisse ungläubig geworden sind, denen aber das Licht des historischen Materialismus noch nicht aufgegangen ist....(die Freidenker) sind religionslos ohne mit der Religion fertig zu sein; sie stehen nicht mehr unter ihrer Gewalt, aber immer noch in ihrem Bann, denn sie sehen die Religion als eine gewaltige, selbstständige Macht an, die sie fürchten, und die daher mit Aufwand aller Kräfte bekämpft werden muß [15] Die Freidenkerverbände verloren ihre Bedeutung für das Proletariat, noch bevor die alte Arbeiterbewegung in der Niederlage ihres unmöglich gewordenen Reformismus, und des Scheiterns ihrer revolutionären Erhebungen nach dem 1. Weltkrieg, zerfiel. In ihrem Aufwand für einen ritualisierten und apologetischen Atheismus (Beweisführung gegen die Existenz Gottes, Kirchenaustrittskampagne, Feuerbestattung, Jugendweihe, usw.), der irgendwann einfach in die rechtlichen Normen und kulturellen Gepflogenheiten innerhalb des kapitalistischen Verkehrs einging, rieben sie sich auf und führten schließlich, bis heute, ein ganz normales, bürgerliches Vereinsdasein. Zu ihnen passt die Verkehrung ‚Religion ist Opium für das Volk’ eigentlich recht gut, da bei ihnen die Angst vor der Indoktrination stets im Vordergrund geblieben ist.
Ein kurzes Aufbegehren der Freidenker lässt sich nochmals feststellen, als die Bolschewiki, bereits bürgerliche Partei geworden, nach der Zerschlagung der Rätebewegung, und später unter Stalin, überall nach Verbündeten suchte und die ‚Bruderparteien’ zu allen möglichen Bündnissen und Kampagnen aufrief. So kam es, dass die Freidenker in Deutschland vorrübergehend von der KPD massiv hofiert wurden. Genauso schnell ebbte dieses Gebaren auch wieder ab. Es verhielt sich ähnlich wie bei den Schwankungen in der Bündnisfrage mit der SPD während der Weimarer Republik.
Während der Revolutionszeit greift Lenin in die Debatte über das Verhältnis der Bolschewiki zu den gläubigen Arbeitern ein. Er tut dies zwar grundsätzlich in Übereinstimmung und Kontinuität mit den Inhalten der kommunistischen Bewegung seit Marx, eine genauere Betrachtung seiner Position deckt jedoch bereits ein taktisches Verhältnis zu den gläubigen Arbeitern auf, welches eng zusammenhängt mit seinem Verständnis von der proletarischen Partei. So kommt er 1918 zu der Überzeugung, dass die Agitation die religiösen Gefühle der Gläubigen nicht verletzen dürfe, da das die Massen gegen die Partei einnehmen könnte.[16] Ein Jahr später, die Agitation war bereits in einem offenen Kampf gegen den Klerus umgeschlagen, weist er darauf hin, dass die forcierte „Zerstörung der Verbindung zwischen den Ausbeuterklassen und der Organisation der religiösen Propaganda“ auf die „Andersdenkenden“ Rücksicht zu nehmen habe, um einer möglichen „Stärkung des religiösen Fanatismus“ zuvorzukommen.[17] Man mag Lenins Haltung klug und folgerichtig finden. Es ist hier m. E. jedoch festzuhalten, dass dieses taktische Verhältnis zu den Gläubigen ein anderes Selbstverständnis verrät, als das nüchtern - distanzierte Verhältnis von Marx, Engels oder Pannekoek, oder gar das engagierte, leidenschaftliche von Rosa Luxemburg. Man mag sein eigenes Urteil darüber in die Sphäre der unterschiedlichen Persönlichkeiten dieser Revolutionäre verbannen, die letztlich in der politischen Bewertung zu vernachlässigen ist. Verfolgt man jedoch die Geschichte der Bolschewiki und ihrer Einflussnahme auf den revolutionären Prozess, dann kann einem der Verdacht kommen, dass hinter dieser Taktik ein Menschenbild verborgen ist, das die „Massen“ nicht aufzurichten, sondern abzurichten trachtet, da es ohnehin deren Bürde zu sein scheint, zu ihrem eigenen Wohl und Werden, belehrt, behütet und geführt, in einem Wort, konditioniert zu werden. Auch hierhin gehört die Denkweise, das Religion Opium für das Volk ist. Der „Stoff“, von dem die Kommunisten die Arbeiter bewahren, bzw. entgiften und entwöhnen müssen. Zuweilen behutsam, zuweilen mit Druck. Und eben nicht das „Opium des Volkes“, von dem das revolutionäre Proletariat sich selbst befreit, indem es sich zu sich selbst befreit. Der Unterschied Lenins gegenüber den Freidenkern (und auch gegenüber den Anarchisten – in dieser Frage) besteht aus meiner Sicht lediglich darin, dass er nicht wie diese in Torschlusspanik verfällt. Wenigstens nicht in Zeiten mächtiger revolutionärer Erhebungen. Die Verfolgungen in der Sowjetunion gegenüber allen Andersdenkenden, unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zu einer gesellschaftlichen Klasse, sollten aber schon bald folgen und ein grausames Gesicht annehmen.
Die Auseinandersetzung im proletarischen Lager über den Umgang mit Andersgläubigen ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass es, selbst in Zeiten revolutionärer Klassenkämpfe, bisher immer auch ein religiöses Empfinden, begleitet von allerlei religiöser Ideen, auch, und gerade unter den Arbeitern, gegeben hat. Eine Tatsache, die ungeduldige Genossen beunruhigen muss.
Die kommunistische Bewegung geht selbstverständlich nicht davon aus, dass die religiösen Bedürfnisse etwa natürlicher Art seien, und von daher determiniert. Sie sind aber auch nicht bloß konditioniert / indoktriniert. Sie sind viel mehr das Resultat sozialer Verhältnisse. Sie kennzeichnen ein allgemeines Unbehagen, und eine gewisse Bewusstlosigkeit der Menschen gegenüber den Verhältnissen in denen sie Leben müssen, und welche sie selbst gestalten. Da dies nicht aus freien Stücken geschieht ist das Unbehagen dem Menschen in der Klassengesellschaft immanent. Religion bedeutet deshalb für die Individuen zugleich Verdrängung ihrer Lebensverhältnisse, sowie einen inneren Widerstand gegen diese Lebensverhältnisse. Religionsausübung ist insofern auch eine Form von Anpassungsleistung, wie sie zugleich eine Form von Abgrenzung ist. Man kann sagen, Religion ist eine notwendige Erscheinung in der Welt der Notwendigkeit. Religion ist die Neigung zum Absoluten in einer Welt der Halbheiten. Umgekehrt ist sie auch eine Halbheit in der Absolutheit der Verhältnisse. Im Glauben entfernt sich das Individuum von einer Welt, die sich längst von ihm entfernt hat. Das entrücken in die Illusion ist für so manches Individuum somit auch schlicht der Selbstschutz vor der Verrücktheit, dem geistigen und psychischen Crash. Es kann nicht darum gehen den Sinn oder Unsinn religiöser Ideen zu diskutieren, sondern die wirkliche Entfremdung der Produzenten von ihren Produkten, und ihre damit zusammenhängenden (warenförmigen) sozialen Beziehungen zu untersuchen, um eine Einsicht in die religiösen Bedürfnisse und in alle Formen der Identifizierungsbemühungen innerhalb des Kapitalismus zu bekommen. Identifizierung ist überlebenswichtig, weil der Kapitalismus uns täglich und stündlich die Identität abspricht. Religion, Ideologie überhaupt, braucht den Arbeitern also nicht ‚eingespritzt’ werden. Denn wenn sie dieses ‚Gift’ einmal haben, finden sie ihre Venen ganz von selbst. Hinter einem religiösen Bekenntnis steckt eine Entscheidung. Mag diese Entscheidung auch Zwanghaftes haben, so ist sie noch längst kein Zwang. So kann auch kein Zwang die Religion überwinden, sondern nur eine Entscheidung.
Die Funktion der Religion für das Kapital
Man muss der IKS gerecht werden. Darum ist es unumgänglich deren Resümee im besagten Artikel an dieser Stelle zu dokumentieren:
„Diese (Mohamed) Karikaturen sind in Wirklichkeit zu Kriegswaffen in den Händen der bürgerlichen Klasse in den islamischen Staaten geworden. Sie stellen somit eine Reaktion auf die immer aggressiver werdende imperialistische Politik der USA, Frankreichs, Deutschlands und Englands dar. ..Bei einer Bevölkerung, die in ein immer größeres Elend gestürzt wird und immer mehr unter dem Krieg leidet, fällt es der Bourgeoisie leicht, bei der Verfolgung ihrer imperialistischen Interessen, durch Manipulationen zynisch zu täuschen. Diese gewalttätigen Massenproteste mit einer wachsenden Zahl verzweifelter entstehen nicht einfach so "spontan" oder "natürlich". Sie sind das Ergebnis einer regelrechten Kriegspolitik, einer Politik der Aufstachelung zum Hass, der nationalistischen ideologischen Mobilisierung durch alle Bourgeoisien auf der Welt.“[18]
Die besagten Karikaturen sind mittels der bürgerlichen Propaganda, der Medien der ganzen Welt, zu Kriegswaffen des Imperialismus geworden. Der o. g. Artikel geht deshalb auch mit Recht ausführlich auf den Begriff der sog. Pressefreiheit ein. Er hebt die gegenwärtige Funktion des islamischen Fundamentalismus für die Herrschenden, für alle am Konflikt beteiligten Fraktionen der Bourgeoisie hervor, und betont zugleich den dialektischen Zusammenhang zwischen dem Elend der Bevölkerung dieser Region, und einem sich daraus entwickelnden Bedürfnis (aus Verzweiflung), dieser Ideologie zu folgen. Darum soll die Bedeutung der Schlussfolgerung, welche die Genossen hier ziehen, auch keinesfalls bestritten oder geschmälert werden. Es geht hier nicht darum zu leugnen, dass Religion (Ideologie) in der Klassengesellschaft die Funktion hat, „die Bewusstwerdung der Arbeiterklasse zu verhindern.“ Selbstverständlich hat sie das! Und sie hat das nicht nur im Kapitalismus gegenüber dem Proletariat, sondern zuvor schon in allen Klassengesellschaften, gegenüber jeder unterdrückten Klasse gehabt. Einfach indem sie die Bewusstwerdung unzähliger Menschen blockiert. Und die Herrschenden setzen die religiösen Gemeinschaften, im Rahmen ihrer psychologische Kriegsführung, zielgerichtet ein. Weil sie um die Verzweiflung wissen!
Das Proletariat hat bislang die Religionen nicht überwinden können/wollen, es hat diesen gelegentlich nur eine andere Prägung verliehen. Die religiösen Ideen kamen in den Klassenkämpfen meist in ihrer Eigenschaft als (falscher) Protest zum Tragen. Von den Sklavenaufständen in Rom bis zu den Arbeiterkämpfen auf der Leninwerft. Noch mal Marx: „Der religiöse Widerschein der wirklichen Welt kann überhaupt nur verschwinden, sobald die Verhältnisse des praktischen Werktagslebens den Menschen tagtäglich durchsichtig vernünftige Beziehungen zueinander und zur Natur darstellen. Die Gestalt des gesellschaftlichen Lebensprozesses, d. h. des materiellen Produktionsprozesses, streift nur ihren mystischen Nebelschleier ab, sobald sie als Produkt frei vergesellschafteter Menschen unter deren bewusster planmäßiger Kontrolle steht.“[19]
Nehmen wir an, dass die europäische Arbeiterbewegung im 19ten und frühen 20ten Jahrhundert, durch Studium und Reflektion der revolutionären Theorie, sich scharenweise eine nüchterne Sicht auf ihr Leben aneignen konnte. Dann könnten wir eine Aussage von Engels in diesem Zusammenhang als das folgerichtige Resultat zeitgemäßer Beobachtung stehen lassen:„Atheist zu sein, ist heutzutage glücklicherweise keine Kunst mehr. Der Atheismus ist so ziemlich selbstverständlich bei den europäischen Arbeiterparteien... Sie sind mit Gott einfach fertig, sie leben und denken in der wirklichen Welt und sind daher Materialisten.“[20] Auf das „Hier und Jetzt“ bezogen, ist diese Aussage kaum brauchbar. Für die Mehrheit des Weltproletariats traf das mit Sicherheit schon damals nicht zu. Nicht einmal für die Mehrheit der europäischen Arbeiter. Zudem haben die schweren Niederlagen, denen das Proletariat in den letzten 150 Jahren immer wieder ausgesetzt gewesen ist, auch stets zu einem Rückfluss (manchmal über Generationen hinweg) in dessen Selbstbewusstsein beigetragen. Ganz zu schweigen von den sog. unterentwickelten Gebieten der Welt, in denen die Religion unter den Arbeiter extrem präsent ist (z.B. Lateinamerika), wirkt die Religion auch in den Zentren des Kapitals nach wie vor enorm auf die (bewussten und unbewussten) Emanzipationsbestrebungen des Proletariats als Blockade zurück. Man denke nur an den stark verankerten Einfluss des Katholizismus in Ländern wie Irland, Italien, Polen. Allesamt zugleich Regionen mit einer starken Tradition von Klassenkämpfen. Und gerade die polnischen Arbeiter, denen es immerhin gelungen ist so kraftvoll in die Geschichte einzugreifen, dass sie einen epochalen Wandel in der Weltpolitik einleiten konnten, besiegelten ihre tragische Funktion für den historischen Kurs des Kapitals im Kniefall vor dem Papst. Tatsächlich hat die Religion hier ihre volle Kraft für die Klassengesellschaft entfalten können. Und sie tut dies täglich aufs neue. Der sog. Nah-Ost-Konflikt zeigt uns die grauenvolle gegenseitige Durchdringung von Akkumulationszwang, militärischer Eigendynamik, kapitalistischer Irrationalität und religiöser Ideologie, die sich in Terror und Krieg entlädt. In diesem Konflikt zeigt sich zudem deutlich, dass die Bourgeoisie mindestens ebenso wenig Herr der Lage ist wie das Proletariat. Wir befinden uns in Zeiten, in denen die Zustände den Bedarf an Illusion, wie wohl kaum jemals zuvor in der Geschichte des Kapitalismus, in allen Klassen der Gesellschaft im gigantischen Ausmaß provozieren. Diese Zustände verlangen der kommunistischen Bewegung große Mühen ab, um einen kühlen Kopf zu bewahren. Es wäre geradezu fatal, wenn die Kommunisten jetzt beispielsweise damit beginnen würden, nach Ausgangspunkten für den Terror in den religiösen Ideen des Islam zu suchen. Ausnahmslos jede Religion kann ihrem Wesen nach den gleichen Zweck erfüllen, welchen jetzt der Islam inne hat. Weil sie eben immer zugleich Ausdruck des Elends und des Protestes ist, und sich daher funktionalisieren lässt.[21]
Die Deutungsweise religiöser Ideen ist abhängig vom sozialen und historischen Kontext, indem die Deutung vorgenommen wird. Religion ist für sich genommen weder schlecht noch gut. Religion ist schlicht politische Religion - oder gar nichts. Entscheidend für die kommunistische Bewegung ist es, den historischen und politischen Kontext zur Kenntnis zu nehmen, indem Religion ausgeübt wird. Heute: Das Kräfteverhältnis zwischen Bourgeoisie und Proletariat, welches sich in einer Art Patt-Situation befindet. Der Bourgeoisie mangelt es gegenwärtig noch an den Voraussetzungen ihre Lösung der generalisierten Krise des Wertes durchzusetzen: Einem erneuten generalisierten Krieg. Dem Proletariat fehlt es seinerseits an den Vorraussetzungen für seine Lösung: Die soziale Revolution. Die Welt befindet sich in einem Zustand der Implosion. Sie droht in Chaos und Barbarei zu Versinken. Vor diesem Hintergrund ist die Ausdehnung des religiösen Fanatismus aller Couleur vorerst kaum zu vermeiden. Der Islamismus ist bloß ein Gespenst, welches die Bourgeoisie gerufen hat, und nicht mehr los wird. Zu ihrem kurzlebigen Vorteil. Denn als eine Religion des Volkes, als verkehrte Protestation gegen das wirkliche Elend, wird der Islam zur Waffe der Herrschenden. Wie sich aber deutlich abzeichnet, haben die Herrschenden kaum die vollständige Kontrolle über ihre Waffen. Ein Verhältnis also, welches die Krise des Kapitals nur noch beschleunigen kann. Die Kommunisten sind davon überzeugt, dass es sich um einen durch und durch falschen Protest handelt, und das der Islam, wie jede andere Religion im Kapitalismus, letztlich eine antiemanzipatorische, gegen das Proletariat gerichtete geistige Strömung bleibt. Man soll das ruhig auch radikal benennen. Wichtiger ist jedoch auszusprechen, wie wir in der Wirklichkeit des Kapitalismus, unabhängig jedweder Ideologie, tatsächlich leben (müssen), und warum das so ist.
Die Entwicklung der Religion im Kapitalismus
Der Fundamentalismus, welcher als Tendenz in allen alten Religionen gegenwärtig wieder deutlich zum Vorschein kommt, ist der Reflex auf den unaufhaltsamen Niedergang der postulierten Ideale dieser Religionen. Er kommt zum Ausdruck als Aufschrei gegen das, was das „Volk“ und seine politische Kaste als ‚Verlust ihrer Werte’ beklagen. Der empfundene Verlust sog. moralischer Werte, welche nur noch in den Religionen aufbewahrt scheinen, ist in Wirklichkeit Ausdruck einer zunehmend spürbaren Irrationalität des warenförmigen Verkehrs unter den Menschen. Der Verlust der Werte ist der Ausdruck des Niedergangs der Wertegesellschaft selbst, die zugleich sich ständig in der Religion rechtfertigen, und daher sich ihrer bedienen muss. Religion ist zum Ausdruck eines auf globaler Ebene implodierenden Gesellschaftssystems geworden, welches für die überwiegende Mehrheit der Menschheit schon längst keinerlei Zukunftsperspektive mehr zu bieten hat. Viele Menschen räumen darum gedanklich, verständlicherweise, der Hoffnung auf eine Zukunft im Jenseits mehr Platz ein, als der Gewissheit ihrer Perspektivlosigkeit im Diesseits.[22]
Die gewaltige Rückkehr des Religiösen, sei es im Wiedererstarken des Fundamentalismus der alten Religionen - oder im Voranschreiten der Privatisierung und Individualisierung der Religion auf den spektakulären Märkten der Esoterik und des Okkultismus in den Metropolen, ist im niedergehenden Kapitalismus nicht mehr bloß der Heiligenschein eines Jammertals, sie ist zum Flutlicht beim Tanz auf dem Vulkan geworden.
Die revolutionäre Theorie hob seinerzeit die Bedeutung des Protestantismus für die Entfaltung des Kapitals hervor: „Luther hat allerdings die Knechtschaft aus Devotion besiegt, weil er die Knechtschaft aus Überzeugung an ihre Stelle gesetzt hat. Er hat den Glauben an die Autorität gebrochen, weil er die Autorität des Glaubens restauriert hat. Er hat die Pfaffen in Laien verwandelt, weil er die Laien in Pfaffen verwandelt hat. Er hat den Menschen von der äußeren Religiosität befreit, weil er die Religiosität zum inneren Menschen gemacht hat. Er hat den Leib von der Kette emanzipiert, weil er das Herz an die Kette gelegt hat.“ [23]
„Für eine Gesellschaft von Warenproduzenten, deren allgemein gesellschaftliches Produktionsverhältnis darin besteht, sich zu ihren Produkten als Waren, also als Werten, zu verhalten und in dieser sachlichen Form ihre Privatarbeiten aufeinander zu beziehen als gleiche menschliche Arbeit, ist das Christentum mit seinem Kultus des abstrakten Menschen, namentlich in seiner bürgerlichen Entwicklung, dem Protestantismus, Deismus usw. die entsprechendste Religionsform.“ [24] „Der Protestantismus spielt schon durch seine Verwandlung fast aller traditionellen Feiertage in Werktage eine wichtige Rolle in der Genesis des Kapitals.“ [25]
Max Weber hat den Beitrag des Protestantismus zur Genesis des Kapitals wohl als erster ausführlich untersucht und in bemerkenswerter Weise dargelegt [26] Ich möchte mich an dieser Stelle umgekehrt mit dem Einfluss des Kapitalismus auf die Religionsausübung auseinandersetzen. Im Kontext der Entwicklung des Kapitalismus in seinen Zentren soll daher im Folgenden die Abhängigkeit der religiösen Ideen vom Lauf der Geschichte skizziert werden. Die Genese der Religionen im Kapitalismus.
Das erfolgreiche Aufbegehren des Protestantismus gegen das Glaubensmonopol des Vatikan hatte einen keinesfalls beabsichtigten Nebeneffekt zur Folge, welcher bereits den allgemeinen Zerfall des alten (feudalen) religiösen Gemeinwesens begleiten sollte, und nun den allgemeinen Zerfallsprozess des Monotheismus unter der Herrschaft des Kapitals begleitet. Das religiöse Sektierertum.
Die Übersetzung[27] und anschließende, massenhafte Verbreitung der „Heiligen Schrift“ – möglich geworden durch die Erfindung des Buchdrucks – begünstigte das Aufkommen allerlei protestantischer Sekten und sog. Hauskreise, die nicht bereit waren, sich den großen protestantischen Gemeinden[28] unterzuordnen, und statt dessen ein reges Eigenleben entwickelten. Während und nach den Religionskriegen in Europa[29] brachen die Widersprüche zwischen den autonomen Gemeinden (Sekten) und den Großkirchen immer wieder offen aus. Das beschleunigte jedoch nur deren Ausbreitung. Die Verfolgung der Sektierer in Europa führte u.a. zu einer Massenflucht ihrer Anhänger in die Kolonien, in denen sie sich z. T. gigantisch ausbreiten konnten. Die Verfolgung und Zerstreuung sorgte zudem für eine ständige Umgruppierung der Sektierer, in dessen Verlauf es zu unzähligen Neugründungen von Gemeinden kam. Ähnliche Beobachtungen lassen sich auch unter den Anhängern der jüdischen Religion, des Buddhismus und des Islam machen. Allerdings längst nicht in dem Maße wie im Christentum, speziell in seiner protestantischen Variante.
Wohl schuf die Reformation Voraussetzungen für den Geist des Pluralismus, aber sie konnte den Absolutismus nicht überwinden, der nach wie vor als Hemmnis gegen die ideologischen, ökonomischen und politischen Bestrebungen des Bürgertums auftrat. Dazu bedurfte es neuer Weltbilder. Diese stellten Philosophen, Künstler und Wissenschaftler im niedergehenden Feudalismus zur Verfügung. Die Zeit der Reformation wurde bereits begleitet von einem Aufbegehren in der Wissenschaft und der Kunst, welche eine Wiederkehr (Renaissance) antiker Welt-, und Menschenbilder in Europa begünstigte. Diese Geisteshaltung konnte sich jedoch erst nach dem 30jährigem Krieg ungehemmt entfalten, und ging dann unter dem Begriff ‚Aufklärung’ in die Geschichte ein. Die Aufklärung, in Deutschland vor allem die Lehre der Vernunft von Kant, schaffte die Grundlage der Weltanschauung des aufstrebenden Bürgertums und der modernen Zivilisation. Dabei war die Aufklärung ihrem Wesen nach keineswegs antireligiös, auch wenn sie sich gegen die weltliche Macht der Kirche und ihrer Definitionsgewalt im Absolutismus entwickelte. Als die Bourgeoisie in der Französischen Revolution von 1789 die Macht an sich riss, rief einer ihrer Führer, Robespierre, vor der französischen Nationalversammlung: „Zepter und Weihrauchfass haben sich verschworen, um den Himmel zu entehren und die Erde zu usurpieren.“ Für ihn war die Revolution die „Wiederaufrichtung des wahren Gottesdienstes“ („culte de l`être suprême“).[30]
Die Funktion der Aufklärung für das Kapital bestand u. a. auch darin, ihre Wirkung zu entfalten, um die im Feudalismus schlummernden Produktivkräfte (unterschlagene, verbotene und verfolgte Erfindungen, Erkenntnisse und Entdeckungen) zu entfesseln, welche durch die Ständegesellschaft und die klerikalen Dogmen gehemmt wurden. Die Entfesselung der Produktivkräfte und die Durchsetzung der Handelsfreiheit konnten sich keinerlei ideologische Einschränkung durch die feudale Gesellschaft mehr leisten. Folgerichtig deklarierte die Revolution die rechtliche Verbriefung der Religionsfreiheit. Mit den Worten: „..la libertê de tous les cultes“ wurde die Religionsfreiheit in der französischen Verfassung als positives Recht aufgenommen. Das Ganze geht einher mit der allmählichen Trennung von Staat und Kirche. Im selben Jahr findet ein entsprechendes Dekret Einzug in die Verfassung der Vereinigten Staaten. Durch die Macht der Sektierer in den USA war eine Trennung von Staat und Kirche bereits zuvor gegeben. Bemerkenswerterweise taucht dieses Recht in Deutschland erstmals mehr als hundert Jahre später auf. Nämlich in der Weimarer Verfassung von 1919 (Art. 135,137), also infolge einer (verlorenen) proletarischen Revolution. Bekanntlich ist die Trennung von Staat und Kirche hierzulande jedoch immer noch nicht vollzogen worden. Erst 1948 wird die Religionsfreiheit schließlich durch die Vereinten Nationen zum Menschenrecht erklärt. Marx beurteilte solcherlei Maßnahmen seinerzeit als Vorraussetzung für die Emanzipation von der Religion. („...wie der Staat sich von der Religion emanzipiert, indem er sich von der Staatsreligion emanzipiert, innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft aber die Religion sich selbst überlässt, so der einzelne Mensch sich politisch von der Religion emanzipiert, indem er sich zu ihr nicht mehr als zu einer öffentlichen Angelegenheit, sondern als zu seiner Privatangelegenheit verhält.“ [31]) Zu vorschnell, wie sich noch herausstellen sollte.
Ermuntert durch die Religionsfreiheit breitete sich das Sektierertum indes weiter aus. Als Reflex auf den Wiederspruch zwischen dem geistigen Fortschritt der Aufklärung und dem erlebten Elend der Massen im Frühkapitalismus, nahm das Sektierertum eine ungeahnte Vielfalt an, und neigte zunehmend zum Fanatismus. Die Sekten erfassten vor allem die ländliche Bevölkerung, genossen jedoch auch großes Ansehen im Proletariat, da das Proletariat sich zunächst ja hauptsächlich aus den „Landflüchtigen“ rekrutierte. Zugleich entfaltete sich eine neue religiöse Strömung in der Gesellschaft, welche bereits unter den Bedingungen des Feudalismus entstanden war, und sich im engen Zusammenhang mit der Aufklärung entwickelt. Es konstituierte sich eine Bewegung von geheimen religiösen Männerbünden gegen den Klerus in Europa und Nordamerika, die unter der Bezeichnung ‚Freimaurer’ bekannt geworden sind. Angelehnt an das Bild des schöpferischen Gottes (Handwerkergott) des Christentums, unter der Parole ‚hilf dir selbst, dann hilft dir Gott’, verstanden sie es den Erfordernissen der Zeit gerecht zu werden. Es gelang ihnen, antike Philosophien, christliche Gnosis und die Erkenntnisse der Naturwissenschaft unter einen Hut zu bringen. Die Freimaurer fühlen sich der Aufklärung und dem Humanismus verpflichtet. Die Freimaurerlogen waren/sind religiöse Zufluchtsorte der Bourgeoisie und Eng verknüpft mit dem Deismus (dem allgemeinen, nicht konkretisierten Glauben an ein höheres Wesen). Ihr konspiratives Handeln war zunächst der Verfolgung unter dem Feudalismus geschuldet. Es diente jedoch von Beginn an auch dem Zweck der Vorteilsnahme und der Machtausübung. Die ‚Geheimlehre’ und die geheimen Rituale der Freimaurer wurden zu Geburtshelfern der modernen Esoterik.[32] Sie selbst wurden zum Mythos. Die Freimaurer unterlagen jedoch, selbstverständlich, der bürgerlichen Konkurrenz. So kam es bald zu Spaltungen innerhalb ihrer Logen. Interessierte Menschen, welche keinen Zugang zu den Freimaurerlogen hatten, gründeten zudem autonome Logen und Orden. Somit erlitt die vorerst in einem gemeinsamen Orden (Großloge) organisierte Bewegung der Logen das gleiche Schicksal wie der Protestantismus, indem sie sich (mehrfach) spaltete und an ihren Rändern immer mehr atomisierte. Genau wie der Protestantismus, ging die Bewegung der Logen jedoch an ihren Spaltungen nicht zugrunde, sondern sie veränderte lediglich ihre Daseinsform.
Ein weiterer Fakt beeinflusste die Religionsausübung in den Zentren des Kapitals. Die Ausdehnung des Weltmarktes. Missionare und Kolonialisten sahen sich in den eroberten Regionen mit religiösen Vorstellungen konfrontiert, welche an antike, oder gar vorgeschichtliche Religionsvorstellungen in Europa erinnern. Ihre Bemühungen, den ‚Eingeborenen’, unterdrückten Völkern das Christentum aufzuzwingen, hatten jedoch nur teilweise Erfolg. Umgekehrt, mit Hilfe der Missionare und Händler zeigten die regionalen Religionen sogar Rückwirkung auf die Entwicklung der Religion in den Zentren des Kapitals. Zwei Beispiele sollen das verdeutlichen.
Im Zuge der Eroberungen des afrikanischen und des amerikanischen Kontinents, und dem damit zusammenhängenden Sklavenhandel, konnte sich ein Synkretismus entwickeln, welcher bald eine beispielhafte Eigendynamik entfalten konnte, und sich bis heute erhalten hat. In Westafrika stießen die Kolonialisten auf ein Volk, die Yoruba, deren Kultur sich in einem Übergangstadium von der Stammesgesellschaft in eine Klassengesellschaft befand.[33] Dies schlug sich nieder in ihrer Religion, die Ifa, die jede Menge Rituale und Ideenfragmente einer Naturreligion in sich bewahrt hatte, zugleich aber über einen patriarchalisch geordneten Götterhimmel (Orixas) verfügte, wie wir ihn etwa aus dem antiken Griechenland kennen. Die christlichen Missionare stießen zunächst auf das Gehör der Yoruba. Diese waren sensibel genug, um erstens zu erkennen, dass das Christentum im Ursprung eine Sklavenreligion ist. D. h., sie erkannten in den Botschaften der Bibel, aufgrund ihres eigenen Schicksals, welches ihnen die Kolonialherren beschert hatten, die Widerspiegelung ihres Sklavendaseins. Zum zweiten waren sie in der Lage die katholischen Heiligen umgehend in ihren Götterhimmel zu integrieren. Da sie selbst bereits über einen Schöpfergott verfügten, welcher allerdings eine andere Rolle spielt als im Monotheismus, konnten sie auch den christlichen Gott auf ihre Weise assimilieren. In der Sklavendiaspora Amerikas nahm dieser Synkretismus zwar unterschiedliche Ausformungen an, konnte sich in seinem Wesen aber erhalten und zur eigenständigen Religion entwickeln. Neben Westafrika gelten vor allem die Karibik, Brasilien und die Südstaaten der USA als stärkstes Ausbreitungsgebiet der Ifa, die hier regionale Ausprägungen gefunden hat. Diese sind bekannt unter Namen wie Voudou ( Haiti, Dom. Rep.), Santeria (Kuba, Columbien) Hoodoo (USA) und schließlich Macumba und Candomble (Brasilien). In den 90er Jahren des 20ten Jahrhundersts erklärte der westafrikanische Staat Benin die Ifa, unter der Bezeichnung Voudoun, zur Staatsreligion und bemüht sich seither um die Errichtung einer Weltkirche. Die moderne Ifa übt noch immer einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die westafrikanischen, afroamerikanischen und afrokaribischen Proletarier aus.[34] Mit der Migrationbewegung lateinamerikanischer und afrikanischer Arbeiter, und der zunehmenden Beliebtheit karibischer Kultur in hiesigen Gefilden, bildeten sich in den letzten 20 Jahren auch in Europa (vor allem in Frankreich, England und Deutschland) Gemeinden dieser Religion, die längst auch Anhänger unter der einheimischen Bevölkerung gefunden hat. Meistens unter dem Dach von Kulturvereinen und Musikschulen. Europa wird für die Ifa damit zunehmend zum Ort ihrer ideellen Wiedervereinigung.
Besonders nachhaltigen Einfluss auf den Zerfallsprozess des christlichen Dogmatismus in Europa übte der Handel mit China und Indien aus. Christian von Wolff (Prof. für Völkerkunde) sprach in einer berühmt gewordenen ‚Chinesenrede’, gehalten vor Kaiser Friedrich Wilhelm I. und Vertreten des Handels und der Industrie, die Frage offen aus,...ob nicht auch die Religion, die diese (Chinesische) Kultur geprägt hat, den Christen in Europa etwas zu sagen habe.“ [35] Der Gedanke, Vernunft und Religion im Einklang zu sehen, wurde durch die Weltbilder von Buddha, Lao Tse und Konfuzius bestätigt. Zugleich verbarg sich hinter einer längst etablierten Modeerscheinung, der Vorliebe für ‚Chinoiserien’, die Anerkennung des Eigenwertes einer außereuropäischen Kultur, von der sogar die Europäer, die sich bis dahin als die maßgebliche Kulturgemeinschaft gefühlt hatten, in Kunst, Handwerk, und Lebensstil etwas lernen konnten.[36] Und wieder war ein Anlass dafür gegeben, dass neue Glaubensgemeinschaften wie Pilze aus den Boden schießen konnten, welche sich gegen Ende der Blütezeit des Kapitalismus, um die Jahrhundertwende, allmählich als fester Bestandteil europäischer Religionsausübung etablieren konnten.
In diesem Kontext bekommt die Theosophie, deren Lehre sich zu Beginn stark aus den Ideen des Hinduismus und tibetischen Buddhismus speist, eine herausragende Rolle. Geistiges Oberhaupt der internationalen theosophischen Gesellschaft war die Russin Helena P. Blavatski, deren erstes Werk „Ises entschleiert“ bereits 1877 in vielen Sprachen übersetzt wurde und weltweit großes Aufsehen erregte. 1888 schloss sie ihre Arbeit, mit ihrem umfangreichen Hauptwerk (4. Bände), „Die Geheimlehre“ ab. Die Schriften und das Wirken Blavatskis und der Theosophen gelten bis heute als Grundlage der meisten esoterischen, und okkulten Gemeinden in der Welt. Bemerkenswert ist zudem, dass sich aus div. Spaltungen der Theosophischen Gesellschaft, die zunächst nach dem Vorbild der Freimaurerlogen organisiert war, drei weitere einflussreiche Strömungen herauskristallisieren konnten.
Die Anthroposophen unter Rudolf Steiner. Diese nehmen bis heute einen enormen Einfluss auf die Pädagogik des Kapitals. Also auch auf gängige Menschenbilder. Sie verfügen über einen spirituellen Insiderzirkel, der Christengemeinschaft, sowie über eigene Schulen, Lebensmittelkonzerne (Demeter, Propolis, Weleda..) eine Bank (GLS-Bank) und eine politische Lobby.
Die Krishnamurti Bewegung. Durch diesen Flügel der Theosophie etabliert sich bereits im 19ten Jh. zum ersten mal die Verehrung eines indischen Gurus, dem jungen Krishnamurti, durch vorwiegend europäischer Anhänger.
Der Ordo Templi Orientis (OTO). Ein zunächst stark theosophisch orientierter Geheimbund, welcher sich, unter der Führung des Magiers und Yogalehrers, Aleisther Crowly, autonom entwickelt. Crowly’s, in unzähligen Schriften zusammengefassten, spirituellen Ideen bilden den Grundstein für das, was man den modernen Satanismus nennt. Darüber hinaus sind seine umfangreichen Ideen und Praktiken in zahlreichen okkultistischen und esoterischen Zirkeln bis heute gegenwärtig.[37]
Eine weitere Strömung der Theosophie wird schließlich zum unmittelbaren Vorläufer der nationalsozialistischen Ideologie. Die Ariosophie, welche ein gewisser Guido von List sich erdacht hat, und dessen Ideen schließlich von Alfred Rosenberg, Rudolf Heß, sowie dem Astrologen Rudolf von Sebottendorff, in der sog. Thule-Gesellschaft ausformuliert wurden.[38]
Der Nationalsozialismus hemmt in Deutschland vorübergehend die freie Entfaltung der religiösen Ideen, in dem es ihm zum einen gelingt, diese seiner eigenen Ideologie einzuverleiben, zum anderen in dem er dazu übergeht, die religiöse Protestation zu unterjochen, zu ersticken, zu verfolgen und zu vernichten. Es kann hier jedoch, aus Platzgründen, nicht weiter auf die Bedeutung der Religiosität im Nationalsozialismus eingegangen werden, da m. E., jeder Versuch einer kurzen Zusammenfassung von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, und dem wirklichen Verständnis dieses besonderen Zeitraums eher entgegenwirken würde. Vom reinen Standpunkt der politischen Ökonomie aus betrachtet, kann man vielleicht noch hinzufügen, dass der Eingriff des Nationalsozialismus in den religiösen Markt in gewisser Weise den allgemeinen Charakter der Nationalökonomien dieser Zeit spiegelt: Staatliche Disziplinierung und Regulierung der Wirtschaft in allen Bereichen, zur Vorbereitung und Durchführung eines imperialistischen Krieges.[39]
Etwa seit Beginn der 20er Jahren des 20ten Jahrhunderts, nachdem der Kapitalismus zuvor in seine andauernde und quälende Niedergangsperiode eingetreten war, finden wir ein Phänomen vor, welches es nie zuvor in der Geschichte der Menschheit gegeben hat: Die Herausbildung eines religiösen Marktes. Eines Marktes der Religionen.[40] Die oben beschriebene Vielfalt der möglichen Religionsausübung traf auf ein Klima beschleunigter Individualisierung, verursacht durch eine enorme Umstrukturierung der Industrie, eine durch den 1. Weltkrieg demoralisierte und traumatisierte Bevölkerung, ein geschlagenes, nach der Niederlage der Revolution all seiner Hoffnungen beraubtes und sich zurückziehendes Proletariat, ein deklassiertes, bzw. im Zerfallsprozess befindliches, völlig verunsichertes Kleinbürgertum, welches zugleich mit den Illusionen eines vorübergehenden wirtschaftlichen Aufschwungs ausgestattet war („goldene“ 20er Jahre). In diesem Klima gärt das Verlangen nach Identifikationsmöglichkeiten, nach Einordnung komplizierter Verhältnisse, also nach Vereinfachung, nach Unmittelbarkeitserfahrungen und Glücksmomenten, also nach Geborgenheit und Bindung, nach geistiger Bestätigung der Illusionen. In einem Wort: Nach aufgehoben[41] sein, also nach Spiritualität und Religion. Eine ausgedehnte okkultistische Modewelle, hauptsächlich in England, Frankreich, Deutschland und den USA, sowie eine spirituelle Jugendbewegung[42] setzten als fröhliche Kundschaft die neue Vielfältigkeit der „frohen Kunde“[43] alsbald in Massenkonsum um. Die kommerzielle Verwertung der moralischen Werte war entfesselt. Der beklagte Verlust der moralischen Werte im Kapitalismus, auch das wird hier deutlich, ist darum u.a. auch als das Resultat ihrer eigenen Verwertung zu begreifen.
Damit hat sich leider auch die Hoffnung der kommunistischen Bewegung, dass die Religionsfreiheit, die Trennung der Religion vom Staat und die Privatisierung der Religion, als Beschleuniger bei der Aufhebung derselben wirken, vorerst leider als trügerisch und falsch erwiesen. Im Gegenteil. Die religiösen Bedürfnisse, sowie die Möglichkeiten für deren Auslebung, haben sich auf geniale Weise den Erfordernissen des Kapitals untergeordnet und angepasst.
Heute sind ausnahmslos alle Konfessionen zu Anbietern von Glaubensartikeln geworden. Vom Katholizismus bis zum spirituellen Workshoptherapeuten. Nicht zuletzt deshalb, weil hinter allen auch ganz normale kapitalistische Wirtschaftsunternehmen stecken. Es gibt Globalplayer (Vatikan), sowie national, bzw. territorial begrenzte Konzerne (alle sog. Weltreligionen), welche ständig darum bemüht sind, sich auf dem Weltmarkt eine bessere Ausgangsposition zu verschaffen. Es gibt den gehobenen Mittelstand (sog. Sekten) dem es stellenweise gelingt sich internationale Marktanteile zu verschaffen, und in dessen Fahrwasser sich eine Schattenwirtschaft (Grauzone, Kriminalität) etabliert (Scientology, Satanismus). Es gibt mittelständische Klein- und Kleinstanbieter, bis hin zu sog. Ich-AG’s, welche in einem erbitterten Konkurrenzkampf ihre Existenz bestreiten (Astrologen, Okkultisten, Schamanen, usw., usf.). Getrieben von der Hoffnung auf Aufstieg und der ständigen Bedrohung des Abstiegs. Es gibt Angebotsdifferenzierungen und Mischwarenhandel. Kapitalkonzentrationen (Ökumene, Dialog der Religionen). Feindliche Übernahmen (Einverleibung psychotherapeutischer Praktiken). Es gibt eine Zuliefererindustrie, sowie einen Zwischenhandel (Devotionalien und Literatur. In keinem Buchladen fehlt mehr die Esoterik – Ecke).
Es gibt zudem ein typisches Marktverhalten der Kundschaft. Stammkunden (Konfessionsgebundene), Laufkundschaft (gelegentliche Kirchengänger, Esoterikmessebesucher, Seminarteilnehmer). Schließlich diejenigen, die sich aus eigens zusammengestellten Modulen ihre individuelle Religion basteln, und damit die religiösen Werte auf den persönlichen Geschmack reduzieren. Diese Kundschaft ist für alle Anbieter die attraktive und umworbene Dunkelziffer. Objekt der Marktspekulation. Zum einen, weil sie in den Metropolen die wahrscheinlich zahlenmäßig größte Kundschaft stellen, zum anderen, weil diese in ihrer Flexibilität und Beliebigkeit stets für Extraprofite sorgen. Selbst die deutschen Amtskirchen stellen ihr Angebot immer mehr auf diese Kundschaft ein, indem sie allerlei Hokuspokus der modernen Esoterik in ihr spirituelles Angebot aufnehmen. An ihrer Seite befinden sich bekannte Persönlichkeiten der internationalen religiösen Unternehmensberatung (Dalai Lama). In diesen babylonischen Zuständen lösen sich Dogmen auf, oder werden zumindest modifiziert. Alte, gewachsene Ideologien verwässern. Neue, dogmatische Strömungen springen in die Bresche, um das entstandene Vakuum zu Füllen. Jedoch mit nur vorübergehendem Erfolg. (Siehe Aufstieg und Fall der Osho – Bewegung).
Die Soziologie bemüht sich derweil um Erklärungsmuster und etabliert (restauriert) dafür Begriffe wie ‚Pantheismus’ in ihrem Sprachschatz. Auf diese und andere Art leistet endlich auch die bürgerliche Sozialwissenschaft ihren Beitrag zum unvermeidlichen Geschehen. So entstanden parallel zum Markt, die Religionssoziologie, Religionspsychologie, allgemeine Religionswissenschaften usw. Zum Teil den theologischen Fakultäten untergeordnet, zum Teil unabhängig davon. In jedem Fall immer auch tendenziös der Markforschung ergeben, insofern sich sowohl die Kirchen als auch die Werbung ihrer Erkenntnisse bedienen. Das ist den meisten dieser Wissenschaftler jedoch kaum gegenwärtig. Manche glauben gar, in ihrer eingebundenen Rationalität, der Irrationalität angemessen begegnen zu können. Als gäbe es was Richtiges im Falschen. Als gäbe es die reine Wissenschaft.
Religion und Wissenschaft
„Die Entwicklung der Wissenschaft, besonders der Naturwissenschaft, und mit ihr aller anderen, steht selbst wieder im Verhältnis zur Entwicklung der materiellen Produktion.“ [44]
So wie die Religion im Kapitalismus nur eine kapitalistische Religion sein kann, so ist auch die bürgerliche Wissenschaft, die Wissenschaft des Kapitals. Deshalb ist anzuzweifeln, ob diese der Religion wirklich etwas entgegen halten kann, bevor sie selbst sich emanzipiert.
Engels beschreibt die Vorraussetzungen für den Einstieg der Wissenschaft in die Epoche des aufblühenden Kapitalismus wie folgt: Die Naturforscher glauben sich von der Philosophie zu befreien, indem sie sie ignorieren oder über sie schimpfen. Da sie aber ohne Denken nicht vorankommen und zum Denken Denkbestimmungen nötig haben, diese Kategorien aber unbesehen aus dem von den Resten längst vergangner Philosophien beherrschten gemeinen Bewußtsein der sog. Gebildeten oder aus dem bißchen auf der Universität zwangsmäßig gehörter Philosophie (was nicht nur fragmentarisch, sondern auch ein Wirrwarr der Ansichten von Leuten der verschiedensten und meist schlechtesten Schulen ist) oder aus unkritischer und unsystematischer Lektüre philosophischer Schriften aller Art nehmen, so stehen sie nicht minder in der Knechtschaft der Philosophie, meist aber leider der schlechtesten, und die, die am meisten auf die Philosophie schimpfen, sind Sklaven grade der schlechtesten vulgarisierten Reste der schlechtesten Philosophien.“[45] Das klingt nicht gerade vielversprechend, aber es kommt noch schlimmer. Die beschleunigte Arbeitsteilung reißt die Wissenschaft immer mehr von ihrem Standessockel. War der Ingenieur von damals noch der Ideengeber, Entwickler und Verwirklicher eines Projektes, so findet man diesen heute meistens an einem Teilchen des Projektes beschäftigt, z. B. in einer Zulieferfabrik, sinnlich und räumlich weit vom Gesamtergebnis entfernt. Wenn man sich zudem vergegenwärtigt, dass Ingeneure, Architekten, Ökonomen usw. seinerzeit nicht selten als Gründer fungierten, und über einen langen Zeitraum eine wichtige Fraktion innerhalb der Bourgeoisie darstellten, das gleiche Milieu heute, bei durchschnittlich ungleich höherem Wissenstand, in der Regel ein Lohnabhängigendasein fristet, wie alle anderen Lohnabhängigen von Arbeitslosigkeit bedroht ist usw., kann man wohl zurecht behaupten: Der größte Teil der wissenschaftlich tätigen Menschen sind heutzutage unwiderrufbar Teil des Weltproletariats. In der versachlichten, verdinglichten Welt des Kapitalismus wird der Wissenschaftler, wie jeder andere Lohnabhängige, durch den fortlaufenden Prozess der Arbeitsteilung, von seinem Produkt immer mehr entfremdet. Der Sinn (bzw. Unsinn) seiner Produktivität spielt sich hinter seinem Rücken ab. Seine Produktivität unterliegt den Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Produktionsweise, also der Planlosigkeit und Willkür. Die Wissenschaft im Kapitalismus ist kalte Rationalität, gefangen in der Sklaverei einer irrationalen Ökonomie.
Die Wissenschaft des Kapitals macht den Menschen Angst. Nicht ganz zu unrecht, denn sie hat sich in der Tendenz als lebensfeindlich demaskiert. Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem ersten großen Wiederaufblühen des religiösen / spirituellen Marktes nach dem Ende des zweiten Weltkrieges, ab Anfang der 70er Jahre – und der Angst der Menschen vor der Wissenschaft.[46] Sie findet ihren politischen Ausdruck, ihre Protestation, in der sog Ökobewegung. Das Kapital hatte sich gigantische Entwicklungen in der Wissenschaft zu nutze gemacht, welche nun unter dessen Willkür ihren Beitrag zum Niedergang der Werte lieferte. Als Vergiftung und Zerstörung der Erde! Die Ökobewegung konnte in ihrer Mehrheit jedoch nicht erkennen, dass das Kapital in seinem planlosen Zwang zu akkumulieren diese Destruktivität der Wissenschaft zu verantworten hat. Stattdessen argumentierte sie gegen die Wissenschaft an sich.[47] Ihre Haltung wurde zudem bestärkt durch die Argumente der Stalinisten und der COMECON – Staaten, welche in ihrer Propaganda die doppelte, aber durchschaubare Lüge verbreiteten, dass die Anwendung dieser Techniken (insbesondere der Atomkraft) im Sozialismus gut aufgehoben seien. Zum einen wurde damit die Mär von der Existenz sozialistischer Staaten kolportiert, zum anderen hofierte man damit einen mechanischen, bürgerlichen Materialismus, welcher die ökonomische Dynamik der Technologien im Kapitalismus ausblendet. Statt dessen wurde so getan, als gäbe es im COMECON eine vom Weltmarkt unabhängige Wissenschaft für das Wohl der Menschen. So ist es auch kein Zufall, dass die zweite Welle der Esoterik, die schließlich das Ausmaß des Marktes der Irrationalität herstellt wie wir es heute kennen, im Zeitkontext mit den AKW – Unfällen in Harrisburg und Tschernobyl losgetreten wurde. Es herrschte ein klassenübergreifendes Klima der Angst vor dem Fortschritt, und der begrenzten Hoffnung. Diese begrenzte Hoffnung definierte sich als Empörung und Aufbegehren gegen ein Symptom des kranken Kapitalismus: die irrationale Anwendung der Rationalität. Die Bedeutung der Sprache verkehrte sich. Die Rationalität, welche der Wissenschaft (unpolitisch) unterstellt wird, wird durch die Ängste der Menschen zum Feindbild in ihren Gedanken. Im Bewusstsein ist der Schritt zum Irrationalem nun nicht mehr weit. Insbesondere dann, wenn das Proletariat sich als unfähig erweist die soziale Revolution auf die Tagesordnung zu stellen, und in Folge dessen die Atomisierung der Individuen immer mehr voranschreitet. Die Produktivkräfte der Wissenschaft sind zugleich entfesselt und gehemmt. Entfesselt in ihrem Zerstörungspotential und gehemmt in ihrem Nutzen für die Menschheit. Die o. g. Pattsituation zwischen Bourgeoisie und Proletariat kommt hier bedrückend zum Ausdruck.
Die Farce an der ganzen Angelegenheit ist die, das gerade die Akademiker, die Menschen aus den Wissenschaften, eine starke Neigung zur Esoterik an den Tag legen. Nicht umsonst ist einer der wichtigsten Theoretiker der sog. New Age Bewegung, der Konsumentenbasis des religiösen Marktes, Friedjoff Capra, zugleich ein renommierter Naturwissenschaftler.[48] Seine weibliche Ergänzung ist die Sozialwissenschaftlerin Marilyn Ferguson.[49] Gegenwärtig trägt die Entwicklung der Wissenschaft kaum dazu bei, die religiösen Affinitäten des „Volkes“ aufzuheben. Im Gegenteil, so wie es aussieht, treibt diese katastrophale Entwicklung in der Anwendung der Wissenschaft die Menschen geradezu in die Arme „höherer Wesen“. Der Protest gegen die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen vermischt sich so von Beginn an mit spirituellen und religiösen Geistesströmungen. Er wird zum falschen Protest. Verständlich, perspektivlos, tragisch. Schließlich manifestiert sich die kollektive Niederlage der Ökobewegung in einem Sturm auf die Konsumtempel der Privatreligion der 80er Jahre, und kommt in den 90er Jahren in der „Mitte der Gesellschaft“ an. Der Metropolenmensch im 21ten Jahrhundert dreht sich endlich um sich selbst. Aber leider nicht im Sinne von Marx, sondern als (religiöser) Egozentriker im vermeintlichen Paradies der spektakulären Warenökonomie, welche zugleich die Hölle seiner Einsamkeit[50] und Entfremdung ist. Und so wie die Wissenschaft des Kapitals die Religion reproduziert, so reproduziert sich diese umgekehrt in der modernen Religion. Hierfür steht, wie kaum eine andere wissenschaftliche Disziplin, die Humanwissenschaft mit ihren Abteilungen Anthropologie, Ethnologie, Soziologie, Medizin und Psychologie. Ein kurzer Blick in die Geschichte der Psychologie im Kapitalismus soll das am Beispiel verdeutlichen.
Die Psychologie vor Freud war beherrscht von einem biologistischen Weltbild, und die Forschung beinahe ausschließlich im Bereich der Effektivität der Produktion und des Militärs angesiedelt. Im gängigen Menschenbild dieser Psychologie war das Individuum ein vom Reiz -, Reaktionsmechanismus determiniertes, zoologisches Objekt. Das brachte die Lehre von einer generellen Konditionierbarkeit des Menschen hervor.[51] Alles was außerhalb der Mechanik des unmittelbaren, unreflektierten Lernens stattfand (was es ja auch gibt), musste folglich noch in den Bereich der Metaphysik verbannt werden. Siegmund Freud war es, dem es als ersten gelang eine Struktur der Psychodynamik zu beschreiben.[52] Damit wurde es zu seinem unzweifelhaften wissenschaftlichen Verdienst, die „Seele“ aus den Klauen des Klerus und der Mythologie zu befreien, und in den Kontext zu stellen, in den „ES“ gehört: In die Entwicklung des Menschen in seine - und aus seiner sozialen Umwelt. In seinem Wirken leistete der Jude Freud nebenher einen wichtigen Beitrag zur Säkularisierung des Judentums. Freud sah den Menschen als ein historisches und gesellschaftliches Wesen. Im Kontext der Sozialisation des Individuums, welches bei ihm stets im Mittelpunkt stand, wurde die Persönlichkeitsentwicklung als subjektiver Prozess begriffen, in dem, durch (Selbst)Reflektion, bewusst eingegriffen werden kann. Ade Schicksalsglaube und Determinismus. Freud nutzte die dialektische Methode für seine Forschungsarbeiten. Er pflegte einen regen interdisziplinären, wissenschaftlichen und politischen Austausch (z. B. mit Albert Einstein) und trug so sein Welt-, und Menschenbild in alle möglichen Bereiche der Gesellschaft. Die Psychoanalyse kann in ihrer Entwicklung, bis heute, als eine dialektisch[53] emanzipatorische Humanwissenschaft angesehen werden, welche der Psychologie insgesamt dazu verholfen hat große Schritte zu machen. Kein Wunder, dass es zahlreiche, wenn auch notwendig gescheiterte Versuche gegeben hat, die Psychoanalyse im Einklang mit der revolutionären Theorie zu bringen.[54] Freud sah den Grund des Leidens der Menschen in seinem „Unbehagen in der Kultur“ begründet, dessen religiöse Affinitäten als eine Art Selbsttherapie (Projektions-, und Verdrängungsleistung) angesehen wurden. Religiöse Inhalte und Empfindungen begriff Freud, ähnlich wie Marx, als Illusion: „Für die Illusion bleibt charakteristisch die Ableitung aus menschlichen Wünschen, sie nähert sich in dieser Hinsicht der psychiatrischen Wahnidee, aber sie scheidet sich, abgesehen von dem komplizierteren Aufbau der Wahnidee, auch von dieser. An der Wahnidee heben wir als wesentlich den Widerspruch gegen die Wirklichkeit hervor, die Illusion muss nicht notwendig falsch, d. h. unrealisierbar oder im Widerspruch gegen die Realität sein . . . Wir heißen also einen Glauben Illusion, wenn sich in seiner Motivierung die Wunscherfüllung vordrängt, und sehen dabei von seinem Verhältnis zur Wirklichkeit ab, ebenso wie die Illusion selbst auf ihre Beglaubigungen verzichtet ... Es liegt nicht im Plane dieser Untersuchung, zum Wahrheitswert der religiösen Lehren Stellung zu nehmen. Es genügt uns, sie in ihrer psychologischen Natur als Illusionen erkannt zu haben."[55] Durch den u. a. hier dargestellten Agnostizismus in Freuds Haltung eröffnete er jedoch, ungewollt, auch religiösen Scharlatanen einen Zugang, der es solchen Elementen bis heute erlaubt, die vielfältigen Methoden der Psychotherapie hemmungslos auszubeuten.[56] Ein wichtiger Ausdruck des Agnostizismus in der Psychoanalyse ist die Spaltung der Psychoanalytischen Gesellschaft, vorangetrieben durch den spirituell -, und völkisch beseelten Freud-Schüler C. G. Jung. „Wie kein anderer hat C. G. Jung mit seiner Archetypenlehre, in der der Seelenkern "die Sphäre der Ganzheit, des unverdorbenen Sinns" darstellt, dazu beigetragen, "Seelenanalyse und Weltanschauung zu vereinen", und den "Anspruch auf Wissenschaftlichkeit und den Durst nach Sinn gleichermaßen zu befriedigen"..."Jungs Lehre krankt an der Zivilisation, deren Dekadenz sie heilen will. Und sie leidet nicht an ihrer Krankheit. Sie richtet sich gemütlich ein in der Welt, aus der sie hinauszuführen meint. Ihr Programm der Ganzheitlichkeit, das den Menschen zu seinem Ursprung zurückbringen soll, steht an der Spitze des Fortschritts: in tiefem Einklang mit der totalitären Tendenz der warenproduzierenden Gesellschaft, Dinge und Menschen als Objekte von Kauf und Verkauf bis zur Indifferenz einander anzugleichen und zur ‚irrationalen Vereinigung der Gegensätze' (Jung) zu zwingen. Die Archetypen sind denn auch keine archaischen Urbilder, sondern moderne Wunschbilder. Sie versprechen sichere Seelenführung, wenn man sie nur gewähren läßt, geben religiösen Sinn, ohne auf eine bestimmte Religion zu verpflichten, bieten eine in sich gerundete Weltanschauung, ohne sich metaphysisch festzulegen."[57] Von der Abspaltung des spirituellen Flügels der Psychoanalyse, bis zum Auftauchen erster esoterisch – psychotherapeutischer Autodidakten (moderne Wunderheiler) war es nur ein kleiner Schritt. Bereits zu Lebzeiten von Freud tat sich in Europa ein Psychoguru hervor, der Kaukasier Georg Iwanowitsch Gurdjieff, dessen literarische Hinterlassenschaft bis heute den esoterischen Buchmarkt bereichert. So konnten sich die Methoden, und Fragmente der Theorie Freuds und seiner Nachfolger auf dem Markt der Religionen, als schlechtes Konglomerat etablieren. Und je mehr die unumkehrbare Zerschlagung des Gesundheitssystems voranschreitet, je mehr werden sich die verfälschten und verwässerten Praktiken der Psychotherapie und der Medizin durch Wunderheiler und Psychogurus in allen Teilen der Bevölkerung ausbreiten können.
Ein weiteres Beispiel für die Wechselbeziehung zwischen Wissenschaft und Religion im Kapitalismus soll hier kurz angerissen werden. Während der ersten Konsolidierung des Marktes der Religionen, eingeleitet durch das Recht auf Religionsfreiheit, und beschleunigt durch die Schaffung des Weltmarktes (Kolonialismus) kam es auf dem Gebiet der Archäologie und Ethnologie, zu bahnbrechenden Entdeckungen. Spektakuläre Ausgrabungen[58] wurden durch die Presse vermarktet und stießen so auf ein großes Interesse in der Bevölkerung der kapitalistischen Zentren. Das führte zu einem großen Ausmaß an Spekulationen und Mystifikationen, in dessen Folge sich weitere religiöse Gemeinschaften bildeten. Es entstanden allerlei Verschwörungstheorien, welche sich z. T. auch in Antisemitismus ergossen. Dies gilt insbesondere für die Theosophie und ihrer Nachfolger. Die Nachhaltigkeit dieser Bewegung zeigt sich heute in der weitverbreiteten Literatur über Mystik und Verschwörung, zuletzt in dem gerade verfilmten Bestseller von Dan Brown, „Sakrileg“ (Da Vinci Code). An der Auflagenstärke dieser Art von Literatur ist abzulesen, dass das (kindlich) magische Denken schon längst Einzug in den Alltag der (erwachsenen) Menschen im Kapitalismus gehalten hat. Als gewöhnlicher Wahn. Ähnlich verhält es sich mit dem Einstieg in die Raumfahrt sowie der beschleunigten Entwicklung der militärisch orientierten Luftfahrt zu Beginn des kalten Krieges, und dem Entstehen der Ufologie, sowie der Renaissance der Astrologie. Es wäre Augenwischerei, wenn die Kommunisten behaupten würden, die Arbeiterklasse sei davon nicht zu berühren, außer durch einen bewusst gesteuerten Eingriff der Bourgeoisie. Hier findet längst eine beunruhigende Eigendynamik statt. Ebenso falsch wäre der Glaube an einen immanenten Fortschritt in der Wissenschaft. Im Gegenteil, die Kommunisten müssen das Zerstörungspotential und die Willkür der wissenschaftlichen Forschung, und deren Anwendung im Kapitalismus zur Kenntnis nehmen, und bedingungslos aufdecken. Forschungsprojekte aller Art werden von vornherein als Warenproduktion in Angriff genommen, auf deren Anwendungen der Forscher keinerlei Einfluss hat. Besonders deutlich wird das, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die meisten Forschungsgelder weltweit in den Bereich des Militärs fließen. Freiheit und freie Entfaltung der Wissenschaft zum Nutzen der Menschheit ist nur möglich in einer Gesellschaft der freien Assoziation freier Menschen. Die Wissenschaft kann deshalb ihren Beitrag zur Befreiung des Menschen von den Fesseln der Religion erst leisten, wenn der Mensch die Wissenschaft von den Fesseln ihrer Verwertbarkeit befreit hat.
Die Linke[59] und die Religionskritik
Die Linke, von der hier die Rede ist, sind die modernen Freidenker. Sie produziert eine umfangreiche, vielseitige und detaillierte Literatur, welche den religiösen Markt kritisch begleitet. Es gibt international kooperierende Skeptiker-, und Atheistenverbände, die in ungeheurer Fleißarbeit auch noch den größten Unsinn esoterischer Stilblüten empirisch als Unsinn nachweisen. Es gibt eine politische Lobby der Linken,[60] für ihre Art der Religionskritik. Es gibt allein in Deutschland mehrere Fachzeitschriften die seit Jahren und Jahrzehnten regelmäßig erscheinen. Es wurden Enzyklopädien erstellt. Es gibt ganze Fachverlage. Man kann sagen, es gibt eine linke, empirische (Anti)Religionswissenschaft. Das ist nicht verwunderlich, kommen sie doch aus dem gleichen Stall wie diejenigen Linken, die, welche im Zuge der Protestbewegung gegen die Zerstörung der Umwelt, oder der Bewegung für die Gleichstellung der Frauen, sehr schnell mit der Verbreitung esoterischer Literatur am Start waren. So war es der vormals libertäre TRIKONT- Verlag, welcher sich als erster in Deutschland mit der Herausgabe von Büchern für die New – Age – Bewegung befasste. Am Anfang stand dabei eine Reihe von Büchern, welche die Religionen und kulturellen Bräuche der amerikanischen Ureinwohner mystifizierten.[61] Nicht wenige Linke und Anhänger der Ökobewegung verzierten seinerzeit ihre WG – Zimmer mit Plakaten von Geronimo und Weisheiten der Hopi – Indianer.[62] In der Frauenbewegung wurde parallel dazu eine unglaubliche Mystifizierung der Rolle der Hexen im Mittelalter betrieben, was zum Anlass für weitere Produktion esoterischer Publikationen wurde, u. ä. m. Zwischen der Linken, und der New – Age – Bewegung gab es vielerorts lückenlose Personalunion. Nachdem vielen linken Esoterikern aufging, dass sie keine „Indianer“ sind - noch nicht einmal „Stadtindianer“ - begannen sie sich mit ihren „eigenen“ Vorfahren zu beschäftigen. Ein Tribal–Kult tat sich auf. Die Identifizierung mit der verklärten Kultur europäischer Stammesgesellschaften (Kelten, Germanen usw.) rief schließlich den Antifaschismus auf den Plan. So ist bis heute die religionskritische Literatur der Linken davon geprägt, dem esoterischen Markt ein rechtes Potential nachzuweisen. Nicht ganz zu unrecht! Die linke Religionskritik ist somit ein Reflex auf das abdriften vieler ihrer ehemaligen Kampfgefährten in die Welt des magischen Denkens. Mit einer Religionskritik im Marxschen Sinne hat das wenig zu tun. Es ist inhaltlich oftmals eher so etwas wie die Verteidigung der Errungenschaften der Aufklärung. War das ursprüngliche Motiv der Linken in der Einhaltung des politischen Kodex und der Rückgewinnung Abtrünniger zu verorten, will sich diese Szene jetzt als eine Art (einsamer) Aufklärer und Warner gegen die Ausbreitung des religiösen Wahns in der gesamten Gesellschaft etablieren. In den meisten Veröffentlichungen dieser Szene wird der gesellschaftliche Zusammenhang zwischen den Lebensbedingungen im Kapitalismus und der Ausdehnung des religiösen Marktes nur oberflächlich, oder gar nicht behandelt. An ihren Randerscheinungen wird die künftige Rolle der linken Religionskritik bereits sichtbar. Immer mehr unentschlossene, esoterisch interessierte Linke, lesen deren publizistische Äußerungen wie Magazine der Stiftung Warentest. Sie informieren sich schlicht darüber, was in ihrem Milieu so gar nicht angesagt ist. Gar nicht angesagt ist alles, was in die rechte, antisemitische Richtung geht. Alles andere geht durch. Und das ist nicht wenig, da es ja vor allem auch eine Frage der Deutung ist. Es tun sich aber immer mehr Strömungen auf dem Markt der Religionen auf, sodass die linke Religionskritik immer ein Stück hinterher ist.[63] Dieser Umstand wird sie immerhin noch eine ganze Zeitlang am Leben erhalten. Die linke Religionskritik ist ihrem Wesen nach eine bürgerliche Religionskritik, so wie diese Linke selbst wohl kaum als revolutionäre Strömung zu bezeichnen ist. Eine emanzipatorische Religionskritik, als Kritik der (Über)Lebensbedingungen im Kapitalismus, ist aus diesem Spektrum kaum zu erwarten. Man muss gerechterweise hinzufügen, dass es auch Ausnahmen gibt.[64]
Am Ende kommen wir vom Glauben ab
Nicht die Religionsfreiheit, noch die Trennung von Staat und Kirche – nicht die Privatisierung der Religion, noch der wissenschaftliche Fortschritt im Kapitalismus haben das Ende der Religionen einläuten können. Wir sind der Aufhebung der Illusionen kein Stück näher gekommen, weil der Kapitalismus, wie kaum eine Gesellschaftsformation vor ihm, komplexe, in allen seinen Ausdrucksformen kaum durchschaubare Zustände geschaffen hat, welche der Illusion bedürfen. Diese Zustände sind aufgehoben in dem wohl widersinnigsten Widerspruch in der bisherigen Geschichte der Menschheit: Die Einsamkeit als generelles Problem in der Gemeinschaft. Die Religion des Kapitals, insbesondere seit Beginn seiner Niedergangsperiode, ist die Privatreligion. Der religiöse Egozentrismus.
Das Kapital, als die Irrationalität von Warenproduktion und Konsum, ist längst in (fast) alle Lebensbereiche unserer Kultur eingedrungen und findet auch in der Auseinandersetzung der Ideologien und Religionen ihren Ausdruck. Jede Form von Ideologie oder Religion ist nicht nur Orientierungshilfe, wenn sie es denn ist, sondern auch Ware. Sie wird nicht nur produziert und reproduziert, sondern kann auch konsumiert werden. Es findet eine Wandlung vom Gebrauchsgut zum Verbrauchsgut statt, mit allen dazugehörigen Entfremdungserscheinungen. Was der Entfremdung entkommen will, bindet sich nun doppelt. Die Rückbindung (re –ligio) ist nicht die Negation der Negation, sondern nur die endlose Schleife. Nicht die Rückbindung an Gott, sondern an das Kapital. Die Religion im Kapitalismus ist das Hamsterrad der Einsamkeit.
Religion überhaupt, d. h. religiöse Ideologie und religiöse Handlung, erklärt sich nicht aus sich selbst, sondern ist immer begründet im Zeitgeist, Ökonomie und Politik, sowie regionale Besonderheiten. Religion wirkt ausschließlich auf diesen Bezugsrahmen zurück, welcher wiederum Bedingung für den Grad der Entfaltung religiöser Wirklichkeit ist.
Grob umrissen kann man davon ausgehen, das der Animismus sich effektiv entfalten konnte in einer Stammes–, bzw. Clangesellschaft. Animismus repräsentiert die Epoche der sog. Barbarei. Er wiederspiegelt den kollektiven (urkommunistischen) Kampf der Stämme und Clans gegen die natürliche Umwelt. Der Polytheismus tritt in seiner Blütezeit als religiöser Überbau der Antike in Erscheinung. Er ist bereits in der Lage differenzierte menschliche Charaktereigenschaften zu spiegeln und gesellschaftliche Arbeitsteilung sowie Herrschaftsverhältnisse zu begründen. Der Monotheismus spielt seine entscheidende Rolle für die Bildung und Organisation großer Staatensysteme. Er war stets eng an der Entstehung des Feudalismus gebunden. Der Monotheismus in Europa entfaltete seine Wirklichkeit, also vor allem seine gesellschaftliche Macht, nicht zufällig am effektivsten im Zeitalter des Absolutismus. Das Bild wäre jedoch allzu einfach, wenn nicht mitgedacht würde, dass ein historischer Prozess keine monokausale Gleichung ist. Religionen lösen sich nicht einfach gegenseitig ab. Sie entwickeln sich meistens als den jeweils herrschenden Religionen alternativ gegenüberstehende Ideen und Handlungsmuster. Eher selten gelingt die Integration neuer religiöser Vorstellungen in das herrschende Gesellschaftssystem ohne sich ständig wiederholende Exesse von Gewalt und Verfolgung über einen sehr langen Zeitraum. Und kaum setzt sich ein Religionssystem durch, muss es schon wieder um die Existenz kämpfen. Denn schon lauern neue gesellschaftliche Widersprüche, die den Geist der Emanzipation anregen, der sich neue, passende Ideologien ausdenkt und die Macht der Priester infrage stellt.
Die Entwicklung der Vermarktung spiritueller und religiöser Bedürfnisse erklärt sich aus dem Welt- und Menschenbild des Kapitals, welches auch die Idee der Religionsfreiheit hervorgebracht hat. Angesichts der Vielfalt religiöser und spiritueller Glaubenssysteme, mit denen wir heute konfrontiert sind, und angesichts der Selbstverständlichkeit, mit der man sich dieser Vielfalt bedienen kann, ist davon auszugehen, dass die Religion in unserer Epoche tatsächlich zur Privatsache geworden ist. Das Individuum ist heutzutage in der Regel fähig und willens, sich aus den unterschiedlichen Möglichkeiten, welche die Angebote auf dem Markt der religiösen Ideen bereithalten, ein persönliches Glaubenssystem zusammenzustellen. Nicht wenige machen davon Gebrauch. Wer sich keiner Konfession zugehörig fühlt ist demzufolge nicht zwangsläufig als Atheist zu betrachten. Das „Wort Gottes“ weicht zunehmend großzügig ausgelegter, individueller Glaubensvorstellungen. Selbst der Monotheismus ist in allen seinen Erscheinungsformen einer einheitlichen Orientierung beraubt. Die Entwicklung auf dem Markt nimmt scheinbar kein Ende. In der gegenwärtigen Situation bliebe den Amtskirchen kaum anderes übrig, als ihr „religiöses Eigentum“ durch Copyright rechtlich abzusichern, um sich einigermaßen vor „Überfremdung“ des Christentums zu bewahren. Jedenfalls hat alle noch so gut vorgetragene Apologetik, vor dem historischen Hintergrund seit der Reformation betrachtet, kaum dazu geführt, die Privatisierung und Vermarktung religiöser Ideen zu behindern.
In der in den hochentwickelten Industrienationen entstandenen sog. New – Age - Bewegung, wird uns, durch die offenkundige Konkurrenz kleiner und großer „Gurus“ in ihrem erbitterten Kampf um Marktanteile, geradezu ein Atomisierungsprozess religiöser Ideen augenscheinlich vorgeführt. Nahezu alle religiösen Vorstellungen aus allen Zeiten und Orten der Geschichte der Menschheit, sofern sie auch nur im Ansatz zugänglich sind, werden in Workshops und auf Messen verkauft. Dabei werden, mit z. T. frappierender Oberflächlichkeit, sämtliche religiösen, spirituellen und anderen ideologischen Vorstellungen unter einen Hut gebracht. Es werden die Dogmen der Weltreligionen in Anspruch genommen, in der New – Age - Bewegung vor allem die Lehren von Jesus Christus und Buddha. Es befinden sich monotheistische Vorstellungen plötzlich im Einklang mit Konzepten und Methoden des Polytheismus wie z. B. mit Runenorakel, hinduistischen Wiedergeburtstheorien, Heilsvorstellungen der Antike u. a. m. Auch die frühgeschichtlichen Glaubensvorstellungen haben längst in Form von schnell konsumierbaren Modulen (schamanische Reisen, indianische Schwitzhütten...) ihren Weg in die New – Age - Bewegung gefunden. Der soziale und historische Kontext, in dem sich diese verschiedenen religiösen Konzepte und Methoden einst bilden konnten, als Beziehungssystem einer Gemeinde in einer bestimmten Kultur, wird schlicht übergangen. Unumwunden bedient man sich außerdem passender Weltbilder moderner Wissenschaften. Das Angebot lässt Rückschlüsse auf die Nachfrage zu. Eine zunehmende Individualisierung verlangt geradezu nach Vielfalt, und jede „Passung“ muss der Individualität entsprechen, sonst kann sie nicht wahr - und in Anspruch genommen werden. Es handelt sich dabei nicht zuletzt um den Versuch dieser Marktbewegung, dem Individualismus eine Art Verbundenheit entgegen zu stellen, die zweifellos gewünscht wird. Über alledem schwebt wie auf Wolken der Begriff der Ganzheitlichkeit, der bereits in der Politik, im Duden und in der Wissenschaftsterminologie Einzug gehalten hat. Unter dem Postulat der Ganzheitlichkeit lassen sich alle Deutungsmodelle zusammenfassen als Wege, die letztlich alle zum Gipfel führen. Unterschiede werden auf die Ebene des persönlichen Geschmacks gesenkt, und geben somit dem inneren Widerspruch zwischen Individualismus und Verbundenheit oder anders ausgedrückt, zwischen Autonomiebedürfnis und Abhängigkeit, eine scheinbar positive Wende. Das Bedürfnis, etwas besonderes zu sein, erleuchtet, erhört, errettet, aus der Masse herauszutreten, muss mit dem Bedürfnis nach Orientierung, Geborgenheit, Vertrauen, zusammengebracht werden. Eine Religionsausübung, die vom Markt wesentlich mitbestimmt ist, macht dies vortrefflich möglich, in dem sie den persönlichen Geschmack bedient, den Konsumenten die Wahl lässt und in jedem Falle Verbundenheit anbietet.
Das Kapital ist in bezug auf sowohl geistiges als auch gegenständliches Gut gekennzeichnet durch die grenzenlose Aufwertung von Eigenart und Eigentum (Individualisierung, Privatisierung). Während der Mensch im Kapitalismus, eigentümlich und eigenartig (und eben nicht selbstverständlich) nach Orientierung, Zugehörigkeit und Geborgenheit sucht, steht ihm auf dem Markt der Weltanschauungen eine verwirrende Vielzahl von Angeboten gegenüber. Aus der Erkenntniswelt wird somit eine Erlebniswelt. Aus dem Gebrauch wird Verbrauch. Spiritualität und Religionen haben ihre orientierende Funktion längst verloren, und sind zum Konsumfetisch verkommen
Die Zwanghaftigkeit und der Fanatismus, sowie die Oberflächlichkeiten und Beliebigkeiten innerhalb des religiösen Marktes sind bloß zwei Seiten derselben Münze. Die vom Kapital besetzten Werte: Freiheit, Selbstbestimmung, Autonomie sind in Wirklichkeit Unfreiheit, Fremdbestimmung und Abhängigkeit. Die sog. freie selbstbestimmte Lebensführung im Kapitalismus bedeutet daher nicht selten Einsamkeit und hilflose Orientierungslosigkeit. Tatsächlich ist es so, dass das Individuum in diesem Zustand selbst die Reglementierungen der Religionsausübung als eine Befreiung von Entscheidungsdruck empfinden kann, ohne wirklich jemals für sich zu entscheiden. Vom Subjekt aus betrachtet kann so der vorübergehende Verzicht auf Selbstbestimmung als durchaus willkommener Effekt der Religionsausübung betrachtet werden.
Die kommunistische Bewegung ist angehalten, die Isolation der Individuen zu durchbrechen und zwischen den Menschen einen Austausch, eine sich austauschende Zwischenmenschlichkeit herzustellen. Sie ist angehalten, Kritik an den Lebensverhältnissen und am Verhalten der in diesen Verhältnissen ums Überleben Kämpfenden zu üben. Empathie, Respekt und Kritik sind unsere Waffen. Diese sind aufgehoben im Wesen der Solidarität. Wir bejammern nicht den Verlust der Werte. Wir wissen um ihre Bedeutungslosigkeit für unsere Befreiung. Wir kämpfen nicht gegen Ideen, sondern gegen Ausbeutung, Entfremdung und Unterdrückung. Wir kämpfen nicht für die Ausgebeuteten, Entfremdeten und Unterdrückten, sondern als diese und mit diesen. Wir bekämpfen weder Egoismus noch Altruismus, weil wir wissen dass beides zur Daseinsform des Menschen gehört. Wir bekämpfen den Egozentrismus. Wir bekämpfen den fanatisierten Islamisten, der sich unseren Bemühungen um Befreiung entgegenstellt nicht als Mohammedaner, sondern in seiner Funktion als Söldner des Kapitals. Wir bekämpfen nicht andersdenkende Menschen, sondern das System, seine Institutionen und seine Funktionen. Unser Kampf ist der Klassenkampf, als die historische und materialisierte Kritik, als die Kritik gegen den kalten, mechanisierten Materialismus des Kapitals, der selbst vor dem Eindringen in das Gewissen, die Intimität und die Fantasie der Menschen nicht halt macht. „Dazu ist es sicher auch notwendig, diese erkannte verkehrte Welt auszuhalten.“ [65]
Die Ideologien und Religionen stellen den Menschen auf den Kopf. Wir wollen, dass der Mensch auf seinen Füssen steht, damit er seinen Kopf sinnvoll und sinnlich gebrauchen kann.
„Die Kritik hat die imaginären Blumen an der Kette zerpflückt, nicht damit der Mensch die phantasielose, trostlose Kette trage, sondern damit er die Kette abwerfe und die lebendige Blume breche. Die Kritik der Religion enttäuscht den Menschen, damit er denke, handle, seine Wirklichkeit gestalte wie ein enttäuschter, zu Verstand gekommener Mensch, damit er sich um sich selbst und damit um seine wirkliche Sonne bewege.“[66]
Riga
[1] „Karikaturen Mohameds“, in : Weltrevolution - Zeitschrift der IKS für den deutschsprachigen Raum, Nr. 135, 2006.
[2] Karl Marx „Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie” in: MEW, Band 1, S. 378
[3] Was ihm, zugegebenermaßen, nicht immer gut gelungen ist.
[4] Friedrich. Engels, Anti-Dühring, in: MEW Band 20, S.295.
[5] Karl Marx, „Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie” in: MEW, Band 1., S. 378
[6] Ebenda, S. 379
[7] Friedrich Engels, „Flüchtlingsliteratur“, in: MEW, Band 18, S. 531
[8] Am Vorabend der Kommune schrieb Bakunin eines seiner charakteristischen Werke: „Staat und Religion.“ In der anarchistischen Literatur nimmt seither die Religionskritik einen gewichtigen Platz ein. Dem Anarchisten Johann Most gelang es im 19ten Jahrhundert, eine Flugschrift unter dem Titel „Die Gottespest“ zu formulieren, die innerhalb der Arbeiterbewegung, bis weit in das 20te Jahrhundert hinein, große Beachtung fand. Der vom Anarchismus beeinflusste Flügel des Proletariats hat sich deshalb auch stets als besonders immun gegen religiöse Vorstellungen erwiesen. So hielten z. b. die anarchistischen Proletarier im spanischen Bürgerkrieg jeder Verlockung durch den Katholizismus stand.
[9] Karl Marx, „Die Heilige Familie“, in: MEW, Band 2, S. 116.
[10] Friedrich Engels, „Brief an Bernstein (1884)“, in: MEW, Band 36, S. 186.
[11] August Bebel, „Rede zum Gesetzentwurf über die Aufenthaltsbeschränkung der Jesuiten.“
[12] Rosa Luxemburg, „Einführung in die Nationalökonomie“ Gesammelte Werke, Band 5 , S. 524ff.
[13] Anton Pannekoek, „Religion und Sozialismus“, Vortrag von 1906, in: Kaiser, „Arbeiterbewegung und organisierte Religionskritik, S. 119
[14] Ebenda
[15] Anton Pannekoek, „Sozialistisches Freidenkertum“ in „Der Atheist“ Nr. 5 (1906) zitiert in Kaiser
[16] Vgl. W. I. Lenin, “Rede auf den 1. Gesamtrussischen Kongress (1918)“, in: „Über die Religion“
[17] Vgl. W. I. Lenin, „Entwurf des Programms der KPR (B)“, in: Ebenda, S. 59
[18] „Karikaturen Mohameds“, in „Weltrevolution“, Zeitschrift der IKS für Deutschland und die Schweiz, Nr. 135, 2006.
[19] Karl Marx, Kapital I, MEW 23, 94.
[20] Friedrich Engels, Flüchtlingsliteratur, MEW 18, 531ff.
[21] Der religiöse Aspekt der Rechtfertigung des nationalsozialistischen Terrors hatte z.b. seine Wurzeln bekanntlich nicht im Islam, sondern, über den Umweg der Theosophie und sonstiger okkultistischen Modeerscheinungen der „goldenen“ 20er Jahre, im Hinduismus und Buddhismus. Vermischt mit christlicher Gnosis, antiker Kultvorstellungen und vorchristlicher, barbarischer Religionsvorstellungen. Schließlich mündend in einem modernen, antisemitischen Staats – Synkretismus, der dem antisemitischen Islamismus der Moderne historisch vorausging - und ihm vor allem in nichts nachsteht.
[22] Hierin besteht auch das verzweifelte Wesen der Selbstmord – Attentäter.
[23] Karl Marx „Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie” in: MEW, Band 1, S. 378
[24] Karl. Marx, Kapital I, MEW 23, S. 93.
[25] Ebenda S., 292, Anm. 124
[26] Vgl. Max Weber, „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“
[27] Zuerst durch Martin Luther
[28] (Unter Luther, Calvin oder Zwingli)
[29] Hugenottenkriege in Frankreich, 30 Jähriger Krieg, Puritanische Revolution in England usw. Der Aufstand der Puritaner unter Cromwell endete mit der Unterdrückung der Katholiken in Irland, was bis heute seine irrationalen Spuren hinterlassen hat. Im Laufe des 30 Jährigen Krieges ging mit dem Eingreifen des katholischen Frankreichs auf Seiten des protestantischen Schwedens schon der religiöse Charakter zugunsten imperialer Herrschaftsinteressen offensichtlich verloren.
[30] Vgl. Richard Schaeffler, „Religiöse Kreativität und Säkularisierung in Europa seit der Aufklärung“, in: „Mircea Eliade – Geschichte der Religiösen Ideen“, Band 3.2 , S. 422 ff.
[31] Karl Marx, Die Heilige Familie, MEW 2, 118.
[32] Griechisch: Esoteron = Inneres. Im Gegensatz zu den missionarisch agierenden Religionen (Exoterik) handelt es sich hier um eine nach Innen gerichtete, nur für den Kreis der Eingeweihten (Initiierten) bestimmte Lehre und Methode.
[33] Siehe hierzu auch S.A. Tokarew, „Religion in der Geschichte der Völker“. Tokarew gelingt es in hervorragender Weise den Zusammenhang zwischen den Formationen der Klassengesellschaften und ihren jeweiligen Ausdrucksformen in den religiösen Ideen und Praktiken, in unzähligen Beispielen aufzuzeigen. Das Beispiel der Yoruba wird bei Tokarew nicht ausdrücklich beschrieben. Es liegen dem eigene Recherchen zugrunde.
[34] Selbst auf Kuba musste das Regime dieser Bewegung immer wieder Zugeständnisse machen. Was auch damit zusammenhängt, dass die Ifa den Einfluss des Katholizismus hervoragend kanalisieren kann.
[35] Richard Schaeffler, „Religiöse Kreativität und Säkularisierung in Europa seit der Aufklärung“, in: „Mircea Eliade – Geschichte der Religiösen Ideen“, Band 3.2 , S. 419
[36] Vgl. Ebenda
[37] Die Werke Blavatskis, Steiners und Crowlys erfahren in regelmäßigen Abständen Neuauflagen
[38] Vgl. Rüiger Sünner, „Schwarze Sonne“, S. 17 ff
[39] Der massive Eingriff des Staates in die Wirtschaft fand, mehr oder weniger, in allen am Krieg beteiligten Mächten statt, Wenn auch mit regionalen Unterschieden, deren Ursache in den besonderen historischen Bedingungen der jeweiligen Regionen zu finden sind. Faschismus – Stalinismus – New Deal – Volksfront usw.
[40] Zur Vertiefung der Materie seien hier Texte des Sozialwissenschaftlers Hartmut Zinser empfohlen. U. a. sein Buch: „ Der Markt der Religionen“, München 1997.
[41] Hier ist der Begriff „aufheben“ in seiner ganzen Vieldeutigkeit, und zugleich in seiner dialektischen Kohärenz zu betrachten, als: Bewahren, überwinden, bergen, emporheben, auflösen. In diesem Fall handelt es sich jedoch leider um eine verkehrte Aufhebung des Individuums. Als sich selbst verlieren.
[42] In Deutschland unter den Namen „Wandervögel“ bekannt. Ihr Kennzeichen war eine ausgeprägte Naturverbundenheit und eine Neigung zur schöngeistigen und spirituellen Literatur. Sie finden ihre Entsprechung am ehesten in der sog. Öko – Bewegung der 70er und 80er Jahre.
[43] (übersetz.: Evangelium)
[44] Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, 592.
[45] Friedrich Engels, „Dialektik der Natur“, MEW 20, S. 480
[46] Ab Ende der 60er Jahre des 20ten Jahrhunderts setzt sich die Anwendung von EDV und Kernkraft immer mehr durch, und verändert nachhaltig die Produktion und den Arbeitsalltag. Dabei kommt es zu großen Umgruppierungsprozessen in der Gesellschaft und zur ersten bedrohlichen Steigerung der Arbeitslosigkeit nach dem 2. Weltkrieg. Die Verunsicherung in den Metropolen nimmt enorm zu. Das bringt vor allem eine vom „Wirtschaftswunder“ desillusionierte Jugend zum Ausdruck.
[47] Es gab auch einige Fraktionen, die sich darum bemühten den Zusammenhang von Profitstreben und Umweltverschmutzung herzustellen, jedoch von der Perspektive der sozialen Revolution abgekoppelt. Jedenfalls getrennt von den sozialen Kämpfen der Arbeiter, welche sie mit der Gewerkschaft identifizierten, die die Anwendung jeder neuen Technonologie standesdünkelhaft verteidigt.
[48] Vgl.: Friedjoff Capra, „Wendezeit“.
[49] Vgl. : Marilyn Ferguson, „Die sanfte Verschwörung – Persönliche und gesellschaftliche Transformation im Zeitalter des Wassermanns.“
[50] „Einsamkeit ist die Grundbedingung für Manipulation“, bemerkte schlau einst Ulrike Meinhof.
[51] Genau diese Art von mechanischen Materialismus schlägt sich in der Auffassung nieder, dass der Mensch seine Weltanschauung von Außen in seine Blackbox/Festplatte eingespeichert bekommt. Religion/Ideologie als Füllmasse für leere Gehirne.
[52] Freuds Triebtheorie enthält jedoch selbst noch biologistische Züge. Diese können jedoch, m.E. im voranschreiten der Psychoanalyse heute als weitgehend überwunden betrachtet werden.
[53] jedoch idealistische
[54] Alfred Adler, Wilhelm Reich, Otto Gross, Friedrich Liebling, Walter Benjamin, Erich Fromm, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Horst-Eberhardt Richter....usw, usf.
[55] Siegmund Freud, Die Zukunft einer Illusion, GW 14, S. 346 ff., S. 105 ff.
[56] Heute werden vor allem auch die verhaltenstherapeutischen und systemischen Schulen vom Markt der Wunderheiler ausgebeutet. Siehe NLP oder Familienaufstellungen.
[57] Ch. Türcke, zitiert in: Maria Wölflingseder „Esoterik und die Linke“
[58] Während des Ägyptenfeldzuges Napoleons (1798) wird die Ägyptologie begründet. Diese findet ihren ersten Höhepunkt in der Entzifferung der Hieroglyphen (1822 durch Champollion). In den 40er Jahren des 19ten Jh. Kommt es zur Ausgrabung der Akropolis durch Ludwig Ross. Ab 1858 beginnt die Erforschung der Kelten durch Ausgrabungen in La Tène. Um 1870 entdeckt Schliemann Troja. Anfang des 20ten Jh. gräbt R. Koldeway Babylon aus. 1903-1905 wird Megido (Armageddon) ausgegraben. 1911 wird die Inkastadt Machu Picchu endeckt. 1928 wird Anyiang, die Hauptstadt der Chan-Dynastie ausgegraben, usw. usf. Die Entwicklung Archäologie ist untrennbar mit dem Kolonialismus und dem Imperialismus, also der gewaltsamen Schaffung und Formierung des Weltmarktes verbunden.
[59] Gemeint ist hier die sog. neue Linke, die sich nach dem Rückfluss der proletarischen Kampfwelle ab Anfang der 70er Jahre etabliert hat, und sich von da an als radikalisierte Bürgerrechtsbewegung in allen möglichen Teilbereichsbewegungen – bis heute – engagiert.
[60] U. a. Ursula Caberta - WASG Spitzenkandidatin und Chefin der Arbeitsgruppe Scientology bei der Hamburger Innenbehörde, Ulla Jelpke Öko - Politikerin u. a. m.
[61] Vgl. Christoph Boechinger, New – Age und moderne Religionen
[62] Einer der wohl bekanntesten Sprüche, welcher den Hopis unterstellt wurde, und der die Protestation, und die begrenzte Hoffnung der esoterischen Linken gut auf den Punkt bringt lautet in etwa: „Erst wenn der letzte Baum gefällt ist .............werdet ihr merken, dass ihr euer Geld nicht essen könnt.“
[63] Als die Linke beispielsweise die rechte Gesinnung des Familienaufsteller Bert Hellinger entdeckte war dieser bereits Millionär und hatte eine enorme Anhängerschaft, auch unter Linken, gewonnen. Solche Beispiele sind endlos. Als es seinerzeit in der Alternativszene bereits von orangebekleideten Leuten wimmelte kam eine Debatte über die Bagwan – Osho – Bewegung erst richtig in Gange, als dieser überall auf der Welt zu Demonstrationen für die Solidarität mit der Außenpolitik der verhassten USA aufrief. Hintergrund war der Wechsel des Geschäftsitzes von Bagwan von Pohna – Indien, wo er wegen Steuerhinterziehung verfolgt wurde, nach Oregon – USA wo er als Unternehmer zunächst herzlich aufgenommen wurde. Usw. usf.
[64] So z. B. Maria Wölflingseder, die in zahlreichen Texten, entlang einer marxistischen Wertkritik, das Geschehen auf dem Markt der Illusionen kommentiert. Oder Johann August Schülein, welcher in bemerkenswerter Weise die Funktion von „Jugendsekten“ im Kapitalismus beschrieben, und zugleich einen Beitrag für eine historisch, materialistische Betrachtung des Subjektes geliefert hat. Schließlich ist von meiner Seite noch zu erwähnen der Text „Konsum der Romantik“ von Eva Illouz, die nachweist wie die Werbung im wachsenden Maße auf die Erzeugung romantischer (auch religiöser) Gefühlszustände abzielt, und dadurch die damit verbundenen Erwartungen zugleich immer mehr in die Abhängigkeit von der Inszenierung und dem Erlebnis des Konsums geraten.
[65]Maria Wölflingseder „Esoterik und die Linke“
[66] Karl Marx „Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie” in: MEW, Band 1, S. 379
Theoretische Fragen:
- Religion [60]
Oktober 2006
- 818 reads
Demonstrationen lateinamerikanischer Immigranten in den USA:
- 2584 reads
Für die Einheit der Arbeiterklasse! Gegen die Einheit mit den Ausbeutern!
In diesem Frühling gingen Hunderttausende von eingewanderten Arbeitern, überwiegend lateinamerikanischer Herkunft, von der Bourgeoisie als “illegale Ausländer“ bezeichnet, in den wichtigsten US-amerikanischen Städten, von Los Angeles über Dallas, Chicago und Washington bis New York, auf die Straße, um gegen ein drohendes schärferes Vorgehen der Behörden gegen illegale Immigranten zu protestieren, das in einem von der Republikanischen Partei befürworteten Gesetzentwurf vorgeschlagen wurde. Es scheint, als sei diese Bewegung über Nacht ausgebrochen und aus dem Nichts gekommen. Welche Bedeutung aber hat diese Bewegung und welchen Klassencharakter trägt sie?
Dieses gegen die Immigranten gerichtete Gesetz, das auf Zustimmung im Repräsentantenhaus stieß und zu den Demonstrationen führte, würde die illegale Einwanderung kriminalisieren, indem es sie erstmals zum Straftatbestand erklären würde. Bisher stellte sie lediglich einen zivilrechtlichen Verstoß und kein kriminelles Delikt dar. Illegale würden eingesperrt, überprüft, verurteilt und abgeschoben werden und künftig jegliche Möglichkeit verlieren, jemals wieder legal in die USA zurückzukehren. Gesetze, welche es lokalen Behörden wie der Polizei, Schulen oder sozialen Einrichtungen bislang verbieten, Berichte über illegale Einwanderer an die Einwanderungsbehörden weiterzuleiten, würden aufgehoben werden und Unternehmer, die illegale Einwanderer einstellen würden, hätten Strafen zu erwarten. Durch dieses Gesetz sähen sich bis zu 12 Millionen Einwanderer von der Abschiebung bedroht. Doch dieser extreme Vorschlag besitzt nicht die Unterstützung der dominierenden Fraktion der Bourgeoisie, da er nicht mit den globalen Interessen des amerikanischen Staatskapitalismus übereinstimmt. Dieser benötigt Immigrantenarbeiter, die die Jobs im Niedriglohnbereich abdecken und als Reservearmee arbeitsloser oder unterbeschäftigter Arbeiter dienen, um die Löhne der gesamten Klasse zu senken, und hält die Idee, 12 Millionen Menschen abzuschieben, für absurd. Gegen das vorgeschlagene schärfere Vorgehen gegen Immigranten sind die Bush-Administration, die offizielle republikanische Führung im Senat, die Demokraten, die Bürgermeister vieler großer Städte, Gouverneure, Konzernchefs, die eine reichliche Versorgung mit Immigrantenrbeitern für die Ausbeutung vor allem im Einzelhandel, in Restaurants, der Fleischverarbeitung, der Landwirtschaft und der Hauskrankenpflege benötigen, und die Gewerkschaften, die sich neue Mitglieder aus dieser verarmten Arbeiterschicht versprechen. Dieser bunte Haufen von bürgerlichen „Beschützern“ der Immigrantenarbeiter favorisiert eine moderatere Gesetzgebung, die eine stärkere Sicherung der Grenzen, die drastische Reduzierung neuer Immigranten, die Legalisierung von Einwanderern, die sich schon einige Jahre in den USA befinden, und die Ausweisung derjenigen beinhalten soll, die weniger als zwei Jahre in den USA sind, wobei diese die Möglichkeit erhalten sollten, später legal zurückzukehren. Es solle eine Art von „Gastarbeiter“-Programm aufgelegt werden, die es ausländischen Arbeitern erlaubten, zeitweise in den USA legal zu arbeiten und somit die Zufuhr der benötigten billigen Arbeitskraft zu garantieren.
In diesem sozialen und politischen Zusammenhang brachen die Demonstrationen der Immigrantenarbeiter aus. Sie folgten direkt auf die Riots der zumeist arbeitslosen Immigrantenjugend in den französischen Banlieus im letzten Herbst, die Studentenrevolte in Frankreich gegen die Regierungsangriffe auf den Kündigungsschutz und den Transportarbeiterstreik in New York im Dezember und wurden von den Linken aller Schattierungen, aber auch von libertären und anarchistischen Gruppen freudig begrüßt. Es ist zweifellos richtig, dass es sich bei den durch den Gesetzesvorschlag bedrohten Einwanderern um einen Sektor der Arbeiterklasse handelt, der sich häufig mit einer besonders harten und brutalen Ausbeutung konfrontiert sieht, der eine grauenhafte Existenz erdulden muss, keinen Zugang zu sozialen Einrichtungen oder medizinischer Versorgung hat und der nach der Solidarität und Unterstützung der gesamten Arbeiterklasse verlangt. Diese Solidarität ist um so notwendiger, als die Bourgeoisie in klassischer Manier die Diskussion über den Status der Einwanderer dazu nutzt, Rassismus und Hass zu schüren und das Proletariat damit zu spalten, während sie gleichzeitig von der Ausbeutung der eingewanderten Arbeiter profitiert. Hier könnte sich in der Tat ein Kampf auf proletarischem Terrain entwickeln, aber es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was sein könnte, und dem, was tatsächlich in einer gegebenen Bewegung passiert.
Fromme Wünsche sollten uns nicht blind gegenüber dem Klassencharakter der aktuellen Demonstrationen machen, bei welchen es sich in hohem Maße um bürgerliche Manipulationen handelte. Natürlich waren Arbeiter auf den Straßen, aber sie befanden sich völlig auf dem Terrain der Bourgeoisie, die die Demonstrationen provozierte, manipulierte, kontrollierte und offen anführte. Es ist auch wahr, dass es einige Beispiele gegeben hat, wie z.B. die spontanen Streiks mexikanischer High-School-Studenten in Kalifornien - der Söhne und Töchter der Arbeiterklasse -, die bestimmte Parallelen mit der Situation in Frankreich aufwiesen, aber diese Bewegung wurde weder auf proletarischem Terrain organisiert noch von den Immigrantenrbeitern selbst kontrolliert. Die Demonstrationen, die Hunderttausende auf die Straße brachten, wurden von den spanischsprachigen Massenmedien, d.h. dem spanischsprachigen Teil der Bourgeoisie, mit der Unterstützung durch Konzerne und Politiker des Establishments inszeniert und mobilisiert.
Der Nationalismus hat die Bewegung vergiftet, ob es sich um den „Latino-Nationalismus“ handelte, der in den Anfängen der Demonstrationen zutage getreten war, um den widerlichen Anfall des Bekenntnisses zum Amerikanismus, der darauf folgte, oder um die nationalistischen und rassistischen Gegner der Einwanderer, die von rechten Radiostationen und Politikern des rechten Flügels der Republikaner angeheizt wurden. Als es Beschwerden seitens der Massenmedien gab, dass zu viele Demonstranten in Kalifornien mexikanische Flaggen mit sich geführt hätten, was bewiesen hätte, dass sie loyaler zu ihrem Vaterland als zu ihrer Wahlheimat stünden, verteilten die Organisatoren Tausende amerikanischer Flaggen, die in den folgenden Demonstrationen in anderen Städten geschwenkt wurden, um ihre Loyalität und ihren Amerikanismus unter Beweis zu stellen. Ende April wurde eine spanische Version der US-amerikanischen Nationalhymne, gesungen von bekannten hispanischen Popstars, aufgenommen und in den Radiostationen gespielt. Natürlich stürzten sich die rechten nationalistischen Gegner sofort darauf und behaupteten, die spanischsprachige Version stelle einen Angriff auf die nationale Würde dar. Die Forderung nach der Staatsbürgerschaft, die ein vollkommener bürgerlicher Legalismus ist, ist ein weiteres Beispiel für das nicht-proletarische Terrain des Kampfes. Die faulige Ideologie des Nationalismus ist dazu bestimmt, jegliche Möglichkeit für eingewanderte und einheimische Arbeiter völlig auszuschalten, ihre unverzichtbare Einheit zu erkennen.
Nirgendwo zeigte sich der kapitalistische Charakter der Bewegung deutlicher als in der Massendemonstration in New York City im April, als sich 300 000 Einwanderer vor der City Hall versammelten, und zwar unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters und Republikaners Michael Bloomberg, des demokratischen Senators Charles Schumer und Hillary Clintons, die zu ihnen sprachen und ihren Kampf als Beispiel von Amerikanismus und Patriotismus lobten.
Es ist 20 Jahre her seit der letzten bedeutenden Reform des Einwanderungsrechts durch die Reagan-Administration, die eine Amnestie für illegale Einwanderer gewährte. Aber diese Amnestie konnte die Flut der illegalen Einwanderung nicht eindämmen, die unvermindert in den letzten beiden Dekaden anhielt, und ihre Ursache darin hat, dass der amerikanische Kapitalismus eine beständige Zufuhr billiger Arbeitskraft benötigt und die Folgen des gesellschaftlichen Zerfalls des Kapitalismus in den unterentwickelten Ländern die Lebensbedingungen so verschlechtert haben, dass eine wachsende Anzahl von Arbeitern Zuflucht in den relativ stabileren und prosperierenden kapitalistischen Metropolen sucht.
Für die Bourgeoisie ist die Zeit gekommen, die Situation wieder einmal zu stabilisieren, weil es schwieriger geworden ist, eine wachsende Zahl an Einwanderern aufzunehmen und die Tatsache hinzunehmen, dass nach fast 20 Jahren der Illegalisierung Millionen von Arbeitern nicht offiziell in die Ökonomie oder die Gesellschaft integriert sind, keine Steuern entrichten und nicht gemeldet sind. Einerseits hat dies die Bush-Administration dazu bewogen, auf den ungeschickten Versuch der Einschränkung neuer Einwanderung an den Grenzen zurückzugreifen, wie beispielsweise durch die Militarisierung der Grenze zu Mexiko, die buchstäblich einem Nachbau der Berliner Mauer gleicht und es Immigranten erschweren soll, in die USA zu gelangen. Andererseits befürwortet sie nun die Legalisierung derer, die sich schon länger als zwei Jahre in den USA aufhalten. Aber gerade weil die US-Wirtschaft einen konstanten Zufluss billiger Arbeitskräfte in einem großen Teil ihrer Ökonomie benötigt, ist es höchst unwahrscheinlich, dass einige Millionen Arbeiter, die sich seit weniger als zwei Jahren in den USA aufhalten und die gesetzlich aufgefordert sind, das Land zu verlassen, dies auch tun werden. Höchstwahrscheinlich werden sie illegal im Land bleiben und damit die Basis eines künftigen illegalen Arbeitskräftereservoir bilden, das auch weiterhin notwendig sein wird, um sowohl die kapitalistische Wirtschaft mit billiger Arbeitskraft zu versorgen als auch Druck auf die Löhne der restlichen Arbeiterklasse auszuüben.
Die Widerspenstigkeit des rechten Flügels, diese Realität zu akzeptieren, verdeutlicht die zunehmende politische Irrationalität, die durch den gesellschaftlichen Zerfall geschaffen wird und sich erst kürzlich in den Schwierigkeiten der herrschenden Klasse gezeigt hat, die erwünschten Ziele in den Präsidentschaftswahlen zu erreichen. Es ist kaum zu glauben, dass die extreme Rechte die Unmöglichkeit der Abschiebung von 12 Millionen Menschen und die Notwendigkeit der Stabilisierung der Situation nicht einsieht. Es ist damit nur eine Frage der Zeit, dass die dominante Fraktion der Bourgeoisie ihre Lösung des Problems durchsetzt und die Massendemonstrationen verschwinden, sobald die Bourgeoisie dazu übergeht, die dann legalisierte Bevölkerung in den herrschenden politischen Prozess zu integrieren.
Internationalism, April 2006
Die Wahlen in Österreich – Zeichen einer Desillusionierung
- 3244 reads
Nicht nur Kanzler Schüssel zeigte sich schockiert über den Ausgang der sicher geglaubten Wahlen (und die für österreichische Verhältnisse sehr niedrige Wahlbeteiligung). Auch international zeigten sich die Herrschenden sehr beunruhigt. Wieso aber diese Unruhe? Bei Wahlen gibt es doch stets Gewinner wie Verlierer. In der Tat, doch das scheinbar Überraschende an den Wahlen in Österreich ist die Tatsache, dass eine Regierung von der Bevölkerung „abgestraft“ wurde, die aus Sicht der Bourgeoise alles richtig gemacht hat. Auch wenn dies in den deutschen Medien kaum gesagt wurde, weil man wie eifersüchtig die „Erfolgsgeschichte“ des kleinen Bruders nur ungern erwähnte, so wird doch Österreich allgemein wie etwa Schweden als Musterland präsentiert. Österreich hat Vieles bereits umgesetzt, was in Deutschland noch kommen wird, um möglichst konkurrenzfähig zu bleiben. Reformen wurden durchgesetzt, es wurden Anreize für Unternehmen geschaffen, das jährliche Staatsdefizit entspricht den Maatrichter Kriterien und die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie lange nicht mehr. So kann man es in den bürgerlichen Medien nachlesen.
Doch die ArbeiterInnen müssen mit diesen Reformen tagtäglich leben und sehen ganz einfach, was dies konkret bedeutet: Auch wenn es der Wirtschaft besser geht, so geht es uns aber immer schlechter. Hier zeigt sich, dass große Teile der Gewinne der Unternehmen auf Senkung des Faktors Arbeitskraft (variables Kapital) beruhen. Es geht den Unternehmen also besser, wenn sie die ArbeiterInnen zu mehr unbezahlter Mehrarbeit, insbesondere zu Zeitarbeitsverträgen erpressen. Sonst droht der Verlust des Arbeitsplatzes. Selbst der ARD-Korrespondent für Österreich schreibt: „Die Arbeitslosigkeit ist beneidenswert niedrig, dafür verdienen aber auch viele Menschen wenig und nur sehr wenige viel. Und alle haben sehr unsichere Arbeitsplätze. Und sie zahlen hohe Abgaben und Steuern, während die Unternehmenssteuern gesenkt wurden.“ (Online Nachrichten ARD) Die Mär, das wenn es der Wirtschaft, den Unternehmen besser geht, es auch mehr sichere Arbeitsplätze gibt, von denen man seine Familie ernähren kann, bekommt tiefe Risse. Im Übrigen ist die Krise des Kapitalismus auch in Österreich damit keineswegs gelöst. Vielmehr sind die „Reformen“ in der einstigen „Insel der Seligen“ Ausdruck der, durch die Krise erzeugten, ungeheueren Verschärfung der internationalen Konkurrenz.
Österreich – Teil einer internationalen Entwicklung
Eigentlich sind die Wahlen ein Hauptinstrument der Herrschenden, um uns ideologisch zu bearbeiten und uns das Gefühl zu geben, dass wir mit der Stimmabgabe etwas bewirken können, doch die Wahlen in Österreich (und nicht nur dort) zeigen, dass die Überzeugung der arbeitenden Bevölkerung schwindet. Heute sehen wir mehr und mehr, dass Wahlen nicht Ausdruck einer positiven Entscheidung für eine Partei, sondern negativer Ausdruck eines Abstrafens sind. In diesem Licht muss man auch das bessere Abschneiden der rechten Randparteien sehen. Sie sind ebenfalls Teil des kapitalistischen Systems. Aber mehr Glaube an die anderen Parteien besteht oft eigentlich auch nicht.
Tatsächlich ist dies eine internationale Entwicklung. Vor wenigen Wochen erst wurde im nördlichen Musterland Schweden die „Erfolgsregierung“ um Persson ebenfalls abgestraft, denn der so genannte Erfolg geht auf Kosten der arbeitenden Bevölkerung. Auch die Vorzeigeländer des ehemaligen Ostblocks Ungarn und die Slowakei brechen derzeit ein. So war der Lügenskandal in Ungarn nicht nur, dass die Bevölkerung vor den Wahlen angelogen wurde, sondern auch, dass Ungarn die Zahlen für die EU fingiert hat. Tatsächlich beträgt das jährliche Staatdefizit um die 10%! Die Lebens- und Arbeitsbedingungen der arbeitenden Bevölkerung sind dort besonders hart.
Wie überraschend war das Wahlergebnis in Österreich also wirklich? Vieles spricht dafür, dass die sozialdemokratische SPÖ – die Hauptgewinnerin dieser Wahl – weniger überrascht war als die Anführerin der abgelösten Regierungskoalition, die ÖVP. Jedenfalls war es auffallend, dass die SPÖ allen für sie negativen Umfragen zum trotz zuversichtlich in den Wahlkampf zog. Die Wahlen sind vor allem für die traditionell konservativen Fraktionen wie die ÖVP in Österreich oder die Fraktion um Merkel in Deutschland als Stimmungsbarometer von Bedeutung, während die Sozialdemokraten mittels ihrer Verbindung zu den Gewerkschaften über viel bessere und kontinuierlicher arbeitende Überwacher der Stimmungen innerhalb der Arbeiterklasse verfügen. So scheint die ÖVP erst nach der Wahl begriffen zu haben, dass der Vormarsch der Krise heute ein anderes ideologisches Vorgehen nötig macht, welches die Verarmung der arbeitenden Bevölkerung nicht mehr einfach leugnet.
Zugleich zeigt das Wahrergebnis, dass es der österreichischen Bourgeoisie nicht gelungen ist, die Partei Jörg Haiders als relativ verantwortungslosen, populistisch-politischen Ausdruck der herrschenden Klasse durch die Regierungsbeteiligung zu bändigen. Heute gibt es nicht eine, sondern gleich zwei solcher Parteien. Dennoch: Die Wahlen haben vor allem gezeigt, dass das Proletariat zwar Illusionen gegenüber der kapitalistischen Krise einbüsst, dass aber die Täuschungsmittel der Demokratie selbst – der sinkenden Wahlbeteiligung zum trotz – immer noch gut funktioniert. Denn das „Abstrafen“ tut zwar den abgestraften Politikern weh, nicht aber der herrschenden Klasse insgesamt. Aber auch damit kann man die Bevölkerung für die Stimmabgabe mobilisieren und vom Wege des Klassenkampfes ablenken. Und das Auftreten der Haiderpartei sowie der ehemaligen Haiderpartei FPÖ erlaubt der Bourgeoisie einerseits durch eine ganz offen ausländerfeindliche Hetze die Arbeiterklasse zu spalten, und gleichzeitig eine „anti-faschistische“ Anti-Haider-Stimmung zu erzeugen, welche Stimmung für die bürgerliche Demokratie macht.
Dies zeigt, dass die Abstrafung der Regierung in Österreich durch die Arbeiterklasse Teil einer allgemeinen und wichtigen Entwicklung ist. In den Medien wurde darüber spekuliert, ob Schüssel den Fehler gemacht hat, alles schön zu reden. Er hätte lieber der Bevölkerung die Wahrheit sagen sollen. Da muss man unwillkürlich an die Wahlstrategie Merkels denken, die aus einer zwischenzeitlichen absoluten Mehrheit in den Umfragen, dank eben dieser „Wahrheitsstrategie“ beinahe noch die Wahlen verloren hätte. Dies zeigt das Dilemma der Herrschenden. Wie soll man diese gesellschaftliche Sackgasse am Besten verkaufen, so dass die Arbeiterklasse all diese Angriffe selbstgenügsam erträgt? Wichtig für uns ist aber das Erkennen, dass die soziale Frage wieder in den Blickpunkt tritt. Es handelt sich um ein allmähliches Dämmern bei der arbeitenden Bevölkerung, dass diese Gesellschaftsordnung eine Sackgasse bedeutet. Die Desillusionierung und die Unzufriedenheit über die Wahlen und über das kapitalistische System insgesamt wachsen. Erst 2003 gab es in Österreich ja große Proteste gegen die so genannte Rentenreform. Der Kampfeswille der Arbeiterklasse ist also keine große Unbekannte.
IKS, 10.10.2006
Geographisch:
- Österreich [61]
Erbe der kommunistischen Linke:
Kommentare der IKS zum Leserbrief über Religion
- 3187 reads
Wir haben uns über den Beitrag des Genossen Riga zur Frage der Religion sehr gefreut, vornehmlich aus drei Gründen.
Erstens, weil der Text den Geist einer proletarischen Debattenkultur ausstrahlt. Es geht nicht um die Profilierung der eigenen Person oder darum, jemand anderem eins auszuwischen, sondern es geht um die gemeinsame, kollektive Klärung von Fragen des Klassenkampfes.
Zweitens, weil dieser Text die Erkenntnis verkörpert, dass theoretische Arbeit unerlässlich ist, um die Standpunkte und Interessen des Proletariats klar sehen zu können.
Drittens ist der Genosse sich nicht zu schade, um von der vergangenen Arbeiterbewegung – nicht nur von Marx, sondern beispielsweise auch von Vertretern des linken Flügels der Zweiten Internationalen vor 1914 zu lernen. Es gibt eine Methode, um Fragen zu klären, welche der Arbeiterbewegung eigen und zugleich die einzige wissenschaftliche Methode ist; eine Methode, die u.a. darin besteht, zunächst zu untersuchen, welche Erkenntnisse und Debatten zu einer gegebenen Frage bereits vorliegen.
Die Gottlosigkeit des Marxismus
Indem der Genosse Riga diese Methode anwendet, fördert er eine wichtige Erkenntnis zu Tage, welche jahrzehntelang durch den Einfluss des Stalinismus verdrängt wurde: dass die Gottlosigkeit des Marxismus ganz anders geartet ist als der Atheismus der Bourgeoisie. Während diese Teile der Bourgeoisie ihr Weltbild, wenn auch negativ, immer noch gegenüber dem Himmel definieren, ist der Marxismus durch eine radikale Hinwendung zum diesseitigen Leben gekennzeichnet. Das gibt dem Proletariat ganz andere Mittel in die Hand, um sich von den Fesseln der Religion zu befreien. Es ermöglicht die Erkenntnis, dass die Religion schädlich ist, weil sie uns mit unserer Ausbeutung und Misere aussöhnen lässt, weil sie den Klasseninteressen des Proletariats zuwider läuft.
Das ist auch wichtig, um die Klassenautonomie der Arbeiterbewegung verteidigen zu können. Bereits im 19. Jahrhundert haben Vertreter der radikalen Bourgeoisie den Atheismus und Antiklerikalismus als klassenversöhnende Ideologie eingesetzt, d.h. um einen klassenübergreifenden Zusammenschluss aller „laizistischen“ Kräfte (und somit der Arbeiterbewegung mit der liberalen Bourgeoisie) zu bewirken. Wie bitter nötig die im Beitrag Rigas zitierten Warnungen der Marxisten vor den Gefahren eines vom proletarischen Klassenkampf abgekoppelten Kampfes gegen Kirche und Religion waren, zeigten später die Erfahrungen des spanischen Bürgerkrieges. Die „antiklerikalen“ Vorstellungen des spanischen Anarchosyndikalismus begünstigten jedenfalls die fatale Teilnahme des CNT an der „laizistischen“ republikanischen, bürgerlichen Volksfrontregierung gegen die von der Kirche unterstützten Francoputschisten.
Vor allem der Stalinismus hat den Atheismus benutzt, um sich so besser als revolutionär und marxistisch verkaufen zu können. Dabei ist der Stalinismus nicht nur selbst ganz gut mit den traditionellen religiösen Kräften wie der orthodoxen Kirche ausgekommen, sondern hat auch selbst eine Art Ersatzreligion gestiftet, ausgestattet mit allen dazugehörigen Attributen (Dogmen und Glaubensartikel, Inquisition, eine strenge, allwissende und allmächtige, beinahe himmlische Vaterfigur à la Stalin, Mao oder Kim Il-Sung). Unserer Meinung nach liegt die Bedeutung des Textes von Riga nicht zuletzt darin, dass er eine kritisch gewordene Generation von in die Fänge des Stalinismus geratenen Proletariern helfen kann, sich von diesem Einfluss zu befreien.
Bürgerlicher oder proletarischer Materialismus
Der Unterschied zwischen bürgerlichem und proletarischem Materialismus in Bezug auf die Religion ist gleichzeitig prinzipieller und methodischer Natur. Für den bürgerlichen Materialismus des 17. und 18. Jahrhunderts in England oder Frankreich war die Religion nichts als Aberglaube und Unsinn. Dieser Materialismus war noch unhistorisch, sprich: in einer statischen Sicht der Geschichte gefangen, welche der Religion nicht unähnlich ist. Die bürgerlichen Aufklärer konnten und können auch heute ihr eigenes Erscheinen in der Geschichte nicht erklären. Es ist fast so, als ob sie selbst vom Himmel geschickt oder erleuchtet worden wären, um mit dem Aberglauben von einst aufzuräumen.
Für den Marxismus hingegen ist die Religion ein historisches Produkt, ja eine geschichtliche Notwendigkeit auf einer gewissen Entwicklungsstufe der Produktivkräfte und der Kultur, ein oft primitiver, sehr irriger, manchmal aber auch großartiger Versuch, das noch Unerklärliche begreifbar zu machen. Der Marxismus befasst sich nicht mit Gott. Er befasst sich aber sehr wohl mit der Religion als einem äußerst bedeutenden gesellschaftlichen, historischen Phänomen.
Und hier wirft der Genosse einen wichtigen Aspekt der marxistischen Auffassung auf, indem er die Ansicht von Marx über Religion als Droge thematisiert. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Der bürgerliche Materialismus geht zumeist davon aus, dass die Wurzeln der Religion allein in der Unkenntnis der Naturgesetze liegen, so dass die Entwicklung der Wissenschaft und der Bildung allein ausreichten, um die Religion überflüssig zu machen. Aber das ist nur eine der Ursachen der Macht der Religion. Die Entwicklung der Wissenschaft allein reicht keineswegs aus, um die Sehnsucht nach dem Himmel hinfällig zu machen.
Wir finden, dass Riga sich zu lange bei der Frage aufhält, ob Marx dabei die Religion als Opium des Volkes oder als Opium für das Volk bezeichnete (mehr dazu unten). Wichtiger ist die Einsicht, dass die Religion die Rolle eines geistigen Rauschmittels übernimmt. Diese Einsicht, einschließlich des Vergleiches zwischen Religion und Opium, wurde bereits vor Marx durch den Dichter Heinrich Heine gewonnen.
Wir betonen diesen Punkt, weil der Marxismus oft in dem Sinne missverstanden wird, dass der Kapitalismus allein oder aber die Ausbeutung in der Klassengesellschaft die einzige Ursache für den Bedarf an Religion wäre. Aber die Religion ist älter als der Kapitalismus, älter auch als die Klassengesellschaft. Das Elend, vor welchem der Mensch in die Religion flüchtet, ist nicht nur eine wirtschaftliche Misere, es ist das ganze Elend einer Menschheit, die noch ihre Vorgeschichte bestreitet, die noch nicht zu sich selbst gefunden hat; ein gesellschaftliches Wesen, das noch nicht in einer wirklich menschlichen Gesellschaft lebt. Die Religion, dass ist auch die kindliche Unreife der Menschheit, die unerfüllte Sehnsucht nach Liebe, die Angst vor dem Tod. Die Religion ist das Herz einer herzlosen Welt, wie Marx bereits sagte.
Die Stellung der II. Internationalen zur Religion
Die Besprechung der Stellung der II. Internationale zur Religion ist einer der interessantesten und lehrreichsten Abschnitte des Textes. Es bleibt uns hier nur übrig, auf den zum Teil zeitlich bedingten Charakter dieser Stellung hinzuweisen. Die geschichtliche Besonderheit der II. Internationale liegt darin, dass sie zu einem Zeitpunkt gegründet wurde, als die Arbeiterbewegung erkannt hatte, dass die sozialistische Revolution noch nicht auf der Tagesordnung stand, so dass es notwendig wurde, sich u.a. durch einen Kampf um Reformen innerhalb des Systems und durch die Massenorganisation der Klasse in großen Parteien und in Gewerkschaften auf die Revolution langsam vorzubereiten. So standen die Sozialisten beispielsweise vor der Aufgabe, im Parlament zu entscheiden, ob sie für oder gegen die Gesetzgebung Bismarcks gegen die katholische Kirche abstimmen (sie stimmten dagegen, wie Genosse Riga ausführt). Heute steht das revolutionäre Proletariat nicht mehr vor dieser Frage, sondern vor der Notwendigkeit, die gesamte bürgerliche Welt mitsamt ihrer Legislatur und ihrem parlamentarischen Zirkus den Garaus zu machen. Hinfällig ist ebenfalls die damalige Auffassung, derzufolge für die Mitglieder der sozialistischen Massenparteien die Religion als „Privatsache“ betrachtet wurde. In der Klassenpartei der revolutionären Epoche kann es nur für Marxisten Platz geben, dies schließt somit religiöse Ausfassungen von vornherein aus.
Der Genosse Riga wirft Lenin und den Bolschewiki in Russland vor, im Widerspruch zur Haltung von Marx und auch der 2. Internationalen zu stehen, dass man niemals Menschen aufgrund ihres Glaubens verfolgen oder auch beleidigen darf. Unserer Meinung nach übersieht Riga, dass die Bolschewiki sich in einer anderen Lage befanden als etwa Marx oder Bebel, da sie durch eine proletarische Revolution an die Macht gebracht wurden und die Aufgabe hatten, den bürgerlichen Staat und seine Institutionen – einschließlich der Kirchen – zu zerschlagen. Zu Lenins Zeiten waren sich die russischen Revolutionäre stets bewusst, dass sie die heikle Aufgabe hatten, gegen die kirchlichen Institutionen als Teil der alten Ordnung vorzugehen, ohne die Gläubigen zu verfolgen oder zu beleidigen.
„Opium für das Volk“ oder „Opium des Volkes“?
Hier rächt sich vielleicht, dass der Genosse im ersten Teil seines Beitrags die oben erwähnten Konzepte von der Religion als „Opium des Volkes“ und als „Opium für das Volk“ einander gegenüberstellt. Es handelt sich dabei um die Frage, ob die Religion existiert, weil der Einzelne im Kapitalismus aufgrund des Elends glaubt, sie nicht entbehren zu können, oder ob die Religion als Teil der Ideologie der herrschenden Klasse bewusst und systematisch gegen die Arbeiterklasse in Stellung gebracht wird. Warum dieses Entweder - Oder? In der Klassengesellschaft hat die Religion in dieser Hinsicht eine Doppelfunktion. Einerseits ist sie Opium des Volkes, um die Widrigkeiten des Lebens ertragen zu können. Andererseits ist sie Opium für das Volk, eine letztendlich unentbehrliche Waffe der Herrschenden, um ihre Herrschaft nach innen und nach außen abzusichern. So ist heute noch die Religion neben dem Nationalismus das wichtigste ideologische Mobilisierungsmittel für den imperialistischen Krieg. Rigas Text beginnt mit einer Kritik an einer Formulierung in einem Artikel der IKS, in der es um die Verurteilung des bewussten Einsatzes der Religion durch die Bourgeoisie und für den Krieg geht. Der Genosse übersieht, dass diese Aussage der IKS an dieser Stelle vollauf berechtigt war und dass dies keineswegs bedeutet, dass wir das Bedürfnis einzelner Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft und auch der Arbeiterklasse nach religiösem Trost verleugnen.
Sehr lesenswert ist die Behandlung der Rolle von religiösen Sekten im Kapitalismus in Rigas Text. Wir sind ganz einverstanden, wenn der Genosse den wachsenden Einfluss dieses Phänomens als Ausdruck der Dekadenz und heutzutage auch des Zerfalls des Kapitalismus identifiziert. Bereits in der Niedergangsphase der antiken Gesellschaft gab es eine wahre Explosion von gegeneinander konkurrierenden religiösen Sekten, von denen das Christentum nur eine war. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle noch einfügen, dass religiöse Bewegungen im Rahmen der Klassengesellschaft nicht immer Ausdruck der Interessen der herrschenden Klassen sein müssen. Das Christentum liefert uns immerhin ein Beispiel hierfür, denn es entstand zum Teil als Opposition der unterdrückten Schichten. Der „Kommunismus“ des Christentums – vornehmlich ein Kommunismus des Konsums, nicht der Produktion – hatte zwar subversives Potenzial, blieb aber in der Antike und auch im Mittelalter Ausdruck von Klassen ohne eigene gesellschaftliche Perspektive. Auch in der Anfangszeit der modernen Arbeiterbewegung, im Frühkapitalismus, nahm der – notwendigerweise noch utopische – Sozialismus oft einen religiösen, oft direkt christlichen Charakter an. Dies war allerdings noch Ausdruck der Unreife der Arbeiterklasse. Seit der Entstehung des wissenschaftlichen Sozialismus mit Marx und Engels ist jedenfalls klar geworden, dass der Sozialismus des modernen Proletariats keinen religiösen Charakter mehr haben kann. Es ist auch kein Kommunismus des Konsums allein, sondern auch und vor allem der Produktion. Diese kollektive Produktion und dieser kollektive Konsum können nicht mehr in kleinen religiösen Gemeinden wie die der Shakers in den USA im 18. und 19. Jahrhundert realisiert werden, sondern einzig und allein auf Weltebene. Viele der Sekten von heute sind gerade deshalb so erfolgreich, weil sie die Sehnsucht der Menschen nach Gemeinschaft, nach Menschlichkeit – sprich: nach Kommunismus – ausnutzen. Sie sind aber heute ein Teil des Apparates der herrschenden Klasse, um die Arbeiterklasse vom Klassenkampf, vom Kampf für den Kommunismus abzuhalten.
Hiller, für Weltrevolution, IKS.
Theoretische Fragen:
- Religion [60]
Öffentliche Diskussionsveranstaltung der IKS zum Thema: Der Krieg im Nahen Osten:
| Attachment | Size |
|---|---|
| 20.04 KB |
- 2281 reads
Ziehen wir zunächst eine erste Bilanz zum Krieg zwischen der Hisbollah im Libanon und Israel:
· 1200 Tote in beiden Ländern, von denen 90 Prozent Zivilisten und 300 Kinder waren;
Aktuelle Lage: Nach dem Krieg ist vor dem Krieg
Ziehen wir zunächst eine erste Bilanz zum Krieg zwischen der Hisbollah im Libanon und Israel:
· 1200 Tote in beiden Ländern, von denen 90 Prozent Zivilisten und 300 Kinder waren;
· eine Million Menschen auf der Flucht;
· ganze Dörfer und Stadtteile in Schutt und Asche;
· erhebliche Zerstörungen an der Infrastruktur im Libanon;
· Umweltkatastrophen wie das durch die Bombardierung verursachte Ausfließen großer Mengen Öl ins Meer.
Doch dies sind nur Zahlen und Fakten der äußeren Schäden. Sie können uns nichts sagen über das seelische Leid, die unermessliche Wut und die grenzenlose Trauer der Zivilbevölkerung, die von einem Tag auf den nächsten ihre Kinder, Eltern oder Freunde verloren hat. Das kollektive Kriegstrauma, das sich tief ins Innerste der Überlebenden eingegraben hat, wird noch sehr lange rumoren.
Wie sieht nun die aktuelle Situation aus? Es herrscht ein Waffenstillstand, genauer gesagt: eine Feuerpause, aber von Frieden keine Spur. Besteht dennoch Hoffnung auf Frieden? Schließlich ist hier und da von Friedensverhandlungen die Rede. Wenn wir jedoch einen genaueren Blick auf diese Aussagen werfen, stellen wir fest: Israel ist bereit zu Friedensverhandlungen, aber bitte nur ohne die Hisbollah. Pech nur, dass diese in der libanesischen Regierung sitzt. Und Libanon und Syrien? Von hier ist zu vernehmen, dass es Friedensverhandlungen nur ohne Israel geben kann. Man dreht sich im Kreise. Nur eines wird hieraus ersichtlich: Friedensverhandlungen wird es wohl unter diesen Umständen nicht geben. Weitere Eskalationen sind vielmehr vorprogrammiert…
Es stellt sich die Frage, ob es einen Sieger in diesem Krieg gegeben hat. Grundsätzlich sollte festgehalten werden, dass die wirtschaftlichen Schäden insgesamt schon auf etwa sechs Milliarden € geschätzt werden. So weit, so schlecht. Und auf politischer Ebene?
Was die Supermacht USA angeht, so erleben wir derzeit eine Schwächung ihrer Führungsrolle. Die USA sind militärisch in Afghanistan und im Irak gebunden und halten sich daher nun sehr bedeckt. Sie greifen weder offensiv die Hisbollah bzw. den dahinterstehenden Iran an noch entsenden sie Truppen in den Libanon. Auch Israel als regional überlegene Militärmacht hat einen großen Rückschlag hinnehmen müssen, denn das Ziel, die Hisbollah zu entwaffnen, ist offenkundig gescheitert. Schon wird Kritik in den eigenen Reihen laut. Dagegen ist die Hisbollah bei Teilen der libanesischen Bevölkerung auf der Beliebtheitsskala sicherlich kurzfristig nach oben geklettert. Der Grund liegt, wie Medien ausführlich berichteten, darin, dass die Hisbollah nun großzügig bis zu 12.000 $ an die libanesischen Kriegsopfer verteilt. Das Geld kommt bekanntermaßen aus dem Iran. Dennoch zehrt die Hisbollah von einer Guerillataktik, die auch keine Perspektive bietet. Mit anderen Worten: Es gibt keinen echten Sieger. Und eine weitere Zuspitzung der Konflikte ist keineswegs nur Spekulation.
Warum gibt es keine Hoffnung auf Frieden?
Die Hisbollah bzw. der Iran sprechen sich offen für die Vernichtung Israels aus. Israel wiederum muss aus existenziellen Gründen alle platt machen, die es zerstören wollen. Zudem erheben Israel und die Palästinenser weiterhin Anspruch auf Palästina.
Unsere These lautet: Es handelt sich hier nicht einfach um einen Krieg zwischen Israel und dem Libanon, sondern dahinter schwelt der Konflikt zwischen Israel und dem Iran um nichts Geringeres als die regionale Vormachtstellung. Bislang ist Israel die einzige Atommacht in der Region. Iran will das ändern und selbst Atombomben besitzen. Der monatelange Streit mit dem Iran um Urananreicherung hat genau hiermit zu tun. Und natürlich mischen auch die imperialistischen Großmächte kräftig mit, um ihre eigenen Interessen bestmöglich durchzusetzen.
Wie geht es weiter? Israel hat die Europäer und gezielt auch die deutsche Regierung aufgefordert, eine UN-Truppe im Nahen Osten anzuführen. Dies ist clever, weil Israel dann eigenes Militär schonen könnte. Die Europäer sind einerseits sehr interessiert daran, in dieser strategisch wichtigen Region der Welt Fuß zu fassen, andererseits ist aber auch bekannt, was für ein ausgesprochenes Minenfeld die Region ist. So erklärt sich auch die sehr zögerliche Reaktion etwa der französischen Regierung. Erst hieß es, dass 2000 Soldaten und Soldatinnen entsandt werden, dann war die Rede von nur noch 200. Erst auf allgemeinen Protest hin wurden doch 2000 Mann geschickt. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik schickt auch Deutschland Truppen, und zwar primär als Unterstützung gegen den Waffenschmuggel. Fragt sich nur, wie die Marine den Waffenschmuggel unterbinden soll, der - wie allgemein bekannt - fast ausschließlich auf dem Landweg von Iran oder Syrien in den Libanon erfolgt. Zudem hat Israel die Europäer (die hier keinesfalls als politische Einheit verstanden werden sollten – hier kämpft jeder gegen jeden) in der Hoffnung hergebeten, dass diese die Hisbollah entwaffnen. Doch schon vor Eintreffen der ersten Soldaten wurde seitens der beteiligten europäischen Mächte nachdrücklich erklärt: Sorry, aber das können wir nicht.
Zusammenfassend können wir festhalten: Der Nahe Osten ist ein Ort, wo die Gewalt immer mehr eskaliert. Kein Zufall also, dass der israelische Verteidigungsminister klarstellte, dass der derzeitige Waffenstillstand nichts anderes ist als die Vorbereitung auf den nächsten Krieg. Um aber zu einem wirklichen Verständnis von dem zu gelangen, was dort vor sich geht, denken wir, ist es unerlässlich, nach den allgemeinen Ursachen der Kriege im Nahen Osten und anderswo zu forschen.
Wir stellen die Frage an die Runde: Ist Kapitalismus ohne Krieg möglich? Oder gibt es im Nahen Osten etwa nur deswegen ständig Krieg, weil die Menschen dort eine besondere Vorliebe für den Krieg haben? Was sind denn die Gründe für diesen Wahnsinn?
Suche nach Antworten: Blick auf die Geschichte
Vor etwa 2000 Jahren begann, eingeleitet durch die Zerstörung Jerusalems durch Rom, die Vertreibung und Zerstreuung der Juden. Die meisten von ihnen gingen nach Europa. Bekannt ist, dass die Juden im Mittelalter meist religiöse Außenseiter waren (abgesehen vom arabischen Spanien der Mauren) und immer wieder Pogromen zum Opfer fielen. Im 16. Jahrhundert zwang eine päpstliche Bulle schließlich alle Juden, im Ghetto zu leben. Im 18. Jahrhundert lebten inzwischen 80 Prozent der Juden in Osteuropa. Dort ging es ihnen aber zumeist auch nicht besser. Sie litten massiv unter dem Terror der Zaren, besonders aber unter Katharina der Großen. In dieser Zeit gab es bereits erste Impulse für eine Rekolonialisierung Palästinas. Die erste massive Immigrationswelle setzte aber erst ab den 1880er Jahren ein und ging entweder in die USA oder nach Palästina. Nach etwa 2000 Jahren der Diaspora wuchs die Zahl der Juden in Palästina wieder an. War das Zufall? Keineswegs. Mit der Neuzeit entwickelte sich der Kapitalismus, und mit der bürgerlich-kapitalistischen Welt entwickelte sich auch der Nationalismus. Nun waren die Juden mehr denn je zuvor ein Fremdkörper in der nationalen Gesellschaft. Ihre Ausgrenzung war nicht mehr religiöser, sondern nationaler, politischer Natur. Es ist vielleicht nicht so bekannt, dass es in der Neuzeit z.T. schlimmere Pogrome gab als im Mittelalter – trotz Aufklärung und Humanismus. Plötzlich wurde es wichtig, einer Nation anzugehören. Die Juden aber waren in aller Welt zerstreut. Daher entstand als Gegenreaktion der Zionismus mit dem Ziel, einen Staat für die Juden zu schaffen, in dem sie sicher wären. Erst in dieser Zeit entstand auch der Hass zwischen den Juden und Arabern (beides semitische Völker), weil sie beide das gleiche Land als Heimat beanspruchten, aber nun „zwei Nationen“ waren. Das Konfliktpotenzial ist hier schon erkennbar. Viele Juden flohen nach Palästina. 1850: 12 000; 1914: 90 000; 1934: 307 000 von insgesamt 1 170 000. Vor Ort lebten die Juden meist in Städten und arbeiteten in modernen Industrien, während die Araber meist noch mehrheitlich Bauern waren, wenn sie denn nicht der kleinen herrschenden Minderheit von Großgrundbesitzern angehörten. Eine sehr interessante Tatsache, die heute kaum noch bekannt ist, ist, dass es die arabischen Großgrundbesitzer waren, die damals bereitwillig ihr Land an die Juden verkauften – Hauptsache, das Geld stimmte. Damit ermöglichten sie aber erst die Vertreibung der arabischen Bauern!
Palästina ist seit Tausenden von Jahren heiß umkämpftes Gebiet. Warum? Ein zentraler Grund ist seine geostrategische Lage! Palästina bildet nämlich die Landverbindung zwischen den drei Kontinenten Europa, Afrika und Asien. Wer also die Weltmacht anstrebt, der kommt an Palästina nicht vorbei. Es hat sowohl wirtschaftliche wie militärische Bedeutung. Ab dem 20. Jahrhundert wuchs seine Bedeutung zusätzlich durch das Öl (eine Pipeline führt nach Mossul). Die damalige Weltmacht Großbritannien betrieb eine imperialistische Politik nach der altrömischen Formel: divide et impera – teile und herrsche! Sie nutzte den jüdisch-arabischen Konflikt für sich aus. Zu einer Zuspitzung des Konfliktes kam es im Ersten Weltkrieg. Großbritannien brachte die Araber wie die Juden auf ihre Seite, indem sie in Geheimverhandlungen beiden Seiten jeweils die gleiche Belohnung versprach: das Land Palästina!
Bis zum Ersten Weltkrieg war Palästina Teil des Osmanischen Reiches. Mit dessen Zusammenbruch behielt England die Herrschaft und förderte gezielt Konflikte im Nahen Osten. Es gab diverse Bestrebungen für die Bildung von Nationalstaaten; die großen imperialen Mächte spielten sie gegenseitig aus. In den 1920-40ern nahmen die Massaker und Pogrome auf jüdischer wie auf arabischer Seite zu. 1948 forcierte England dann die Staatsgründung Israels. Allein durch die Grenzziehung waren Konflikte vorprogrammiert. Die historisch und kulturell zusammenhängenden Gebiete Palästina, Libanon und Syrien wurden erstmals auseinander gerissen. Vom ersten Tag der Gründung Israels an stand der Krieg mit den Nachbarstaaten auf der Tagesordnung. Dabei leitete Israel sein staatliche Existenzrecht aus dem Grauen des Holocaust ab. Hätten die Juden damals einen Staat gehabt, wäre ein solcher Massenmord an den Juden unmöglich gewesen, so die Begründung. Kriege und Morde aber gehen weiter, auch unter aktiver Beteiligung Israels. Seit 1948 haben alle arabischen Nachbarn ein Ziel: Weg mit Israel. Aber gleichzeitig sind sie auch gegen einen palästinensischen Staat.
Wie man sieht, ist der Konflikt im Nahen Osten uralt, und doch hat er im Kapitalismus eine neue Stufe der Barbarei und einer zuvor unbekannten Gewalt erreicht. Der Konflikt heute hat das Potenzial, sich zu einem regionalen Brandherd auszuweiten. Die Gefahr besteht eben darin, dass es sich nicht nur um einen Kampf um Territorien handelt. Man will sich darüber hinaus gegenseitig vernichten!
Gibt es einen echten Ausweg ohne faule Kompromisse?
Obwohl die Kriegsnachrichten ihn meist verdrängen, es gibt ihn doch, den Klassenkampf im Nahen Osten. Letztes Jahr gab es in Israel Proteste gegen Preiserhöhungen, gegen die Kürzungen von Sozialleistungen zugunsten erhöhter Militärausgaben. Und in Palästina gab es erst in diesem Sommer zahlreiche Demonstrationen von Arbeitern und Arbeitslosen, die Jobs forderten bzw. die Auszahlung der seit Monaten ausstehenden Löhne. Die Hamas zeigte sich rasend vor Wut angesichts dieser Streiks und donnerte, diese Streiks seien per se gegen die „nationale Sache“. Schuld an allem sei doch Israel. Ein Punkt in der Aussage trifft den Nagel aber auf den Kopf: Der Klassenkampf der arbeitenden Bevölkerung hat in der Tat mit der „nationalen Sache“ nichts zu tun. Die Arbeiterklasse hat kein Vaterland! Und gerade weil sie die einzige internationale und assoziativ agierende Klasse ist, kann auch nur die Arbeiterklasse weltweit dem nationalistischen Wahn aller Staaten oder Möchtegern-Staaten eine echte Perspektive entgegenstellen: die Klassensolidarität und den Klassenkampf für die erste echte menschliche Gesellschaft ohne Krieg. 9.9.2006 IKS
November 2006
- 717 reads
Amoklauf an Emsdettener Schule
- 3412 reads
Der Amoklauf an der Geschwister-Scholl-Realschule in Emsdetten am 21. November 2006 ist vergleichsweise glimpflich verlaufen. Am Ende gab es „nur“ ein Todesopfer zu beklagen – den achtzehnjährigen Amokläufer selbst. Wie stets in solchen Fällen, löste der tragische Vorfall im Münsterland tiefe Betroffenheit in der Bevölkerung aus. Schließlich werden gerade an den Schulen auf diese Weise sehr junge Menschen all zu früh der Gewalt und Rohheit dieser Gesellschaft hilflos ausgesetzt. Der Tod wirft seinen Schatten auf den Rest ihres Lebens.Der Amoklauf an der Geschwister-Scholl-Realschule in Emsdetten am 21. November 2006 ist vergleichsweise glimpflich verlaufen. Am Ende gab es „nur“ ein Todesopfer zu beklagen – den achtzehnjährigen Amokläufer selbst. Wie stets in solchen Fällen, löste der tragische Vorfall im Münsterland tiefe Betroffenheit in der Bevölkerung aus. Schließlich werden gerade an den Schulen auf diese Weise sehr junge Menschen all zu früh der Gewalt und Rohheit dieser Gesellschaft hilflos ausgesetzt. Der Tod wirft seinen Schatten auf den Rest ihres Lebens.
Für gewöhnlich stürzen sich die Medien und die Politik auf solche Ereignisse, um die Sensationsgier der abgestumpften bürgerlichen Gesellschaft zu befriedigen, und um die üblichen Stammtischparolen zum Besten zu geben. Geschieht das Unglück in einer amerikanischen Schule, so werden die Mythen von den schiesswütigen Cowboys jenseits des Atlantiks bemüht, welche die zivilisatorischen Errungenschaften Europas schmerzlich vermissen lassen. Geschieht Ähnliches in Europa, so wird zu den Waffen gerufen: Immer mehr Polizisten, immer mehr repressive Gesetze werden verlangt. Eine stets ausgefeiltere Überwachung der Bevölkerung von Seiten des Staates wird eingefordert.
Diesmal wird man den Eindruck nicht los, dass die Regierenden und ihre bezahlten Medien mit Verlegenheit auf die Gewalttat von Emsdetten reagieren. Man bemüht sich, die Frage der „besseren“ Überwachung von Gewaltvideospielen in den Vordergrund zu stellen. Es liegt uns fern, die Rolle solcher Videospiele herunter zu spielen. Es ist bekannt geworden, dass der Amokläufer von Emsdetten solchen Spielen zugetan war. Diese Spiele sind ein Nebenprodukt des Militarismus. Sie wurden ursprünglich entwickelt, um im Rahmen der Ausbildung von Soldaten Kampfsituationen zu simulieren. Nicht zuletzt dienen sie dazu, die Hemmschwelle zum Blutvergießen und zum Töten zu senken.
Dennoch hatte ein Lobbyist dieser Branche der kapitalistischen Unterhaltungsindustrie nicht unrecht, als er nach Emsdetten behauptete, die Kampagne gegen die Gewaltvideospiele sollen von dem eigentlichen „Skandal“ dieses Vorfalls ablenken, dass nämlich quasi Jedermann tödliche Waffen frei kaufen kann. Die herrschende Klasse verhält sich tatsächlich wie ein auf frischer Tat ertappter Dieb, seitdem die Verzweifelungstat des Sebastian B. für alle erkennbar gemacht hat, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der jeder, der über die notwendige Kaufkraft verfügt, sich mühelos Mordwerkzeuge besorgen kann. Sebastian B. war nicht nur mit mehreren Gewehren ausgerüstet, als er das Gelände seiner ehemaligen Schule betrat, sondern mit nicht weniger als zehn selbst gebastelten Rohrbomben. Die Boulevardpresse, sonst einer schier grenzenlosen Sensationslust frönend, zog es diesmal vor, sich darüber auszuschweigen, an was für einer Katastrophe die Schule und der scheinbar so friedliche Ort vorbeigeschrammt ist.
Keiner sollte behaupten, dass die Herrschenden von solchen Verhältnissen nichts gewusst haben. Seit Jahren erzählen unsere eigenen Kinder von den Zuständen an den Schulen. Sie berichten von Waffengeschäften an den Schulhöfen und von den neuen militärischen Tötungskulten unter Jugendlichen. Diese Entwicklungen sind Ausdruck einer Welt ohne Zukunft. Wenn die junge Generation sich zunehmend mit Tod und Zerstörung beschäftigt, so ist das ein sicheres Anzeichen der Perspektivlosigkeit der Gesellschaft.
Aber warum unternehmen die Verantwortlichen dieser Gesellschaft nichts, um die Gewalt wenigstens einzudämmen? Nach jedem Amoklauf werden Stimmen laut, welche eine wirkungsvollere Einschränkung der Verfügbarkeit von Waffen verlangen. Aber nichts in dieser Richtung geschieht. Freilich, die Waffenlobby ist mächtig. Aber auch die Lobby der Tabakindustrie ist mächtig, und dennoch werden Maßnahmen getroffen, um wenigstens die schädlichsten Auswirkungen des Tabakkonsums für die kapitalistische Wirtschaft selbst zu begrenzen. Der Unterschied liegt darin, dass es bei den Freiheiten der Waffenindustrie um die Ausrichtung der Gesellschaft insgesamt geht. Der Kapitalismus ist wie keine andere Gesellschaft in der Menschheitsgeschichte eine Konkurrenzgesellschaft. Als solche lebt er von und durch die Gewalt. Die herrschende Klasse ist nicht nur unfähig, die spontane Gewaltentladung, die sie selbst erzeugt, einzudämmen. Sie hat dazu auch keinen Grund. Sie benötigt Gewalt, sie lebt davon. Sie kultiviert die Gewalt, und versucht dabei, sie im Sinne ihres eigenen Klasseninteresses zu kanalisieren und zu mobilisieren.
In der Woche von Emsdetten erschien das Nachrichtenmagazin Der Spiegel mit den Titel: „Die Deutschen müssen das Töten lernen“. Eben. Der Staat braucht wieder eine Jugend, die bereit ist, mit der Waffe in der Hand fürs Vaterland zu töten und zu sterben. Die jetzigen Generationen des Proletariats sind in ihrer Widerstandskraft ungeschlagen, und wollen deshalb von blutigen Heldentaten für die Nation nichts wissen. So sieht sich die Bourgeoisie gezwungen, Schleichwege einzuschlagen, um der Jugend das Gedankengut des Militarismus einzuflössen. Auch deshalb wird gegen die Gewaltvideos im Kinderzimmer und die Waffen an den Schulen nicht vorgegangen. Der westliche, demokratische Staat ruft die Bürger zu „erhöhter Wachsamkeit“ gegenüber dem islamischen Terrorismus auf – und kultiviert selbst einen Markt der Tötungswerkzeuge und der Tötungsträume, welcher für das Leben der Bevölkerung immer bedrohlicher wird. Die „zivilisierten“ Vertreter dieses Staates ereifern sich gegenüber dem islamischen Terrorismus. Aber Emsdetten hat tief blicken lassen. Was die „Volksvertreter“ am meisten wurmt, ist, dass die „eigene“ Jugend nicht mit demselben blinden Fanatismus bereit ist, für die Interessen der kapitalistischen Gangs zu sterben.
Theoretische Fragen:
- Zerfall [8]
Erbe der kommunistischen Linke:
Internationalistische Stellungnahme aus Korea gegen die Kriegsgefahr
- 2786 reads
Ende Oktober 2006 wurde von der Socialist Political Alliance (SPA) zu einer Konferenz internationalistischer Oganisationen, Gruppen und Individuen in den südkoreanischen Städten Seoul und Ulsan eingeladen. Auch wenn die Teilnehmerzahl noch bescheiden war, handelt es sich um den ersten organisierten Ausdruck im Fernen Osten (so weit wir wissen) der Prinzipien der Kommunistischen Linken und diese Konferenz war sicherlich die erste ihrer Art. Als solche ist sie von historischer Bedeutung. Die IKS unterstützte sie von ganzem Herzen durch eine Delegation, die sich an der Konferenz beteiligte. (1)
In den Tagen vor der Konferenz wurde die langfristige politische Bedeutung der Ziele der Konferenz durch die dramatische Zuspitzung der inter-imperialistischen Spannungen in der Region überschattet, die durch die Zündung der ersten nordkoreanischen Atombombe und die Manöver ausgelöst wurde, welche insbesondere seitens der verschiedenen Staaten der Region (USA, China, Japan, Russland, Südkorea) folgten. Deshalb wurde diese Frage ausführlich auf der Konferenz diskutiert. Dies führte schließlich dazu, dass die Teilnehmer, deren Namen wir weiter unten veröffentlichen, die folgende Stellungnahme verabschiedeten.
Internationalistische Stellungnahme aus Korea gegen die Kriegsgefahr
Nach der Bekanntgabe von atomaren Tests in Nordkorea, beziehen wir, die kommunistischen Internationalisten, die sich in Seoul und Ulsan getroffen haben, wie folgt Stellung:
-
Wir verurteilen die Entwicklung neuer Atomwaffen in den Händen eines weiteren kapitalistischen Staates: Die Atomwaffe ist die letzte Waffe im interimperialistischen Krieg. Ihre einzige Funktion besteht in der massiven Vernichtung der Zivilbevölkerung im Allgemeinen und der Arbeiterklasse im Besonderen.
-
Wir verurteilen vorbehaltlos diesen neuen Schritt in Richtung Krieg, der von dem kapitalistischen Staat Nordkoreas vollzogen wurde, welcher damit erneut unter Beweis gestellt hat (wenn es dazu noch Beweise bedurfte), dass er absolut gar nichts mit der Arbeiterklasse oder dem Kommunismus zu tun hat. Dieser neue Schritt ist nichts als eine der extremsten und grotesksten Ausdrücke der allgemeinen Tendenz des dekadenten Kapitalismus zur militaristischen Barbarei.
-
Wir verurteilen vorbehaltlos die heuchlerische Kampagne der USA und ihrer Verbündeten gegen den nordkoreanischen Gegner. Diese ist nichts als eine ideologische Vorbereitung zur Durchführung ihrer eigenen vorbeugenden Militärschläge – sobald diese die Mittel dazu haben -, bei denen die arbeitende Bevölkerung zum Hauptopfer werden würde, wie das heute im Irak der Fall ist. Wir haben nicht vergessen, dass die USA die einzige Macht sind, die bislang Atomwaffen im Krieg eingesetzt haben, als sie die Zivilbevölkerung von Hiroshima und Nagasaki vernichtete.
-
Wir verurteilen vorbehaltlos die sogenannten ‚Friedensinitiativen’, die unter der Führung anderer imperialistischer Gangster wie China ergriffen werden. Dabei wird es nicht um Frieden gehen, sondern um den Schutz eigener kapitalistischer Interessen in der Region. Die Arbeiter dürfen überhaupt kein Vertrauen haben in die ‚friedlichen Absichten’ irgendeines kapitalistischen Staates.
-
Wir verurteilen vorbehaltlos jegliche Versuche der südkoreanischen Bourgeoisie, unter dem Vorwand des Schutzes der nationalen Freiheit oder der Demokratie Repressionsmaßnahmen gegen die Arbeiterklasse oder gegen Aktivisten zu ergreifen, wenn diese internationalistischen Prinzipien verteidigen.
-
Wir erklären unsere volle Unterstützung für die Arbeiter Nord und Südkoreas, Chinas, Japans und Russlands, die bei einem militärischen Eingreifen die ersten Opfer sein werden.
-
Wir erklären, dass nur der weltweite Arbeiterkampf die ständige Bedrohung der Barbarei, des imperialistischen Krieges und atomarer Vernichtung, die im Kapitalismus über der Menschheit schweben, für immer beenden kann.
Die Arbeiter haben kein Vaterland. Arbeiter aller Länder vereinigt euch!
Diese Erklärung wurde von den folgenden Organisationen und Gruppen unterzeichnet:
Internationale Kommunistische Strömung
Socialist Political Alliance (SPA) (Korea), Treffen der Seouler Gruppe am 26. Oktober 2006
Internationalist Perspectives
Eine Reihe von Genossen, die sich an der Konferenz beteiligten, haben die Stellungnahme im eigenen Namen unterzeichnet:
SJ (Seouler Gruppe Arbeiterräte)
MS (Seouler Gruppe Arbeiterräte)
LG,
JT,
JW (Ulsan)
SC (Ulsan)
BM
(1) Wir werden in kürze mehr über die Konferenz berichten.
Geographisch:
- Asien [64]
Theoretische Fragen:
- Krieg [25]
Oaxaca: Kampfbereitschaft der Arbeiter im Gezänk zwischen bürgerlichen Fraktionen gefangen
- 2785 reads
Die Repression, die der Staat auf die Bevölkerung von Oaxaca niedergehen lässt, enthüllt die wahre, blutige Fratze der Demokratie. Die Stadt Oaxaca gleicht seit mehr als fünf Monaten einem Pulverfass, auf dem die polizeilichen und paramilitärischen Kräfte die wichtigsten Hebel gewesen sind, um den staatlichen Terror auszubreiten. Die Hausdurchsuchungen, die Entführungen und die Folter sind die Mittel, die der Staat in Oaxaca benützt, um „Ruhe und Ordnung“ wiederherzustellen. Das Ergebnis des Polizeieinsatzes ist nicht eine “saubere Sache“, wie die Regierung sagt, vielmehr hinterließ er Dutzende von “Verschwundenen“, verschiedene Gefangene und mindestens drei Tote (ohne die rund 20 Personen mit zu rechnen, die von weißen Garden von Mai bis Oktober dieses Jahres umgebracht wurden).
Die herrschende Klasse verkündete vor 6 Jahren, dass wir durch den Antritt der Regierung Fox in eine „Periode des Wandels“ eingetreten seien, doch die Wirklichkeit offenbarte, dass der Kapitalismus trotz allen Wechseln im Personal oder bei den Parteien keine Verbesserung bringt… wie nie zuvor hat sich bestätigt, dass das einzige, was dieses System bringen kann, eine vermehrte Ausbeutung, mehr Elend und Repression sind. Angesichts der Ereignisse der letzten Zeit in Oaxaca sollte die gesamte Arbeiterklasse eine vertiefte Reflexion durchführen, bei der erkannt werden muss, dass die brutale und repressive Handlungsweise nicht einfach eine Eigenheit einer bestimmten Regierung oder eines Beamten ist, sondern dass sie zum Wesen des Kapitalismus gehört. Gleichzeitig müssen wir die Schwächen und Schwierigkeiten, vor denen die Arbeiterklasse steht, erkennen. Es braucht eine allgemeine Bilanz über die Bedeutung dieser Mobilisierungen, und zwar so, dass diese Sorgen Teil der Reflexion sind und die Lehren gezogen werden können, die eine angemessene Vorbereitung der zukünftigen Kämpfe erlauben.
Die Bourgeoisie dämmt die Unzufriedenheit ein und lenkt sie auf ihre Mühlen
Die Demonstrationen in Oaxaca sind zweifellos Ausdruck einer bestehenden Unzufriedenheit der Arbeiter gegen die Ausbeutung und Zumutungen des Kapitalismus. Die heutigen Mobilisierungen in dieser Region fassen die Unzufriedenheit unter den Ausgebeuteten über die fortschreitende Verschlechterung der Lebensbedingungen zusammen, sie drücken einen aufrichtigen Mut und eine Kampfbereitschaft aus, doch ist diese Kraft in der Falle der Bourgeoisie gefangen worden, der es gelungen ist, die Ziele, die Methoden und die Durchführung der Aktionen der Kontrolle der Arbeiterklasse zu entringen.
Die Bourgeoisie konnte mit dem Streit, der in ihren eigenen Reihen entstanden war, die gesellschaftliche Unzufriedenheit einfangen, kanalisieren und auf ihre Mühlen lenken. Dabei verwandelte sie das, was zunächst ein Kampf um besseren Lohn war, in eine perspektivlose Bewegung, die stecken blieb bei der Ablehnung einer Fraktion der Bourgeoisie, die aus alten Kaziken besteht, und der Unterstützung für eine Fraktion der „Demokratisierung“. Die Abdankung eines Ulises Ruiz zu fordern bedeutet nichts anderes als die ausdrückliche Unterstützung derjenigen Bande, die ihn ablösen will. Vor diese falsche Wahl gestellt, verlieren die Arbeiter in jedem Fall, und ihre Kraft als Klasse verwandelt sich in eine Manövriermasse der Bourgeoisie. Die herrschende Klasse hat schon vor den Mai-Demonstrationen versucht, die Massen der Ausgebeuteten als „Druckmittel“ gegen die eine oder andere bürgerliche Fraktion im Streit zu benützen. Die offene Intervention von Esther Gordillo, von Murat, oder Ulises Ruiz selber sowie weiteren Politikern, die durch die Lehrergewerkschaft (SNTE-CNTE, einschließlich der “kritischen” Teile wie des CCL), zeigt, wie die Interessen der Bourgeoisie, vor allem diejenigen der Kaziken dieser südlichen Region, die Unzufriedenheit gelenkt und ausgenützt haben. Ein Kampf, der mit einer Stoßrichtung gegen das Elend und einer Kritik der kapitalistischen Ausbeutung begonnen hat, hat sich in eine Mobilisierung verwandelt, die das Elend mit einer „schlechten Führung“ durch die sich an der Macht befindende Bande erklären will und sich mit der Suche nach einer Demokratisierung des Systems zufrieden gibt.
Gegenüber diesen Mobilisierungen hat das System offen sein blutiges Wesen gezeigt, doch geht der Gebrauch des Terrors durch den Staat über die Repression gegen die Demonstranten von Oaxaca hinaus. Der Einsatz des Militärs und der Polizei in Oaxaca zielte nicht hauptsächlich auf die Vernichtung der „Volksversammlung des Volkes von Oaxaca“ (Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, APPO) ab, sondern versuchte vielmehr, den Terror als Methode der Warnung und der Drohung gegenüber allen Arbeitern durchzusetzen. Der Staatsterror breitete sich aus in der Kombination von Repressionskräften der Bundes- und der Staatsregierung, was einmal mehr bewies, dass die verschiedenen im Streit liegenden Banden der Bourgeoisie durchaus zu Absprachen gelangen können, wenn es darum geht, Unterdrückungsmaßnahmen zu ergreifen. Deshalb nährt die Annahme, dass es möglich sei, mit einem Teil der Regierung einen „Dialog zu führen“, nur die falsche Hoffnung, es gebe “fortschrittliche” oder “offene” Sektoren der Bourgeoisie. Genau aus diesem Grund ist die Haltung, die darin besteht, mit diesen Mobilisierungen hauptsächlich den Abgang von Ulises Ruiz als Gouverneur von Oaxaca zu fordern, Werbung für die Illusion, dass sich das kapitalistische System auf dem Weg der Demokratisierung oder der Auswechslung des Regierenden verbessern lasse. Wenn die Reflexion behindert und die gesellschaftliche Kraft auf die Absetzung von Ulises Ruiz umgelenkt wird, so bringt dies die Entwicklung des Bewusstseins nicht weiter, sondern vergrößert die Verwirrung und stärkt das Vertrauen in die Möglichkeit, dass die Ausgebeuteten mit einer „besseren Regierung“ etwas zu gewinnen hätten.
Was die APPO mit ihrer Parole der “Vereinigung” gegen Ulises Ruiz gemacht hat, ist nicht ein Impuls für die gemeinsame Reflexion und das bewusste Handeln, sondern eine Ausbreitung der Verwirrung und die Unterwerfung der gesellschaftlichen Kraft unter die Interessen von gewissen Fraktionen der Bourgeoisie, die sich in den Haaren liegen.
Der beste Beweis dafür, dass der Kampf die Klarheit seiner Ziele verloren hat und nun für die indirekte Unterstützung einer Fraktion der Bourgeoise missbraucht wird, ist der Umstand, dass die Forderung der Lohnerhöhung in den Hintergrund geschoben wurde und der Ablehnung des Gouverneurs weichen musste. Damit gelang es der Gewerkschaft und der Bundesregierung, das Problem der Lohnerhöhung als eine technische Angelegenheit zu behandeln, als ein Frage der angemessenen Verteilung der Mittel in einer bestimmten Region durch eine entsprechende Planung in den öffentlichen Finanzen. Damit wurde das Problem isoliert, das Sinken der Löhne als ein “lokales” Problem - ohne Bedeutung für die übrigen Lohnabhängigen - dargestellt.
Gleichzeitig sind die angewandten Kampfmethoden – Mahnwachen, ermüdende Märsche, Blockaden und perspektivlose Konfrontationen – keine Mittel, um die Solidarität zu wecken, sondern umgekehrt der Weg in die Isolation, wo die Leute ein leichte Zielscheibe der Repression werden.
Ebenso wenig helfen die “propagandistischen Bomben”, die die Guerilla gelegt hat, bei der Vertiefung des Bewusstseins, geschweige denn, dass sie das System schwächen würden. Im Gegenteil: Sie sind ein Ausdruck der Verzweiflung von Deklassierten, wenn sie nicht sogar direkt durch den Staat gelegt wurden, damit er einen “Vorwand” für die Entfesselung der Repression hat.
APPO: ein dem Proletariat fremdes Mittel
Die gesellschaftliche Zusammensetzung der APPO (die aus “sozialen” und gewerkschaftlichen Organisationen besteht) macht deutlich, dass die Kontrolle über diese Organisation (und über ihre Entscheide) nicht in den Händen der Arbeiter liegt. Deren Struktur ist zutiefst geprägt von nicht lohnabhängigen Sektoren (was schon ein Beleg für ihre Schwäche ist); hinzu kommt aber und vor allem, dass die Diskussion und die Vertiefung der Führung der Gewerkschaften und von Gruppen des linken Apparats des Kapitals überlassen wird (die direkt oder indirekt mit den Interessen von Fraktionen der Bourgeoisie verbunden sind), was erkennen lässt, dass ihr Wesen nicht proletarisch ist. Dies führt zur Auflösung des Kraftpotenzials der Arbeiter, die sich daran beteiligen. Diese Kraft kann sich nicht in einer Struktur ausdrücken, in der sich trotz der scheinbaren Organisationsform von offenen Vollversammlungen in der Praxis selber ihr wahres Wesen offenbart, nämlich das einer klassenübergreifenden Front, die von der Konfusion und der Verzweiflung von Zwischenklassen und –schichten gelenkt wird. Diese Tatsache wurde unterstrichen durch den Aufruf, den sie machte, um sich in eine dauerhafte Struktur zu verwandeln (die Staatliche Versammlung der Völker von Oaxaca). In ihrer Versammlung vom 9. November 2006 umschreibt sie die von der mexikanischen Bourgeoisie 1917 geschaffene Verfassung als ein “historisches Dokument, das für die emanzipatorische Tradition unseres Volkes steht…“, weshalb sie zu ihrer Verteidigung aufruft wie auch zu derjenigen “... des Landes und der Bodenschätze…“ Mit anderen Worten beschränkt sich der Radikalismus der APPO auf die Verteidigung der nationalistischen Ideologie, die ein wahrhaftiges Gift für die Arbeiter ist. Darüber hinaus missbrauchen sie die Etikette des proletarischen Internationalismus, indem sie in ihrer Versammlung die Notwendigkeit unterstreichen, „Verbindungen der Zusammenarbeit, der Solidarität und Brüderlichkeit mit allen Völkern dieser Erde zu knüpfen, um eine gerecht, freie und demokratische Gesellschaft aufzubauen; eine wirklich menschliche Gesellschaft…“, und zu diesem Zweck, so sagen sie weiter, würden sie für „die Demokratisierung der UNO …“ streiten.
Die Gründung der APPO bedeutete für die Arbeiterbewegung keinen Fortschritt, im Gegenteil: Sie kann nicht getrennt werden von der Unterwerfung der ursprünglichen Unzufriedenheit der Arbeiter unter die Kontrolle der Bourgeoisie. Die APPO entstand als “Zwangsjacke”, um die proletarische Kampfbereitschaft einzupacken. Die stalinistischen, maoistischen und trotzkistischen Gruppen sowie die Gewerkschaften, aus denen die APPO besteht, wussten, wie man den Mut und den Ausdruck der Solidarität entstellen und gleichzeitig der Bewegung eine Richtung geben kann, die sie weit weg führt von den Interessen der Arbeiter und der übrigen Ausgebeuteten. Aus diesem Grund sind die Vergleiche, die zwischen der APPO und Strukturen wie den Arbeiterräten oder „Embryonen der Arbeitermacht“ gezogen werden, ein hinterlistiger Angriff auf die wirkliche Tradition der Arbeiterbewegung.
Die proletarische Organisation unterscheidet sich dadurch, dass die Ziele, die sie verfolgt, in einem direkten Bezug stehen zu den Interessen und Bedürfnissen als Klasse, d.h. zur Verteidigung ihrer Lebensbedingungen. Sie verfolgt nicht den Zweck der Verteidigung der „nationalen Wirtschaft“, von Staatsbetrieben, und schon gar nicht denjenigen der Demokratisierung des Systems, das uns ausbeutet; sie trachtet in erster Linie danach, eine politische Unabhängigkeit von der herrschenden Klasse zu wahren, die es ihr erlaubt, den Kampf gegen den Kapitalismus aufzunehmen.
Aus diesem Grund sind die Forderungskämpfe der Arbeiter die Vorbereitung auf die radikale Kritik der Ausbeutung, sie sind ein Widerstand gegen die kapitalistischen Wirtschaftsgesetze; und die Radikalisierung desselben zeigt den Weg zur Revolution. Dies sind verschiedene Momente der Vorbereitung auf die revolutionären Kämpfe, denen sich das Proletariat wird stellen müssen. Sie sind der Keim des revolutionären Kampfes.
Organisation und Bewusstsein, die Waffen der Arbeiter, um dem Kapitalismus entgegenzutreten
Die Arbeiter sind eine internationale und internationalistische Klasse; als solche müssen sie sich die Erfahrungen ihrer vergangenen Kämpfe zu eigen machen; deshalb ist es für die Entwicklung des Bewusstseins wichtig, die Lehren aus den Mobilisierungen der Studenten und Arbeiter im Frühjahr 2006 in Frankreich gegen den Erstanstellungsvertrag (CPE) zu ziehen. Das Wichtige dieser Mobilisierungen bestand in der Fähigkeit, sich zu organisieren, womit es auch gelang, die Kontrolle über den Kampf so weit zu behalten, dass die Gewerkschaften und die Linken es nicht schafften, ihn vom zentralen Ziel des Widerstandes gegen den CPE abzulenken. In die gleiche Richtung entwickelte sich die Mobilisierung der Arbeiter in Vigo/Spanien im Mai 2006, denen es gelang, der Sabotage der Gewerkschaften etwas entgegen zu setzen und die Lohnforderungen durch die Kontrolle über ihre Vollversammlungen und die Ausweitung des Kampfes zu verteidigen.
Die Verteidigung unserer Lebensbedingungen, die organisatorische Unabhängigkeit und die massenhafte Vertiefung des Bewusstseins - das sind die Errungenschaften dieser Bewegungen. Die Lehren aus diesen Erfahrungen gehören dem Proletariat insgesamt. Diese Saat soll in den kommenden Kämpfen aufgehen.
18. November 2006
Proletarier aller Länder, vereinigt euch!
Theoretische Fragen:
- Arbeiterklasse [58]
Dezember 2006
- 742 reads
Die Entwicklung des Kapitalismus und die neue Perspektive - Internationalisme 1952
- 5395 reads
Der hier veröffentlichte Text erschien erstmals in der Nr.46 von "Internationalisme" im Sommer 1952. Das war die letzte Nummer dieser Zeitschrift, und der Artikel enthält, wie schon der Titel sagt, in gewisser Hinsicht eine zusammengefasste Bilanz der Positionen und politischen Orientierungspunkte dieser Gruppe. Deshalb ist er von besonderem Interesse. Was klargestellt werden muss, ist der Unterschied zwischen der Perspektive, wie sie sich aus dem Text ergibt, und der, die wir heute erkennen können. "Internationalisme" analysierte die Periode nach dem zweiten Weltkrieg richtig als eine Fortführung der Reaktion und des Rückflusses des proletarischen Klassenkampfs. Als Konsequenz davon verurteilte "Internationalisme" den bordigistischen Aufruf zur Gründung der Partei als künstlich und abenteuerlich. Ebenfalls richtig war die Behauptung, dass der Kapitalismus mit dem Ende des zweiten Weltkrieges nicht aus seiner dekadenten Phase austrat, und dass alle Widersprüche, die den Kapitalismus in den Krieg geführt hatten, ihn unerbittlich in neue Kriege stoßen würden. Aber "Internationalisme" merkte nicht oder stellte nicht genügend klar, was die Phase des Wiederaufbaus im Zyklus Krise-Krieg-Wiederaufbau bedeutete. Aus diesem Grund und im Kontext des Kalten Krieges USA-UDSSR sah "Internationalisme" keine Möglichkeit des Wiedererstarkens des Proletariats. Es sah diese Möglichkeit erst im Zusammenhang mit einem dritten Weltkrieg. Es gibt auch heute noch Revolutionäre, die diese Vorstellung vertreten. Die Krise jedoch, die notwendigerweise der Wiederaufbauphase folgte, und während derer viele Mystifikationen zerstört wurden, hat ein Wiedererstarken des Kampfes der Arbeiterklasse erlaubt, und den Weltkapitalismus aufgrund seiner inneren Widersprüche dazu gezwungen, seinen Klassenfeind anzugreifen. Wenn die Perspektive der Unvermeidbarkeit eines dritten Weltkrieges im Kontext der 50er Jahre verstanden werden muss, in denen es dazu auch eine reale Gefahr gab, so gibt es heutzutage keinen Grund mehr, diese Auffassung aufrecht zu erhalten. Der Kapitalismus findet heute in den lokalen Kriegen ein Ventil für seine Widersprüche und Antagonismen, aber er kann keinen generalisierten Krieg führen, solange er das Proletariat nicht erfolgreich geschlagen hat. Eine Bewegungslosigkeit und Passivität des Proletariats kann er nur erreichen, indem er die Arbeiterklasse offen angreift und die Kampfkraft der Arbeiter zerdrückt. Es ist genau diese Konfrontation, dieser neue Angriff, welche heute unsere Perspektive darstellen. Nichts erlaubt uns, einen ungünstigen Ausgang dieser kommenden Konfrontationen vorherzusagen. Mit all ihren Kräften müssen die Revolutionäre den Erfolg des Kampfes ihrer Klasse unterstützen.
Révolution Internationale 1974
Der hier veröffentlichte Text erschien erstmals in der Nr.46 von "Internationalisme" im Sommer 1952. Das war die letzte Nummer dieser Zeitschrift, und der Artikel enthält, wie schon der Titel sagt, in gewisser Hinsicht eine zusammengefasste Bilanz der Positionen und politischen Orientierungspunkte dieser Gruppe. Deshalb ist er von besonderem Interesse. Was klargestellt werden muss, ist der Unterschied zwischen der Perspektive, wie sie sich aus dem Text ergibt, und der, die wir heute erkennen können. "Internationalisme" analysierte die Periode nach dem zweiten Weltkrieg richtig als eine Fortführung der Reaktion und des Rückflusses des proletarischen Klassenkampfs. Als Konsequenz davon verurteilte "Internationalisme" den bordigistischen Aufruf zur Gründung der Partei als künstlich und abenteuerlich. Ebenfalls richtig war die Behauptung, dass der Kapitalismus mit dem Ende des zweiten Weltkrieges nicht aus seiner dekadenten Phase austrat, und dass alle Widersprüche, die den Kapitalismus in den Krieg geführt hatten, ihn unerbittlich in neue Kriege stoßen würden. Aber "Internationalisme" merkte nicht oder stellte nicht genügend klar, was die Phase des Wiederaufbaus im Zyklus Krise-Krieg-Wiederaufbau bedeutete. Aus diesem Grund und im Kontext des Kalten Krieges USA-UDSSR sah "Internationalisme" keine Möglichkeit des Wiedererstarkens des Proletariats. Es sah diese Möglichkeit erst im Zusammenhang mit einem dritten Weltkrieg. Es gibt auch heute noch Revolutionäre, die diese Vorstellung vertreten. Die Krise jedoch, die notwendigerweise der Wiederaufbauphase folgte, und während derer viele Mystifikationen zerstört wurden, hat ein Wiedererstarken des Kampfes der Arbeiterklasse erlaubt, und den Weltkapitalismus aufgrund seiner inneren Widersprüche dazu gezwungen, seinen Klassenfeind anzugreifen. Wenn die Perspektive der Unvermeidbarkeit eines dritten Weltkrieges im Kontext der 50er Jahre verstanden werden muss, in denen es dazu auch eine reale Gefahr gab, so gibt es heutzutage keinen Grund mehr, diese Auffassung aufrecht zu erhalten. Der Kapitalismus findet heute in den lokalen Kriegen ein Ventil für seine Widersprüche und Antagonismen, aber er kann keinen generalisierten Krieg führen, solange er das Proletariat nicht erfolgreich geschlagen hat. Eine Bewegungslosigkeit und Passivität des Proletariats kann er nur erreichen, indem er die Arbeiterklasse offen angreift und die Kampfkraft der Arbeiter zerdrückt. Es ist genau diese Konfrontation, dieser neue Angriff, welche heute unsere Perspektive darstellen. Nichts erlaubt uns, einen ungünstigen Ausgang dieser kommenden Konfrontationen vorherzusagen. Mit all ihren Kräften müssen die Revolutionäre den Erfolg des Kampfes ihrer Klasse unterstützen.
Révolution Internationale 1974
0 0 0
Wir veröffentlichen hier eine Reihe von Referaten, die im Laufe von gemeinsamen Treffen mit Genossen der "Union Ouvriere Internationaliste" entstanden sind. Um eine möglichst schnelle Diskussion darüber zu ermöglichen, geben wir sie hier in einer zergliederten Form wieder. Dadurch ergibt sich, dass der Leser keine statistischen Hinweise und keine genauen Darlegungen finden wird. Es ist dem Genossen M. überlassen, der die Verantwortung für seine Referate trägt, sie zu erweitern oder ihnen die nötigen Ausführungen zuzufügen. Wir wünschen uns eine Diskussion, die so breit wie möglich ist, sich jedoch an den Texten orientiert. Es ist überflüssig, auf der Wichtigkeit einer solchen Diskussion und der Veröffentlichung aller dazugehörenden Dokumente zu beharren.
Die Entwicklung des Kapitalismus und die neue Perspektive
Bevor wir die generellen Charakteristiken des Kapitalismus auf seiner heutigen Stufe des Staatskapitalismus darlegen, ist es notwendig, sich an die Grundzüge der kapitalistischen Produktionsweise zu erinnern und diese zu verdeutlichen. Das ganze ökonomische System, das mit einer Klassengesellschaft verbunden ist, hat den Zweck der Ausbeutung der Mehrarbeit der Arbeiterklasse zugunsten der ausbeutenden Klasse. Was die verschiedenen Systeme unterscheidet, ist die Art der Aneignung der Mehrarbeit durch die herrschende und ausbeutende Klasse und die der Entwicklung der Produktivkräfte, die dadurch einen unabdingbaren Charakter erhält. Wir beschränken uns hier darauf, die wesentlichsten Grundzüge der kapitalistischen Ausbeutung der Arbeitskraft in Erinnerung zu rufen.
Die Trennung der Produktionsmittel vom Produzenten
Geleistete und angeeignete Arbeit ist tote Arbeit. Sie, die tote Arbeit beherrscht und beutet die jetzige Arbeit(skraft) aus, die lebendige Arbeit. Mit anderen Worten: Weil die Kapitalisten (nicht individuell, sondern als Klasse) die tote Arbeit d.h. die Produktionsmittel besitzen, können sie die Arbeit der Proletarier ausbeuten. Das ganze wirtschaftliche Leben ist der Suche nach Profit untergeordnet. Dieser Profit wird teils durch die Bourgeoisie verzehrt, zum größten Teil aber dient er der Wiederherstellung (Reproduktion) und Erweiterung des Kapitals.
Die Produktion als Warenproduktion
Die Beziehungen der einzelnen Gesellschaftsmitglieder nehmen die Form von Warenbeziehungen an. Die Arbeitskraft selbst ist eine Ware, die zu ihrem Wert bezahlt wird: dieser Wert ist der Wert der Produkte, die zur Wiederherstellung der Arbeitskraft notwendig sind. Die Zunahme der Arbeitsproduktivität senkt den Wert der Waren,
die von der Arbeiterklasse konsumiert werden und folglich auch den Wert der Arbeitskraft selbst. Somit vermindert sich auch der Lohn im Verhältnis zum Mehrwert. Je mehr sich die Produktivität erhöht und der Anteil der Arbeiter sich vermindert in dieser Produktion, desto mehr sinkt auch der Arbeitslohn, gemessen an dieser erhöhten Produktion. Der Warenaustausch findet auf dem Gesetz des Wertes dieser Waren statt (Wertgesetz). Dieser Warenaustausch wird gemessen durch die Menge gesellschaftlich notwendiger Arbeit, die für die Produktion der Waren verwendet wird. Diese Charakteristiken, die wir hier aufgezählt haben, findet man in jedem Stadium der Entwicklung des Kapitalismus vor. Die Entwicklung hat diese Grundzüge ohne Zweifel verändert. Aber diese Veränderungen, die sich innerhalb des Kapitalismus abspielen, bleiben zweitrangig, sie verändern das kapitalistische System nicht grundlegend.
Die Aneignungsweise
Man kann den Kapitalismus nicht analysieren, ohne sein Wesen zu erfassen: das Verhältnis Kapital - Arbeit. Man muss das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit betrachten und nicht das zwischen Kapitalisten und Arbeitern. In den vorkapitalistischen Gesellschaften gründete der Besitz an Produktionsmitteln auf der individuellen persönlichen Arbeit. Der Besitz an Produktionsmitteln war tatsächlich Privatbesitz, so waren auch die Sklaven Produktionsmittel. Der Besitzer der Produktionsmittel war selbständig und diese Selbständigkeit war nur begrenzt durch Abgaben an Stärkere (Zolltribute, Lehensabgaben). Mit dem Kapitalismus gründete sich der Besitz an Produktionsmitteln auf der gesellschaftlichen Arbeit. Der Kapitalist ist dem Marktgesetz unterworfen. Seine Freiheit ist innerhalb wie außerhalb seines Unternehmens begrenzt. Er kann nicht "auf Verlust" produzieren, indem er die Marktgesetze überschreitet. Das Ergebnis wäre der sofortige Konkurs. Dies würde jedoch nur den Konkurs des Einzelkapitalisten bedeuten und nicht den Fall der Kapitalisten als Klasse. Der Grund liegt darin, dass die Bourgeoisie als Klasse kollektiver Besitzer der Produktionsmittel der ganzen Gesellschaft ist. Die Lage des Einzelkapitalisten ist instabil und wird dauernd in Frage gestellt. Auch Marx bestätigte dies: "Die aus der kapitalistischen Produktionsweise hervorgehende kapitalistische Aneignungsweise, daher das kapitalistische Privateigentum, ist die erste Negation des individuellen, auf eigene Arbeit gegründeten Privateigentums." ("Das Kapital", Band 1, Seite 791). Denn der kapitalistische Besitz ist Besitz der Kapitalistenklasse als solches. Diesen Sachverhalt zeigte Marx in seinem Werk "Zur Kritik der Politischen Ökonomie" auf, nämlich dass die Besitzverhältnisse "juristischer Ausdruck für die Produktionsverhältnisse sind". Der Privatbesitz des Einzelkapitalisten an seinem Betrieb steht in einem engen Verhältnis mit der jeweiligen Phase des Kapitalismus. Er ist notwendigerweise gebunden an das tiefe Niveau der Produktivkräfte und an die Tatsache, dass das kapitalistische Expansionsfeld noch weiträumig ist und nicht einer übergeordneten Art der Konzentration des Besitzes unterliegt. Unter diesen Bedingungen war der Eingriff des Staates in die Wirtschaft zufällig, der Staat blieb ein politischer Organismus, mit der Regelung der Gesellschaft im Interesse der Kapitalisten beauftragt. Wenn jedoch das tiefe Niveau der Entwicklung der Produktivkräfte die Existenz einer globalen privaten kapitalistischen Fraktion nach sich zieht (gebildet durch ihre Unternehmungen), folgt daraus nicht automatisch, dass ein hohes Niveau der Produktivkraftentwicklung den Rückgriff auf den Staatskapitalismus erfordert. Das hohe Niveau der Entwicklung der Produktivkräfte produziert ganz sicher eine Besitzkonzentration, wie man sie mit der Aktiengesellschaft und dem Monopol erlebt. Aber es genügt nicht, sich nur darauf zu berufen, um den Rückgriff des Kapitalismus auf den Staatskapitalismus zu erklären. Eigentlich, gemäß der strengen Logik des Eigentums, hätte und hat sich teilweise auch die Konzentration anders, d. h. monopolistisch auf internationalem Maßstab (z.B. in Kartellen) entwickeln können, statt in nationalem Rahmen, der alle Formen staatlichen Besitzes beinhaltet.
Der Kapitalismus als historisch notwendige Etappe für die Errichtung des Sozialismus
Einer der wichtigsten Wesenszüge der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen ist der, dass das Ergebnis der gemeinsamen Produktion nicht dazu dient, die gemeinsamen Bedürfnisse der menschlichen Gesellschaft zu befriedigen. Es existiert ein Kampf um die Aufteilung der Güter oder, anders gesagt, um die Ausbeutung der Arbeit(skraft). Auch die historische Möglichkeit der Emanzipation der Arbeiterklasse kann es nicht sofort ermöglichen, die gesamten Bedürfnisse der Gesellschaft zu decken, ohne ein bestimmtes Niveau der Entwicklung der Produktivkräfte erreicht zu haben. Um den Sozialismus, die klassenlose Gesellschaft zu errichten, ist es notwendig, diesen Stand der Produktivkraftentwicklung abzuwarten, der es erlaubt die alten Klassenwidersprüche zu liquidieren. Der Kapitalismus, der die Produktivkräfte entwickelt hat, stellt somit eine notwendige Vorstufe zur Errichtung des Sozialismus dar. Nur auf den Errungenschaften des Kapitalismus kann der Sozialismus aufgebaut werden. Man kann also nicht wie die Anarchisten behaupten, dass eine sozialistische Perspektive offen war, als sich die Produktivkräfte zurückentwickelten oder auf ihrem Niveau stehen blieben. Der Kapitalismus stellt eine notwendige und unumgängliche Etappe zur Errichtung des Sozialismus dar. Nur der Kapitalismus kann die objektiven Bedingungen für den Sozialismus entwickeln. Aber im aktuellen Stadium des Kapitalismus, und darüber sprechen wir, ist der Kapitalismus eine Bremse zur Entwicklung d. Produktivkräfte geworden. Je länger der Kapitalismus andauert, desto mehr verschlechtern sich die Bedingungen für den Sozialismus. Die Frage, die sich heute stellt, ist die zwischen der historische Alternative Sozialismus oder Barbarei.
Die verschiedenen Theorien über die Entwicklung des Kapitalismus
Als Marx die Entwicklung des Kapitalismus analysierte, konnte er dies nicht anhand von konkreten Grundlagen (Zahlen) über die höchstentwickelten Stufen des Kapitalismus tun. Diese Aufgabe mussten seine Nachfolger übernehmen. Dabei entstanden verschiedene Theorien in der marxistischen Bewegung, die den Anspruch erhoben, Marx Theorie zu aktualisieren. Wir schlagen der Klarheit willen vor, uns die drei wichtigsten dieser Theorien kurz in Erinnerung zu rufen.
Die Theorie der Konzentration
Von Hilferding aufgestellt und später von Lenin übernommen, ist diese Theorie eigentlich mehr eine Beschreibung als eine Interpretation der Entwicklung des Kapitalismus. Sie geht von der generellen Feststellung aus, dass der hohe Grad der Konzentration des Kapitals den Monopolen die leitende Rolle in der Ökonomie überträgt. Die Tendenz dieser Monopole, sich den gigantischen Superprofit anzueignen, führt zur imperialistischen Aufteilung der Welt. Diese Theorie kann angewendet werden auf die Phase des Konkurrenz- und Monopolkapitalismus, aber nicht auf den Staatskapitalismus, der eine Infragestellung der internationalen Monopole darstellt. Eine fortgeschrittene Konzentration bedeutet nicht notwendigerweise die Zuflucht zu Formen der staatlichen Konzentration. Die kapitalistische Konkurrenz ist das Ergebnis der Konkurrenz unter den Kapitalisten, durch die der technisch schlechter gestellte Betrieb aufgesogen wurde durch den größeren, den mit höherer Produktivität. Daraus folgt eine Vergrößerung des überlebenden Kapitalisten. Diese Entwicklung geht so weit, dass gewisse Unternehmen das Auftauchen neuer Unternehmen verhindern, aus der Notwendigkeit der immer höheren organischen Zusammensetzung des Kapitals. Wenn dieser Prozess die Entwicklung der monopolistischen Trusts zu hochkonzentrierten Kapitalien erklärt, beweist dies, unter dem Gesichtspunkt des investierten Kapitalbetrags, noch nicht, dass das Monopol unfähig wäre, den Erfordernissen einer höheren Konzentration als der schon erreichten zu genügen. Die Verstaatlichung bedeutet keineswegs eine höhere Konzentration als die schon durch die Monopole erzielte. Einige monopolistische Absprachen stellen viel mehr eine Tendenz zu einer höheren Konzentration des Kapitals dar als diejenige, die sich in einem einzelnen Staat ergab. Den reformistischen Standpunkt Hilferdings aufgreifend, kam Lenin zu der wenig logischen Schlussfolgerung, dass der Kapitalismus keine Grenzen in der Entwicklung kenne. Auch die Barbarei bedeutete für Lenin nicht eine historische Möglichkeit, sondern vielmehr ein Bild: das der Stagnation der Produktivkräfte und des parasitären Charakters des Kapitalismus. Für Lenin, wie auch für die Sozialdemokraten, aber für diese mit unterschiedlichen Gesichtspunkten und Mitteln, stellte sich die Frage der objektiven Bedingungen der Revolution nicht mehr anhand der Fortentwicklung oder Zurückentwicklung der Produktivkräfte, sondern nur noch unter dem Gesichtspunkt der Notwendigkeit für das Proletariat, die bürgerliche Revolution in eine proletarische umzuwandeln. Dieser letzte Aspekt wird hier später wieder aufgegriffen.
Die Theorie des tendenziellen Falls der Profitrate
Diese Theorie wurde von Henryk Grossmann aufgestellt. Einer Neuformulierung des marxschen Schemas der erweiterten Reproduktion folgend, beharrte Grossmann darauf, dass die fortwährende Erhöhung der organischen Zusammensetzung des Kapitals einen Fall der Wertsteigerung herbeiführt. Ein Fall der Profitrate zieht einen Fall der Profitmasse nach sich. Der fehlende relative Mehrwert widerspricht dem Bedürfnis nach Akkumulation. Die Kapitalisten versuchen die Kosten der Produktion und des Transportes, sowie die Lohnkosten, zu vermindern. Die technische Entwicklung folgt einem sich beschleunigenden Rhythmus, während der Klassenkampf aufgrund der gesteigerten Überausbeutung kraftvoll darauf reagiert. Diese Theorie weist auf ein objektives Ende der kapitalistischen Akkumulation hin: auf seinen Zusammenbruch. Das Kapital findet nicht mehr die notwendigen Bedingungen zur Erzielung einer genügenden Rentabilität vor. Eine Serie von Kriegen, um die Rentabilität aufrecht zu erhalten (der Versuch einer provisorischen Aufrechterhaltung) und danach der Zusammenbruch des Kapitalismus sind die Folgen. Grossmanns Anschauung jedoch scheint nicht überzeugend in dem Punkt, wo er eine absolute Verbindung zwischen dem Fall der Profitrate und der relativen Verminderung der Profitmasse macht. R. Luxemburg schrieb in ihrer "Antikritik": Man sagt, "der Kapitalismus werde schließlich 'an dem Fall der Profitrate' zugrunde gehen. (...) Der Trost wird leider durch einen einzigen Satz von Marx in Dunst aufgelöst, nämlich durch den Hinweis, dass 'für große Kapitale der Fall der Profitrate durch Masse aufgewogen' werde. Es hat also mit dem Untergang des Kapitalismus am Fall der Profitrate noch gute Wege, so etwa bis zum Erlöschen der Sonne." Verlag Neue Kritik Frankfurt, 1966, S. 411] Wie reagiert der Kapitalismus auf den Fall der Profitrate? Schon Marx zeigte auf, dass der Kapitalismus über verschiedene Reaktionsmittel verfügt, um die Ausbeutung der Arbeit rentabel zu halten. Die Verfeinerung der Ausbeutung der Arbeitskraft ist eines dieser Mittel. Ein anderes Mittel ist die Ausdehnung der Produktion: Obgleich bei jedem Produkt der Fall der Profitrate eine Verringerung des relativen Profits nach sich zieht, wird die Vermehrung der Profitmasse erreicht durch die Erhöhung der Summe der produzierten Güter. Schließlich reagiert der Kapitalismus durch die Eliminierung von Faktoren, die sich negativ auf den Profit auswirken. Also bewirkt die Entwicklung vom Konkurrenzkapitalismus zum Monopolkapitalismus die Eliminierung von rückständigen Kleinproduzenten. Man kann deshalb aber nicht behaupten, dass sich dieser Prozess im Staatskapitalismus fortsetzt. Im Gegenteil, man kann mit gutem Grund sagen, dass die staatliche Konzentration eine Schicht hervorbringt die unproduktiv und parasitär ist: die Bürokratie.
Damit gesagt werden könnte, dass Grossmanns Theorie zur Erklärung der Krise genügt, müsste sie beweisen, dass die Vermehrung der Profitmasse den Fall der Profitrate nicht kompensieren kann. Oder mit anderen Worten, dass die Summe des globalen Profits sich verringert trotz eines erhöhten Produktionsausstosses. Der Lehrsatz, den Grossmanns Theorie beweisen will, ist also folgender: Am Ende des neuen Produktionszyklus 'ist der globale Profit niedriger als der des vorangehenden Zyklus'. Eine solche Theorie stimmt vielleicht in der Unendlichkeit des Schemas, aber nicht in den realen Bedingungen der Produktion. Die wirkliche Lösung scheint woanders zu liegen. Die Unmöglichkeit der Ausdehnung der Produktion liegt nicht darin, dass diese ausgeweitete Produktion unrentabel ist, sondern allein darin, dass sie nicht mehr abgesetzt werden kann.
Die Akkumulationstheorie von Rosa Luxemburg
Wie auch über die vorhergehenden Theorien geben wir hier nur eine kurze Zusammenfassung der Thesen von Luxemburg. Luxemburg hat nach vertieften Studien des marxschen Schemas der erweiterten Reproduktion daraus gefolgert, dass die Kapitalisten unfähig sind, den gesamten Mehrwert auf dem vorhandenen Markt zu realisieren. Im Streben nach Akkumulation sind die Kapitalisten gezwungen, einen Teil ihrer Produkte im ausserkapitalistischen Markt abzusetzen, an Produzenten, die ihre Produktionsmittel selber besitzen (Handwerker, Bauern, Kolonien und Halbkolonien). Es ist das Vorhandensein dieses ausserkapitalistischen Milieus, das den Rhythmus der kap. Akkumulation bestimmt. Wenn sich das ausserkapitalistische Absatzgebiet verengt, stürzt der Kapitalismus in eine Krise. Es entwickeln sich Kämpfe zwischen den verschiedenen Sektoren des Weltkapitals um die Ausbeutung dieser ausserkapitalistischen Länder. Das Verschwinden dieser Märkte hat eine permanente Krise des Kapitalismus zur Folge. Luxemburg zeigt anderswo auf, dass der Ausbruch dieser Krise erfolgt, noch bevor die ausserkapitalistischen Märkte ganz verschwunden sind. Um dieses Verschwinden zu überdecken, entwickelt der Kapitalismus eine von Natur aus parasitäre, unproduktive Produktion; die Produktion von Zerstörungsmitteln (Waffen). Der dekadente Charakter des Kapitalismus zeigt sich durch die Unfähigkeit, die Produktion von gesellschaftlichen Werten (Konsumgütern) aufrecht zu erhalten. Der Krieg wird zur Überlebensform des Kapitalismus; Krieg zwischen verschiedenen Staaten oder Staatenbündnissen, oder jegliche Form der Ausplünderung und Unterwerfung der Besiegten. Während in vergangenen Epochen der Krieg eine Expansion der Produktion bei dem einen oder dem anderen der Kontrahenten zur Folge hatte, so bedeutet der Krieg heute einfach den Ruin des einen und des anderen in unterschiedlicher Form. Dieser Ruin zeigt sich auch im Lebensniveau der Bevölkerung und dem immer unproduktiveren Charakter, den die Produktion annimmt. Die Zuspitzung des Kampfes zwischen den Staaten und ihr dekadenter Charakter seit 1914 zwingt jeden Staat, für sich zu schauen und zur staatlichen Konzentration zurückzugehen. Wir gehen hier nicht tiefer, denn es ist die Aufgabe des weiteren Textes, die Thesen anhand der historischen Realität zu erläutern.
Die grundlegenden Charakteristiken des Staatskapitalismus
Der Staatskapitalismus ist kein Versuch, die grundlegenden Widersprüche zu lösen, die der Kapitalismus als System der Ausbeutung der Arbeit in sich trägt, aber er ist ein Ausdruck dieser Widersprüche. Jede kapitalistische Fraktion versucht, die Auswirkungen der Krise auf die anderen Teile der Bourgeoisie abzuwälzen, und sich deren Märkte und Ausbeutungsfelder anzueignen. Der Staatskapitalismus entstand aus der Notwendigkeit für jede kapitalistische Gruppe, ihre Konzentration zu verstärken, um die Märkte der anderen unter ihren Einfluss zu bringen. Die Wirtschaft verwandelt sich dadurch in eine Kriegswirtschaft.
Das Problem der Produktion und des Tausches
In den dem Staatskapitalismus vorangehenden kapitalistischen Entwicklungsphasen, ging der Tausch der Produktion voraus, die Produktion folgte dem Tausch. Wenn die Produktion gleich groß wurde wie der internationale Handel, kam es zur Krise. Diese Krise zeigte die Sättigung der Märkte an. Am Ende der Krise ging der Aufschwung vorerst in der Sphäre des Handels vor und nicht in der Produktion, weil die Produktion der Nachfrage folgte. Seit 1914 kehrte sich dieses Phänomen um: die Produktion bestimmte den Tauschhandel. Es schien zuerst, als sei dies den Zerstörungen des Krieges zuzuschreiben. Aber 1929 holte der Handelsindex den der Produktion wieder ein und löste die Krise aus. Lagerbestände füllten sich, der Kapitalist war unfähig, den Mehrwert auf dem Markt zu realisieren. Vorher wurden die Krisen gelöst durch Erschließung neuer Märkte, was eine Wiederbelebung der Produktion zur Folge hatte. Zwischen 1929 und 1935 fand die Krise kein Ventil in Form einer Erweiterung der Märkte, deren Grenzen erschöpft waren. Die Krise zwang den Kapitalismus in eine Kriegswirtschaft. Der Kapitalismus ist in eine permanente Krise eingetreten, er kann seine Produktion nicht erweitern. Man kann eine bemerkenswert genaue Bestätigung der Theorie von R. Luxemburg feststellen: Die Verengung der ausserkapitalistischen Märkte führt auch zu einer Sättigung der eigentlichen kapitalistischen Märkte.
Das Problem der Krisen
Der Charakter der Krisen seit 1929 ist der, dass sie viel tiefer sind als die vorhergehenden Krisen. Es handelt sich nicht mehr um zyklische, sondern um eine permanente Krise. Die zyklische Krise, die der klassische Kapitalismus kannte, erfasst die Gesamtheit der kapitalistischen Länder. Auch der Wiederaufschwung fand in einem globalen Rahmen statt. Die permanente Krise, die wir heute kennen, zeichnet sich aus durch den Fall des Handelsvolumens und der Produktion in allen kapitalistischen Ländern (so z.B. zwischen 1929 und 1934). Aber man konnte nicht mehr auf einen generellen Wiederaufschwung hoffen. Dieser Wiederaufschwung fand nur noch in einem Sektor der Wirtschaft statt und auf Kosten der anderen Sektoren. Die Krise verschiebt sich nur noch von einem Land auf das andere und stürzt die Weltwirtschaft in eine permanente Krise. Wegen der Unmöglichkeit der Erschließung neuer Märkte schließen sich die Staaten mehr und mehr ab und schauen für sich selbst. Die Universalisierung der kapitalistischen Ökonomie wird durch die vermehrte Autarkie zerbrochen und jedes Land versucht nur noch die eigenen Interessen zu verfolgen. Es entstehen unproduktive Sektoren der Wirtschaft, um die Folgen des zusammengebrochenen Marktes zu lindern. Diese Linderungsversuche verstärken zusätzlich die Auflösung des Weltmarktes. Die Rentabilität, die auf dem Markt erzielt wurde, bestimmte vor 1914 die Währung, das Maß und den Anreiz der kapitalistischen Produktion. Die jetzige Phase des Kapitalismus bremst dieses Gesetz der Rentabilität. Diese wird von nun an nicht mehr auf Betriebsebene festgelegt, sondern auf der Ebene des Staates. Der Ausgleich findet nach einem festgelegten Plan auf nationaler Ebene statt, nicht mehr vermittels des Weltmarktes. Der Staat subventioniert defizitäre Teile der Wirtschaft und übernimmt selber die Verantwortung für die Wirtschaft. Aus dem vorher gesagten darf man aber nicht auf eine Verwerfung des Wertgesetzes schließen. Was wir zu beachten haben ist, dass die Bildung einer einheitlichen Produktion abgetrennt scheint vom Wertgesetz. Sie kann sich bilden, scheinbar ohne die Rentabilität zu berücksichtigen. Der monopolistische Extraprofit wird durch die "künstlichen" Preise realisiert, aber auf dem Feld der globalen Produktion bleibt sie weiterhin an das Wertgesetz gebunden. Die Summe der Preise für die Gesamtheit der Produkte drückt nichts anderes aus als den globalen Wert dieser Produkte. Nur die Verteilung des Profits unter den verschiedenen Gruppen des Kapitals wird verändert: Die Monopole erheischen einen Extraprofit auf Kosten der weniger starken Kapitalisten. Desgleichen kann man sagen, dass das Wertgesetz auf dem Niveau der nationalen Produktion spielt. Das Wertgesetz bewegt sich nicht mehr auf einem individuellen Produktionspreis, sondern auf der Gesamtheit der Produkte. Man führt eine Einschränkung des Wirkungsfeldes des Wertgesetzes ein. Die gesamte Profitmasse wird reduziert aufgrund der Tatsache, dass defizitäre Sektoren auf Kosten der anderen aufrechterhalten werden.
Das Wirkungsfeld des Wertgesetzes
1. Das Kapital
Aus dem vorher Gesagten folgt, dass der rigorose Mechanismus des Wertgesetzes auf der Stufenleiter des Unternehmens oder auf der Ebene einer ganzen Branche der Wirtschaft nicht immer spielt. Das Wertgesetz manifestiert sich auf der Ebene des Handels. Also bleibt wie in vorhergehenden Stadien des Kapitalismus der Markt die letzte Instanz, der einzige Regulator des Wertes der kapitalistischen Güter oder Produkte. Das Wertgesetz scheint geleugnet oder umgangen in einzelnen Ländern oder Sektoren der Industrie, die in den staatlichen Sektor integriert sind. Der Austausch mit anderen Sektoren aber findet auf der Basis des Wertgesetzes statt. In Russland hat das Verschwinden des Privatbesitzes eine große Einschränkung in der Art der Anwendung des Wertgesetzes bewirkt. Dieses Gesetz kann nicht im Handel zwischen zwei staatlichen Sektoren spielen, so wie es auch nicht im Inneren der Fabrik zwischen den verschiedenen Abteilungen spielt. Aber es spielt zu dem Zeitpunkt, wo ein fertiges Produkt gegen ein anderes ausgetauscht wird. Es ist immer die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, die zu seiner Produktion benötigt wird, die den Preis des Produktes festlegt, und nicht die launische Allmacht eines Bürokraten. Die Produkte werden nach den Bedingungen der Produktion gehandelt und ausgetauscht, und wie "gelenkt" dies immer aussehen mag, auch gemäß den Gesetzen des Marktes. Die Preise bleiben der Warenausdruck des Wertgesetzes.
2. Die Arbeitskraft
Aber der fundamentale Austausch in der kapitalistischen Ökonomie ist der, der zwischen den Produkten und der Arbeitskraft stattfindet. In Russland sowie auch anderswo geschieht der Kauf der Arbeitskraft zu ihrem kapitalistischen Wert. Der bezahlte Preis (Lohn) ist der ihrer Reproduktion. Die mehr oder weniger große Verwertung der Arbeitskraft oder das größere oder kleinere Niveau der Löhne ändert nichts an dieser Tatsache. Der Wert der Arbeitskraft wird teilweise festgelegt durch die Art und Weise wie die Arbeiter auf die Ausbeutung reagieren. Ihr Kampf oder das Nichtvorhandensein von Kämpfen können den Teil der Produktion der ihr in Form des Lohnes zufällt verkleinern oder vergrößern. Die Arbeiter können im Schoße des Kapitalismus jedoch nur auf die Menge der Produkte einwirken, die ihnen im Austausch mit ihrer Arbeitskraft zugeschrieben werden, und nicht auf die Verteilung dieser Produkte, also den Sinn der kapitalistischen Produktion. Das Vorhandensein einer "zusammengefassten" Arbeitskraft in Russland oder anderswo ändert nichts an diesen Betrachtungen. Nein, sie stellt lediglich einen minimalen Teil der Arbeitskraft dar, die auf der Gesamtheit der Gebiete verbraucht wird. Dieses Phänomen bleibt im Rahmen des Verhältnisses Kapital und Arbeitskraft. Die Bedeutung dieses Phänomens zeigt sich in der Notwendigkeit eines kapitalistischen Landes, ein tiefes Lohnniveau aufrecht zu erhalten. Es gibt im Rahmen der Akkumulation ein Druckmittel, um auf die Größe des gesellschaftlichen Gesamtwertes des Produkts zur Reproduktion der Arbeitskraft einzuwirken: die industrielle Reservearmee, die Arbeitslosen. Der vorübergehende Charakter dieses Phänomens bestätigt sich noch, wenn man betrachtet, dass das Grundlegendste, die "zusammengefassten" Arbeitskräfte durch die Arbeit der inneren Kolonisation gelenkt sind. Es handelt sich um Arbeit, die nicht rentabel ist, in entfernter Sichtweise um billige, unspezialisierte Arbeitskräfte. Und es wird unmöglich sein, unter den Bedingungen eines in Rückstand geratenen Landes die Löhne dieser Arbeitskräfte nach ihrem kapitalistischen Wert zu bezahlen. Man muss anfügen, dass sich an einem solchen Einsatz der Arbeitskraft in Russland die Notwendigkeit ergibt, für den Kapitalismus ein wirksameres Mittel, das des politischen Zwangs, zu entwickeln. Es gibt Leute, die sich bemühen, in dieser Form der Ausbeutung eine Rückkehr zum Sklaventum zu erkennen. Dazu bräuchte es aber vorher das vollständige Verschwinden des kapitalistischen Wertgesetzes. Die antiken Sklaven wurden durch ein körperliches Zeichen gestraft, wenn sie ein Vergehen begingen, durch ein Brandmal. Für den russischen Arbeiter, der "Saboteur" genannt wird, wenn er einen Fehler begeht, besteht die Strafe in der Verminderung seines Wertes. Dieser Arbeiter wird gezwungen, ein gewisses Quantum an Arbeitsstunden unbezahlt und zusätzlich zu leisten. Der "Stachanov", der gute Arbeiter genießt den Vorteil des höheren Lohnes und darüber hinaus auch den einer besseren Wohnung und mehr Freizeit. Politisch verfolgt dieses System die Aufspaltung der Klasse der Ausgebeuteten (eine Arbeiteraristokratie bilden, die dem Regime hörig ist). Generell gesagt, wird der Fall der Profitrate und der Profitmasse durch den maximalen Verbrauch der Arbeitskraft verschleiert. Die Zahl der Arbeiter ist gestiegen: Die Proletarisierung der Kleinbürger und Bauernmassen verstärkt sich, die Kriegsversehrten und die geistig Behinderten sind arbeitsfähig gemacht und in den Produktionszyklus reintegriert, die Zeugung und Erziehung von Kindern wird gefördert und unterstützt. Die Arbeitsintensität ist gestiegen, die Arbeitszeiten werden streng kontrolliert etc. Die "Theoretiker" des Zuwachses der Produktivität oder des sog. "Rechts auf Arbeit" [Vollbeschäftigung], machen nichts anderes, als die Tendenz zur maximalen Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft vermittelnd zu erklären.
Der Zweck der Produktion
Die Produktion nahm solange zu, bis der Handel zurückzugehen begann. Wohin entwickelte sich diese Produktion, die mit dem Verschwinden der Handelsmöglichkeiten dazu verdammt war, keine soziale Verwendung mehr zu haben? Sie orientierte sich in die Richtung der Produktion von Zerstörungsgütern. Wenn der Staatskapitalismus die individuelle Produktion steigen lässt, entstehen dadurch nicht neue Werte sondern Bomben und Uniformen. Die Finanzierung dieser Produktion geschieht vor allem auf drei Arten:
1. In einem gegebenen Produktionszyklus geht ein immer größerer Teil dieser Produktion in die Produkte, die im folgenden Zyklus nicht mehr auftauchen. Das Produkt verlässt die Produktionssphäre und kehrt nie mehr in sie zurück. Ein Traktor geht in Form von Weizengarben in die Produktion zurück, ein Panzer nicht. Die zu dieser Produktion (Waffen) verwendete gesellschaftliche Arbeit gibt ihr einen Wert. Aber diese gesellschaftliche Arbeit wurde ausgegeben ohne gesellschaftliches Gegenstück: nicht konsumiert, nicht reinvestiert, Sie dient nicht der Produktion. Die Produktion von Waffen oder anderen unproduktiven Gütern kann auf der Ebene des individuellen Kapitalisten rentabel sein aber nicht in einer weltweiten Form. Die Produktion vergrößert sich im Volumen aber nicht im realen sozialen Wert. Also wird ein erster Teil mit der Produktion von Destruktivmitteln der laufenden Produktion entzogen.
2. Ein zweiter Teil wird bezahlt durch das Aufsaugen von unproduktivem Kapital (Rentner, Geschäftsinhaber, Kleinbauerntum, -das Wolle produziert) und dadurch auch durch akkumuliertes produktives Kapital, das aber nicht unentbehrlich ist zur Aufrechterhaltung einer Produktion, die nicht mehr auf die produktive Konsumtion ausgerichtet ist. Die Ersparnisse verschwinden. Genauer gesagt geben die nun folgenden Angaben ein Bild einer Tendenz, wie sie in Frankreich vorhanden ist. Diese Tendenz ist typisch für die allgemeine Entwicklung. "Geschätzte Kaufkraft; das Kapital von 1950 ist 19 500 Milliarden, stellt aber nicht mehr dar als 144 Milliarden von 1911 (gegenüber 286), was heißt, dass im Vergleich nur noch die Hälfte der Kaufkraft besteht. Aber diese Sicht bleibt unvollständig wenn, man die Masse der Ersparnisse nicht in Betracht zieht. Im Zeitraum 1910-1914 waren es 144 Goldmilliarden, die den 300 Mrd. dieser Zeit hinzugefügt werden können. In der Folge der zwei Weltkriege gingen diese Ersparnisse zurück bis nichts mehr übrig blieb. Es war kein Stück mehr vorhanden". Die kommerziellen Gewinne werden durch die staatliche Abschöpfung enorm gekürzt. Schließlich findet eine dauernde inflationäre Geldentwertung statt: Die Kaufkraft des Geldes nimmt ab.
3. Ein dritter Teil schließlich wird direkt von den Arbeitern abgezogen: Durch Verminderung des Lebensstandards und Intensivierung der Ausbeutung der Arbeitskraft. Wie in Frankreich z. B., als der Index der Produktion anfangs 1952 auf 153 war, gegenüber dem Niveau von 1938, der Lebensstandard aber trotzdem um 30% fiel, und es wäre noch mehr, wenn man dies mit der gesteigerten Produktivität vergleichen würde. Dieses offensichtliche Paradox eines fortschreitenden Anstiegs der Produktion, der begleitet wird von einer sich vermindernden Konsumtion der Arbeiter, also dem Schmelzen des aufgehäuften sozialen Kapitals, ist ein Zeichen der Dekadenz des Kapitalismus.
Die soziale Struktur der kapitalistischen Klasse
Gewisse ökonomische Entwicklungen bewirken tiefe soziale Veränderungen. Die Konzentration der ökonomischen Macht in den Händen des Staates - und dadurch die teilweise physische Liquidierung des Bourgeois als individueller Kapitalist beschleunigt eine Entwicklung, die sich schon im vorangegangenen Stadium des Kapitalismus abzeichnete. Zahlreiche Theorien haben floriert, besonders im trotzkistischen Milieu, die vorgaben, diese Entwicklung zu erklären, indem sie ihr die Dynamik des Kampfes einer neuen Klasse gegen die klassische Bourgeoisie zuschrieben. Diese Theorien sprechen von der physischen Zerstörung des Bourgeois, des Privateigentums in Osteuropa und von der Gleichschaltung dieses Prozesses in den faschistischen Ländern, sowie den Ländern mit "Arbeiterregierungen" bzw. Ländern, die "aus der Resistance hervorgegangen" sind. Diese Beispiele erlauben nicht, solche Schlüsse daraus zu ziehen. Eine Theorie aufzubauen auf einer Reihe von Fakten, die lediglich ein Zeugnis einer rückständigen Ökonomie sind, und Fakten, die eher scheinbar als real sind (der Kapitalist ist keine physische Person sondern eine gesellschaftliche Funktion), heißt auf Sand zu bauen. Es gilt, die hoch entwickelte kapitalistische Welt aus dem Blickwinkel einer gesunden Analyse zu betrachten. Die Situation ist als eine Mischung und Verflechtung von traditionellen kapitalistischen Elementen und von Elementen des Staatskapitalismus zu charakterisieren. Eine solche Mischung entsteht nicht ohne Reibungen, Stockungen und Fragezeichen. Der Faschismus und die Resistance sind in diesem Sinne gescheiterte Versuche. Die Verbindung, die unsere "Theoretiker" eines Bürgerkrieges zwischen der neuen Klasse der Bürokraten und dem klassischen Kapitalismus ziehen, verschleiert die Klarheit über die permanente Krise des Kapitalismus. In dieser Krise, deren Auswirkungen explosiv in den Schoß ihres Ursprunges zurückprallen, unterstützen die Trotzkisten (die offiziellen sowie die sog. nichtoffiziellen wie Max Shachtman) einen, wie sie behaupten "progressiven Kampf zwischen zwei historischen Klassen". Die Abwesenheit des Proletariates auf der historischen Bühne scheint also unbedeutend. Zu der Alternative, welche die Geschichte und die Revolutionäre aufzeigen: "Sozialismus oder Barbarei", wird also ein dritter Vorschlag gemacht von unseren "Theoretikern": sich integrieren in den einen oder anderen Block. Diese Unterstützung einer neuen ausbeutenden Klasse im Kapitalismus, welche eine historische Lösung der kapitalistischen Widersprüche mit sich bringen soll, führt zur Preisgabe der revolutionären Ideen und zur Übernahme von kapitalistischen Auffassungen.
Die Situation der Kapitalisten
Der Gewinn der Kapitalisten mit Privatbesitz nimmt die Form einer Vergütung, proportional zur Größe des verwalteten Unternehmens an. Der bezahlte Charakter des Kapitalisten im Verhältnis zum Kapital bleibt verdeckt, der Kapitalist erscheint als der Besitzer seines Unternehmens. Letztenendes lebt der Kapitalist auch vom Mehrwert, der von den Arbeitern abgepresst wird, aber er nimmt seinen Gewinn als direktes Gehalt ein; er ist ein Funktionär. Die Profite werden nicht mehr nach den juristischen Titeln des Besitzes verteilt, sondern nach der sozialen Funktion des Kapitalisten. Auch fühlt sich der Kapitalist grundsätzlich solidarisch mit der Gesamtheit der nationalen Produktion und interessiert sich nicht nur für den alleinigen Profit seines Unternehmens. Seine Sorge ist es, den Arbeiter an die Produktion zu binden. Das Proletariat sieht klar und deutlich, dass der Kapitalismus überleben kann auch ohne den Privatbesitz an Produktionsmitteln. Jedoch die Veränderung der "Entlohnung" des Kapitals schafft scheinbar die ökonomischen Fronten zwischen den Klassen ab. Das Proletariat wir ausgebeutet, aber es erkennt nur mit Schwierigkeiten den Ausbeuter wieder, der im Kleid der Gewerkschaft oder des "fortschrittlichen Retters" auftritt.
Das koloniale Problem
Einst glaubte man in der Arbeiterbewegung, dass die Kolonien nicht zu ihrer nationalen Emanzipation kommen können außer im Rahmen der sozialistischen Revolution. Gewiss, ihr Charakter als "schwächstes Glied in der imperialistischen Kette", aus dem Grund der Überausbeutung und der kapitalistischen Repression, erwies sich als besonders empfindlich für soziale Bewegungen. Ihre Möglichkeit, die Unabhängigkeit zu erreichen, blieb gebunden an den Ausgang der Revolution in den kapitalistischen Metropolen. In den letzten Jahren konnte man jedoch sehen, dass die Mehrheit der Kolonien unabhängig wurde. Die kolonialen Bourgeoisien entwickelten sich mehr oder weniger wie die metropolitanen Bourgeoisien. Dieses Phänomen, so begrenzt es in der Wirklichkeit ist, lässt sich nicht begreifen im Rahmen der alten Theorie, welche die koloniale Bourgeoisie nur als Lakai des Imperialismus darstellt. In Wirklichkeit sind die Kolonien, die man nur als einen ausserkapitalistischen Markt der Metropolen darstellt, selber neue kapitalistische Länder geworden. Sie verloren dadurch ihren Charakter als Absatzmarkt, was den Widerstand der alten imperialistischen Staaten gegen die Ansprüche der Bourgeoisie der Kolonien verringerte. Dazu kommt die Tatsache, dass die Schwierigkeiten, vor welche die imperialistischen Staaten gestellt wurden, die wirtschaftliche Expansion der Kolonien während der zwei Weltkriege begünstigt haben. Das konstante Kapital wurde in Europa angelegt, während die Produktionskapazität der Kolonien und Halbkolonien sich vergrößerte und eine Explosion des einheimischen Nationalismus mit sich brachte (Südafrika, Argentinien, Indien ect.). Es ist bemerkenswert festzustellen, dass diese neuen kapitalistischen Länder seit ihrer Gründung als unabhängige Staaten auch einen Staatskapitalismus entwickelten, der die gleichen Aspekte aufweist, die auch anderswo existieren: Eine Wirtschaft, die auf den Krieg ausgerichtet ist.
Die Theorie des "schwächsten Gliedes" von Lenin und Trotzki bricht zusammen. Die Kolonien werden in die kapitalistische Welt integriert und gleichzeitig verstärken sie diese wiederum. Es existiert kein "schwächstes Glied" mehr: die Beherrschung der Welt durch das Kapital ist auf der ganzen Erde neuaufgeteilt.
Die Einbindung des proletarischen Kampfes und der Gesellschaft in den Staat
Das wirkliche Leben in der Phase des klassischen Kapitalismus spielte sich in der bürgerlichen Gesellschaft ab, außerhalb des Staates. Dieser Staat war nichts anderes als das Instrument der vorherrschenden Interessen in der bürgerlichen Gesellschaft und nur das: ausführendes Organ und nicht ein Organ der Lenkung der Politik und Wirtschaft. Die Elemente des Staates, die dazu berufen waren, die Ordnung aufrechtzuerhalten (Administration), tendierten zu einer Loslösung von der Kontrolle durch die Gesellschaft, tendierten zur Bildung einer selbständigen Klasse, die ihre eigenen Interessen hat. Diese Trennung und der Kampf zwischen dem Staat und der Gesellschaft konnte nicht zur absoluten Dominanz des Staates führen, solange dieser nicht die Produktionsmittel kontrollierte. Die Periode der großen Monopole stellt den Beginn einer Mischung von Staat und Oligarchie dar. Doch diese Mischung war instabil: Der Staat blieb außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft, die grundsätzlich auf dem Privatbesitz gründete. Die gegenwärtige Phase vereint alles in den gleichen Händen: die Verwaltung der Sachen und die Regierung über die Menschen. Das dekadente Kapital leugnet die Widersprüche zwischen den zwei ökonomisch ausbeutenden Klassen, den Kapitalisten und den Landbesitzern (durch das Verschwinden der zweiten). Es leugnet ebenfalls die Widersprüche zwischen den verschiedenen kapitalistischen Gruppen, deren Unterschiede früher einer der Motoren der Produktion waren, einer Produktion, die heute unter dem Gesichtspunkt der reellen Wertproduktion im Niedergang begriffen ist. Aber auch die ausgebeutete Klasse ist in den Staat integriert. Diese Integration findet ebenfalls auf dem Feld der Mystifikation statt: dass die Arbeiter nicht mehr dem Kapital als solchem gegenüberstünden, sondern einen Teil der Nation darstellten. Wir haben gesehen, dass der Staatskapitalismus gezwungen ist, die Menge der Güter, die der Erhaltung des variablen Kapitals dienen, zu reduzieren, die Arbeitskraft der Arbeiter wild auszubeuten. Gestern noch konnten die wirtschaftlichen Ansprüche der Arbeiter befriedigt werden. Durch die Expansion der Produktion konnte das Proletariat eine wirkliche Verbesserung seiner Lebensbedingung durchsetzen. Diese Zeit ist vorbei. Das Kapital hat Sicherheiten verloren, die ihm eine wirkliche Erhöhung der Löhne ermöglichen würde. Der Fall der realen Produktion brachte die Unmöglichkeit für den Kapitalismus mit sich, die Löhne aufzubessern. Die ökonomischen Kämpfe der Arbeiter können nicht mehr bewirken als Misserfolge - bestenfalls die Erhaltung der schon verschlechterten Lebensbedingungen. Sie binden das Proletariat an ihre Ausbeuter und bringen es dazu, sich solidarisch zusehen mit dem System im Austausch gegen einen Teller Suppe mehr (den es aber auch nur bekommt, damit schließlich seine "Produktivität" verbessert wird). Der Staat behält die Organisationsformen der Arbeiter (Gewerkschaften) bei, um das Proletariat besser kasernieren und mystifizieren zu können. Die Gewerkschaften werden ein Räderwerk des Staates und als solches sind sie interessiert, die Produktivität zu entwickeln, das heißt die Ausbeutung der Arbeit zu steigern. Die Gewerkschaften waren ein Instrument zur Verteidigung der Arbeiter, solange der rein ökonomische Kampf geschichtlich möglich war. Dieses alten Sinnes beraubt, wurden die Gewerkschaften, ohne die Form zu verändern, ein Instrument der ideologischen Repression des Staates und seiner Kontrolle über die Arbeitskraft.
Die Agrarreform und die Organisation der Verteilung: die Kooperativen
Um sich einen maximalen Anteil der Arbeit zu festen Bedingungen zu sichern, organisiert und zentralisiert der Staatskapitalismus die landwirtschaftliche Produktion, so wie er auch den Parasitismus im Verteilungssektor beschränkt. Das gilt auch für die handwerklichen Branchen. Die verschiedenen Zweige bilden Kooperativen mit dem Ziel, das Handelskapital zu eliminieren, die Distanz zwischen Produktion und Konsumtion zu verkleinern, und die landwirtschaftliche Produktion in den Staat zu integrieren.
Die soziale Sicherheit
Selbst der Lohn ist in den Staat integriert. Die Festlegung zu seinem kapitalistischen Wert fällt den staatlichen Organismen zu. Ein Teil des Lohnes wird dem Arbeiter weggenommen und direkt vom Staat verwaltet. Auch das Leben des Arbeiters nimmt der Staat in seine Hände, er kontrolliert die Gesundheit (Kampf gegen den Absentismus) und lenkt die Freizeit der Arbeiter (ideologische Repression). Am Ende hat der Arbeiter kein Privatleben mehr, jeder Moment wird direkt oder indirekt vom Staat bestimmt. Der Arbeiter ist abgestimmt wie die aktive Zelle eines lebendigen Körpers, die überfordert wird; seine Persönlichkeit verschwindet. Das geschieht nicht, ohne verschiedenste Neurosen zu erzeugen. Die Entfremdung der Gefühle in all ihren Formen ist in unserer Epoche das, was die großen Epidemien wie die Pest im Mittelalter waren. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass das Schicksal der Arbeiter auch das der übrigen Teile der Gesellschaft ist. Es ist auch unnötig zu unterstreichen, dass die Vorsorge für das Individuum in der sozialistischen Gesellschaft gegen Krankheiten und andere Gefahren des Lebens, nicht so sein wird wie die "Lebensversicherung" im Kapitalismus. Diese hat ihren Sinn lediglich im Rahmen der Ausbeutung der menschlichen Arbeit und als Funktion in diesem Rahmen.
Die revolutionäre Perspektive
Wir haben festgestellt, dass der ökonomische Kampf der Arbeiter um ihre unmittelbaren Interessen die Arbeiterklasse nicht befreien kann. Das gleiche gilt für den politischen Kampf, der im Innern des Staates geführt wird und eine Reform des Kapitalismus anstrebt. Als die bürgerliche Gesellschaft getrennt vom Staat existierte, führte der Kampf zwischen den verschiedenen sozialen Lagern zu einem fortwährenden Umsturz der politischen Verhältnisse in der Gesellschaft. Die Theorie der "permanenten Revolution" entspricht genau dieser immer wiederkehrenden Veränderung der Beziehungen im Innern der Gesellschaft. Diese Veränderungen erlaubten es dem Proletariat, seinen eigenen politischen Kampf zu führen, der die Kämpfe überragte, die an der Seite der Bourgeoisie geführt wurden. Die Gesellschaft kreierte also die sozialen Bedingungen und das ideologische Klima, das nötig war, um sie selbst umzustürzen. Revolutionärer Aufstieg und Rückfluss folgten einander in einem jedes Mal vertiefteren Rhythmus. Jede dieser Krisen erlaubte es dem Proletariat, ein historisches Klassenbewusstsein zu zeigen, das von Mal zu Mal reiner wurde. Die Daten 1791, 1848, 1871 und 1917 sind die herausragendsten einer langen Liste. Der Staatskapitalismus kennt keine tief greifenden und umwälzenden Kämpfe zwischen verschiedenen Interessengruppen des Kapitals mehr. Der Zusammenfassung der Interessen im Staatskapitalismus entspricht im klassischen Kapitalismus die Zusammenfassung der Parteien zur parlamentarischen Demokratie. Mit dem Staatskapitalismus schmilzt die Gesellschaft zusammen, und die Tendenz zur Einheitspartei entsteht: Die Verteilung des Mehrwerts nach dem Plan der jeweiligen Funktion im Kapitalismus erzwingt ein Gesamtinteresse für die Klasse der Ausbeuter, eine Vereinheitlichung der Bedingungen der Auspressung und Verteilung des Mehrwerts. Die Einheitspartei ist der Ausdruck dieser neu entstandenen Bedingungen. Es bedeutet das Ende der klassischen bürgerlichen Demokratie: Das politische Vergehen wird kriminell. Die Kämpfe, die früher ihren Ausdruck im Parlament oder auch auf der Strasse fanden, spielen sich heute innerhalb des Staatsapparates ab oder mit verschiedener Färbung im Schoße einer kapitalistischen Interessenkoalition, einer Nation oder eines Blocks von Nationen.
Die aktuelle Situation des Proletariates
Das Proletariat hat sich noch kein Bewusstsein über diese Veränderungen der Ökonomie angeeignet. Mehr noch, es ist in den Staat integriert. Der Kapitalismus ist heute anders als zurzeit da er noch keine staatliche Form angenommen hatte. Die Ära der Revolutionen hat sich eröffnet. Der politisch revolutionäre Kampf der Arbeiter entwickelte sich zu einem absoluten Misserfolg und Rückschlag für die Klasse, wie sie die Geschichte noch nie erlebt hatte. Dieser Misserfolg und dieser Rückschlag (Scheitern der revolutionären Welle 17 - 23) haben es dem Kapitalismus erlaubt, sich so zu verändern. Es scheint ausgeschlossen, dass das Proletariat im Verlaufe dieses Prozesses sich als historische Klasse wieder finden kann. Was der Klasse in der Vergangenheit die Möglichkeit gab, sich zu bestätigen, war der Umstand, dass die Gesellschaft durch ihre zyklischen Krisen ihren Rahmen sprengte und das Proletariat aus dem Produktionszyklus hinauswarf. Aus der Gesellschaft hinausgeworfen, eigneten sich die Arbeiter ein Bewusstsein an über die Bedingungen und die Mittel der Veränderung. Vor dem spanischen Bürgerkrieg und dem Beginn der antifaschistischen Mystifikationen, wo sich das erste Mal eine relative Vereinigung der ausbeutenden Klasse ergab, dann durch den Verlauf des 2. Weltkrieges tendierte der Kapitalismus dazu, die zyklischen Krisen und deren Folgen zum Verschwinden zu bringen und sich mit seiner permanente Krise abzufinden. Das Proletariat ist an seine Ausbeutung gebunden. Es ist also geistig und politisch in den Kapitalismus integriert. Der Staatskapitalismus fesselt das Proletariat stärker als zuvor an seine urtümlichen Kampftraditionen. Denn die Kapitalisten als Klasse haben aus der Erfahrung gelernt und begriffen, dass die wichtigste Waffe zur Aufrechterhaltung ihrer Herrschaft weniger die Polizei als die direkte ideologische Repression ist. Die politische Partei der Arbeiter ist die des Kapitals geworden. Was mit den Gewerkschaften passiert, die Entleerung ihrer früheren Inhalte und die Integration in den Staat, geschieht auch mit dem, was sich "Arbeiterpartei" nennt. Diese Parteien stellen einzig und allein eine politische Phraseologie dar, sind Ausdruck der Ausbeuterklasse, die ihre Interessen und ihren Wortschatz an die neue Realität angleicht. Eine der Grundlagen dieser Mystifikation ist der Ruf nach dem Kampf gegen das Privateigentum. Dieser Kampf hatte einen revolutionären Charakter in der Epoche, als der Kapitalismus ans Privateigentum gebunden war und dies die Ausbeutung in ihrer offensichtlichsten Form darstellte. Die Veränderungen der Bedingungen für das Kapital haben diesen Kampf der Arbeiter gegen das Privateigentum als historisch überholt erwiesen. Es ist das Schlachtross der geschicktesten Fraktionen der Bourgeoisie in der Zeit des dekadenten Kapitalismus geworden. Die unüberlegte Hingabe der Arbeiter an ihre Kampftraditionen, an Mythen und verbrauchte und überholte Vorstellungen besiegelt schließlich ihre Integration in den bürgerlichen Staat. Auch der 1. Mai, der noch unlängst manchmal gewaltige Streiks bedeutete und immer einen kämpferischen Charakter behielt, wurde zu einem Feiertag des Kapitalismus: Die Arbeiterweihnacht. Die "Internationale" wird von Generälen gesungen und die Pfarrer schimpfen gegen den Klerus. All das dient dem Kapitalismus aus dem Grunde, weil das Ziel des Kampfes für Reformen, das an eine historische Epoche gebunden war, verschwunden ist, sowie auch die Form dieses Kampfes ohne ihren alten Inhalt weiterlebt.
Die Elemente einer revolutionären Perspektive
Der Prozess der Aneignung des revolutionären Bewusstseins durch das Proletariat ist direkt gebunden an die Wiederkehr der objektiven Bedingungen, innerhalb derer diese Aneignung des revolutionären Klassenbewusstseins stattfinden kann. Diese Bedingungen können zusammengeführt werden zu einer einzigen, zur Allgemeinsten, nämlich dass das Proletariat aus der Gesellschaft hinausgeworfen wird, dass es dem Kapitalismus nicht mehr gelingt, ihm eine Existenzgrundlage zu sichern. Auf dem Kulminationspunkt der Krise ist diese Bedingung gegeben. Dieser Kulminationspunkt der Krise liegt im Staatskapitalismus im Krieg. Genau an diesem Punkt kann sich das Proletariat nicht anders ausdrücken denn als historische Klasse, die ihre eigenen Interessen wahrnimmt. Es kann sich nicht mehr als ökonomische Kategorie des Kapitals ausdrücken, sondern nur noch als das Gegenteil davon. Unter den aktuellen Bedingungen ist der generalisierte Krieg für das Kapital unvermeidlich. Aber das will nicht heißen, dass die Revolution unvermeidlich ist, und noch weniger, dass sie nicht erfolgreich sein wird. Die Revolution stellt nichts anderes als einen Teil der Alternative dar, vor welche die Menschheit gestellt wird. Wenn sich das Proletariat kein sozialistisches Bewusstsein aneignet, ist dies der Anfang der Barbarei, von der man schon heute gewisse Aspekte erkennt.
M. Mai 1952
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Theoretische Fragen:
- Politische Ökonomie [66]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Staatskapitalismus [67]
IKS Stellungnahme zu den Angriffen gegen die ArbeiterInnen von VW in Belgien und Deutschland
- 3315 reads
Gegenwärtig stehen in einer Reihe von Ländern Massenentlassungen an. Wiedermal wird von den Unternehmern und Gewerkschaften versucht, uns ArbeiterInnen auf nationaler Ebene gegeneinander auszuspielen, wie die Angriffe bei VW exemplarisch zeigen. VW hat den Abbau von Zehntausenden Arbeitsplätzen angekündigt. Allein in Deutschland sollen über 20.000 Arbeitsplätze wegfallen. In Brüssel soll ein Großteil der Arbeitsplätze bei VW gestrichen werden. Die Arbeitgeber und die Gewerkschaften an ihrer Seite können ihre Sparpläne nur durchsetzen, wenn sie die Beschäftigten spalten. Standorte werden gegeneinander ausgespielt. Dabei wird immer deutlicher, dass unsere Probleme als ArbeiterInnen überall die Gleichen sind. Wir können uns deshalb nur als internationale Arbeiterklasse vereint gegen das internationale Kapital erfolgreich zur Wehr setzen. Die weiter unten veröffentlichte Stellungnahme unserer Sektion in Belgien prangert die Sabotage- und Spaltungstaktik der Gewerkschaften und greift Fragen auf, vor denen die Beschäftigten stehen. Der Text wurde in Belgien bei verschiedenen Betrieben und auf einer landesweiten Demonstration verteilt. Sektion der IKS in Deutschland
Gegenwärtig stehen in einer Reihe von Ländern Massenentlassungen an. Wiedermal wird von den Unternehmern und Gewerkschaften versucht, uns ArbeiterInnen auf nationaler Ebene gegeneinander auszuspielen, wie die Angriffe bei VW exemplarisch zeigen. VW hat den Abbau von Zehntausenden Arbeitsplätzen angekündigt. Allein in Deutschland sollen über 20.000 Arbeitsplätze wegfallen. In Brüssel soll ein Großteil der Arbeitsplätze bei VW gestrichen werden. Die Arbeitgeber und die Gewerkschaften an ihrer Seite können ihre Sparpläne nur durchsetzen, wenn sie die Beschäftigten spalten. Standorte werden gegeneinander ausgespielt. Dabei wird immer deutlicher, dass unsere Probleme als ArbeiterInnen überall die Gleichen sind. Wir können uns deshalb nur als internationale Arbeiterklasse vereint gegen das internationale Kapital erfolgreich zur Wehr setzen. Die weiter unten veröffentlichte Stellungnahme unserer Sektion in Belgien prangert die Sabotage- und Spaltungstaktik der Gewerkschaften und greift Fragen auf, vor denen die Beschäftigten stehen. Der Text wurde in Belgien bei verschiedenen Betrieben und auf einer landesweiten Demonstration verteilt. Sektion der IKS in Deutschland
Angesichts der Entlassungen und Arbeitsplatzverlagerungen bei VW lautet die einzige Antwort auf die kapitalistische Krise: Arbeitersolidarität!
Gestern noch behaupteten die Arbeitgeber, die Regierung und die Gewerkschaften einmütig gegenüber den Beschäftigten von VW: "Wenn Ihr mehr Flexibilität und eine Erhöhung der Bandgeschwindigkeit akzeptiert, werden Eure Arbeitsplätze gerettet". Man sieht heute, was solche Versprechungen wert sind: 4.000 direkte Entlassungen und 8.000-10.000 indirekte Entlassungen.
Wie soll man gegenüber diesem sozialen Kahlschlag, der mit einer bislang nicht da gewesenen Brutalität durchgeführt wird, reagieren? Sollen wir ruhig bleiben und die Logik der Entlassungen hinnehmen, wie es von den Gewerkschaften verlangt wird? Sollen wir auf die Verhandlungen und diese Solidaritätsschauveranstaltungen bauen, die von den Gewerkschaften veranstaltet werden? Wie können wir einen wirklichen, solidarischen und kollektiven Kampf entwickeln? Kann der Kapitalismus uns noch eine Zukunft bieten? Können wir den neuen Versprechungen von Umstrukturierungen usw. Glauben schenken, oder will man uns damit nur Sand in die Augen streuen, um die Wut und unseren Abwehrkampf einzudämmen? Vor diesen Fragen stehen wir bei dem Konflikt bei VW; sie verlangen eine klare Antwort.
Die Sackgasse der Marktwirtschaft
Seit mehreren Tagen vergießen die bürgerlichen Medien in Sondersendungen heuchlerisch Krokodilstränen. Die ganze Verwirrung der betroffenen Arbeiter angesichts ihrer Lage soll breit getreten werden. Die Botschaft, die die herrschende Klasse vermitteln will, ist klar. Sie zielt auf alle Beschäftigten im Lande ab und lautet: "Das ist traurig und bedauernswert, aber es gibt keine andere Wahl. Dies sind die Gesetze der Marktwirtschaft und die Folgen der Globalisierung. Es bringt nichts, Widerstand zu leisten, denn die Logik der kapitalistischen Konkurrenz ist unausweichlich. Der einzige Ausweg ist wettbewerbsfähiger zu werden und somit noch mehr Opfer zu akzeptieren, die von unseren Ausbeutern im Namen der Rettung der Volkswirtschaft verlangt werden". Ist das tatsächlich die einzige Perspektive? Wie sieht die Wirklichkeit aus?
Diese ‘Gesetze der Marktwirtschaft’ sind die Gesetze des Kapitalismus. Es sind die Gesetze der Arbeitgeber und Regierenden. Gesetze, die zu einer endlosen Reihe von Entlassungen, Arbeitsplatztransfers, Lohnsenkungen und Ähnlichem führen. Gesetze, die den Arbeitern der Industriestaaten einen unerträglichen Arbeitsrhythmus und Flexibilität und ihren Klassenbrüdern in den "Schwellenländern" unmenschliche Bedingungen aufzwingen. Gesetze, die jedes Mal dann gewaltige Profite erzeugen, wenn massenhaft Arbeiter vor die Tür gesetzt werden. Gesetze, die die ganze Menschheit in den Abgrund treiben – sowohl auf ökonomischer, militärischer als auch auf ökologischer Ebene, wenn wir nicht dagegen kämpfen.
Hinsichtlich der von uns verlangten Solidarität mit den Arbeitgebern und der Regierung "unseres Landes" bedeutet diese nichts anderes als noch mehr Sparpläne und Flexibilisierungsbeschlüsse im Namen der "Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft" hinzunehmen, d.h. die Verteidigung der Profitraten der belgischen Bourgeoisie im unerbittlichen Handelskrieg mit ihren Konkurrenten. Es bedeutet, sich gegen die Beschäftigten der anderen Länder zu stellen. All dies geschieht im Rahmen in einer endlosen Spirale von Lohnsenkungen, Produktivitätserhöhungen und einer Verschlechterung der Lebensbedingungen.
Nach den Massenentlassungen bei Renault Vilvorde, der SNCB (Eisenbahn), Sabena, Ford Genk, DHL, Inbey oder AGFA Gevaert, morgen vielleicht auch bei Opel, auch wiedermal bei der Post, (nachdem dort ein "Generationenpakt" für die Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit oder der Arbeitsplätze abgeschlossen wurde, was nur Lohnsenkungen und eine Flexibilitätserhöhungen mit sich gebracht hat,) stehen wir vor der Frage: Was bringt diese unendliche Spirale der Sparpolitik und des gnadenlosen Konkurrenzkampfes mit sich? Die Erfahrung der vergangenen Wochen bei VW zeigt, was immer mehr Arbeiter spüren: Die kapitalistische Marktwirtschaft (ob mit oder ohne ‚sozialer’ Steuerung) hat nichts anderes als Verarmung, Unsicherheit und grenzenlose Armut anzubieten.
Regierung und Gewerkschaften organisieren die Spaltung und verbreiten ein Gefühl der Machtlosigkeit
Die angebliche Überraschung der belgischen Bourgeoisie über den brutalen Angriff bei VW und ihr ‚Verständnis’ für die Wut der entlassenen Beschäftigten sind reine Heuchelei. Erinnern wir uns daran, wie zynisch sie die Interessen von Tausenden Beschäftigen bei DHL im Namen eines ‚Kampfes gegen die lautlosen Schäden‘ mit Füssen getreten oder als ‚staatlicher Arbeitgeber’ die Zahl der Arbeitsplätze bei der SNCB und der Post um die Hälfte reduziert hat. Und dieses soziale Beben findet zu einem Zeitpunkt statt, wo ein neuer Tarifvertrag mit dem Ziel der "Bescheidenheit von Lohnforderungen" in der gesamten Industrie abgeschlossen werden soll. Es ist übrigens kein Zufall, wenn Wochen vor der Ankündigung von Massenentlassungen die Bourgeoisie und ihre Gewerkschaften vor Ort aktiv waren, um die Wut einzudämmen, die Arbeiter zu spalten und ihnen ein Gefühl der Hilflosigkeit einbläuen wollen.
Schon vor der endgültigen Ankündigung zeigten die sozialistischen Gewerkschafter auf die Verantwortlichen: Schuldig waren nicht die Arbeitgeber und der bürgerliche Staat, sondern die deutschen Arbeiter und ‚ihre’ Gewerkschaftsorganisationen, die zur Rettung der eigenen Arbeitsplätze nun VW-Forest (Brüssel) geopfert hätten. Welch eine Lüge! Die Arbeiter in Deutschland sind genauso wie die Arbeiter in anderen Ländern die Opfer der kapitalistischen Angriffe. Unsere Feinde sind nicht unsere Klassenbrüder in einem anderen Land oder einer anderen Region. Sie stehen vor den gleichen wilden Angriffen auf ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen. Nein! Unser Feind ist der Kapitalismus, der diese höllische Spirale der gesteigerten Ausbeutung und Entlassungen, diese Logik der weltweiten wirtschaftlichen und kriegerischen Konkurrenz auslöst. In Wirklichkeit betreiben die herrschende Klasse und ihre Gewerkschaften (in Belgien wie in Deutschland) ein schmutziges Spiel der Spaltung der Beschäftigten einen Landes gegen die eines Anderen. Die Erpressung lautet: "Wenn ihr nicht Lohnsenkungen und mehr Flexibilität akzeptiert, werden die Arbeitsplätze dorthin verlagert, wo die Löhne niedriger sind", oder: "Wenn ihr die Umstrukturierung der Arbeitsplätze und die Entlassungen nicht hinnehmt, wird die Produktion ausgelagert".
Das Hauptziel der Herrschenden und ihrer Gewerkschaftsorganisationen besteht darin, die ganze Medienaufmerksamkeit auf die wachsende Wut und die Verwirrung der VW-Beschäftigten zu richten, damit sich dieses Gefühl der Hilflosigkeit auf die ganze Arbeiterklasse in Belgien ausdehnt. Die Botschaft ist klar: "Wenn dieser kampfstarke Teil der Arbeiter, der sich in der Vergangenheit immer durch seine Kämpfe und Kampfbereitschaft auszeichnete, es nicht schafft, sich gegen solche Maßnahmen zur Wehr zu setzen, dann schafft die Arbeiterklasse woanders in Belgien das auch nicht (in den Medien wird immer darauf angespielt, dass die Fabrik in den 1990er Jahren als ein Zentrum von Streiks galt)."
Es gibt einen Grund für diesen Medienwirbel. Regierung, Arbeitgeber und Gewerkschaften machen sich Sorgen wegen der wachsenden Wut unter vielen Arbeitern. Dieses Gefühl zeigt sich durch ein langsames Erstarken der Arbeiterkämpfe in mehreren Bereichen. Um diese Konflikte zu vereiteln, versucht die Bourgeoisie dieses Gefühl der Hilflosigkeit und einen gewissen Fatalismus zu verbreiten.
Die Gewerkschaften organisieren eine Scheinsolidarität der Arbeiter
Den Gewerkschaften ist es gelungen, den Ausbruch von Kämpfen bei VW zu verhindern. Sie haben die Arbeiter dazu aufgefordert, isoliert bei sich zu Hause zu bleiben, ohne Informationen, ohne Perspektiven, abhängig vom guten Willen der Arbeitgeber und den anstehenden Verhandlungen. Dann haben sie den Arbeitern einen Streik aufgezwungen, der nicht der Aktivierung und dem Kampf dient, sondern der ein endlos langer Streik sein soll, um zur Erschöpfung zu führen (er soll bis zum 15. Dezember dauern, dem Tag der offiziellen Ankündigung der Entlassungen durch die Konzernspitze in Deutschland) – dann soll jeder für sich zu Hause bleiben. Die einzige Sorge der Gewerkschaften ist "die Würde zu bewahren, den Betrieb nicht zu besetzen, die Anlagen nicht zu zerstören", weil man so nicht die Arbeitgeber verärgern wolle, die – so behaupten sie – diese "verantwortliche Haltung" berücksichtigen würden. Das ist vollkommener Unfug! Die Gewerkschaften zeigen erneut, dass sie die Interessen des Kapitalismus gegen die Interessen der Arbeiter verteidigen.
Deshalb organisieren sie, um nicht als reine Saboteure zu erscheinen, eine Scheinsolidarität für VW. Es geht nicht um eine wirkliche Solidarität im Kampf, um mit vereinten Kräften die Arbeitgeber und die Regierung zum Nachgeben zu zwingen, sondern um wirkungslose Aktionen, wie die nationale Demonstration am 2. Dezember, die ohne Folgeaktionen bleiben soll. Auch schicken sie Gewerkschaftsdelegationen in andere Automobilbetriebe, um dort andere Gewerkschaftsvertreter zu treffen und um ‚Unterstützung’ zu bitten. Das einzige Ziel, das sie dabei verfolgen, ist in "Verhandlungen mit den Arbeitgebern, die schlechtesten Kündigungsbedingungen zu verhindern". Darüber hinaus wollen die Gewerkschaften die Regierung bei ihrer Forderung zu unterstützen, ein "neues Industrieprojekt" einzurichten, das nur für neue Illusionen sorgen kann, indem durch die "Neueinstufung" von Arbeitslosen, Tausende gezwungen werden, irgendeine Arbeit anzunehmen, zu Bedingungen, die ihnen die Arbeitgeber diktieren, und bei denen sie jeglichen Anspruch auf Unterstützungsleistungen verlieren. Und da all diese Illusionen nur in eine Sackgasse führen können, werden die Gewerkschaften die Schuld dafür den Beschäftigten selbst zuschieben, die sich angeblich nicht "solidarisch" genug gezeigt hätten.
Die Geschichte zeigt, wenn man sich durch die Gewerkschaften spalten lässt, sind Niederlage und Entmutigung unausweichlich. Nicht ursächlich, weil die Gewerkschaftsvertreter bei VW oder die Führer der Metallarbeitergewerkschaft korrupt sind. Die Gewerkschaften spalten die Arbeiter und treten für eine "verantwortungsbewusste Verwaltung" der kapitalistischen Wirtschaft auf Kosten der Beschäftigten ein, weil sie seit langem Teil der Strukturen des kapitalistischen Staats sind und dessen Mechanismen verteidigen.
Die einzige Antwort auf die Angriffe besteht in einer wirklichen Arbeitersolidarität
Die Erfahrung lehrt, dass nur die Ausdehnung der Kämpfe auf anderer Teile der Arbeiterklasse dazu in der Lage ist, auch nur vorübergehend die Bourgeoisie zum Nachgeben zu zwingen. Und in Anbetracht der gärenden Kampfbereitschaft in vielen Bereichen, der angekündigten Entlassungen in anderen Betrieben ist die Möglichkeit der Ausdehnung auch gar nicht so utopisch. Aber das heißt vor allem, dass die Arbeitersolidarität und die Ausdehnung des Kampfes nur durch die Arbeiter selbst vollzogen werden kann. Dazu sind souveräne Vollversammlungen erforderlich, an denen sich die Arbeiter anderer Bereiche aktiv und massiv beteiligen und die von diesen dann selbst getragen werden.
Dabei können wir uns auf die Beispiele der jüngsten Kämpfe wie in Frankreich gegen die CPE, die Streiks der New Yorker U-Bahnbeschäftigten oder auch der Metaller von Vigo in Spanien stützen, bei denen es klare Anzeichen einer proletarischen Solidarität gab, und wo Vollversammlungen unter der Kontrolle der Arbeiter abgehalten wurden und direkt mit den Kapitalisten – ohne Mitwirken der Gewerkschaften – verhandelt wurde.
Heute werden die Krise des Kapitalismus, die Geißel der Arbeitslosigkeit und die allgemeine Barbarei des Systems immer offensichtlicher. Die große Sympathiewelle in der Bevölkerung für die Beschäftigten von VW – die viel stärker ist als zur Zeit der Entlassungen bei Ford Genk vor zwei Jahren – ist direkt mit dieser wachsenden Erkenntnis verbunden, die sich immer mehr über die Tragweite der allgemeinen Lage entwickelt wie über das grundlegende Problem, vor dem die Gesellschaft steht: Welche Perspektive bietet diese Spirale von Sparmaßnahmen und gnadenloser Konkurrenz? Die Löhne und die Arbeitsbedingungen, die während der letzten beiden Jahrhunderte in Arbeiterkämpfen den Kapitalisten abgerungen wurden, sind heute bedroht. Die Arbeitskraft, die die Quelle des Reichtums der Gesellschaft ist, wird immer stärker ausgebeutet und entwertet. All dies sind keine Zeichen der bevorstehenden schmerzhaften Geburt eines neuen Systems, sondern der Ausdruck eines dahinsiechenden Systems, das zu einem Hindernis für den Fortschritt der Menschheit geworden ist. Die zaghaften Schritte zu einem Arbeiterwiderstand, zu einer Rückkehr zur Solidarität gehen immer mehr einher mit einem vertieften Nachdenken über die Lage unserer Welt. Dies kann und muss dazu führen, dieses barbarische System in Frage zu stellen und die Perspektive eines höheren, sozialistischen Gesellschaftssystems aufzuwerfen.
IKS 24.11.06
Geographisch:
- Belgien [68]
Erbe der kommunistischen Linke:
Leserbrief: Wofür kämpfen - Nation oder Klasse?
- 3016 reads
Nachstehend veröffentlichen wir einen sehr lesenswerten Leserbrief und unsere Antwort aus der schwedischen Presse der IKS.
Wir denken, dass es interessant ist, den folgenden Brief (E-Mail) mit einer kurzen Antwort zu veröffentlichen, weil er wichtige und aktuelle Fragen aufgreift. Wir freuen uns über eure Briefe, etwa zu Gesichts- und Standpunkten von aktuellen Fragestellungen bis zu allgemeinen politischen Fragen.
Leserbrief:
Hallo, ihr Genossen!
Folgendes kann man in einem Beitrag von ‚autonomas’ im Internet finden:
‚Als Sozialist schätzt man den Klassenkampf hoch und respektiert Menschenleben. Der Anlass, dass die Linke interessiert daran ist, für die Sache der Palästinenser und Libanesen zu kämpfen, ist die Übermacht Israels mit ihrem imperialistischen und rassistischen Beigeschmack. Das ist für die Linke eine Selbstverständlichkeit, sich dagegen zu stellen.’ (aus: autonomas)
Man fragt sich, was der Kampf für die Sache der Palästinenser und Libanesen mit dem Klassenkampf zu tun hat. Der Klassenkampf in seiner richtigen und einzigen Bedeutung heißt, dass die ARBEITERKLASSE für sich, für die Befreiung der Arbeiter kämpft. Da kann man sich nur wundern, was sie [die Linken] als Klassenkampf einschätzen. Für sie ist, so sieht es aus, der Klassenkampf ein Kampf neben beliebigen anderen Kämpfen. Als ob die Angelegenheiten von Palästinensern und Libanesen mit Rassismus und Imperialismus überhaupt nichts zu tun hätten. Dabei kann ein nationaler Kampf nur ganz und gar imperialistisch sein, kann nichts anderes sein, weil man ja für eine (neue) Nation kämpft; weil Hamas und Hisbollah erklären, dass Israel vernichtet werden sollte (mit den Menschen, die in diesem Land wohnen), als ob die nicht genauso Menschen wären, auch wenn sie Juden – gläubige oder nicht gläubige - sind. Die Linken – ob eingewandert oder einheimisch – sind da anderer Ansicht. Denn wie wäre es sonst möglich, vor einer Synagoge zu protestieren? Was hat eine Synagoge, zu der alle Menschen mit jüdischem Glauben gehen, mit dem Staat Israel zu tun? Aber sie meinen vermutlich, dass wenn man jüdischen Glauben hat, dies bedeute, dass man für alles schuldig ist, was der Staat Israel macht. Genauso bescheuert wäre es, wenn man vor einer Moschee demonstrieren würde (zu der alle Menschen muslimischen Glaubens gehen), wenn einige Muslime grauenhafte Verbrechen begehen. Die Autonomen schreiben auch von „der verratenen Arbeiterrevolution im Iran und von den Verfolgungen der Linken, die dann eine Folge waren“. Wie kann man den Sturz des Schahs vor ein paar Jahrzehnten eine Arbeiterrevolution nennen? Ich weiß, dass die Linken den Sturz betrieben haben, aber ich habe nie gehört, dass man das Arbeiterrevolution nennt.
Antwort der IKS
Dein Brief greift viele sehr wichtige politische Fragen auf, die sich im Zusammenhang mit der Situation im Nahen Osten stellen. In deinem Brief gehst du auf die Frage ein, was man von dem Angriff Israels auf den südlichen Libanon, aber auch von dem Konflikt zwischen Israel und Palästina halten soll. Wir meinen, dass du viele wichtige Beobachtungen über das Verhalten der Linken in diesem Konflikt machst. Aber die vielleicht wichtigste Frage in deinem Brief ist so formuliert: „Man fragt sich, was der Kampf für die Sache der Palästinenser und Libanesen mit dem Klassenkampf zu tun hat. Der Klassenkampf in seiner richtigen und einzigen Bedeutung heißt, dass die ARBEITERKLASSE für sich, für die Befreiung der Arbeiter kämpft.“ Das ist während der ganzen Geschichte der Arbeiterbewegung eine der größten und grundlegendsten Fragen gewesen. Wie soll sich die Arbeiterklasse zu Kriegen und zu so genannten Befreiungskämpfen verhalten? Diese Fragen stellen sich konkret im Zusammenhang mit dem furchtbaren Leiden und Elend, die ein unmittelbares Ergebnis der sich verschärfenden imperialistischen Konflikte in immer größeren Teilen der Welt sind.
Wie du es aufzeigst, ist für die Linke die Antwort in diesen Konflikten, Stellung zu beziehen für eine imperialistische Seite in diesen Konflikten. Um ein Beispiel zu nennen: Wir konnten neben Demonstrationen gegen die israelischen Angriffe auf den Libanon hören, wie man den heroischen Widerstand der Hamas oder Hisbollah gegen Israels Imperialismus huldigte. Ein anderes Beispiel ist, wie die Trotzkisten von ‚Arbeitermacht’ die Taliban in Afghanistan unterstützen in ihrem Widerstand gegen den amerikanischen Imperialismus. Die gleiche Logik hatten die Trotzkisten während des 2. Weltkrieges, indem sie das brutale (und imperialistische) Regime in Russland „kritisch“ unterstützten.
Dieser Anti-Imperialismus ist immer eine ideologische Falle für die Arbeiterklasse gewesen. Er ist stets als Mittel benutzt worden, um die Entwicklung des Klassenkampfes zu verhindern und die Arbeiterklasse dazu zu missbrauchen, eine Fraktion der Bourgeoisie gegen eine andere zu unterstützen. Du berührst dies in deinem Brief indem du zeigst, dass beide Seiten in dem Konflikt zwischen Israel und Hisbollah oder Hamas den Nationalismus oder den Rassismus benutzen, um ihre eigene Kriegsführung zu rechtfertigen. Das ist ein konkretes Beispiel dafür, wie der „Anti-Imperialismus“ der Linken die reaktionärsten und nationalistischsten Bewegungen unterstützt, die immer die größten Feinde der Arbeiterklasse gewesen sind. (1) Dieser „Anti-Imperialismus“ steht auch in direktem Gegensatz zum konkreten Klassenkampf, wie wir das im Gaza beobachten konnten:
„Während des Streiks wegen der ausstehenden Löhne in Gaza City verurteilte die Hamas den Streik als einen Versuch die Regierung zu destabilisieren und mahnte die Lehrer den Streik abzubrechen.“ (siehe unseren Artikel: Der Krieg im Nahen Osten; IR 109)
Dies zeigt eben, dass die Arbeiterklasse in ihrem Kampf direkt in Konfrontation mit dem nationalen Interesse gerät. Die gleichen Erfahrungen hat das Proletariat etwa 1936 in Spanien gemacht oder auch die ANC in Südafrika, all die unzähligen so genannten nationalen Befreiungsbewegungen der 1960er Jahren (v.a. in Vietnam, Afrika, Kurdistan, Lateinamerika). Marx konstatierte schon vor 150 Jahren: „Die Arbeiterklasse hat kein Vaterland.“ Nur durch die Entwicklung ihres Klassenkampfes kann die Arbeiterklasse eine Alternative zum Krieg anbieten.
„Der einzige Kampf gegen den Imperialismus ist der Widerstand der Arbeiterklasse gegen ihre Ausbeutung, denn nur dieser Widerstand kann in einen offenen Kampf gegen das kapitalistische System übergehen. Ein Kampf, bei dem es um die Überwindung des alten, auf Profit und Krieg gestützten Systems geht. Ein Kampf, durch den eine Gesellschaft aufgebaut werden soll, die auf die Erfüllung der menschlichen Bedürfnisse hinarbeitet. Weil die Ausgebeuteten überall die gleichen Interessen haben, ist der Klassenkampf international; die Ausgebeuteten haben kein Interesse daran, sich mit irgendeinem Staat gegen einen anderen zu verbünden. Ihre Methoden stehen in direktem Gegensatz zu der Zuspitzung des Hasses zwischen ethnischen oder nationalen Gruppen, weil sie sich die Arbeiter aller Länder in einem gemeinsamen Kampf gegen das Kapital und dessen Staat zusammenschließen müssen.“ (aus der Erklärung der IKS vom 17.7.06: Nahost - Die einzige Antwort zu den ständig eskalierenden Krieg: der internationale Klassenkampf)
Das ist die Verbindung zwischen dem Klassenkampf hier in Schweden und der Solidarität mit den Opfern des imperialistischen Kriegs im Nahen Osten. Nicht so wie die Linken es machen, Stellung zu beziehen für eine Seite in einem imperialistischen Konflikt, auch wenn diese sich als heroische Widerstandsbewegung darstellen, wie die verschiedenen Bewegungen im Nahen Osten. Es ist allgemein bekannt, dass z.B. die Hisbollah ein Werkzeug der imperialistischen Interessen Irans in der Region ist, oder dass die verschiedenen palästinensischen Bewegungen ein Ausdruck dafür sind, dass die palästinensische Bourgeoisie einen eigenen Staat zu schaffen versucht. Gegen diesen Nationalismus und „Anti-Imperialismus“ müssen wir den Internationalismus stellen, für den die kommunistische Linke schon immer kämpft. Das heißt, immer die internationale Einheit der Arbeiterklasse zu verteidigen. Dies zeigt deutlich, dass eine Unterstützung des „nationalen Widerstands“ immer in direktem Gegensatz zum Klassenkampf und zu den Interessen der Arbeiterklasse auf kurze oder lange Sicht steht. Die Arbeiter in Palästina leben auf Grund des Krieges in Verzweiflung und Elend, gleichzeitig leben die Arbeiter in Israel unter der Drohung des Krieges und unter ständigen Angriffen auf ihren Lebensstandard, was ein Resultat der Kriegsrüstung des israelischen Staates ist. Ein wirklicher Kampf gegen den Imperialismus, dem Ausdruck des Verfalls des Kapitalismus, kann einzig durch den gemeinsamen Kampf gegen die Ausbeutung geschehen, der sich zu einem Kampf gegen das kapitalistische System auf internationaler Ebene entwickelt.
Zum Schluss noch ein paar kurze Zeilen über „die Revolution im Iran“. Wir teilen deine Ansicht, dass es keine Revolution war, die den Schah 1979 stürzte. Doch gab es damals im Iran einen mächtigen Kampf der Arbeiterklasse. Dieser Kampf wurde nicht nur von den Islamisten Khomeinis, sondern auch von der iranischen Linken im Keim erstickt und unterdrückt. Es ist wahr, dass die Anhänger Khomeinis eine brutale Repression gegen die Linke durchführten, als sie an die Macht kamen. Nicht nur, um jeden Rivalen zu eliminieren. Wieder zeigte sich, dass der Nationalismus und „Anti-Imperialismus“ (im Iran unter dem Deckmantel, zuerst die demokratische Gerechtigkeit zu erobern - ein typischer maoistischer Slogan) ein tödliches Gift für den Kampf der Arbeiterklasse sind.
(1) siehe z.B. unsere Broschüre Nation oder Klasse und verschiedene Artikel in der Internationalen Revue.
Geographisch:
- Schweden [34]
Theoretische Fragen:
- Internationalismus [69]
Erbe der kommunistischen Linke:
Marc : Von der Oktoberrevolution 1917 bis zum 2. Weltkrieg
- 3861 reads
Seit langem hat der Marxismus und gerade gegenüber alle dem bürgerlichen Individualismus typischen Auffassungen aufgezeigt, daß nicht die Individuen die Geschichte machen, sondern daß seit dem Auftauchen von Klassen "Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft... die Geschichte von Klassenkämpfen" ist (Manifest der Kommunistischen Partei, MEW, Bd 4, S. 462). Das Gleiche trifft insbesondere zu auf die Geschichte der Arbeiterbewegung, deren Hauptakteur gerade die Klasse ist, die weit mehr als alle anderen auf assoziierte Weise zusammenarbeitet und ihren Kampf kollektiv führt. Innerhalb des Proletariats handeln auf kollektive Art und Weise auch die kommunistischen Minderheiten, die von der Arbeiterklasse als Ausdruck ihrer revolutionären Zukunft hervorgebracht werden. Deshalb tragen die Aktionen dieser Minderheiten einen vor allem anonymen Charakter, und sie haben nichts mit Persönlichkeitskulten zu tun. Ihre Mitglieder handeln als revolutionäre Militanten nur als ein Teil eines Ganzen, einer kommunistischen Organisation. Während die Organisation mit all ihren Mitgliedern rechnen können muß, liegt es auf der Hand, daß nicht alle Mitglieder den gleichen Beitrag leisten können. Die persönliche Geschichte, die Erfahrung, die Persönlichkeit gewisser Mitglieder, ebenso die historischen Umstände, bewirken, daß sie in den Organisationen, in denen sie tätig sind, eine besondere Rolle spielen und für die Aktivität dieser Organisationen als vorwärtstreibende Kräfte wirken, insbesondere bei den Aktivitäten, die die Grundlage der Daseinsberechtigung einer Organisation darstellen: die Ausarbeitung und Vertiefung der revolutionären politischen Positionen.
Marc war gerade einer von diesen Genossen. Er gehörte zu dieser winzigen Minderheit von kommunistischen Militanten, die wie Anton Pannekoek, Henk Canne-Meijer, Amadeo Bordiga, Onorato Damen, Paul Mattick, Jan Appel oder Munis der schrecklichen Konterrevolution widerstanden und sie überlebt haben, d.h. dieser Konterrevolution, die zwischen den 20er und 60er Jahren stattgefunden hat. Neben seiner Treue gegenüber der Sache des Kommunismus vermochte es Marc, sowohl sein volles Vertrauen in die revolutionären Fähigkeiten des Proletariats aufrechtzuerhalten, und damit die neuen Generationen von Militanten von seiner ganzen Erfahrung profitieren zu lassen. Gleichzeitig blieb er nicht bei den Analysen und Positionen stehen, die durch den Verlauf der Geschichte selbst überholt worden waren (1). Aus dieser Sicht ist seine ganze Aktivität als Militant ein konkretes Beispiel dessen, was der Marxismus bedeutet: das lebendige Denken der revolutionären Klasse, die die Zukunft der Menschheit in ihren Händen hält. Ein Denken, das sich in ständiger Ausarbeitung und Weiterentwicklung befmdet. Diese Rolle der Bereicherung des Denkens und der Aktionen der politischen Organisation wurde von unserem Genossen natürlich in der IKS gespielt. Und das galt bis in die letzten Stunden seines Lebens. Sein ganzes Leben war durch die gleiche Vorgehensweise gekennzeichnet, durch den gleichen Willen, mit Entschlossenheit und unerschütterlich die kommunistischen Prinzipien zu verteidigen, wobei er gleichzeitig ein kritischer Geist war, der - wenn jeweils notwendig -das infrage stellte, was vielen als unantastbare und "invariante" Dogmen erschien. Er war mehr als 60 Jahre militant tätig. Und dieses militante Leben hatte seinen Ursprung in der Hitze der Revolution selber.
DAS ENGAGEMENT IM REVOLUTIONÄREN KAMPF
Marc wurde am 13. Mai 1907 in Kishinew, Hauptstadt Bessarabiens (Moldawien) zu einer Zeit geboren, als diese Region ein Teil des alten Zarenreichs war. Er war also noch keine 10 Jahre alt, als die Revolution von 1917 ausbrach. Anläßlich seines 80jährigen Geburtstages beschrieb er selber dieses gewaltige Ereignis, welches sein ganzes Leben prägte, folgendermaßen..:
"Ich hatte das Glück, schon als Kind die russische Revolution sowohl den Februar als auch den Oktober 1917 mitzuerleben und kennenzulernen. Ich habe das alles sehr intensiv miterlebt. Man muß wissen und begreifen, was ein Kind in einer revolutionären Periode erlebt und mitmacht, wo man ganze Tage auf Demonstrationen verbringt, von der einen zur anderen Demo geht, von einem Treffen zum anderen gelangt, wo man Nächte in Diskussionstreffs verbringt, wo sich die Soldaten, die Arbeiter versammeln, wo diskutiert wird, und wo die Meinungen aufeinanderprallen. Wenn an jeder Straßenecke plötzlich unerwartet jemand auf eine Fensterbank steigt und zu sprechen anfängt. Und dann gibt es plötzlich 1000 Menschen um einen herum und die Diskussionen entbrennen. Das war etwas Unvergeßliches in meinen Leben, das natürlich mein ganzes Leben geprägt hat. Dazu hatte ich noch das Glück, daß mein älterer Bruder Soldat und Bolschewiki war, Parteisekretär in der Stadt, und an seiner Seite bin ich auf der Straße gewesen, von einem Treffen zum nächsten geeilt, auf dem er jeweils die Positionen der Bolschewiki verteidigte... Ich hatte die Chance, der letzte in einer Familie zu sein, der fünfte, in der alle Parteimitglieder waren, bis sie getötet oder ausgeschlossen wurden. So konnte ich ich einem Haus leben, in dem es immer viele Menschen gab, Jugendliche, in dem immer diskutiert wurde, denn am Anfang war nur einer Bolschewik, die anderen waren mehr oder weniger Sozialisten. Es gab ständig Debatten mit allen ihren Freunden, ihren Kollegen usw... Und dies war eine große Chance zur politischen Bildung eines Kindes..."
Während des Bürgerkriegs, als Moldawien von den weißen Armeen aus Rumänien besetzt war, mußte die Familie Marcs 1919 nach Palästina flüchten, weil sie von Pogromen (der Vater war ein Rabbiner) bedroht war. Übrigens waren seine älteren Brüder und Schwester Mitbegründer der kommunistischen Partei dieses Landes. Zu diesem Zeitpunkt wurde Marc Anfang 1921 (er war noch keine 13 Jahre alt) Militant, als er der kommunistischen Jugend (er war einer ihrer Mitbegründer) und der Partei beitrat. Sehr schnell prallte er mit der Kommunistischen Internationale und ihrer Position zur nationalen Frage zusammen, die er, seinen eigenen Worten zufolge, nicht akzeptieren konnte. Aufgrund dieser Divergenz wurde er dann 1923 zum ersten Mal aus der kommunistischen Partei ausgeschlossen. Schon von diesem Zeitpunkt an, als er noch Jugendlicher war, zeigte Marc schon eine Hauptfähigkeit, die er sein ganzes Leben lang bewahren sollte: eine unwandelbare Unnachgiebigkeit bei der Verteidigung der revolutionären Prinzipien, ungeachtet der Tatsache, daß diese Verteidigung ihn in Widerspruch und "Opposition" zu den "bekanntesten Führern" der Arbeiterbewegung bringen sollte, wie es damals die, Führer der Komintern, insbesondere Lenin und Trotzki war (2). Seine völlige Unterstützung der Sache des Proletariats, seine militante Beteiligung bei der Arbeit der kommunistischen Organisation und die tiefgreifende Achtung, die er gegenüber den großen Namen der Arbeiterbewegung hegte, haben ihn aber nie dazu veranlaßt, den Kampf für seine eigenen Positionen aufzugeben, wenn er meinte, daß die der Organisation sich von diesen Prinzipien entfernten, oder daß sie aufgrund von neuen historischen Umständen überholt seien. Aus seiner Sicht waren genau wie bei allen großen Revolutionären wie Lenin oder Rosa Luxemburg die Unterstützung des Marxismus, der revolutionären Theorie des Proletariats keine Unterstützung für jede einzelne Aussage, sondern jeweils für den Geist und die Methode des Marxismus. In Wirklichkeit war der Mut, den unser Genosse immer bewiesen hat, genau wie bei den anderen großen Revolutionären das Gegenstück, die andere Seite seiner vollständigen und nicht zu brechenden Unterstützung der Sache des Proletariats. Weil er dem Marxismus zutiefst verbunden war, war er niemals von einer Angst gelähmt, sich von ihm zu entfernen, als er auf der Grundlage des Marxismus selber das kritisierte, was bei den Positionen der Arbeiterorganisationen überholt und veraltet war. Die Frage der Unterstützung der nationalen Befreiungskämpfe, die in der II. und dann in der III. Internationale zu einem Dogma geworden war, war die erste Stufe der Auseinandersetzung, auf der er Gelegenheit hatte, diese Vorgehensweise anzuwenden (3).
DER KAMPF GEGEN DIE ENTARTUNG DER KOMMUNISTISCHEN INTERNATIONALE
1924 kam Marc in Begleitung einer seiner Brüder nach Frankreich. Er wurde in die jüdische Gruppe der kommunistischen Partei aufgenommen, womit er erneut zum Mitglied derselben Internationale wurde, aus der er kurz zuvor ausgeschlossen worden war. Von Anfang an beteiligte er sich an der Opposition, die gegen den Prozeß der Entartung der Komintern und der Kommunistischen Parteien ankämpfte. So beteiligte er sich mit Albert Treint (Generalsekretär der KPF von 1923-26) und Suzanne Girault (ehemalige Schatzmeisterin der Partei) an der Gründung der "Leninistischen Einheit" im Jahre 1927. Als die Oppositionsplattform, die von Trotzki in russischer Sprache verfaßt worden war, nach Frankreich gelang, erklärte er sich mit ihr einverstanden. Dagegen verwarf er im Gegensatz zu Treint die Erklärung Trotzkis, derzufolge bei all den Fragen, bei denen es zwischen Lenin und Trotzki vor 1917 Divergenzen gegeben hatte, Lenin Recht gehabt habe. Marc meinte, solch eine Einstellung sei überhaupt nicht richtig, zunächst weil Trotzki nicht wirklich von dem überzeugt war, was er behauptete; dann weil solch eine Position Trotzki auch nur bei den falschen Positionen Lenins verharren lassen konnte, die dieser in der Vergangenheit vertreten hatte (insbesondere bei der Revolution von 1905 bei der Frage der "Demokratischen Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft"). Erneut zeigte der Genosse seine Fähigkeit, eine kritische und hellsichtige Einstellung gegenüber den großen "Autoritäten" der Arbeiterbewegung zu bewahren. Seine Zugehörigkeit zur Opposition der Internationalen Linken nach seinem Ausschluß aus der KPF im Februar 1928 bedeutete keine Unterwerfung gegenüber all den Positionen ihres Hauptführers, ungeachtet all der Hochachtung, die er gegenüber ihm hegte. Insbesondere dank dieses Geistes war er dazu in der Lage, später nicht durch die opportunistischen Tendenzen der trotzkistischen Bewegung aufgesogen zu werden, gegen die er Anfang der 30er Jahre den Kampf aufnahm. Nachdem er sich neben Treint an der Bildung der "Redressement communiste" (Kommunistische Wiederaufrichtung) beteiligt hatte, trat er 1930 dem Kommunistischen Bund (Ligue Communiste/ die Organisation, welche in Frankreich die Opposition darstellte) bei, innerhalb der er neben Treint Mitglied der Exekutivkommission im Oktober 1931 wurde. Aber alle beide verließen diese Gruppierung im Mai 1932, nachdem sie eine Minderheitsposition gegenüber dem ansteigenden Opportunismus verteidigt hatten, um bei der Gründung der Fraktion der Kommunistischen Linken (sog. Gruppe aus Bagnolet) mitzuwirken. 1933 gab es in dieser Organisation eine Spaltung und Marc brach mit Treint, der anfing, eine Analyse der UdSSR zu vertreten, wie sie ähnlich später von Burnham und Chaulieu ("bürokratischer Sozialismus") vertreten wurde. Im November 1933 beteiligte er sich mit Chaz6 (Gaston Davoust, der 1984 starb) an der Gründung der Union Communiste (Kommunistische Union). Mit Chaz6 hatte er Kontakt seit Anfang der 30er Jahre gehalten, als dieser noch Mitglied der KPF war (von der er im August 1932 ausgeschlossen wurde) und bei der Gruppe des 15. Bereichs (westlicher Vorort von Paris) mitmachte, die oppositionelle Auffassungen vertrat.
DIE GROSSEN KÄMPFE DER 30er JAHRE
Marc blieb Mitglied der "Union Communiste" bis zum Zeitpunkt des Spanienkriegs. Es handelte sich um einen der tragischsten Momente der Arbeiterbewegung. Victor Serge sprach von "il est minuit dans le sicle" (m.a.W. die finstersten Stunden des Jahrhunderts). Wie Marc es selber beschrieb "Jahrelang in schrecklicher Isolierung zu leben, mit ansehen zu müssen, wie das französische Proletariat hinter der französischen Trikolore marschierte, der Fahne der Versailler, wie es die Marseillaise sang, all das im Namen des Kommunismus; für die Generationen, die revolutionär geblieben waren, war dies eine ganz scheußliche Sache".
Und gerade während des Spanienkriegs erreichte dieses Gefühl der Hilflosig- und Machtlosigkeit einen Höhepunkt, als eine Vielzahl von Organisationen, die bis dahin Klassenpositionen aufrechterhalten hatten, von der "anti-faschistischen" Welle weggeschwemmt wurden. Insbesondere traf dies auf die Union Communiste zu, die die Ereignisse von Spanien als eine proletarische Revolution einschätzte, in der die Arbeiterklasse die Initiative der Kämpfe ergriffen hätte. Diese Organisation ging zwar nicht soweit, die Regierung der "Volksfront" zu unterstützen. Aber sie befürwortete das Engagement bei den antifaschistischen Milizen und nahm politische Beziehungen mit dem linken Flügel der POUM auf, einer antifaschistischen Organisation, die sich an der Regierung der Generalitat in Katalonien beteiligte.
Als unnachgiebiger Verteidiger der Klassenprinzipien konnte Marc natürlich solch eine Kapitulation vor der herrschenden antifaschistischen Ideologie nicht akzeptieren, auch wenn diese in Worten verpackt war wie "Solidarität mit dem Proletariat Spaniens". Nachdem er in einer Minderheit gegen solch ein Abgleiten mit gekämpft hatte, verließ er die Union Communiste und trat als Einzelmitglied 1938 der Fraktion der Italienischen Linken bei, mit der er in Kontakt geblieben war. In deren Reihen wiederum hatte es auch eine Minderheit gegeben, die dem Engagement bei den antifaschistischen Milizen positiv gegenüberstand. Inmitten der Erschütterungen, die der Spanienkrieg hervorrief und in Anbetracht all der Verrate, die er mit sich brachte, war die Italienische Fraktion, die im Mai 1928 in einem Pariser Vorort in Pantin gegründet worden war, eine der wenigen Gruppierungen, die auf Klassenprinzipien beharrte. Sie stützte ihre Position der unnachgiebigen Verwerfung all der antifaschistischen Lockrufe auf dem Begreifen des historischen Kurses, der durch die Konterrevolution beherrscht wurde. In solch einer Phase des tiefgreifenden Zurückweichens des Weltproletariats, des Sieges der Reaktion, konnten die Ereignisse in Spanien nicht als ein Erstarken einer neuen revolutionären Welle verstanden werden, sondern als eine neue Etappe der Konterrevolution. Am Ende des Bürgerkrieges, in der sich nicht Arbeiterklasse und Bourgeoisie gegenüberstanden, sondern die bürgerliche Republik, die auf der Seite des "demokratischen" imperialistischen Lagers stand, gegen eine andere bürgerliche Regierung, die dem "faschistischen" imperialistischen Lager verbunden war, konnte es keine Revolution, sondern nur einen Weltkrieg geben. Die Tatsache, daß die Arbeiter in Spanien spontan die Waffen gegen den Putsch Francos im Juli 1936 ergriffen haben (was natürlich von der Fraktion begrüßt wurde), eröffnete diesen jedoch keine revolutionäre Perspektive von dem Zeitpunkt an, als sie von den antifaschistischen Organisationen wie der SP, KP oder der anarcho-syndikalistischen CNT kontrolliert wurden, und darauf verzichteten, auf ihrem eigenen Klassenterrain zu kämpfen. Denn sie wurden schließlich zu Soldaten der bürgerlichen Republik, die von der "Volksfront" geführt wurde. Und einer der deutlichsten Beweise dafür, daß das Proletariat sich in Spanien in einer tragischen Sackgasse befindet, liegt in der Tatsache, daß es in diesem Land keine revolutionäre Partei gibt (4). Als Militant der Italienischen Fraktion, die in Frankreich und in Belgien im Exil lebt, (5) setzte Marc den revolutionären Kampf fort. Insbesondere wurde er ein enger Weggefährte Vercesis (Ottorino Perrrone), der eine Haupttriebkraft in der Italienischen Fraktion war. Jahre später hat Marc oft den jungen Militanten der IKS erklärt, wieviel er an der Seite Vercesis gelernt habe, für den er eine große Hochachtung zeigte und den er bewunderte. "An seiner Seite habe ich wirklich gelernt, was es hieß, ein Militant zu sein", hat er oft gesagt. Die bemerkenswerte Festigkeit, die die Fraktion unter Beweis stellte, ist zum großen Teil auf Vercesi zurückzuführen, der schon als Militant seit dem Ende des 1. Weltkriegs in der PSI und dann in der PCI einen ständigen Kampf führte für die Verteidigung der revolutionären Prinzipien gegen den Opportunismus und gegen den Niedergang dieser Organisationen. Im Unterschied zu Bordiga, der Hauptführer der PCI während ihrer Gründung 1921 und Haupttriebkraft der Linken in den nachfolgenden Jahren, der sich aber nach seinem Ausschluß aus der PCI im Jahre 1930 aus dem militanten Leben zurückzog, hat Vercesi seine Erfahrung in den Dienst der Fortsetzung des Kampfes gegen den Konterrevolution gestellt. Insbesondere leistete er einen gewaltigen Beitrag zur Herausarbeitung der Position hinsichtlich der Rolle der Fraktionen im Leben der proletarischen Organisationen, insbesondere in den Zeiträumen der Reaktion und des Niedergangs der Partei (6). Aber seine Beiträge waren noch umfangreicher. Auf der Grundlage des Begreifens der Aufgaben der Revolutionäre nach dem Scheitern der Revolution und dem Sieg der Konterrevolution war die Erstellung einer Bilanz (daher der Name der Publikation der Fraktion auf französisch "BILAN") der vorausgegangenen Erfahrung im Hinblick auf die "Vorbereitung der Kader für die neuen Parteien des Proletariats" unerläßlich, wobei dies - wie BILAN schrieb, ohne irgendwelche Scheuklappen und irgendein Verbot ,etwas zu überprüfen, geschehen sollte. Dabei trieb er die Fraktion zu einer umfangreichen Arbeit der Reflexion und theoretischen Ausarbeitung an, wodurch diese zu einer der ergiebigsten Organisationen in der Geschichte der Arbeiterbewegung wurde. Obgleich er von seiner politischen Bildung her "leninistischer" Ausrichtung war, hatte er keine Angst, die Positionen Rosa Luxemburgs zu übernehmen, die die Unterstützung der nationalen Unabhängigkeitskämpfe verwarf und sich auf eine Analyse der ökonomischen Ursachen des Imperialismus stützte. Bei diesem letzten Punkt hatte er aus den Debatten mit dem Bund der Internationalistischen Kommunisten (Ligue des communistes internationalistes) Belgiens gelernt, deren Minderheit sich den Positionen der Fraktion während des Spanienkriegs anschloß, um mit ihr Ende 1937 die Internationale Kommunistische Linke zu gründen. Auch entwickelte Vercesi (in Zusammenarbeit mit Mitchell, Mitglied der LCI) ausgehend von den Lehren des Prozesses des Niedergangs der russischen Revolution und der Rolle des Sowjetstaates in der Konterrevolution die Position, derzufolge es eine Identifizierung zwischen Diktatur des Proletariats und Staat, der nach der Revolution entstehen würde, nicht geben kann. Schließlich gab er bei der Organisationsfrage ein Beispiel innerhalb der Exekutivkommission der Fraktion, wie eine Debatte geführt werden muß, wenn schwerwiegende Divergenzen entstehen. Gegenüber der Minderheit, die jegliche Organisationsdisziplin brach, als sie sich den antifaschistischen Milizen anschloß, die nicht mehr ihre Beiträge zahlen wollte, trat er gegen die Auffassung einer überstürzten organisatorischen Trennung auf (obgleich den Funktionsregeln der Fraktion gemäß die Mitglieder der Minderheit hätten ausgeschlossen werden können), um die besten Bedingungen für die größtmöglichen Gelegenheiten zur Entwicklung einer Klarheit in der Debatte zu haben. Aus Vercesis Sicht wie für die Mehrheit der Fraktion war die politische Klarheit eine wesentliche Priorität bei der Rolle und der Aktivität der revolutionären Organisationen.
All diese Lehren, die er sich in vielerlei Hinsicht schon in seiner früheren politischen Aktivität zu eigen gemacht hatte, hat Marc während der Jahre verarbeitet, in denen er an der Seite Vercesis als Militant aktiv war. Und auf diese gleichen Lehren stützte er sich selbst, als Vercesi anfing, sie zu vergessen und sich von den marxistischen Positionen zu entfernen. Als die Kommunistische Linke Italiens (GCI) gegründet wurde, als "BILAN" durch "Octobre" ersetzt wurde, hatte Vercesi angefangen, eine Theorie über die Kriegswirtschaft zu entwickeln, die ein endgültiges Überwinden der Krise des Kapitalismus ermöglicht hätte. Von dem vorübergehenden Erfolg der Wirtschaftspolitik des New Deal und der Nazis desorientiert, schlußfolgerte er daraus, daß die Waffenproduktion, die auf keine gesättigten kapitalistischen Märkte strömt, es dem Kapitalismus ermöglicht, seine wirtschaftlichen Widersprüche zu überwinden. Ihm zufolge stellten die gigantischen Aufrüstungsprogramme aller Länder Ende der 30er Jahre keine Vorbereitungen für einen späteren Weltkrieg dar, sondern waren im Gegenteil ein Mittel, um diesem auszuweichen, indem die Hauptursache beseitigt würde: die wirtschaftliche Sackgasse des Kapitalismus. Auf diesem Hintergrund, so Vercesi, müßten die verschiedenen lokalen Kriege, die damals stattfanden, insbesondere der Spanienkrieg, nicht als ein Vorspiel eines größeren Konfliktes aufgefaßt werden, sondern als ein Mittel für die Bourgeoisie, die Arbeiterklasse zu zerschlagen, damit diese keine revolutionären Kämpfe liefern könnte. Deshalb wandelte das Internationale Büro der GCI den Namen seiner Publikation in "Octobre" um: man sei in eine neue revolutionäre Periode eingetreten. Solche Positionen stellen eine Art nachträglichen Sieg der ehemaligen Minderheit der Fraktion dar.
Gegenüber solch einem Abgleiten, wodurch die Hauptlehren BILANs in-fragegestellt wurden, führte Marc einen Kampf für die Verteidigung der klassischen Positionen der Fraktion und des Marxismus. Für ihn war dies ein sehr schwieriger Test, denn er mußte die Fehler eines Genossen bekämpfen, den er ausgesprochen hoch einschätzte. In diesem Kampf war er in der Minderheit, denn die Mehrheit der Mitglieder der Fraktion, die durch ihre Bewunderung Vercesis 'erblindet' waren, folgten diesem in dessen Sackgasse. Schließlich bewirkte diese Auffassung bei der Italienischen Fraktion wie auch bei der Belgischen Fraktion eine vollständige Lähmung zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Weltkriegs. Damals meinte Vercesis, es gebe keinen Grund mehr zu intervenieren, weil die Arbeiterklasse "gesellschaftlich verschwunden" sei. Zu diesem Zeitpunkt konnte Marc, der in die französische Armee eingezogen worden war (obgleich er staatenlos war), nicht sofort den Kampf aufnehmen (7). Erst im August 1940 konnte er sich in Marseille im Süden Frankreichs wieder in politische Aktivitäten stürzen, um die Elemente der Italienischen Fraktion zusammenzuschließen, die sich in dieser Stadt zusammengefunden hatten.
GEGEN DEN IMPERIALISTISCHEN KRIEG
Die meisten Genossen weigerten sich, die von dem Internationalen Büro unter Vercesis Einfluß getroffene Entscheidung der Auflösung der Fraktionen hinzunehmen. Im Jahre 1941 hielten sie eine Konferenz der neugebildeten Fraktion ab, die sich auf die Verwerfung des seit 1937 eingeschlagenen Kurses stützte. So verwarf sie die Theorie der Kriegswirtschaft als Überwindung der Krise, auch die Idee, daß "lokale" Kriege zum Zweck der Niederschlagung der Arbeiterklasse geführt würden sowie des "gesellschaftlichen Verschwinden des Proletariats" usw.. Auch gab die Fraktion die alte Position zur UdSSR auf, derzufolge diese als ein "entarteter Arbeiterstaat" (8) dargestellt wurde. Stattdessen wurde ihr kapitalistisches Wesen aufgezeigt. Während des ganzen Krieges hielt die Fraktion unter den schlimmsten Bedingungen der geheimen Arbeit Jahreskonferenzen mit Genossen aus Marseille, Toulon, Lyon und Paris ab. Und trotz der Besetzung durch deutsche Truppen wurden Verbindungen zu Elementen in Belgien aufgebaut.
Ein internes Diskussionsbulletin wurde in Umlauf gebracht, das alle Fragen, die zur Niederlage von 1939 geführt hatten, aufgriff. Wenn man die verschiedenen Nummern dieses Bulletins liest, kann man sehen, daß die meisten Grundsatztexte, die die von Vercesi am deutlichsten vertretenen Abweichungen bekämpfen oder die Herausarbeitung neuer Positionen, die durch die Entwicklung der neuen historischen Situation entstanden waren, die Unterschrift Marco trugen. Unser Genosse, der der Fraktion erst 1938 beigetreten und ihr einziges "ausländisches" Mitglied war, war während des Krieges ihre Haupttriebkraft. Gleichzeitig hatte Marc Diskussionen mit einem Kreis von jungen Elementen vorangetrieben, von denen die meisten aus dem Trotzkismus kamen, und mit denen er im Mai 1942 den französischen Kern der Kommunistischen Linke auf den politischen Grundlagen der GCI bildete. Dieser Kern arbeitete auf die Perspektive hin der Bildung einer Französischen Fraktion der Kommunistischen Linke, aber sie verwarfen die Politik der "Rekrutierungskampagnen" und der von den Trotzkisten praktizierten "Unterwanderung". Unter Marcs Einfluß weigerten sie sich, überstürzt sofort eine solche Fraktion zu gründen.
Nachdem die Exekutivkommission der Italienischen Fraktion neu gebildet worden war, zu der Marc gehörte, wie auch dem französischen Kern, mußten diese gegenüber den Ereignissen in Italien 1942-43 Stellung beziehen, als wichtige Klassenkämpfe zum Sturz Mussolinis am 25. Juli 1943 und zu seiner Ersetzung durch den Admiral Badoglio führten, welcher auf Seiten der Alliierten stand. Ein von Marco unterzeichneter Text im Namen der Exekutivkommission äußerte sich folgendermaßen "die revolutionären Revolten, die den Lauf des imperialistischen Krieges zu Ende bringen werden, werden in Europa eine chaotische Lage entstehen lassen, die für die Bourgeoisie sehr gefährlich sein wird". Gleichzeitig warnten sie gegen die Versuche des "angloamerikanischen-russischen imperialistischen Blocks", die Revolten von Außen her zu zerschlagen, und auch gegen die der Parteien der Linken, die "das revolutionäre Bewußtsein mundtot machen wollen". Die Konferenz der Fraktion, die trotz der Opposition Vercesis im August 1943 stattfand, erklärte nach ihrer Analyse der Ereignisse in Italien, daß "die Umwandlung der Fraktion zur Partei" in diesem Land auf der Tagesordnung steht. Aufgrund der materiellen Schwierigkeiten und aufgrund des passiven Widerstands, den Vercesi gegenüber solch einer Position ausübte, schaffte es die Fraktion nicht, nach Italien vorzudringen, um dort aktiv bei den Kämpfen zu intervenieren, die angefangen hatten, sich zu entfalten. Insbesondere wußte sie nicht, daß sich Ende 1943 im Norden Italiens nach den Anregungen Onorato Damens und Bruno Maffis die Partito Comunista Internazionalista (PCInt, Internationalistische Kommunistische Partei) gegründet hatte, an der sich alte Mitglieder der Fraktion beteiligten.
Während dieser Zeit hatten die Fraktion und der Kern Kontakte entwickelt und Diskussionen aufgenommen mit anderen revolutionären Elementen, insbesondere mit deutschen und österreichischen Flüchtlingen, den Revolutionären Kommunisten Deutschlands (RKD), die sich vom Trotzkismus gelöst hatten. Mit ihnen und insbesondere an führender Stelle der französische Kern betrieben sie eine direkte Propaganda gegen den imperialistischen Krieg; sie wandten sich an die Arbeiter und Soldaten aller Nationalitäten, die deutschen Proletarier in Uniform eingeschlossen. Es handelte sich natürlich um eine sehr gefährliche Aktivität, denn sie traten nicht nur der Gestapo entgegen, sondern auch der R6sistance. Gerade diese erwies sich als für die Genossen am gefährlichsten, denn nachdem unser Genosse mit seiner Lebensgefährtin von den FFI (Forces Francaises de l'Interieur - die demokratische Gestapo) verhaftet worden war, in deren Reihen es von Stalinisten wimmelte, entronn er nur knapp dem Tod, mit dem die Stalinisten ihm gedroht hatten. Aber das Ende des Krieges sollte auch die Totenglocke der Fraktion einläuten.
In Brüssel übernahm Vercesi Ende 1944 nach der "Befreiung" bei der Fortführung seiner falschen Positionen, mit denen er die Prinzipien verworfen hatte, welche er in der Vergangenheit verteidigt hatte, die Führung einer "antifaschistischen Koalition", die "L'Italia di Domani" (Das Italien von morgen) herausbrachte. Es handelte sich um eine Zeitung, die unter dem Vorwand der Hilfe für italienische Gefangene und Emigranten klar Stellung bezog für die Seite der Kriegsalliierten. Sobald diese Tatsachen überprüft worden waren, und am Anfang wollte dies einfach niemand glauben, schloß die Exekutivkommission der Fraktion nach Marcs Vorschlag Vercesi am 25. Jan. 1945 aus. Solch eine Entscheidung ist nicht zurückzuführen auf die Divergenzen, die es bei verschiedenen Punkten zwischen Vercesi und der Mehrheit der Fraktion gab. Wie damals mit der alten Minderheit von 1936-37 bestand die Politik der Exekutivkommission und mit Marc in ihren Reihen darin, die Haltung Vercesis aus dem damaligen Zeitraum fortzusetzen, die die Debatten mit der größtmöglichen Klarheit vorandrängen wollte. Aber was Vercesi 1945-45 vorgeworfen wurde, waren nicht nur einfach politische Divergenzen, sondern seine aktive Teilnahme und gar führende Rolle bei einem Organismus der Bourgeoisie, der am imperialistischen Krieg mitwirkte. Aber dieses letzte Zeichen Unnachgiebigkeit seitens der Italienischen Fraktion war nur ein "letztes Aufbäumen".
Nachdem sie von der Existenz der PCInt in Italien erfahren hatten, beschloß die Mehrheit ihrer Mitglieder auf der Konferenz vom Mai 1945 die Selbstauflösung der Fraktion und die individuelle Integration ihrer Mitglieder in die neue "Partei". Mit seiner letzten Energie trat Marc gegen diesen Schritt auf, den er als vollständige Verwerfung der ganzen Vorgehensweise auffaßte, auf der sich bislang die Fraktion gestützt hatte. Er forderte deren Aufrechterhaltung bis zum Abschluß der Überprüfung der politischen Positionen dieses neuen, so wenig bekannten Gebildes. Und die Zukunft gab ihm mit dieser Vorsicht recht, wenn man feststellt, daß die erwähnte Partei, der Elemente aus dem Süden Italiens aus der Umgebung Bordigas beitraten (und von denen einige eine Unterwanderungsarbeit in der Italienischen KP betrieben), die schlimmsten opportunistischen Positionen entfaltete, wobei man sogar soweit ging, mit der antifaschistischen Partisanenbewegung Kontakt aufzunehmen (siehe dazu Internationale Revue, Nr. 8, 4. Quartal 1976 und Nr. 32, 1. Quartal 1983, jeweils englisch, französische Ausgabe). Um gegen solch eine Kehrtwendung zu protestieren, kündigte Marc seinen Rücktritt aus der Exekutivkommission an und verließ die Konferenz, die sich auch geweigert hatte, die Französische Fraktion der Kommunistischen Linken (FFGC) anzuerkennen, welche Ende 1944 von dem französischen Kern gegründet worden war, und die die Grundsatzpositionen der Internationalen Kommunistischen Linke (GCI) übernommen hatte. Vercesis seinerseits trat der neuen "Partei" bei, welche von ihm keine Rechenschaft forderte über seine Teilnahme an der antifaschistischen Koalition in Brüssel. So kamen all die Bemühungen zum Erliegen, die er selber jahrelang unternommen hatte, um die Fraktion als Brücke zur Zukunft wirken zu lassen zwischen einer alten Partei, die zum Feind übergewechselt war und einer neuen Partei, die mit dem Wiedererstarken des Klassenkampfes des Proletariats auftauchen würde. Da Vercesi den Kampf für diese Position nicht weiter fortsetzte, sondern im Gegenteil dieser neuen Gruppierung -der FFGC - , die den klassischen Prinzipien der Italienischen Fraktion und der Internationalen Kommunistischen Linken (GCI) treu geblieben war, standen er und die neue PCInt ihr sehr feindlich gegenüber. Vercesi zielte gar darauf ab, innerhalb der FFGC eine Spaltung herbeizuführen,
wodurch es zur Bildung einer 'FFGC bis' (9) kam. Diese Gruppe veröffentlichte eine Zeitung, die den gleichen Namen wie die der FFGC hatte, "L'Etincelle", "Der Funken". Ihr traten bei Mitglieder der ehemaligen Minderheit von BILAN, die seinerzeit von Vercesi bekämpft worden war, sowie ehemalige Mitglieder der Union Communiste. Die PCInt und die Belgische Fraktion (die sich nach dem Krieg um Vercesi in Brüssel zusammengefunden hatte) bezeichneten die 'FFGC bis' als die einzigen "Repräsentanten der Kommunistischen Linken".
Von dem Zeitpunkt an war Marc das einzige Mitglied der Italienischen Fraktion, der den Kampf und die Positionen aufrechthielt, die die Stärke und die politische Klarheit dieser Organisation ausgemacht hatten. Innerhalb der Kommunistischen Linke Frankreichs, die FFGC bezeichnete sich nunmehr so, begann er eine neue Etappe in seinem politischen Leben.
Fußnoten:
(1) Die hier erwähnten Militanten waren nur die bekanntesten unter denen, die es schafften, die Konterrevolution zu überleben, ohne ihre kommunistische Meinungen aufzugeben. Man muß jedoch hervorheben, daß die meisten von ihnen im Gegensatz zu Marc es nicht geschafft haben, revolutionäre Organisationen zu gründen oder am Leben zu halten. Das trifft insbesondere für Mattick, Pannekoek und Canne-Meijer zu, berühmte Genossen der Rätekommunistischen Bewegung, die von ihren eigenen Auffassungen zur Organisationsfrage gelähmt wurden, oder gar wie bei Canne-Meijer von der Idee, daß der Kapitalismus in der Lage sei, seine Krisen endgültig zu überwinden, wodurch dem Sozialismus wieder jede Grundlage entzogen würde (siehe unsere Internationale Revue Nr. 37, "Das Scheitern des Rätismus, der verlorene Sozialismus"). So schaffte es auch Munis, ein sehr wertvoller und mutiger Genosse, der aus der spanischen Sektion der trotzkistischen Strömung hervorgegangen war, nicht, mit seinen anfänglichen Auffassungen zu brechen, und da er in einer sehr voluntaristischen Betrachtungsweise verfangen war, die die Rolle der Wirtschaftskrise bei der Entwicklung des Klassenkampfes verwarf, gelang es ihm auch nicht, den neuen Elementen, die dem FOR (Ferment Ouvrier R6volutionnaire) beigetreten waren, einen theoretischen Rahmen zu vermitteln, der ihnen ermöglicht hätte, die Aktivitäten dieser Organisation auf ernsthafte Weise nach dem Tode ihres Gründers fortzusetzen. Bordiga und Damen ihrerseits vermochten politische Gruppen zu be‑reichern, die über deren Tod hinaus weiterbestehen (die Internationale Kommunistische Partei und die Internationalistische Kommunistische Partei); jedoch hatten sie große Schwierigkeiten (vor allem Bordiga), um die überholt gewordenen Positionen der Kommunistischen Internationale zu überwinden, was wiederum zu einem Handikap für diese Organisationen wurde. Dadurch kam es zu einer sehr schwerwiegenden Krise Anfang der 80er Jahre (im Fall der IKP) oder zu einer ständigen Zweideutigkeit, Unklarheit bei lebenswichtigen Fragen wie bei den Gewerkschaften, dem Parlamentarismus oder den nationalen Bewegungen (im Fall der Internationalistischen KP, wie man es während der internationalen Konferenzen in den 70er Jahren feststellen konnte). Das traf übrigens auch auf Jan Appel zu, einer der bekannten Führer in der KAPD, der von den Positionen dieser Gruppe geprägt blieb, ohne sie wirklich aktualisieren zu können. Jedoch hat sich dieser Genosse seit der Gründung der IKS mit der allgemeinen Orientierung unserer Organisation identifiziert, und er hat uns nach besten Kräften unterstützt. Man muß wissen, daß Marc gegenüber all diesen Genossen ungeachtet der zahlreichen Divergenzen, die sie trennten, die größte Hochschätzung für sie hatte, und er fühlte sich mit den meisten von ihnen freundschaftlich verbunden. Diese Hochachtung und Verbundenheit begrenzte sich übrigens nicht auf diese Genossen. Er hatte sie auch für Genossen, die weniger bekannt waren, die aber .in Marcs Augen das große Verdienst hatten, ihre Treue gegenüber der Sache der Arbeiterklasse, der Revolution in den schwierigsten Momenten in der Geschichte des Proletariats aufrechterhalten zu haben.
Marc erwähnte gerne diese Episode aus dem Leben Rosa Luxemburgs, die auf dem Kongreß der II. Internationale 1896 (als sie gerade 26 Jahre alt war) es wagte, gegen all die "Autoritäten" der II. Internationale Stellung zu beziehen, und um das zu bekämpfen, was ein unantastbares Prinzip der Arbeiterbewegung geworden zu sein schien: die Forderung nach der Unabhängigkeit Polens.
Diese Vorgehensweise war der Bordigas diametral entgegengesetzt, aus dessen Sicht das Programm seit 1848 "invariabel" war. Dennoch hat dies nichts mit den "Revisionisten" wie Bernstein zu tun, oder mit den neueren Vertretern wie Chaulieu, Mentor der Gruppe "Sozialismus oder Barbarei" (1949-65). Sie unterscheidet sich auch von der rätekommunistischen Bewegung, die meinte, weil die russische Revolution von 1917 zu einer neuen Variante des Kapitalismus geführt habe, handelte es sich dabei um eine bürgerliche Revolution, oder die sich auf eine "neue" Arbeiterbewegung berief in Gegenüberstellung zu der "alten" (der II. und III. Internationale), die gescheitert wären.
Hinsichtlich der Haltung der Fraktion gegenüber den Ereignissen in Spanien siehe insbesondere die "Internationale Revue", Nr. 4,6,7 1976 (engl. Ausgabe)
Zur Italienischen Fraktion siehe unsere Broschüre "Die Kommunistische Linke Italiens".
Zur Frage des Verhältnisses Partei-Fraktion siehe unsere Artikelsammlung in der Internationalen Revue Nr. 59,61,64,65 usw. - auch auf deutsch erhältlich.
15 Jahre lang war unser Genosse nur im Besitz eines "Ausweisungsbeschlusses" vom französischen Territorium, den er alle zwei Wochen bei den Behörden vorlegen mußte, um die Durchführung desselben aufzuschieben zu lassen. Es handelte sich um ein Damoklesschwert der sehr demokratischen Regierung Frankreichs, dem "Land des Asyls und der Menschenrechte", den diese über seinem Kopf schweben ließ. Marc war ständig gezwungen, zu beteuern, daß er keine politischen Aktivitäten betreibe, was er natürlich nicht einhielt. Zum Zeitpunkt des Krieges beschloß diese Regierung, daß dieser "unerwünschte Staatenlose" durchaus dazu gut sei, als Kanonenfutter bei der Verteidigung des Vaterlandes zu dienen. Obwohl von den deutschen Truppen gefangengenommen, gelang ihm die Flucht, bevor diese entdeckten, daß er Jude war. Mit seiner Lebensgefährtin Clara flüchtete er nach Marseille, wo die Polizei, nachdem sie seine Lage von vor dem Krieg entdeckt hatte, ihm keinen Ausweis ausstellte. Ironischerweise zwangen die Militärbehörden die Zivilbehörden zu einer Änderung ihrer Haltung zugunsten von Marc, den sie als jemanden betrachteten, der "im Dienste Frankreichs" stünde, umso mehr noch, da es sich noch nicht einmal um sein Land handelte.
Diese Analyse, die denen der Trotzkisten gleicht, hat die Fraktion jedoch nie zu einem Aufruf zur "Verteidigung der UdSSR" veranlaßt. Seit Anfang der 30er Jahre - und die Ereignisse in Spanien haben diese Position vollauf bestätigt - ging die
Fraktion davon aus, daß der "Sowjetstaat" einer der schlimmsten Feinde des Proletariats war.
Man muß unterstreichen, daß Marc trotz der Fehler Vercesis ihm gegenüber immer einen großen Respekt und Hochachtung zollte. Diese Hochachtung galt auch für alle Mitglieder der Italienischen Fraktion, die er immer mit den herzhaftesten Worten erwähnte. Man mußte ihn reden hören von all den Militanten, die nahezu alle Arbeiter waren, von Piccino, Tulio, Stefanini, deren Kampf er in den dunkelsten Stunden dieses Jahrhunderts teilte, um seine Hochachtung und Verbundenheit mit diesen Genossen einschätzen zu können.
Dieser Artikel war in seiner ursprünglichen Fassung in zwei Teilen veröffentlicht worden. Es folgt hier der 2.
VOM 2. WELTKRIEG BIS HEUTE "INTERNATIONALISME"
Die Gauche Communiste de France (GCF) hielt ihre 2. Konferenz im Juli 1945 ab. Sie verabschiedete einen Bericht zur internationalen Situation, der von Marc verfaßt worden war (wiederveröffentlicht in der International Review Nr. 59, 1989, engl. Ausgabe), in dem eine globale Bilanz der Kriegsjahre gezogen wird. Ausgehend von den klassischen Positionen des Marxismus zur Frage des Imperialismus und des Krieges, insbesondere gegenüber den Verirrungen, die Vercesi entfaltet hatte, stellt dieses Dokument eine Vertiefung des Begreifens der Hauptprobleme dar, vor denen die Arbeiterklasse in der Dekadenz des Kapitalismus steht. Dieser Bericht spiegelt den ganzen Beitrag wider, den die GCF für das revolutionäre Gedankengut leistete, und von dem man sich eine Vorstellung machen kann, wenn man die theoretische Revue "Internationalisme" liest (1). "L'Etincelle" stellte sein Erscheinen Ende 1946 ein. Die GCF hatte verstanden, daß ihre Prognose eines revolutionären Endes des imperialistischen Krieges (d.h. die Erwartung einer parallelen Entwicklung wie am Ende des 1. Weltkriegs) nicht erfüllt worden war. Dank der Lehren, die sie aus der Vergangenheit gezogen hatte -und die Fraktion hatte dies schon seit 1943 befürchtet-hatte die Bourgeoisie der "Siegerländer" es geschafft, einen Aufstand des Proletariats zu verhindern. Die "Befreiung" war kein Sprungbrett für die Revolution, sondern im Gegenteil ein Gipfel der Konterrevolution. Die GCF zog daraus die Konsequenzen und meinte, daß die Bildung der Partei nicht auf der Tagesordnung stünde; ebenso meinte sie, daß jetzt nicht eine Hauptaufgabe die Agitation in der Arbeiterklasse sei, zu dessen Zweck L'Etincelle geschaffen worden war. Jetzt standen die Revolutionäre vor einer Aufgabe, ähnlich wie sie BILAN vor sich gehabt hatte. Deswegen widmete sich die GCF nunmehr der Arbeir der Klärung und der theoretisch-politischen Diskussion -im Gegensatz zur IKP , die jahrelang einen fieberhaften Aktivismus betrieb, welcher 1952 zu einer Spaltung zwischen der Tendenz um Damen, der aktivistischer war, und um Bordiga führte (mit dem sich Vercesi zusammenschloß). Diese Tendenz um Bordiga zog sich vollständig ins Sektierertum und in eine angebliche Invarianz zurück (tatsächlich war es eine erstarrte, versteinerte Form der Positionen der Kommunistischen Linken von 1926). Dies sollte nunmehr das Merkmal der Internationalen Kommunistischen Partei (IKP I= International) und ihrer Zeitschrift Programma Comunista sein. Die IKP (IInternationalistisch) um Damen (welche noch in der Mehrheit war, setzte die Publikation Battaglia Comunista und Prometeo fort), der man zu diesem Zeitpunkt diesen Vorwurf des Sektierertums nicht machen konnte, stürzte sich in eine ganze Reihe von Initiativen von Konferenzen und gemeinsamen Aktivitäten mit nicht-proletarischen Strömungen wie den Trotzkisten und Anarchisten.
Die GCF wiederum hat diesen Geist der Offenheit aufrechterhalten, der ein Kennzeichen der Italienischen Linken vor und während des Krieges gewesen war. Aber im Gegensatz zur IKP, die sich nach allen Seiten hin öffnete und nicht lange nach dem Klassencharakter der Organisationen fragte, mit denen sie in Kontakt trat, stützten sich die von der GCF hergestellten Kontakte genau wie seinerzeit bei BILAN auf genaue politische Kriterien, die eine präzise Abgrenzung von nicht-proletarischen Organisationen ermöglichten.
So beteiligte sich die GCF im Mai 1947 an einer internationalen Konferenz, die dank der Initiative des Communistenbond Hollands (rätekommunistischer Tendenz) einberufen worden war, an der auch insbesondere die Gruppe Le Proletaire (sie war aus den RKD hervorgegangen) mitwirkte sowie die belgischen Fraktion und die autonome Föderation Turins, die sich von der IKP gespalten hatte aufgrund der Divergenzen hinsichtlich der Wahlbeteiligung. Bei der Vorbereitung dieser Konferenz, zu der der Bond auch die Anarchistische Föderation eingeladen hatte, bestand die GCF auf der Notwendigkeit von präziseren Auswahlkriterien, die Gruppen fernhalten wie die offiziellen Anarchisten, welche an der Regierung der spanischen Republik und an der Resistance (2) mitgewirkt hatten.
Aber der Hauptbeitrag der GCF zum Kampf des Proletariats in dieser von der Konterrevolution beherrschten Zeit liegt sehr wohl bei der programmatischen und theoretischen Herausarbeitung und Vertiefung. Die beträchtlichen Vertiefungsbestrebungen seitens der GCF in dieser Hinsicht haben insbesondere zu einer Präzisierung der Funktion der revolutionären Partei geführt, wobei man über die klassischen "leninistischen" Auffassungen hinausging, und die endgültige und unwiderrufliche Einverleibung der Gewerkschaften und der Gewerkschaftsarbeit in den kapitalistischen Staat feststellte. In dieser Hinsicht hatte die deutsch-holländische Linke von Anfang der 20er Jahre an eine ernsthafte Kritik an den falschen Positionen Lenins und der Kommunistischen Internationale erarbeitet. Die Auseinandersetzung der Italienischen Fraktion vor dem Krieg und der GCF nach dem Krieg mit den Positionen dieser Strömung versetzten die GCF in die Lage, einige der Kritiken an der Kommunistischen Internationale weiter zu vertiefen. Aber die GCF erwies sich als fähig, nicht den gleichen Exzessen zu verfallen, den die deutschholländische Linke bei der Parteifrage begangen hatte (der nachher jede Funktion abgesprochen wurde). Auch ging man beim Verständnis der Gewerkschaftsfrage viel weiter (denn neben der Verwerfung der klassischen Gewerkschaftsarbeit, trat die deutschholländische Linke für eine Art Basisgewerkschaftsarbeit ein, wobei sie sich auf die "Unionen" aus der Zeit 1919-20 in Deutschland stützte). Bei der Gewerkschaftsfrage konnte man den Unterschied in der Methode zwischen der deutschen und italienischen Linken sehen. Die deutsche Linke verstand während der 20er Jahre den großen Rahmen einer Frage (z.B. des kapitalistischen Wesens der UdSSR oder des Wesens der Gewerkschaften), aber indem man eine systematische, vertiefte Auseinandersetzung bei der Erarbeitung neuer Positionen unterließ, wurden bestimmte Grundlagen des Marxismus infrage gestellt, und eine spätere Vertiefung dieser Fragen unmöglich gemacht. Die Italienische Linke ihrerseits war viel vorsichtiger. In Anbetracht der Ausrutscher Vercesis im Jahre 1938 hatte sie die ständige Sorge, jeden von ihr vollzogenen Schritt der Vertiefung einere systematischen Kritik zu unterziehen, um zu überprüfen, ob sie sich nicht vom Rahmen des Marxismus entfernten. Dadurch wurde sie in die Lage versetzt, viel weiter zu gehen bei der Vertiefung und bei der theoretischen Weiterentwicklung der Positionen insbesondere zu einer so grundsätzlichen Frage wie der des Staats. Diese Vorgehensweise hatte Marc innerhalb der Italienischen Fraktion kennengelernt und übernommen; und auf diese stützte er sich wiederum bei der Arbeit in der GCF. Die GCF vertiefte auch weiterhin die Frage des Staates in der Übergangsperiode vom Kapitalismus zum Kommunismus. Auch wurde die Frage des Staatskapitalismus nicht mehr nur im engen Rahmen der Analyse der UdSSR gesehen, sondern die allgemeinen, weltweit gültigen Merkmale dieser Haupterscheinungsweise der Dekadenz der kapitalistischen Produktionsweise wurden herausgearbeitet. Diese Analyse findet man insbesondere in dem Artikel "Die Entwicklung des Kapitalismus und die neue Perspektive" (veröffentlicht in Internationalisme Nr. 46, wieder veröffentlicht in International Review Nr. 21, engl. Ausgabe). Dieser Text war von Marc im Mai 1952 verfaßt worden, und er stellt in gewisser Hinsicht das politische Testament der GCF dar. Im Juni 1952 verließ Marc Frankreich, um nach Venezuela umzuziehen. Diese Abreise entsprach einem kollektiven Beschluß der GCF, die in Anbetracht des Koreakrieges davon ausging, daß ein dritter Weltkrieg zwischen dem amerikanischen und russischen Block unvermeidbar wäre und kurz bevorstünde (wie in dem o.g. Text entwickelt wurde). Solch ein Krieg würde hauptsächlich Europa zerstören, dadurch würden die wenigen kommunistischen Gruppen vollständig vernichtet, auch die GCF, deren Mitglieder ja gerade erst den 2. Weltkrieg überlebt hatten. Wenn einige Militanten außerhalb Europas Schutz suchen wollten, dann geschah dies nicht so sehr aus Sorge um die individuelle Sicherheit (während des ganzen 2. Weltkriegs hatten Marc und seine Genossen bewiesen, daß sie bereit waren, große Risiken einzugehen, um die revolutionären Positionen unter den schlimmst möglichen Bedingungen zu verteidigen), sondern weil man so das Überleben der Organisation selber ermöglichen wollte. Aber die Abreise einer der erfahrensten und politisch gebildesten Genossen zu einem anderen Kontinent sollte für die GCF einen nicht zu verkraftenden Schlag darstellen. Denn die Mitglieder, die in Frankreich blieben, schafften es trotz der fortgesetzten Korrespondenz mit Marc nicht, die Organisation in der Zeit der tiefgreifenden Konterrevolution am Leben zu halten. Aus Gründen, auf die wir hier nicht eingehen können, fand dann der 3. Weltkrieg nicht statt. Es liegt auf der Hand, daß dieser Fehler bei der Analyse der Lage der GCF das Leben gekostet hat (und dies ist wahrscheinlich der Fehler, unter denen, die von dem Genossen während seines militanten Lebens begangen wurden, der die schwersten Konsequenzen gehabt hat). Aber die GCF hinterließ ein großes politisches und theoretisches Vermächtnis, auf das sich die Gruppen stützen konnten, die später die IKS gründeten.
DIE INTERNATIONALE KOMMUNISTISCHE STRÖMUNG
Mehr als 10 Jahre lang - d.h. in einer Zeit, in der die Konterrevolution die Arbeiterklasse weiter erdrückte - lebte Marc in einer besonders schlimmen Isolierung. Er verfolgte die Aktivitäten der revolutionären Organisationen, die sich in Europa am Leben hielten und blieb in Kontakt mit ihnen und einigen ihrer Mitglieder. Auch setzte er die Arbeit der Reflexion, der Vertiefung über einige Fragen fort, die die GCF nicht ausreichend hatte klären können. Aber zum ersten Mal in seinem Leben konnte er an keiner organisierten Aktivität teilnehmen, die ja gerade unentbehrlich ist für solch eine Arbeit der Vertiefung. Es war eine sehr schwere Herausforderung, wie er selber formulierte: "In dieser Zeit der Reaktionen nach dem 2. Weltkrieg gab es einen langen Marsch durch die Wüste, insbesondere nach der Auflösung der Gruppe "INTERNATIONALISME" nach 10 Jahren ihres Bestehens. Dem folgte eine 15jährige Isolierung. Diese dauerte an bis zum Zeitpunkt, als er es schaffte, um ihn herum eine kleine Gruppe von Gymnasiasten zu sammeln, die den Kern einer neuen Organisation darstellen sollten: "Und 1964 wurde in Venezuela eine Gruppe gegründet, der ganz junge Leute angehörten... und diese Gruppe besteht heute noch. 40 Jahre lang in der Konterrevolution, in der dunkelsten Reaktion zu leben, und dann plötzlich Hoffnung zu verspüren, zu merken, daß die Krise und die Jugend wieder da sind... Und dann zu spüren, wie diese Gruppe Schritt für Schritt anwuchs, wie sie sich durch die Ereignisse von 1968 entfaltete, in Frankreich und dann in 10 Ländern... All das ist wirklich eine Freude für einen Militanten. Diese Jahre, die letzten 25 Jahre sind sicherlich die glücklichsten Jahre gewesen. Während dieser Jahre konnte ich die Freude über diese Entwicklung verspüren, und über die Überzeugung, daß es wieder losging, daß wir die Niederlage überwunden hatten, und daß wir aus der Niederlage herausgekommen ware, und daß das Proletariat wieder als solches in Erscheinung tritt, daß die revolutionären Kräfte wieder Aufschwung nehmen. Die Freude zu haben, selber daran mitzuwirken, all das zu geben, was man kann, das Beste für diesen Wiederaufbau geben - all das bereitet eine große Zufriedenheit. Und diese Freude schulde ich der IKS..." Im Unterschied zu anderen Organisationen, in denen Marc aktiv gewesen war, wollen wir hier nicht die Geschichte der IKS neu aufrollen, denn anläßlich des 10. Jahrestags des Bestehens der IKS haben wir dies schon in unserer Presse getan (siehe dazu Internationale Revue, Sondernummer zur Organisationsfrage). Wir wollen nur einige Elemente erwähnen, die den gewaltigen Beitrag unseres Genossen zum Prozeß der Bildung unserer Organisation verdeutlichen. So war es hauptsächlich das Verdienst Marcs, daß noch vor der Gründung der IKS die kleine Gruppe in Venezuela, die Internacionalismo veröffentlichte (sie hatte den gleichen Namen wie die Revue der GCF), eine große Klarheit entwickeln konte, insbesondere zur Frage der nationalen Befreiung. Denn diese Frage spielte in Venezuela eine große Rolle. Auch bestanden hierzu im politischen Milieu große Verwirrungen. Auch entsprach die Politik Internacionalismos der Kontaktaufnahme mit anderen Gruppen aus dem Milieu auf dem amerikanischen Kontinent und in Europa der Politik der GCF und der Fraktion. Und während man im Januar 1968 nur vom Wohlstand und der Blütezeit des Kapitalismus und dessen Fähigkeit, die Krisen zu überwinden, sprach (und einige Revolutionäre taten dies auch schon), und als die Theorien Marcuses über die "Integration der Arbeiterklasse in den Kapitalismus" weit verbreitet waren, und als die Revolutionäre, die Marc während einer Reise durch Europa im Sommer 1967 getroffen hatte, meist total skeptisch waren hinsichtlich des Potentials einer Arbeiterklasse, die angeblich noch in der tiefsten Konterrevolution steckte, da fürchtete sich unser Genosse nicht, in Internacionalismo Nr. 8 zu schreiben: ""Wir sind keine Propheten, und wir behaupten auch nicht raten zu können, wann und wie sich die zukünftigen Ereignisse abspielen werden. Aber wir sind uns in der Tat sicher und uns dessen bewußt, daß der Kapitalismus den Prozeß, in den er gegenwärtig geraten ist, nicht aufhalten kann... dieser führt nämlich direkt zur Krise. Und wir sind ebenfalls sicher, daß die entgegengesetzte Entwicklung der Entfaltung der Kampfbereitschaft der Klasse, die man jetzt überall sieht, die Arbeiterklasse in einen blutigen und direkten Kampf um die Zerstörung des bürgerlichen Staats treiben wird". Einige Monate später brachte der Generalstreik des Mai 1968 in Frankreich eine unwiderlegbare Bestätigung dieser Vorhersagen. Natürlich war noch nicht die Stunde eines "direkten Kampfes um die Zerstörung des bürgerlichen Staates" gekommen, sondern die eines historischen Wiedererstarkens des Weltproletariats, das angefacht worden war durch die ersten Erscheinungen der offenen Krise des Kapitalismus nach der tiefsten Konterrevolution der Geschichte. Diese Vorhersagen sind kein Ergebnis einer Spekulation, sonder einfach ein bemerkenswerter Beweis dafür, daß unser Genosse den Marxismus beherrschte, und daß er auch in den schlimmsten Momenten der Konterrevolution ein Vertrauen in die revolutionären Fähigkeiten der Arbeiterklasse bewahrt hat. Sofort kam Marc nach Frankreich (er legte gar einen Teil der Anreise per Anhalter zurück, da der öffentliche Verkehr in Frankreich durch Streiks gelähmt war). Dort nahm er Kontakt zu alten Mitgliedern der GCF auf und trat in Diskussionen mit einer Reihe von Gruppen und Elementen des politischen Milieus ein (3). Diese Aktivitäten wie die eines jungen Mitglieds von Internacionalismo, der schon seit 1966 nach Frankreich gekommen war, waren entscheidend für das Entstehen und die Entfaltung der Gruppe Revolution Internationale, die die Rolle des Pols der Umgruppierung spielen sollte, auf dem aufbauend später die IKS entstand. Wir können hier leider nicht auf all die politischen und theoretischen Beiträge unseres Genossen innerhalb unserer Organisation nach ihrer Gründung eingehen. Es reicht aus zu sagen, daß bei allen wesentlichen Fragen, vor denen die IKS stand, wie auch die Arbeiterklasse insgesamt, bei all den Schritten vorwärts, die wir haben machen können, der Beitrag unseres Genossen entscheidend war. Marc war in der Regel derjenige unter uns, der neue Fragen, neue Punkte als erster aufwarf, vor denen wir standen. Diese ständige Wach- und Achtsamkeit, diese Fähigkeit, schnell und in der Tiefe die neuen Fragen zu untersuchen, auf die man eine Antwort entwickeln mußte, aber auch gegenüber älteren Fragen, bei denen noch im politischen Milieu Verwirrungen vorhanden waren, all dies ist in unserer Internationalen Revue in mehr als 60 Ausgaben schriftlich zum Ausdruck gekommen. Die Artikel zu diesen Fragen waren nicht immer direkt von Marc verfaßt worden, denn da er nie an einer Uni studiert hatte, und vor allem, weil er immer in Sprachen schreiben mußte, die er erst im Erwachsenenalter gelernt hatte, wie das mit dem Französischen der Fall war, war Schreiben für ihn jeweils eine schwere Aufgabe. Aber er war immer derjenige, der zu den meisten Artikeln die Inspiration, die Anregung geliefert hatte, damit unsere Organisation ihre Verantwortung der ständigen Aktualisierung der kommunistischen Positionen erfüllt. Um nur eines der letzten Beispiele zu nennen, als unsere Organisation gegenüber einer neuen historischen Situation schnell reagieren mußte, nämlich dem Zusammenbruch des Ostblocks und des Stalinismus, war es die große Wachsamkeit unseres Genossen und gleichzeitig natürlich die Tiefgründigkeit seiner Gedanken, die eine entscheidende Rolle bei der Fähigkeit der IKS gespielt haben, eine ausreichende Antwort für die Analyse dieser Ereignisse zu liefern. Und seitdem haben die Ereignisse unsere Analyse nur bestätigt.
Aber der Beitrag Marcs zum Leben der IKS begrenzte sich nicht auf die Ausarbeitung und die Vertiefung der politischen Positionen und theoretischen Analysen. Bis in die letzten Tage seines Lebens setzte er sich nicht nur mit der Entwicklung der Weltlage auseinander, dachte darüber nach und teilte dies trotz der übermenschlichen Anstrengungen, die dies in Anbetracht seines Gesundheitszustandes bedeuteten, den Genossen mit, die ihn am Krankenbett besuchten. Auch beschäftigte er sich weiter mit den Details der Aktivitäten und der Funktionsweise der IKS. Für ihn gab es nie "untergeordnete" Fragen, mit denen sich theoretisch weniger gebildete Genossen hätten auseinandersetzen sollen. Er setzte sich immer dafür ein, daß alle Genossen der Organisation die Fähigkeit zu einer größtmöglichen politischen Klarheit entwickeln, und daß theoretische Fragen nicht den "Spezialisten" vorbehalten bleiben, er hat nie gezögert, mit Hand anzulegen an alle praktischen Alltagsaktivitäten unserer Organisation. So hat Marc den jungen Mitgliedern unserer Organisation als Beispiel für einen Genossen gedient, der seine ganzen Fähigkeiten in das Leben dieses unabdingbaren Organs der Arbeiterklasse, ihre revolutionäre Organisation steckt. Tatsächlich vermochte unser Genosse ständig den neuen Generationen von Genossen die Erfahrung zu vermitteln, die er im Laufe seines außergewöhnlichen und langen militanten Lebens gesammelt hatte. Und solch eine Erfahrung konnten diese Generationen von neuen Militanten nicht nur anhand von politischen Texten erwerben, sondern im Alltagsleben der Organisation, und mit Hilfe der Anwesenheit Marcs selber konnten sie dies tun. Aus dieser Sicht hat Marc einen ganz außergewöhnlichen Platz im Leben des Proletariats eingenommen. Während die Konterrevolution die politischen Organisationen, die die Arbeiterklasse in der Vergangenheit hervorgebracht hatte, entweder auslöschte oder sie zerfallen ließ, stellte Marc eine Brücke, ein unersetzbares Verbindungsglied zwischen den Organisationen dar, die an der revolutionären Welle nach dem 1. Weltkrieg teilgenommen hatten und den Organisationen, die sich an der nächsten beteiligen werden. In seiner Geschichte der russischen Revolution warf Trotzki die Frage der besonderen und außergewöhnlichen Stellung Lenins auf. Sich auf die klassischen Thesen des Marxismus über die Rolle des Individuums in der Geschichte stützend, schloß er daraus, daß die Revolution ohne Lenin, der es geschafft hatte, die bolschewistische Partei wieder aufzurichten und sie politisch "zu festigen, zu bewaffnen", nicht hätte stattfinden können, oder daß sie zum Scheitern verurteilt gewesen wäre. Es liegt auf der Hand: ohne Marc gäbe es die IKS nicht, zumindest nicht in ihrer gegenwärtigen Form als bedeutendste Organisation des internationalen revolutionären Milieus (ohne von der Klarheit der Positionen zu sprechen, von denen natürlich andere revolutionäre Gruppen eine andere Meinung haben können). Insbesondere seine Präsenz und sein Wirken haben es ermöglicht, daß die gewaltige und Grundsatzarbeit, den die Fraktionen der Linken verrichtet haben, insbesondere die Italienische Linke, die alle aus der Komintern ausgeschlossen worden waren, nicht in Vergessenheit geraten, sondern fruchtbringend verwendet werden. Während unser Genosse in der Arbeiterklasse nie einen Bekanntheitsgrad vergleichbar mit dem von Lenin, R. Luxemburg, Trotzki oder gar Bordiga oder Pannekoek gehabt hat - denn dies konnte nicht anders sein, weil er den größten Teil seines Lebens unter der Konterrevolution arbeitete- soll man sich gerade deshalb nicht fürchten zu sagen, daß sein Beitrag zum Kampf des Proletariats auf der gleichen Ebene liegt wie der der oben genannten Revolutionäre.
Unser Genosse hat solche Vergleiche immer verworfen. Mit der größtmöglichen Einfachheit und Bescheidenheit hat er immer seine militanten Aufgaben erfüllt; auch hat er nie seinen "Ehrenplatz" innerhalb der Organisation verlangt. Sein größter Stolz lag nicht in seinem außergewöhnlichen Beitrag, den er geliefert hat, sondern in der Tatsache, daß er es geschafft hat, bis zum Ende seines Lebens dem Kampf des Proletariats treu zu bleiben. Und das war auch eine wertvolle Lehre für all die neuen Generationen von Genossen, die nicht die Gelegenheit gehabt haben, die große Aufopferung, das Engagement für die revolutionäre Sache kennenzulernen, die die früheren Generationen von Genossen auszeichneten. Vor allem auf dieser Ebene wollen wir in diesem Kampf auf der Höhe sein, den wir nun ohne die wachsame und hellsichtige, brüderliche und leidenschaftliche Präsenz unseres Genossen entschlossen sind fortzusetzen.
IKS
Politische Strömungen und Verweise:
- Kommunistische Linke [70]
Schweden - Die Wahlen 2006: Was können sie uns bieten?
- 2804 reads
Nachstehend veröffentlichen wir einen Artikel von unserer schwedischen Sektion zu den Wahlen in Schweden, damit man trotz möglicher Sprachbarrieren mehr über die Entwicklungen in anderen Ländern erfahren kann, zugleich aber auch sieht, dass das Proletariat weltweit vor den gleichen Fragen und Aufgaben steht. IKS in Deutschland
Die Wahlen 2006: Was können sie uns anbieten?
Während dieser Artikel geschrieben wird, es ist noch eine Woche bis zu den Wahlen. Der Skandal um die „Internet-Spionage“ der Volkspartei hat sich gelegt. Neue Meinungsumfragen zeigen einen knappen Vorsprung für die „bürgerliche Allianz“ gegen die sozialdemokratische Regierung. Durch die Wahlpropaganda will die bürgerliche Klasse uns Glauben machen, dass es einen Unterschied zwischen den verschiedenen „Wahlblöcken“ gäbe und diese Wahl eine Wahl zwischen verschiedenen Wegen für Schweden bedeuten würde. Man will die Wahlen als eine Wahl zwischen zwei Alternativen hinstellen. Das ist der Hauptinhalt der sozialdemokratischen Propaganda. Die „Gemäßigten“ ihrerseits wollen sich als neue „Arbeiterpartei“ profilieren, die „Klartext“ über Arbeitslosigkeit „redet“. Die Sozialisten kontern damit, dass sie in die Opposition gehen würden. Sie drohen mit ziemlich hohl klingenden Phrasen, „dass eine Regierung „Reinfeld“ [so heißt die Hauptwahlfigur der bürgerlichen Allianz] nur Verschlechterungen für die Arbeiterklasse bedeuten würde“. Diese „Arbeiterregierung“, die seit 1994 an den Fleischtöpfen der Macht gesessen hat, die die drastischsten Sparmaßnahmen in der neueren Zeit durchgeführt hat, versucht fortwährend, in ihrer Wahlrhetorik mit dem „Gespenst einer Rechtsregierung“ zu drohen. Der erste Vertreter des nationalen Kapitals, Göran Persson, und seine Partei, die staatstragende Sozialdemokratie, ist immer noch die für die Interessen des nationalen Kapitals am besten geeignete Machtklicke, um Angriffe gegen das Volk und die Arbeiterklasse durchzuführen. Das hat die Arbeiterklasse während der „Rosskur“ in 90er Jahren erfahren können, als der damalige Finanzminister und spätere Staatsminister Göran Persson, den größten Abbau des „Wohlfahrtstaates“ durchführte, den ein entwickeltes europäisches Land je geschehen hat.
Trotzdem ist die selbstherrliche und arrogante Haltung, die er und seine Partei ausstrahlen, ein Problem für die bürgerliche Klasse, wenn man den demokratischen Zirkus glaubwürdig machen will. Die immer mehr verbreitete Korruption und die Identifikation der Sozialdemokratie mit dem Staat, sind Probleme, die man in den Medien hervorhebt: Die „Machtkonzentration“ in Perssons Staatsratausschuss – die sich im Zusammenhang mit der Tsunamikatastrophe zeigte - ist das offenkundigste Beispiel der Medienkritik gewesen. Deshalb haben die Medien und die Kommentatoren während des ganzen Wahlzirkusses die Notwendigkeit, die Regierung zu wechseln, betont. „Die Macht macht korrupt“ und andere „Wahrheiten“ hat man in den Medien betont; verschiedene Kommentatoren und sozialdemokratische Professoren haben sich in den Medien dafür ausgesprochen, dass ein Machtwechsel um der „Demokratie“ willen besser wäre.
Die demokratische Fassade
Zur Zeit der Wahlkämpfe regte sich die Bourgeoisie mächtig darüber auf, dass die Politiker so sehr in der Gesellschaft verachtet würden. Auch wenn es in Schweden keine „Missbrauchparteien“ in größerem Ausmaß gibt, hat die Bourgeoisie Schwierigkeiten, die demokratische Fassade aufrecht zu erhalten. Den spontanen Reaktionen bei den meisten Menschen, denen es gleichgültig ist, wer die Regierung stellt, muss bewiesen werden, dass es tatsächlich verschiedene Alternativen innerhalb der Demokratie gäbe. Um die Demokratie wieder glaubwürdig zu machen, wäre ein Machtwechsel gut. Skandale verhelfen dazu, dass die Leute sich wieder mehr für Politik interessieren.
Eine glaubwürdige Alternative für die in ihrer Macht selbstherrliche Sozialdemokratie zu schaffen, ist ein Hauptthema im aktuellen Wahlkampf gewesen. Nach den letzten Wahlen von 2002, als die Sozialdemokraten ihr schlechtestes Wahlergebnis einfuhren, und trotzdem die Regierung bilden konnten, gab es bestimmt viele Wähler, die sich fragten, was ihre Stimme für eine Bedeutung hat. Tatsache ist, dass sie gar keine Bedeutung hat, um wirklich etwas zu verändern.
Trotz des Bedürfnisses der Demokratie, eine Regierung zu wechseln, ist die „bürgerliche Allianz“ immer noch die unsichere Karte für die schwedische Bourgeoisie. Die schwedische Rechte ist historisch gesehen schwach und hat nur begrenzte Erfahrungen in der Regierung. Trotz der Änderungen ihrer Politik (die Annäherung der moderaten Sammlungspartei gegenüber der „Mitte“, ihr neuer „sozialkonservativer“ Ton, wie das Aufgeben der früheren EU-Politik und der Kernkraftgegnerschaft des Zentrums), die vorgenommen wurden, um eine glaubwürdige Regierungsalternative zu schaffen, gibt es immer noch Spannungen innerhalb des „bürgerlichen“ Blocks. Es gibt sogar Meinungsverschiedenheiten innerhalb der „Allianz“, was die Außenpolitik betrifft. Dies kann bei einer eventuellen Regierungsbildung noch von Bedeutung sein.
Was passiert nach den Wahlen?
Das Präsentieren eines neuen „sozialen Gewissens“ innerhalb der gemäßigten Sammlungspartei, besonders durch Fredrik Reinfeld und Kristina Axén Olin, deren Konterfei uns überall auf den Wahlplakaten entgegenstarrt, bedeutet, dass man sich von der „Steuersenkungspolitik“ abgewendet hat, die 2002 in eine katastrophale Wahlniederlage geführt hat. Dafür kritisiert man jetzt „die Rechte“ für deren „Leichtsinn“ (Zeitung „Dagens Arbeite“ im Sept. 06), zu versprechen, dem sozialdemokratischen Entwurf zu folgen.
Wir können sicher sein, dass weitere Verschlechterungen für die Arbeiterklasse kommen werden, egal welche Regierung am 18. September an die Macht kommt! Die von der Sozialdemokratie eingeleiteten Verschlechterungen der Kranken- und Arbeitslosenversicherung und die mehr und mehr unerträglicher werdenden Arbeitsbedingungen für die Arbeiter im öffentlichen Dienst werden weitergeführt. Die Arbeitslosigkeit, über die Reinfeld „Klartext redet“ und sich „profiliert“, wird nicht geringer werden, egal ob diese oder jene Fraktion des politischen Apparates der Bourgeoisie an die Macht kommt. Die ökonomische Krise des Kapitalismus zwingt die Bourgeoisie fortwährend die Arbeiterklasse anzugreifen, auf die eine oder andere Weise; mit Arbeitslosigkeit und Lohnsenkungen, Steuererhöhungen und Verschlechterungen - in der Privatwirtschaft wie im öffentlichen Dienst.
Was soll man stattdessen machen?
Wenn wir wach werden nach der Wahlnacht, ist der Zirkus ein weiteres Mal beendet. Vier Jahre bis zum nächsten Mal, vier Jahre neue Verschlechterungen und Kürzungen. Gewiss, es ist leicht, spöttisch zu werden gegenüber dieser Heuchelei. Die Stalinisten sagen, dass „es das ganze Jahr Ungerechtigkeit gibt, dass wir aber am 17. September alle gleich sind.“ Die Anarchisten sagen, dass „die Wahl eine Illusion ist“, aber sie sagen gleichzeitig im Internet, dass man die Wahllokale kaputt schlagen soll.
Die Wahlen sind eine Scheinveranstaltung, sind ein Mittel der Bourgeoisie, die demokratische Fassade aufrecht zu erhalten. Ist man desillusioniert über die Alternative, die die Bourgeoisie anbietet, soll man mindestens das „kleinere Übel“ wählen und seine „demokratische Pflicht“ tun - besonders in einem Land wie Schweden, wo die Wahlbeteiligung immer hoch gewesen ist, mit Zahlen, die vergleichbar sind mit denen in den stalinistischen Diktaturen des ehemaligen Ostblocks, wo man die Staatsangehörigen zu den Wahlurnen gezwungen hat. Ansonsten wurde man beschuldigt, ein „Antidemokrat“ oder ein Faulenzer zu sein, oder „so würde man die sich herausbildende rechtsextreme Bewegung“ begünstigen. Die Vorwürfe der Bourgeoisie im Brustton der Überzeugung gegen die, die nicht an den Wahlen teilnehmen wollen, klingen ab, sobald der Wahlzirkus vorüber ist. Dann gibt es keinen mehr, der fragt, was wir meinen und wollen!
Aber „apathisch“ oder „unpolitisch“ bleiben, ist genauso eine Falle für die Arbeiterklasse. Die Erklärungen der Bourgeoisie zum Vormarsch verschiedener „extremistischer Parteien“, dass „die Arbeiterwähler der gewöhnlichen, ‚demokratischen’ Parteien überdrüssig sind“, verwendet man gegen die Arbeiterklasse, teils so, dass man sie zu Idioten erklärt und teils so, dass man die Tatsache verbirgt, dass die Bourgeoisie zunehmend die Kontrolle über ihren „demokratischen Apparat“ und besonders über das ganze kapitalistische System zu verlieren beginnt.
Die Politisierung des Klassenkampfes der Arbeiterklasse, die sich in den letzten Jahren vermehrt entwickelt, ist die einzige wirklich politische Triebkraft, die vermag, Widerstand gegen die zunehmenden frontalen Angriffe des verfaulenden Kapitalismus zu leisten. Man konnte einen Schimmer von Zukunft in den Vollversammlungen sehen, die spontan in den Universitäten während des Kampfes gegen das Gesetz (CPE) gegen junge Arbeitnehmer in Frankreich im Frühling dieses Jahr entstanden. Wenn wir dies einen Augenblick lang mal damit vergleichen, was die so genannte „Osynliga Partei“ in diesem Frühjahr gegen die Zentrumspartei unternahm (die einen besonderen Gesetzesvorschlag für junge Arbeitnehmer vorbrachte), nämlich ein Parteibüro zu verwüsten, was ist da nützlicher und zielgerichteter: Ein Parteibüro verwüsten? Oder wie die Studenten und Schüler in Frankreich den Kampf auf alle Arbeiter, Arbeitslosen und Rentner auszudehnen versuchen? Mit der Methode der CPE-Bewegung gelang es in Frankreich wirklich, die Bourgeoisie zu erschüttern und sie dazu bewegen, den Gesetzesvorschlag zurückzunehmen. Sinnlose Gewalt der Hooligans bringt nichts, wohl aber der kraftvoll organisierte und zentralisierte Kampf, mit dem Ziel, so viele wie möglich mit in den Kampf zu ziehen! Denn dadurch, dass man dazu auffordert, Wahllokale und Wahlplakate zu zerstören, trägt man nur zur Verstärkung der „demokratischen Illusion“ bei. Man bildet sich ein, dass man kämpft, und man ist nur im Wahlzirkus befangen, als ob das irgendetwas bedeuten würde!
Die Arbeiterklasse gewinnt nichts dabei, wenn sie am demokratischen Wahlzirkus teilnimmt. Sich mit „Wahlboykott“ oder blinder Gewalt zu beschäftigen, trägt nur dazu bei, die Wahlen und den parlamentarischen Zirkus zu legitimieren. Genauso wenig, wie der wirkliche Beschluss für Verschlechterungen und Kürzungen dadurch bestimmt würde, wer zufällig in der Regierung ist, genauso wenig kann die Arbeiterklasse ihre Situation beeinflussen, wenn sie sich an den Wahlen beteiligt oder sich lediglich der Wahl enthält. Je mehr die kapitalistische Krise sich entwickelt, desto mehr ist man gezwungen, die Arbeiterklasse immer brutaler, frontaler, und totaler anzugreifen.
Die Arbeiterklasse hat durch ihren Kampf in den letzten Jahren, durch den Prozess der politischen Reifung ihre eigene Stärke und ihre Möglichkeit eine politische Kraft in der Gesellschaft zu sein, zusehends entdeckt. Dafür hat die Arbeiterklasse den Beweis in ihren Kämpfen geliefert, in denen sie großes Klassenbewusstsein
a) über die Generationsgrenzen hin weg gezeigt hat, wie der Kampf gegen Verschlechterungen im Rentensystemen in Frankreich und Österreich 2003, der Kampf der Arbeiter der öffentlichen Verkehrbetriebe in New York im Dezember 2005, der Kampf gegen die CPE und
b) über die nationalen Grenzen hin weg gezeigt hat, wie etwa der Kampf der Arbeiter auf dem Flughafen London-Heathrow 2005.
Die Politisierung der Kämpfe wird immer gegenwärtiger, weil der Kampf, den man heute führt, einen viel größeren Einsatz der Arbeiterklasse fordert als in früheren Zeiten (das Risiko von Arbeitslosigkeit, astronomische Geldstrafen bei illegalen Kampfaktionen). Die Arbeiterklasse hat, genauso wie früher, keine andere Wahl, als ihren Klassenkampf einzusetzen, um die selbstständige, politische Kraft zu werden, die schließlich in der Lage ist, das faulende kapitalistische System in den Mülleimer der Geschichte zu werfen.
11. 9. 2006 Raimo aus: Internationell Revolution Nr. 109, Zeitung der Sektion der IKS in Schweden
Geographisch:
- Schweden [34]
Erbe der kommunistischen Linke:
Ursprung und Mythos der IWW
- 2984 reads
Der Mythos der IWW stellt diese als eine Gruppe klarer, entschlossener Revolutionäre dar, die das kapitalistische System kompromißlos bekämpfen. Wie allen Mythen liegt auch diesem ein Stück Wirklichkeit zugrunde. Egal welche Kritiken an der IWW angebracht sind, die Kampfbereitschaft und die Entschlossenheit, die Aufopferung der Wobblies müssen anerkannt werden. Bei ihrer Gründung waren die IWW eine wirkliche proletarische Organisation, der Mitglieder angehörten, die alle den Umsturz des kapitalistischen Systems anstrebten und die Macht in die Hände der Arbeiterklasse legen wollten. Die IWW war hauptsächlich Ausdruck einer revolutionärsyndikalistischen Reaktion - mit besonderen amerikanischen Kennzeichen - gegen die Sackgasse des parlamentarischen Reformismus, so wie er von der II. Internationale praktiziert wurde. Der revolutionäre Syndikalismus entstand Ende des 19. Jahrhunderts, als der Kapitalismus in die Endphase seiner Ausdehnung trat, d.h. wo es einerseits den Arbeitern noch möglich gewesen war, dem Kapitalismus dauerhafte Reformen mittels der Gewerkschaften und des Parlaments abzugewinnen, und wo er andererseits noch die Produktivkräfte weiter entfalten konnte, ohne daß sie mit den Produktionsverhältnissen zusammenstießen. Aber je mehr das System zu einer Fessel für die Produktivkräfte wurde, je geringer der Spielraum der Kapitalisten wurde, desto stärker entfalteten sich auch der Opportunismus der Karrieristen in den Gewerkschaften und in den Bürokratien der Sozialdemokratischen Parteien.
Der Mythos der IWW stellt diese als eine Gruppe klarer, entschlossener Revolutionäre dar, die das kapitalistische System kompromißlos bekämpfen. Wie allen Mythen liegt auch diesem ein Stück Wirklichkeit zugrunde. Egal welche Kritiken an der IWW angebracht sind, die Kampfbereitschaft und die Entschlossenheit, die Aufopferung der Wobblies müssen anerkannt werden. Bei ihrer Gründung waren die IWW eine wirkliche proletarische Organisation, der Mitglieder angehörten, die alle den Umsturz des kapitalistischen Systems anstrebten und die Macht in die Hände der Arbeiterklasse legen wollten. Die IWW war hauptsächlich Ausdruck einer revolutionärsyndikalistischen Reaktion - mit besonderen amerikanischen Kennzeichen - gegen die Sackgasse des parlamentarischen Reformismus, so wie er von der II. Internationale praktiziert wurde. Der revolutionäre Syndikalismus entstand Ende des 19. Jahrhunderts, als der Kapitalismus in die Endphase seiner Ausdehnung trat, d.h. wo es einerseits den Arbeitern noch möglich gewesen war, dem Kapitalismus dauerhafte Reformen mittels der Gewerkschaften und des Parlaments abzugewinnen, und wo er andererseits noch die Produktivkräfte weiter entfalten konnte, ohne daß sie mit den Produktionsverhältnissen zusammenstießen. Aber je mehr das System zu einer Fessel für die Produktivkräfte wurde, je geringer der Spielraum der Kapitalisten wurde, desto stärker entfalteten sich auch der Opportunismus der Karrieristen in den Gewerkschaften und in den Bürokratien der Sozialdemokratischen Parteien.
Als eine Reaktion gegen die Theorie des friedlichen Übergangs zum Sozialismus mit Hilfe der Wahlurnen hoben die IWW die Notwendigkeit des offenen Kampfes auf der Produktionsebene hervor. Die IWW leisteten einen wertvollen Beitrag zur Arbeiterbewegung im Bereich des ökonomischen Kampfes, indem sie beispielsweise die Massenstreiktaktiken propagierten, aktive Klassensolidarität betonten etc.
Ungeachtet all der Fehler der IWW dürfen dadurch nicht die Aufopferung und der Mut der Wobblies in den Jahren zwischen ihrer Gründung und Mitte der 20er Jahre bezweifelt werden. Die Mitglieder der frühen IWW waren Helden der Arbeiterklasse. Entschlossen und offen in ihrem Haß gegen das System der Ausbeutung traten sie den Herrschenden entgegen, die wiederum ihre Repression auf sie niedergehen ließen. Organisatoren der IWW wurden immer wieder verhaftet, unter Mordanklage und Nötigung gestellt, eingesperrt usw. Sie wurden geschlagen, geteert und gefedert, gelyncht und gar verstümmelt.
All dies sind Tatsachen, und keiner der Fehler der IWW kann darüber hinwegtäuschen. Diese Tatsachen liefern die Grundlage für den Mythos der IWW. Aber die Welt muß heute mehr von Revolutionären verlangen als die Aufzählung mutiger Taten und die Erinnerung an heldenhafte Aktionen. Um die Arbeiterklasse zu befreien und die Welt aus den Fesseln der Ausbeutung herauszulösen, müssen wir die Lehren der Vergangenheit begreifen, d.h. sowohl die positiven wie die negativen und auf ihnen aufbauen.
Alles Positive an der Geschichte der IWW muß Teil des Erbes der Arbeiterbewegung sein, aber wir müssen auch immer das Negative vor Augen haben. Die Arbeiterklasse kann ihren Kampf nicht mit Hilfe von Mythologien gewinnen.
Die gespaltene Persönlichkeit der IWW
Von Anfang an litten die IWW unter einer Reihe von Mängeln, die Hindernisse bei der Verfolgung ihres Ziels der proletarischen Revolution waren. Von Anfang an versuchten die IWW eine Doppelrolle zu spielen, nämlich zwei Rollen gleichzeitig zu erfüllen: a) ein Einheitsorgan der ganzen Klasse zu sein und b) eine politische Organisation revolutionärer Militanten. Dadurch entwickelte sie eine "gespaltene Persönlichkeit". Die IWW bezeichnete sich gleichzeitig als eine Gewerkschaft, ein Verband, der die ganze Arbeiterklasse auf der Grundlage von Industriezugehörigkeit zusanmenfassen würde, und als eine revolutionäre Organisation entschlossener Kader, die danach strebte, das Bewußtseinsniveau in der ganzen Arbeiterklasse zu heben. Daß die IWW nicht einsehen konnte, daß eine Organisation diese beiden Funktionen unmöglich gleichzeitig erfüllen konnte, wurde ihr zum Verhängnis.
Dieser unklare, halb-gewerkschaftliche, halb-revolutionäre organisatorische Charakter der frühen IWW rief ständig Spannungen und Probleme in der Organisation hervor. Die Ernsthaftigkeit und die Gründlichkeit der politischen Debatten innerhalb der IWW wurden zutiefst dadurch beeinträchtigt. Man erkannte nicht die Notwendigkeit, ja die Verantwortung der revolutionären Organisationen, Debatten zu führen und theoretische Ausarbeitungen anzufertigen, um einen Rahmen für den revolutionären Kampf zu liefern. Die IWW öffneten ihre Presse für die Debatten, aber diese Debatten selbst wurden öfters abgebrochen und abgewürgt, ohne zu Schlußfolgerungen zu kommen. Der Einwand war jeweils ein Ruf des Dachverbandes, man solle aufhören, Haarspalterei zu betreiben und endlich mit der Frage der Organisierung anfangen. Infolgedessen brachten die IWW keinen programmatischen Text hervor, abgesehen von der Präambel zu ihrer Verfassung, die ein Mindestmaß an Aussagen waren zu revolutionären Prinzipien. Diese waren hauptsächlich syndikalistischer Natur und unzureichend für die gewaltigen Aufgaben des revolutionären Kampfes.
Es gab eine ständige Spannung zwischen den sogenannten "propaganda locals" (örtlichen Propagandagruppen), die im wesentlichen kleine Gruppen revolutionärer Militanten ohne festverwurzelte, organisatorische Basis in Industriebranchen waren, und ihren Gegenstücken, den sogenannten "jobbites", die Einheiten des Verbandes waren, welche die Arbeiter in Auseinandersetzungen mit Bossen vertraten. Die örtlichen Propagandagruppen zeigten eher radikale Tendenzen bei ihrer politischen Orientierung, so z.B. als die USA in den I. Weltkrieg eintraten. Die "job locals" verfolgten eher eine klassische gewerkschaftliche Orientierung und konzentrierten sich auf die "ökonomischen" Kämpfe. Weil sie nicht klar darüber waren, welche Art Organisation sie waren - eine Organisation einer revolutionären Minderheit oder eine Einheitsorganisation der ganzen Klasse - durchlief die IWW eine Entwicklung historischer Instabilität. Die Mitgliederzahlen schwankten enorm. Arbeiter, die nicht wirklich einverstanden waren oder die revolutionären Ziele der IWW nicht auseichend verstanden, traten massenweise in Zeiten von Streiks ein, nur um wieder auszutreten, als die Kämpfe vorüber waren. Obgleich die IWW nie behaupteten, je mehr als 40.000 zahlende Mitglieder zu haben, hatten sie Anfang der 1920er Jahre mehr als eine Million Mitgliederkarten ausgegeben; manche Arbeiter waren bis zu zehn mal ein- und ausgetreten. Im Verlaufe des berühmten Lawrence Textilstreiks, dem vielleicht größten Erfolg der IWW, hatten sich dort mehr als 14.00 Mitglieder der IWW angeschlossen. Aber nur 3 oder 4 Monate nach dem Streikende verfügte die lokale Sektion nur noch über 400 Mitglieder.
Die Tragweite dieser Verwirrung der IWW über ihre eigene Rolle, ihr Unvermögen die verschiedenen Aufgaben der jeweiligen Organisation zu begreifen, dürfen nicht unterschätzt werden. Die Revolution kann nicht nur auf der Grundlage von Kampfbereitschaft durchgeführt werden. Eine Hauptwaffe des Proletariats ist sein Bewusstsein; und dies läßt die Aufgabe der theoretischen Ausarbeitung zu einer absoluten Notwendigkeit der Tätigkeiten revolutionärer Minderheiten werden. In dieser Hinsicht scheiterte die IWW kläglich. Verschärft wurde dieses Problem noch durch die politikfeindlichen Vorurteile der meisten der IWW Gründer, die Wahlpolitik/Parlamentarismus mit politischer Aktion als solcher gleichsetzten und nicht erkannten, daß revolutionäre Arbeiter sich in einer politischen Partei zur Verteidigung revolutionärer Prinzipien zusammenschließen müssen, um so das Bewußtsein der Klasse insgesamt vorandrängen zu können. Das oberflächliche Verständnis des Marxismus durch viele Gruppen in den USA um die Jahrhundertwende träg ebenso zu diesem Vorurteil bei. Obgleich die frühen Wobblies sich voll mit den Arbeiten Marx' identifizierten, verstanden sie nicht die Methode der marxistischen Analyse, und dies ließ sie später falsche Positionen entwickeln. Sie begriffen einfach nicht, daß der Marxismus die Gewerkschaften nie als revolutionäre Organe auffaßte, sondern als Organisation, die die Arbeiter als eine Klasse auf der Grundlage von ökonomischen Interessen zusamnenfaßte, damit diese der Kapitalistenklasse entgegentreten können. Marx verstand, daß die politische Aufgabe des Proletariats darin bestand, den kapitalistischen Staat insbesondere nach der Erfahrung der Pariser Kommune (1871) zu zerstören. Zum Zeitpunkt der Gründung der IWW zogen linke Sozialisten wie R. Luxemburg die Lehren aus den Massenstreiks in Rußland und erkannten das Zusammenfließen des politischen und ökonomischen Kampfes im neuen Zeitraum der kapitalistischen Dekadenz, der gerade angebrochen war. Aber die Mehrheit der Wobblies verstand dies nie. Gegen den Reformismus der II. Internationale reagierten sie mit einer Verwerfung der Politik im Allgemeinen und einer Betonung, daß der politische Kampf dem ökonomischen untergeordnet sein solle.
Eine Organisation der Arbeiterklasse kann auf drei Ebenen des Kampfes eingeschätzt werden: dem ökonomischen, dem politischen und dem theoretischen. Auf der Ebene des ökonomischen Kampfes, die einzige Ebene, die die IWW jemals anerkannten, leisteten die IWW - wie oben erwähnt - zahlreiche Beiträge. Aber hinsichtlich des politischen Kampfes - dem Kampf um die Zerstörung des kapitalistischen Staats und den Aufbau der Diktatur des Proletariats - und beim theoretischen Kampf - dem Kampf, um die Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen, die Entwicklung der Gesellschaft zu begreifen und einen theoretischen Rahmen für den Kampf zu entwickeln - trugen die IWW sehr wenig Positives bei. Ja, viele ihrer Beiträge waren negativ, gar tatsächlich Hindernisse für die Arbeiterklasse.
Die IWW und politische Aktionen
Die Debatten über politische Aktionen waren sehr konfus in den IWW. Vor allem die Beziehung zwischen dem ökonomischen und politischen Kampf, oder das Verhältnis zwischen den IWW und den politischen Organisationen der Arbeiterklasse wurde nie erörtert. Auf dem Gründungskongreß der IWW gab es viele militante und revolutionäre Redebeiträge, die voll von Hoffnung aber auch von vagen Beschreibungen der revolutionären Aufgabe der neuen Organisation waren. Ein Redner nach dem anderen brandmarkte die klassenversöhnliche American Federation of Labor (AFL) und plädierte für den Kampf um die Revolution. Aber abgesehen von der Übereinstimmung hinsichtlich der Notwendigkeit, militante, klassenkämpferische Unionen auf Industriebranchenebene zu organisieren, gab es keine wirkliche Übereinstimmung darüber, wie das Ziel der Revolution durchgesetzt werden könnte. Genauso wenig gab es eine Übereinstimmung über die Frage politischer Aktionen im Allgemeinen.
Am Gründungskongreß nahmen Vertreter einer Reihe etablierter Gewerkschaften teil, die alle im Clinch lagen mit der AFL. Viele dieser Gewerkschaften bewegten sich auf der Linie der Sozialistischen Partei Amerikas. Obgleich diese selbst nicht offiziell auf dem Gründungskongreß vertreten war, gab es Repräsentanten des linken Flügels. Auch Vertreter einer rivalisierenden Sozialistischen Arbeiterpartei Amerikas (z.B. DeLeon) waren anwesend, ebenso eine Reihe von Anarchisten und Syndikalisten.
Hinsichtlich der Frage politischer Aktionen gab es große Meinungsunterschiede, aber dies wurde durch einen Kompromiß bei der Formulierung der Präambel zur Konstitution überbrückt, welche von DeLeonisten und Syndikalisten entworfen worden war, und die den Kongreß dominierten. In seiner ersten Rede auf dem Kongreß betonte DeLeon, daß die wirtschaftliche Stärke des Proletariats dazu benutzt werden sollte, um bei den Wahlen mehr Gewicht zu haben. Er brachte damals keine Übereinstimmung zur Frage des Generalstreiks zum Ausdruck; ebenso wenig meinte er, das Proletariat könnte seine Revolutionen nur durch direkte ökonomische Aktionen vollziehen, was ja die Auffassung der Syndikalisten war. Der erste Entwurf der Präambel, von Hagerty vorbereitet, sagte aus, das Proletariat sollte "das übernehmen“, was es mit seiner Arbeit produziert, und in den Händen einer Wirtschaftsorganisation der Arbeiterklasse halten". Hagerty hatte sich gegen DeLeons Aufruf zur Unterstützung der Wahlen ausgesprochen, als er meinte, "ein Stück Papier in eine Wahlurne zu werfen, hat der Arbeiterklasse noch nie ein Stück Befreiung gebracht, und meiner Ansicht nach wird es dies nie tun können". Hagerty fuhr fort, man müsse vor allem die "Werkzeuge der Industrie" in die Hände der Arbeiter bringen. Der Streit über die Präambel wurde in Komiteetreffen aus der Welt geschafft. DeLeon, der sich schon einige syndikalistische Ideen zu Eigen gemacht hatte, stimmte damit überein, daß das Proletariat die Revolution mit Hilfe einer Industriegewerkschaft machen müßte, aber die Präambel berücksichtigte die Notwendigkeit, daß politische Aktionen durchgeführt werden müssen. Gleichzeitig war es der Organisation verboten, sich mit irgendeiner sozialistischen Partei zusammenzuschließen. Die Schlußfassung der 1905 angenommenen Version erwähnte die Notwendigkeit der Agitation auf "politischer und ökonomischer Ebene ...ohne den Zusammenschluß mit einer politischen Partei". Ein Delegierter auf dem Gründungskongreß faßte am besten das Wesen der Präambel zusammen, als er sagte: "Uns scheint, daß dieser Paragraph, die politische Klausel der Präambel eine Anbiederung ist an drei verschiedene Fraktionen auf diesen Kongreß, an die, die überhaupt nicht von der Notwendigkeit politischer Aktionen überzeugt sind, an die Sozialisten und auch an die Anarchisten." Anstatt grundlegende Prinzipienfragen auszudiskutieren, weil diese absolut notwendig sind für die Organisierung einer revolutionären Organisation, wurden sie damals unter den Teppich gekehrt.
Nach dem Gründungskongreß brachen sofort Richtungskämpfe und vor allem Intrigen um die Macht aus, nicht zuletzt auch um die Kontrolle über die Einnahmen.
Die politischen Auseinandersetzungen aber traten nie klar zum Vorschein. DeLeon verteidigte die Politik als Parlamentarismus und als eine Gelegenheit, soziale Fragen ohne Gewalt zu lösen. Auf einen Anarchisten antwortend schrieb DeLeon: "Nicht, alles, was der Kapitalismus geschaffen hat, ist verwerflich. (…)Eine der wertvollsten Ideen des Kapitalismus ist die friedliche Methode der Konfliktbeilegung. Eine Organisation, die so etwas verwirf t, und sich nur für die Gewalt organisiert, sich ausschließlich auf einen Machtkampf einstellt, drängt sich selbst aus der Zivilisation". Politische Aktionen, behauptete DeLeon, bieten die Möglichkeit einer "friedlichen Lösung".
Gegen solch ein Geschwätz konnten politik-feindliche Argumente schnell die Überhand gewinnen. Ihm wurde entgegengehalten, "die Kapitalistenklasse hat schon den Krieg gewählt, wie kann da nur jemand eine friedliche Lösung vorschlagen?"
Die Debatte über Politik wurde durch ein schlagfertiges politisches Manöver 1908 auf einem Kongreß beendet, als DeLeon ein Mandat wegen einer technischen Raffinesse versagt wurde. Die anderen Anhänger der Socialist Labour Party verließen den Kongreß, gründeten ihre eigene IWW, die sich einige Jahr am Leben erhielt, bevor sie jämmerlich verschwand. Die politische Klausel wurde aus der Präambel gestrichen.
Die Verwerfung der Politik sollte schwerwiegende Folgen haben bei der kläglichen Reaktion der IWW gegenüber dem Ausbruch des I. Weltkriegs und ihrer Weigerung, sich der Kommunistischen Internationale anzuschließen.
Die IWW und der Erste Weltkrieg Krieg und Revolution sind Momente, wo Revolutionäre der Arbeiterklasse unwiderruflich Farbe bekennen missen. Alle Manifeste, Erklärungen, Präambeln und Reden schmelzen zu nichts zusammen, falls die von den Revolutionären ergriffenen Maßnahmen in Zeiten von Krieg und Revolution nicht den proletarischen Prinzipien entsprechen. So muß eine Einschätzung der IWW auch deren Aktivitäten während des I. Weltkriegs mit untersuchen.
Zum Mythos der IWW gehört es, daß sie als unnachgiebige Kriegsgegner dargestellt werden, als Leute, die verfolgt, gehetzt, unterdrückt, eingekerkert wurden aufgrund ihres Widerstandes gegen den US-amerikanischen Kriegseintritt. Es stimmt, daß über 100 Führer und Militanten der IWW verhaftet wurden, der Nötigung bezichtigt und der Kriegssabotage beschuldigt wurden und damit lange Gefängnisstrafen erhielten. Jedoch selbst die "offizielle" Geschichte der IWW, die von einem IWW Organisator Fred Thompson geschrieben wurde, meint, daß Wobblies oft fälschlicherweise beschuldigt wurden, daß sie unschuldige Opfer des Bestrebens der Bourgeoisie wurden, die nämlich die Militanten der IWW für ihre militanten Streiks vor dem Krieg bestrafen wollte. Obgleich die IWW die Kriegshetze nicht unterstützten, erfüllten sie nicht ihre Verantwortung, die sie nämlich in eine Opposition gegen den Krieg hätte treten lassen müssen.
1916 nahm ein IWW-Kongreß eine Resolution an, die eine "anti-militaristische Propaganda in Friedenszeiten vorsah und somit Klassensolidarität unter den Arbeitern der ganzen Welt, und in Kriegszeiten den Generalstreik in allen Industrien". Aber als die USA 1917 in den Krieg eintraten, war das Allgemeine Exekutivorgan der IWW total zerstritten. Eine von Frank Little angeführte Minderheit wollte die .Anti-Kriegs-Arbeit zum Kernpunkt organisatorischer Aktivitäten machen. "Die Mehrheit", schreibt Fred Thompson in seinen "First Fifty Years of IWW", meinte, die Anti-Kriegs-Arbeit würde den Klassenkampf in Sackgassen enden lassen und damit genau die Wirkung haben, welche die Kriegshetzer erwarteten, wodurch die IWW in die Hände der Kriegsbefürworter arbeiten würden. Unter den gegenwärtigen Bedingungen sollte man weiterhin die Arbeiter dafür organisieren, um ihren ständigen Feind zu bekämpfen, um bessere Löhne durchzusetzen, kürzere Arbeitsstunden, sichere und gesundere Arbeitsbedingungen; das Endziel, eine weltweite Solidarität der Arbeiter, sollte dabei im Auge behalten werden". Gewerkschaftsorganisatoren wurden angehalten, nicht über den Krieg zu sprechen, und ein Anti-Kriegs-Aufruf - The Deadly Parallel - sowie ein Sabotage befürwortendes Dokument wurden aus dem Verkehr gezogen.
Von den 521 Streiks, die in den USA während des I. Weltkrieges stattfanden, waren nur drei von den IWW organisiert worden; eine Regierungsuntersuchung zog später die Schlußfolgerung, daß keiner dieser Streiks mit der Absicht der Kriegssabotage geführt worden war. In den Docks von Philadelphia, wo die IWW einflußreich waren, wurden die IWW Mitglieder angehalten, ihre Arbeit fortzusetzen und Kriegsschiffe nach Europa zu beladen.
Auf dem berühmten Prozeß in Chicago gegen 100 IWW-Führer im Jahre 1918 sagte Haywood aus, F. Little habe nicht die Mehrheitsposition der Organisation in ihrer Einstellung gegen den Krieg und die Zwangsrekrutierung vertreten, und er bestätigte, daß die IWW alle kriegsfeindliche Literatur zurückgezogen hätten. Seinen Aussagen zufolge hatten sich die Wobblies vorsichtig verhalten, als sie "ruhig blieben und ihre Agitation auf den Arbeitsplatz und seine Bedingungen beschränkten". "Jetzt ist die Zeit, ruhig Blut zu bewahren, vernünftige Urteile zu treffen und gewissenhaft unsere Arbeit zu verfolgen". Arbeiter, die an die IWW Zentrale mit der Bitte um Rat, was man gegen den Krieg tun könne, schrieben, erhielten als Antwort: "Die Organisation als solch hat keine Stellung bezogen". Haywood behauptete, die "IWW kämpfe mehr auf dem Feld ökonomischer Kämpfe, und es ist nicht meine Aufgabe, zudem ich selbst nicht gezogen werden kann, anderen zu sagen, ob sie in den Krieg ziehen sollten oder nicht". Das war also der "Generalstreik" zu Kriegszeiten, von dem die IWW gesprochen hatten.
Nachdem sie zuvor die "Politik" verworfen und politische Theorien abgelehnt hatten, waren die IWW nicht in der Lage, die Bedeutung des I. Weltkriegs zu verstehen. Zu glauben, ein Kampf gegen den Krieg, in dem sich Millionen von Arbeitern bekämpften, und all das zugunsten des Kapitals, sei eine Ablenkung vom Klassenkampf, hieß schon blind sein gegenüber der Geschichte. Die Konfusionen der IWW über dem I. Weltkrieg können nicht einfach auf die Isolierung und die Unerfahrenheit des amerikanischen Milieus - zum damaligen Zeitpunkt zurückgeführt werden. Andere Auffassungen wurden von der Socialist Party of America und der Socialist Labor Party vertreten, die sich trotz ihrer ernsthaften theoretischen und politischen Mängel dem Krieg entgegenstellten. Die Sozialistische Partei nahm eine Resolution gegen den Krieg an, Debs, ein prominenter Führer wurde wegen Antikriegspropaganda verhaftet.
Während Haywood, ein IWW-Führer , sich weigerte, die Proletarier zum Kampf gegen den Krieg aufzurufen, hatte Debs klar Stellung bezogen: "Ich bin kein kapitalistischer Soldat, ich bin ein proletarischer Revolutionär...Ich bin gegen jeden Krieg, außer einem; ich bin für den Krieg, der weltweit für die soziale Revolution geführt werden muß." (11 .9.1915) . Während die IWW kriegsfeindliche Propaganda vor dem Krieg zirkulierte, bewies die Geschichte, daß Debs und nicht die IWW diese Parolen in die Tat umsetzten, als Amerika in den Krieg eintrat.
Gleichzeitig mit seiner Stellungnahme gegen den Krieg verband Debs einen Aufruf zur Unterstützung der Russischen Revolution. Er verstand zumindest ansatzweise den neuen Zeitraum, der mit der revolutionären Welle von 1917-23 angebrochen war. Innerhalb der Sozialistischen Partei gab es einen Flügel, der die Notwendigkeit des Bruches mit der II. Internationale und den Anschluss an die Kommunistische Internationale erkannt hatte. Die IWW verstanden diese Notwendigkeit nie.
Letztendlich muß man betonen, daß die proletarischen Organisationen mit einem politischen Engagement unabhängig von ihren jeweiligen Konfusionen besser die Prinzipien des proletarischen Internationalismus verteidigten. Die IWW überschritten nicht die Klassengrenze, indem sie zur Teilnahme am Krieg aufriefen. Sie unterstützten nicht den Krieg oder mobilisierten die Klasse. Aber sie erfüllten auch nicht ihre eigenen Versprechungen. Wobblies wurden ins Gefängnis geschmissen, aber nicht weil sie Widerstand gegen den Krieg geleistet hatten. (Fortsetzung folgt) (aus Internationalism, Zeitung der IKS in den USA)
(Erstveröffentlichung in Weltrevolution Nr. 24, 1986).
Der Mythos der IWW
Im ersten Teil dieses Artikels untersuchten wir die Geschichte der IWW bis zum 1. Weltkrieg. Durch den Zusammenschluss der besten Militanten der Arbeiterklasse in den USA und die Verwerfung der klassenversöhnlichen Politik der AFL und des parlamentarischen Kretinismus des rechten Flügels der Sozialdemokratie trat die IWW als ein entschlossener Vertreter der Arbeiterklasse auf. Das proletarische Engagement und die Entschlossenheit der frühen IWW können nicht geleugnet werden. Von Anfang an war die Organisation jedoch durch eine Reihe von Konfusionen geschwächt. So verstand sie nicht den Unterschied zwischen einer Einheitsorganisation der Arbeiterklasse, die alle kämpfenden Arbeiter ungeachtet ihrer politischen Auffassungen zusammenfaßt, und einer revolutionären Organisation, die nur eine Minderheit von revolutionären Militanten umfaßt, ausgehend von der Zustimmung zu bestimmten politischen Positionen. Ein anderer entscheidender Fehler war die Verwerfung der Politik, die sie gleichsetzten mit dem Parlamentarismus, anstatt sie als Notwendigkeit der Zerstörung des bürgerlichen Staats aufzufassen. Diese Konfusionen ließen die IWW schlecht gewappnet für den 1. Weltkrieg und die nachfolgende revolutionäre Welle.
Nach anfänglichen Schwankungen gegenüber der Frage der Unterstützung des 1. Weltkriegs beschloß die IWW 1917, nachdem die USA in den Krieg eingetreten waren, eine ursprüngliche Position des Generalstreiks im Kriegsfalle zurückzuziehen, um zu behaupten, daß der Kampf gegen den Krieg eine Ablenkung vom Klassenkampf sei. Kriegsfeindliche Propaganda wurde aus dem Verkehr gezogen, kriegsfeindliche Aktionen von Militanten der IWW wurden nicht unterstützt und die Haltung eines jeden Militanten gegenüber dem Krieg wurde jedem einzelnen Mitglied selbst überlassen. Zuvor schon theoretisch durch die Verwerfung der Politik und des Marxismus entwaffnet, begriff die IWW nicht die grundsätzliche Wende, die mit dem Anbruch der Dekadenz des Kapitalismus eingetreten war.
Die IWW und die russische Revolution
Obgleich sie anfänglich der Russischen Revolution gegenüher viele Sympathien hatten, verstanden die IWW nie ihre Bedeutung. Weil sie nicht begriffen, daß der I. Weltkrieg den Eintritt des Kapitalismus in seine dekadente Phase bedeutete und damit die proletarische Revolution auf die Tagesordnung der Geschichte stellte, fassten die IWW die Revolution in Rußland als ein spezifisch russisches Phänomen auf, das nur durch die Umstände in Rußland selber bestimmt sei.
Revolutionäre Marxisten begriffen, daß die für die Zerstörung des Kapitalismus erforderliche Revolution eine weltweite sein muß. Unter der Initiative der Bolschewisten wurde der Versuch unternommen, die Revolutionäre Anfang 1919 international zusammenzufassen. Der Gründungsskongreß der Kommunistischen Internationale (März 1919) forderte die IWW zum Anschluss an diese revolutionäre Umgruppierung auf. Die Debatte über diesen Anschluss der IWW an die Komintern war ein entscheidender Moment in der Geschichte der Organisation, und das Ergebnis dieser Debatte sollte den weiteren Werdegang der IWW entscheidend beeinflussen.
Die Debatte üher politische Aktionen wurde diesesmal auf einer viel höheren Ebene geführt. Vor 1905-07 sprach man von politischen Aktionen in einer sehr verwirrten Weise. DeLeonisten faßten politische Aktionen als Wahlbeteiligung, als ein Mittel zur friedlichen Beilegung von Konflikten auf. Die Anarchisten und AnarchosSyndikalisten hatten sich gegen diese Auffassung gewandt und sich für direkte ökonomische Aktionen und den Klassenkampf ausgesprochen. Wir wollen näher die Argumente für den Eintritt in die Komintern untersuchen, denn es ist wichtig, sich der Tragweite der Entscheidung der IWW bewusst zu werden, als sie der Komintern nicht beitraten.
Befürworter des Anschlusses an die Komintern brachten folgende Argumente vor:
- die Revolutioräre könnten nicht mehr davon träumn, eine neue Gesellschaft innerhalb der alten aufzubauen; der Zeitraum der Weltrevolution war angebrochen;
- falls die Revolution sich nicht ausbreitete, wäre der durch das Proletariat in Rußland erreichte Durchbruch zum Scheitern verurteilt;
- die Hauptaufgabe des revolutionären Proletariats bestand nicht in dem Aufbau von Industrieverbänden, sondern in dem Umsturz und der Zerstörung des bürgerlichen Staats und der Errichtung der Diktatur der Arbeiterklasse, die diese mittels der Arbeiterräte oder Sowjets ausübt;
- und um den Prozeß der Weltrevolution zu beschleunigen, müssen sich die Revolutionäre in der neuen Kommunistischen Internationale zusammenschließen. Zum Beispiel wurde in Revolutionary Age, Zeitung des linken Flügels der Socialist Party 1919 die IWV folgendermaßen kritisiert: "Gibt es in den offiziellen Schriften der IWW irgendeine Auffassung von der revolutionären Massenaktion und der proletarischen Diktatur? Ihre Theorie, der zufolge sich das Proletariat organisieren muss, um die Industrie zu übernehmen, stimmt nicht mit der Theorie und Praxis der proletarischen Revolution überein. Das revolutionäre Proletariat muß zunächst die Staatsmacht ergreifen, den neuen proletarischen Staat der Sowjets und die proletarische Diktatur organisieren; erst danach kann es dazu übergehen, die Industrie zu übernehmen und das neue kommunistische System und die Industrieverwaltung zu organisieren, von der die IWW dummerweise glauben, daß sie innerhalb der alten Gesellschaft aufgebaut werden könnte... die IWW schlägt die Erfahrung der proletarischen Revolution in Rußland und Deutschland in den Wind - daß man nämlich zuerst die Staatsmacht ergreifen rnuß " In einem Artikel in "Voice of Labor", dem Organ der Kommunistischen Arbeiterpartei wurden im April 1920 ähnliche Argumente vorgetragen: "Die Auffassung, daß das Bestehen eines Industrieverbandes ausreiche, um die Macht im Kapitalismus zu erobern, muß entschieden verworfen werden.. .Die Idee, daß sich die Arbeiter im Kapitalismus mit Hilfe der Industrieverbände die Erfahrung und das technische Know How zur Leitung der Industrie aneignen können, daß man in die neue Gesellschaft durch die allmähliche Übernahme der Industriekontrolle durch die Industrieverbände "hineinwachsen" könnte, stimmt (in entgegengestzter Form) mit den Ideen des parlamentarschen Sozialismus überein, daß die Arbeiterklasse schrittweise in den Sozialismus "hineinwachsen" könnte, indem siesSich die Erfahrung in Sachen Stzatsgeschäften aneignet und die Kontrolle des bürgerlichen Staates "übernimmt". Jede Auffassung verwirft auf ihre Weise die Grundsatzfrage der revolutionären Eroberung der Staatsmacht." "Die Eroberung der Staatsmacht ist das Ziel des revolutionären Proletariats. Weder Parlamente noch Industrieverbände sind Mittel zur Eroberung der Macht, sondern nur Massenaktionen und die Arbeiterräte ...In der Zeit der aktiven Revolution wird der Kampf nicht um die Industrieverbände geführt, sondern um die Errichtung von Arbeiterräten".
Am deutlichsten wurden die veränderten Bedingungen des Klassenkampfes und die Notwendigkeit revolutionärer politischer Aktionen in dem Aufruf formuliert, den das Exekutivkomitee der Komintern im Januar 1920 unter der Feder Sinowjcws an die IWW richtete: "Der durch den Weltkrieg desorganisierte Kapitalismus ist heute nicht mehr imstande, die von ihm selbst zum Leben erweckten ungeheuren Kräfte zu fesseln und nähert sich seinem Zusammenbruch. Die Stunde der Arbeiterklasse hat geschlagen. Die soziale Revolution hat begonnen und hier, auf der Ebene Rußlands, wird bereits die erste Schlacht der Vortruppen geschlagen. Die Geschichte fragt nicht danach, ob es uns recht ist oder nicht, ob wir zur Revolution bereit sind oder nicht. Eben ist eine günstige Gelegenheit eingetreten. Benutzt sie, und die ganze Welt wird den Werktätigen gehören: wenn Ihr an ihr vorbeigeht, kann sich vielleicht ein Jahrhundert lang keine zweite bieten. Jetzt ist nicht die Zeit, von dem "Aufbau einer neuen Gesellschaftsordnung in der Hülle der alten" zu reden. Die ALTE GESELLSCHAFTSORDNUNG ZERSPRENGT IHRE HÜLLE. DIE ARBEITER MUSSEN DIE DIKTATUR DES PROLETARIATS ERRICHTEN, DIE ALLEIN DIE NEUE ORDNUNG AUFBAUEN KANN."Etwas weiter im Text wird betont: "Doch kann die russische Revolution nicht bestehen, wenn die Arbeiter der anderen Länder sich nicht gegen ihre Kapitalisten erheben". Die Notwendigkeit der Zerstörung des kapitalistischen Staats wurde ebenso hervorgehoben:
"Um den Kapitalismus zu zerstören, müssen die Arbeiter vor allen Dingen die Staatsmacht den Händen der Kapitalisten entreißen. Sie müssen nicht allein die Macht an sich reißen, sondern auch den ALTEN KAPITALISTISCHEN STAAT BIS AUF DEN GRUND VERNICHTEN." Zum Widerstand der IWW gegen politische Aktionen schrieb die Komintern: "Das Wort "Politik" ist für viele Mitglieder des Verbandes der Industriearbeiter, was das rote Tuch für den Stier oder- den Kapitalisten. Diese "apolitischen" Genossen Arbeiter sind bisweilen gegen die Bolschewiki, weil die letzteren sich als eine "politische Partei" bezeichnen und manchmal an Wahlkampagnen teilnehmen. Das heißt aber das Wort "Politik" im allzu engem Sinn gebrauchen." Karl Marx schrieb dazu: "JEDER KLASSENKAMPF IST EIN POLITISCHER KAMPF. Das heißt, jeder Kampf der Arbeiter gegen die Kapitalisten ist ein Kampf der Arbeiter um die POLITISCHE Macht, d.h. um die Staatsmacht".
Während diese Dokumente, die vor 65 Jahren geschrieben wurden, Formulierungen enthielten, mit denen damals die Kommunistische Linke und die IKS heute nicht übereinstimmen (z.B. Teilnahme an Wahlkampagnen, Errichtung von Gewerkschaften und die Auffassung vom "proletarischen Staat" und sein Zusamnenhang mit den Arbeiterräten), lag der Text bei den grundlegenden Fragen absolut richtig. Er stellte die Fragen gegenüber den IWW auf einer viel höheren Ebene als vormals in der Debatte mit den DeLeonisten.
Was erwiderten die IWW auf diese Argumente?
Die anarchistische und anarcho-syndikalistische Mehrheit der IWW wollte sich nicht von der Stelle bewegen. In einem Editorial stand im Mai 1919: "Wir betonen nicht mehr besonders die "Notwendigkeit" des Umsturzes des bürgerlichen Staates. Wir sind der Ansicht, je mehr sich dic industrielle Entwicklung entfaltet, desto weniger wird der parlamentarische Staat dazu in der Lage sein, die Probleme der Gesellschaft zu lösen, während gleichzeitig die industrielle Verwaltung, die wir in der IWW aufbauen, mehr und mehr die Funktionen übernehmen wird, die sie erfüllen soll. Wir rechnen nicht mit der Notwendigkeit des Umsturzes des Staats. Fast hatten wir damit gerechnet, daß der Staat von selbst außer Gebrauch kommen würde.. .Uns wäre ein allmählicher Übergang lieber als ein "revolutionärer" Schock. Solche Schocks sind unerwünscht, weil sie Blut vergießern und Leiden verursachen ...Je zivilisierter die Menschen werden, desto mehr wird es möglich sein, von der alten Gesellschaftsform zur neuen durch Zustimmung der Öffentlichkeit ohne Gewaltanwendung überzugehen. D.h. diese Gewalt bolschewi,stischer Art, von der bei revolutionären Massenaktionen gesprochen wird, ist nicht notwendig.".
All das Gerede über revolutionäre Massenaktionen zur' jetzigen Zeit ist reiner Unfug... Wie könnten Massenaktionen stattfinden, bevor wir das Bewußtsein und den Willen der Massen kontrollieren. Wir müssen zuerst eine intensive Erziehungsarbeit leisten, so daß die Massen zu uns überwechseln, und bei der gegenwärtigen Entwicklung kann das noch Jahre dauern,..aber dann wird es immer noch keine Massenaktion bolschewistischer Art sein. Es wird sich um eine von der Mehrheit organisierte Massenaktion handeln. Da wir in einem demokratischen Land leben, wird der Wille der Mehrheit entscheidend sein
"Übrigens, warum sollten wir es so eilig haben, alles den Bolschewisten nachzumachen? Was ist bei ihnen so nachahmenswert, daß wir aus unseren Gleisen springen sollten, um uns ihnen anzuschließen? Sie haben die Autokratie umgestürzt und für das Proletariat politische Demokratie aufgebaut. Aber die politische Demokratie besteht (bei uns in den USA) schon seit langem... Deshalb tauchen die Ideen "revolutionärer Massenaktion" und der "Diktatur des Proletariats" nicht in unserem Programm auf. An unserem festen Glauben, daß die neue Gesellschaft in der Hülle der alten aufgebaut werden kann, gibt es nichts zu rütteln. . .Wenn die Russen sich mit der Frage industrieller Organisierung vorher befaßt hätten, wie wir das tun, wäre ihre Aufgabe viel einfacher gewesen und die Gefahr des Zusammenbruches und des Widerstandes seitens der Herrschenden viel neringer."
Die Verwerfung politischer Aktionen erhielt in einem Artikel von L. Sandgren. dem Herausgeber des One Big Union Monthly (OBUM) nach dem Kongreß von 1920 weiter Kontour. Er schrieb- "Wir wollen das soziale Problem ohne politische Aktionen lösen, ohne die Hilfe von Politikern". Sandgren schrieb dann weiter verachtungsvoll, daß die Kommunisten "offen zugeben, daß sie den bewaffneten Aufstand wollen... Die IWW aber kann'mit deren Politik nichts anfangen, genausowenig wie mit der anderer Parteien. Wir kommen selbst zurecht. Wir brauchen keine politische Hilfe, um die soziale Frage zu lösen.Unser Endziel werden wir nicht schneller erreichen, wenn wir von unserem Kurs der direkten Wirtschaftsaktionen abweichen.. .Wenn die Leute sich selbst unter Kontrolle haben und unser Programm übernehmen, werden politische Revolutionen wie die, die die Kommunisten anstreben, nicht erforderlich sein. Irgendeine Gruppe von Verwirrten kann eine blutige Revolution machen, aber nur vernünftige Leute wie die der IWW können versuchen, eine umfassende wirtschaftliche Revolution ohne Blutvergießen herbeizuführen". Hatte derselbe Sandgren Jahre zuvor noch gegen DeLeon von der Notwendigkeit einer Revolution gesprochen, wurde er nun zu dem Zeitpunkt, als das Proletariat tatsächlich eine revolutionäre Offensive angetreten hatte, "vernünftig" und sprach nur von der Möglichkeit eines "friedlichen Ubergangs". Andere Artikel in OBUM betonten ebenfalls die spezifischen russischen Bedingungen und schlossen deren Ubertragbarkeit auf die USA aus. Sie wollten nicht anerkennen, daß es sich um eine Weltrevolution handelte. Van Dorn, Sandgrens Nachfolger als Herausgeber des OBUM schrieb: "Die Revolution liegt noch in weiter Ferne.. in Amerika. Wir können nur so weiter machen wie bislang und versuchen die neue Gesellschaft in der alten aufzubauen... Was den Umsturz unserer Regierung angeht, haben wir nie daran gedacht, selbst nicht im Traum. Warum soll man sich um solche albernen Fragen kümmern. Das bringt uns nur in den Knast, weil wir des Verrats und des Aufwiegelns angeklagt werden. Wir kümmern uns um die großen Sachen - die Industrie. Nachdem wir die Industrie übernommen haben werden, werden wir selbst eine Regierung stellen, die alleine auskommen kann. Die kapitalistische Regierung wird dann arbeitslos dastehen und sich in nichts auflösen".
Innerhalb der IWW gab es Anhänger der Komintern und Mitglieder Kommunistischer Parteien, die sich an den Debatten beteiligten. Die Anarchisten waren bei der Denunzierung ihrer kommunistischen Genossen am vehemenstesten: "Arbeiter, es ist unmöglich solche Leute (die Kommunisten) ernst zu nehmen. Sie sind sowjetische Geisteskranke, die ihren Verstand aufgrund der aufwirbelnden Ereignisse in diesen Tagen verloren haben... Mit diesen Armleuchtern, unverfrorenen Abenteurern, gerissenen Politikern und Provokateuren sollen wir gemeinsame Sache machen?" Als angeblichen Beweis für die geistige Umnachtung und Spitzeltätigkeit brachte die Zeitung ein Zitat aus einer kcmmunistisdhen Zeitung: "Ihr müßt eure Streiks gegen die Regierung richten und die Kapitalisten davonjagen. Wenn der Endkarnpf zum Umsturz der Regierung kommt, müßt ihr euch bewaffnen, so wie es die Bergleute aus West Virgina nun getan haben, und für einen bewaffneten Aufstand vorbereitet sein,um die Kapitalisten zu stürzen und eure eigene Regierung, die der Arbeiterräte aufzubauen." Die Anarchisten waren aus dem Häuschen geraten durch diese klare Beschreibung der Vorgehensweise des Proletariats. Der o.g. Artikel zog die Schlußfolgerung: "Es ist an der Zeit, daß die vernünftigen Mitglieder der IWW eindeutig Stellung beziehen gegen solche Umnachteten und Provokateure,und daß unser Name nie mehr im gleichen Atemzug mit ihnen genannt werden kann".
Einige der Anarchisten gründeten "Stoßtrupps", die sich darauf spezialisierten, Kommunisten gewalttätig anzugreifen und pro-kommunistische Treffen zu stören. Das war das Engagement gegenüber der proletarischen Demokratie, das von einigen Anhängern der politik-feindlichen Perspektive vertreten wurde.
Die Mehrheit der IWW wollte schließlich der Komintern nicht beitreten. Viele Mitglieder traten jedoch aus den IWW aus und schlossen sich der Kommunistischen Partei an.
Sich der Komintern nicht anzuschließen, sollte für die lWW schwerwiegende Konsequenzen haben. Jetzt hatte sie keine gespaltene Persönlichkeit mehr, wo sie versuchen konnte. gleichzeitig eine Gewerkschaft zu sein, die eine Organisation sein sollte, welche alle Arbeiter zusammenenfaßt, und sowie eine revolutionäre Organisation zu sein. Jetzt war sie nicht mehr beides gleichzeitig, sondern nur noch eine Gewerkschaft, die sich durch radikale Phrasen auszeichnete. Aber im dekadenten Kapitalismus sind die Gewerkschaften keine Organisationen der Arbeiterklasse mehr, da der Staatskapitalismus die Gewerkschaften in den Staat aufsaugt und ihnen die Aufgabe zuträgt, die Arbeiterklasse zu kontrollieren.
Diese Entscheidung der IWW war ein Scheideweg im Leben der Organisation. Anstatt sich an die neue Situation des Eintritts des Kapitalismus in seine Dekadenz anzupassen und entsprechende Konsequenzen daraus zu ziehen, blieb die IWW weiterhin an Positionen haften, die sich als arbeiterfeindlich herausgestellt hatten, insbesondere:
- die Unfähigkeit zu erkennen, daß der Klassenkarripf gegen den Kapitalismus notwendigerweise ein politischer Kampf ist,
- die Verwerfung der Notwendigkeit einer revolutionären Partei,
- das Unvermögen zu verstehen, daß die Welt in einen neuen Zeitraum, den der Kriege und Revolutionen eingetreten war,
- ihr mangelndes Begreifen der Bedeutung der Arbeiterräte,
- die Verwerfuna der Diktatur des Proletariats,
- die Leugnung der Notwendigkeit der Zerstörung des bürgerlichen Staats,
- die Verwerfung des Marxismus als die Theorie der Befreiung der Arbeiterklasse.
Nachdem sie zuvor schon in der Frage des imperialistischen Krieges zentristisch geschwankt war, wandte die Organisation sich dann von der revolutionären Welle ganz ab. In ihrem Aufruf an die IWW vom Jahre 1919 hatte die Komintern die IWW dazu gedrängt einzusehen, daß die Weltrevolution auf der Tagesordnung stand. "Eben ist eine günstige Gelegenheit eingetreten. Benutzt sie, und die ganze Welt wird den Werktätigen gehören: wenn Ihr an ihr vorbeigeht, kann sich vielleicht ein Jahrhundert lang keine zweite bieten." Die IMI wollte nicht einmal wahrhaben, daß es die Möglichkeit gab. Sie verschlossen die Augen und trugen so zur Niederschlagung der Revolution bei. Die IWW war nie in der Lage, die Fehler zu korrigieren, die sie damals beging; anstelledessen verbreitet sie weiterhin den Mythos von der kämpferischen, revolutionären IWW
Die IWW in den 1920er und 1930er Jahren
In den 20er Jahren entwickelte die IWW ein besonderes Interesse in ihren Publikationen an "technischen Artikeln und der Beschreibung industrieller Produktionsprozesse und vermeidbarer Verschwendungen" (F. Thoanpson). Während das Proletariat in Deutschland Opfer blutiger Repression war, Linkskommunistische Fraktionen gegen den Niedergang der III. Internationale ankämpften, befaßte sich die IWW mit bürgerlichen Fragen der Technologie und der Mitbestimmung am Arbeitsplatz. Dann begab sich die IWW ehenso auf den Weg des Kompromisses mit ihren alten revolutionären Prinzipien und Traditionen der "revolutionären Unionen". Waren die Mitgliedsbeiträge anfänglich niedrig gewesen, um schlecht bezahlten Arbeitern den Beitritt zu ermöglichen, wurden diese jetzt angehoben. Eine Kontroverse entstand, als eine örtliche Gruppe ein althergebrachtes Verbot brach, und Zeitverträge mit einer Geschäftsleitung abschloß. Das Problem wurde auf dem Kongreß von 1938 gelöst, als die Statuten dahingehend geändert wurden, um diese Möglichkeit, welche vormals als unvereinbar mit den revolutionären Unionen galt, zuzulassen. Die IWW leiteten ebenso die Zusarmmenarbeit mit dem Staat ein, als sie an Tarifverhandlungen teilnahmen und bei Kommissionen des "Nationalen Arbeitsrates" mitwirkten. Wie wir in unserer Broschüre zu den Gewerkschaften (siehe Broschüre mit Artikel zur CIO, der in den 30er Jahren gegegründeten USGewerkschaft) aufzeigen, strebte die Bourgeoisie nach einer stärkeren Kontrolle der Arbeiter durch die Gewerkschaften. Die Zwangsmitgliedschaft war ein mittel dazu. Ende der 30er Jahre beteiligte sich die IWW überall an von der Regierung organisierten Arbeitsverwaltungswahlen; all das geschah unter dem Vorwand, damit das Recht zu haben, Arbeiter zu repräsentieren! Als die CNT in Spanien in die Regierung eintrat, brach die IWW ihre Unterstützung für die CNT nicht ab, sondern stand weiterhin treu an ihrer Seite.
Die IWW und der 2. Weltkrieg
In der Zeit vor und während des 2. Weltkriegs setzte sich der Verfall der IWW fort. Als der Krieg immer näher rückte und Europa sich schon im Krieg befand, dachten die IWW' nie daran, ihre Haltung während des 1. Weltkriegs zu überprüfen oder nunmehr eine Resolution zu verfassen, die ihre Handlungen während der nachfolgenden Zeit leiten würde. Die Reaktion der IWW auf den 2. Weltkrieg war völlig unzureichend. Einerseits hatte sie schon zu den anti-faschistischen Kampagnen und der Kampagne zur Mitgliederwerbung in den Gewerkschaften aufgerufen, die ja unerläßlich waren für die Mbbilisierunq für den Krieg - auch wenn die IWW sich nicht über die Konsequenzen dieses Verhaltens im klarren waren. Andererseits behauptete die IWW gegen den imperialistischen Krieg zu sein. Die Organisation kritisierte Gewerkschaften, die sich für eine Verstärkung der Verteidigungsanstrengungen aussprachen, und sie warnte davor, daß solche Gruppen sich schuldig machen würden " am Tod von hundert tausenden amerikanischer Arbeiter, dazu noch in einem Krieg, der nicht in ihrem Interesse wäre. Während sie schon im 1. Weltkrieg den Kampf gegen den Krieg als eine Ablenkung vom Klassenkampf verworfen hatte, vermochte sie im II. Weltkrieg auch keine revolutionäre Alternative anzubieten, außer der IWW beizutreten.
In einem Artikel vom 6. Jan. 1940 stand: "Den kapitalistischen Kriegen muß man entgegentreten, ebenso müssen alle Ausbeutungssysteme, aus denen die Kriege hervorgehen, zerstört werden. Für die Verwirklichung dieser Aufgabe sind Industrieorganisationen nötig, wo sich die Arbeiterklasse in einem Verband zusammenschließt. Tretet jetzt der IWW bei". Die kriegsfeindlichen Reden der IWW wurden aber ständig durch zweideutige Äußerungen untergraben. F. Thompson schrieb: "Während der 1930er und 1940er Jahre stieß man oft auf das Argument, daß eine bloße militärische Niederlage des Faschismus nicht dessen Auslöschung bedeuten würde, da seine Wurzel in den wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen des Kapitalismus liegen und diese ausgerissen werden müßten..," Natürlich beinhaltete solch eine Formulierung eine kritische Unterstützung der militärischen Niederlage des Faschismus und des damit verbundenen Kriegs.
Die Handlungen der IWW während des Krieges verdeutlichen das klägliche Scheitern des "Widerstandes" des "revolutioräen Unionismus". Die IWW, angeblich Verteidiger internationalistischer Prinzipien und proletarischer Zusammengehörigkeit, schrieben in einem Artikel am 20. Dez. 1941 mit dem gleichen rassistischen Propagandaslogan der Bourgeoisie "Japanische Militaristen führen den Krieg mit Waffen, die von amerikanischen Profitsüchtigen geliefert werden". Der Artikel nahm frühere Waffenlieferungen an Deutschland und Japan unter Beschuß, die "trotz heftiger Proteste der Arbeiterbewegung gegen die Politik der Bewaffnung feindlicher Nationen" durchgeführt worden seien. Der Artikel erwähnt einen Streik amerikanischer Hafenarbeiter, die sich im Okt. 1940 weigerten, Benzin nach Japan zu verschiffen. Die IWW schrieben, "daß als Folge dieser normalen Beziehungen mit den Aggressoren die Arbeiter in den USA, die unter dem Kriegsgewicht zu leiden hätten, nun Hunderte von Millionen zusätzlicher Arbeitsstunden zu leisten hätten, um nach Japan geschickte Güter wieder zu ersetzen". Das war das härteste an Kritik, das die IWW am amerikanischen Kriegseintritt zu erklären hatte, wobei es ein Krieg war, dem sie sich entgegenstellen wollte. Dem privaten Kapital wird vorgeworfen, bei den Kriegsvorbereitungen zu geizig gewesen zu sein. Sie beklagen sich über die Überstunden, die erforderlich sein werden, um die den amerikanischen Kriegsgegnern gelieferten Güter wieder zu produzieren. Damit teilte sie die Weltbourgeoisie in Angreifer- und angegriffene-Nationen, was genau das Ziel der bürgerlichen Kriesgmobilisierungskampagnen war. Sie bemängelte die Kriegslasten, die die Arbeiterklasse zu tragen hätte, von dem Widerstand gegen den Krieg war aber nie die Rede! Im Jan. 1942 prophezeite ein Artikel von J. Ebert, dem Führer der IWW, daß ein Sieg der Alliierten nicht "die Probleme der Allierten oder die des Fernen Ostens aus der Welt schaffen würde.. .Diese inländischen und ausländischen Probleme werden gar noch zunehmen, wenn der Sieg einmal sichergestellt ist". Jedoch schloß Ebert ebenso sdunell "revolutionäre'" Schlußfolgerungen daraus aus, als er betonte, "wir schreiben dies nicht, um die Moral der Truppen zu schwächen oder die Einberufungen zu behindern." Soweit also zum berühmten Widerstand der IWW gegen den 2. Weltkrieg. Während des II. Weltkriegs konnten die IWW ungestört weiter wirken. Die Regierung beschränkte ihren Aktionsradius nicht; das zeichnet ein entsprechendes Bild von der Gefahr, die von ihnen ausging. Häufig berufen sich Wobblies auf die von ihnen erreichte "Errungenschaft", daß "freiwillige Soldaten oder Zwangsrekrutierte nach Rückkehr aus der Armee Wiedereinstellungsansprüche hatten auf ihren früheren Arbeitsplätzen" (Thronpson) . Während Wobblies im 1. Weltkrieg wegen Antikriegspropaganda hingerichtet wurden, bestand der Widerstand der IWW im 2. Weltkrieg in dem Kampf um Wiedereinstellungsansprüche nach dem Militärdienst. Solch eine Forderung stellte keine Bedrohung für die Kriegsanstrengungen dar. Im Gegenteil, sie begünstigte die Kriegsmobilisierungen, weil dadurch der Widerstand der Arbeiter, ihre Arbeit und Familien aufzugeben, gesenkt wurde. Es handelte sich um ein Versprechen, daß die Arbeiter, nach dem sie überall auf der Welt andere Arbeiter in Uniform massakriert hätten, und falls sie Glück genug hätten lebendig nach Hause zurückzukehren, ihre alte Arbeit zurückbekommen würden.
Die Haltung der Wobblies im 2. Weltkrieg steht im krassen Gegensatz zu den revolutionären, defätistisdien Postionen der Rätekommunisten in Holland, der Italienischen und Französischen Linken in Frankreich, die ungeachtet ihrer geringen zahlenmäßigen Größe den revolutionären proletarischen Prinzipien treu blieben. Diese Genossen riskierten ihr Leben, als sie z.B. Flugblätter verteilten, in denen sie Arbeiter in Uniform zur Verbrüderung aufriefen, sie aufforderten, die Gewehre gegen die eigenen Bourgeoisie richten, anstatt sich gegenseitig zu massakrieren, Diese Haltung hat ihren Ursprung in dem unterschiedlichen politischen Weg, der während der revolutionären Welle von 1917-23 eingeschlagen wurde.
Wie stark die Wobblies im Verfall begriffen waren, beweisen auch ihre Versuche während vieler Gerichtsprozesse im Laufe des 2. Weltkrieges zu untermauern, daß sie keine "subversive" Organisation waren. Als 1949 die staatlichen Behörden die Wobblies auf die Liste der subversiven Organisationen setzten, verlangten die IWW "Beweise" und Aufklärung darüber, weshalb dies geschehen sei. Im Gegenzug betonten die IWW, daß sie keine Bedrohung für den bürgerlichen Staat darstelle,und da wie wir gesehen haben, und da sie, wie wir gesehen haben, die revolutionären Prinzipien verwarfen, hatten sie natürlich recht!
Aber die Aufgabe früherer Prinzipien blieb da nicht stehen. 1940 wurde in Cleveland das System des "closed shop" eingeführt. Dies beinhaltet Thompson, dem IWWHistoriker zufolge ein Siebsystem, mit Hilfe dessen Arbeiter, die keine bedingungslosen Unterstützer der IWW sind, bei Konflikten mit den Bossen alleine dastehen werden, weil die IWW ihnen Hilfe versagen. Diese diskriminierende Praxis wird von allen Gewerkschaften praktiziert, um so Disziplin in den Reihen der Arbeiter aufrechtzuhalten und Unruhestifter loszuwerden, die , weil sie ohne Rückendeckung der Gewerkschaften, von den Bossen entlassen werden können. In Cleveland organisierten die IWW ebenfalls während des Krieges ein. "Share the Ride Program" (Mitfahrerprogramm). Als Straßenbahnrahrer einen illegalen Streik ausrufen wollten, um sich gegen die Stadtverwaltung durchzusetzen und dabei die IWW um Unterstützung baten, gerieten die Wobblies in Verlegenheit wegen ihres "Mitfahrerprogramms", das nämlich als ein Str-eikbrecherprogramm erscheinen konnte. Die IWW "lösten das Problem", indem sie den Straßenbahnfahrern vorschlugen, anstatt zu streiken, sollten sie weiterhin die Bahnen fahren aber keine Fahrpreise kassieren. Ein weiteres Beispiel für die "revolutionäre" gewerkschaftliche Aktivität.
In der Zeit des 2. Weltkriegs wurde die IWW wurden nur noch zu einem bloßen Schatten von dem, was sie einmal war. Sie existierte von da an nur noch als anarcho-syndikalistische Sekte, die den Mythos ihrer Vergangenheit aufrechterhielt und dabei gleichzeitig als verwirrender Pol für Militante wirkte, die den Stalinisus und die anderen Gruppen der Extremen Linke verwürfen. So trugen Wobblies in den 50er Jahren bei Demos Spruchbänder mit der Aufschrift: "Kapitalismus nein, Stalinismus nie!", als ob der Stalinismus keine Form des Kapitalismus sei, sondern gar etwas Schlimmeres, oder umgekehrt, als ob die Fassade der "Demokratie" im Westen besser sei als der Stalinismus.
DIE IWW HEUTE UND MORGEN
Heute legen die Wobblies Wert darauf sich als Gewschaft darzustellen; in einigen Betrieben können sie auch bei Verhandlungen im Namen der Arbeiter sprechen. Die gegenwärtigen Aktivitäten und ihre Literatur geben klar zu erkennen, daß es sich heute um eine Organisation handelt, die in dem Sumpf der halb-linken Gruppen stecken geblieben sind, die die Führung der AFL-CIO kritisiert, aber diese Organisationen nicht als kapitalistische Agenten denunziert, wie das seinerzeit die IWW gegenüber der AFL tat (d.h. zu Beginn des Jahrhunderts). Sie unterstützen heute die "gewerkschaftliche Reformbewegung", die Pazifisten und nationalen Befreiungsbewegungen in der 3. Welt. Die IWW stellten sich voll hinter Solidarnosc, als diese Gewerkschaft 1980 gegründet wurde.
Das, was die IWW innerhalb des Sumpfs der Linken unterscheidet,ist ihre Ideologie des Anarchismus und der "revolutionären Gewerkschaftsarbeit"; d.h. zwei Aspekte, die der Arbeiterklasse während der letzten 65 Jahre keineswegs weitergeholfen haben.
In Anbetracht des Gewichts der Konterrevolution, des Triumpfes des Stalinismus in Rußland, des Verrats der ehemaligen Arbeiterparteien „die allemal zu einem grossen Misstrauen gegenüber revolutionären Organisationen und dem Marxismus geführt haben, stellt eine Organisation wie die IWW, so politik-, Partei, Marxisinusfeindlich wie sie ist, eine große Gefahr für die Entwicklung einer revolutionären Bewegung dar. Die IWW stützt sich auf die Konfusionen und das Mißtrauen gegenüber politischen Organisationen und kann nur als Hindernis in dem Prozeß der revolutionären Bewußtseinsentwicklung wirken. Je mehr sich der Klassenkampf entwickelt, und je deutlicher die zynische -Rolle der gewerkschaftlichen Basisaktivisten wird, desto mehr wird der Kapitalismus von der Hilfe der Linken abhängen, um die Arbeiterkämpfe zu sabotieren.
Dieser Rückblick auf die Geschichte der IWW verdeutlicht, daß die Wobblies an jedem kritischen Scheideweg in der Geschichte der Arbeiterklasse seit dem 1. Weltkrieg die falsche Entscheidung getroffen haben. Die Glanztage der IWW gab es in der Endphase des aufsteigenden Kapitalismus,als der revolutionäre Syndikalismus einen Ausweg zu bieten schien. Aber der Eintritt des Kapitalismus in den Zeitraum seiner Dekadenz änderte die materiellen Bedingungen des Klassenkampfs.
Die IWW waren seit jeher eine zutiefst konfuse Organisation. Ihr Kennzeichen ist die Verwerfung der Notwendigkeit der Partei, der Räte, der Diktatur des Proletariats, der Politik und des Marxismus, ihr Festhalten an dem Glauben an einen industriellen Unionismus in einem Zeitraum, wo die Gewerkschaften nicht mehr den Interessen der Arbeiter dienen können. Der IWW blieb es erspart, in den kapitalistischen Staat integriert zu werden, weil ihnen dieser Schritt als inkonsequente Organisation zu konsequent war. Heute lebt sie nur noch als Sekte mit dem Potential, in Zukunft den Interessen des Kapitals als eine parteifeindliche, anti-marxistische, an der gewerkschaftlichen Basis aktive Organisation zu dienen. Für revolutionäre Militanten bietet sie keine Perspektive. J. G. (aus Internationalism, Zeitung der IKS in den USA)
Politische Strömungen und Verweise:
IKSonline - 2007
- 3284 reads
Januar 2007
- 807 reads
Arbeiteraristokratie: Ursprung einer Mystifikation
- 3002 reads
In dem Artikel "Die Arbeiteraristokratie: eine soziologische Theorie, um die Arbeiterklasse zu spalten" (siehe INTERNATIONALE REVUE Nr. 7, erhältlich bei der Kontaktadresse) zeigten wir auf, daß die Theorie der Arbeiteraristokratie "auf einer soziologischen Untersuchung, die das historische Klassenwesen des Proletariats außer Acht läßt, beruht" (S. 26) und "daß die praktische Schlußfolgerung dieser Auffassung automatisch zu einer Spaltung der Arbeiter in ihren Kämpfen, zur Isolierung der "meist ausgebeuteten" Arbeiter vom Rest der Klasse führt" (S.26)
In diesem Artikel wollen wir die Fehler der ökonomischen Prämissen dieser Theorie verdeutlichen. Alle Versionen dieser Theorie stützen sich ausdrücklich oder unausgesprochen auf eine Variante des Lassallschen "eisernen Lohngesetzes", d.h. auf der falschen Auffassung, daß der Wert der Arbeitskraft einfach dem physiologischen Minimum für das Überleben eines Arbeiters gleichgesetzt werden kann. Für die Verteidiger der Theorie der Arbeiteraristokratie kann irgendein dauerhafter Anstieg der Löhne über dieses physiologische Minimum nur durch die Tatsache erklärt werden, daß die Arbeiter etwas von den Extraprofiten der Kapitalisten mit abbekommen, die aus den arbeitenden Massen in den Kolonien und Halbkolonien herausgepreßt werden. Diese Auffassung, derzufolge die Arbeiter, deren Löhne ein gewisses natürliches Minimum übersteigen, nicht aus den Töpfen des variablen Kapitals sondern aus dem Mehrwert bezahlt werden, derzufolge auch die Arbeitermassen in der fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaft und die Arbeiter der modernen Industriezweige in den rückständigen Ländern die Bundesgenossen der Kapitalisten bei der Plünderung der kolonialen Massen sind, ist eine zutiefst reaktionäre und arbeiterfeindliche Theorie. Der Marxismus lieferte schon vor langer Zeit eine niederschmetternde Widerlegung des gesamten Netzes der kleinbürgerlichen Theorien und Vorurteile, die die Verteidiger der Theorie von der Arbeiteraristokratie als wissenschaftliche Theorie darzustellen versuchen. Bei all ihrem Enthusiasmus für das Aufstöbern von Zitaten - egal in welchem Zusammenhang sie geschrieben wurden -, wo Engels oder Lenin von einer Arbeiteraristokratie sprechen, lassen die gegenwärtigen Vertreter dieser Theorie absichtlich die ökonomischen Schriften von Marx (Grundrisse, Kapital, Theorien über den Mehrwert) außer Acht, wo nämlich die Funktionsweise des Wertgesetzes, das die einzige Grundlage für das Begreifen der Lohnbewegungen im Kapitalismus ist, erklärt wurde. Unsere eigenen Ausführungen werden die Form eines auf der Marxschen Analyse aufbauenden aber notwendigerweise kurzen Umrisses der Elemente annehmen, die wirklich den Wert der Ware Arbeitskraft bestimmen, sowie der verschiedenen Faktoren, die eine Wertminderung oder -steigerung derselben beeinflussen.. Weiterhin werden wir die eigentliche Lohnbewegung in den verschiedenen Phasen der kapitalistischen Gesellschaft untersuchen.
Im ersten Band des Kapitals zeigte Marx auf, daß "der Wert der Arbeitskraft der Wert für die Subsistenzmittel ist, die für die Aufrechterhaltung der Arbeitskraft des Lohnarbeiters erforderlich ist". Jedoch können diese notwendigen Subsistenzmittel, von denen Marx spricht, nicht auf irgendein physiologisches Mindestmaß reduziert werden, das notwendig wäre, um das Leben eines Arbeiters als ein biologischer Organismus sicherzustellen. Sie müssen ausreichen, um ihn in seinem normalen Zustand als Arbeiter am Leben zu halten, d.h. in einem Zustand, wo er fähig ist für das Kapital Mehrwert zu produzieren. Diese Tatsache weist auf den historisch variablen Charakter des Wertes der Arbeitskraft hin, da:"der Umfang sog. notwendiger Bedürfnisse, wie die Art ihrer Befriedigung, selbst ein historisches Produkt (ist und sie) hängt daher großenteils von der Kulturstufe eines Landes, unter andrem auch wesentlich davon ab, unter welchen Bedingungen, und daher mit welchen Gewohnheiten und Lebensansprüchen die Klasse der freien Arbeiter sich gebildet hat. Im Gegensatz zu den anderen Waren enthält also die Wertbestimmung der Arbeitskraft ein historisches und moralisches Element" (K. Marx, "Das Kapital", Erster Band, MEW 23, S. 185). Das einzigartige Wesen der Arbeitskraft als Ware liegt daher nicht nur in ihrer Fähigkeit, mehr Wert zu produzieren als sie besitzt, also einfach einen Mehrwert zu produzieren, sondern ebenso in der Tatsache, daß ihr eigener Wert "selber keine fixe, sondern eine variable Größe ist, selbst die Werte aller andern Waren als gleichbleibend unterstellt"(K. Marx, "Lohn, Preis und Profit", MEW Bd. 16, S. 148).
Bei der Bestimmung dessen, was eigentlich die für die Arbeiter zu einem gegebenen Zeitpunkt und an einem Ort erforderlichen Subsistenzmittel sind, ist dieses "historische und moralische Element", das Marx betont, von größerer Bedeutung als das physiologisch notwendige Element. Einer der Hauptfaktoren, der den Verlauf der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft auszeichnet, ist das, was Marx als den Rückzug oder Senkung der natürlichen Grenzen im Arbeitsprozeß bezeichnete. Damit meinte Marx das abnehmende Gewicht der natürlichen Bedingungen im Produktionsprozeß und die immer größere Sozialisierung der Produktionsaktivitäten - diese Entwicklung wurde bislang vom Kapitalismus auf die höchste Stufe getrieben. Jedoch kann dieses Absinken der natürlichen Grenzen ebenso in der Produktion und der Reproduktion der Arbeitsfähigkeit der Arbeiterklasse gesehen werden. Die Befriedigung grundsätzlich physiologischer Bedürfnisse - die das Kennzeichen der arbeitenden Massen in der vorkapitalistischen Gesellschaft war, z.B. Sklaven, Leibeigene usw. - verliert proportional als Faktor bei der Aufrechterhaltung der Arbeiterklasse an Gewicht, und ein noch größerer Teil der Produktion und Reproduktion der Arbeitskraft des Proletariats in der kapitalistischen Gesellschaft befaßt sich mit der Befriedigung der Bedürfnisse, die aus der zunehmenden Vergesellschaftung der Produktion hervorgehen. Diese Bedürfnisse schließen ein: das allgemeine Bildungsniveau, das heute selbst ein einfacher Arbeiter erreichen muß, um Mehrwert unter den Bedingungen der hohen Produktivität des Arbeitsprozesses abzuwerfen; das Radio, Fernsehen, Kinos, Urlaub usw. Sie sind alle zu einem notwendigen Bestandteil der Aufrechterhaltung der Arbeitskraft unter den gegenwärtigen Bedingungen der intensiven Arbeit geworden. Weiter zählen dazu die Diäten und die medizinische Versorgung, die unabdingbar sind, wenn der Arbeiter 40 Jahre in der Fabrik schuften muß - und das ist das Normale in der modernen Industrie; sowie eine ganze Reihe anderer sozialer Bedürfnisse, auf die wir hier nicht näher eingehen können. Mit anderen Worten: der Wert der Arbeitskraft eines Arbeiters kann auf keinen Fall einfach mit der Größe gleichgesetzt werden, die für die Befriedigung seiner rein natürlichen Bedürfnisse erforderlich ist. "Der wirkliche Wert seiner Arbeitskraft weicht von diesem physischen Minimum ab; er ist verschieden je nach dem Klima und dem Stand der gesellschaftlichen Entwicklung; er hängt ab nicht nur von den physischen, sondern auch von den historisch entwickelten gesellschaftlichen Bedürfnissen, die zur zweiten Natur werden" (K. Marx, "Das Kapital", Dritter Band, MEW Bd. 25, S. 866).
Dieses physiologische Minimum stellt in Wirklichkeit nur die untere Grenze des Werts der Arbeitskraft eines Arbeiters dar, die obere Grenze dagegen wird durch den "traditionellen Lebensstandard" gebildet."Er betrifft nicht das rein physische Leben, sondern die Befriedigung bestimmter Bedürfnisse, entspringend aus den gesellschaftlichen Verhältnissen, in die die Menschen gestellt sind und unter denen sie aufwachsen" (K. Marx, "Lohn, Preis und Profit", MEW Bd. 16,S. 148). Die Größe dieser historisch variablen Obergrenze, der eigentliche Wert der Ware Arbeitskraft zu einem gegebenen Zeitpunkt und an einem gegebenen Ort, hängt selbst stark von 3 Faktoren ab: der Akkumulationsrate des Kapitals, der Größe der industriellen Reservearmee, der Stärke des Klassenkampfes. Das komplexe Zusammenwirken dieser 3 Faktoren bestimmt das eigentliche Lohnniveau,und wir sollten in Erinnerung behalten, daß dauerhafte Änderungen des Lohnniveaus, d.h. des Preises der Arbeitskraft, eine Änderung ihres Wertes darstellen.
Marx schrieb:"Die Größe der Akkumulation ist die unabhängige Variable, die Lohngröße die abhängige, nicht umgekehrt" ("Das Kapital", Erster Band, MEW 23, S. 648).
Wenn der Umfang der Kapitalakkumulation schnell anwächst, m.a.W. wenn die Mehrwertrate ansteigt, werden neue Märkte für die Realisierung des Mehrwertes geöffnet und somit neue Sphären für die Kapitalisierung des Mehrwertes zur Verfügung stehen, der objektiven ökonomischen Grundlage für einen Anstieg der Reallöhne.
Bevor wir die eigentliche Beziehung zwischen Akkumulation und Löhnen untersuchen, ist es wichtig darauf hinzuweisen, daß wir es bei der Berücksichtigung des Mehrwertes und der Reallöhne nicht mit einer festgesAtzten Größe zu tun haben, sondern eher mit elastischen Größen. Sowohl der Mehrwert als auch die Reallöhne können gleichzeitig ansteigen und auch im gleichen Verhältnis zueinander sich erhöhen. Somit bedeutet ein Anstieg der Reallöhne nicht unbedingt eine Senkung der Masse der Mehrwertrate - historisch gesehen war das auch fast nie der Fall. Deshalb schließt Marxens absolut richtige Schlußfolgerung, wo er sagte,"die Erhöhung des Arbeitspreises bleibt also eingebannt in Grenzen, die die Grundlagen des kapitalistischen Systems nicht nur unangetastet lassen, sondern auch seine Reproduktion auf wachsender Stufenleiter sichern" (K. Marx, "Das Kapital", Erster Band, MEW Bd 23, s. 649), einen dauerhaften Anstieg der Reallöhne nicht aus, vorausgesetzt die Akkumulation nimmt sowohl in ihrem Umfang als auch in ihrem Rythmus zu.
Im Kapital untersuchte Marx auch die Änderungen der Höhe der Preise der Arbeitskraft und des Mehrwerts. Er bewies, daß eine Änderung der Löhne aber auch des Mehrwertes durch die Veränderung der Länge des Arbeitstages, der Intensität und Produktivität der Arbeit hervorgebracht werden könnten. Bei all diesen Fällen zeigte Marx die Möglichkeit eines gleichzeitigen Anstiegs der Reallöhne und der Rate und Masse des Mehrwerts auf. Die Ausdehnung des Arbeitstages kann offensichtlich zu einer Erhöhung des aus den Arbeitern gepreßten Mehrwertes führen, aber auch zu einer Erhöhung der Reallöhne.
"Da das Wertprodukt, worin sich der Arbeitstag darstellt, mit seiner eignen Verlängerung wächst, können Preis der Arbeitskraft und Mehrwert gleichzeitig wachsen, sei es um gleiches oder ungleiches Inkrement (Zunahme)" (K.Marx,"-Das Kapital", Erster Band, MEW
Bd. 23,S. 549).
Ein ähnliches Ergebnis kann erzielt werden, wenn aie Arbeitsintensität erhöht Wird."Wachsende Intensität der Arbeit unterstellt vermehrte Ausgabe von Arbeit in demselben Zeitraum. Der intensivere Arbeitstag verkörpert sich daher in mehr Produkten als der mnnder intensive von gleicher Stundenzahl...Bei gleichbleibender Stundenzahl verkörpert sich also der intensivere Arbeitstag in höherem Wertprodukt. . .Es ist klar: Variiert das Wertprodukt des Arbeitstages, ... so können beide Teile dieses Wertprodukts, Preis der Arbeitskraft und Mehrwert, gleichzeitig wachsen, sei es in gleichem oder ungleichem Grad"(K. Marx, "Das Kapital",
Erster Band, MEW Bd 23, s. 547). Während in beiden der oben erwähnten Fälle ein dauerhafter Anstieg der Reallöhne zu einer Erhöhung des Wertes der Arbeitskraft führen kann, ist es ebenso möglich, daß der Wert der Arbeitskraft fällt, selbst wenn ihr Preis steigt. Dies kann entweder im Falle einer Ausdehnung des Arbeitstages geschehen oder durch eine Intensivierung der Arbeit, Weil "die Preiserhöhung der Arbeitskraft ihren beschleunigten Verschleiß nicht kompensiert" (K. Marx, "Das Kapital", Erster Band, MEW Bd 23, S. 547).
Obgleich ein Anstieg der Arbeitsproduktivität immer ein Sinken des Wertes der Arbeitskraft mit sich bringt, ist es ebenso vereinbar mit einem Anstieg des Lebensstandard der Arbeiter. "Wechsel in der Produktivkraft der Arbeit, ihre Zunahme oder Abnahme,wirkt'in umgekehrter Richtung auf den Wert der Arbeitskraft und in direkter auf den Mehrwert" (K. Marx, "Das Kapital", Erster Band, MEW Bd. 23, S. 543). Wenn somit die Produktivität der Arbeit ansteigt, steigt ebenso der Mehrwert an, während der Wert der Arbeitskraft sinkt. Dies bedeutet jedoch nicht ein Sinken der Reallöhne, ein Verschlechtern des Lebensstandards, der gar ansteigen kann. "Der Wert der Arbeitskraft ist bestimmt durch den Wert eines bestimmten Quantums von Lebensmitteln. Was mit der Produktivkraft der Arbeit wechselt, ist der Wert dieser Lebensmittel, nicht ihre Masse. Die Masse selbst kann, bei steigender Produktivität der Arbeit, für Arbeiter und Kapitalist gleichzeitig und in demselben Verhältnis wachsen ohne irgendeinen Größenwechsel zwischen Preis der Arbeitskraft und Mehrwert" (K. Marx, "Das Kapital", Erster Band, MEW Bd. 23, S. 545).
Aber egal wie groß der Umfang der Akkumulation auch ist, das Kapital gesteht nie aus eigener Initiative reale Lohnerhöhungen zu. In Wirklichkeit bringt die Steigerung der Akkumulation des Kapitals, die die objektive Basis für eine Erhöhung der Reallöhne schafft, ebenso eine entgegengesetzte Tendenz zum Vorschein, die jede Erhöhung des Lebensstandards der Arbeiter beschränkt und eingrenzt. "Je größer der gesellschaftliche Reichtum, das funktionierende Kapital, Umfang und Energie seines Wachstums, also auch die absolute Größe des Proletariats und die Produktivkraft seiner Arbeit, desto größer die industrielle Reservearmee ... Je größer aber diese Reservearmee im Verhältnis zur aktiven Arbeiterarmee, desto massenhafter die konsolidierte Überbevölkerung, deren Elend im umgekehrten Verhältnis zu ihrer Arbeitsqual steht. Je größer endlich die Lazarusschichte der Arbeiterklasse und die industrielle Reservearmee, desto größer der offizielle Pauperismus. DIES IST DAS ABSOLUTE, ALLGEMEINE GESETZ DER KAPITALISTISCHEN AKKUMULATION. Es wird gleich allen anderen Gesetzen in seiner Verwirklichung durch mannigfache Umstände modifiziert ..."(K. Marx, "Das Kapital", Erster Band, MEW 23, s. 673). Insbesondere die Veränderungen bei der Funktionsweise dieses spezifischen Gesetzes, das Maße, in dem die Reservearmee unter bestimmten Bedingungen zunimmt oder sinkt, bestimmen das Ansteigen oder Sinken der Reallöhne (und des Wertes der Arbeitskraft). "Im grossen und ganzen sind die allgemeinen Bewegungen des Arbeitslohnes ausschließlich reguliert durch die Expansion und Kontraktion der industriellen Reservearmee, welche dem Periodenwechsel des industriellen Zyklus entsprechen" (K. Marx, "Das Kapital", Erster Band, MEW 23, S. 666).
Während die Ausdehnung der Reservearmee das Steigen der Reallöhne hemmt - obgleich ihr Schrumpfen solch eine Erhöhung begünstigt - (was immer von der Akkumulationsrate abhängt),ist der ausschlaggebende Faktor für das wirkliche Ansteigen oder Sinken der Löhne das Niveau des Klassenkampfes. Nur durch den Rückhalt eines kämpferischen Klassenkampfes kann das Proletariat dem Kapital eine größere Masse an Subsistenzmitteln abzwingen, die es durch seine eigene Arbeit geschaffen hat. Jedoch wird das Niveau des Klassenkampfes selber durch die globalen Bedingungen des Akkumulationsprozesses und die Größe der Reservearmee beeinflußt.
Wir können nun dazu übergehen, auf die tatsächliche Entwicklung der Löhne sowohl während der aufsteigenden als auch während der dekadenten Phase des Kapitalismus einen Blick zu werfen, um die.Gründe für die Reallohnsteigerungen aufzudecken, die zeitweilig stattgefunden haben. Es gibt vor allem 3 Zeiträume, mit denen wir uns gesondert befassen müssen, weil die Löhne damals wirklich lange anstiegen.
Zunächst in Europa von 1850 bis 1913, dem Höhepunkt der aufsteigenden Phase des Kapitalismus. Zweitens in den Siedlerkolonien wie die USA, Kanada, Australien, wo während der gesamten Phase des aufsteigenden Kapitalismus selbst während des I. Weltkrieges und gar bis zum Ausbruch der Wirtschaftskrise von 1929 die Löhne real anstiegen. Drittens der Zeitraum des Wiederaufbaus in den fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaften, der sich dem 2. Weltkrieg anschloß und bis 1967 dauerte. In den ersten beiden Fällen kam es zu einem enormen Anstieg des Wertes der Arbeitskraft, und im 3. Fall ist der Anstieg des Wertes der Arbeitskraft etwas fragwürdiger - obgleich der Preis der Arbeitskraft zweifellos anstieg (ganz zu schweigen von der zeitlich engen Begrenzung dieses Phänomens).
Wir werden als Beispiel England nehmen, um die Lohnentwicklung während des Höhepunktes des aufsteigenden Kapitalismus zu verfolgen, weil England das klassische Beispiel. einer fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaft während der damaligen Zeit war, und weil die Theoretiker der Arbeiteraristokratie es als einen Beweis für ihre Ideen betrachten. Die Löhne entwickelten sich zwischen 1789 und 1900 folgendermaßen:
Reallöhne (1900 = 100)
1789-98 58 1859-68 63
1809-18 43 1869-79 74
1820-26 47 1880-86 80
1849-58 57 1887-95 91
1895-1903 99
(Jürgen Kuczynski, "A Short History of Labour Conditions Under Industrial Capitalism in Great Britain and the Empire", 1944, S. 68)
Während der Phase der primitiven Akkumulation (ca. 1789 -1826) führten die Auswirkungen der Landflucht zu der Schaffung einer massiven Reservearmee, welche den Klassenkampf stark einengte und eine Senkung der Reallöhne mit sich brachte.
,Erst ab 1858 erreichten die Reallöhne erneut den Stand von 1789. Von 1858 bis 1900 stiegen die Reallöhne enorm an, was zu einer bedeutsamen Erhöhung des Wertes der Arbeitskraft führte. Eine Reihe von Faktoren spielten dabei eine entscheidende Rolle. Die Akkumulationsrate
stieg sehr schnell an, verbunden mit einem noch nie dagewesenen Anstieg der Arbeitsproduktivität und der Arbeitsintensität, wodurch so das bis dahin am häufigsten verwendete Mittel der Verlängerung des Arbeitstages durch den Anstieg der Arbeitsproduktivität ersetzt wurde. Dies schuf im Zusammenhang mit der schnellen Ausdehnung der Kolonialmärkte aufgrund der weltweiten Ausdehnung des britischen Imperialismus die Basis für die Beschäftigung eines immer größer werdenden Teiles der Reservearmee in der Metropole. Dies fiel mit dem Ende der Phase der primitiven Akkumulation und der Verarmung der Landbevölkerung zusammen, was bedeutete, daß die überflüssige Bevölkerung nicht mehr so schnell anwuchs wie vorher. Weiterhin schufen die endlosen Möglichkeiten der Auswanderung in die Siedlerkolonien zusätzliche "Abzugswege", dies beschränkte zugleich die Größe der Reservearmee. All dies schuf optimale Bedingungen für das Proletariat, um einen wirkungsvollen Kampf um höhere Löhne und Reformen zu führen. Dieses Zusammenspiel zwischen einer besonders schnellen Akkumulationsrate, dem zeitweiligen Rückgang der Reservearmee und der großen Kampfbereitschaft der Arbeiter erklärt den Anstieg des Wertes der Arbeitskräfte während jenes Zeitraums.
In den Siedlerkolonien (USA, Kanada, Australien usw.) beruhte der Anstieg des Wertes der Arbeitskraft, der natürlich letzten Endes durch den Klassenkampf,-des Proletariats selber herbeigeführt wurde, auf der unabdingbaren Vorbedingung der gewaltigen Akkumulation und zuvorderst auf dem fast vollständigen Fehlen einer Reservearmee (praktisch bis fast nach dem 1. Weltkrieg). Dieser letztgenannte Faktor wurde von Marx als der Schlüssel für das Begreifen der Gründe für die hohen Reallöhne in diesen Ländern hervorgehoben:
"Was die Grenzen des Werts der Arbeit angeht,so hängt seine faktische Festsetzung immer von Angebot und Nachfrage ab ...In Kolonialländern begünstigt das Gesetz von Angebot und Nachfrage den Arbeiter. Daher der relativ hohe Lohnstandard in den Vereinigten Staaten. Das Kapital kann dort sein Äußertes versuchen. Es kann nicht verhindern, daß der Arbeitsmarkt ständig entvölkert wird durch die ständige Verwandlung von Lohnarbeitern in unabhängige, selbstwirtschaftende Bauern. Die Tätigkeit eines Lohnarbeiters ist für einen sehr großen Teil des Amerikanischen Volks nur eine Probezeit, die sie sicher sind, über kurz oder lang durchlaufen zu haben" (K. Marx, "Lohn, Preis und Profit", MEW Bd. 16, S. 149).
Die Abwesenheit einer größen überflüssigen Bevölkerung bedeutete aufgrund der Verfügbarkeit von billigem Land, daß das Kapital in diesen Ländern insbesondere davon abhängig war, die Arbeitsproduktivität als ein Mittel der Auspressung des Mehrwerts zu erhöhen. Dies schuf gar noch günstigere Bedingungen für die Akkumulation, weil die objektive ökonomische Basis für den Anstieg des Wertes der Arbeitskraft erweitert wurde.
Der Anstieg der Reallöhne während der Wiederaufbauphase nach dem 2. Weltkrieg fölgte einem starken Rückgang des Lebensstandards des Proletariats, der mit dem Ausbruch deroffenen Krise im Jahre 1929 begonnen hatte. Die durcf den Krieg verursachte massive Zerstörung von überschüssigem Kapital schuf die ökonomische Basis für einen Zeitraum des Wiederaufbaus während dessen die Akkumulation bedeutend zunahm.Dieser wachsenden Akkumulation müssen die Auswirkungen einer bis dahin unerreichten Zerstörung der "überschüssigen Bevölkerung" durch das imperialistische Abschlachten hinzugefü¢ werden, die zu einer Abnahme der Reservearmee während einer langen Zeit führte. Dieses Zusammenwirken von einer zeitweilig schnellen Akkumulationsrate und dem Rückgang der Reservearmee schuf die objektive Grundlage für die während dieser Zeit aufgetretenen Reallohnerhöhungen. Jedoch waren die Verlängerung des Arbeitstages durch obligatorische Überstunden und die mörderischen Beschleunigungen des Arbeitstempos, die die Arbeit bis zum Zerreißen intensivierten, so bedeutend, daß es als fragwürdig erscheint, ob diese Reallohnsteigerung dazu ausreichte, um den Verschleiß der Arbeitskraft unter diesen Bedingungen auszugleichen. Kurzum, es gibt beträchtliche Beweise dafür, daß trotz des zeitweiligen Ansteigens der Reallöhne die Arbeitskräfte unter ihrem Wert, dh. unter den Kosten ihrer Unterhaltung bezahlt wurden.
Nun müssen wir die nationalen Unterschiede bei den Löhnen untersuchen, denn diese Unterschiede dienen den Theoretikern der Arbeiteraristokratie zum großen Teil als Argument für die Behauptung, daß die höheren Löhne in den fortgeschrittenen Ländern die Krümel von den Extraprofiten sind, die aus der Arbeit der schlechtbezahlten Massen der Kolonien und Halbkolonien gepreßt werden. Während es vollkommen stimmt, daß die Profitrate in den rückständigen Ländern mit ihrer niedrigen organischen Zusammensetzung des Kapitals höher ist, wird dies durch die viel größere Profitmasse, die durch die produktiven Arbeiter in den fortgeschrittenen Ländern produziert wird, in den Schatten gedrängt, gerade aufgrund der höheren organischen Zusammensetzung (dabei müssen wir die Auswirkungen des Ausgleiches der Profitraten hinzufügen, welche sich zum Nachteil dieser ,Länder auswirken). Was für uns nun am wichtigsten zu berücksichtigen ist, ist die Tatsache, daß die Mehrwertrate, d.h. die Ausbeutungsrate in den fortgeschrittenen Ländern viel größer ist als in den rückständigen. Nur weil die Arbeiter in den am meisten fortgeschrittenenen Ländern am meisten ausgebeutet werden, mehr als sogar ihre Klassenbrüder in den rückständigen Ländern, könnnen ihre Reallöhne höher sein. "Je produktiver ein Land gegen das andere auf dem Weltmarkt, um so höher sind die Arbeitslöhne in ihm, verglichen mit den andren Ländern. Nicht nur der nominelle, sondern der reelle Arbeitslohn in England ist höher als auf dem Kontinent. Der Arbeiter ißt mehr Fleisch, befriedigt mehr Bedürfnisse .... Aber er ist nicht höher im Verhältnis zur Produktivität der englischen Arbeiter" (K. Marx, "Theorien über den Mehrwert", Zweiter Teil, MEW Bd. 26.2, S. 8).
Zu dem höheren Ausbeutungsgrad und der größeren Produktivität der Arbeiter in den Metropolen muß eine besonders wichtige Änderung des Wertgesetzes hinzugefügt werden, die von der folgenden Tatsache herrührt: "Noch mehr aber wird das Wertgesetz in seiner internationalen Anwendung dadurch modifiziert, daß auf dem Weltmarkt die produktivere nationale Arbeit ebenfalls als intensivere zählt" (K. Marx, "Das Kapital", Erster Band, MEW Bd 23, S. 584).
Daher ist die Arbeit der Arbeiter in den Metropolen nicht nur produktiver als die der Arbeiter in den früheren Kolonien, sondern sie schafft ebenso mehr Wert, da sie intensiver ist. Daher bestimmen diese Faktoren zusammen mit der ungeheuren Größe der "überflüssigen" Bevölkerung in den rückständigen Ländern (aufgrund des Einflusses derselben auf das Kräfteverhältnis zwischen dem Proletariat und dem Kapital) und die unterschiedlichen historischen Ergebnisse des Klassenkampfes die sehr niedrigeren Arbeitslöhne (Reallöhne) in den früheren Kolonien und dementsprechend die,-viel höheren Reallöhne in den fortgeschrittenen Ländern. Die Befürworter der Theorie von der Arbeiteraristokratie richten sich ausschließlich auf die Frage der Reallöhne (die sie zudem vollkommen falsch verstehen), und sie lassen die sehr wichtige Frage der relativen Löhne außer acht. Marx wies auf die Bedeutung der relativen Löhne zum Verständnis der Lage der Lohnarbeiter in der kapitalistischen Gesellschaft hin:
"Aber weder der nominelle Arbeitslohn, d.h. die Geldsumme, wofür der Arbeiter sich an den Kapitalisten verkauft, noch der relle Arbeitslohn, d.h. die Summe Waren, die er für dies Geld kaufen kann, erschöpfen die im Arbeitslohn enthaltnen Beziehungen. Der Arbeitslohn ist vor allem noch bestimmt durch sein Verhältnis zum Gewinn, zum Profit des Kapitalisten- verhältnismäßiger, relativer Arbeitslohn. Der relle Arbeitslohn drückt den Preis der Arbeit im Verhältnis zum Preis der übrigen Waren aus, der relative Arbeitslohn dagegen den Anteil der unmittelbaren Arbeit an dein von ihr neu erzeugten Wert im Verhältnis des Anteils davon, der der aufgehäuften Arbeit, dem Kapital, zufällt" (K. Marx, "Lohnarbeit und Kapital", Peking 1969).
Marx zeigte weiterhin auf, daß die relativen Löhne sinken können, während die Reallöhne ansteigen, und daß in diesem Falle folgendes wichtig ist: "Die Macht der Kapitalistenklasse über die Arbeiterklasse ist gewachsen, die-gesellschaftliche Stellung des Arbeiters hat sich verschlechtert, ist um eine Stufe tiefer unter die des Kapitalisten herabgedrückt" (K. Marx, "Lohnarbeit und Kapital", Peking, 1969, S. 38): Genau dies traf im Fall der englischen Arbeiterklasse während des Höhepunktes der aufsteigenden Phase des Kapitalismus zu:
|
Relative Löhne, 1859-1903 (1900 = 100) |
|||
|
Relativer Anteil der Produktion, |
Löhne, Kapitalisten pro |
||
|
Industriekapital Produktion |
|||
|
Löhne |
Kapitalisten |
||
|
1869-79 |
66 |
1iT |
$9 |
|
1880-86 |
83 |
96 |
104 |
|
1887-95 |
96 |
95 |
105 |
|
1895-1903 |
105 |
94 |
106 |
(Kuczynski, ebenda, S. 82)
So erhielt die Arbeiterklasse gar einen kleineren Anteil von dem großen Reichtum, den sie durch ihre eigene Arbeitskraft während dieses Zeitraums geschaffen hatte - wohingegen die Verteidiger der Theorie der Arbeiteraristokratie behaupten, es handele sich um ein korrurnpiertes Werkzeug der Reaktion. Die absolute Unfähigkeit dieser Theoretiker, die Bedeutung der relativen Löhne zu begreifen, hängt mir ihrem Unvermögen zusammen, das eigentliche Wesen des Mehrwerts selber zu begreifen.
Die simplistische Argumentationsweise der Verteidiger der Theorie der Arbeiteraristokratie und ihr Außerachtlassen des Wertgesetzes in der kapitalistischen Gesellschaft tritt somit offen hervor. Die Theorie von der Arbeiteraristokratie mit ihren politischen Schlußfolgerungen ist eine Mystifizierung, die die revolutionären Marxisten entschlossen bekämpfen müssen.
MacIntosh, Aug. 1981
Erstveröffentlichung in Weltrevolution Nr. 7, 1982
Theoretische Fragen:
- Arbeiterklasse [58]
China 1927: Letztes Aufbäumen der Weltrevolution
- 5945 reads
Im März 1927 erhoben sich in Schanghai die Arbeiter in einem erfolgreichen Aufstand; binnen kürzester Zeit übernahmen sie die Kontrolle in der Stadt, gleichzeitig war ganz China in Bewegung geraten. Im April wurde dieser Aufstand von den Kräften Tsching Kai-scheks brutal niedergeschlagen, diesem Tschiang, den die Kommunistische Partei Chinas als den Held der chinesischen "nationalen" Revolution gefeiert hatte. Anläßlich des 60. Jahrestages dieses Aufstandes wollen wir als Revolutionäre die Ereignisse kurz in Erinnerung rufen und die Hauptlehren aus den Kämpfen für die Arbeiterklasse ziehen.
Die Haupttragödie dieses Aufstandes war die Tatsache, daß die Arbeiterklasse in China genauso wie das chinesische Kapital, das zu spät auf dem Weltmarkt auftauchte, in diese Kämpfe gegen das Kapital zu einer Zeit eintrat, als die internationale revolutionäre Welle von Kämpfen, welche aus dem I. Weltkrieg hervorgegangen war, sich schon im Rückzug befand.
Im März 1927 erhoben sich in Schanghai die Arbeiter in einem erfolgreichen Aufstand; binnen kürzester Zeit übernahmen sie die Kontrolle in der Stadt, gleichzeitig war ganz China in Bewegung geraten. Im April wurde dieser Aufstand von den Kräften Tsching Kai-scheks brutal niedergeschlagen, diesem Tschiang, den die Kommunistische Partei Chinas als den Held der chinesischen "nationalen" Revolution gefeiert hatte. Anläßlich des 60. Jahrestages dieses Aufstandes wollen wir als Revolutionäre die Ereignisse kurz in Erinnerung rufen und die Hauptlehren aus den Kämpfen für die Arbeiterklasse ziehen.
Die Haupttragödie dieses Aufstandes war die Tatsache, daß die Arbeiterklasse in China genauso wie das chinesische Kapital, das zu spät auf dem Weltmarkt auftauchte, in diese Kämpfe gegen das Kapital zu einer Zeit eintrat, als die internationale revolutionäre Welle von Kämpfen, welche aus dem I. Weltkrieg hervorgegangen war, sich schon im Rückzug befand.
Der I. Weltkrieg hatte der Entwicklung der chinesischen Industrie einen gewaltigen Auftrieb verliehen. Dadurch war eine zahlenmäßig kleine, aber hochkonzentrierte und furchtbar ausgebeutete Zahl von Proletariern in den Großstädten wie Schanghai, Hangchow und Kanton entstanden. Diese Arbeiter erhoben zum ersten Mal Anfang der 20er Jahre ihre Stirn gegen die Ausbeutung.
Die Erschütterungen des Kapitalismus nach dein I. Weltkrieg zogen aber auch das chinesische Kapital in ihren Sog. Die Zuspitzung der inter-imperialistischen Spannungen und die Spannungen innerhalb der örtlichen bürgerlichen Fraktionen, der Ausbruch von großen Bauernrevolten gegen ein überholtes Grundbesitzsystem und das Auftauchen einer großen kämpferischen Arbeiterklasse stellten den Hintergrund für die Schlüsselperiode der chinesischen Revolution von 1925-27 dar. Aber letztendlich hing der Ausgang der Ereignisse in China 1925-27 nicht von der Situation in China selbst ab, sondern wurde auf Weltebene entschieden.
Russland: Hochburg der Konterrevolution
Die große revolutionäre Welle, die mit der Oktoberrevolution ausgelöst worden war, trat nach 1920 in eine Rückflußphase ein; danach erreichte sie nie mehr ihren ursprünglichen Schwung, trotz der verzweifelten Kämpfe in Deutschland 1921 und 1923, Bulgarien 1923 und China 1925-27. Dieser Rückfluß hatte die tiefstgreifenden und tragischsten Konsequenzen für die ursprüngliche Hochburg der Revolution, Sowjetrußland. Bei dem Versuch, in einer kapitalistischen Welt zu überleben, wurden der russische Staat und die Bolschewistische Partei, die sich mit diesem verschmolzen hatte, schnell zu einem
der Hauptzentren der Konterrevolution. In Rußland selbst führten die Bedürfnisse des Kapitals zur Niederschlagung der Arbeiteraufstände in Petrograd und Kronstadt 1921, der Verfolgung von oppositionellen kommunistischen Fraktionen und zur rücksichtslosen Kapitalakkumulierung auf Kosten der Arbeiterklasse. Auf Weltebene erforderten die gleichen Notwendigkeiten eine zunehmende Unterwerfung der internationalen Revolution unter die Bedürfnisse des russischen Staates, insbesondere seiner Suche nach Bündnissen und wirtschaftlicher Hilfe von dem Rest der kapitalistischen Welt. Gleichzeitig wurden die Parteien der Kommunistischen Internationale zunehmend zu einer Fessel bei der Entwicklung des Klassenkampfes.
Nach 1924 verstärkte die Fraktion um Stalin in Bußland ihre Machtposition und räumte die letzten Widerstände bei der unbegrenzten Verfolgung der Interessen des russischen nationalen Kapitals aus dem Weg. Aber schon vor 1924 trug die Politik der Bolschewisten den Keim der Niederlage in sich. 1922 hatte der Vertreter der Kommunistischen Internationale in China, H. Maring, alias Sneevliet, die Grundlage für ein Bündnis zwischen der Chinesischen Kommunistischen Partei und der Kuomintang eingefädelt. Dahinter steckte die Absicht der Bildung einer "vereinigten antiimperialistischen Front" für den Kampf um die nationale Befreiung Chinas, was in erster Linie einen militärischen Kampf gegen die war-lords insbesondere im Norden Chinas bedeutete, da diese große Teile des Landes beherrschten. Dieses Bündnis führte dazu, daß Mitglieder der chinesischen KP sich der Kuomintang als Individuen anschlossen, und gleichzeitig die Partei förmlich eine politische Autonomie aufrechterhielt. In der Praxis bedeutete dies jedoch eine fast vollständige Unterwerfung der KP unter die Ziele der Kuomintang. Auf dem IV. Kongreß der Komintern im Jahre 1922- der gleiche Kongreß, welcher die Politik der "Arbeiterfronten" im Westen beschlossen hatte - verwarf Radek die Zögerungen einiger Delegierter der KP hinsichtlich des Bündnisses mit der Kuomintang: "Genossen, ihr müßt begreifen, daß heute in China weder der Sozialismus noch eine Sowjetrepublik auf der Tagesordnung stehen". M.a.W: China müßte eine "bürgerlich, demokratische Phase" durchlaufen, bevor die Diktatur des Proletariats auf der Tagesordnung stünde. In Rußland hatten die Menschewisten 1917 die gleiche Argumentation gehabt.
Es handelte sich um einen großen Rückschritt der Komintern gegenüber den Erklärungen ihres I. Kongresses, als sie behauptete, nur die proletarische Weltrevolution könnte die unterdrückten Massen der kolonialen Gebiete befreien. Die spätere Politik der von Stalin und Bucharin beherrschten Komintern führte diese Logik nur zu ihrer letzten Konsequenz. Das Bündnis zwischen der chinesischen KP und der Kuomintang von 1922 spiegelte den Versuch Rußlands wider, sich mit der chinesischen Bourgeoisie zu verbünden und so einen Schutzring gegen jene imperialistischen Mächte aufzubauen (GB insbesondere), die immer noch eine unnachgiebige Feindschaft gegenüber der SU aufrechterhielten. Das chinesische Proletariat wurde mehr und mehr als Handelsware bei den Geschäften Rußlands mit der chinesischen Bourgeoisie betrachtet. Gleichzeitig bedeutete dies, daß jeder Versuch des chinesischen Proletariats für seine eigenen Interessen einzutreten, nur als eine Bedrohung des Bündnisses mit der Kuomintang aufgefaßt werden könnte.
Unter Stalins Schirmherrschaft verfolgte die Kernintern diese Linie ohne Zögern oder Zweifel. Aber von 1923 an strömten russische Waffen und militärische Berater nach China, um dieses sowjetische Bündnis mit der Kuomintang und der chinesischen KP zu unterstützen. In der chinesischen KP war Mao Tse-tung einer der entschlossensten Verteidiger des Bündnisses mit der Kuomintang.
Die revolutionären Kämpfe von 1925- 1927
Am 30. Mai 1925 demonstrierten in Schanghai Arbeiter und Studenten aus Solidarität mit einem Streik in einer Fabrik, die sich im Besitz von Japanern befand. Von Briten angeführte Polizei schoß auf die Demonstranten und tötete 12. Die Antwort der Arbeiter ließ nicht auf
sich warten. Innerhalb weniger Wochen wurden Schanghai, Kanton und Hong Kong von einem Generalstreik gelähmt. In Schanghai wurde der Streik von der KP-geführten Allgemeinen Arbeiterunion geleitet. In Kanton und Hong Kong aber lag die Organisierung des Streiks in den Händen eines embryonären Sowjets, der Delegiertenkonferenz der Streikenden. Unterstützt von 250.000 Streikenden, die einen Delegierten pro 50 Arbeiter wählten, stellte die Konferenz 2000 Streikposten auf, kontrollierte Krankenhäuser und Schulen, übernahm die Verwaltung der Justiz und führte einen totalen Boykott aller britischen Güter ein.
Die westlichen imperialistischen Mächte reagierten mit Schrecken. Aber auch die Kuomintang, welche ein Bündnis verschiedenster Teile der nationalen Bourgeoisie war (Industrielle, Militärs, Studenten, verträumte Kleinbürger), änderte ihre Haltung. War sie vor den Streiks der Arbeiter davon ausgegangen, daß ein Bündnis der Kuomintang mit der KP Chinas für sie von Vorteil sein könnte, weil so das chinesische Proletariat vor den Karren der nationalen Revolution gespannt werden könnte, und dessen Kämpfe solange toleriert wurden, wie sie sich gegen die ausländischen Firmeninhaber richteten, entdeckten die Kuomintang nach diesen Streiks, daß sie mehr gemeinsame Interessen mit den "ausländischen Imperialisten" als mit den "eigenen Arbeitern" hätten.
Aus diesem Grunde vollzog sich eine Spaltung innerhalb der Kuomintang. Ein rechter Flügel entsprach den Interessen der Großbourgeoisie, die die Arbeiterkämpfe zu Ende bringen, die Kommunisten loswerden und zu irgendeinem Kompromiß mit den ausländischen Imperialisten kommen wollte. Der linke Flügel, hauptsächlich von Intellektuellen und den unteren Rängen der Armee angeführt, sprach sich für ein Bündnis mit der Sowjetunion und der russischen KP aus. Tschiang Kai-schek, ursprünglich Anhänger des linken Flügels, galt als ein entschlossener Vertreter einer Bündnispolitik mit der UdSSR und allen möglichen anderen Ordnungskräften. Im März 1926 machte er seinen ersten großen Zug gegen das Proletariat. In Kanton vollzog er einen militärischen Staatsstreich, der ihm fast unbegrenzte Kontrolle über den Parteiapparat der Kuomintang verschaffte. Kommunisten und andere Militanten der Arbeiterklasse wurden verhaftet, das Hauptquartier des Streikkomitees von Kanton-HongKong wurde überfallen. Der Streik, der schon monatelang gedauert hatte, zerbrach nun schnell unter den Schlägen der Repression der Kuomintang. Die Komintern reagierte auf diesen plötzlichen Richtungswechsel der Kuomintang mit Schweigen, oder eher mit einem Leugnen, daß es eine Unterdrückung gegen die Arbeiterklasse gegeben habe. Andererseits denunzierte die Stalin-Bucharin Fraktion jeden in der Komintern oder in der chinesischen KP, der diese Entwicklung des Bündnisses zwischen Kuomintang und KP kritisierte. Tschiang hatte diesen Staatsstreich als ein Vorspiel zu einer großen militärischen Expedition gegen die war-lords im Norden inszeniert. Diese nördliche Expedition war der verhängnisvolle Auftakt für die blutigen Ereignisse 1927 in Schanghai.
Tschiangs Truppen konnten spektakuläre Vorstöße gegen die nördlichen Militaristen unternehmen; hauptsächlich ist dies auf die Welle von Arbeiterstreiks und Bauernrevolten zurückzuführen, die zum Zusammenbruch der militärischen Kräfte des Nordens hinter der Front beitrugen. Das Proletariat und die armen Bauern kämpften gegen ihre schrecklichen Lebensbedingungen mit der Illusion, daß ein Sieg der Kuomintang ihre materielle Lage verbessern würde. Die Kommunistische Partei, die diese Illusionen nicht bekämpfte, sondern sie voll unterstützte, rief die Arbeiter nicht nur zum Kampf für den Sieg der Kuomintang auf, sondern begrenzte auch Arbeiterstreiks und Landbesetzungen durch die Bauern, als diese "zu weit gingen". Borodin, der Vertreter der Komintern, meinte, die Aufgabe der chinesischen Kommunisten und der chinesischen Arbeiterklasse bestünde darin, der "Kuomintang einen 'Kulidienst' zu erweisen".
Während die chinesische KP und die Komintern die "Auswüchse" des Klassenkampfes eifrig bekämpften, machte sich Tschiang an die Aufgabe der Niederschlagung des Proletariats und der Bauernkräfte, die ihm bei seinem Sieg geholfen hatten. Nachdem alle Arbeitskonflikte während des Nordfeldzuges verboten worden waren, schlug Tschiang die Arbeiterbewegung in Kanton, Kwangsi und anderen Städten seines Vorstoßes nieder. In der Provinz Kwangtung wurde die Bauernbewegung gegen die Grundbesitzer gewaltsam niedergemetzelt. Die Tragödie von Schanghai war nur der Höhepunkt dieses Prozesses.
Der Aufstand von Schanghai
Mit seinem Hafen und seiner Industrie war Schanghai das Zentrum des chinesischen Proletariats. Die erbitterten Kämpfe der Arbeiter gegen ihre Herrscher wurden von der Kuomintang und der chinesischen KP als eine Phase auf dem Weg des Sieges der "nationalen Revolution" gegen die war-lords gesehen. Als die Armee Kuomintangs sich auf die Stadt zu bewegte, rief der Allgemeine Arbeiterrat (von der KP angeführt) zu einem Generalstreik mit dem Ziel des Sturzes der herrschenden Klasse der Stadt und zur "Unterstützung der nördlichen Expeditionsarmee" auf. Tschiang Kai-schek sollte als Befreier begrüßt werden. Die Polizeibehörden übten einen furchtbaren Terror gegen die Arbeiterbevölkerung aus, deren Widerstandsgeist aber ungebrochen blieb. Am 21. März erhob sich die Arbeiterklasse erneut, dieses Mal war sie besser organisiert, 5.000 Milizen und zwischen 500.000 und 800.000 nahmen aktiv am Generalstreik und dem Aufstand teil. Polizeiwachen und Armeekasernen wurden angegriffen und erobert, Waffen an die Arbeiter ausgeteilt. Am nächster. Morgen befand sich die ganze Stadt in den Händen des Proletariats.
Eine unheilverkündende Übergangsphase setzte ein. Tschiang stand vor den Toren Schanghais, und konfrontiert mit diesem bewaffneten Arbeiteraufstand, begann er sofort Kontakt herzustellen mit den örtlichen Kapitalisten, Imperialisten und kriminellen Banden, um seine Niederschlagung vorzubereiten, genauso wie er es in allen anderen Landesteilen vorher gemacht hatte. Und während sich Tschiangs Absichten immer deutlicher abzeichneten, traten die Komintern und die chinesische KP weiterhin dafür ein, daß die Arbeiter der nationalen Armee vertrauen und Tschiang als Befreier begrüßen sollten. In der Zwischenzeit hatten zwar Tschiangs Unterdrückungsmaßnahmen eine Minderheit mißtrauisch gemacht, und sie zu der Einsicht in der Notwendigkeit eines Kampfes gegen Tschiang kamen lassen. In Rußland forderte z.B. Trotzki die Bildung von Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräten als eine Grundlage für den bewaffneten Kampf gegen Tschiang und für die Errichtung der Diktatur. In China verteidigte eine Dissidentengruppe von Komintern-Repräsentanten -Albrecht, Nassonow u. Fokkine - eine ähnliche Position; sie warfen der chinesischen KP ihre Rückgratlosigkeit vor. Innerhalb der KP selbst rührten sich immer mehr Stimmen, die sich für einen Bruch mit der Kuomintang aussprachen. Aber die Parteiführung blieb der Linie der Komintern treu, demzufolge jeder Schritt gegen Tschiang nur der "Konterrevolution" nützen werde. Anstatt zur Gründung von Arbeiterräten aufzurufen, organisierte die chinesische KP einen" provisorischen örtlichen Stadtrat", in der sie als eine Minderheit neben der örtlichen Bourgeoisie teilnahm. Anstatt die Arbeiter vor den Absichten Tschiangs zu warnen, begrüßte die KP die Ankunft seiner Truppen in der Stadt. Anstatt den Klassenkampf zu verstärken, trat der KP-geführte General Labor Union gegen spontane Streiks auf und schnitt die Machtbefugnisse der bewaffneten Streikposten ein, die die Kontrolle in den Straßen ausübten. So vermochte Tschiang seinen Gegenangriff sorgfältig vorbereiten. Am 12. April, als er seine Söldner und kriminellen Banden loslegen ließ, waren viele Arbeiter nicht auf der Hut gewesen. Völlig \erwirrt reagierten sie auf diesen Gegenschlag. Trotz entschlossenen Widerstands der Arbeiter schaffte es Tschiang relativ schnell, die "Ordnung" nach einem Blutbad wiederherzustellen. Tausende von Arbeiter wurden auf der Straße erschossen, in Massengräbern verbrannt. Das Rückgrat der chinesischen Arbeiterklasse war gebrochen worden.
Einige Zeit nach dieser Katastrophe gaben Stalin und seine Gefolgsleute zu, daß die "Revolution einen Rückschlag erlitten" hatte. Trotzdem sei die Linie der chinesischen KP und der Komintern korrekt gewesen. Die Schanghaier Niederlage, behaupteten sie, sei "unvermeidbar" gewesen. Aber nachdem nun Tschiang und die ganze chinesische Bourgeoisie zur "Konterrevolution übergegangen waren", meinten sie es sei notwendig, daß die Arbeiter Arbeiterräte organisieren und selbst die Macht ergreifen. Diese neue Linie nahm in der "Kommune von Kanton" im Dez. 1927 Gestalt an; es handelte sich dabei um einen von der chinesischen KP organisierten Putsch in der Form eines selbsternannten "Arbeiterrates". Obgleich mehrere Tausend Arbeiter dem Aufruf der KP folgten und einen Arbeiterrat errichteten, war die Mehrheit der Klasse schon so demoralisiert durch die Verrate der KP und der Repression der Kuomintang, daß sie am Aufstand nicht teilnahmen.
Er endete in einem neuen Blutbad.
Der Tod der Kommunistischen Internationale
Stalin hatte sich sicherlich getäuscht, als er Tschiang zuviel Vertrauen geschenkte hatte und von ihm geglaubt hatte, er sei der beste Verteidiger russischer Interessen in China. Nachdem er die Arbeiterklasse in China niedergemetzelt hatte, rückte Tschiang wieder in den Einflußbereich der westlichen Imperialismen. Aber die Politik der Stalinisten war kein Fehler im Sinne von "taktischen Fehlern" in einer proletarischen Tendenz. Trotzki und die Linksopposition konnten dies nie verstehen. Der Stalinismus stellte den endgültigen Sieg der bürgerlichen Konterrevolution in Rußland und innerhalb der Komintern dar. 1928 beherrschten die Stalinisten die russische Partei vollständig, selbst die Linksopposition war ausgeschlossen worden, die Bürokratie hatte ihr Programm der beschleunigten Militarisierung und Industrialisierung als Vorbereitung des nächsten imperialistischen Weltkriegs in die Wege geleitet. Auf dem VI.Kongreß der Komintern 1928 zeichnete die formale Zustimmung zu der "Theorie des Sozialismus in einem Lande" das Todesurteil der Komintern.
Die Ereignisse des Jahres 1927 brachten auch den Tod der chinesischen KP als proletarische Organisation mit sich. Seit ihrer Gründung war sie unfähig gewesen, sich der Degenerierung der Komintern entgegenzustellen und sie hatte es zugelassen, als passives Instrument in den Dienst der Komintern gestellt zu werden. Ihre besten Elemente wurden in den Niederlagen von 1927 abgeschlachtet. Diejenigen, die das Massaker überlebten, entwickelten sich in zwei Richtungen: einige wenige wie Ch'en Tu-hsiu, einer führenden Figur vor 1927, fingen an die ganze Politik der Komintern in Frage zu stellen, verließen die Partei und schlossen sich der Linksopposition an. Aber der Rest, wie Mao Tsetung und Chou En-lai, blieben der stalinistischen Konterrevolution treu. Nachdem sie zur Niedermetzelung der Arbeiterklasse beigetragen hatten, hatten sie nun freie Bahn, um ihre neue Theorie und Praxis über die "führende Rolle" der Bauern in der "chinesischen Revolution" zu entwickeln. Die Niederlage in China im Jahre 1927 eröffnete eine neue Runde imperialistischen Abschlachtens. In all diesen Konflikten erwies sich die chinesische KP als ein treuer Diener des nationalen Kapitals, als Mobilisierungsagent der Massen für den Krieg gegen Japan in den 30er Jahren und den 2. Weltkrieg. So hatte sie gute Vorleistungen erbracht, um zum Führer des kapitalistischen Staates nach 1949 und zum Hauptkontrollorgan der Arbeiterklasse zu werden.
Die Arbeiterklasse in China, die mit diesen Kämpfen 1927 ein letztes internationales Aufbäumen der Arbeiterklasse insgesamt gezeigt hatte, wodurch die revolutionäre Welle von 1917 schließlich verebbt war, mußte den Preis für ihre eigene Unreife bezahlen. Die Arbeiterklasse in China hatte es nicht geschafft, aus der ideologischen Zwangsjacke der Kuomintang und des Nationalismus insgesamt auszubrechen und sich als eigenständige Klasse zu behaupten. Die internationale Niederschlagung der Weltrevolution ließ die Arbeiter in China in ihrer Isolierung und Verwirrung zurück, den Kräften der Konterrevolution ausgeliefert. Ihre großen spontanen Kämpfe hatten deswegen auf ein bürgerliches Terrain geführt und sie konnten schließlich niedergeschlagen werden.
Trotzki und die Lehren von 1927
Die Kritik der Linksopposition an der stalinistischen Sabotage der chinesischen Revolution, ihr Aufruf für einen unmittelbaren Kampf für die Arbeitermacht gegen die ganze chinesische Bourgeoisie (die Kuomintang eingeschlossen), war einer der letzten Augenblicke, als Trotzki und seine Anhänger eine revolutionäre Position verteidigten. Aber wie bei den meisten Positionen der Linksopposition kam alles zu spät und zu wenig; die wirklichen Lehren aus 1927 wurden von ihnen ohnehin nicht verstanden. Trotzki hatte erst 1926 angefangen, einen Bruch mit der Kuomintang zu verlangen. Er hatte sich nicht der fatalen Politik der anti-imperialistischen Einheitsfront von 1922 entgegengestellt, genauso wenig wie er dem Gegenstück im Westen, der sog. Arbeitereinheitsfront entgegengetreten war. Ebenso wenig sprach er sich gegen die Möglichkeit aus, daß die Arbeiter auch nur eine vorübergehende gemeinsame "militärische Front" mit der Kuomintang eingehen; selbst nach 1927 schloß er dies nicht aus. Diese Verwirrungen führte Trotzki und seine Anhänger später zur Verteidigung von offen konterrevolutionären Positionen im chinesisch-japanischen Krieg, als sie vertraten, der von Arbeiterblut triefende Tschiang Kai-schek sollte "kritisch" gegen die japanischen Eindringlinge unterstützt werden. So begannen die Trotzkisten ihre übliche Praxis der Unterstützung der einen oder anderen Seite in den inter-imperialistischen Kämpfen, die als sogenannte "Befreiungskriege" aufgebaut wurden.
Insbesondere stellte die Linksopposition die unantastbare Position der Unterstützung der nationalen Befreiungskämpfe, die Lenin auf dem II. Kongreß der Komintern 1920 vertreten hatte, nie in Frage. Trotz der Tatsache, daß Lenin auf der Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der politischen Autonomie der Kommunisten in solchen Kämpfen bestanden hatte, was von der Komintern in ihrem Bündnis mit der Kuomintang total über Bord geworfen wurde, sollten die in diesen Thesen enthaltenen Verwirrungen den Weg bereiten für all die Mystifizierungen der "nationalen Revolution" und den "Stufen", die die Komintern eine kurze Zeit später vertrat. Schon 1921-23 hatte die Politik der Unterstützung der sog. "kolonialen Revolution" dazu geführt, daß lokale nationalistische Kräfte Arbeiter und Kommunisten in der Türkei und Persien niedermetzelten. Die kapitalistische Konterrevolution war ein weltweiter Prozeß gewesen, der das reaktionäre Wesen aller Fraktionen der kolonialen Bourgeoisie ans Tageslicht gebracht hatte.
In der dekadenten Phase des Kapitalismus kann es zu keinem Zeitpunkt eine Übereinstimmung der Interessen zwischen Bourgeoisie und Proletariat geben. Jeder Aufruf zur Bildung einer "vereinigten antiimperialistischen Front", "militärischer Blöcke" oder "antifaschistischer Fronten" mit einem sog. progressiven Teil der Bourgeoisie führt nur zur Entwaffnung und zum Abschlachten der Arbeiter. Nach dem Massaker von 1927 kann es daran keinen Zweifel geben. Die Arbeiterklasse kann sich nur durch ihre autonomen Organe und durch den entschlossenen Klassenkampf gegen alle kapitalistischen Fraktionen zur Wehr setzen. In einer Zeit, in der alle Nationalstaaten und alle nationalen Bourgeoisien nur eine Fessel für die Entwicklung der Produktivkräfte sind, hat die Arbeiterklasse keine nationalen Aufgaben zu verwirklichen. Ihre Zukunft liegt einzig und allein in der Errichtung des Kommunismus auf Weltebene.
(aus World Revolution, Zeitung der IKS in GB) CDW.
(Erstveröffentlichung in Weltrevolution Nr. 26, 1987)
Geographisch:
- China [72]
DAS REVOLUTIONÄRE WESEN DER ARBEITERKLASSE
- 3290 reads
Wenn die Arbeiterklasse ihre Kraft offen zeigt, die Produktionsmaschinerie zu lähmen droht, den Staat zurückdrängt, ein Aufwallen des Lebens in der gesamten Gesellschaft entfesselt, wie es z.B. während des Massenstreiks in Polen im Sommer 1980 der Fall war, dann scheint die Frage, ob die Arbeiterklasse die revolutionäre Kraft unserer Zeit ist, als lächerlich. In Polen, wie in allen sozialen Bewegungen, die den Kapitalismus erschüttert haben, war das Herz der sozialen Bewegung nichts anderes als das Herz der Arbeiterklasse selber: die Schiffswerften der Ostsee, die Stahlbetriebe in Nowa Huta, die Bergwerke Schlesiens. Als die polnischen Bauern in den Kampf traten, die Studenten oder die Künstler den Staat bekämpfen wollten, war ihre erste Handlung,"sich an die Arbeiter zu wenden".
Wenn die Arbeiter die Kräfte, die sie atomisieren, zerschlagen, wenn sie sich gegen die herrschende Kraft vereinigen und ihr gesamtes Herrschaftsgebäude erschüttern, so daß diese zurückweichen muß, ist es einfach, gar unleugbar, zu verstehen, wie und weshalb die Arbeiterklasse die einzige Kraft ist, die in der Lage ist, eine revolutionäre Umwälzung in der Gesellschaft zu begreifen und durchzuführen.
Aber sobald der offene Kampf ruht, sobald das Kapital die Oberhand wiedergewinnt und seine Kontrolle über die Gesellschaft wieder verstärkt, dann scheint das zu verblassen, was eine Zeitlang so klar war, und das dekadente Kapital zwingt seinen Knechten seine eigene Auffassung der Welt auf: die einer unterworfenen, atomisierten Arbeiterklasse, die jeden Morgen schweigend zur Arbeit trottet und unfähig ist, die Fesseln des Kapitalismus selber zu zerbrechen.
Wenn die Arbeiterklasse ihre Kraft offen zeigt, die Produktionsmaschinerie zu lähmen droht, den Staat zurückdrängt, ein Aufwallen des Lebens in der gesamten Gesellschaft entfesselt, wie es z.B. während des Massenstreiks in Polen im Sommer 1980 der Fall war, dann scheint die Frage, ob die Arbeiterklasse die revolutionäre Kraft unserer Zeit ist, als lächerlich. In Polen, wie in allen sozialen Bewegungen, die den Kapitalismus erschüttert haben, war das Herz der sozialen Bewegung nichts anderes als das Herz der Arbeiterklasse selber: die Schiffswerften der Ostsee, die Stahlbetriebe in Nowa Huta, die Bergwerke Schlesiens. Als die polnischen Bauern in den Kampf traten, die Studenten oder die Künstler den Staat bekämpfen wollten, war ihre erste Handlung,"sich an die Arbeiter zu wenden".
Wenn die Arbeiter die Kräfte, die sie atomisieren, zerschlagen, wenn sie sich gegen die herrschende Kraft vereinigen und ihr gesamtes Herrschaftsgebäude erschüttern, so daß diese zurückweichen muß, ist es einfach, gar unleugbar, zu verstehen, wie und weshalb die Arbeiterklasse die einzige Kraft ist, die in der Lage ist, eine revolutionäre Umwälzung in der Gesellschaft zu begreifen und durchzuführen.
Aber sobald der offene Kampf ruht, sobald das Kapital die Oberhand wiedergewinnt und seine Kontrolle über die Gesellschaft wieder verstärkt, dann scheint das zu verblassen, was eine Zeitlang so klar war, und das dekadente Kapital zwingt seinen Knechten seine eigene Auffassung der Welt auf: die einer unterworfenen, atomisierten Arbeiterklasse, die jeden Morgen schweigend zur Arbeit trottet und unfähig ist, die Fesseln des Kapitalismus selber zu zerbrechen.
Es fehlt dann nicht an "Theoretikern", die es jedem, der es hören will, gerne lang und breit erklären, daß die Arbeiterklasse als solche integriertes Bestandteil des Systems ist, daß sie innerhalb des Systems einen Platz zu verteidigen hat,und daß nur blinde Fanatiker diese Masse von geldgierigen und geldbewußten Individuen als den Träger einer neuen Gesellschaft ansehen können.
Die ständigen Verteidiger der Wohltaten des kapitalistischen Systems - ob in seiner "westlichen" oder "stalinistischen" Form - legen immer das gleiche Glaubensbekenntnis ab. Aber in den Rückflußphasen des Klassenkampfes tauchen auch regelmäßig Gruppen oder Publikationen wieder auf, die die "Zweifel" an der historischen Natur der Arbeiterklasse theoretisieren; das geschieht selbst bei denjenigen, die sich auf die kommunistische Revolution berufen, und die außerdem keine Illusionen über die Natur der sogenannten "sozialistischen" Länder oder der westlichen sog. "Arbeiterparteien" haben.
Die alten Ideen anarchistischen oder populistischen Ursprungs, denen zufolge die Revolution hauptsächlich das Werk nicht einer spezifischen ökonomischen Klasse, sondern der gesamten Menschen sein wird, die auf irgendeine Weise die Unmenschlichkeit des Systems ertragen, gewinnen wieder an Einfluß.
So wie zur Zeit des Rückflusses der Arbeiterkämpfe nach der Kampfwelle von 1968-74 scheint die "modernistische" Ideologie, die Ideologie der "modernen Theorie der Revolution", die die "alte Arbeiterbewegung"und "ihren verstaubten Marxismus" verwirft,zur Zeit mit dem Rückfluß der Arbeiterkämpfe nach Polen einen Aufschwung zu erfahren. Das Erscheinen der Revue "I,a Banquise"(1) und der Übergang zum vierteljährlichen Erscheinen der Revue "La Guerre Sociale" (2) in Frankreich, sowie das Wiedererscheinen von "Solidarity" (3) in GB sind Beispiele dieser Entwicklung (4).
Diese Publikationen sind relativ unterschiedlich voneinander. "La Guerre Sociale" und "La Banquise" verfolgen eine direktere theoretische Linie, die durch "Invariance"und"Le Mouvement Communiste" geht.(5) Aber alle teilen die gleiche Ablehnung dieser Grundidee des "alten Marxismus": die Arbeiterklasse ist die einzig wirklich revolutionäre Klasse der Gesellschaft; die Zerstörung des Kapitalismus und der Aufbau einer kommunistischen Gesellschaft erfordern eine Übergangsperiode, die durch die politische Diktatur des Proletariats gekennzeichnet ist.
Wir wollen hier keine vollständige Kritik der gesamten, von dieser Art Strömung vertretenen Ideen entwickeln. Im übrigen ist die Polemik mit diesen Tendenzen oft steril und langweilig, da es sich erstens um informelle Gruppen handelt (die darauf stolz sind), die verschiedene "unabhängige" Individuen gruppieren, so daß man von einem Artikel zum anderen in der gleichen Publikation unterschiedliche, sich widersprechende Konzepte und Ideen findet, und zweitens vertreten die Anhänger des Modernismus ständig Zweideutigkeiten und "Ja, aber", "Nein, aber" vor allem gegenüber dem Marxismus, auf dessen Wortschatz sie sich oft und mit Leichtfertigkeit stützen (Marx wird bei jeder Gelegenheit zitiert), dabei aber das Wesentliche des Marxismus verwerfen. Deshalb können sie immer auf die Kritiken mit dem klassischen Satz antworten "so haben wir das nicht gesagt, Ihr entstellt unsere Ideen".
Unser Ziel ist es, in einem Zeitraum des vorübergehenden Zurückweichens der Klassenkämpfe und des sich beschleunigenden Heranreifens der sozialen Voraussetzungen für die kommunistische Revolution, die zentrale Rolle der Arbeiterklasse erneut zu bestätigen, zu erklären, warum sie die revolutionäre Klasse ist, und warum die Verwerfung dieser Tatsache heutzutage einerseits zu einem Unverständnis des Laufs der Geschichte, wie sie sich vor unseren Augen abspielt, führt (siehe z.B. den Pessimismus von "La Banquise"), und andererseits dazu verleitet, in die gröbsten Fallen der bürgerlichen Ideologie zu rennen (siehe die Zweideutigkeiten von "La Guerre Sociale" und von "Solidarity" über die Gewerkschaft "Solidarnosc" in Polen). Dies ist umso notwendiger, als manche modernistische Gruppen - so wie die "radikalen" Studenten von 1968 - oft eine klare und vertiefte Analyse bestimmter Aspekte des dekadenten Kapitalismus liefern, wodurch die Glaubwürdigkeit ihrer politisch unsinnigen Aussagen nur noch zunimmt.
WAS IST DAS PROLETARIAT ?
Bei Marx, wie bei allen Marxisten, waren die Begriffe Arbeiterklasse und Proletariat seit jeher gleichbedeutend. Dennoch kommt es oft vor, daß von denjenigen, die die revolutionäre Natur der Arbeiterklasse als solcher in Frage stellen, ohne sich dabei direkt auf den Anarchismus oder den radikalen Populismus des Ende des letzten Jahrhunderts berufen zu wollen, ein Unterschied zwischen beiden Begriffen erfunden wird. Die Arbeiterklasse, das wären demnach die Arbeiter und Angestellten, die alltäglich unter dem Joch des Kapitals für bessere Löhne und Arbeitsplätze kämpfen. Das Proletariat wäre eine mehr oder weniger definierte Kraft, die alles, was sich irgendwann gegen die Autorität des Staates auflehnt, zusammenschließt. Das geht vom Stahlarbeiter über die geschlagenen, reichen oder armen Frauen, die Homosexuellen oder Studenten bis hin zum professionellen Dieb, je nach dem "modernistischen Denker"(siehe wie fasziniert die "Situationi'siische Internationale" oder "Mouvement Communiste" von den "Gesetzlosen" waren, siehe die Zeitung "Die Rowdys" in den 70er Jahren, siehe die Begeisterung von "Solidarity" für den Feminismus).
In der Zeitschrift "Invariance"(Camatte) wurde 1974 die Definition des Proletariats letztendlich bis zu ihrem Extrem geführt: es umfaßt die gesamte Menschheit. Aus dem Verständnis heraus, daß die Herrschaft des Kapitalismus über die Gesellschaft immer totalitärer und unpersönlicher geworden ist, schloß man, daß sich die "menschliche Gemeinschaft" gegen das Kapital erheben müßte. Dies bedeutete die Verwerfung des Klassenkampfes als Dynamik der Revolution. Heute bietet uns "La Guerre Sociale" eine andere, etwas einschränkende, aber kaum präzisere Definition an: "Der Arbeiter ist nicht der Arbeiter oder gar der Arbeiter oder Angestellte, der auf der untersten Stufe arbeitet. Der Proletarier ist nicht der Produzent, auch wenn der Produzent Proletarier sein kann. Der Proletarier, das ist der "Abgeschnittene", "Ausgeschlossene", der "ohne Rückhalt" ist". ("La Guerre Sociale", Nr. 6, "Offener Brief an die Genossen der weiterbestehenden Internationalen Kommunistischen Partei", Dez. 82). Tatsächlich ist der Proletarier ausgeschlossen, von jeglichem wirklichen Einfluß auf die Führung des sozialen Lebens und somit seines eigenen abgeschnitten. Tatsächlich - und im Gegensatz zu bestimmten vorkapitalistischen ausgebeuteten Klassen - besitzt er nicht seine Produktionsmittel und lebt ohne Reserven. Aber der Proletarier ist nicht j nur das. Er ist nicht nur ein Armer wie andere. Er ist auch Produzent, der Produzent des Mehrwerts, der in Kapital verwandelt wird. Er wird kollektiv ausgebeutet beutet und sein Widerstand gegen das Kapital ist unmittelbar kcllektiv. Das sind wesentliche Unterschiede.
Die Definition des Proletariats auszuweiten, führt nicht zu einer Vergrößerung der revolutionären Klasse, sondern zu ihrer Auflösung im Nebel des Humanismus.
Nach "Invariance" glaubt "La Banquise" sich auf • Marx beziehen zu können, um den Begriff "Proletariat" ausdehnen zu können.
"Das Produkt verwandelt sich überhaupt aus dem unmittelbaren Prozeß des individuellen Produzenten in ein gesellschaftliches, in das gemeinsame Produkt eines Gesamtarbeiters,d.h. eines kombinierten Arbeitspersonals, dessen Glieder der Handhabung des Arbeitsgegenstandes näher oder ferner stehn. Mit dem kooperativen Charakter des Arbeitsprozesses selbst erweitert sich daher notwendig der Begriff der produktiven Arbeit und ihres Trägers, des produktiven Arbeiters. Um produktiv zu arbeiten, ist es nun nicht mehr nötig, selbst Hand anzulegen; es genügt, Organ des Gesamtarbeiters zu sein, irgendeine seiner Unterfunktionen zu vollziehn"(Marx, Das Kapital, Band 1, MEW 23, S.531, S.Abschnitt,l4.Kap.).
Marx entwickelte hier nicht die Idee, daß irgendjemand und jeder auf der Welt Produzent oder Proletarier geworden sei. Er betonte vielmehr, daß im entwikkelten Kapitalismus die spezifische Qualität einer von diesem oder jenem Arbeiter geleisteten Arbeit kein Maßstab dafür sei, um zu bestimmen, ob er produktiv ist oder nicht. Mit der Veränderung des Produktionsprozesses nach seinen Bedürfnissen beutet das Kapital die ge;amte von ihm gekaufte Arbeitskraft wie die eines
ein-zigen produzierenden Arbeiters aus. Die konkrete Verwendung jedes einzelnen Arbeiters - ob Bäckergehilfe pder Büroangestellter, Rüstungsarbeiter oder Straßenreger - ist zweitrangig für die Bedeutung der Frage, wer vom Kapital ausgebeutet wird. Die kollektive Gekamtheit wird ausgebeutet. Das Proletariat schließt heute als Arbeiterklasse die meisten Angestellten des sogenannten "tertiären" Sektors ein.
Trotz ihrer gewaltigen Entwicklung hat die Herrschaft des Kapitals nicht die gesamte Gesellschaft proletarisiert. Das Kapital hat riesige Massen von beschäftigungslosen Randgruppen vor allem in der 3. Welt hervorgebracht. Es hat die vorkapitalistischen Bereiche wie die individuellen Kleinbauern, die Kleinhändler, die Handwerker , die Freiberuflichen überleben lassen.
Das Kapital beherrscht alle Bereiche der Gesellschaft.Und alle diejenigen, die unter seiner Herrschaft der Misere leben, haben Grund genug, sich gegen diese Herrschaft zu erheben. Aber nur der Teil, der durch die Lohnarbeit und die Produktion des Mehrwerts mit dem Kapital direkt verbunden ist, steht wirklich im Gegensatz zum Kapital, nur dieser Teil bildet das Proletariat, die Arbeiterklasse.
WARUM IST DAS PROLETARIAT DIE REVOLUTIONÄRE KLASSE ?
Vor Marx blieb die Dynamik der Geschichte der Gesellschaft ein Geheimnis. Man bezog sich auf religiöse Begriffe wie die "Vorsehung", auf das Genie militärischer Führer oder erklärte die Geschichte durch große Persönlichkeiten, und versuchte so ein kohärentes Bild darzustellen. Durch die Verdeutlichung der zentralen Rolle des Klassenkampfes in dieser Dynamik ermöglichte der Marxismus zum ersten Mal ein Verständnis dieser Dynamik. Dadurch wurde aber nicht ein Mittel zur Interpretierung der Welt geschaffen, sondern eine Auffassung zur Veränderung der Welt. Marx betrachtete als seine größte Entdeckung nicht die Existenz des Klassenkampfes an sich - was im übrigen von den bürgerlichen Theoretikern schon aufgezeigt worden warsondern die Tatsache, daß dieser Klassenkampf zur Diktatur des Proletariats führt.
Der unversöhnliche Widerspruch zwischen Arbeiterklasse und Kapital muß Marx zufolge zu einem revolutionären Kampf für die Zerstörung der kapitalistischen sozialer Verhältnisse und die Einführung einer kommunistischer Gesellschaft führen. Der Hauptträger dieser Revolutior wird die Arbeiterklasse sein; sie wird sich als autonome Klasse gegenüber dem Rest der Gesellschaft organisieren und eine politische Diktatur ausüben müssen, damit die Grundlagen der alten Gesellschaft vollständig zerstört werden. Diese Analyse wird von den Modernisten verworfen:
"Um ihre Existenzbedingungen wirklich zu verändern, dürfen sich die Proletarier nicht als "Arbeiterklasse erheben; das gerade ist aber schwierig, da sie ausge-+ rechnet von ihren Lebensbedingungen ausgehend kämpfen Der Widerspruch wird erst in der Theorie völlig geklärt werden, wenn er in der Praxis überwunden sein wird" ("La Banquise" Nr. 1) "Das Proletariat hat nich als gesellschaftliche Kraft aufzutreten, bevor es die Welt verändert" (ebenda, Nr. 2).
"Aber schon jetzt verschließt man sich in dieser Un terdrückung, wenn man sich nicht als Proletarier ode als Mensch dagegen wehrt, und nicht auf der Grundlage einer zu verteidigenden oder zu erhaltenden Spezifizi tät, die ohnehin mehr und mehr illusorisch wird. Das Schlimmste ist, wenn man aus dieser Spezifizität ableitet, daß das Proletariat die Fähigkeit zur Revo te habe" ("La Guerre Sociale", Nr. 5, S.32).
Die Modernisten wissen nicht, was das Proletariat ist weil sie nicht verstehen, warum es revolutionär ist. Warum sollte sich das Proletariat getrennt als Klasse organisieren, wenn es für die Abschaffung der Klasse kämpfen muß? Für die Modernisten ist die Arbeiterkla se als Klasse nicht revolutionärer als irgendjemand anders: als Klasse bleibt ihr Kampf im Rahmen der Lohnerhöhungsstreitigkeiten und der Verteidigung der Sklavenarbeit begrenzt. Statt sich als politische Klasse zu bilden, sollte sich also das Proletariat als Klasse verneinen und sich als "...Menschen" behaupten. Das Schlimmste, sagt "La Guerre Sociale" sei, aus einer Besonderheit - z.B. Arbeiter zu seineinen "Ansatzpunkt oder ein Terrain für die Fähigkeit zur Revolte" zu machen.
Für die Modernisten scheint die Geschichte immer mit ihnen selbst zu beginnen. Die Pariser Kommune, der Massenstreik in Rußland 1905, die Oktoberrevolution von 1917, die revolutionäre Bewegung in Deutschland von 1919, all das habe nichts aufgezeigt, nichts gelehrt. "Der Widerspruch kann erst in der Theorie völlig geklärt werden, wenn er in der Praxis überwunden sein wird", sagt "La Banquise". Wer hat aber die revolutionären Kämpfe seit mehr als einem Jahrhundert gegen das Kapital geführt, wenn nicht die Arbeiterklasse, die für die Verteidigung ihrer spezifischen Bedürfnisse kämpfte.
Warum war das immer so?
"Weil die Abstraktion von alter Menschlichkeit, selbst von dem Schein der Menschlichkeit im ausgebildeten Proletariat praktisch vollendet ist, weil in den Lebensbedingungen des Proletariats alte Lebensbedingungen der heutigen Gesellschaft in ihrer unmenschlichsten Spitze zusammengefaßt sind, weit der Mensch in ihm sich selbst verloren, aber zugleich nicht nur das theoretische Bewußtsein dieses Verlustes gewonnen hat, sondern unmittelbar durch die nicht mehr abzuweisende, nicht mehr zu beschönigende, absolut gebieterische Not - dem praktischen Ausdruck der Notwendigkeit - zur Empörung gegen diese Unmenschlichkeit gezwungen ist, darum kann und muß das Proletariat sich selbst befreien. Es kann sich aber nicht selbst befreien, ohne seine eigenen Lebensbedingungen aufzuheben. Es kann seine eigenen Lebensbedingungen nicht aufheben, ohne alte unmenschlichen Lebensbedingungen der heutigen Gesellschaft, die sich in seiner Situation zusammenfassen, aufzuheben" (Marx, "Die heilige Familie", -Der dialektische Gegensatz von Proletariat und Reichtum-).
Dies ist die Besonderheit der Arbeiterklasse: ihre unmittelbaren und historischen Interessen treffen mit denen der ganzen Menschheit zusammen, was bei keiner anderen Schicht der Gesellschaft zutrifft. Sie kann sich von der kapitalistischen Lohnarbeit als der vollendetsten Form der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen nur befreien, indem sie jegliche Form der Ausbeutung abschafft. Daraus folgt keineswegs, daß alle Teile der Menschheit die materielle Kraft und das notwendige Bewußtsein besitzen, um eine kommunistische Revolution in Angriff zu nehmen.
Die Arbeiterklasse stützt ihre Kraft vor allem auf ihrer zentralen Stellung im Produktionsprozeß. Das Kapital besteht nicht aus Maschinen und Rohstoffen, es ist ein gesellschaftliches Verhältnis. Wenn die Arbeiterklasse durch ihren Kampf gegen dieses Verhältnis antritt, ist das Kapital sofort gelähmt. Es gibt kein Kapital ohne Mehrwert, kein Mehrwert ohne die Arbeit der Proletarier. Darin besteht die Kraft der Massenstreikbewegungen. Dies erklärt auch zum Teil, warum die Arbeiterklasse materiell die Zerstörung des Kapitalismus in Angriff nehmen kann. Aber das reicht nicht aus zu erklären, warum sie die Grundlage einer kommunistischen Gesellschaft schaffen kann.
Die Sklaven von Spartakus in der Antike, oder die Leibeigenen im Feudalismus besaßen auch eine zentrale, bestimmende Stellung im Produktionsprozeß. Dennoch konnten ihre Revolten zu keiner kommunistischen Perspektive führen.
"Die Spaltung der Gesellschaft in eine ausbeutende und eine ausgebeutete, eine herrschende und eine unter" (F. Engels, in "Antti-Dühring", Dritter Abschnitt, Sozialismus, II. Theoretisches).
drückte Klasse war die notwendige Folge der frühern geringen Entwicklung der Produktion. Solange die gesellschaftliche Gesamtarbeit nur einen Ertrag liefert, der das zur notdürftigen Existenz aller Erforderliche nur um wenig übersteigt, solange also die Arbeit alle oder fast alle Zeit der großen Mehrzahl der Gesellschaftsmitglieder in Anspruch nimmt, solange teilt sich die Gesellschaft notwendig in Klassen
Das Proletariat ist Träger des Kommunismus, weil die kapitalistische Gesellschaft die materiellen Mittel zu seiner Verwirklichung geschaffen hat. Indem er die materiellen Reichtümer der Gesellschaft soweit entwickelt hat, so daß ein ausreichender Überfluß möglich geworden ist, um die ökonomischen Gesetze abzuschaffen - d.h. die Verwaltungsgesetze des Mangels - hat der Kapitalismus eine revolutionäre Perspektive für die Klasse eröffnet, die er ausbeutet.
Letztendlich ist das Proletariat Träger der kommunistischen Revolution, weil es der Träger des kommunistischen Bewußtseins ist. Wenn man die halbreligiösen, vorkapitalistischen Auffassungen einer ausbeutungslosen Gesellschaft beiseite läßt, stellt man fest, daß sich das Projekt einer kommunistischen Gesellschaft ohne Privateigentum, ohne Klassen, in der die Produktion ausschließlich auf die menschlichen Bedürfnisse orientiert ist, mit der Existenz der Arbeiterklasse und ihren Kämpfen entstand und sich entwickelte. Die sozialistischen Ideen von Babeuf, SaintSimon, Owen, Fourier drückten die Entwicklung der Arbeiterklasse am Ende des 18. und am Anfang des 19. Jahrhunderts aus. Die Entstehung des Marxismus, der ersten kohärenten und wissenschaftlich begründeten Theorie des Kommunismus, entspricht dem Erscheinen der Arbeiterklasse als politisch spezifische Kraft (Chartismus in England, Revolutionen von 1848). Seitdem haben alle wichtigen Käm' Dfe der Arbeiterklasse auf die eine oder andere Weise mit mehr oder weniger Klarheit die kommunistischen Ideen aufgegriffen.
Die kommunistischen Ideen, die revolutionäre Theorie, haben sich nur durch und im Hinblick auf das Verständnis der Arbeiterkämpfe entwickelt. Alle großen Schritte der Theorie der kommunistischen Revolution nach vorn waren das Produkt logischer Schlußfolgerungen nicht von einigen isolierten Denkern, sondern von militanten und engagierten Analysen der großen Schritte der wirklichen Bewegung der Arbeiterklasse.
Aus diesem Grund konnte auch nur die Arbeiterklasse die Zerstörung der kapitalistischen Macht in einem kommunistischen Sinn in der Praxis (Pariser Kommune, Oktober 1917) in Angriff nehmen.
Die Geschichte der kommunistischen Bewegung ist nichts anderes als die Geschichte der Arbeiterbewegung.
Bedeutet das, daß das Proletariat die Revolution allein machen und dabei den Rest der Gesellschaft ignorieren kann ? Seit dem 19. Jahrhundert weiß das Proletariat, daß der Kommunismus die "Vereinigung der menschlichen Gattung" sein muß. Die Erfahrung der Russischen Revolution hat ihm die Wichtigkeit der Unterstützung aller ausgebeuteten Schichten für seinen Kampf klar aufgezeigt. Aber die Erfahrung hat auch verdeutlicht, daß nur das Proletariat in der Lage ist, ein kohärentes revolutionäres Programm anzubieten. Die Vereinigung der Menschheit, und im ersten Moment aller Ausgebeuteten, kann nur auf der Grundlage der Aktivität und des Programms der Arbeiter-klasse geschehen. Das Proletariat spaltet nicht die Gesellschaft, indem es sich getrennt organisiert, sondern es gibt sich die Mittel, die kommunistische Vereinigung durchzuführen.
Deshalb beginnt im Gegensatz zu den Behauptungen der Modernisten der Weg zur kommunistischen Revolution mit der einheitlichen Organisierung der Arbeiterklasse als Kraft mit der Diktatur des Proletariats.
Der Modernismus und seine Irrwege
DIE HISTORISCHE PERIODE
Wenn man außer Acht läßt, daß die Arbeiterklasse die revolutionäre Kraft ist, ist es sehr schwer,die jetzige historische Periode zu verstehen, genauso schwer ist es, das Ende des Feudalismus zu verstehen, wenn man die Entwicklung der revolutionären Bourgeoisie nicht berücksichtigt.
Es ist schwer zu erkennen, ob die Bedingungen für einen revolutionären Umsturz heranreifen, wenn man den Träger dieser Revolution nicht identifizieren kann.
Wer die Geschichte der Arbeiterbewegung kennt und ihre revolutionäre Natur begreift, weiß, daß der Prozeß, der das Proletariat zur kommunistischen Revoluiton führt, weder geradlining noch automatisch ist. Er ist eine dialektische Dynamik mit Rückschritten und Vorstößen, in denen eine lange Praxis und Erfahrung des Kampfes es Millionen von Arbeitern ermöglicht sich zu vereinigen, die Lehren aus vorangegangenen Kämpfen zu ziehen, die Fesseln der herrschenden Ideologie zu zerschlagen, um einen neuen Angriff gegen die herrschende Ordnung unter dem Druck der Misere zu starten. Wenn man aber in den Arbeiterkämpfen der Klasse als solcher nur aussichtslose Kämpfe sieht, und diese nicht in ihrer Dynamik und ihrem revolutionären Potential beqreift, kann man nur "enttäuscht" sein.
Wenn man die Kämpfe wie die in Polen 1980 als Kämpfe "innerhalb" des Kapitals betrachtet, kann man 15 Jahre nach dem Mai 1968 nur deprimiert sein; es ist auch normal, daß man trotz des momentanen Rückflusses der Arbeiterkämpfe seit 1980 die Bedeutung der Streiks, welche hier und da in den Industriezentren (Belgien 82, Italien 83) stattfanden, unterschätzt, ebensowenig kann man dann auch nicht die Bedeutung der Tatsache erkennen, daß die Arbeiter sich nicht für die Interessen des nationalen Kapitals und für ihre Gewerkschaftsführer mobilisieren lassen, sondern eher zu gewalttätigen Zusammenstößen mit den Gewerkschaften neigen.
So beginnt z.B. die erste Nummer von "La Banquise" mit diesem Satz, der von der Nostalgie und den Barrikaden des Mai '68 in Paris geprägt ist und einen depressiven Ton aufweist:
"Unter dem Pflasterstein Ziegt der Strand', sagten wir von der großen Eiszeit. Heute hat das Packeis all das bedeckt. Zehn, zwanzig, hundert Meter Eis über dem Pflasterstein, dann der Strand..."
Diese Niedergeschlagenheit ist so senil wie die Begeisterung der radikalen Studenten von 1968 kindisch war, die "Alles sofort" wollten.
OHNMACHT UND KONFUSION DES MODERNISMUS GEGENÜBER DEM KLASSENKAMPF
Es ist kein Zufall, daß modernistische Publikationen wie "Solidarity" oder "La Guerre Sociale" zur Zeit der Arbeiterkämpfe in Polen ihr Erscheinen einstellten. Ebenso wie die Kleinbourgeoisie, die in der modernistischen Strömung einen "radikalen" Ausdruck findet, lebt diese Strömung in der Zweideutigkeit und der Unschlüssigkeit, zwischen der Ablehnung der bürgerlichen Ideologie und der Verachtung für die allzu "materiellen" Kämpfe der Arbeiter. Wenn sich die Kraft der Revolution wie in Polen behauptet, neigt die Geschichte dazu, sich der Zweideutigkeiten und somit der darin versinkenden Ideologien zu entledigen. Das gleiche geschah mit dem Modernismus während des Jahres 1980.
Aber leider hört die politische Verwirrung dieser Strömung nicht mit ihrer Ohnmacht auf. Sie kann sogar zu überaus platten linkskapitalistischen Positionen führen, wenn es darum geht, zu einem Kampf der Ärbeiterk1asse Stellung zu beziehen.
So z.B. "La Guerre Sociale", die neben den Trotzkisten und anderen Demokraten heute behauptet, die Gewerkschaft "Solidarnosc" - welche die Niederlage der Arbeiter in Polen organisierte - sei ein proletarisches Organ: "Ohne Zweifel ist "Solidarnosc" ein Organ des Proletariats. Die Tatsache, daß Elemente aus anderen geseZZschaftZichen Schichten als der ArbeiterkZasse (Intellektuelle und andere) an ihrer Führungsspitze Platz genommen haben, ändert nichts an der Tatsache, daß sich das Proletariat von vornerein damit identifiziert hat. Wie sollte man sonst erklären, daß beinahe das gesamte polnische Proletariat ihr beigetreten ist? Wie sollte man den Einfluß der Gewerkschaft auf das Proletariat erklären? ("La Guerre Sociale", Nr. 6).
Diese Art bornierter Beweisführung ist typisch für die extremen Linken und die Ausrichtung der degenerierenden 3. Internationalen. Dieser Logik zufolge sollte die polnische Kirche, die mehr Anhänger unter den Arbeitern als Solidarnosc hat, "ohne Zweifel ein Organ des Proletariats" sein und der Papst... Lenin!
"La Guerre Sociale" spricht auch in allgemeinen Begriffen von dem Wesen der Gewerkschaften, serviert uns aber dabei den alten Kaffee der Gruppe "Pouvoir Ouvrier" (Gruppe in Frankreich Ende der 60er Jahre, stammte auch von "Socialisme ou Barbarie") hinsichtlich der "Doppelnatur der Gewerkschaften":
"Der Hauptunterschied zwischen "Solidarnosc" und dem polnischen Pr,)Zetariat ist, daß die erste die nationaZen und internationalen ökonomischen Interessen berücksichtigte, während das zweite die Verteidigung seiner unmittelbaren Interessen verfolgte, ohne sich im geringsten um die Probleme der Kapitalverwertung zu kümmern" (ebenda).
Im dekadenten Kapitalismus gibt es keine Zusammenarbeit zwischen Kapitalisten und Arbeitern zugunsten der Arbeiter. Die Auffassung einer Identität zwischen Gewerkschaften und Arbeiterklasse ist heute nichts anderes als Propaganda der herrschenden Klassen (die im übrigen auf Weltebene zusammenarbeiten, um eine glaubwürdige Gewerkschaft "Solidarnosc" aufzubauen). Die Auffassung beinhaltet, daß es eine Gemeinsamkeit zwischen den Interessen des Kapitals und denen des Proletariats geben könnte; diese Auffassung ignoriert die revolutionäre Natur der Arbeiterklasse. So kann "La Guerre' Sociale" folgende naive Feststellung machen: "Die Gewerkschaft ist kein Organ des Kapitals, keine Kriegsmaschine gegen das Proletariat, sondern der organisationelle Ausdruck dessen Verhältnis zum Kapital: Gegensatz und Kooperation. Dies bringt zum Ausdruck, daß das Kapital ohne das Proletariat nichts ist und gleichfalls umgekehrt" (ebenda).
Nur wenn man die revolutionäre Natur des Proletariats ignoriert und die Arbeiterklasse hauptsächlich als einen Teil des Kapitals betrachtet und nicht als seinen Zerstörer, kann man irgendeine Gleichheit zwischen den nationalen und internationalen ökonomischen Interessen des "Kapitals" und den "unmittelbaren Interessen" des Proletariats sehen.
Die Verwirrung, die aus der fehlenden Erkenntnis des Wesens der Arbeiterklasse entsteht, führt somit zu gleichen Auffassung wie die der Linken, die der radikale Modernismus so sehr kritisiert.
Das Proletariat ist die erste revolutionäre Klasse der Geschichte, die gleichzeitig eine ausgebeutete Klasse ist. Der Kampfprozeß, durch den das Proletariat zur kommunistischen Revolution übergeht, weist unvermeidlich Perioden der Rückflüsse und Rückzüge auf. Diese Rückflüsse werden nicht nur durch die Abnahme der Anzahl von Arbeiterkämpfen gekennzeichnet. Auch auf der Ebene des Bewußtseins erlebt das Proletariat eine Verwirrung, die sich in der Abschwächung ihrer politischen revolutionären Ausdrücke aufzeigt, und die ebenfalls das Wiederentstehen von politischen Strömungen ermöglicht, die "Zweifel an der Arbeiterklasse" hegen.
Der Bruch, den die Kämpfe von 1968 mit einem halben Jahrhundert siegreicher Konterrevolution vollzogen, hat einen Kurs zur Entwicklung immer entscheidenderer Klassenzusammenstössen eröffnet. Dieser Kurs wurde durch den Rückfluß nach Polen ebensowenig umgekehrt wie durch den Rückfluß von 1975-78. Die historischen Bedingungen dieses Riickflusses werden mit der Vertiefung der ökonomischen Krise zunehmend schwächer wirksam, da die Realität langsam aber sicher die Fundamente der dekadenten, bürgerlichen Ideologie zerstört (Wesen der Ostblockländer, Wohlfahrtsstaat, parlamentarische Demokratie, Gewerkschaften, Kämpfe für nationale Befreiung usw.).
Alle Bedingungen-reifen heran, damit das Proletariat mit all seiner Kraft durch seinen Kampf die Zukunft der Menschheit erneut aufzeigt und alle Zweifel hinsichtlich seiner revolutionären Natur hinwegfegt. R.V.
(1) "La Banquise", B.P. 214, 75623 Paris, Cede 13, F.
(2)'"La Guerre Sociale", B.P.88,75623 Paris,Cedex 13 ' Erschien von 1977 bis 1979 jährlich, verschwand dann 1980, dem Jahr der großen Kämpfe in Polen... tauchte dann im Mai '81 wieder auf und erscheint seit Juni '82 vierteljährlich. Die Gruppe Solidarity stammt aus den 60er Jahren., Während der 70er Jahre veröffentlichten sie relativ regelmäßig eine Revue mit dem cJleichen Namen. Aber im Herbst 1980 verschwand die Revue, weil die Gruppe unfähig aar, eine kohärente Position zu den Kämpfen in Polen und eine Einstellung zu Solidarnosc zu beziehen.
Diese 3 Gruppen sind mehr oder weniger direkt oder indirekt mit "Sozialismus oder Barbarei" verbunden, einer Zeitschrift während der 50er und 60er Jahre, deren Hauptträger Castoriadis (alias Chaulieu, Cardan, Coudray) war und die die meiste Zeit damit verbrachten, das Veraltetsein des Marxismus zu theoretisieren.
(3) (4)
(aus der INTERNATIONALEN REVUE, Nr. 35, drittes Quartal 1983) Erstveröffentlichung in Weltrevolution Nr. 12, 1983
Theoretische Fragen:
- Arbeiterklasse [58]
Februar 2007
- 742 reads
Der Spartakusaufstand: Eine Inspiration für das Proletariat
- 10155 reads
Der weltweite Erfolg des Films Gladiator hat ein erneuertes Interesse am alten Rom und der Rolle der Gladiatoren erzeugt. Wenn man sich mit dieser Frage befasst, stößt man auf den Sklavenkrieg zwischen 73 und 71 v. Chr., welcher von dem Gladiator Spartakus angeführt wurde. Im Gegensatz zu dem im Film auftretenden Gladiator, welcher die im Zentrum stehende Figur und seine kleine Gruppe von Gladiatoren dem bösen Kaiser Kommodus gegenüberstellt, beteiligten sich an der wirklichen Sklavenrevolte 100.000 oder mehr Sklaven im Kampf gegen ihre römischen Unterdrücker. Dabei besiegten sie immer wieder die als unbesiegbar geltenden Legionen. Obwohl sie blutig niedergeschlagen wurde, inspirierte diese Revolte revolutionäre Bewegungen. Die größte Gruppe von Revolutionären in Deutschland, welche sich gegen den 1. Weltkrieg stellte, nannte sich Spartakusbund. Damit wollte sie ihre Entschlossenheit, einen Krieg gegen die herrschende Klasse zu führen, zum Ausdruck bringen. Und wie im Falle Spartakus und der Sklavenarmee wurde der revolutionäre Kampf der Arbeiter in Deutschland im Blut ertränkt. Folglich wurde der Name Spartakus zum Inbegriff der revolutionären Bestrebungen der Ausgebeuteten. Dagegen dreht sich der Film ’Gladiator’ um den Helden und seine kleine Gruppe von Anhängern, welche gegen den ach so bösen Kommodus für ein Reich eintraten, das sich auf "Gerechtigkeit" stützte (die Ausbeutung von Sklaven wird nicht mal erwähnt), kurzum im Film kämpft man für Demokratie gegen Diktatur.
Das Ziel dieses Artikels ist nicht eine Kritik an Gladiator oder eine detaillierte Geschichte Spartakus zu verfassen, statt dessen wollen wir zeigen, warum die Spartakusrevolte, obwohl sie von einer anderen ausgebeuteten Klasse getragen wurde, nur verstanden und für sich beansprucht werden kann durch die ausgebeutete Klasse in dieser Gesellschaft, das moderne Proletariat.
Dabei werden wir zeigen, wie die heutige Klasse von "Sklavenbesitzern", die Bourgeoisie, versucht, die Geschichte von Spartakus zu verdrehen und für ihre eigenen Zwecke zu nutzen.
Die Sklavenkriege
Die Erhebung der Sklaven zwischen 73- 71 v. Chr. Erfolgte nicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Sie spiegelte die breite soziale Aufruhr wider, welche die Römische Republik erschütterte. Im 2. J.H. v. Chr. hatte die römische Armee den Mittelmeerraum erobert und sich weiter über Europa ausgedehnt. Die fortgesetzten Eroberungen sorgten für einen wachsenden Zustrom von Sklaven und ersetzten die Bauern, welche die Grundlage des Römischen Reiches gewesen waren. Anstelle des alten Systems der kleinbäuerlichen Wirtschaft entstanden nun große Latifundien, die Sklavenarbeit zum Abbau von Rohstoffen und zur Herstellung von landwirtschaftlichen Produkten nutzten. In den Städten wurden die Handwerker immer mehr durch Sklavenarbeit ersetzt. Zur gleichen Zeit war eine sehr kleine Minderheit der herrschenden Klasse in der Lage, die Kontrolle über die Ausbeutung der Reichtümer der neu eroberten Gebiete zu erlangen. Dies erzeugte starke soziale Spannungen: zwischen der herrschenden Klasse und denen, welche auf dem Land arbeitslos wurden oder als Arbeitslose vom Land in die Städte getrieben wurden. Auch verschiedene Interessen innerhalb der herrschenden Klasse prallten aufeinander. Wir haben hier keinen Platz, um dies im Rahmen dieses Artikels näher zu analysieren. Stattdessen empfehlen wir Karl Kautsky's „Der Ursprung des Christentums" zu lesen. Diese Spannungen führten ab 130 v. Chr. zu einer Serie von blutigen Bürgerkriegen. Während dieser Periode führten die Brüder Gracchus die Bewegung der Besitzlosen gegen den Staat, insbesondere der früheren Legionäre, welche einst Parzellen von Land als Vergütung für ihre jahrelangen Dienste erhalten hatten. "Die privaten Söldner kämpften um und starben für das Wohlergehen und den Luxus der Großen. Sie wurden eingestuft als Herren der Welt, während sie keinen Fuß Land besaßen" (Tiberius Gracchus erwähnt von M Beer's Allgemeine Geschichte des Sozialismus und der sozialen Kämpfe,. Russel & Russel, 1957). 132 v. Chr. wurde Tiberius und sein Unterstützer von der herrschenden Partei ermordet, und 121 v. Chr. traf seinen Bruder Caius und seine Unterstützer ein ähnliches Schicksal. In den darauf folgenden Jahren wurden Massaker und blutige Bürgerkriege zur Norm. Zehntausende fanden bei den Kämpfen unter verschiedenen Fraktionen der herrschenden Klasse um die Kontrolle des Staates den Tod.
Mitten in diesem Aufruhr brach der von Spartakus angeführte Sklavenaufstand aus. Aber nochmals, dies ist im Kontext mit den zwei vorhergehenden Sklavenkriegen zu sehen, welche in Sizilien stattfanden (v. Chr. 134-32, 104-101). In diesen Kriegen erhoben sich Tausende von Sklaven auf den großen Gütern, die auf der Insel bestanden, und besiegten ihre römischen Herrscher, bevor sie dann wiederum gegen römische Legionen kämpften. In diesen Kämpfen wurden sie mit großer Gewalt niedergeschlagen. Zur Zeit des ersten Krieges in Kleinasien stand im Königreich von Pergamum, Aristonikos, der Halbbruder des früheren Königs, den Römern gegenüber. Er befreite die Sklaven und gründete den Sonnenstaat, welchem eine "kommunistische" Ordnung nachgesagt wurde. Dort gab es eine "vollständige politische Demokratie; die Gesamtheit der Bewohner, alteingesessen oder ausländisch, mit Eigentum oder enteignet, bekamen Stimmrecht und die Unabhängige Befugnis über ihren Staat" (Beer, ibid, p153). Von 133 bis 129 führten die Römer Krieg gegen den Sonnenstaat bevor sie ihn letztendllich zerstörten. Auf diesem Hintergrund des sozialen Aufruhrs und einer Reihe von blutigen Sklavenkriegen brach der dritte große Sklavenkrieg aus.
Der Verlauf der Revolte
Die Informationen, die wir über Spartakus und den Sklavenkrieg, haben sind sehr begrenzt- einige tausend Worte, geschrieben von altertümlichen Historikern der herrschenden Klasse: Sallust, ein römischer Senator (1. Jahrhundert v. Chr.), Plutarch und Appian waren wohlhabende Aristokraten ( 2. J.h. n. Chr.). Die Tatsache, dass diese Mitglieder der herrschenden Klasse es für notwendig erachteten, sich mit dieser Revolte zu befassen, zeigt wie wichtig sie war. Wie wir gesagt haben, wollen wir hier keine historische Schilderung liefern, sondern die Hauptzüge dieses Kampfes aufzeigen. Anfänglich brachen Spartakus und 70 weitere andere Gladiatoren aus ihrer Gladiatorschule in Capua aus, nachdem ihr Plan eines größeren Ausbruchs aufgedeckt wurde. Die Tatsache, dass solch eine Gruppe von Gladiatoren mit unterschiedlichem ethnischen Hintergrund, die dafür ausgebildet waren, sich gegenseitig zu töten, einen solchen Plan ausarbeiten konnten, zeugt von einer wirklichen Solidarität unter ihnen. Sobald sie frei waren, flohen sie zum Berg Vesuv. Hier sagt Appian, verbanden sich viele Sklaven und einige freie Menschen mit ihnen. "Seitdem Spartakus die Einnahmen aus Überfällen zu gleichen Teilen verteilte, ließ dies ihm schnell eine große Anzahl von Streitern zuströmen" (Appian, in Spartakus und der Sklavenkrieg, eine kurze Geschichte mit Dokumenten, von Brent D. Shaw, S. 140). Solche vorkommunistischen Maßnahmen belegen die Führungsrolle Spartakus: "Spartakus verbot Händlern Gold und Silber zu importieren, und er verbot seinen eigenen Leuten welches zu erwerben. Zum größten Teil kaufte er Eisen und Kupfer und kritisierte nicht diejenigen, die diese Metalle importierten" (Appian, ibid, S.142). Diese Maßnahmen mussten eine sehr wichtige Eigenschaft des Sklavenkrieges sein, denn der römische Historiker Pliny verglich dies mit der Gier des Reichs: "Wir wissen", sagt Pliny in dem dreiunddreißigsten Buch seiner Naturgeschichte, "dass Spartakus in seinem Lager kein Gold und Silber erlaubte. Unsere ausgerissenen Sklaven überragen uns in der Größe des Geistes" (zitiert in Kautsky's Der Ursprung des Christentums). Diese Handlungen konnten den Massen der Sklaven nicht von Spartakus aufgedrängt worden sein, sondern mussten den Wunsch der Mehrheit nach einer Gesellschaft mit größerer Gleichheit reflektiert haben. Spartakus war auch gegen die mutwillige Plünderung von Teilen seiner Armee, insbesondere gegen diejenigen, die unter dem Kommando von Gaul Krixos ausgeführt wurden. "Spartakus besaß nicht die Mittel sie aufzuhalten, obwohl er sich wiederholt eindringlich dagegen aussprach und sogar versuchte einen Boten zu schicken, um andere Städte vor solchen Plünderungen zu warnen (Shaw, S. 148). Diese Spaltungen innerhalb der Sklavenarmee waren scheinbar einer der Hauptgründe dafür, dass sie nicht aus Italien ausbrechen konnten, obwohl die Armee zweimal die Alpen erreichte. Jedoch sagte Florus (Florus 2. J.h. n. Chr.), nachdem die Armee, die von Lentulus geführt wurde, in den Alpen ausgelöscht wurde und sie danach das Lager von Gaius Crassus angriffen, dachte Spartakus daran Rom anzugreifen. Am Ende, nachdem sie durch Crassus in den äußersten Süden Italiens abgedrängt wurden und immer mehr Legionen aus dem Ausland eintrafen, mussten Spartakus und die Sklaven sich entweder gefangen nehmen lassen oder einen letzten Aufstandsversuch machen. Die Sklavenarmee entschied sich für letzteres. In vollen Schlachtreihen traten sie den sie verfolgenden Legionen entgegen. 36.000 starben auf dem Schlachtfeld, später kamen noch viel mehr hinzu, nachdem die herrschende Klasse erbarmungslos diejenigen zur Strecke brachte, die die Kühnheit besessen hatten, ihre Legionen zu besiegen, ihre Generäle und Würdenträger der Oberschicht zu töten und gegen die herrschende Klasse aufzustehen. Als eine Warnung an alle anderen Rebellen kreuzigte die herrschende Klasse 6.000 Überlebende der Sklavenarmee entlang der Via Appia, der Hauptstraße nach Rom. Schließlich war die Niederwerfung der Sklavenarmee nicht einfach auf die inneren Spaltungen oder taktischen Fehlern zurückzuführen. Sie spiegelte vielmehr die geschichtliche Begrenztheit der Epoche wider. Obwohl sie die damals am höchsten entwickelte Gesellschaft war, welche die Welt bis damals gesehen hatte, konnte die römische Sklavengesellschaft nie die Produktivkräfte bis zu dem Punkt entwickeln , ab dem eine wirkliche allgemeine kommunistische Gesellschaft hätte hervorgebracht werden können. Der Niedergang der Sklavengesellschaft konnte nur durch ein fortschrittlicheres System der Ausbeutung ersetzt werden (so entstand nach dem Niedergang der Sklavengesellschaft in Europa der Feudalismus). Auf diesem Hintergrund kann man verstehen, dass die Sklaven keine revolutionäre Klasse waren, die mit ihrem Kampf die Grundlage für ein neues Gesellschaftssystem gelegt hätten und noch weniger ein bewusstes Programm für seine Verwirklichung. Ihre Hoffnungen auf eine Gesellschaft, in der privater Besitz nicht länger existieren würde, konnten nur Träume bleiben, die auf Erinnerungen an eine verlorene gegangene Stammesordnung und auf Mythen eines ursprünglichen goldenen Zeitalters basierten. Das bedeutet nicht, dass Marxisten auf diese Revolte oder die kommunistischen Träume der früheren ausgebeuteten Klassen mit Verachtung herabblicken. Im Gegenteil, diese Revolten haben Generationen von Proletarier inspiriert und diese Träume bleiben unentbehrliche Schritte hin zu einer wissenschaftlichen kommunistischen Ansicht über die moderne Arbeiterklasse.
Die Reaktion der herrschenden Klasse auf Spartakus
Die Entwicklung der Reaktion der herrschenden Klasse auf den Sklavenkrieg ist sehr aufschlussreich. Im Frankreich des 18. Jahrhunderts hielt die revolutionäre Bourgeoisie Spartakus für einen Helden und einen Ausdruck ihres eigenen Kampfes gegen den Feudalismus; im 19. Jahrhundert wurde er ebenso von der italienischen Bourgeoisie für sich eingenommen. Sobald jedoch die Bourgeoisie ihre unbestrittene Vorherrschaft gefestigt hatte, wurde Spartakus zu einer gefürchteten Gestalt, weil der Sklavenkrieg beunruhigend nahe rückte an den Klassenkrieg, der nun zwischen der Bourgeoisie und ihrem Todesfeind, der Arbeiterklasse, Gestalt annahm. Diese Angst vor dem Klassenkampf nahm durch die revolutionären Kämpfe zwischen 1917 und 1927 eine konkrete Form an, als die "Spartakisten" zu einem Synonym für "Bolschewismus" und Weltrevolution wurde: "Übrigens ist der Name ‚Spartakusleute’, den die deutschen Kommunisten jetzt tragen, diese einzige Partei in Deutschland, die wirklich gegen das Joch des Kapitalismus kämpft, von diesen gewählt worden, weil Spartakus einer der hervorragendsten Helden eines der größten Sklavenaufstände vor ungefähr zweitausend Jahren war" (V. I Lenin, Über den Staat, Lenin Bd. 29, S. 472) In die Fußstapfen der blutigen Unterdrückung der ursprünglichen Spartakusbewegung durch Rom tretend, schlug die deutsche Bourgeoisie den Sklavenkrieg von heute mit großer Brutalität nieder.
In den folgenden Jahren der Konterrevolution fühlte sich die herrschende Klasse weniger durch das Gespenst des Klassenkampfes bedroht, und ab den Fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts fühlte sie sich selbstbewusst genug, Spartakus für den kalten Krieg einzuspannen. Zu diesem Zweck benutzte die amerikanische Bourgeoisie Hollywood und Stanley Kubrick's Film Spartakus, mit Kirk Douglas in der Hauptrolle. Dies soll nicht den künstlerischen Verdienst des Filmes bestreiten, der dem jüngsten Gladiatorfilm mit seiner Flut von Spezialeffekten mit dem Ziel der Aktualisierungsversuche bei weitem überlegen ist. Tatsächlich enthält der Film Szenen, welche wunderschön die befreiende Kraft der Solidarität vermitteln, wie zum Beispiel die Darstellung des anfänglichen Ausbruch aus der Gladiatorenschule und ganz besonders die unvergessliche Szene, als die römischen Sieger versuchten Spartakus zu identifizieren, Tausende von gefangenen Sklaven nach vorne traten und angaben "ich bin Spartakus". Nichtdestoweniger ist die ideologische Absicht des Films offensichtlich. Spartakus selbst wird zu einer Christus-ähnlichen Gestalt verdreht, welche die Sklaven in die Freiheit führt. Dies wird deutlich am Ende des Films, als er gekreuzigt wird. Dies ist eine vorsätzliche Lüge, um die Erinnerung an den Sklavenkrieg auszulöschen. Spartakus starb nicht am Kreuz, sondern im Endkampf auf seinem Weg zu Crassus, dem überragenden Symbol der herrschenden Klasse Rom's - er war der reichste und mächtigste Mann in Rom. "Als man ihm sein Pferd brachte, zog Spartakus sein Schwert und rief, wenn er die Schlacht gewänne, würde er viele gute Pferde haben, wenn er sie aber verlieren würde, bräuchte er kein Pferd mehr. Daraufhin tötete er das Tier. Dann stürmte Spartakus, sich seinen Weg durch Waffen und Verwundete bahnend, zu Crassus. Er erreichte niemals den Römer, aber er tötete zwei Centurios, die mit ihm fielen" (Plutarch, ibid 136).
Der Film wurde benutzt, um die westlichen Werte des "Westens" gegen die Diktatur aufzubauschen. Der Film wollte die Botschaft vermitteln, dass der Diktatur nur durch Freiheit, Demokratie und Christentum entgegen getreten werden kann. Am Anfang des Filmes sagt der Kommentator, während Spartakus und die Sklaven im Krieg besiegt wurden, war es das Christentum, welches schließlich die Sklaven befreite (während man gleichzeitig nicht erwähnte, dass das Christentum im 16. bis zum 19. Jahrhundert eine Hauptstütze der Sklaverei in Europa war). Die Sklaverei wurde als Schandfleck der römischen Zivilisation dargestellt und nicht als ihre Grundlage.
Er war ebenso Teil der Bestrebungen der USA, die Märkte der früheren britischen Kolonien zu gewinnen. Kirk Douglas sagte in seiner Autobiographie, ‚Ragman's Son’, er habe darauf bestanden, dass alle Hauptrollen der herrschenden Klasse Roms durch britische Schauspieler gespielt werden sollten und die Sklavenrollen durch amerikanische oder andere Schauspieler.
Der Stalinismus trug auch zur Verzerrung der Bedeutung des Spartakus-Aufstandes bei. Der "Skriptschreiber" des Films, Dalton Trumbo, ein Stalinist, stellte Spartakus mit Stalin und den heißspornigen Krixos, welcher sich im Film von Spartakus trennte, um Rom anzugreifen, mit Trotzki gleich.
Der Film stützt sich auf den Roman von Howard Fast. Im Film werden die Sklaven so gezeigt, als ob sie Spartakus bis zum bitteren Ende gefolgt wären, aber im Buch werden die Sklaven für das Scheitern des Krieges verantwortlich gemacht. Aber als ein guter Stalinist hatte Howard Fast für die Arbeiterklasse nichts als Verachtung übrig. Dies wird im Buch deutlich, in dem die Sklaven so dargestellt werden, als ob sie die Idealen Spartakus nicht erfüllen konnten. Dies ist auch die Botschaft, die in Arthur Koestler's Roman ‚The Gladiator’ vermittelt werden soll. Koestler war in der 1930er Jahren ein Stalinist, aber er wurde offenkundig von der Revolution und dem Proletariat enttäuscht. Für ihn wie für Fast war Spartakus ein revolutionärer Führer, der einen Pöbel anführt, welcher nicht seinen Idealen entsprach.
Ein noch bösartigerer Angriff ist kürzlich von Alan Baker in seinem Buch „Der Gladiator -Die geheime Geschichte Roms Kriegssklaven" lanciert worden, das sich den Erfolg des Films zunutze macht. In einem Kapitel über Spartakus bestätigt Baker die Meinung des Historikers Christian Meir, dass dieser "ein Räuberchef im großen Stil" war. Das zeigt, auf welches niedrige Niveau die Bourgeoisie herabsinkt, um die Bewegung anzugreifen, die ihre Vorfahren bedrohte. Die Historiker des Altertums zeigten mehr Würde, und obwohl sie Spartakus und all das, wofür er stand, hassten, kannten sie seine Stärke und Persönlichkeit an. "Spartakus war ein Thraker, geboren inmitten von nomadischen Hirten. Er besaß nicht nur einen großen Geist und körperliche Stärke, sondern er war auch intelligenter und nobler als sein Schicksal und er war griechischer als seine Herkunft aus Thrakien vermuten lassen könnte" (Plutarch, op cit S. 131-2).
Am Anfang des Jahres brachte der englische Sender Channel 4 einen Film über Spartakus. Obwohl die Sendung ausgeglichener war, zeigte die Sendung erneut Spartakus nicht seinem revolutionären Image entsprechend, weil er bei einer Gelegenheit gefangene Römer in Gladiatorenspielen kämpfen ließ und ebenso einen gefangenen Römer kreuzigte. Noch aufschlussreicher war, dass der Dokumentarfilm von einem früheren Armeeoffizier erstellt wurde, der sich auf Spartakus’ außerordentliche strategische und taktische Fähigkeiten konzentrierte. Es wurde nichts über die sozialen Ideale der Bewegung gesagt und noch weniger darüber, wie eine so gewaltige Masse von Sklaven und anderen unterdrückten Schichten die Organisierung des Kampfes zustande brachten (tatsächlich bleibt dies bis heute nahezu völlig undurchsichtig).
Die herrschende Klasse wird bestimmt weiter versuchen, jeden möglichen Gebrauch von den großen Klassenkriegern der Geschichte zu machen. Aber im Falle Spartakus stimmen wir mit der Einschätzung Marxens überein, die er in einem Brief an Engels schrieb: "Spartacus erscheint als der famoseste Kerl, den die ganze antike Geschichte aufzuweisen hat. Großer General (kein Garibaldi), nobler Charakte, real representative des antiken Proletariats" (MEW, Bd. 30, S. 160).
Für Marx war die Größe Spartakus letztendlich auf die Tatsache zurückzuführen, das er ein "real representative des antiken Proletariats" war: mit anderen Worten, er war ein Produkt des Kampfes einer ausgebeuteten Klasse, welche es wagte, ihre Ausbeuter herauszufordern. In einer Welt, die immer noch auf der Ausbeutung einer Klasse durch eine andere gründet, bleibt Spartakus ein einflussreiches Symbol für das moderne Proletariat, das die Fähigkeit besitzt, alle Formen der Sklaverei für immer zu beenden. Phil, 17.7.2001
Diskussionsveranstaltung der IKS - Wir müssen den Kapitalismus zerstören, bevor er den Planeten zerstört
- 3378 reads
Bei der Frage, die wir heute diskutieren wollen, geht es schlicht und ergreifend um die des Überlebens der Menschheit.
Eine Bewertung der neuesten Prognosen der Wissenschaftler zur Klimakatastrophe zeigt unleugbar, dass, wenn die Entwicklung so weitergeht wie bisher, die stufenweise Zerstörung des Planeten und damit die Vernichtung der Lebensgrundlagen der Menschen vorprogrammiert ist.
Geht allein die Klimaerwärmung so weiter wie bisher, sind die Konsequenzen langfristig so katastrophal, dass das Überleben der Menschen auf dem Spiel steht.
Bei einem weiteren Anstieg der Durchschnittstemperaturen der Erde seien hier nur einige der Konsequenzen erwähnt, die die Wissenschaftler erwarten:
Die Dramatik der Lage – was steht auf dem Spiel?
Bei der Frage, die wir heute diskutieren wollen, geht es schlicht und ergreifend um die des Überlebens der Menschheit.
Eine Bewertung der neuesten Prognosen der Wissenschaftler zur Klimakatastrophe zeigt unleugbar, dass, wenn die Entwicklung so weitergeht wie bisher, die stufenweise Zerstörung des Planeten und damit die Vernichtung der Lebensgrundlagen der Menschen vorprogrammiert ist.
Geht allein die Klimaerwärmung so weiter wie bisher, sind die Konsequenzen langfristig so katastrophal, dass das Überleben der Menschen auf dem Spiel steht.
Bei einem weiteren Anstieg der Durchschnittstemperaturen der Erde seien hier nur einige der Konsequenzen erwähnt, die die Wissenschaftler erwarten:
Die Polkappen und Gletscher schmelzen. Dadurch steigt der Meeresspiegel bedrohlich an. Mit steigendem Meeresspiegel erhöht sich der Druck der Wassermassen in den Ozeanen. Es wird befürchtet, dass dadurch unberechenbare Prozesse entstehen, zum Beispiel tektonische Verschiebung in der Erdkruste, was die Gefahr von Erdbeben erhöht und zu einer Häufung von Vulkanausbrüchen führt.
Durch noch längere und verheerendere Dürreperioden in den einen Weltregionen und sintflutartige Regenfälle und Überschwemmungen in den anderen wird die Landwirtschaft nicht mehr ausreichend Lebensmittel bereitstellen können. Eine massive Lebensmittelknappheit ist nur noch eine Frage der Zeit.
Durch die weiter ansteigende Verpestung der Luft mit CO2 nehmen die damit verbundenen Krankheiten noch epidemischere Ausmaße an. Mensch und Umwelt werden also immer stärker bedroht.
Viele Siedlungsgebiete dieser Welt, in denen allein 40 Prozent der Weltbevölkerung lebt, sind durch den Anstieg des Meeresspiegel von Überflutung bedroht. Die Zahl der dadurch in die Flucht getriebenen Menschen ist einfach unvorstellbar.
Die Gefahr irreparabler Schäden wird immer offensichtlicher, denn die jetzt aufgetretenen Schäden sind das Ergebnis der Emissionen der letzten Jahrzehnte. Und bislang ist der Trend nicht mal gebrochen. Es steht uns also ein wahres Inferno bevor.
Kein Wunder, dass die Warnrufe selbst aus dem bürgerlichen Lager lauter und deutlicher werden. Kein Wunder, dass der Film Al Gores „Die unbequeme Wahrheit" auf solch großes Interesse stößt. Kein Wunder, dass die Warnung vor der bevorstehenden Explosion der durch die Umweltverschmutzung bedingten Kosten vom britischen Ökonomen und Regierungsberater Stern so viel Aufmerksamkeit erregte. Kein Wunder, dass von vielen Seiten der Ruf nach einschneidenden Maßnahmen zu hören ist.
Wir wollen uns deshalb mit der Frage befassen, ob es möglich ist, innerhalb des Kapitalismus, d.h. mit Hilfe kapitalistischer Regulierungsmittel, die Umweltzerstörung aufzuhalten, deren Schäden zu reparieren und künftige gar zu verhindern. Doch zuvor muss man klären, wie es dazu kommen konnte, dass die Zerstörung der Umwelt solche Ausmaße angenommen hat, um zu verstehen, was man heute und in der Zukunft machen kann.
Ursachen der Umweltzerstörung
Mit ihrer Fortentwicklung hat die Menschheit die Quellen der Natur immer intensiver genutzt und dabei immer ausgefeiltere Techniken zur Herstellung von Produkten entwickelt.
Doch stets konnten die Menschen, sobald die Ressourcen der Natur an einem Ort oder einer Region knapp wurden, weiterziehen, um in anderen, üppiger ausgestatteten Regionen nach Nahrung suchen, konnten sie sich woanders niederlassen, um jungfräulichen Boden zu bestellen. Der Einfluss der Menschen auf die Natur blieb meist lokal beschränkt und so lange geringfügig, wie die Menschen nur für sich produzierten. Zwar führten auch im Altertum und im Mittelalter große Kriege und die damit verbundene Aufrüstung zum Abholzen ganzer Wälder, aber das Ausmaß dieser Eingriffe in die Natur blieb noch relativ begrenzt.
Erst mit dem Aufkommen des Kapitalismus änderten sich die Bedingungen. Der Kapitalismus ist die erste Produktionsweise, die sich immer mehr ausdehnen, immer mehr expandieren muss, um zu überleben. Daher muss diese Produktionsweise der gesamten Welt ihre Mechanismen aufzwingen - mit den entsprechenden globalen Konsequenzen. Die Umweltverschmutzung belastet Luft, Wasser und Boden, und da die Emissionen nicht an einem Ort der Erde verharren, sondern sich über den ganzen Erdball ausdehnen, sind die Auswirkungen nicht auf einen Ort der Erde beschränkt, sondern sie sind überall zu spüren.
Worin bestehen diese Mechanismen, die eine derartige Umweltverschmutzung hervorbringen?
Profitproduktion versus Produktion für die Bedürfnisse des Menschen
Der Kapitalismus produziert nicht für die Bedürfnisse der Menschen, sondern für den Profit, für den Tauschwert. Nicht der Gebrauchswert, d.h. nicht der Nutzen einer Ware für die menschlichen Bedürfnisse motiviert den Kapitalisten, er produziert, was sich verkaufen lässt.
Während in den früheren Produktionsformen Produkte hergestellt wurden, die dem täglichen Gebrauch dienten, sei es dem Konsum der Ausgebeuteten oder dem Luxusbedürfnis der Herrschenden, wird im Kapitalismus ausschließlich für Profit produziert.
Nutzen, Art, Zusammensetzung, Entstehung, Verwertung und Entsorgung der produzierten Waren sind dem Kapitalisten schnuppe – Hauptsache, es lässt sich damit Geld machen. Dieser Mechanismus führt dazu, dass im Kapitalismus Waren hergestellt werden, die oft nur einen geringen oder gar keinen Gebrauchswert haben.
Ist der Nutzen eines Produktes oft schon verschwindend gering, nimmt die Herstellung vieler Produkten noch absurdere Züge an. Es werden Produkte hin- und hertransportiert, nicht weil deren Beschaffenheit oder Veredelung dies verlangen würde, sondern weil die Herstellung bzw. Verarbeitung an verschiedenen Standorten für den einzelnen Kapitalisten kostengünstiger ist.
Beispiele gibt es genug: So wird Milch von Deutschland über die Alpen nach Italien transportiert, um dort zu Joghurt verarbeitet zu werden, bevor dieser wieder nach Deutschland über die Alpen zurückbefördert wird, um hier verkauft zu werden. Ein anderes Beispiel: PKWs werden heute aus einzelnen Bestandteilen an vielen verschiedenen Orten hergestellt, die durch halb Europa gekarrt werden, ehe sie in den riesigen Montagebetrieben zusammengebaut werden und vom Band laufen. Bevor eine Ware im Regal zum Verkauf bereitliegt, haben ihre Bestandteile in verschiedenster Form schon unzählige Kilometer zurückgelegt. Warum? Es ist das günstige Verhältnis zwischen Lohn- und Transportkosten, das den einzelnen Unternehmer dazu veranlasst, seine Produktion zu verlagern und auf verschiedene Standorte aufzuteilen.
So sind unglaublich umfangreiche Güterbewegungen entstanden, die bei einer vernünftigen Produktionsweise, die sich nicht nach den Profitinteressen des einzelnen Unternehmers richtet, sondern nach den Bedürfnissen der Menschen, nicht anfallen würden. Solange die Unternehmer ihre Güter hin und herkarren, nur weil in dem einen Ort billiger produziert werden kann als in dem anderen, lassen sich die weltweiten CO
Unsere Behauptung lautet also: Es ist die geradezu wahnhafte Logik eines Systems, das nicht für die Bedürfnisse der Menschen, sondern für Profit produziert, die den Kapitalismus dazu treibt, immer mehr Verkehr und damit immer größere CO2-Emissionen nicht vermeiden. Allein ein Drittel dieser Emissionen sind auf den Verkehr zurückzuführen. Ein Teil dieser vom Verkehr verursachten Emissionen ist aber auch dem Umstand geschuldet, dass aufgrund der Konzentration der immer weniger werdenden Arbeitsplätze in Ballungsgebieten jeden Tag Hunderte von Millionen Menschen pendeln müssen. Viele Arbeiter legen auf dem Weg zu ihrer Arbeit wahre Marathonstrecken zurück, oft stundenlang, mit entsprechendem CO2-Ausstoß. 2-Emissionen zu produzieren. Und die Prognosen der Wissenschaftler sagen ein weiteres enormes Wachstum des Transport- und Logistiksektors voraus...
Konkurrenz und Anarchie – bringen der Menschheit und der Natur den Tod
Ein weiteres Prinzip im Kapitalismus ist, dass jeder Kapitalist für sich produziert. Er steht in meist mörderischer Konkurrenz zu anderen Produzierenden. Weil somit jeder der Rivale des anderen ist, kann es keine Absprachen, keine Planung, kein gemeinsames Vorgehen geben, sondern nur ein Sich-Durchsetzen des einen auf Kosten des anderen. Leidtragender ist die Natur und damit letztendlich der Mensch. Denn die Konkurrenz hat zur Folge, dass bei der Erstellung eines Produktes nicht danach gefragt wird, ob der Bau der dafür notwendigen Fabrik im Einklang steht mit den Gegebenheiten der Natur, ob der Anbau eines landwirtschaftlichen Erzeugnisses gesamtwirtschaftlich, d.h. gesellschaftlich sinnvoll ist.
Die Folge: Unternehmer können Fabriken inmitten unberührter Landschaften errichten, weil sich dort leichter Rohstoffe fördern lassen oder mit billigen Löhnen produziert werden kann. Bauern bestellen die Felder mit Pflanzen, die ohne künstliche Bewässerung, ohne Unmengen von Pestiziden und Fungiziden usw. nicht gedeihen können, während sie an anderen Orten auf der Erde ohne all diese Hilfsmittel bzw. mit einem viel geringeren Aufwand gedeihen könnten. Mittlerweile reift in der Landwirtschaft ein Drittel der Ernteerzeugnisse mit künstlicher Bewässerung heran. Die Folge: zwei Drittel des weltweit vorhandene Süßwassers wird von der Landwirtschaft zur künstlichen Bewässerung benötigt.
Die Folgen des Raubbaus an der Natur sind bekannt: Überdüngung, Entzug des Grundwassers, Versalzung der Böden. So ist infolge der künstlichen Bewässerung weltweit ca. ein Viertel der landwirtschaftlichen Fläche durch Versalzung bedroht. Die langfristigen Auswirkungen dieser durch die Konkurrenz entstandenen Schäden an der Umwelt sind noch gar nicht abzusehen.
Wie lässt sich die Tatsache erklären, dass mehr als 150 Jahre Kapitalismus eine ökologische Trümmerlandschaft hinterlassen haben, dass die jeweiligen Konkurrenten – vom einzelnen Unternehmer bis hin zu den Staaten – nicht miteinander, sondern gegeneinander arbeiten? Stimmt es, was Rosa Luxemburg schon vor nahezu 100 Jahren schrieb?
„In dem Ganzen, das sich über Ozeane und Weltteile schlingt, macht sich kein Plan, kein Bewusstsein, keine Regelung geltend; nur blindes Walten unbekannter, ungebändigter Kräfte treibt mit dem Wirtschaftsschicksal der Menschen sein launisches Spiel. Ein übermächtiger Herrscher regiert freilich auch heute die arbeitende Menschheit: das Kapital. Aber seine Regierungsform ist nicht Despotie, sondern Anarchie. Erkennen und bekennen, dass Anarchie das Lebenselement der Kapitalsherrschaft ist, heißt in gleichem Atem das Todesurteil sprechen, heißt sagen, dass ihrer Existenz nur eine Gnadenfrist gewährt ist" (Rosa Luxemburg, Einführung in die Nationalökonomie, Gesammelte Werke, Ökonomische Schriften, Bd. 5, S. 578).
Solange es also keine Planung, keine Abstimmung über eine ökologisch vernünftige, auf Nachhaltigkeit abzielende Produktion gibt, werden die Mechanismen der kapitalistischen Produktion uns und unsere Umwelt weiter vergiften; denn der Kapitalist fragt nicht, was wo wie am vernünftigsten produziert werden kann. Und solange die Produktion nicht nach diesen Kriterien organisiert wird, werden die Müllberge, die Deponien und Kloaken weiter wachsen.
Nun sagen die selbsternannten Umweltschützer und andere, weil die Lage so dramatisch sei und die Welt durch die Umweltzerstörung vernichtet werde, müsse man sofort handeln. Sonst sei es zu spät... In der Tat läuft der Menschheit die Zeit davon. Jeder Tag Kapitalismus bedeutet weitere Zerstörungen und Schäden, die immer irreparabler werden. Die Frage ist, ob die von den Umweltschützern propagierten Maßnahmen die Umweltzerstörung verhindern können. An dieser Stelle wollen wir nur ein Beispiel anführen, um zu verdeutlichen, warum diese Maßnahmen nicht greifen können.
In Kyoto wurde 1997 ein Abkommen, unterzeichnet, das vorsieht, die CO2-Emissionen bis 2012 um X Prozent zu senken. Nun, abgesehen davon, dass in Anbetracht des gigantischen Anstiegs der COs-Emissionen und der daraus erforderlichen Maßnahmen die angestrebte Reduzierung von X Prozent lächerlich gering ist, ja nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein - was hat der Beschluss selbst bewirkt? Einige Länder haben sich an die Vorgaben gehalten, andere dagegen haben noch mehr CO2 emittiert. Unter dem Strich hat der globale CO2-Ausstoß noch weiter zugenommen. Ein Land, das weniger CO2 ausstößt, kann mehr ausstoßen, indem es Geld von einem anderen, mehr ausstoßenden Land erhält, das angeblich für umweltfreundlichere Produktion benutzt werden soll. So werden weltweit nicht die globalen Emissionen gesenkt, sondern nur verlagert.
Weil man das Problem mittels finanzieller Anreize und „Sanktionen" zu regeln versucht, anstatt an seiner Wurzel zu packen, hat der kapitalistische Unternehmergeist keine substanziellen Reduzierungen hervorgebracht, sondern.... eine Emissionenbörse. Man betreibt Schacher mit den Emissionen.
Zudem hat ausgerechnet die größte Industrienation der Welt, die USA, das Abkommen nicht unterzeichnet. Die Bush-Regierung rechtfertigte ihre Weigerung mit der Verteidigung der Konkurrenzfähigkeit der US-Wirtschaft, die durch eine Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls bedroht sei.
Die bald zweitgrößte Industriemacht, der neue Wachstumsstar China, wurde als Entwicklungsland eingestuft, genau so wie Indien – mit besonderen Konzessionen. Doch China ist nicht nur bei den Wachstumszahlen, sondern auch in der Umweltverschmutzung Spitzenreiter. Allein zwei Drittel der chinesischen Städte können beispielsweise nur auf verseuchtes, gesundheitsgefährdendes Trinkwasser zurückgreifen. Ähnliches, wenn auch in etwas geringerem Maße, trifft auf Indien zu. Sollten diese Länder tatsächlich eines Tages mehr Umweltschmutzmaßnahmen ergreifen, so würden sich ihre Produktionskosten erhöhen, die Wettbewerbsvorteile würden im Nu dahinschmelzen, und der Boom in China und in Indien käme zum Erliegen. Tatsache ist, dass man in Anbetracht der bislang registrierten Umweltschäden und Erkrankungen jetzt schon vorhersehen kann, dass es zu einem ökologischen Super-Gau in China und Indien kommen wird; große Gebiete werden aufgrund der ökologischen Zerstörungen unbewohnbar werden. Die Konsequenzen sind unvorstellbar.
Kurzum: Die ökologischen Reformen, die die Umweltschützer vorschlagen, setzen also keineswegs die Mechanismen des Kapitalismus außer Kraft.
Die Folgen der Dekadenz
Nun, diese verheerenden Mechanismen sind untrennbar mit dem kapitalistischen System verbunden und bestehen seit seinem Beginn. Es stand diesen Widersprüche von Anfang an in den Genen geschrieben, eines Tages die Menschheit in die Zerstörung zu stürzen. Die verheerenden umweltzerstörenden, und gesundheitsschädlichen Auswirkungen dieser Produktionsweise wurden schon früh ersichtlich, doch nachdem der Kapitalismus 1914 in seine Niedergangsphase eingetreten ist, hat die Umweltverschmutzung ganz andere Dimension angenommen. Die Zuspitzung des Konkurrenzkampfes, Weltkriege, lokale Kriege ohne Unterbrechung und der Militarismus hatten und haben katastrophale Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.
Rückblickend kann man sagen, dass uns viele tödliche, giftige Hinterlassenschaften des Kapitalismus erspart geblieben wären, wenn der Kapitalismus in der revolutionären Welle von Kämpfen 1917-23 überwunden worden wäre. Die Perspektiven der Menschheit würden heute anders aussehen.
Theoretische Fragen:
- Umwelt [24]
Klassenbewusstsein - Motor der Revolution
- 3426 reads
Für das Proletariat ist sein Bewußtsein seine wichtigste und entscheidende Waffe, ohne die es seine historischen Interessen nicht durchsetzen kann. Da wir jetzt in einem Zeitraum leben, in dem die Entscheidung für den Kommmunismus oder die Barbarei gefällt wird, ist die Frage des Bewußtseins von grundsätzlicher Bedeutung.
Die nachfolgenden Artikel wurden Mitte der 1980er Jahre während einer Debatte der IKS zur Frage der Entwicklung des Klassenbewusstseins veröffentlicht.
Klassenbewußtsein, Motor der Revolution
Für das Proletariat ist sein Bewußtsein seine wichtigste und entscheidende Waffe, ohne die es seine historischen Interessen nicht durchsetzen kann. Da wir jetzt in einem Zeitraum leben, in dem die Entscheidung für den Kommmunismus oder die Barbarei gefällt wird, ist die Frage des Bewußtseins von grundsätzlicher Bedeutung.
Die Bourgeoisie versucht das Proletariat in einen Nihilismus zu treiben, ihm seine Orientierung zu nehmen und die Perspektiven zu verdecken, um es so später zu besiegen und in den Krieg zu führen.
Vor allem möchte die Bourgeoisie das Proletariat in den Sumpf des Apolitismus drängen. Das Klassenbewusstsein ist hauptsächlich ein politisches Bewußtsein; ein Bewußtsein über die Notwendigkeit der Verstärkung des Klassenkampfes gegen den bürgerlichen Staat, für seine Zerstörung und für den Aufbau des Kommunismus. Dieses Bewußtsein setzt das Begreifen voraus, daß das Proletariat in seinen Reihen eine eigene politische Partei schaffen muß, die sein Bewußtsein über den Kommunismus vertieft und ausbreitet. Während die Bourgeoisie in den 70er Jahren das Proletariat für ihre Alternativen zu begeistern suchte (Demokratie, Antifaschismus, Verstaatlichungen usw.), muß sich die Bourgeoisie in Anbetracht des Verschleißes dieser Mythen, der sich vertiefenden Krise und dem Voranschreiten des Klassenkampfes bemühen, die Entpolitisierung zu verstärken. So will sie verhindern, daß die Verwerfung der Politik der Bourgeoisie zu einer Entfaltung der autonomen proletarischen Politik führt.
Deshalb ist eine Diskussion über das Wesen, die Funktion und den Prozeß der Entwicklung des revolutionären Bewußtseins eine grundlegende Frage der militanten Arbeit der Revolutionäre. In diesem ersten Teil der Artikelserie wollen wir uns zunächst mit der Rolle des Bewußtseins in der Geschichte und einer Beschreibung des Wesens des Klassenbewußtseins befassen.
Bei der Entwicklung der Menschheit kann man 3 Faktoren hervorheben: die Natur, die Entwicklung der Produktivkräfte und das Bewußtsein. Die Natur, die über einen langen Zeitraum hinweg ein entscheidender Faktor war, wurde durch die Entwicklung der Produktivkräfte stark gebändigt, die nun mit dem Kapitalismus eine entscheidende Stufe erreichten: sie legten die Grundlagen für die Überwindung des Mangels und der Misere und die bewußte Vereinigung der gesamten Menschheit. Aber dies führt uns zum 3. Faktor, dem Bewusstsein.
Jahrhundertelang war das Bewußtsein ein zweitrangiger und untergeordneter Faktor in der Entwicklung derMenschheit. Erstens weil es ein verschleiertes Bewußtsein der Wirklichkeit war, denn die ausbeutenden Klassen haben es immer der Verteidigung ihrer Interessen untergeordnet. Zweitens weil es hauptsächlich eine betrachtende Widerspiegelung der vorher stattgefundenen Veränderungen der Infrastruktur der Gesellschaft war. Das Bewußtsein hat in den historischen Prozessen eine Rolle gespielt, aber in letzter Instanz war der entscheidende Faktor die Umwälzung der Produktivkräfte und der Produktionsverhältnisse, die wiederum das Bewußtsein bestimmt haben. Mit dem Erscheinen des Proletariats muß der Faktor Bewußtsein zum Motor der Entwicklung der Menschheit werden.
- Erstens weil das Proletariat gleichzeitig als ausgebeutete und revolutionäre Klasse nicht das geringste Interesse daran hat, ein falsches Bewußtsein der Welt zu haben, oder sich über seine eigenen historischen Klasseninteressen Illusionen zu machen - die Abschaffung der Ausbeutung und der Klassen setzt ein umfassendes Verständnis der Welt voraus, das weder Tabus, noch irgendwelche Einschränkungen akzeptieren kann.
- Zweitens erfordert und läßt die von den Produktivkräften erreichte Entwicklung der Menschheit es möglich werden, daß die Arbeiterklasse die Kontrolle und die bewußte Orientierung über diese Produktivkräfte ausübt. In der geschichtlichen Existenz des Proletariats liegt die Lösung für den Widerspruch, in dem der Kapitalismus die ganze Menschheit, gefangen hält: einerseits hat er auf phantastische Weise die Produktivkräfte umgewälzt, sie weltweit vorangetrieben, andererseits läßt seine gesellschaftliche Grundlage - das Privateigentum an Produktionsmitteln, die Ausbeutung der Lohnarbeit - sie zu erschreckenden Zerstörungskräften werden, die die Gesellschaft in eine Krise versinken lassen, welche die Bedrohung einer Auslöschung der Menschheit in einen neuen Holocaust eines 3. Weltkrieg bedeutet.
Das revolutionäre, bewußte Handeln des Proletariats stellt eine positive Lösung des historischen Widerspruches zwischen Krieg und Revolution, Barbarei oder Kommunismus dar.
"Der Kommunismus unterscheidet sich von allen bisherigen Bewegungen dadurch, daß er die Grundlage aller bisherigen Verkehrsverhältnisse umwälzt und alle naturwüchsigen Voraussetzungen zum ersten Mal mit Bewußtsein als Geschöpfe der bisherigen Menschen behandelt, ihrer Naturwüchsigkeit entkleidet und der Macht der vereinigten Individuen unterwirft" (Die deutsche Ideologie, MEW Band 3, S.70).
DIE ERSTE BEWUSSTE REVOLUTION IN DER GESCHICHTE
Aufgrund seines Zieles, seiner Mittel und des Prozesses seiner Verwirklichung ist der Kommunismus die erste bewußte Revolution der Geschichte.
Sein Ziel ist die volle Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse. Das Ziel des Kapitalismus besteht nicht in der Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse, sondern in der Produktion von Mehrwert, was eine allgemeine Misere für die Arbeiter bedeutet, die nur in Zeiten wirtschaftlichen "Wohlstands" überdeckt wird.
Dagegen ist der Kommunismus die Organisierung des gesellschaftlichen Lebens in ihrer Gesamtheit für die volle Verwirklichung der menschlichen Bedürfnisse. Er beinhaltet die weltweite bewußte Kontrolle und Planung der Produktivkräfte, ihrer Ausrichtung und ihrer Entfaltung.
Die Mittel für die Verwirklichung des Kommunismus sind die menschliche Weltgemeinschaft, die das bewußte Ergebnis der Diktatur des Proletariats sein wird, die wiederum die notwendigen Bedingungen schaffen wird, damit die Gattung Msnsch bewußt und frei ihre Geschichte bestimmen kann.
"Das Subjekt der kommunistischen Revolution, das Proletariat, ist aufgrund seiner Stellung in der Geschichte Träger einer Bewußtseinsform, die eine wirkliche und keine verschleierte, eine globale und keine partielle, eine aktive und keine rein widerspiegelnde Erkenntnis der Welt besitzt.
"Die Aneignung ist ferner bedingt durch die Art und Weise, wie sie vollzogen werden muß. Sie kann nur vollzogen werden durch eine Vereinigung, die durch den Charakter des Proletariats selbst wieder nur eine universelle sein kann, und durch eine Revolution, in der einerseits die Macht der bisherigen Produktions- und Verkehrsweise und gesellschaftlichen Gliederung gestürzt wird und andererseits der universelle Charakter und die zur Durchführung der Aneignung nötige Energie des Proletariats sich entwickelt, ferner das Proletariat alles abstreift, was ihm noch aus seiner bisherigen Gesellschaftsstellung geblieben ist." (ibid S.68)
Zwischen der kommunistischen Revolution und allen vorherigen Revolutionen gibt es einen gewaltigen Unterschied. Wie alle früheren Revolutionen ist sie notwendigerweise eine gewalttätige und ersetzt die Macht einer Klasse durch die einer anderen. Aber hier hören auch schon die Gemeinsamkeiten auf. Das Proletariat zielt nicht darauf ab, eine neue Form der Ausbeutung zu errichten, sondern sie abzuschaffen.
Es strebt nicht danach, seine Herrschaft als neue Klasse aufrechtzuerhalten, sondern alle bestehenden Klassen abzuschaffen. Im Gegensatz zu der Bourgeoisie besitzt es keine ökonomische Macht, auf deren Grundlage es die politische Macht erobern könnte, sondern es ist vollkommen "besitzlos", seine einzigen Waffen sind die Grundlage der zukünftigen Gesellschaft: die Einheit und das Klassenbewußtsein.
All das wird von vielen Revolutionären außer Acht gelassen, die die Auffassung von der Revolution verteidigen, welche sich auf die Modelle der Bourgeoisie stützen und denen gemeinsam ist, daß sie alle die entscheidende Rolle des massiven Bewußtseins des Proletariats verkennen.
So fassen die Rätekommunisten die proletarische Revolution als das spontane Ergebnis der Zuspitzung der Wirtschaftskrise auf, die die Arbeitermassen zu einer revolutionären Radikalisierung zwingen würde. Solch eine Betrachtungsweise stützt sich auf die bürgerliche Revolution, deren wirtschaftlichen Erschütterungen der alten Ordnung die Massen auf die Straße jagen würden, die dann wiederum als Werkzeug durch die Bourgeoisie bei der Eroberung ihrer Macht mißbraucht wurden. So wird die entscheidende Rolle des Bewußtseins in der proletarischen Revolution außer Acht gelassen, die sich nämlich als bewußte Reaktion gegen die Todeskrise des Kapitalismus entwickelt.
Die Bordigisten vertrauen nur der Partei, die einziger Träger des Bewußtseins sei und die Massen zur Revolution führe. Solch ein Modell stammt aus bürgerlichen Vorstellungen, in der eine politische Minderheit die Unzufriedenheit und den Kampf der Massen für die Ziele der Bourgeoisie ausnützt, da diese kein Bewußtsein
entfalten könnten. Um seine Befreiung durchzusetzen, muß das Proletariat sich voll der Ziele und Mittel seines Kampfes bewußt werden, denn dieser Kampf kann von keiner Minderheit durchgeführt oder ihr delegiert werden. Diese Auffassungen lassen außer Acht, "daß also die Revolution nicht nur nötig ist, weil die herrschende Klasse auf keine andere Weise gestürzt werden kann, sondern auch, weil die stürzende Klasse nur in einer Revolutlon, dahin kommen kann, sich den ganzen alten Dreck vom Halse zu schaffen und zu einer neuen Begründung der Gesellschaft befähigt zu werden." (Die deutsche Ideologie MEW Band 3, S. 70).
DAS WESEN DES KLASSENBEWUSSTSEINS
Das Klassenbewußtsein bedeutet für das Proletariat die Kenntnis seiner selbst - nicht nur seiner unmittelbaren Existenz als vom Kapital ausgebeuteten Klasse, sondern seiner geschichtlichen Existenz als Trägerin des Kommunismus. Deshalb ist das Klassenbewußtsein kein einfaches Begreifen des Proletariats, sondern gleichzeitig ein umfassendes Verständnis seiner gegenwärtigen Lage und vor allem seiner Zukunft.
Von den 3 Momenten der Wirklichkeit, die untrennbar mit dem Bewußtsein verbunden sind (Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft) ist die Zukunft das richtungsweisende Element. Für das Proletariat ist die Zukunft ein aktives Element, weil ein zu verwirklichendes Ziel. Sie ist die Grundlage der Handlung, der Wille zum Handeln wird durch sie genährt, sie ist der Kompaß im Bewußtwerdungsprozeß, der Maßstab, der es ermöglicht, den zurückgelegten Weg zu messen, ihn zu korrigieren und den noch austehenden Weg abzuschätzen, der Bezugspunkt zur Aufrechterhaltung der allgemeinen Orientierung, der Anziehungspunkt und daher dynamische Faktor in diesem Prozess.
All das führt dazu, daß sich das Wesen des Klassenbewußtsein des Proletariats grundlegend von der Ideologie und dem bürgerlichen "Wissen" unterscheidet.
1) Für das Proletariat ist das Bewußtsein ein aktiver Faktor eine materielle Kraft. Es ist keine bloße Widerspiegelung der objektiven Bedingungen und der lebendigen Erfahrung sondern entsteht aus der Existenz des Proletariats, beeinflußt seine Kämpfe (genau wie es von ihnen selbst beeinflußt wird), bis es zu einem entscheidenden Faktor bei seinen Handlungen wird (in der revolutionären Periode).
Dagegen ist die bürgerliche Ideologie hauptsächlich eine betrachtende Wiederspiegelung der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse, sie kann immer nur eine Rechtfertigung der Gesellschaftsordnung sein. Diese Bewußtseinsform ist charakteristisch für eine ausbeutende K1asse, die eine wirtschaftliche Macht in der Gesellschaft besitzt und deren Hauptinteresse in der Verteidigung der Ausbeutungsgesellschaft besteht.
2) Das Bewußtsein des Proletariats stellt eine historische Kontinuität dar. Es ist kein für immer etabliertes Dogma, (was eine statische und somit die Aufrechterhaltung der gegenwärtigen Verhältnisse befürwortende Auffassung wäre), sondern entwickelt sich, indem es in einer höher entwickelten Synthese die Errungenschaften der Kämpfe und die durch die geschichtliche Entwicklung entstandenen Veränderungen integriert. Das Bewußtsein taucht nicht bei dem jeweiligen Entflammen der Kämpfe jeweils wieder neu auf, um danach wieder spurlos zu verschwinden, sondern es hält eine historische Kontinuität aufrecht, die die Grundlage ihres aktiven und militanten Wesens ist.
3) Es handelt sich um ein politisches Bewußtsein. So ist es keine reine Erkenntnis der ökonomischen Lage der Arbeiterklasse, auch keine ökononisch-soziologische Untersuchung der gegenwärtigen Lage und genausowenig ein Reformkatalog um die Welt zu verbessern, sondern eine militante Waffe der revolutionären Klasse, um die Macht der herrschenden Klasse zu zerstören und die eigene Klassenherrschaft zu errichten. .......
4) Es hat einen kollektiven Charakter. Das Proletariat kann seine Revolution nur durchführen, wenn es voll bewusst kämpft, ohne dabei seine Macht an irgendeine Minderheit zu delegieren oder auf andere Kräfte zu vertrauen.
Die Grundlagen des kollektiven Wesens des Bewußtseins des Proletariats findet man auf zwei Ebenen:
erstens sein Ursprung. Das Bewußtsein entstammt nicht dem Gehirn einer Handvoll von geniereichen Individuen, genausowenig ist es die Summe dessen, was alle Arbeiter denken- es entsteht vielmehr aus dem gesamten Proletariat, dh. gleichzeitig aus seiner historischen Stellung und der historischen Kontinuität seines Kampfes als weltweite historische Gesamtheit. Als ausgebeutete Klasse, in deren Reihen es keine spezifischen Interessen gibt, ist die Vorbedingung für ihre Selbstorganisation, die Entfaltung ihrer Einheit, ihrer Solidarität, ihrer gemeinsamen Handlungen, ihr Bewußtsein als kollektives Ganzes; all das macht ihre Stärke aus.
- zweitens sein Ziel. Die kommunistische Revolution, die gigantischste Umwälzung der Geschichte, das Ende der Herrschaft des Mangels und der Anfang der Herrschaft der Freiheit können als Ausgangspunkt nicht unbewußte und desorganisierte Handlungen der Proletariermassen haben, sondern erfordern als Grundvoraussetzung ihre massive und bewußte Teilnahme, ihre Fähigkeit, den revolutionären Prozeß kollektiv zu leiten. Die Befreiung der Arbeiterklasse kann nur das Werk der Arbeiterklasse selbst sein.
Es geht nicht darum, daß statistisch gesehen alle Arbeiter das gleiche Niveau an Klarheit hätten (das ist eine kindische Auffassung, die von dem individuellen bürgerlichen Denken geprägt ist), sondern es geht um die massive Aktivität der Klasse, ihres Kampfes, ihrer Entschlossenheit, die kollektiven Diskussionen, die Überzeugung, für die schrittweise die große Mehrheit der Arbeiter gewonnen werden muß. .......
5)Schließlich entwickelt und gipfelt das Klassenbewußtsein in der Vereinigung von Theorie und Praxis. Die Ausbeutungsgesellschaft zwingt die Spaltung zwischen geistiger und manueller Arbeit, zwischen Theorie und Praxis auf. Die Theorie ist das Monopol einer Minderheit von Spezialisten, die die Mehrheit zu assimilieren, ihr passiv zuzustimmen habe. Das Bewußtsein des Proletariat unterscheidet sich davon gewaltig. Es ist Ausdruck seines bewußten Seins und entspricht zutiefst seinen Denkweisen, seinen Zielen, Initiativen und Überlegungen.
"Das Verdienst Marx und Engels besteht nicht darin, wie die Bourgeoisie glaubt, dem Proletariat ihre Ideen aufgezwungen zu haben, sondern die Ideen des Proletariats zum Ausdruck gebracht zu haben. Sie haben das ausgedrückt was in Millionen von Köpfen sich entfaltet, sie haben dem Proletariat geholfen sich über diesen Prozeß bewußt zu werden ...
Der kommunistische Agitator versucht die Arbeiter zu sich selbst zu bringen. Er gibt nicht vor, ihnen etwas aufzuzwingen was ihnen fremd ist, sondern sie zu dem zu bringen, was ihnen wirklich eigen ist."
(0. Strasser, Der Arbeiter und die Nation).
"Er will das Bewußtsein über diese Tatsache etablieren, er will also, wie die übrigen Theoretiker nur ein richtiges Bewußtsein über ein bestehendes Faktum hervorbringen, während es dem wirklichen Kommunisten darauf ankommt das Bestehende umzustürzen." (ibid S.42)
Als dynamische Kraft ist das Klassenbewußtsein für das Proletariat in seinem Kampf gegen den Kapitalismus und für die Herausarbeitung von Perspektiven ein praktisches Bewußtsein und gleichzeitig eine bewußte Praxis.
Soweit zu einigen allgemeinen Charakteristiken des Bewußtseins. In einem nächsten Artikel werden wir den konkreten Prozeß untersuchen, in dem das Proletariat bewußt wird und dieses Bewußtsein in der ganzen Klasse homogener wird.
(aus Accion Proletaria, Zeitung der IKS in Spanien) Nr. 16, 1984,
Teil 2: aus Weltrevolution Nr.19, 1985,
Klassenbewusstsein – Motor der Revolution
Dieser Artikel ist Teil einer Reihe von Artikeln, die wir in Weltrevolution Nr.16 angefangen haben, und die sich mit dem Klassenbewußtsein befassen. In dem letzten Artikel haben wir die Rolle des Bewußtseins in der Geschichte der Menschheit behandelt, um die Grundlagen aufzuzeigen, warum das Bewußtsein des Proletariats eine neue und höhere Form des Bewußtseins darstellt, welches das Bewußtsein der Menschheit von der Notwendigkeit des Kommunismus ankündigt.
In diesem Artikel werden wir aufzeigen, wie das Proletariat sein Bewußtsein entwickelt, welchen Prozeß es dabei durchläuft und welche Überreste des Drucks der bürgerlichen Ideologie es dabei über Bord werfen muß, um letztendlich ein klares, kollektives Bewußtsein seiner historischen Aufgabe und der Mittel, sie zu verwirklichen, zu entfalten.
Klassenbewusstsein und Bewusstsein der Klasse
Weil das Proletariat gleichzeitig eine ausgebeutete und revolutionäre Klasse ist, kann sein Klassenbewußtsein nicht zu jedem Zeitpunkt die gleiche Ausdehnung und die gleiche Tiefe haben, weil es ständig folgenden Faktoren unterworfen ist:
- dem Druck der herrschenden Ideologie,
- dem Einfluß und dem Gewicht der verschiedenen Traditionen,. seinem unterschiedlichen Konzentrationsgrad, der Stellung in der Wirtschaft, Kultur usw.,
- den Auswirkungen der normalen Bewegungen des Kapitalismus, der das Proletariat atomisieren und die Konkurrenz in seinen Reihen verstärken will.
"Die grundlegende Schwierigkeit der sozialistischen Revolution besteht in dieser komplexen und widersprüchlichen Lage; einerseits kann die Revolution nur als bewußte und von der großen Mehrheit der Arbeiter getragenen Revolution stattfinden, andererseits stößt dieser Bewußtwerdungsprozeß mit den von der kapitalistischen Gesellschaft den Arbeitern aufgezwungenen Bedingungen zusammen, die die Bewußtwerdung über die historischen Aufgaben des Proletariats ständig zu behindern und zu zerstören suchen" (INTERNATIONALISME, "Zur Natur und Funktion der Partei"(1)).
Die Bewegung des Klassenkampfes besteht in einer Dynamik, die von der Heterogenität zur Homogenität, von einer bewußten Minderheit zu einem massiven, in den breiten Arbeitermassen vorhandenen Bewußtsein verläuft. Den schwierigen und widersprüchlichen Bewußtwerdungsprozeß zu verstehen, heißt das "Geheimnis" der proletarischen Revolution zu begreifen: die historische Dynamik, mit Hilfe derer die Arbeiterklasse, die die gesamte Unmenschlichkeit der bürgerlichen Gesellschaft zu ertragen hat, zum bewußten Träger der Befreiung der Menschheit wird.
Die Fähigkeit des Proletariats, ein ständiges Bewußtsein seines Seins und seiner Aufgabe zu haben, zeigt sich am deutlichsten in dem Auftauchen von kommunistischen Minderheiten in seinen Reihen, welche dieses Bewußtsein ausdehnen und vertiefen (wir werden diesen Punkt an anderer Stelle ausführlich behandeln). Um diesen Bewußtwerdungsprozeß zu begreifen, müssen wir beim Klassenbewußtsein zwei Aspekte oder Dimensionen unterscheiden: das Klassenbewußtsein, und das zu einem bestirnten Zeitpunkt vorhandene Bewußtsein in der Klasse, oder anders ausgedrückt: seine Tiefe und Ausdehnung.
Obwohl beide Teil der gleichen unteilbaren Einheit sind und sich gegenseitig beeinflussen, dürfen sie nicht miteinander verwechselt werden. Das Klassenbewußtsein ist das Bewußtsein seiner Selbst, das das Proletariat nicht nur hinsichtlich seiner unmittelbaren Zukunft entwickelt, sondern vor allem hinsichtlich seiner kommunistischen Zukunft. Das Bewußtsein in der Klasse hängt von einer Reihe von Faktoren ab, insbesondere von der Entwicklung des Kräfteverhältnisses zwischen der Bourgeoisie und dem Proletariat. "Die Ideen der herrschenden Klasse sind die herrschenden Ideen in der Gesellschaft" schrieb Marx; das bedeutet, der Bewußtwerdungsprozeß wird ständig durch den brutalen Druck der herrschenden Ideologie erschwert, und nur die Verstärkung der Kämpfe sowie der Ausbau der historischen Errungenschaften kann die Macht der bürgerlichen Ideologie zerbrechen. So tragen auch die Wirtschaftskrise und der sich daraus ergebende Zerfall der Werte der bürgerlichen Gesellschaft zur Verstärkung des Klassenbewußtseins bei.
Die beiden Dimensionen des Bewußtseins, Tiefe und Ausdehnung durchschreiten nicht immer die gleiche Bewegung, ebenso wenig dürfen sie in den revolutionären Zeiträumen miteinander verwechselt werden, d.h. das erste löst sich nicht in der zweiten Bewegung auf. Das Klassenbewußtsein ist ständig vorhanden: die ständige Ausarbeitung, das Voranschreiten seiner politischen Positionen und seines Programms; das Bewußtsein in der Klasse schwankt dagegen je nach der Epoche, und es fällt in den Zeiten der siegreichen Konterrevolution in sich zusammen, weicht zurück, um bei den nächsten bedeutenden aufsteigenden Kämpfen wieder zuzunehmen und in den revolutionären Phasen seinen Höhepunkt zu erreichen.
Das Klassenbewußtsein hängt nicht ausschließlich von den Arbeiterkämpfen ab. Obgleich diese eine große Bereicherung darstellen, und vor allem zu seiner Ausdehnung beitragen, werden sie ebenso von den politischen Positionen des Proletariats bestimmt, welche dieses im Verlaufe seines weltweiten historischen Kampfes entwickelt.
Wenn das Klassenbewußtsein ausschließlich von den Kämpfen abhinge und nach deren Ende jedesmal wieder verschwinden würde, würde es aufhören, ein aktiver Faktor zu sein und würde anstelle dessen ein empirisches und unmittelbares Wissen darstellen, das sich durch nichts von der bürgerlichen Ideologie unterscheiden würde. Es wäre nicht mehr die Stimme und die Stärke einer Klasse, die die Zukunft der Menschheit darstellt; es bliebe ein passiver Zeuge der blinden Kämpfe einer Klasse ohne Zukunft. Das Klassenbewußtsein kann nicht auf die Momente des Kampfes selber reduziert werden, es hat einen viel breiteren Weg zurückzulegen, umfaßt gleichzeitig die tag-täglichen Kämpfe der Klasse wie auch die Zeiträume seiner revolutionären Aktionen. Ebenso umfaßt es die unterirdische Reifung, die die Arbeiterklasse, insbesondere die Aktivitäten ihrer kommunistischen Organisationen durchläuft.
Jede Etappe des Klassenkampfes beruht auf einer Vorbereitung und Reifung des Klassenbewußtseins und wird wiederum auf dialektische Weise durch dieses bereichert und verändert, so daß die neuen Kämpfe der Klasse auf einer breiteren und weiter fortgeschrittenen Grundlage anfangen. Von einem historischen Standpunkt aus betrachtet, ist das Klassenbewußtsein der historische rote Faden der Arbeiterkämpfe, der diese ständig orientiert auf dem Weg hin zu der Selbstverwirklichung des Proletariats, dem Kommunismus.
Die kommunistischen Gruppen haben bei dem Bewußtwerdungsprozeß eine Hauptrolle zu spielen. In den dunkelsten Zeiten der Konterrevolution aber auch in den Phasen des zeitweiligen Zurückweichens des Klassenkampfes oder einfach in Anbetracht der Schwankungen oder Zögerungen, die in der Klasse auftauchen, haben sie die Verantwortung, die Entwicklung des Klassenbewußtseins voranzutreiben und zu versuchen, es in der gesamten Klasse zu verbreitern. Das heißt nicht, daß sie ein Monopol des Bewußtseins besäßen und daß die Mehrheit der Arbeiter dieses Bewußtsein nur passiv assimilieren könnten.
An erster Stelle sprechen wir von einem Bewußtsein, das aus der Existenz des Proletariats als Träger und Kämpfer eines historisch-weltweiten Kampfes selbst hervorgeht. Wir meinen damit nicht, daß das Bewußtsein außerhalb des Proletariats entstünde, unter den bürgerlichen Intellektuellen, und daß von diesen dann das Bewußtsein in das Proletariat - wie Kautsky meinte - von Außen "eingeimpft" würde.
Zweitens muß man immer die Bewußtwerdung in ihrer Gesamtheit und nicht nur zu einem gegebenen Zeitpunkt betrachten. Das Proletariat nimmt an dieser Bewußtseinsentwicklung insgesamt teil, und nicht nur die Kommunisten.
Das Proletariat in seiner Gesamtheit durchläuft einen mehr oder weniger ausgedehnten unterirdischen Reifungsprozeß seines Bewußtseins (der berühmte alte Maulwurf, von dem Marx sprach). Es vollzieht sich ein umfassender Prozeß der Reflektion, Kritik, Infragestellung, der in den Reihen der Arbeiter Gestalt annimmt und in den Zeiten intensiver Kämpfe ans Tageslicht tritt, vor allem während der revolutionären Zeiträume (2). Deshalb wäre man blind, wenn man dies nicht erkennen würde. Gerade weil der bürgerliche Staat und insbesondere die Linken und die Gewerkschaften einen Druck ausüben, kann dieser Reifungsprozeß nicht ständig ans Tageslicht treten. Daher haben die Revolutionäre die Aufgabe, ihn laut auszusprechen, ihm seine gesamte historische Dimension zu verleihen. Darüber hinaus bringen die Kämpfe selbst Korrekturen und für das Bewußtsein der Klasse unabdingbare Vertiefungen und Erweiterungen mit sich, vor allem in den revolutionären Phasen.
Die Klasse besitzt ein kollektives Gedächtnis, vor allem in den konzentriertesten und am meisten fortgeschrittenen Teilen, die auch die größten Traditionen haben. Dieses Gedächtnis wirkt wiederum direkt auf die Kämpfe ein. Weil die Bourgeoisie mit Hilfe ihrer Gewerkschaften und der Extremen Linke dieses Bewußtsein entstellt, verzerrt, müssen die Revolutionäre dieses Bewußtsein vorantreiben, damit es seine Rolle in den Kämpfen voll erfüllt.
Aber die Kommunisten erweitern und vertiefen dieses Bewußtsein nicht außerhalb des Lebens der Klasse in einer Welt abstrakter Gedanken, die man in die Massen in Gestalt von agitatorischen Lösungen einzugehen hätte. Im Gegenteil: die Grundlage und die Ebene ihrer Intervention und ihrer Reflektion ist der Klassenkampf, den man auf historischer und weltweiter und nicht auf örtlich begrenzter und unmittelbarer Ebene betrachten muß.
Die theoretischen Sätze der Kommunisten beruhen keineswegs auf Ideen, auf Prinzipien, die von diesem oder jenem Weltbesserer erfunden oder entdeckt sind. Sie sind nur allgemeine Ausdrücke tatsächlicher Verhältnisse eines existierenden Klassenkampfes, einer unter unseren Augen vor sich gehenden geschichtlichen Bewegung" (Manifest der Kommunistischen Partei, MEW 4, S. 474).
Obgleich die Kommunisten die besondere Aufgabe der Ausarbeitung des Klassenbewußtseins haben, entsteht dieses wiederum nicht als ein Monopol der revolutionären Organisationen, das ihnen die Klasse überlassen hätte.
Nur indem die Revolutionäre den Prinzipien des Proletariats treu bleiben und praktische Antworten auf die Probleme haben die sich im Laufe der Bewegung stellen, erfüllen sie ihre Rolle. Auch sind die Revolutionäre nicht immer gegenüber dem Druck der bürgerlichen Ideologie immun, genau wie die Klasse insgesamt leiden sie auch darunter und müssen dagegen ankämpfen.
Klassenbewusstsein und kommunistisches Programm
Weil es eine Klasse ist, die als Endziel die bewußte Umwälzung der Welt anstrebt, muß das Proletariat die Ziele seines Kampfes sowie die Mittel ihn voranzutreiben, in einem Prinzipiensystem festhalten: das muß das kommunistische Programm sein.
Das kommunistische Programm hat nichts mit den Programmen der bürgerlichen Parteien gemeinsam, die aus einem Katalog demagogischer Forderungen bestehen, welche dazu bestimmt sind, das Proletariat zu verwirren und dessen Bruch mit dem Kapitalismus zu verhindern. Im Gegenteil: das kommunistische Programm ist der Ausdruck der Avantgarde des Bewußtseins des Proletariats, die Speerspitze seiner Entfaltung - sowohl bei der Vertiefung als auch bei der Ausdehnung. Das Programm spielt eine klärende, erleuchtende Rolle, das zur Stärke und Einheit der Klasse treibt. Die Ausarbeitung und Verteidigung des kommunistischen Programms ist die besondere und ständige Aufgabe der revolutionären Organisationen des Proletariats. Das heißt nicht, das Programm wäre ein vom Bewußtwerdungsprozeß des gesamten Proletariats getrenntes Element, sondern es ist der lebendigste Faktor, die systematischste und mächtigste Kraft. Es faßt die gewaltige Menge an Erfahrung, Reflektion und Tendenzen des Proletariats in klaren und Handlungsweisen aufzeigenden Prinzipien zusammen.
Das kommunistische Programm ist keine Doktrin, die den Massen eingegeben werden müßte, welche sie dann nur noch passiv zu folgen hätten.
Das kommunistische Programm hat einen weltweit gültigen Charakter. Es ist keine einfache Wiederholung von Prinzipien, auch soll durch seinen internationalen Charakter nicht geleugnet werden, daß es in jedem Land besondere Schwierigkeiten und spezifische Faktoren zu berücksichtigen gibt.
An erster Stelle ist also das Programm eine Waffe für den Kampf, eine Methode, um die Kämpfe zu analysieren und zu orientieren, deren Besonderheiten erst im Licht der historisch weltweiten Erfahrung verstanden werden können.
Das kommunistische Programm ist kein unabänderliches Dogma, wie die Bordigisten behaupten, die davon ausgehen, daß das kommunistische Programm seit 1848 bis heute unverändert gelte, sondern eine Gesamtheit von schrittweise, im Laufe des historischen Kampfes des Proletariats ausgearbeiteten Positionen. Die neuen "Daten", "Elemente", die sowohl durch die Entwicklung des Kapitalismus als auch durch den Klassenkampf entstehen, werden auf einer höheren Ebene integriert, die die früheren Positionen nicht annulliert, sondern sie nur präzisiert, prägnanter faßt und sie stärker hinsichtlich des Endziels -der Kommunismus - konkretisiert. Die auf diese Art entwickelten Positionen sind unwiderruflich, stellen eine Klassengrenze zwischen Proletariat und Bourgeoisie dar.
Das kommunistische Programm wird ständig durch den Opportunismus bedroht, der Ausdruck des Gewichtes der bürgerlichen Ideologie in den Reihen der Arbeiter ist (wir werden in den nächsten Artikeln näher darauf eingehen). Jede proletarische Gruppe, die die Klassenpositionen vergißt oder sie indirekt oder offen in der Theorie oder in der Praxis relativiert, verfällt dem Opportunismus und wird dazu verurteilt, wenn sie diesem Prozeß nicht Einhalt gebietet, sich selbst zu zerstören und sich dem Feindeslager anzuschließen.
Die unnachgiebige Verteidigung des kommunistischen Programms bedeutet nicht einem Purismus oder Sektierergeist zu verfallen, wie zynischerweise die opportunistischen Rätisten und Bordigisten behaupten. Erstens weil die Klassengrenzen des Proletariats, sein Prinzipiensystem das Geheimnis seines Kampfes selber, seine tiefgreifende Dynamik erklären. Zweitens weil diese theoretische Stärke des Programms es ermöglicht, "in jedem Kampf die historische und geographische Dimension der Bewegung hervorzuheben, was nicht bedeutet, sich mit der Erwähnung der Endziele, dem Kommunismus auf Weltebene, zufrieden zu geben. Es kommt gerade darauf an, zu jedem Zeitpunkt den springenden Punkt hervorzuheben und Vorschläge zu machen, die zu verwirklichen sind und gleichzeitig einen wirklichen Schritt nach vorne für den Kampf und die Entwicklung der Einheit und des Klassenbewußtseins der gesamten Klasse sind" (aus Broschüre der IKS zu "Kommunistische Organisation und Klassenbewußtsein", S. 80).
Der Marxismus – treibende Kraft bei der Entwicklung des Klassenbewußtseins
Das Bewußtsein, das erst mit dem Auftauchen des Proletariats entsteht, hat seine eigene Dynamik, die auf der Reflektion, der Ausarbeitung und theoretischen Untersuchung beruht. Die Theorie ist ein unabdingbares Element bei der Ausdehnung und Entwicklung des Bewußtseins des Proletariats. Logischerweise ist ihr Verhältnis zur Gesamtheit der Klasse nicht das Gleiche, wie das zwischen der bürgerlichen Theorie und ihrer Klasse. Ebenso ist die Ausarbeitung, ihre Weiterentwicklung vollkommen anders.
So ist die Theorie keine bloße abstrakte Widerspiegelung der Welt, sondern ist zu jedem Zeitpunkt ungeachtet der Tatsache, daß sie einen gewissen Abstraktionsgrad benötigt, um die einzelnen Fakten zu begreifen und sie in ihrem historischen Rahmen zu sehen, ein Element des praktischen Kampfes des Proletariats. Im Gegensatz zu der bürgerlichen Theorie hat sie keinen ahistorischen, auf das menschliche Gattungswesen als solchen oder den Einzelnen bezogenen Charakter. Sie zeichnet sich vor allem durch ihren historischen Charakter und ihre Zugehörigkeit zu einer Klasse aus, die zur Aufgabe hat, die umfassendste gesellschaftliche Umwälzung zu vollziehen, die bislang in der Geschichte der Menschheit stattgefunden hat. Schließlich entfaltet sich die proletarische Theorie nicht nach den Regeln der Arbeitsteilung zwischen Intellektuellen und Handarbeitern, die in allen Ausbeutungsgesellschaften vorherrschten ; die Art, wie sie sich entwickelt, spiegelt vielmehr schon ihr Endziel wider - nämlich die Abschaffung der Arbeitsteilung.
"Der Marxismus ist die grundlegende theoretische Errungenschaft des proletarischen Kampfes. Auf seiner Grundlage gliedern sich alle Errungenschaften des proletarischen Kampfes in ein kohärentes Ganzes ein. Indem er den Verlauf der Geschichte durch die Entwicklung des Klassenkampfes erklärt, und indem er das Proletariat als den Träger der Revolution anerkennt, die den Kapitalismus abschaffen wird, wird der Marxismus zur einzigen Weltauffassung, die wirklich den Standpunkt der Arbeiterklasse ausdrückt" (Plattform der IKS, S.4).
Wenn wir vom Marxismus sprechen, meinen wir nicht das Werk von Karl Marx als solches, sondern wir meinen damit eine Auffassung von der Welt und eine Methode des Begreifens ihrer Entwicklung, deren erster und systematischer Autor Marx war. Diese Methode ist die kohärenteste und radikalste Ausarbeitung der programmatischen Positionen des Proletariats.
"Heute Marxist zu sein bedeutet nicht, jeden einzelnen Buchstaben des Werkes Marxens wörtlich zu übernehmen. Dies würde viele Probleme aufwerfen, da sich in verschiedenen Abschnitten der Schriften Marx° Widersprüche befinden. Dies ist kein Beweis für die Inkohärenz, sondern ein Zeichen dafür, daß seine Gedanken lebendig in ständiger Entwicklung waren und sich auf die Wirklichkeit und die historische Erfahrung bezogen" (International Review, Nr. 33, "Marx ist immer aktuell"). Der Marxismus ist weder eine Summe von Positionen noch ein geschlossenes System, das von bestimmten abstrakten Prämissen ausginge, die ebenso zu bestimmten abstrakten Schlußfolgerungen führten, (wie das bei den meisten philosophischen Systemen der Fall ist) ebensowenig ist er ein System der Klassifizierung der Wirklichkeit, bei der jedes Phänomen genau definiert würde, ohne daß dabei seine Dynamik und seine Evolution berücksichtigt wird.
Er steht im Gegensatz zu solchen Denkweisen. Der Marxismus ist eine Methode, die ständig und konstant auf die Notwendigkeiten des historischen Kampfes des Proletariats Antworten gibt. Dabei darf er nicht als statisch betrachtet werden; er ist vielmehr eine dynamisch-dialektische Methode; deshalb ist er keine Summe von Rezepten für den Klassenkampf, auch keine Garantie, daß man nie Fehler macht, sondern eine lebendige Methode, die ständig eine für das Proletariat vorantreibende Rolle spielt.
Der Marxismus umfaßt die am meisten fortgeschrittenen Errungenschaften des Gedankengutes der Bourgeoisie, als diese noch eine revolutionäre Klasse war, d.h. genau gesagt den wissenschaftlichen und dialektischen Charakter der Methode Hegels, der als erster den partiellen und statischen und idealistischen Charakter der Philosophie verworfen hatte. "Die Geschichte der Philosophie und die Geschichte der Sozialwissenschaft zeigen mit aller Deutlichkeit, daß der Marxismus nichts enthält, was einem "Sektierertum" im Sinne einer abgekapselten, verknöcherten Lehre ähnlich wäre, die abseits von der Heerstraße der Entwicklung der Weltzivilisation entstanden ist. Im Gegenteil: Die ganze Genialität Marx' besteht gerade darin, daß er auf die Fragen Antworten gegeben hat, die das fortgeschrittene Denken der Menschheit bereits gestellt hatte" (Lenin, "Drei Quellen und drei Bestandteile des Marxismus", 1913).
Der Marxismus schreitet voran, indem er sowohl dem Druck der feindlichen Klasse wie den unzureichenden Positionen entgegentritt, die als zögernde, schwankende und unklare Positionen in den Reihen des Proletariats existieren können.
Die marxistische Methode ist materialistisch, historisch und dialektisch. Sie ist materialistisch, weil sie die Welt als eine konkrete historische Gesamtheit auffaßt, in der sich der Mensch und die Natur in einer einzigen Globalität bewegen, und deren inneren Entwicklungsgesetze er analysieren kann. "Für Hegel ist der Denkprozeß, den er sogar unter dem Namen Idee in ein selbständiges Subjekt verwandelt, der Demiurg (Schöpfer) des Wirklichen, das nur seine äußere Erscheinung bildet. Bei mir ist umgekehrt das Ideelle nichts andres als das im Menschenkopf umgesetzte und übersetzte Materie" (Marx, Nachwort zur 2. Auflage des Kapitals, NEW 23, Bd. 1, S. 27).
Aber der Marxismus ist kein vulgärer Materialismus, gegen den er im Gegenteil antritt: "Der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus - den Feuerbachschen mit eingerechnet - ist, daß der Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit, nur unter der Form des Objekts oder der Anschauung aufgefaßt wird; nicht aber als menschliche sinnliche Tätigkeit, Praxis, nicht subjektiv" (Marx, Thesen über Feuerbach, 1.These).
Er ist historisch, weil er vom Klassenkampf als dem Motor der Geschichte ausgeht, und diesen jeweils in ein dialektisches Verhältnis mit der Entwicklung der Produktivkräfte stellt. Er begreift das Proletariat als Klasse, das ausgehend von einer bestimmten Entwicklung der Produktivkräfte seine geschichtliche Aufgabe, die Abschaffung der Ausbeutung und der Klasse erfüllt.
Es ist dialektisch, weil er die Geschichte nicht als eine ständige Rückkehr in die Vergangenheit oder als bei Null beginnend auffaßt, sondern als eine Entwicklung, die sich in Widersprüchen bewegt (These-Antithese-Synthese) ; das ist der Rahmen, innerhalb dessen sich eine Kontinuität zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart herstellt, wobei sie ständig durch die Zukunftsperspektive (den Kommunismus) angezogen und geleitet wird, und die den Bezugspunkt gegenüber dem Gewicht der Vergangenheit (Konservatismus, Dogmatismus) und den Schwächen der Gegenwart (Empirismus, Immediatismus, Revisionismus) darstellt.
Wenn wir uns auf den Marxismus berufen, treten wir damit auch den Verzerrungen und Entstellungen entgegen, die die Bourgeoisie in die Welt setzt, um den Marxismus als Waffe des Proletariats zu entschärfen, insbesondere die Stalinisten, die Sozialdemokratie, Trotzkisten usw. sowie die Marxologen, die Universitätsmarxisten betreiben diese Arbeit.
Die ersten leugnen die Grundprinzipien des Marxismus: den Internationalismus, die Diktatur des Proletariats, seine politische Selbständigkeit… Der universitäre Marxismus dagegen reduziert ihn auf ein philosophisches System, dessen praktische Auslegung nur zur Verteidigung des bestehenden Systems dient.
Unter dem Gewicht der bürgerlichen Ideologie vertreten viele Teile des proletarischen Lagers eine verzerrte und konfuse Auffassung des Marxismus: die Bordigisten reduzieren ihn auf ein Dogma, die Rätisten machen aus ihm eine Methode der ‚gesellschaftlichen Untersuchungen’, andere verwerfen ihn ganz oder teilweise, weil sie dem Marxismusanspruch der Stalinisten und Trotzkisten auf den Leim gehen und sich dadurch abgeschreckt fühlen. Und schließlich machen ihn viele zu einem reinen Akademismus.
0 – 0 – 0
Im nächsten Artikel werden wir darauf eingehen, wie die Bourgeoisie als herrschende Klasse versucht, den Bewußtwerdungsprozeß des Proletariats zu verhindern und welche Abweichungen und Schwächen innerhalb des Proletariats vorhanden sind, insbesondere der Opportunismus. (aus Acción Proletaria, Zeitung der IKS in Spanien).
(1) In ‚Geschichte der russischen Revolution’ von Trotzki, und ‚10 Tage, die die Welt erschütterten’, von J. Reed sowie in ‚Massenstreik, Partei und Gewerkschaften’ von Rosa Luxemburg findet man genug Material, das die Eigenständigkeit und das massive Bewusstsein des Proletariats in Zeiten revolutionärer Kämpfe verdeutlicht.
Teil 3 – aus Weltrevolution Nr. 20, 1985,
KLASSENBEWUSSTSEIN, MOTOR DER REVOLUTION(3)
In diesem letzten Artikel der Serie über das Klassenbewußtsein des Proletariats wollen wir die Krankheiten untersuchen, die den Bewußtwerdungsprozeß des Proletariats bedrohen: der Opportunismus und Zentrismus.
Der Opportunismus und Zentrismus greifen bevorzugt die politischen Organisationen des Proletariats an: verstricken die neu entstehenden Gruppen in einem Wirrwarr politischer Konzessionen an die Bourgeoisie, der Versöhnung oder dem Schwanken zwischen konsequent proletarischen Positionen und denen der Bourgeoisie. Sie hemmen ernsthaft deren Bemühungen, eine marxistische Kohärenz zu entwickeln. Andererseits bedrohen sie die Gruppen, die fest im Marxismus verankert sind, mit dem Krebs der mangelnden Festigkeit bei der Vertiefung der Prinzipien, dem Außerachtlassen der Prinzipien in der Praxis u.a. Die Geschichte beweist, daß der Opportunismus und Zentrismus eine entscheidende Rolle bei der Degenerierung der proletarischen Organisationen wie bei der II. und III. Internationale und der Integration der verschiedenen Parteien in den bürgerlichen Staat gespielt haben.
Heute muß das Proletariat die größtmögliche Klarheit und Entschlossenheit erlangen, um das Kräfteverhältnis gegenüber der Bourgeoisie zu seinen Gunsten ausschlagen zu lassen; und dazu muß es Opportunismus und Zentrismus energisch bekämpfen.
Das Wesen des Opportunismus und Zentrismus
Um zu begreifen, warum die Krankheiten des Opportunismus und Zentrismus das Proletariat befallen, ist es notwendig, die Bedingungen zu begreifen, unter denen das Proletariat sein Bewußtsein entwickelt.
Das Proletariat muß die gewaltigste Revolution der Geschichte der Menschheit verwirklichen: die jahrtausend alten Ausbeutungsgesellschaften zerstören, eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und ohne Klassen aufbauen, die menschliche Weltgemeinschaft, etwas ganz Neues, bislang noch nie Dagewesenes. Und diese ungeheuer große Aufgabe muß es als ausgebeutete Klasse verwirklichen, die dem Druck und der ständigen Wachsamkeit der herrschenden Klasse unterworfen ist.
Auf dem Hintergrund der wirklichen, materiellen Bedingungen entwickelt das Proletariat sein Bewußtsein und kämpft um die Durchführung seiner historischen Aufgabe. Diese Bedingungen bringen es mit sich, daß das Proletariat nicht abgeschlossen, im luftleeren Raum sein Bewußtsein entwickelt, in einem Bereich, in dem es keine Widerstände gäbe, sondern es ist ständig den Angriffen der herrschenden Klasse ausgesetzt:
- dem furchtbaren Druck der bürgerlichen Ideologie,
- die Bourgeoisie führt gegen die Arbeiterklasse die Strategie der Linken in der Opposition zu Felde;
- dem Einfluß der Kleinbourgeoisie, die Träger konfuser und reaktionärer Werte und Aktivitäten sind;
- dem Gewicht einer jahrhunderte alten Ausbeutung mit ihrem untragbaren Taster der Unterwerfung, dem Individualismus und dem Obskurantismus.
Diese Gesamtheit der Bedingungen führt dazu, daß die Bewußtwerdung des Proletariats inmitten einer gewaltigen Konfusion, einem zerbrechlichen, geschwächten Umfeld stattfindet, wodurch ein ständiger Prozeß der Klärung und politischen Loslösung und Herausarbeitung durch die politischen Organisationen erforderlich ist.
Aus diesen Bedingungen der Konfusion und permanenten Schwierigkeiten gehen die Krankheiten des Opportunismus und Zentrismus hervor, welche sich ständig zwischen der kohärentesten proletarischen Position einerseits (den marxistischen Organisationen) und dem Lager der Bourgeoisie andererseits einzunisten versuchen. Es handelt sich um ein sumpfiges, konfuses Gebilde, das das gesamte Proletariat und die konsequentesten Verteidiger seines Programms, die marxistischen Organisationen, heimsucht.
Der Opportunismus besteht in der Kapitulation gegenüber den Positionen der Bourgeoisie; er verwirft oder entstellt die revolutionären Prinzipien aus Gründen der "Taktik", "um möglichst mehr zu sein, anstatt alleine da zu stehen", "damit wir in der Klasse auf Gehör stoßen" oder einfach indem er sich den unmittelbaren Bedingungen oder einer rein empiristisch oder idealistischen Analyse unterwirft. Der Zentrismus ist eine Variante des Opportunismus, der in der Theorie die kommunistischen Prinzipien mit Worten nach Außen hin vorgibt zu verteidigen, in Wirklichkeit aber nicht zu ihnen steht; sie in der Praxis relativiert oder sie mit offen opportunistischen Positionen zu verbinden sucht.
Der Opportunismus und Zentrismus in den politischen Organisationen des Proletariats
Der Opportunismus und Zentrismus gehören nicht dem Lager der Bourgeoisie an, sondern sind Tendenzen, die aus den Reihen des Proletariats hervorgehen.
Die KPs, SPs, Gewerkschaften und Parteien der Extremen Linke sind keine Zentristen oder Opportunisten, sondern Teil des kapitalistischen Staates, die bewußt gegen das Proletariat vorgehen, um dessen Kämpfe zu sabotieren.
Dagegen tauchen die opportunistischen und zentristischen Tendenzen in den Reihen des Proletariats in den Organisationen und unter den Elementen auf, die versuchen, seinen Kampf zu stärken und sein Klassenbewußtsein zu entwickeln, die aber dann dem ständigen Druck der Bourgeoisie und dem zersetzenden Einfluß des Kleinbürgertums nachgeben und eine Reihe von Konzessionen gegenüber den Positionen des Kapitalismus machen und den Marxismus aufgeben.
Die Gewerkschaften, Linke und Extreme Linke müssen mit der Waffe in der Hand bekämpft werden, weil sie Teil des kapitalistischen Staates sind; die zentristischen und opportunistischen Tendenzen werden durch eine klare , unnachgiebige politische Ablehnung der Konfusionen, eine offene und systematische Diskussion, eine energische Debatte bekämpft, um zu verhindern, daß sich die jetzigen revolutionären Elemente im Sumpf der Bourgeoisie verfangen.
Die Opportunisten und Zentristen spielten bei der Entartung der alten Arbeiterorganisationen und dem Übergang ins kapitalistische Lager eine entscheidende Rolle; das trifft insbesondere zu für den Verlust der II. und III. Internationale für das Proletariat (aus der II. Internationale gingen die "sozialistischen" Parteien hervor, die eine gute Arbeit für das Kapital leisteten, und aus der III. Internationale, aus der die Stalinisten entstanden, die die Sozialdemokratie um kein Manöver und kein Verbrechen zu beneiden brauchen, haben sie doch genauso viele gegen die Arbeiter vollbracht).
Von 1890 an entfalteten sich opportunistische Tendenzen in der Arbeiterbewegung eindeutig: in den Reihen der Sozialdemokratie mit dem Reformismus (dessen Sprecher Bernstein, Vollmer usw. waren), der einen schrittweisen Kampf für die friedliche Umwälzung des Kapitalismus vorschlug und damit die proletarischen Prinzipien über Bord warf. Außerhalb der Sozialdemokratie gab es den Anarcho-Syndikalismus, der den Selbstverwaltungsreformismus theoretisierte und Propaganda für den Generalstreik am Tage X betrieb.
Aber zwischen der revolutionären marxistischen Position (Lenin, R.Luxemburg, Pannekoek) und den opportunistischen Tendenzen tauchte eine zentristische, versöhnliche, von Kautsky verkörperte Tendenz auf, die langsam anfing , die Grundsatzpositionen des Marxismus selber in Frage zu stellen. Kautsky erschien als der orthodoxeste Verteidiger des Marxismus, aber seine Verteidigung war in Wirklichkeit der schlimmste Angriff. 3 Grundsatzfragen verdeutlichten die große Gefahr, die seine zentristische Position darstellte:
Als R. Luxemburg den 1905 in Rußland aufgetauchten Massenstreik als einen Ausdruck des Wechsels der historischen Periode analysierte und aus diesem den Schluß zog, daß nunmehr die Revolution auf der Tagesordnung der Geschichte stand, und als sie dabei den Gradualismus und Reformismus der Gewerkschaften kritisierte, bezeichnete Kautsky, der sich als den Verteidiger des Massenstreiks ausgab, R. Luxemburg als "Anarchistin". Er war unfähig die historischen Veränderungen zu erkennen.
Als Lenin und Pannekoek die grundlegende Notwendigkeit der proletarischen Revolution hervorhoben, (die Zerstörung des bürgerlichen Staates), griff Kautsky diese grundlegende Position an und bezeichnete sie als "anarchistisch";
- Als 1914der imperialistische Krieg ausbrach, trat Kautsky an die Spitze einer Tendenz, die sich zwischen die Sozialpatrioten (die endgültig in das Lager der Bourgeoisie übergewechselt waren), welche für die bedingungslose Unterstützung des Krieges im Namen der "Verteidigung des Vaterlandes" eintraten, und die konsequenten Revolutionäre (Lenin, Luxemburg, Liebknecht) stellten. Die konsequenten Revolutionäre traten für die Umwandlung des imperialistischen Krieges in einen Bürgerkrieg, d.h. in einen Klassenkrieg ein.
Der Opportunismus und Zentrismus machten in Anbetracht des langsamen Zurückweichens der revolutionären Welle von 1917-23 den gewaltigen Schritt zunichte, den das Weltproletariat mit der Gründung der III. Internationale vollzogen hatte. Die Klarheit und Vertiefung des Marxismus, welche die Theorien des I. Kongresses der Komintern ermöglicht hatten, wurden schnell durch das Abgleiten ihrer Hauptführer (Lenin, Trotzki, Sinowjew, Radek usw.) aufgeweicht zu einer zentristischen Haltung zwischen dem unverblümten Opportunismus, der aus den alten sozialdemokratischen Parteien hervorging und den unnachgiebigen marxistischen Positionen der Kommunistischen Linke (KAPD, Bordiga).
Verschiedene Tatsachen verdeutlichen diesen Prozeß:
Unterstützung durch die Kornintern auf ihrem II. Kongreß der nationalen Befreiungsbewegungen, der These von der Wiedereroberung der Gewerkschaften und des revolutionären Proletariats, was eine Verwerfung der marxistischen Position zu den Bedingungen des Arbeiterkampfes im dekadenten Kapitalismus bedeutete,
Aufnahme der opportunistischen Strömungen, die aus dem linken Flügel der Sozialdemokratie staunten, in die Kornintern, ohne daß dabei feste Kriterien berücksichtigt worden wären (trotz der verschärften Aufnahmebedingungen).
- Verabschiedung der Thesen zur "Einheitsfront" auf dem III. Kongreß, was ein schrittweises Abgleiten hin zu einer Kapitulation gegenüber den sozialdemokratischen Parteien bedeutete, die voll in den kapitalistischen Staat integriert waren.
Der Krebs des Opportunismus und Zentrismus führte zur Auslöschung der III. Internationale als proletarische Organisation und zum Übergang der verschiedenen kommunistischen Parteien in den Dienst des jeweiligen nationalen Kapitals.
Die Geschichte der Arbeiterbewegung - insbesondere ihrer marxistischen Organisationen - beweist, daß der Zentrismus und Opportunismus eine tödliche Gefahr sind, die langsam die Avantgardeorganisationen des Proletariats erwürgen und sie schließlich durch ihre Auflösung, Auslieferung, Verfaulung und Schwächung dem staatlichen kapitalistischen Monster übereignen.
Der Opportunismus und Zentrismus sind ein Phänomen falschen Bewußtseins in den Reihen des Proletariats. Sie stellen eine Aufgabe der marxistischen Methode, ihrer Kohärenz zwischen Theorie und Praxis dar, zwischen der Analyse der ummittelbaren oder besonderen Lage und der Verteidigung der allgemeinen historischen Perspektive, zwischen der Verteidigung der Prinzipien und ihrer Anwendung in einer konkreten Situation.
Opportunismus und Zentrismus sind ein Virus, der das Proletariat zutiefst schwächt und es gegenüber den Mystifikationen und Machenschaften der Bourgeoisie, insbesondere ihrer Gewerkschaften und linken Apparate anfällig macht. Vor allem in den entscheidenden Augenblicken gegen den bürgerlichen Staat haben sie eine lähmende Wirkung. Wenn sie in den Reihen des Proletariats siegen, besiegelt das die Niederlage des Proletariats.
In der heutigen, für das Proletariat und die Menschheit entscheidenden historischen Situation muß das Proletariat und seine kommunistischen Organisationen seine Wachsamkeit und den politischen Kampf gegen die opportunistischen und zentristischen Tendenzen, die in seinen Reihen entstehen und entstehen werden, verstärken. Die Loslösung und energische Bekämpfung dieser Tendenzen ist von grundlegender Bedeutung für die Gründung der zukünftigen Kommunistischen Weltpartei des Proletariats und des Sieges der proletarischen Revolution.
(aus Acción Proletaria, Zeitung der IKS in Spanien).
Erbe der kommunistischen Linke:
März 2007
- 758 reads
AIRBUS, TELEKOM, BAYER: Die Notwendigkeit der internationalen Arbeitersolidarität
- 2778 reads
Am Mittwoch, den 28. Februar kündigte der Airbus-Konzern den Abbau von 10.000 Arbeitsplätzen binnen vier Jahren in Europa an, davon 4.300 Stellen in Frankreich, 3.700 in Deutschland, 1.600 in Großbritannien und 400 in Spanien. Betroffen davon werden je zur Hälfte Zeitarbeiter und Festangestellte sein. Die Werke St. Nazaire in Frankreich und Varel und Laupheim in Deutschland sollen verkauft, Nordenham als „Joint Venture“ geführt werden. In mehreren französischen Werken reagierte man auf das „Power 8“ getaufte „Sparprogramm“ mit Arbeitsniederlegungen. In Varel, Laupheim und Nordenham fanden ebenfalls sofort Proteststreiks statt, welche meistenteils bis zum darauf folgenden Montag andauerten. Obwohl die Konzernleitung sichtlich bemüht war, den Eindruck zu erwecken, dass die Zukunft der wichtigsten, sich in städtischen Ballungsräumen befindenden deutschen Standorte – Hamburg und Bremen –gesichert sei, fanden auch dort erste Arbeitsniederlegungen statt. Dies geschah teilweise als Reaktion auf den auch dort vorgesehenen Stellenabbau (1.000 Jobs in Hamburg, 900 in Bremen stehen zur Disposition) und teilweise aus Solidarität mit den noch härter betroffenen Belegschaften. Überall war von den betroffenen Arbeiterinnen und Arbeiter zu hören, dass die Beschäftigten der verschiedenen Standorte im In- und Ausland unbedingt zusammenstehen und verhindern müssen, dass die Belegschaften gegen einander ausgespielt werden.
Am Mittwoch, den 28. Februar kündigte der Airbus-Konzern den Abbau von 10.000 Arbeitsplätzen binnen vier Jahren in Europa an, davon 4.300 Stellen in Frankreich, 3.700 in Deutschland, 1.600 in Großbritannien und 400 in Spanien. Betroffen davon werden je zur Hälfte Zeitarbeiter und Festangestellte sein. Die Werke St. Nazaire in Frankreich und Varel und Laupheim in Deutschland sollen verkauft, Nordenham als „Joint Venture“ geführt werden. In mehreren französischen Werken reagierte man auf das „Power 8“ getaufte „Sparprogramm“ mit Arbeitsniederlegungen. In Varel, Laupheim und Nordenham fanden ebenfalls sofort Proteststreiks statt, welche meistenteils bis zum darauf folgenden Montag andauerten. Obwohl die Konzernleitung sichtlich bemüht war, den Eindruck zu erwecken, dass die Zukunft der wichtigsten, sich in städtischen Ballungsräumen befindenden deutschen Standorte – Hamburg und Bremen –gesichert sei, fanden auch dort erste Arbeitsniederlegungen statt. Diese geschahen teilweise als Reaktion auf den auch dort vorgesehenen Stellenabbau (1.000 Jobs in Hamburg, 900 in Bremen stehen zur Disposition) und teilweise aus Solidarität mit den noch härter betroffenen Belegschaften. Überall war von den betroffenen Arbeiterinnen und Arbeitern zu hören, dass die Beschäftigten der verschiedenen Standorte im In- und Ausland unbedingt zusammenstehen und verhindern müssen, dass die Belegschaften gegen einander ausgespielt werden.
An eben diesem 28. Januar legten 12.000 Telekom-Beschäftigte gleichfalls die Arbeit nieder und zogen protestierend vor die Konzernzentrale in Bonn. Sie reagierten damit auf die Ankündigung des Managements, 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Konzern auszugliedern, was zunächst bedeutet: für deutlich weniger Geld vier Stunden die Woche mehr arbeiten zu müssen. Inzwischen will die ‚Wirtschaftswoche‘ erfahren haben, dass nicht 50.000 sondern 85.000 Opfer dieses „Outsourcing“ werden sollen.
Genau zwei Tage später, am 2. März, demonstrierten aufgebrachte Arbeiterinnen und Arbeiter vor der Schering-Zentrale in Berlin. Ihr Protest galt dem soeben angekündigten Abbau von 6.100 Stellen weltweit. Betroffen sind Standorte in den USA, Japan, Kanada, Südamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum sowie in Deutschland vornehmlich der Sitz der Bayer Schering Pharma AG mit 1.200 Stellen.
Mit diesen Aktionen bewiesen die Betroffenen wieder einmal die urwüchsige Klugheit der kollektiv in Bewegung geratenen Arbeiterklasse. Indem sie die falschen Alternativen - passives Hinnehmen oder kopflos und isoliert bis zum bitteren Ende streiken - vermieden, setzten die Betroffenen ein erstes aber deutliches Signal, mit den Plänen des Kapitals nicht einverstanden zu sein und sie nicht hinnehmen zu wollen. Dabei rückte die Frage der Solidarität unvermeidlich in den Mittelpunkt des Arbeiterkampfes. Mit ihrer Betonung des Zusammenhalts aller Airbus-Beschäftigten in Europa, mit den Solidaritätsaktionen in Hamburg und Bremen knüpfen die Betroffenen an die besten Traditionen der Arbeiterbewegung wieder an, wie das beispielsweise vor drei Jahren bei Mercedes geschah, als das Werk Bremen aus Solidarität mit den angegriffenen Kolleginnen und Kollegen in Stuttgart mitstreikte.
Der Verlust der Illusionen
So die ersten Reaktionen der Arbeiter. Und wie reagiert die Politik, wie reagieren die Regierungen dieser Welt auf diese neue Welle der Massenentlassungen und der „Präkarisierung“? Sie reagieren mit Sympathiebekundungen gegenüber den Betroffenen sowie mit Zusicherungen, helfen zu wollen. Warum plötzlich diese „Sympathie“ der Regierenden, die sich sonst gnadenlos zeigen, wenn es darum geht, die Lasten der kapitalistischen Wirtschaftskrise auf die Schultern der Arbeiterklasse abzuwälzen? Von Sympathie war jedenfalls wenig zu spüren, als es darum ging, Hartz IV, die Rente mit 67, die „Lockerung“ des Kündigungsschutzes oder den erbarmungslosen Lohnabbau durchzusetzen. Die Herrschenden kennen keine Sympathie mit der Klasse, von deren Ausbeutung sie leben. Sie sind aber jetzt aufgeschreckt, da die neuen Massenentlassungen im Herzen der modernen Industrie sowie die Reaktionen der Betroffenen die kommenden sozialen Explosionen ankündigen. Eigentlich wollte die Große Koalition am 28. Februar triumphal die Senkung der offiziellen Arbeitslosenzahlen um 826.000 gegenüber dem Vorjahr ankündigen und feiern lassen. Die Hiobsbotschaften von Airbus, Telekom und dann Bayer, aber auch die von China ausgehende Panik an den Weltbörsen haben Union und SPD einen Strich durch die Rechnung gemacht. Von der immer krasser werdenden Retouchierung der Erwerbslosenstatistiken abgesehen, fragen sich immer mehr Menschen zu recht, was das für neue Jobs sein sollen, die entstehen, während (mit einer Ausnahme) sämtliche in Deutschland börsennotierten Unternehmen im vergangenen Jahr kräftig Arbeitsplätze abgebaut haben (Mercedes z.B. in aller Stille 15.000). Es handelt sich offensichtlich um Arbeit zu Hungerlöhnen, das, was man „working poor“ nennt.
Die Herrschenden sind also alarmiert und wollen kein Öl ins Feuer gießen. Sie sind nicht weniger besorgt als der Betriebsratsvorsitzende von Opel in Bochum, der die aufkommenden Spekulationen darüber, dass General Motors erneut in Erwägung zieht, ein Werk in Europa – entweder Bochum oder Antwerpen – zu schließen, Anfang März so kommentierte: „wer dies tue, riskiere es, einen Krieg auszulösen“. Dabei meinte er einen Klassenkrieg. Dieser Krieg wird zwar nicht so schnell kommen. Aber die ersten Vorgeplänkel dazu finden jetzt schon statt.
Sie gehen einher mit dem Verlust der Illusionen der Lohnabhängigen in die Möglichkeit, Verbesserungen innerhalb dieses Systems zu erzielen. Statt dessen merken sie, dass sie ihren jetzigen Lebensstandard im Kapitalismus nicht mehr halten können. Dies gilt um so mehr, da derzeit sogar solche Firmen ihre Belegschaften massiv angreifen, die noch satte Profite erzielen (wie die Telekom) oder volle Auftragsbücher zu verzeichnen haben (wie bei Airbus). So wird das alte Märchen zunehmend der Lächerlichkeit preisgegeben, demzufolge es sich lohne, sich als Arbeiter für die Interessen des Kapitals zu opfern, da es den Arbeitern gut gehe, wenn es „ihren“ Firmen gut geht. Stattdessen wird der Interessengegensatz zwischen Lohnarbeit und Kapital immer unübersehbarer.
Auffallend an den Äußerungen der Demonstrierenden bei Airbus oder Telekom war die Beschäftigung mit der Zukunft, mit der (mangelnden) Perspektive der kommenden Generation, also mit der Frage, in welcher Welt unsere Kinder leben werden. Es handelt sich um erste Ansätze, die Frage einer Alternative zum Kapitalismus wieder aufzuwerfen.
Was die Entlassungen derzeit v.a. bei Airbus außerdem verdeutlichen, ist dass die Arbeiter aller Länder vor denselben Problemen stehen. Seit Jahren will uns die bürgerliche Propaganda weiß machen, dass es der arbeitenden Bevölkerung verschiedener europäischer Nachbarstaaten besser gehe als „hierzulande“, da dort die Wirtschaft –sprich der Kapitalismus – besser funktioniere. Auch hier macht die Realität dieser Propaganda den Ausbeutern einen Strich durch die Rechnung. Brisant bei Airbus ist nicht zuletzt die sich abzeichnende Erkenntnis, dass die Arbeiterklasse in Frankreich und Deutschland gleichzeitig frontal angegriffen wird. Brisant nicht nur, weil der moderne Kapitalismus in den letzten 150 Jahren die Arbeiter Frankreichs und Deutschlands in drei mörderischen Kriegen gegeneinander gehetzt hat, sondern auch, weil die Arbeiterbewegung dieser beiden Länder in der Geschichte immer wieder imstande war, von einander zu lernen und durch ihre Kämpfe den Arbeitern aller Länder ein Signal zu geben. Aber auch die jüngste Ankündigung Daimler-Chryslers, Tausende von Stellen v.a. in den USA abzubauen, hilft zu verdeutlichen, dass es weltweit eine Arbeiterklasse gibt, der ein einziger Gegner gegenübersteht.
Die Gewerkschaften: Speerspitzen der kapitalistischen Konkurrenz
Und wie reagieren die Gewerkschaften? Sie haben angekündigt, um jeden Arbeitsplatz und um jeden Standort kämpfen zu wollen. Diesen „Kampf um jeden Arbeitsplatz“ kann man natürlich nur als Floskel auffassen, wenn man bedenkt, welch millionenfache Arbeitsplatzvernichtung gerade die Gewerkschaften in der Vergangenheit mit unterschrieben und auch durchgesetzt haben. Dabei haben sie oft genug vorauseilend ihre eigenen „Sparpläne“ vorgelegt, welche nicht selten über die der Unternehmen hinausgingen und noch raffinierter die Betroffenen unter einander spalteten.
Sie taten und tun dies nicht in erster Linie aus Bösartigkeit, oder weil sie korrumpiert sind, sondern weil sie als bekennende Verteidiger des Kapitalismus die Konkurrenz bejahen. Die Konkurrenz aber ist das Grundprinzip des Kapitalismus, während die Solidarität das Grundprinzip des Arbeiterkampfes bildet. Diese beiden Dinge lassen sich niemals vereinbaren. Dies macht derzeit z.B. die Haltung der französischen Gewerkschaften gegenüber der Lage bei Airbus deutlich. Sie quittierten die Nachricht von den „Power 8“ Plänen des Konzerns mit einem Aufschrei gegen „den Ausverkauf der französischen Industrie“. Seitdem hetzen sie gegen „die Deutschen“, die angeblich bei Airbus „die Franzosen“ über den Tisch gezogen haben.
Was ist aber mit der IG Metall (IGM) in Deutschland? Redet sie nicht der „internationalen Solidarität“ das Wort? War es nicht die IGM, welche als erste zu einem europaweiten Aktionstag bei Airbus (Mitte März) aufgerufen hat? Diese wohlfeilen Phrasen der internationalen Solidarität stehen den deutschen Gewerkschaften schlecht zu Gesicht. Auch sie kennen sich bestens aus, wenn es darum geht, sich der nationalistischen Hetze zu bedienen. Jedoch bietet die augenblickliche Lage in Deutschland, mit der Gleichzeitigkeit der Angriffe in verschiedenen Branchen, wenig Gelegenheit dazu. Oder sollen die Franzosen auch noch für die Misere bei der Telekom oder bei Bayer herhalten? So übernimmt die IGM in einer Art urwüchsigen Arbeitsteilung den Part des „internationalistischen“ Verteidigers des europäischen Airbuskonzerns insgesamt: Gegenüber der Konkurrenz von Boeing aus Amerika. Das verspricht eine „gehobenere“, transatlantische Art, die Arbeiter verschiedener Länder gegeneinander aufzuhetzen. Dabei verteidigt diese Gewerkschaft damit durchaus die ureigenen Interessen des deutschen Kapitals. Denn Deutschland allein ist nicht imstande, gegenüber der amerikanischen Konkurrenz eine eigene Flugzeugindustrie zu unterhalten. Die Interessen des deutschen Kapitals verlangen somit eine Mäßigung der inner-europäischen Konkurrenz innerhalb des Airbuskonzerns, um Boeing die Stirn bieten zu können. Das titulieren sie dann „Solidarität aller europäischen Standorte“. Die Gewerkschaften sind immer dabei, wenn es darum geht, den jeweiligen Betrieb, Konzern oder die Nation gegen andere zu verteidigen. Einen besonderen Eifer entfalten sie allerdings dann, wenn es um die Verteidigung der strategischen Interessen des eigenen Nationalstaats geht. Bei Airbus beispielsweise geht es auch und gerade um militärische Fragen, um den neuen, riesigen europäischen Militärtransporter, um die Satellitentechnologie des EADS Konzerns usw. Da ist die IG Metall sehr engagiert. Nicht weniger engagiert zeigt sich die Gewerkschaft Verdi gegenüber der Deutschen Telekom. Jahrelang hat Verdi die Monopolstellung bzw. die Restprivilegien des einstigen Staatskonzerns erbittert verteidigt – angeblich im Interesse der Beschäftigten. Dabei sprechen die jetzt vom neuen Konzernchef Obermann vorgelegten Zahlen eine deutliche Sprache: Verluste im Inland, Gewinne im Ausland. Was bedeutet das? Jahrelang durfte die Telekom mittels überhöhter Inlandspreise spektakuläre Einkäufe im Ausland finanzieren, um zum „global player“ aufzusteigen. Von wegen: "im Interesse der Beschäftigten", deren Arbeitsplätze immer wieder zehntausendfach abgebaut wurden! Es ging stattdessen um die Positionierung des deutschen Kapitals im strategisch wichtigen Telekommunikationsbereich, welcher für die kapitalistische Wirtschaft ebenso zentral ist wie fürs Militär. Jetzt, wo dieses Ziel mehr oder weniger erreicht ist, kann das deutsche Kapital es sich leisten, dem Druck der Europäischen Union (sprich der europäischen Konkurrenz!) nachzugeben und mehr Konkurrenz im Inland zuzulassen. Dies liegt sogar im Interesse des deutschen Kapitals, denn langfristig bedeuten überhöhte Telekommunikationspreise einen Standortnachteil. Wie vorher das Erlangen der Konkurrenzfähigkeit im Ausland, erfordert nun die Konkurrenzfähigkeit im Inland neue Opfer der Beschäftigten! Nachdem Verdi zuvor die Kolleginnen und Kollegen bei der Telekom eine 34h Woche mitsamt 8%igen Lohneinbußen aufzubürden half, sollen sie nun wieder vier Stunden mehr, und zwar gratis, arbeiten!
Man könnte viele andere solche Beispiele nennen, etwa die deutsche Energiewirtschaft, die letztens wieder von sich reden machte im Rahmen des Vorziehens der Bergbauschließungen an der Ruhr und an der Saar. Diese Konzerne haben jahrelang mit Unterstützung der Gewerkschaft eine Art Monopolstellung in Deutschland bewahren können und damit viel Kapital angehäuft, mit dem man nun versucht, die Energiewirtschaft anderer Staaten, wie z.B. Spanien, unter ihre Kontrolle zu bekommen. Es geht dabei um mehr als nur das Erzielen von Gewinnen. Denn wer die Energiewirtschaft anderer Staaten kontrolliert, kann diese Staaten auch erpressen, wie die jüngsten Konflikte Russlands mit der Ukraine und zuletzt Weißrussland wieder gezeigt haben. Es ist selbstredend, dass nicht nur der deutsche, sondern dass alle Staaten nach diesem Gesetz des Dschungels gegeneinander verfahren.
Kein Wunder also, wenn der Airbus-Chef Gallois seinen „Power 8“ Masterplan nicht als starres Schema vorstellte, sondern als Richtlinie, welche zusammen mit den Gewerkschaften „schöpferisch“ konkretisiert werden soll. Man zählt auf die Gewerkschaften vor Ort, die die Verhältnisse bestens kennen und für das in-Schach-Halten der Arbeiterklasse zuständig sind. Sie sollen dafür sorgen, dass der Widerstand der Arbeiter versandet, lokal abgekapselt und isoliert wird. Und die Gewerkschaften haben sofort ihre verantwortungsvolle Mitarbeit angekündigt. Sie werden umso „konstruktiver“ mitarbeiten, da es nicht nur um das Wohl des Konzerns, sondern um das des Vaterlandes geht. Sie werden gegebenenfalls auch nicht zögern, die Arbeiter gegeneinander in einen imperialistischen Krieg zu hetzen, so wie sie es bereits im Ersten Weltkrieg getan haben.
Das Problem des „Missmanagements“
Was die Krise bei Airbus betrifft, beeilte sich Bundeskanzlerin Merkel, den Gewerkschaften beizupflichten, die von Missmanagement sprechen gegenüber der Konzernleitung, welche den „schwachen Dollar“ als Hauptursache der Misere ausgemacht haben wollen. Das ist eine alte Leier. Wenn immer eine Firma ins Wanken gerät, sollen die Arbeiter denken, das liege nicht am kapitalistischen System sondern daran, dass man nicht kapitalistisch genug sei.
Jetzt sehen sich die Verteidiger des Systems allerdings bei ihren Klagen über Missmanagement gezwungen, ein wenig mehr zu verallgemeinern. Auf einmal gibt es drei Spitzenkonzerne, die unter dieser Krankheit leiden. Was schlagen sie uns also vor? Eine bessere Ausbildung für Manager? Schön. Es gibt gute und schlechte Manager. Die Firmen mit „gutem“ Management haben einen Konkurrenzvorteil gegenüber den schlecht geführten. Was wäre aber, wenn es nur noch gute Manager gäbe? Das Problem der Eliminierung der weniger konkurrenzfähigen Firmen und damit des permanenten Drucks, Stellen abzubauen und die Löhne zu drücken, würde wohl kaum verschwinden – deren Ursache nicht im „Missmanagement“ sondern in der kapitalistischen Konkurrenz liegt.
Oder wollen die Gewerkschaften beim Management der Konzerne mehr mitmischen, um dadurch deren Leitung aufzubessern? Dies ist seit Jahrzehnten längst geschehen! Die Gewerkschaften haben alle Entscheidungen bei Airbus oder der Telekom mitgetragen, die sie nun als „Missmanagement“ abkanzeln!
Die Notwendigkeit der internationalen Solidarität
Bei Airbus sehen sich die Arbeiter mit den beiden derzeitig hauptsächlichen Denkrichtungen der Bourgeoisie konfrontiert. Die Konzernleitung unter Gallois stellt den Typus der neoliberalen Globalisierer dar, welche die Firma als international operierendes Unternehmen ohne Rücksicht auf die politischen Interessen der beteiligten Nationalstaaten führen möchte. Das ist natürlich eine Utopie. Denn Airbus ist überhaupt erst als staatliches Geschöpf entstanden, als eine Willensbekundung bestimmter europäischer Staaten. Aber selbst wenn das realistisch wäre, was würde es der Arbeiterklasse anderes bescheren als das, was ohnehin angekündigt worden ist?
Die zweite, mehr protektionistisch ausgerichtete, die Rolle des Nationalstaates betonende Richtung wird auch heute wieder vornehmlich von der Politik und von den Gewerkschaften hochgehalten. Aber auch die Ideologie der „Globalisierungsgegner“ wie ATTAC steht dieser Sichtweise nah. Sie fordern die Nationalstaaten dazu auf, die Interessen der arbeitenden Bevölkerung gegenüber den „Multis“ zu wahren. Das bedeutet aber, dass diese Richtung offen die nationale Konkurrenz befürwortet. Nebenbei bemerkt: einer der Gründe, weshalb Airbus trotz voller Auftragsbücher in die Krise rutschte, war, weil etliche Aufträge aufgrund nicht passender Teile (z.B. zu kurze oder zu dicke Kabel!) nicht rechtzeitig ausgeführt werden konnten! Diese unglaubliche Inkompetenz, ebenso wie das unsinnige hin- und her Transportieren von Teilen durch halb Europa, ist u.a. ein klassisches Produkt der „Einmischung der Nationalstaaten zugunsten der arbeitenden Bevölkerung“!
Die neoliberale und die nationalstaatliche Richtung sind in Wahrheit keine Gegensätze und erst recht keine Alternativen, sondern stellen zwei Seiten ein- und derselben Medaille dar. Kapitalismus bedeutet Weltwirtschaft und zugleich Konkurrenz der Nationalstaaten. Die soeben erwähnten Ideologien betonen lediglich mehr die eine oder andere Seite dieses im Kapitalismus unlösbaren Widerspruchs.
Wir brauchen unbedingt eine Weltwirtschaft. Denn kein einziges der großen Probleme der Menschheit kann heute anders als auf Weltebene gelöst werden. Aber die kapitalistische Konkurrenz, die Produktion für den Markt, die Lohnarbeit – einst eine unentbehrliche Stachel, um die noch unterentwickelten Produktivkräfte der Menschheit zur Entfaltung zu bringen – brauchen wir längst nicht mehr. Sie sind vielmehr zu einer riesigen Fessel der Entwicklung von Wirtschaft und Kultur geworden.
Die objektive Lage selbst wirft die Systemfrage auf und damit die Frage des Internationalismus. Nur die Arbeiterklasse ist international. Die Lohnsklaven bei Airbus müssen auf der Hut sein, dürfen sich nicht ausspielen lassen, nicht nur zwischen den einzelnen Airbus-Standorten, sondern auch zwischen Airbus und Boeing, zwischen Europa und Amerika (und China usw.). Das Kapital mit seiner Konkurrenz ist weltweit. Die Arbeiterklasse muss ihren Kampf aufnehmen. Das Wesen dieses Kampfes liegt in der Aufhebung der Konkurrenz unter den Arbeitern, in der Führung des Kampfes in allen Ländern im Zeichen der internationalen Solidarität.
Proletarier aller Länder, vereinigt euch!
IKS. 5. März 2007.
Der Kommunismus ist nicht nur eine schöne Idee, sondern er steht auf der Tagesordnung der Geschichte
- 3275 reads
Der nachfolgende Artikel ist der 3. Teil der Zusammenfassung unserer bisher in der International Review erschienen Artikelserie zum Thema Kommunismus. Die ersten beiden Teile erscheinen im Laufe des Jahres 2007 auf unserer Webseite und in der Internationalen Revue auf Deutsch.
Die Lehren der Niederlage begreifen, die Vision der Zukunft aufrechterhalten
Im ersten Teil unserer Zusammenfassung des 2. Bandes untersuchten wir, wie das kommunistische Programm durch die großen Fortschritte bereichert wurde, die die Arbeiterbewegung während der Welle revolutionärer Kämpfe gemacht hatte, welche durch den I. Weltkrieg hervorgerufen worden war. In diesem zweiten Teil werden wir untersuchen, wie die Revolutionäre sich darum bemühten, den Rückfluss und die Niederlage der revolutionären Welle zu begreifen. Wir werden dabei aufzeigen, dass diese Phase auch eine Quelle unschätzbar wichtiger Lehren für die zukünftigen Revolutionen darstellt.
Kommunismus: Die Menschheit tritt in ihre wirkliche Geschichte ein (3)
Der Kommunismus ist nicht nur eine schöne Idee, sondern er steht auf der Tagesordnung der Geschichte
(Zusammenfassung Teil II)
Der nachfolgende Artikel ist der 3. Teil der Zusammenfassung unserer bisher in der International Review erschienen Artikelserie zum Thema Kommunismus. Die ersten beiden Teile erscheinen im Laufe des Jahres 2007 auf unserer Webseite und in der Internationalen Revue auf Deutsch.
Die Lehren der Niederlage begreifen, die Vision der Zukunft aufrechterhalten
Im ersten Teil unserer Zusammenfassung des 2. Bandes untersuchten wir, wie das kommunistische Programm durch die großen Fortschritte bereichert wurde, die die Arbeiterbewegung während der Welle revolutionärer Kämpfe gemacht hatte, welche durch den I. Weltkrieg hervorgerufen worden war. In diesem zweiten Teil werden wir untersuchen, wie die Revolutionäre sich darum bemühten, den Rückfluss und die Niederlage der revolutionären Welle zu begreifen. Wir werden dabei aufzeigen, dass diese Phase auch eine Quelle unschätzbar wichtiger Lehren für die zukünftigen Revolutionen darstellt.
Die Revolution kritisiert ihre Fehler (Teil 1)
Da die Russische Revolution, wie Rosa Luxemburg sagte, „die allererste Erfahrung der Diktatur des Proletariats in der Geschichte der Welt ist“, muss folglich jeder Versuch, den Weg zu einer künftigen Revolution zu bahnen, auf die Lehren zurückgreifen, die aus dieser Erfahrung hervorgingen. Eingedenk der Tatsache, dass die proletarische Bewegung nur Schaden erleiden kann, wenn sie versucht, vor der Wirklichkeit zu fliehen, gingen die Bemühungen, diese Lehren zu begreifen, auf die ersten Tage der Revolution selbst zurück, auch wenn es mehrere Jahre schmerzhafter Erfahrungen und ebenso quälender Überlegungen brauchte, um das Erbe der Russischen Revolution umfassend zu begreifen.
Die Vorlage zur Analyse der Fehler der Revolution wurde von Rosa Luxemburg in ihrer Broschüre „Zur Russischen Revolution“ geliefert, die sie 1918 im Gefängnis niederschrieb. Luxemburgs Ausgangspunkt war die grundsätzliche Solidarität mit der Sowjetmacht und der bolschwistischen Partei. Sie erkannte, dass die Schwierigkeiten, vor denen beide standen, zuallererst das Ergebnis der Isolation der russischen Bastion waren und dass sie nur überwunden werden konnten, wenn das Weltproletariat – insbesondere das deutsche Proletariat – seine Verantwortung übernahm und das Urteil der Geschichte über den Kapitalismus vollstreckte.
Innerhalb dieses Rahmens kritisierte Luxemburg die Bolschewiki in drei Bereichen:
- in der Landfrage: Auch wenn sie anerkannte, dass die bolschwistische Parole: „Das Land den Bauern“ taktisch notwendig war, um die Bauernmassen für die Sache der Revolution zu gewinnen, war Luxemburg der Auffassung, dass die Bolschewiki ihre eigenen Schwierigkeiten noch vergrößerten, als sie die Aufteilung des Landes in Parzellen formalisierten. Aber auch wenn Luxemburg richtig vorhersah, dass dieser Prozess schlussendlich eine konservative Schicht von kleinen Landbesitzern hervorbringen würde, war ebenso klar, dass die Kollektivierung des Bodens als solche keine Garantie für eine Bewegung hin zum Sozialismus war, solange die Revolution isoliert blieb.
- in der nationalen Frage: Luxemburgs Kritik an der Parole der nationalen Selbstbestimmung (die von Pjatakow und anderen innerhalb der bolschwistischen Partei vertreten wurde) wurde durch die späteren Erfahrungen vollauf bestätigt. In Wirklichkeit kann „nationale“ Selbstbestimmung nur „Selbstbestimmung“ für die Bourgeoisie bedeuten. Doch in der Epoche des Imperialismus und der proletarischen Revolution entschieden sich all die Länder (d.h. die Bourgeoisien), die von der Sowjetmacht in die „nationale Unabhängigkeit“ entlassen worden waren, dafür, sich den großen imperialistischen Mächten und deren Kampf gegen die Russische Revolution anzuschließen. Das Proletariat konnte die nationalen Befindlichkeiten der Arbeiter der „unterdrückten“ Nationen nicht ignorieren; doch diese hätten für die revolutionäre Sache nur gewonnen werden können, wenn man an ihre Klassenbedürfnisse und nicht an ihre nationalistischen Illusionen appelliert hätte.
- in der Frage der „Demokratie“ und „Diktatur“: In Luxemburgs Auffassungen zu diesen Fragen gibt es zutiefst widersprüchliche Aussagen. Auf der einen Seite meinte sie, dass sich die Abschaffung der Konstituierenden Versammlung durch die Bolschewiki negativ auf das Leben der Revolution auswirken werde. Damit legte sie eine seltsame Nostalgie für überholte Formen der bürgerlichen Demokratie an den Tag. Auf der anderen Seite rief das Spartakusprogramm, das kurze Zeit später verfasst wurde, zur Ersetzung der alten parlamentarischen Versammlungen durch Kongresse der Arbeiterräte auf, was darauf hinweist, dass sich Rosa Luxemburgs Auffassungen zu dieser Frage schnell weiterentwickelt hatten. Doch Luxemburgs Kritik an der Tendenz der Bolschewiki, die Redefreiheit in der Arbeiterbewegung einzuschränken, war sehr wohl begründet. Diese gegen andere Gruppen der Arbeiterklasse und gegen andere Parteien getroffenen Maßnahmen sowie die Umwandlung der Sowjets in ausführende Organe des von der bolschwistischen Partei angeführten Staates erwiesen sich in der Tat als negativ für das Überleben und die Integrität der proletarischen Diktatur.
In Russland selbst kam es bereits 1918 zu ersten Reaktionen gegen die Gefahr der Kursabweichung der Partei. Ihr Zentrum (zumindest unter den Strömungen des revolutionären Marxismus) war die linkskommunistische Tendenz in der bolschwistischen Partei. Diese Tendenz war hauptsächlich wegen ihres Widerstandes gegen den Brest-Litowsker Vertrag bekannt geworden, von dem sie fürchtete, dass er nicht nur zur Aufgabe von Teilen des Landes, sondern auch zur Aufgabe der Prinzipien selbst führen würde. Doch auf der Ebene der Prinzipien ist ein Vergleich zwischen Brest-Litowsk und dem vier Jahre später abgeschlossenen Rapallo-Vertrag unzulässig. Ersterer wurde in aller Offenheit verhandelt; es gab keinen Versuch der Verschleierung der brutalen Folgen des Vertrages. Letzterer dagegen wurde geheim ausgehandelt und führte de facto zu einem Bündnis zwischen dem deutschen Imperialismus und dem sowjetischen Staat. Zudem fußte, wie Bilan später unterstrich, die Position, die von Bucharin und anderen Linkskommunisten zugunsten eines „revolutionären“ Krieges vertreten wurde, auf einer ernsthaften Konfusion: auf der Vorstellung, dass die Revolution hauptsächlich durch militärische Mittel in der einen oder anderen Form ausgedehnt werden könne, während sie in Wirklichkeit die Arbeiter der ganzen Welt nur durch den Einsatz von im Wesentlichen politischen Mitteln (wie die Bildung der Kommunistischen Internationale 1919) für sich gewinnen kann.
Nützlicher für das Verständnis der Lehren aus der Revolution waren die ersten Debatten zwischen Lenin und der Linken über den Staatskapitalismus. Lenin trat dafür ein, die deutschen Waffenstillstandsbedingungen zu akzeptieren, um so der Sowjetmacht die dringend benötigte „Atempause“ zu verschaffen, in der sie ein Mindestmaß an gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Leben wieder aufbauen sollte.
Die Divergenzen kreisten um zwei Fragen:
- um die Frage der in diesem Prozess verwendeten Mittel: Lenin, dessen besonderes Anliegen der Kampf um Produktivität und Effizienz gegen das erdrückende Gewicht der russischen Rückständigkeit war, plädierte für strenge Maßnahmen wie die Übernahme des Taylor-Systems und die Ein-Mann-Führung der Betriebe, während die Linke darauf beharrte, dass solche Methoden für die Selbsterziehung und die Selbstaktivierung des Proletariats schädlich seien. Ähnliche Debatten entbrannten in der Frage, in welchem Maße die Prinzipien der Kommune auf die Rote Armee angewandt werden sollen.
- um die Gefahr des Staatskapitalismus: Aus Lenins Sicht war der Staatskapitalismus ein Schritt vorwärts, weil die russische Wirtschaft zuvor fragmentiert gewesen und in einem halb-mittelalterlichen Zustand verharrt geblieben sei. Dies stand in Einklang mit der Auffassung, dass der große Schub staatskapitalistischer Entwicklung in den entwickelten Ländern nach dem 1. Weltkrieg in einem gewissen Sinne eine Vorbereitung für die sozialistische Umwälzung sei. Die Linken wiederum neigten dazu, die dem Staatskapitalismus innewohnende Bedrohung für die Arbeitermacht zu sehen, und warnten vor der Gefahr, dass die Partei durch den Prozess bürokratischer Staatskontrolle vereinnahmt und sich letztendlich gegen die Interessen des Proletariats wenden werde.
Die Kritik der Linken am Staatskapitalismus steckte sicherlich erst in ihren Anfängen und enthielt viele Konfusionen. Sie neigte dazu, die Hauptgefahr im Kleinbürgertum zu lokalisieren; und sie war sich auch im Unklaren darüber, dass die Staatsbürokratie selbst die Rolle einer neuen Bourgeoisie spielen könnte. Auch hegten die Linken Illusionen über die Möglichkeit einer echten sozialistischen Umwälzung innerhalb russischer Grenzen. Doch Lenin irrte, als er im Staatskapitalismus etwas anderes als die Negation des Kommunismus erblickte. Auch mit ihrer Warnung vor der Entwicklung in Russland sollten die Linken Recht behalten; ihre Vorhersagen sollten sich als geradezu prophetisch erweisen.
2) „1921 – Das Proletariat und der Übergangsstaat“
(International Review, Nr. 100)
Trotz der großen Differenzen innerhalb der bolschwistischen Partei wegen des Kurses der Revolution und insbesondere wegen der Richtung, den der sowjetische Staat einschlug, bewirkte die Notwendigkeit der Einheit in Anbetracht der unmittelbaren Bedrohung durch die Konterrevolution, dass diese Differenzen in gewisser Weise eingedämmt wurden. Das Gleiche kann man hinsichtlich der Spannungen in der russischen Gesellschaft insgesamt sagen: Trotz der schrecklichen Bedingungen für die Arbeiter und Bauern während der Bürgerkriegszeit wurde der wachsende Konflikt zwischen den materiellen Interessen und den politischen und ökonomischen Forderungen des neuen Staatsapparates durch den Kampf gegen die weiße Konterrevolution unter Kontrolle gehalten. Doch mit dem Sieg im Bürgerkrieg war der Deckel entfernt worden. Und mit der zunehmenden Isolation der Revolution infolge einer Reihe von entscheidenden Niederlagen des Proletariats in Europa trat der Konflikt erneut als zentraler Widerspruch des „Übergangsregimes“ hervor.
Innerhalb der Partei kam das grundlegende Problem, vor dem die Revolution stand, durch die Debatte über die Gewerkschaftsfrage ans Tageslicht, die auf dem 10. Parteikongress im März 1921 stattfand. Diese Debatte drehte sich hauptsächlich um drei verschiedene Positionen, obgleich es zwischen ihnen und um sie selbst herum viele unterschiedliche Schattierungen gab:
- die Position Trotzkis: Nachdem er die Rote Armee trotz oft überwältigender Schwierigkeiten zum Sieg gegen die Weißen Armeen geführt hatte, war Trotzki zu einem glühenden Verfechter militärischer Methoden geworden. Er wollte sie in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens angewandt sehen, insbesondere im Arbeitsleben. Da der Staat, der diese Methoden anwende, ein „Arbeiterstaat“ sei, meinte er, könne es keine Interessenkonflikte zwischen der Arbeiterklasse und den Forderungen des Staates geben. Er ging sogar so weit, die Zwangsarbeit als historisch fortschrittliche Möglichkeit zu theoretisieren. In diesem Zusammenhang empfahl er, dass die Gewerkschaften offen als Organe der Arbeitsdisziplin zugunsten des Arbeiterstaates handeln sollten. Gleichzeitig begann Trotzki, eine ausdrückliche theoretische Rechtfertigung des Begriffs der Diktatur der Kommunistischen Partei und des Roten Terrors zu entwickeln.
- die Position der Arbeiteropposition um Kollontai, Schljapnikow und andere: Aus der Sicht Kollontais hatte der Sowjetstaat einen heterogenen Charakter, und er war höchst zugänglich für den Einfluss nicht-proletarischer Kräfte wie Bürokraten und Bauern. Für die schöpferische Arbeit, die bei dem Aufbau der russischen Wirtschaft zu leisten sei, sei es deshalb nötig, dass diese von spezifischen Organen der Arbeiter geleitet würden, wofür aus der Sicht der Arbeiteropposition die Industriegewerkschaften in Frage kamen. Ihr zufolge konnte die Arbeiterklasse mit Hilfe der Industriegewerkschaften die Kontrolle der Produktion aufrechterhalten und entscheidende Schritte zum Kommunismus einleiten. Diese Strömung brachte eine proletarische Reaktion gegenüber der wachsenden Bürokratisierung des Sowjetstaates zum Ausdruck, aber sie litt auch an einer ernsthaften Schwäche. Ihre Befürwortung der Industriegewerkschaften als der beste Ausdruck der Interessen der Arbeiterklasse bedeutete einen Rückschritt im Verständnis der Rolle der Arbeiterräte, die in der neuen revolutionären Epoche als das Instrument des Proletariats zur Leitung nicht nur des wirtschaftlichen, sondern auch des politischen Lebens entstanden waren. Und gleichzeitig kam mit den Illusionen der Opposition über die Möglichkeit der Errichtung neuer kommunistischer Verhältnisse in Russland eine erhebliche Unterschätzung der negativen Auswirkungen der Isolation der Revolution zum Ausdruck. 1921 war die Isolation fast total.
- die Position Lenins: Lenin wehrte sich vehement gegen die Exzesse Trotzkis in dieser Debatte. Er wandte sich gegen den Sophismus, demzufolge es auf unmittelbarer Ebene keinen Interessenkonflikt zwischen Staat und Arbeiterklasse geben könne, da es sich bei diesem Staat um einen Arbeiterstaat handle. Zwar behauptete Lenin einst, dass der Arbeiterstaat faktisch ein „Arbeiter- und Bauernstaat“ sei, aber er räumte auch ein, dass es sich dabei um einen bürokratisch sehr deformierten Staat handle. In solch einer Lage müsse die Arbeiterklasse immer noch ihre materiellen Interessen verteidigen können, wenn notwendig, auch gegen den Staat. Die Gewerkschaften sollten deshalb nicht nur als Organe der Arbeitsdisziplin, sondern auch als Organe der proletarischen Selbstverteidigung betrachtet werden. Gleichzeitig verwarf Lenin die Position der Arbeiteropposition als eine Konzession gegenüber dem Anarcho-Syndikalismus.
Rückblickend können wir sagen, dass die Grundlagen dieser Debatte mit großen Schwächen behaftet waren. Zunächst war es kein Zufall, dass die Gewerkschaften so widerstandslos bereit waren, zu Organen der Arbeitsdisziplin im Interesse des Staates zu werden. Diese Richtung wurde durch die neuen Bedingungen der kapitalistischen Dekadenz aufgezwungen. Nicht die Gewerkschaften, sondern die Organe, mit denen die Klasse auf diese neue Zeit reagiert hatte – Fabrikkomitees, Räte usw. –, hatten zur Aufgabe, die Autonomie der Arbeiterklasse zu verteidigen. Gleichzeitig waren all die Strömungen, die sich an dieser Debatte beteiligten, mehr oder weniger der Idee verbunden, dass die Diktatur des Proletariats durch die Kommunistische Partei ausgeübt werden sollte.
Doch die Debatte zeigte bei aller Konfusion den Versuch zu begreifen, was geschieht, wenn die Staatsmacht, die von der Revolution geschaffen wurde, anfängt, der Kontrolle des Proletariats zu entgleiten und sich gegen die Interessen des Proletariats zu richten. Dieses Problem sollte noch dramatischer durch den Kronstädter Aufstand illustriert werden, der während des 10. Kongresses der Partei nach einer Reihe von Arbeiterkämpfen in Petrograd ausbrach.
Die Führung der Bolschewiki prangerte die Rebellion anfangs als eine reine Verschwörung der Weißen Garden an. Später legte sie die Betonung auf ihren kleinbürgerlichen Charakter, aber die Niederschlagung der Revolte wurde mit dem Argument gerechtfertigt, dass sie sowohl geographisch wie auch politisch der Konterrevolution den Weg bereitet habe. Und dennoch war Lenin gezwungen einzugestehen, dass die Revolte eine Warnung vor einer weiteren Fortsetzung der Zwangsarbeitsmethoden der kriegskommunistischen Phase bedeutete und eine Art „Normalisierung“ der kapitalistischen gesellschaftlichen Verhältnisse anmahnte. Doch hinsichtlich der Auffassung, dass die Verteidigung der proletarischen Macht in Russland die ausschließliche Rolle der bolschwistischen Partei sei, gab es keinen Kompromiss. Diese Auffassung wurde von vielen russischen Linkskommunisten geteilt. Auf dem 10. Kongress zählten Mitglieder der oppositionellen Gruppen zu den ersten Freiwilligen für den Angriff auf die Kronstädter Garnison. Sogar die KAPD in Deutschland leugnete, dass sie die Rebellen unterstützte. Auch Viktor Serge verteidigte schweren Herzens die Niederschlagung der Revolte als das geringere der beiden Übel, da die Alternative der Sturz der Bolschewiki und der Aufstieg einer neuen weißen Tyrannei sei.
Dennoch gab es innerhalb des revolutionären Lagers diesbzüglich auch Meinungsverschiedenheiten. Da gab es natürlich die Anarchisten, die schon viele richtige Kritiken an den Exzessen der Tscheka und der Unterdrückung der Organisationen der Arbeiterklasse geübt hatten. Doch der Anarchismus bietet wenige nützliche Lehren aus dieser Erfahrung, da aus seiner Sicht die Reaktion der Bolschewiki auf die Revolte von Anfang an dem Wesen einer jeden marxistischen Partei entsprach.
In Kronstadt selbst schlossen sich jedoch auch viele Bolschewiki auf der Grundlage der ursprünglichen Ideale des Oktober 1917 dem Aufstand an: für die Sowjetmacht und die Weltrevolution. Der Linkskommunist Miasnikow verweigerte die Unterstützung derjenigen, die sich am Angriff auf die Garnison beteiligt hatten. Er ahnte die katastrophalen Ergebnisse, die die Niederschlagung der Arbeiterrevolte durch den „Arbeiterstaat“ verurachen würde. Damals war dies noch eine Ahnung. Erst in den 1930er Jahren, als die Italienischen Linkskommunisten sich mit der Frage befassten, konnten mit größter Klarheit die Lehren daraus gezogen werden. Die Italienische Linke, die die Revolte als ohne Zweifel proletarisch bezeichnete, meinte, dass die Ausübung von Gewalt innerhalb der Arbeiterklasse aus Prinzip abgelehnt werden müsse; dass die Arbeiterklasse über Mittel zu ihrer eigenen Verteidigung gegen den Übergangsstaat verfügen müsse, der aufgrund seines Wesens Gefahr laufe, ein Anziehungspunkt für die Kräfte der Konterrevolution zu werden, und dass die Kommunistische Partei sich nicht mit dem Staatsapparat vermischen dürfe, sondern ihre Unabhängigkeit ihm gegenüber bewahren müsse. Die Italienische Linke stellte die Prinzipien über den Schein der Zweckmäßigkeit. Deshalb war sie auch der Auffassung, dass es besser gewesen wäre, Kronstadt zu verlieren, als die Macht zu behalten, da dadurch die grundlegenden Ziele der Revolution untergraben worden seien.
1921 stand die Partei vor einem historischen Dilemma: die Macht zu behalten und zu einem Träger der Konterrevolution zu werden oder in die Opposition zu gehen und in den Reihen der Arbeiterklasse tätig zu werden. Indes war die Verschmelzung zwischen Partei und Staat schon zu weit fortgeschritten, als dass die Partei in ihrer Gesamtheit den letztgenannten Weg hätte einschlagen können. Daher stand konkret die Arbeit einer linken Fraktion an, die innerhalb und außerhalb der Partei tätig werden musste, um sich der zunehmenden Degeneration zu widersetzen. Das Fraktionsverbot innerhalb der Partei nach dem 10. Kongress bedeutete, dass diese Aufgabe zunehmend außerhalb der Partei und schließlich gegen die bestehende Partei angegangen werden musste.
3) „1922-23: Die kommunistischen Fraktionen gegen die ansteigende Konterrevolution“ (International Review Nr. 101)
Die Konzessionen an die Bauernschaft – für Lenin waren sie eine unumgängliche Notwendigkeit, die durch den Kronstädter Aufstand um so dringender geworden waren - fanden ihren Ausdruck in der Neuen Ökonomischen Politik. Diese wurde als ein zeitweiliger Rückzug angesehen, der es der vom Krieg zerrissenen proletarischen Macht erlauben werde, ihre in Schutt und Asche liegende Wirtschaft wieder aufzubauen, um sich so als Bastion der Weltrevolution am Leben zu halten. In der Praxis jedoch führte der Versuch, die Isolation des Sowjetstaates zu durchbrechen, zu grundlegenden Konzessionen in Grundsatzfragen, nicht nur bezüglich des Handels mit kapitalistischen Mächten (was als solches kein Bruch der Prinzipien war), sondern auch bezüglich geheimer militärischer Bündnisse, wie der Rapallo-Vertrag mit Deutschland. Und neben diesen militärischen Bündnissen entstanden unnatürliche politische Allianzen mit Kräften der Sozialdemokratie, die zuvor als der linke Flügel der Bourgeoisie entlarvt worden waren. Dies war die Politik der „Einheitsfront“, die vom 3. Kongress der Komintern verabschiedet worden war.
Lenin hatte bereits 1918 behauptet, dass der Staatskapitalismus für ein rückständiges Land wie Russland einen Schritt vorwärts bedeute; 1922 behauptete er ferner, dass der Staatskapitalismus dem Proletariat nützen könne, solange er von einem „proletarischen Staat“ geleitet werde. Gleichzeitig jedoch musste er einräumen, dass der Staat - weit entfernt davon der Staat zu sein, den man in der Revolution geerbt hatte - dabei war, alles zu lenken, aber nicht in die Richtung, die er einschlagen sollte, sondern zurück zu einer bürgerlichen Restaurierung.
Lenin erkannte schnell, dass die Kommunistische Partei selbst zutiefst von diesem Prozess der Regression erfasst worden war. Zunächst führte er das Problem hauptsächlich auf die unteren Schichten von kulturlosen Bürokraten zurück, die begonnen hatten, massenhaft in die Partei einzudringen. Aber in seinen letzten Lebensjahren wurde ihm auf schmerzhafte Weise klar, dass der Fäulnisprozess bis in die höchsten Ebenen der Partei vorgedrungen war. Wie Trotzki hervorhob, konzentrierte sich Lenins letzter Kampf hauptsächlich auf Stalin und den aufkommenden Stalinismus. Im Gefängnis des Staates eingesperrt, war Lenin jedoch unfähig, mehr als nur administrative Maßnahmen zur Eindämmung der aufkommenden Bürokratie vorzuschlagen. Hätte er länger gelebt, wäre er sicher dazu gedrängt worden, eine oppositionellere Haltung einzunehmen; so aber musste der Kampf gegen die aufsteigende Konterrevolution jetzt von anderen übernommen werden.
1923 brach die erste Wirtschaftskrise in der Phase der NEP aus. Für die Arbeiterklasse hieß dies Lohnkürzungen und Stellenstreichungen sowie eine Welle von spontanen Streiks. Innerhalb der Partei rief sie Konflikte und Debatten hervor; auch brachte sie neue Oppositionsgruppen hervor. Ihr erster expliziter Ausdruck war die Plattform der 46, der auch Prominente wie Trotzki (er wurde damals schon zunehmend von dem herrschenden Triumvirat Stalin, Kamenew und Sinowjew kritisiert) und Mitglieder der Gruppe Demokratischer Zentralismus angehörten. Die Plattform kritisierte die Bereitschaft, die NEP als adäquaten Weg zum Sozialismus zu betrachten; sie forderte mehr statt weniger zentrale Planung. Wichtiger noch - sie warnte vor der zunehmenden Erdrosselung des Parteilebens.
Gleichzeitig distanzierte sich die Plattform von den radikaleren oppositionellen Gruppen, die damals entstanden waren. Die wichtigste unter ihnen war die Arbeitergruppe Miasnikows, die an den Streiks in den Industriezentren beteiligt war. Obwohl sie als eine verständliche, aber „morbide“ Reaktion gegen die aufkommende Bürokratie angesehen wurde, war das Manifest der Arbeitergruppe in Wirklichkeit ein Ausdruck der Ernsthaftigkeit der russischen Kommunistischen Linken:
- Die Schwierigkeiten des Sowjetregimes erklärten sie mit der Isolation und der fehlgeschlagenen Ausdehnung der Revolution.
- Ihre Kritik an der opportunistischen Politik der Einheitsfront war hellsichtig; sie bekräftigte ihre ursprüngliche Analyse, dass die sozialdemokratischen Parteien Verteidiger des Kapitalismus seien.
- Sie warnten vor den Gefahren des Aufkommens einer neuen kapitalistischen Oligarchie und riefen zur Erneuerung der Sowjets und der Fabrikkomitees auf.
- Gleichzeitig waren sie äußerst vorsichtig bei der Einschätzung der Charakteristiken des Sowjetregimes und der bolschwistischen Partei. Im Gegensatz zu Bogdanows Gruppe Arbeiterwahrheit wollten sie nichts mit der Idee zu tun haben, dass die Revolution oder die bolschwistische Partei von Anfang an bürgerlich gewesen sei. Sie begriffen ihre Rolle im Wesentlichen als die einer linken Fraktion, die innerhalb und außerhalb der Partei für ihre Wiederaufrichtung kämpfte.
Die Linkskommunisten waren deshalb die theoretische Avantgarde im Kampf gegen die Konterrevolution in Russland. Die Tatsache, dass Trotzki 1923 eine offen oppositionelle Haltung eingenommen hatte, war in Anbetracht seines Rufs als Führer des Oktoberaufstandes von großer Bedeutung. Jedoch zeichnete sich im Vergleich zu den kompromisslosen Positionen der Arbeitergruppe Trotzkis Opposition gegen den Stalinismus durch eine zögerliche und zentristische Herangehensweise aus:
- Trotzki verpasste eine Reihe von Gelegenheiten, einen offenen Kampf gegen den Stalinismus zu führen; insbesondere zögerte er, Lenins „Testament“ zu benutzen, um Stalin anzuprangern und ihn aus der Parteiführung zu drängen.
- Er neigte dazu, während vieler Debatten innerhalb des bolschwistischen Zentralorgans zu schweigen.
Diese Schwächen sind vor allem auf Charakterfragen zurückzuführen. Trotzki war kein durchtriebener Intrigant wie Stalin, er besaß keine umfassenden persönlichen Ambitionen. Aber es gab noch tieferliegende, politische Gründe für Trotzkis Unfähigkeit, seine Kritik so weit wie die radikalen Schlussfolgerungen der Kommunistischen Linken zu entwickeln.
- Trotzki hatte nie verstanden, dass Stalin und seine Fraktion keine verirrte, fehlgeleitete zentristische Tendenz innerhalb der Arbeiterbewegung darstellten, sondern die Speerspitze einer bürgerlichen Konterrevolution.
- Trotzkis eigener Werdegang als eine Person im Mittelpunkt des Sowjetregimes erschwerte es ihm, sich von dem Prozess des Niedergangs zu lösen. Ein tief in der Partei verwurzelter „Parteipatriotismus“ erschwerte es zudem Trotzki und anderen Oppositionellen anzuerkennen, dass die Partei sich irren kann.
4) „1924-28: Der Triumph des stalinistischen Staatskapitalismus“
(International Review Nr. 102)
1927 hatte Trotzki akzeptiert, dass die Gefahr einer bürgerlichen Restaurierung in Russland bestand – eine Art schleichende Konterrevolution ohne den förmlichen Sturz des bolschwistischen Regimes. Aber er unterschätzte sehr stark, bis zu welchem Punkt dieser Prozess schon gereift war, ja dass er nahezu abgeschlossen war.
- Es war für ihn sehr schwer zu begreifen, dass er selbst in großem Maße am Niedergangsprozess beteiligt war (durch die Politik der Militarisierung der Arbeit, der Niederschlagung Kronstadts usw.).
- Während er begriff, dass die Probleme, vor denen die Sowjetunion stand, ein Ergebnis der Isolierung und des Rückzugs der internationalen Revolution waren, verstand Trotzki nicht das Ausmaß der Niederlage, die die Arbeiterklasse im Begriff war zu erleiden. Vor allem aber erkannte er nicht, dass die Sowjetunion schon dabei war, sich in das imperialistische Weltsystem einzugliedern.
- Trotzki glaubte, dass der russische „Thermidor“ durch einen Sieg jener Kräfte erfolgen würde, die auf eine Rückkehr des Privateigentums (NEP-Leute, Kulaken, die Rechte um Bucharin) drängten. Der Stalinismus wurde als eine Art Zentrismus, nicht als eine Speerspitze der staatskapitalistischen Konterrevolution definiert.
Die ökonomischen Theorien der linken Opposition um Trotzki erschwerten die Erkenntnis, dass der „Sowjetstaat“ selbst zum direkten Träger der Konterrevolution geworden war, ohne dass es eine Rückkehr zum klassischen Privateigentum gegeben hatte. Die Bedeutung der Erklärung Stalins vom „Sozialismus in einem Land“ wurde sehr spät und nie vollständig begriffen. Durch den Tod Lenins und die offensichtliche Stagnation der Weltrevolution mutiger geworden, vollzog Stalin mit dieser Erklärung einen offenen Bruch mit dem Internationalismus und verpflichtete sich, Russland zu einer imperialistischen Weltmacht aufzubauen. Dies stand im völligen Gegensatz zum Bolschewismus des Jahres 1917, der betont hatte, dass der Sozialismus nur das Ergebnis einer erfolgreichen Weltrevolution sein kann. Aber je mehr die Bolschewiki an der Verwaltung des Staates und der Wirtschaft in Russland beteiligt und durch sie absorbiert wurden, um so mehr neigten sie dazu, die Verwirklichung des Sozialismus auch in einem isolierten und rückständigen Land zu theoretisieren. So wurde die Debatte über die NEP beispielsweise aus diesem Blickwinkel betrachtet: Die Rechte argumentierte, dass der Sozialismus durch das Wirken der Marktkräfte eingeführt werden könne, wohingegen die Linke die Rolle der Planwirtschaft und der Schwerindustrie betonte. Preobrashenski, der Haupttheoretiker der linken Opposition in ökonomischen Fragen, sprach von der Überwindung des kapitalistischen Wertgesetzes durch ein Monopol im Außenhandel und der Akkumulation im staatlichen Sektor. Man nannte dies gar „primitive sozialistische Akkumulation“.
Die Theorie der primitiven sozialistischen Akkumulation verwechselte fälschlicherweise das Wachstum der Industrie mit den Interessen der Arbeiterklasse und des Sozialismus. In Wirklichkeit war ein Industriewachstum in Russland nur durch die wachsende Ausbeutung der Arbeiterklasse möglich. Kurzum, primitive sozialistische Akkumulation konnte nur heißen: Akkumulation von Kapital. Deshalb warnte die Italienische Linke zum Beispiel vor jeder Tendenz, industrielles Wachstum oder die Verstaatlichung von Industrien als eine fortschrittliche, zum Sozialismus weisende Maßnahme zu betrachten.
Nach dem Auseinanderbrechen des herrschenden Triumvirates wurde der Kampf gegen die Theorie des „Sozialismus in einem Lande“ von der Gruppe um Sinowjew aufgenommen. Dies führte zur Bildung der Vereinigten Opposition 1926, die anfangs auch die Demokratischen Zentralisten umfasste. Obwohl man sich formell dem Verbot der Bildung von Fraktionen unterwarf, war die neue Opposition zunehmend gezwungen, ihre Kritik am Regime auf die unteren Ränge der Partei und sogar direkt auf die Arbeiter auszudehnen. Dabei stieß sie auf Drohungen, Beleidigungen, erfundene Beschuldigungen, Repression und Ausschluss. Dennoch war sie noch immer nicht in der Lage, das Wesen dessen, wogegen sie kämpften, zu begreifen. Stalin machte sich ihren Wunsch nach Versöhnung innerhalb der Partei zunutze, indem er sie zwang, auf jede so genannte Fraktionsaktivität zu verzichten. Die Gruppe um Sinowjew und einige Anhänger Trotzkis kapitulierten sofort. Und als Stalin 1928 seine „Linkswende“ und eine zügige Industrialisierungspolitik verkündete, nahmen viele Trotzkisten, Preobrashenksi eingeschlossen, an, dass Stalin doch noch ihre Positionen übernommen habe.
Gleichzeitig jedoch gerieten jene Mitglieder der Opposition unter den wachsenden Einfluss der Linkskommunisten, denen es besser gelungen war zu begreifen, dass die Konterrevolution schon eingetreten war. Die Demokratischen Zentralisten zum Beispiel, die zwar noch Hoffnungen auf eine radikale Reform des Sowjetregimes hegten, waren sich weitaus klarer darüber, dass die verstaatliche Industrie nicht mit dem Sozialismus gleichzusetzen war, dass die Verschmelzung zwischen Staat und Partei zur Liquidierung der Partei führte und dass die Außenpolitik des Sowjetregimes sich zunehmend gegen die internationalen Interessen des Proletariats richtete. Nach dem massenhaften Ausschluss der Opposition 1927 entwickelten die Linkskommunisten mehr und mehr die Auffassung, dass Regime und Partei nicht mehr reformierbar waren. Die Reste der Miasnikow-Gruppe spielten eine Schlüsselrolle bei der nun einsetzenden Radikalisierung. Doch im Verlauf der nächsten Jahre sollten die lebhaften Debatten über das Wesen des Regimes vor allem in Stalins Gefängnissen geführt werden.
5) „Die Lösung des russischen Rätsels: 1926-36“
(International Review Nr. 105)
In Anbetracht des Ausmaßes der Niederlage verlagerte sich jetzt der Schwerpunkt der Bemühungen, das Wesen des stalinistischen Regimes zu begreifen, nach Westeuropa. In dem Maße, wie die Kommunistischen Parteien „bolschewisiert“, d.h. in leicht beeinflussbare Instrumente der russischen Außenpolitik verwandelt wurden, entstand in ihren Reihen eine Vielzahl von Oppositionsgruppen, die sich jedoch schnell von der Partei abspalteten oder ausgeschlossen wurden.
In Deutschland umfassten diese Gruppen manchmal Tausende von Mitgliedern, wenngleich ihre Mitgliederzahlen schnell schrumpften. Die KAPD existierte noch und intervenierte gegenüber diesen Gruppen. Eine der bekanntesten war die Gruppe um Karl Korsch; die Korrespondenz zwischen ihm und Bordiga in Italien verdeutlicht viele der Probleme, vor denen die Revolutionäre damals standen.
Eines der Merkmale der Deutschen Linken – ein Faktor, der zu ihrem organisatorischen Zerfall mit beitrug – war die Tendenz, voreilige Schlüsse über das Wesen des neuen Systems in Russland zu ziehen. Während sie dessen kapitalistisches Wesen erkannten, waren sie oft nicht in der Lage, die Hauptfrage zu beantworten: Wie kann sich eine proletarische Macht in ihr Gegenteil verkehren? Oft bestand ihre Antwort in der Leugnung, dass diese jemals proletarisch gewesen war. Man behauptete, dass die Oktoberrevolution nichts anderes als eine bürgerliche Revolution und die Bolschewiki nichts als eine Partei der Intelligentsia gewesen seien.
Bordigas Antwort verkörperte die eher geduldigere Methode der Italienischen Linken. Sie war gegen den überstürzten Versuch des Aufbaus einer Organisation ohne eine gesunde programmatische Grundlage. Bordiga unterstützte die Notwendigkeit einer umfassenden und tiefgreifenden Diskussion der Lage, die viele neue Fragen aufgeworfen hatte. Dies war die einzige Grundlage einer substanziellen Umgruppierung. Gleichzeitig weigerte er sich, den proletarischen Charakter der Oktoberrevolution in Frage zu stellen. Statt dessen betonte er, dass die Frage, vor der die revolutionäre Bewegung stünde, laute: Wie konnte eine isolierte, auf ein Land beschränkte proletarische Macht in einen solchen Prozess der inneren Degeneration geraten?
Mit dem Sieg des Nationalsozialismus in Deutschland verlagerte sich erneut der geographische Schwerpunkt der Diskussionen – dieses Mal nach Frankreich, wo eine Reihe von Oppositionsgruppen 1933 eine Konferenz in Paris abhielt, um über das Wesen des Regimes in Russland zu diskutieren. Es beteiligten sich auch die „offiziellen“ Anhänger Trotzkis, doch die meisten Gruppen standen eher links, wie auch die Exilgruppe der Italienischen Linken. In der Konferenz tauchten viele Theorien über den Charakter des Regimes auf, von denen viele sich stark widersprachen: dass es sich um einen Klassensystem neuen Typs handelte, welches man nicht mehr unterstützen dürfe; dass es sich um ein Klassensystem neuen Typs handelte, welches man dennoch weiter unterstützen müsse; dass es ein proletarisches Regime geblieben sei, welches man aber nicht mehr verteidigen dürfe… All dies spiegelte die großen Schwierigkeiten der Revolutionäre wider zu begreifen, in welche Richtung sich die Sowjetunion entwickelte und was dies bedeutete. Aber es zeigte auch, dass die „orthodoxe“ trotzkistische Position – wonach die UdSSR trotz ihrer Entartung ein Arbeiterstaat bleibe und gegen den Imperialismus verteidigt werden müsse – von verschiedenen Seiten angegriffen wurde.
Größtenteils aufgrund dieses Drucks seitens der Linken schrieb Trotzki 1936 seine berühmte Analyse der russischen Revolution: „Die verratene Revolution“.
Dieses Buch belegt, dass Trotzki, obwohl er zunehmend dem Opportunismus anheimfiel, ein Marxist geblieben war. So zertrümmerte er schlagfertig die Behauptung des Stalinismus, die UdSSR sei ein Paradies für die Arbeiter. Sich auf die Aussage Lenins stützend, dass der Übergangsstaat „ein bürgerlicher Staat ohne Bourgeoisie“ ist, lieferte er wichtige Erkenntnisse über das Wesen dieses Staates und seine von ihm für das Proletariat ausgehende Gefahr. Trotzki kam damals sogar zur Schlussfolgerung, dass die alte bolschwistische Partei tot sei und die Bürokratie nicht mehr reformiert werden könne, sondern mit Gewalt gestürzt werden müsse. Doch das Buch hat eine fundamentale Schwäche – es wendet sich ausdrücklich gegen die Auffassung, dass die UdSSR eine Form des Staatskapitalismus war. Trotzki verteidigte hartnäckig die These, dass die staatlichen Eigentumsformen ein Beleg für den proletarischen Charakter des russischen Staates seien. Während er theoretisch eingestand, dass es in der kapitalistischen Niedergangsphase eine Tendenz zum Staatskapitalismus gibt, lehnte er die Idee ab, dass die stalinistische Bürokratie eine neue herrschende Klasse sei, denn sie besitze keine Aktien und könne ihr Eigentum nicht weiter vererben. Damit reduzierte er das Kapital auf eine juristische Form, anstatt es als ein im Wesentlichen unpersönliches gesellschaftliches Verhältnis zu betrachten.
Und was die Idee angeht, dass die UdSSR immer noch ein Arbeiterstaat sei, obgleich er selbst eingestehen musste, dass die Arbeiterklasse als solche von der politischen Macht völlig ausgeschlossen war, so brachte dies ein mangelndes, oberflächliches Verständnis des Wesens der proletarischen Revolution zum Vorschein. Die proletarische Revolution ist die erste Revolution in der Geschichte, die das Werk einer eigentumslosen Klasse ist; eine Klasse, die nicht über ihre eigenen Wirtschaftsformen verfügt und die ihre Befreiung nur erreichen kann, wenn sie in der Lage ist, ihre politische Macht als einen Hebel zu benutzen, um die „spontanen“ Gesetze der Wirtschaft unter die bewusste Kontrolle der Menschen zu bringen.
Vor allem aber zwang Trotzkis Charakterisierung der UdSSR seine Bewegung dazu, in der ganzen Welt den Stalinismus radikal zu verteidigen. Dies ging deutlich aus Trotzkis Argument hervor, wonach das schnelle Industriewachstum unter Stalin – das sich auf eine schreckliche Ausbeutung der Arbeiterklasse stützte und Teil der Vorbereitungen der Kriegswirtschaft im Hinblick auf eine neue imperialistische Aufteilung der Welt war – ein Beweis für die Überlegenheit des Sozialismus über den Kapitalismus sei. Es wurde auch offenkundig angesichts Trotzkis entschlossener Unterstützung der russischen Außenpolitik und der kompromisslosen Verteidigung der Sowjetunion gegen imperialistische Angriffe zu einer Zeit, als der russische Staat selbst zu einem aktiven Mitspieler auf der imperialistischen Weltbühne geworden war. Diese Analyse barg den Keim für den Verrat der Trotzkisten am Internationalismus im II. Weltkrieg in sich.
Trotzkis Buch gab der Idee Auftrieb, dass die Frage der Sowjetunion noch nicht endgültig geklärt sei und dass dies nur entscheidende historische Ereignisse wie ein Weltkrieg regeln könnten. In seinen letzten Schriften, in denen er sich möglicherweise der Risse in seiner Theorie des „Arbeiterstaates“ bewusst wurde, aber noch zögerte anzuerkennen, dass die UdSSR ein kapitalistisches Gebilde war, begann er darüber zu spekulieren, dass, wenn der Stalinismus eine neue Form der Klassenherrschaft darstellte, die weder kapitalistisch noch sozialistisch wäre, der Marxismus seine Glaubwürdigkeit verloren hätte. Trotzki selbst wurde ermordet, bevor er sich dazu äußern konnte, ob der Krieg in der Tat das „russische Rätsel“ gelöst hatte. Doch nur diejenigen unter seinen Gefolgsleuten, welche dem Weg folgten, den die Kommunistische Linke eingeschlagen hatte, und die Analyse des Staatskapitalismus übernahmen (wie Stinas in Griechenland, Munis in Spanien und Trotzkis Frau Natalia), blieben dem proletarischen Internationalismus während und nach dem II. Weltkrieg treu.
6) „Das russische Rätsel und die Italienische Kommunistische
Linke 1933-46“ (International Review Nr. 106)
Die Kommunistische Linke fand ihren klarsten Ausdruck unter jenen Teilen des Weltproletariats, die den Kapitalismus in der revolutionären Welle am stärksten herausgefordert hatten. Neben Russland waren dies das deutsche und italienische Proletariat; folglich waren die Deutsche und Italienische Kommunistische Linke die theoretische Avantgarde der internationalen Kommunistischen Linken.
Als es darum ging, das Wesen des Regimes zu begreifen, das auf den Trümmern der Niederlage in Russland entstanden war, bewies die Deutsche Linke mit ihrer Fähigkeit, Schlussfolgerungen zu ziehen, eine gewisse Frühreife. Sie erkannte nicht nur, dass das stalinistische System eine Spielart des Staatskapitalismus war; sie entwickelte auch wichtige Einsichten in den Staatskapitalismus als eine universelle Tendenz des krisengeschüttelten Kapitalismus. Dennoch waren diese Erkenntnisse zu oft mit der Neigung verbunden, die Solidarität mit der Oktoberrevolution aufzukündigen und den Bolschewismus als Speerspitze einer bürgerlichen Revolution zu bezeichnen. In dieser Auffassung spiegelte sich die Überstürzung wider, in der die deutsche Linke die Notwendigkeit einer proletarischen Partei aufgab und die Rolle der revolutionären Organisation unterschätzte.
Die Italienische Linke dagegen brauchte lange, um das Wesen der UdSSR klar zu begreifen, aber sie ging an die Frage mit größerer Vorsicht und Stringenz heran. Ihre grundlegenden Prämissen waren:
- Sie hielt an der Überzeugung fest, dass der Rote Oktober eine proletarische Revolution gewesen war.
- Da der Weltkapitalismus ein im Niedergang befindliches System war, stand die bürgerliche Revolution nirgendwo mehr auf der Tagesordnung.
- Vor allem durfte es keinen Kompromiss beim proletarischen Internationalismus geben, der eine totale Ablehnung der Auffassung vom „Sozialismus in einem Lande“ bedeutete.
Trotz dieser soliden Grundlagen war die Auffassung der Italienischen Linken über das Wesen der UdSSR in den 1930er Jahren sehr widersprüchlich. Oberflächlich betrachtet, teilten sie mit Trotzki die Auffassung, dass die UdSSR ein proletarischer Staat sei, da er staatliche Eigentumsformen aufrechthalte. Die stalinistische Bürokratie wurde eher als eine parasitäre Kaste denn als eine eigenständige Ausbeuterklasse bezeichnet.
Aber der tief verwurzelte Internationalismus der Italienischen Linken zog eine scharfe Trennungslinie zu den Trotzkisten, deren Position, die Verteidigung des degenerierten Arbeiterstaates, sie in die Fänge des imperialistischen Krieges trieb, in ihre Teilnahme an ihm. Die theoretische Zeitschrift der Italienischen Linken, Bilan, erschien ab 1933. Nach anfänglichem Zögern überzeugten die Ereignisse jener Zeit (Hitlers Machtergreifung, die Unterstützung der französischen Wiederbewaffnung, Russlands Beitritt zum Völkerbund, der Krieg in Spanien) Bilan, dass, auch wenn die UdSSR proletarisch blieb, sie dennoch nun eine konterrevolutionäre Rolle auf der ganzen Welt spielte. Deshalb verlangten die internationalen Interessen der Arbeiterklasse, dass die Revolutionäre ihre Solidarität mit diesem Staat verweigerten.
Diese Analyse war mit Bilan’s Erkenntnis verbunden, dass das Proletariat eine historische Niederlage erlitten hatte und die Welt sich auf einen neuen imperialistischen Krieg hinzubewegte. Bilan sagte mit bestechender Genauigkeit voraus, dass die UdSSR sich letztendlich mit dem einen oder anderen in der Bildung befindlichen Block verbünden werde. Damit lehnte sie die Auffassung Trotzkis ab, derzufolge die UdSSR grundsätzlich feindlich gegenüber dem Weltkapital eingestellt sei und die imperialistischen Mächte zum Zusammenschluss gegen sie gezwungen seien.
Im Gegenteil, Bilan meinte, dass trotz des Überlebens der „kollektivierten“ Eigentumsformen die Arbeiterklasse in der UdSSR einer rücksichtslosen kapitalistischen Ausbeutung unterworfen sei. Die beschleunigte Industrialisierung, die als „Aufbau des Sozialismus“ tituliert wurde, bedeutete nichts anderes als den Aufbau einer Kriegswirtschaft, welche es der UdSSR ermöglichen sollte, sich an der nächsten imperialistischen Aufteilung der Beute zu beteiligen. Deshalb lehnte Bilan Trotzkis Lobpreisungen der Industrialisierung in der UdSSR ab.
Bilan war sich des Weiteren bewusst darüber, dass es auch in den westlichen Ländern eine wachsende Tendenz zum Staatskapitalismus gab, ob er nun in Gestalt des Faschismus oder des demokratischen „New Deal“ auftrat. Dennoch zögerte Bilan, den letzten Schritt zu machen - anzuerkennen, dass die stalinistische Bürokratie tatsächlich eine Staatsbourgeoisie war. Statt sie als Verkörperung einer neuen kapitalistischen Klasse zu betrachten, sah man sie als „Vertreter des Weltkapitals“.
Nachdem die Auffassung vom „proletarischen Staat“ mit den Ereignissen in der realen Welt immer mehr in Konflikt geraten war, begann eine Minderheit von Genossen in der Fraktion die ganze Theorie in Frage zu stellen. Und es war kein Zufall, dass diese Minderheit am besten dafür gerüstet war, die anfängliche Verwirrung zu überstehen, die der Kriegsausbruch in der Fraktion ausgelöst hatte. Diese war zuvor durch die revisionistische Theorie der „Kriegswirtschaft“ in eine Sackgasse geführt worden - eine Theorie, derzufolge kein Weltkrieg stattfinden werde.
Es war immer als selbstverständlich angesehen worden, dass die russische Frage so oder so durch den Ausbruch des Krieges gelöst werden würde. Und für die klarsten Teile der Italienischen Linken lieferte die Beteiligung der UdSSR am imperialistischen Räuberkrieg den letzten Beweis. Die kohärentesten Argumente für die Position, dass die UdSSR imperialistisch und kapitalistisch sei, wurden von jenen Genossen entwickelt, die die Arbeit Bilan‘s in der Französischen Fraktion der Kommunistischen Linken und, nach dem Krieg, in der Gauche Communiste de France (Kommunistische Linke Frankreichs) fortsetzten. Durch die Integration der wertvollsten Erkenntnisse der Deutschen Linken - ohne dabei rätekommunistischen Verleumdungen der Oktoberrevolution auf dem Leim zu gehen - zeigte diese Strömung auf, warum der Kapitalismus in seiner Niedergangsphase hauptsächlich die Form des Staatskapitalismus annahm. Was Russland anbetraf, so wurden die letzten Reste einer „juristischen“ Definition des Kapitalismus über Bord geworfen. Es wurde die grundlegende marxistische Auffassung bekräftigt, dass das Kapital ein gesellschaftliches Verhältnis ist, das von einem zentralisierten Staat genauso wie von einer Gruppe von Privatkapitalisten ausgeübt werden kann. Und es wurde die notwendige Schlussfolgerung bezüglich der proletarischen Herangehensweise gegenüber der Übergangsperiode gezogen. Die Fortentwicklung zum Kommunismus kann nicht daran gemessen werden, in welchem Maße der staatliche Bereich wächst – denn damit ist die große Gefahr einer Rückkehr des Kapitalismus verbunden –, sondern in der Tendenz, dass lebendige Arbeit tote Arbeit beherrscht und dass die Produktion für den Mehrwert durch eine Produktion ersetzt wird, die auf die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse abzielt.
6) „Die Debatte über die ‚proletarische Kultur’ im
revolutionären Russland“
(International Review, Nr. 109)
Entgegen der zunehmend oberflächlichen Herangehensweise an das Problem der Kultur im bürgerlichen Denken, die dazu neigt, die Kultur auf die unmittelbarsten Ausdrücke bestimmter Länder bzw. ethnischer Gruppen oder gar auf den Status vorübergehender gesellschaftlicher Verhaltensweisen zu reduzieren, stellt der Marxismus die Frage in ihrem umfassensten und tiefsten historischen Zusammenhang: die grundlegenden Charakteristiken der Menschheit und ihrer Entstehung aus der Natur im Rahmen der großen Zyklen aufeinander folgender Produktionsformen, die die Geschichte der Menschheit kennzeichnen.
Die proletarische Revolution in Russland, die so viele reichhaltige Lehren hinsichtlich der politischen und ökonomischen Ziele der Arbeiterklasse enthält, war auch auf dem Gebiet der Kunst und Kultur von einer kurzen, aber mächtigen Explosion der Kreativität geprägt – in der Malerei, Bildhauerei, Architektur, Musik und Literatur, in der praktischen Organisierung des Alltagslebens auf gemeinschaftlicher Grundlage, in den Humanwissenschaften wie die Psychologie und so weiter. Gleichzeitig wurde die allgemeine Frage des Übergangs der Menschheit von der bürgerlichen Kultur zu einer höheren, kommunistischen Kultur aufgeworfen.
Eine der Hauptdiskussionen unter den russischen Revolutionären kreiste um die Frage, ob dieser Übergang zur Entwicklung einer spezifischen proletarischen Kultur führen werde. Da auch frühere Kulturen aufs Engste mit den Ansichten der herrschenden Klasse verbunden waren, schienen manche zu meinen, dass die Arbeiterklasse, sobald sie zur herrschenden Klasse geworden ist, ihre eigene Kultur schaffen werde, die im Gegensatz zur Kultur der alten, ausbeutenden Klasse stehen werde. Dies war jedenfalls die Meinung der „Proletkult“-Bewegung, die in den ersten Jahren nach der Revolution über eine große Anhängerschaft verfügte.
In einer dem „Proletkult“-Kongress von 1920 vorgelegten Resolution schien selbst Lenin diese Idee einer besonderen proletarischen Kultur zu akzeptieren. Gleichzeitig kritisierte er gewisse Aspekte der „Proletkult“-Bewegung: ihre philisterhafte „Arbeitertümelei“, die dazu führte, die Arbeiterklasse in ihrem Ist-Zustand zu idealisieren, statt ihren Soll-Zustand anzustreben, und ihr Hang zur bilderstürmerischen Ablehnung der früheren kulturellen Errungenschaften der Menschheit. Lenin misstraute der Gruppe „Proletkult“ auch wegen ihrer Tendenz, als eine eigenständige Partei mit eigenem Organisationsapparat und eigenem Programm aufzutreten. So empfahl Lenin in seiner Resolution, dass die Orientierung der Kulturarbeit im Sowjetregime unter der direkten Leitung des Staates stehen sollte. Doch im Grunde lag Lenins Hauptinteresse in Kulturfragen woanders. Aus seiner Sicht hatte die Kulturfrage weniger mit der grandiosen Fragestellung zu tun, ob es eine neue proletarische Kultur in Sowjetrussland geben kann, als vielmehr mit dem Problem, die gewaltige kulturelle Rückständigkeit der russischen Massen zu überwinden, unter denen mittelalterliche Sichtweisen und der Aberglaube noch ein großes Gewicht hatten. Lenin war sich des niedrigen kulturellen Entwicklungsstandes der Massen bewusst; er wusste, dass dies ein Nährboden für die Ausbreitung der Geißel der Bürokratie im Sowjetstaat werden kann. Die Anhebung des kulturellen Niveaus der Massen war für Lenin ein Mittel zur Bekämpfung dieser Geißel und zur Verstärkung der Fähigkeit der Massen, die politische Macht in den Händen zu behalten.
Trotzki dagegen entwickelte eine tiefergehende Kritik der „Proletkult“-Bewegung. Aus seiner Sicht, die er in einem Kapitel seines Buches „Literatur und Revolution“ darstellte, war der Begriff proletarische Kultur als solche schon eine unzutreffende Bezeichnung. Als ausbeutende Klasse, die ihre ökonomische Macht über eine ganze Zeit lang innerhalb des Rahmens des alten Feudalsystems aufbauen konnte, konnte die Bourgeoisie auch eine eigene, spezifische Kultur entfalten. Dies trifft auf das Proletariat nicht zu, das als eine ausgebeutete Klasse nicht über die materiellen Grundlagen für die Entwicklung einer eigenen Kultur innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft verfügt. Es stimmt, dass das Proletariat während der Übergangsperiode zum Kommunismus zur herrschenden Klasse werden muss, doch handelt es sich dabei lediglich um eine vorübergehende politische Diktatur, deren Endziel nicht darin besteht, die Existenz des Proletariat als solches unbegrenzt aufrechtzuerhalten, sondern darin, das Proletariat in der neuen menschlichen Gemeinschaft aufzulösen. Die Kultur dieser neuen Gemeinschaft wird die erste wirklich menschliche Kultur sein, die alle früheren kulturellen Fortschritte, die die Gattung Mensch erzielt hat, integrieren wird.
Trotzki verfasste sein Buch „Literatur und Revolution“ im Jahr 1924. Es war ein wichtiges Werkzeug in Trotzkis Kampf gegen den emporkommenden Stalinismus. Nachdem „Proletkult“ durch die Befürwortung der Eigeninitiative der Arbeiter anfangs ein wichtiges Sammelbecken für die linken Gruppen gewesen war, die sich gegen das Aufblähen der sowjetischen Bürokratie stellten, neigten seine Nachfolger später dazu, sich mit der Ideologie des „Sozialismus in einem Land“ zu identifizieren. Aus ihrer Sicht schien dies in Einklang mit der Auffassung zu stehen, dass eine „neue“ Kultur in der Sowjetunion bereits im Aufbau war. Trotzkis Schriften zur Kultur zeigten auf, dass solche Ansprüche haltlos waren. Er wandte sich auch heftig gegen die Verwandlung der Kunst in eine Staatspropaganda. Stattdessen propagierte er eine „anarchistische“ Politik auf dem Gebiet der Kultur, die von niemand verordnet werden dürfe, weder von der Partei noch vom Staat.
7) „Trotzki und die Kultur des Kommunismus“
(International Review Nr. 111 )
Trotzki entwickelt seine Auffassung über die kommunistische Kultur der Zukunft im letzten Kapitel seines Buchs „Literatur und Revolution“. Er wiederholt zunächst seine Ablehnung des Begriffs „proletarische Kultur“ als Bezeichnung des Verhältnisses zwischen Kunst und Arbeiterklasse in der Übergangsperiode. Stattdessen schlägt er eine Unterscheidung zwischen revolutionärer und sozialistischer Kunst vor. Die erste hebt sich vor allem durch ihren Gegensatz zur bestehenden Gesellschaft hervor. Trotzki meinte gar, dass sie tendenziell von einem „gewissen gesellschaftlichen Hass“ geprägt sein wird. Er warf auch die Frage auf, welche Kunst-„Schule“ einer revolutionären Periode am offensten gegenüber eingestellt sein wird. Er benutzte den Begriff „Realismus“ zur Beschreibung dieses Phänomens Aber dies hieß in seiner Sicht nicht die geisttötende Unterwerfung der Kunst unter die Staatspropaganda, die von der stalinistischen Schule des „sozialistischen Realismus“ betrieben wurde. Ebenso wenig bedeutete dies, dass Trotzki blind gegenüber der Möglichkeit einer Eingliederung der Errungenschaften von Kunstformen war, die nicht direkt mit der revolutionären Bewegung verbunden waren oder sich gar durch eine verzweifelte Flucht vor der Realität auszeichneten.
Sozialistische Kunst würde Trotzki zufolge von höheren und positiveren Emotionen durchdrungen sein, die in einer Gesellschaft aufblühen werden, die sich auf Solidarität stützt. Gleichzeitig verwarf Trotzki die Idee, dass in einer Gesellschaft, die Klassenspaltungen und andere Quellen von Unterdrückung und Angst überwunden hat, die Kunst steril werden könnte. Im Gegenteil, sie werde dazu neigen, alle Aspekte des Alltaglebens mit einer schöpferischen und harmonischen Energie zu durchdringen. Und da Menschen in einer kommunistischen Gesellschaft immer noch mit den grundlegenden Fragen des menschlichen Lebens – vor allem Liebe und Tod – konfrontiert sein werden, wird es immer noch Raum für die tragischen Dimensionen der Kunst geben. Hier stimmte Trotzki völlig überein mit der Herangehensweise von Marx an die Frage der Kunst in den Grundrissen, in denen er erklärte, warum die Kunst früherer menschlicher Epochen nicht ihren Charme für uns verlieren werde. Denn die Kunst könne nicht auf die politischen Aspekte des menschlichen Lebens reduziert werden und auch nicht auf die gesellschaftlichen Verhältnisse einer spezifischen Epoche in der Geschichte, sondern spiegele die grundlegenden Bedürfnisse und Bestrebungen des menschlichen Wesens wider.
Und die Kunst der Zukunft werde auch nicht monolithisch sein. Im Gegenteil, Trotzki fasste sogar die Möglichkeit einer Bildung von „Parteien“ ins Auge, die für oder gegen besondere Herangehensweisen in der Kunst oder bei Projekten plädierten, mit anderen Worten: eine lebendige und fortdauernde Debatte unter frei assoziierten gesellschaftlichen Produzenten.
In der zukünftigen Gesellschaft werde die Kunst in der Herstellung von Gütern, im Städtebau und in der Landschaftsgestaltung integriert sein. Weil sie nicht mehr der Bereich von Spezialisten sind wird, wird die Kunst, wie Bordiga es nannte, ein „Plan zum Leben für die menschliche Gattung“ werden; sie wird die Fähigkeiten der Menschen ausdrücken, eine Welt zu errichten, die „im Einklang steht mit den Gesetzen der Schönheit“, wie Marx schrieb.
Bei der Landschaftsgestaltung werden die Menschen in Zukunft nicht versuchen, eine längst verlorengegangene ländliche Idylle wiederherzustellen. Die kommunistische Zukunft wird sich auf die fortschrittlichsten Entdeckungen der Wissenschaft und der Technologie stützen. Deshalb wird die Stadt und nicht so sehr das Dorf die Kerneinheit der Zukunft bilden. Doch Trotzki lehnte nicht die Befürwortung einer neuen Harmonie zwischen Stadt und Land und damit eines Endes der gewaltigen, überbevölkerten Megastädte ab, die zu solch einer zerstörerischen Wirklichkeit im dekadenten Kapitalismus geworden sind. Das wird durch Trotzkis Idee deutlich, dass z.B. Tiger und Dschungel von den künftigen Generationen geschützt und in Frieden gelassen werden.
Schließlich wagte Trotzki das Bild der Menschen in einer späteren, weit entfernten kommunistischen Gesellschaft zu umreißen. Diese Menschen werden nicht mehr beherrscht werden durch blinde Natur- und gesellschaftliche Kräfte. Da die Menschheit nicht mehr durch die Todesangst beherrscht wird, wird sie den Instinkten des Lebens freie Entfaltungsmöglichkeiten bieten. Die Männer und Frauen der Zukunft werden mit Anmut und Präzision vorgehen, sie werden die Gesetze der Schönheit bei der „Arbeit, beim Gehen und im Spiel“ befolgen. Der Durchschnittsmensch wird sich auf das „Niveau eines Aristoteles, Goethe oder Marx erheben“. Darüber hinaus werde die Menschheit bei der Erkundung und Beherrschung der Tiefen des Unbewussten nicht nur wirklich menschlich werden, sondern sie werde in einem gewissen Sinne auch zu einer neuen Gattung übergehen:
„Der Mensch wird sich zum Ziel setzen, seiner eigenen Gefühle Herr zu werden, seine Instinkte auf die Höhe des Bewusstseins zu heben, sie durchsichtig zu machen, mit seinem Willen bis in die letzten Tiefen seines Unbewussten vorzudringen und sich auf eine Stufe zu erheben – einen höheren gesellschaftlich-biologischen Typus, und wenn man will – den Übermenschen zu schaffen“.
Dies ist sicherlich einer der kühnsten Versuche seitens eines kommunistischen Revolutionärs, die mögliche Zukunft der Menschen zu beschreiben. Da er sich dabei fest auf das wirkliche Potenzial der Menschheit und auf die proletarische Weltrevolution als ihre unabdingbare Vorbedingung stützte, kann seine Auffassung nicht als ein Rückgriff auf den utopischen Sozialismus verworfen werden. Gleichzeitig gelang es ihm, die inspiriertesten Spekulationen der alten Utopisten auf eine solidere Grundlage zu stellen. Dies ist der Kommunismus als ein Reich der unbegrenzten Möglichkeiten.
CDW (International Review, Nr. 126)
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Theoretische Fragen:
- Kommunismus [74]
Die verlustreichen Spekulationsgeschäfte der Gewerkschaftsbank in Österreich
- 3408 reads
Anmerkung der Redaktion von Weltrevolution:
Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Gruppe Internationalistische Kommunisten aus Österreich, welche den nachstehenden – wie wir finden hochinteressanten – Artikel verfasst und uns zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt hat.
Wie eng die heutigen Gewerkschaften mit dem Kapitalismus verbandelt sind, nicht nur durch ihre staatstragende Haltung, durch ihr stetes Eintreten für die Stabilität des nationalen Kapitalismus und für sozialen Frieden, sondern auch finanziell, hat die jüngste Entwicklung in Österreich offenbart – die desaströse Entwicklung des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) und der in seinem Eigentum befindlichen Bank für Arbeit und Wirtschaft (BAWAG) (der „Gewerkschaftsbank“). Erst 2006 kam nämlich ans Tageslicht, dass der Gewerkschaftspräsident und der ÖGB-Finanzchef, beide SPÖ-Mitglieder, einige Jahre zuvor das gesamte Vermögen des ÖGB, darunter auch den sogenannten Streikfonds, verpfändet hatten, um die BAWAG zu retten, die in hochriskanten Spekulationsgeschäften in den USA – den „Karibik-Geschäften“ - große Verluste eingefahren hatte. Es war eine einsame Entscheidung der beiden Gewerkschaftsbosse gewesen. Sie hatten niemanden sonst im ÖGB, nicht einmal ihre KollegInnen aus den höchsten Gewerkschaftsgremien, geschweige denn die 1,3 Millionen Mitglieder in die Sache eingeweiht bzw. ihre Zustimmung zu einer solchen Verwendung der angesammelten Mitgliederbeiträge eingeholt. Sowohl die verlustreichen Spekulationsgeschäfte des BAWAG-Vorstands als auch die Entscheidung der beiden Spitzengewerkschafter waren jahrelang geheim gehalten worden. Erst 2006 erfuhr die Öffentlichkeit über den fließenden Zusammenhang von internationalen Finanzmärkten und dem Firmenimperium des ÖGB inklusive Streikfonds.
Anmerkung der Redaktion von Weltrevolution:
Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Gruppe Internationalistische Kommunisten aus Österreich, welche den nachstehenden – wie wir finden hochinteressanten – Artikel verfasst und uns zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt hat.
Wie eng die heutigen Gewerkschaften mit dem Kapitalismus verbandelt sind, nicht nur durch ihre staatstragende Haltung, durch ihr stetes Eintreten für die Stabilität des nationalen Kapitalismus und für sozialen Frieden, sondern auch finanziell, hat die jüngste Entwicklung in Österreich offenbart – die desaströse Entwicklung des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) und der in seinem Eigentum befindlichen Bank für Arbeit und Wirtschaft (BAWAG) (der „Gewerkschaftsbank“). Erst 2006 kam nämlich ans Tageslicht, dass der Gewerkschaftspräsident und der ÖGB-Finanzchef, beide SPÖ-Mitglieder, einige Jahre zuvor das gesamte Vermögen des ÖGB, darunter auch den sogenannten Streikfonds, verpfändet hatten, um die BAWAG zu retten, die in hochriskanten Spekulationsgeschäften in den USA – den „Karibik-Geschäften“ - große Verluste eingefahren hatte. Es war eine einsame Entscheidung der beiden Gewerkschaftsbosse gewesen. Sie hatten niemanden sonst im ÖGB, nicht einmal ihre KollegInnen aus den höchsten Gewerkschaftsgremien, geschweige denn die 1,3 Millionen Mitglieder in die Sache eingeweiht bzw. ihre Zustimmung zu einer solchen Verwendung der angesammelten Mitgliederbeiträge eingeholt. Sowohl die verlustreichen Spekulationsgeschäfte des BAWAG-Vorstands als auch die Entscheidung der beiden Spitzengewerkschafter waren jahrelang geheim gehalten worden. Erst 2006 erfuhr die Öffentlichkeit über den fließenden Zusammenhang von internationalen Finanzmärkten und dem Firmenimperium des ÖGB inklusive Streikfonds.
Dazu ist anzumerken, dass der ÖGB in dem ganzen halben Jahrhundert nach 1945 die Sozialpartnerschaft und den absoluten sozialen Friedens als Credo gepredigt hatte und sich in vielen Situationen erfolgreich als Streikvermeider hervortat, gewerkschaftsintern auch mit dem Argument, ein Streik koste die Mitglieder mehr (Zahlung von Streikgeldern) als er an Erfolgen bringen würde. Der ÖGB rühmte sich stets, wesentlich daran mitzuwirken, dass in Österreich die Streikzeit pro Beschäftigtem und Jahr nur in Streiksekunden zu messen sei. (Die einzigen größeren Streiks waren der eintägige branchenübergreifende Streik gegen die Pensionsreform und ein 3-tägiger Eisenbahnerstreik 2003 gewesen.) Als es um die Abdeckung von Finanzverlusten der ÖGB-eigenen Bank ging, gingen die zwei Gewerkschaftsbosse plötzlich sehr großzügig mit dem sagenumwitterten „Streikfonds“ um, dessen Ausmaß stets als Betriebsgeheimnis, von dem kein Mitglied erfahren durfte, gehandhabt wurde („der Gegner darf nicht über unsere Reserven im Streikfall Bescheid wissen, das würde ihm Vorteile verschaffen“).
Die verlustreichen Geschäfte der BAWAG und die Krise des ÖGB
Im März 2006 kam also zutage, dass sich bei der im Eigentum des ÖGB befindlichen Bank für Arbeit und Wirtschaft (BAWAG), der viertgrößten Bank Österreichs, nach riskanten Finanzspekulationen in den USA während der 90er-Jahre (sogenannte „Karibik-Geschäfte“) Verluste von 1,9 Milliarden Euro angesammelt hatten, die die Bank anschließend, seit 2000, durch ein Geflecht von Stiftungen, Tochtergesellschaften und Scheinfirmen zu verstecken und abzubauen versucht hatte. Nach einem neuerlichen Großverlust im Oktober 2005 war das Debakel aber nicht mehr zu verbergen. Für die Verluste musste nun der Gewerkschaftsbund als Eigentümer der Bank gerade stehen. Zuerst operierte die BAWAG am Rande des Konkurses - tausende Kunden hoben nach dem Publikwerden des Finanzdesasters 2006 ihre Sparguthaben ab und die Regierung musste eine Rettungsaktion unternehmen, „damit der Finanzplatz Österreich keinen größeren Schaden nehme“ -, dann, nach der Übertragung der Verluste auf den Gewerkschaftsbund, befand sich die Gewerkschaft in dieser misslichen Situation. Die Schulden betrugen fast das Zwanzigfache der jährlichen Einnahmen aus Mitgliederbeiträgen (über 2 Milliarden Euro). Für längere Zeit war ein Konkurs des ÖGB im Bereich des Möglichen, ganz abgesehen vom moralischen Imageschaden bei den Gewerkschaftsmitgliedern und den nicht im ÖGB organisierten Teilen der Arbeiterklasse bzw. der Öffentlichkeit.
Dieses Desaster von ÖGB und BAWAG, die in Österreich beide der „sozialdemokratischen Reichshälfte“ zugeordnet werden, wirbelte in Österreich viel Staub auf und dominierte die österreichische Innenpolitik im Jahr vor den Nationalratswahlen (= Pendant zu den deutschen Bundestagswahlen) im Oktober 2006, fand aber im Ausland, etwa in Deutschland, in den Medien kaum Beachtung. Das Debakel kratzte stark am Image der SPÖ und lieferte der regierenden ÖVP (Schwesterpartei der CDU) willkommene Munition im Wahlkampf („Die Roten können nicht wirtschaften“). Eine nach den Jahren der Rechtskoalition schon als sicher geltende „rot“-grüne Mehrheit kam bei den Wahlen nicht mehr zustande, wenngleich es auch der SPÖ gelang, kurz vor den Wahlen aus dem Tief wieder herauszukommen und die ÖVP doch noch knapp zu überrunden.
Die Verluste sind nicht mehr zu verheimlichen – der BAWAG-ÖGB-Skandal 2005/06
Die Verluste der BAWAG kamen an die Öffentlichkeit, nachdem der BAWAG-Vorstand, Jahre nach den eigentlichen „Karibik-Geschäften“, im Oktober 2005 einen Blitzkredit von 350 Millionen Euro an einen amerikanischen Geschäftspartner, das Wertpapierhaus Refco, schon am Tag nach der Kreditvergabe als verloren vermelden musste. Denn der BAWAG-Vorstand in Wien war nicht darüber informiert gewesen, dass Refco zur Zeit der Kreditvergabe schon auf dem Weg in den Konkurs war.
Ein paar Monate später, im März 2006, nach einer weiteren Kalamität, musste auf einer öffentlich zugänglichen Vorstandssitzung des neuen BAWAG-Vorstandes (der alte Vorstand war in der Zwischenzeit abgelöst worden) der Finanzchef des ÖGB und gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzende der BAWAG, Günter Weninger, zugeben, dass er fast als Einziger im ÖGB von den Spekulationsgeschäften und Verlusten der BAWAG gewusst und im Jahr 2000 eine unbegrenzte Haftung des ÖGB für die Verluste der Bank abgegeben hatte. Es war dies „der offizielle Beginn vom Ende der alten Gewerkschaftsbank, die völlige Entzauberung des ÖGB als Bankeigentümer – und die an Harakiri grenzende Selbst-Demontage von Bawag-Kontrollor Weninger. Er sollte in den folgenden Minuten aufhören, die viel zitierte „graue Eminenz des ÖGB“, der „mächtige ÖGB-Finanzchef“ zu sein; er stülpte sich stattdessen coram publico in die Rolle eines der Hauptdarsteller der Causae BAWAG und ÖGB.“ (1)
Außer Weninger war nur der ÖGB-Präsidenten Verzetnitsch informiert, die beiden bewahrten all die Jahre absolutes Stillschweigen gegenüber dem „Rest“ des ÖGB und auch gegenüber den Finanzbehörden. Sie hielten sich an das Schweigegebot, das der Chef der BAWAG, Helmut Elsner, der die „Karibik-Geschäfte“ betrieben hatte, nach einem Totalverlust im Jahr 1998 dem restlichen Bankvorstand auferlegt hatte. Seine Lösung nach den Verlusten damals: „Stillschweigen nach allen Seiten“ - gegenüber der behördlichen Finanzmarktaufsicht, den Eigentümern (ÖGB und Bayerische Landesbank) und selbstverständlich den Medien bewahren, um die Bank nicht ins Gerede zu bringen und dadurch am Ende erst recht einen Run der Kunden auf die Bank und damit den Konkurs der Bank auszulösen. Als einzige Eigentümervertreter waren – mit Verzögerung – die zwei obersten Gewerkschafter, Verzetnitsch und Weninger, in die Sache eingeweiht, weil man sie für die Haftung, ohne die man im Jahr 2000 keine Bilanz mehr hätte erstellen können, brauchte.
Diese Vorgänge warfen ein grelles Licht auf die hierarchische Entscheidungsstruktur des ÖGB, die offenbar so weit getrieben wurde, dass zwei Spitzenfunktionäre über das gesamte Gewerkschaftsvermögen entscheiden konnten. (Tatsächlich ist vereinsintern der ÖGB-Finanzchef allein für die Finanzen der ÖGB-Stiftung, wo sich ein großer Teil des Vermögens befindet, zeichnungsberechtigt, die Mitglieder haben absolut keine Verfügungsgewalt über die Verwendung ihrer Beiträge bzw. des sogenannten Streikfonds). Es stellte sich nun außerdem heraus, dass der Streikfonds in einer Stiftung angelegt war und diese nichts anderes war als das Aktienkapital des ÖGB an der BAWAG (Aussage von Weninger in einer Pressekonferenz am 24. März 2006 in Wien), also im Streikfall gar nicht so schnell flüssig zu machen gewesen wäre.
Den zwei ÖGB-Obersten wurde gewerkschaftsintern und auch sonst vor allem auch vorgeworfen, sie hätten als Eigentümervertreter den Generaldirektor der Bank, Helmut Elsner, vorbehaltlos schalten und walten lassen. Auch daran, dass der Generaldirektor vor drei Jahren trotz der angerichteten Megaverluste, die der ÖGB nun zu tragen hatte, mit ungeschmälerten Abfindungs- und Pensionsansprüchen in Pension gehen konnte, hatten die beiden obersten Gewerkschafter, die über den BAWAG-Aufsichtsrat in solche Entscheidungen involviert waren, nichts auszusetzen gehabt. Sie hinterließen einen finanziellen wie moralischen Scherbenhaufen und mussten im April 2006 zurücktreten. Außerdem wurde der Gewerkschaftspräsident, Verzetnitsch, vom seinem Nachfolger als Angestellter des ÖGB fristlos entlassen.
Ein in den bürgerlichen Medien breit getretener Stein des Anstoßes war es auch, dass Elsner (Direktor der BAWAG) und ÖGB-Präsident Verzetnitsch in luxuriösen Penthäusern auf dem Dach des BAWAG-Gebäudes residierten, die ihnen von der BAWAG zu Spottpreisen, einem Bruchteil ihres eigentlichen Werts, verkauft worden waren bzw. vermietet wurden.
Wie bereits eingangs festgestellt, wäre es verfehlt, die ganze Entwicklung als bloßen Betriebsunfall anzusehen. Nein, wenn ein Gewerkschaftsbund die viertgrößte Bank eines Landes besitzt, die sich obendrein in einem großen Umfang auf höchst riskante Finanzgeschäfte einlässt, und die so genannten Streikgelder nichts anderes als das Aktienpaket an eben dieser Bank sind, so zeigt dies die tiefgreifende institutionelle und finanzielle Verquickung eines nationalen Gewerkschaftsbundes mit dem Finanzkapitalismus, welche die das kapitalistische System stützende Praxis der Gewerkschaften bei der Unterordnung der Arbeiter unter die Kapitalinteressen begleitet und zementiert.
Der ÖGB inszeniert einen Reformprozess
Der ÖGB befand sich also im Jahr 2006 in einer doppelten Krise - einer finanziellen wie moralischen. 40.000 Mitglieder traten aus dem ÖGB aus, dessen Mitgliederzahl bereits seit 1985 von 1,6 Millionen auf 1,3 Millionen abgenommen hatte (ein Rückgang des „gewerkschaftlichen Organisationsgrades“ der Beschäftigten von 55 auf 40 %). Ein bürgerlicher Kommentator meinte (vermutlich etwas voreilig): „Der Österreichische Gewerkschaftsbund in seiner bisherigen Form ist tot. Hingerichtet durch die Spekulationsgeschäfte der BAWAG und die Übernahme ihrer Schulden.“ (2) Der ÖGB stand unter Druck. Neben der Bereinigung der finanziellen Situation musste die moralische Glaubwürdigkeit der Gewerkschaft wiederhergestellt werden. Die Zauberworte des ÖGB-Vorstands: „Reform“ und „Totalerneuerung“.
Man beschloss, sich von der Bank zu trennen – der Verkaufserlös sollte es dem ÖGB ermöglichen, sich von den Schulden zu befreien. Außerdem fährt der Vorstand nun unter dem Motto „Schlank und effizient“ einen rigoroser Sparkurs, muss man doch in Zukunft auf die Einnahmen aus den Dividenden der BAWAG (rund ein Drittel der Einnahmen) verzichten und noch verbliebene Schulden abdecken: Das Gebäude der Gewerkschaftszentrale und sonstige Gebäude und Liegenschaften werden verkauft, Personal abgebaut, die Betriebspensionen der Gewerkschaftsangestellten gegen eine einmalige Abfindung gestrichen.
Ansonsten wird ein Reformprozess inszeniert. Der neue ÖGB-Präsident klapperte das ganze Jahr 2006 hindurch einen Betrieb nach dem anderen ab und verkündete den „Reformwillen“, auf Regionalkonferenzen wurden Reformvorschläge ausgearbeitet, im Jänner 2007 fand ein „Reformkongress“ statt. Doch dazu weiter unten.
2) Die Geschichte des BAWAG-ÖGB-Desasters
Die Karibikgeschäfte der BAWAG 1998-2000 – die Verluste des Herrn Flöttl …
Die Gewerkschaftsproblematik ist die eine Seite der Angelegenheit. Die andere sind die spekulativen „Karibikgeschäfte“ und die Krise der Bank selbst, welche am Schluss auf die Gewerkschaft durchschlugen. Die gewerkschaftseigene BAWAG war 1922 als „Arbeiterbank“ gegründet worden, ihr Geschäftsfeld waren Konten, Sparbücher und Kredite (häufig sogenannte „Betriebsratskredite“) für kleine Kunden und Sparer – Gewerkschaftsmitglieder, Arbeiter, Angestellte. Sie agierte lange Zeit sehr konventionell.
Anfang der 90er-Jahre, im Sog der rapiden Ausdehnung der globalen Finanzmärkte und Kapitalspekulation, begann sich auch der BAWAG-Vorstand spekulativen Finanzgeschäften in den USA zuzuwenden, die höhere Gewinne versprachen. Der Vorstandsvorsitzende Walter Flöttl beauftragte seinen Sohn damit - Wolfgang Flöttl, der nach Wirtschaftsstudien in Wien und Harvard als Investmentbanker in New York tätig war und mehrere Investmentgesellschaften (mit Sitz in verschiedenen Steueroasen der Karibik) gegründet hatte. Er war in kurzer Zeit mit Wertpapierspekulationen zu großem Vermögen gekommen. Der Vater und Bankdirektor in Wien beauftragte ihn bald mit der spekulativen Veranlagung von BAWAG-Geldern. „In Wien war man vom blühenden Handel mit Derivaten und anderen komplexen Finanzprodukten noch weit entfernt. Erst recht in der Gewerkschaftsbank…. Doch unbemerkt von der Öffentlichkeit begannen sich alte Gewerkschaftswelt und neue Finanzwelt miteinander zu verbinden. Die Verknüpfer hießen Flöttl – Walter und Wolfgang.“ (3)
Wolfgang Flöttl legte das von der BAWAG in Form von Krediten erhaltene Geld riskant in Währungs- und Zinsswaps (Termingeschäften mit Dollar-Yen-Kursen und japanischen Zinsentwicklungen) sowie Bonds an, außerdem in PIPE-Geschäften an. Gemanagt wurden diese Geschäfte von seinen eigenen Investmentgesellschaften – er agierte wie ein ausgelagerter Portfolio-Manager der BAWAG. Für die Veranlagung gründete Flöttl im Einverständnis mit dem BAWAG-Vorstand eine Vielzahl von Stiftungen bzw. Briefkastenfirmen, die er selbst kontrollierte, stets mit Sitz in der Karibik – Anguilla, Cayman Islands – oder in Liechtenstein. So kam ein Firmengeflecht zustande mit Namen wie Global Arbitrage, Stretegic Arbitrage, Financial Arbitrage, Narrow Investment, Felixton Ltd., Ophelia Ltd., Glen Star, Hapenney Ltd, Benson Stiftung, Treval Stiftung, Biamo Foundation, Huntington Investment Ltd., Madison Capital Holdings Ltd. Columbia Investment Ltd., West End International Investments Ltd. usw.
Anfangs waren die Geschäfte gewinnbringend, doch in den Jahren 1998, 1999 und 2000 machte Flöttl dreimal hintereinander Totalverlust, d.h. das gesamte Geld war verloren, jeweils zwischen 500 und 700 Millionen Dollar. Flöttl setzte innerhalb kurzer Zeit 1,9 Milliarden Dollar in den karibischen Sand. Einmal (1998) war ein Bankencrash an der Wall Street dazwischen gekommen (einer der größten Hedgefonds, „Long Term Capital“, mit 4 Milliarden Dollar Eigenkapital (!), machte bankrott), wodurch der Dollar gegenüber dem Yen plötzlich fiel statt weiter zu steigen, worauf Flöttl spekuliert hatte. Ein andermal (2000) hatte Flöttl das gesamte Geld in japanischen Zinsswaps angelegt und spekulierte auf eine bestimmte Zinsentwicklung des Yen. Die unerwartete Änderung der japanischen Geldmengenpolitik und damit der Zinsentwicklung im Zuge der Asienkrise führte abermals zum Totalverlust.
Nach dem ersten Verlust hatte der BAWAG-Vorstand (unter dem neuen Chef Helmut Elsner) Flöttl erneut Geld gegeben, damit er die Verluste wieder wettmache. Nach dem nächsten Verlust nochmals dasselbe. Flöttl spekulierte jedes Mal noch riskanter, setzte den Hebel bzw. Leverage-Effekt der Derivate (Verhältnis von Einsatz und möglichem Gewinn oder Verlust ausgehend vom Basiswert des Produkts, auf dessen Wertentwicklung spekuliert wird) jedes Mal höher an, um die vergangenen Verluste wieder auszugleichen.
Ein weiterer Verlust ergab sich durch die Schließung eines Großcasinos in Jericho, an der die BAWAG maßgeblich beteiligt war, aufgrund der Ereignisse der zweiten Intifada.
… und ihre Vertuschung
Aufgrund der angehäuften Verluste (netto circa 1,6, Milliarden Dollar oder 1,3 Milliarden Euro) konnte die BAWAG (Eigenkapital: 3,3 Milliarden Euro) 2000 keine Bilanz mehr erstellen. Der Vorstand unter Generaldirektor Helmut Elsner fürchtete, ein Öffentlichwerden der Verluste und der bisher geheim betriebenen Karibik-Geschäfte würde einen Run der Kunden auf die Bank auslösen und die Bank womöglich in den Konkurs treiben. Also beschloss man, die Verluste nicht in der Bilanz auszuweisen, sondern durch Scheingeschäfte mit extra für diesen Zweck gegründeten Stiftungen und Briefkastenfirmen zu verstecken und in den folgenden Jahren durch Gegenrechnung gegen laufende Gewinne und Aufwertungen von Beteiligungen sukzessive abzubauen. Statt die ursprünglichen Kredite der BAWAG an die Flöttl-Firmen als verloren auszuweisen, wurden sie als rückgeführt verzeichnet, die BAWAG verkaufte diesen Firmen die Verluste (als Schuldverschreibungen) und stattete sie mit neuen Krediten aus, mit denen sie eben diese zurückzahlen sollten. Die Verluste konnten somit in der Bilanz als werthaltige Forderungen ausgewiesen werden.
Manchmal waren die Konstruktionen komplizierter, um die Sache besser zu tarnen. Es wurden z.B. BAWAG-eigene Stiftungen zwischen den Flöttl-Firmen und der BAWAG zwischengeschaltet, und zwischen ihnen, den Flöttl-Firmen und der BAWAG konstruierte man Finanztransaktionen der verschiedensten Art. Die BAWAG verkaufte etwa in einem Fall uneinbringliche Flöttl-Bonds (in der Höhe von 550 Millionen Dollar) an eine neu gegründete Stiftung (Liquid Opportunity Plus Fund) und kaufte im Gegenzug in mehreren Tranchen Anteile dieses Fonds zum selben Wert. Natürlich wurde dabei auch nicht auf Aktennotizen vergessen, die für spätere Bankprüfungen gedacht waren und die diese Scheinwelt glaubhaft machen sollten- samt Erfindung von Zahlungsterminen, Namen von Managern usw.
Die interne wie die behördliche Kontrolle wurden damit hinters Licht geführt, der Komplex Karibik-Geschäfte war sozusagen eine Bank in der Bank. Später wurde aber auch kritisiert, die dem Finanzministerium unterstehende Finanzmarktaufsicht hätte versagt. Teils hatte sie sich austricksen lassen, teils wurden warnende Berichte vom Finanzministerium ignoriert.
Den restlichen Vorstand verpflichtete Generaldirektor Elsner, wie schon oben dargestellt, nach allen Seiten Stillschweigen zu bewahren“ – gegenüber den Eigentümern (ÖGB und damals auch noch Bayerische Landesbank), bankintern, gegenüber dem Aufsichtsrat sowie gegenüber der Öffentlichkeit. Nur der Aufsichtsratsvorsitzende, der ÖGB-Finanzchef Weninger, wurde – stark verspätet – dann doch noch informiert. Dieser gab die bekannte unlimitierte Garantie des ÖGB für die BAWAG-Verluste ab. In der Haftung war der Streikfonds enthalten. Informiert wurde außer dem inzwischen zurückgetretenen ÖGB-Präsidenten Verzetnitsch, der an der Haftung nichts auszusetzen hatte, niemand. Die entsprechenden ÖGB-Gremien wurden umgangen. Die beiden ÖGB-Bosse rechtfertigten sich später, nach dem Auffliegen der Sache, damit, dass ohne diese Haftung die Bank und damit tausende Arbeitsplätze und die Bankeinlagen von über 1 Million Kunden gefährdet gewesen wären.
Unter dem Dach der ÖGB-Garantien konnte die Bank tatsächlich die Schulden in den folgenden Jahren stark verringern.
Der ÖGB bekommt die BAWAG-Schulden umgehängt
Später fusionierte die BAWAG mit der Postsparkasse (P.S.K.). Dabei wurden die Schulden aufgrund einer speziellen Konstruktion auf den ÖGB übertragen. D.h., die Schulden wurden in der „alten BAWAG“ zurückgelassen, die nicht mehr als Bank operierte, sondern als bloße Hülle bzw. Finanzholding zurückblieb, während die Eigenmittel in die neue Bank BAWAG P.S.K. wanderten. Diese rechtliche Umgründung wurde in einer Aufsichtsratssitzung von einem ÖGB-Funktionär mit unterschrieben, der die Bedeutung dieser Transaktion für den ÖGB (Schuldenübernahme in Milliardenhöhe) nicht erkennen konnte, da er vom damaligen allein informierten ÖGB-Präsidenten Verzetnitsch nicht über die BAWAG-Schulden in Kenntnis gesetzt worden war – ein gewerkschaftsinterner Skandal für sich!
Weitere Summen in den Sand gesetzt – das Refco-Debakel
Das Pech war, dass die BAWAG im gleichen Jahr einen neuen Riesenverlust baute, der dann das Fass endgültig zum Überlaufen brachte. Wie oben dargestellt, überwies der BAWAG-Vorstand im Oktober 2005 einen Blitzkredit von 430 Millionen Dollar (oder 350 Milliarden Euro) (!) an den britisch-amerikanischen Investmentbanker Philipp Bennett bzw. dessen Refco Group Holding, ohne zu wissen, dass dieser Philipp Bennett bereits insolvent war. Tags zuvor war Bennett der Zutritt zur Firmenzentrale des US-Wertpapierhauses Refco, deren Chef er war, verweigert worden, nachdem bekannt geworden war, dass er durch Jahre hindurch Verluste aus anderweitigen Spekulationsgeschäften, die er in der Russland- und Asienkrise erlebt hatte, in seiner Firma Refco Group Holding, einer Tochter von Refco, versteckt hatte. Drei Tage später wurde der Handel mit Refco-Aktien an der Wall Street ausgesetzt, die Firma ging in Konkurs – mit 48 Milliarden Dollar (!) die viertgrößte Pleite in der US-Geschichte. Bennett wurde festgenommen, ihm wird Bilanzfälschung, Betrug, illegale Bereicherung vorgeworfen. Der BAWAG-Kredit war aber verloren.
Die BAWAG ihrerseits hatte schon längere Zeit mit Refco zu tun, sie hatten sich aus den Flöttl-Geschäften ergeben. Vorübergehend hatte sie über eine ÖGB-Stiftung in Liechtenstein 10 % der Aktien von Refco gehalten.
Nun begann der bürgerliche Staat - die Aufsichtsbehörden und die Justiz - die internationalen Geschäfte der BAWAG zu durchforsten. Dabei flogen die geheim gehaltenen Verluste aus den Karibik-Geschäften auf, es wurde klar, dass alle internen Kontrollen und die Bankenaufsicht versagt hatten. Der BAWAG-ÖGB-Skandal war perfekt. (Wenn Spekulationsgeschäfte die Gewinne steigern, werden sie allerseits gut geheißen, sobald sie aber schief gehen, sind die Akteure Verbrecher und ist das Ganze ein Skandal.)
Die finanziellen Transaktionen sind ein so undurchschaubares Gewirr, dass natürlich leicht Geld abgezweigt werden hätte können. Auch dahin gehend wird ermittelt. „Es stellt sich die grundsätzliche Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass ein erfahrener Portfoliomanager wie Wolfgang Flöttl über Jahre hindurch jedes ihm anvertraute Geld in einen Totalverlust führt.“ (4)
Der BAWAG-Vorstand trat zurück, Strafverfahren wegen Bilanzfälschung, Betrug, Untreue laufen. Und das ÖGB-Führungsduo Verzetnitsch-Weninger musste die Erteilung der unbeschränkten Haftung des ÖGB für die BAWAG zugeben und trat ebenfalls zurück, Verzetnitsch wurde von seinem Nachfolger zusätzlich aus dem ÖGB geschmissen.
Sammelklage aus den USA, die Bank gerät ins Strudeln
Im Frühjahr 2006 drohte der BAWAG neues Ungemach aus den USA in der Refco-Affäre – zusätzlich zum Kreditschaden. Vom Refco-Konkurs betroffene Refco-Wertpapierbesitzer und -Gläubiger drohten mit einer Sammelklage, sie warfen der BAWAG Beihilfe zum Bilanzbetrug bei Refco vor. Der neue BAWAG-Vorstand wies das zurück und erreichte einen Vergleich, um einen jahrelangen Rechtsstreit vor amerikanischen Gerichten zu vermeiden: Die BAWAG erklärte sich bereit, 700 Mio. Dollar zu zahlen. Das Refco-Debakel (Kreditverlust, Sammelklage usw.) kostete die BAWAG 1,3 Milliarden Dollar (ca. 1 Milliarde Euro). Auch diesen Verlust sollte später die Gewerkschaft übernehmen.
Inzwischen setzte ein Run auf die BAWAG ein, täglich hoben Kunden hoben ihre Ersparnisse ab, die Bank kam ins Trudeln.
Rettungsaktion der Regierung
Die rechte Bundesregierung Schüssel schnürte ein Rettungspaket für die „rote“ Bank, um „den Finanzplatz Österreich nicht zu gefährden.“. Sie gab eine limitierte Staatshaftung für die Bank und veranlasste die anderen österreichischen Großbanken, der BAWAG Geld zur Verfügung zu stellen.
Das Rettungspaket verpflichtete gleichzeitig den Eigentümer ÖGB, für die gesamten Verluste der BAWAG aufzukommen und zu diesem Zweck Liegenschaften, Firmen, Beteiligungen zu verkaufen. Erst wenn all das nicht ausreichen sollte, sollte die Staatshaftung schlagend werden. Der ÖGB stand geschwächt da und musste gegenüber dem Staat bzw. der Nationalbank seine Vermögensverhältnisse offen legen, auch den Streikfond, aus dem in der Vergangenheit immer so ein Geheimnis gemacht worden war, auch gegenüber den Mitgliedern.
Der ÖGB ist über die BAWAG und direkt tatsächlich an einer Reihe von Unternehmen beteiligt, z.B. an der Nationalbank (20 %), an der Bausparkasse (7 %), an den Österreichischen Lotterien (34 %) und am privaten TV-Kanal ATV, der vorwiegend Müll sendet (42 %), er ist Alleinaktionär (via BAWAG) an der easy bank, der Österreichischen Verkehrskreditbank, der Sparda Bank und der slowenischen Istrobanka und besitzt Immobiliengesellschaften.
Nachdem der ÖGB die Schulden der BAWAG übernommen hatten, stand ihrem Verkauf nichts mehr im Wege. Den Zuschlag bekam just ein amerikanischer Hedgefonds (Cerberus), er zahlte über 2 Milliarden. Der Erlös machte den ÖGB schuldenfrei. Aber er war um eine Bank ärmer, und es war das Ende der BAWAG als Gewerkschaftsbank – sehr zum Missfallen des sozialdemokratischen Bankklientels und mancher Gewerkschafter.
3) Der ÖGB versucht die Krise zu bewältigen – der
„Reformprozess“
Das BAWAG-Debakel ließ, wie oben angedeutet, in den Gewerkschaften den Ruf nach Reform des ÖGB aufkommen. Viele GewerkschafterInnen sahen in der fundamentalen aktuellen Krise die historische Chance gekommen, den ÖGB, der sich durch wenig Mitbestimmung der Mitglieder auszeichnete, zu reformieren und „demokratisieren“. Es bildete sich eine innergewerkschaftliche Plattform für Gewerkschaftsreform - „Zeichen setzen“. Der Ruf nach Reform kam von Vertrauensleuten in den Betrieben, verstärkt von bestimmten Fraktionen (linken „Unabhängige Gewerkschafter“, teilweise sozialdemokratische Gewerkschafter), aber auch aus dem Apparat selbst, der im Zusammenhang mit dem BAWAG-Desaster aufgescheucht war. Es sollte unter anderem die enge Verbindung von Gewerkschaft und Parteien gelöst werden, die in der Vergangenheit zu Mehrfachfunktionen (Gewerkschaftsfunktion, Parteifunktion, Abgeordneter in Parlament, Landtag oder Gemeinderat) und dadurch zu „Interessenskollisionen“ und häufig zur bloßen Nachvollziehung von Parteibeschlüssen in Gewerkschaftsgremien statt einer „ehrlichen Interessensvertretung“ geführt hätten. Unter der Devise „Für einen starken und demokratischen ÖGB“ bildeten sich die folgenden Forderungen heraus:
-
Trennung von Parteipolitik und Gewerkschaft, stärkere „Unabhängigkeit“ der Gewerkschaft von den Parteien - die Spitzengewerkschafter sollen in Hinkunft kein Mandat mehr in gesetzgebenden Körperschaften ausüben dürfen
-
Demokratisierung – direkte Wahl aller Leitungsgremien der Teilgewerkschaften durch die Mitglieder, Urabstimmungen in wichtigen Angelegenheiten (z.B. Gehaltsabschlüssen), mehr Mitgliederbefragungen, Einführung von regelmäßigen regionalen Versammlungen der gewählten GewerkschaftsvertreterInnen, deren Rolle gegenüber den Leitungsgremien und dem Apparat verstärkt werden soll, Recht von Betriebsräten, die Bearbeitung von Themen zu initiieren, regionale Gewerkschaftshearings, verbesserte Kommunikation zwischen Führung und Basis usw.
-
stärkeres Bemühen des ÖGB um die Bedürfnisse bisher vernachlässigter „Zielgruppen“ (prekär bzw. atypisch Beschäftigte, Scheinselbstständige, Arbeitslose, Frauen in schlecht bezahlten Teilzeitjobs, Angehörige von Sozialberufen, MigrantInnen), um neue Mitglieder zu gewinnen
-
mehr Frauen in den Leitungsgremien (Frauenquoten)
-
Einkommensobergrenzen für Spitzenfunktionäre, da die bisherigen Spitzengagen samt üppigen Pensionsregelegungen und Doppelbezügen aufgrund Mehrfachfunktionen die Glaubwürdigkeit der Gewerkschaft bei den ArbeiterInnen beeinträchtigt und zu einer „Entfremdung von der Basis“ geführt hätte. (Es wurde als Obergrenze 4500,- Euro netto gefordert, beschlossen wurden schließlich 5800,- netto)
Projektgruppen zu einzelnen Themenbereichen arbeiteten Reformvorschläge aus. In ein paar Dutzend Regionalkonferenzen ließ man die daran teilnehmenden Betriebsräte und einfachen Mitglieder Reformvorschläge ausarbeiten. Allerdings waren diese Regionalkonferenzen vom Gewerkschaftsapparat gelenkt, auch wenn Kritik aufkam. So wurden gewisse Fragestellungen und Forderungen von den Konferenzleitern von vornherein ausgesiebt, und die ausgearbeiteten Vorschläge wurden nicht abgestimmt und standen am Schluss der Konferenzen als unverbindliche Appelle im Raum. Es stand in den Sternen, was der die Fäden ziehende Apparat damit dann anfing.
Die Vorschläge der Projektgruppen wurden anschließend in einen langwierigen organisatorischen Prozess geschickt, sie wurden in einer Klausur der leitenden Gremien modifiziert und dann in einem „Reformkongress“ beschlossen. Nun arbeiten Umsetzungsgruppen an der Implementierung der beschlossenen Veränderungen in den gewerkschaftlichen Alltag. Wie zu erwarten, hat der Apparat die Kontrolle behalten. Die Maßnahme, die am ehesten den Willen der Gewerkschaftsführung durchkreuzen könnte – die Einführung von Urabstimmungen -, wird nun nochmals 2 Jahre lang von einer Umsetzungsgruppe diskutiert und zunächst einem Testlauf unterworfen. Erst danach wird sie eventuell (!) verbindlich beschlossen – vermutlich aber nicht, da sich bis dahin der Reformzwang wieder verlaufen haben wird.
Desinteresse der Mitglieder
Auffallend war das Desinteresse der Mitglieder des ÖGB, der Arbeiter und Angestellten, am Reformprozess. Nur relativ wenige Mitglieder beteiligten sich. Den Leuten ist es entweder egal oder sie sehen keine große Möglichkeit der Änderung. Den Reformkatalog der Plattform „Zeichen setzen“ unterzeichneten gerade einmal 6200 Mitglieder (0,5 % aller Mitglieder). Den von der ÖGB-Spitze an die Mitglieder versandten Fragebogen, in dem diese ihre Präferenzen für verschiedene vorgefertigte Reformvorschläge ankreuzen konnten, sandten nur 58.000 Mitglieder (4 % aller Mitglieder) zurück. (Die Auswertung der Ergebnisse des Fragebogens war übrigens erst nach dem Vorliegen der Ergebnisse der Projektgruppen fertig und fand gar keine Berücksichtigung mehr, das zeigt den Alibicharakter!) An den Regionalkonferenzen nahmen österreichweit vielleicht 3000 Personen teil (ebenfalls im Promillebereich der Mitglieder).
Vor ein paar Jahren hatten sich noch weit mehr Mitglieder an einer Mitgliederbefragung beteiligt, in der die ÖGB-Führung die Mitglieder befragte, ob sie sich grundsätzlich im Falle von Konflikten mit Arbeitgebern oder Regierung an Kampfaktionen inklusive Streiks beteiligen würden. (Damals waren die Erwartungen der ÖGB-Führung übertroffen worden, und die Umsetzung von manchen Ergebnissen wurde fallengelassen.)
Alle diese Versuche, die Gewerkschaft zu reformieren, ändern nichts an der grundsätzlichen Rolle des ÖGB und der Gewerkschaften überhaupt, die bestehende kapitalistische Ordnung zu verteidigen, die Anliegen der Lohnabhängigen nur innerhalb des Rahmens der kapitalistischen gelten zu lassen und die ArbeiterInnen vom direkten Kampf für ihre Interessen abzuhalten. Die Reform zielt darauf ab, den ÖGB durch symbolische Akte (Reforminszenierung) und die Beseitigung der gröbsten „Missstände“ (Beseitigung von Mehrfachfunktionen bei den hohen Funktionären, Herstellung eines Minimums von Mitsprache der VertreterInnen an der Basis, Ansprache neuer „Zielgruppen“) aus seiner Glaubwürdigkeitskrise zu holen und in die Lage zu versetzen, seine oben beschriebenen Aufgaben weiterhin wahrzunehmen. Wie der Präsident des Wirtschaftsbundes, einer Interessensorganisation der Unternehmer, letztes Jahr sagte: „Wir brauchen eine starke Gewerkschaft.“
Es ist eine Illusion, wie etwa die trotzkistischen Gruppen (z.B. Arbeitsgruppe Marxismus AGM oder Antifaschistische Linke) zu glauben, man könne die Funktion der Gewerkschaft, die man für grundsätzlich verteidigenswert hält, ändern und einen „demokratischen und klassenkämpferischen ÖGB“ erreichen, der nicht von den sozialdemokratischen und christdemokratischen Funktionären bzw. dem Apparat, sondern von den KollegInnen in den Betrieben kontrolliert wird. Die Funktion der Gewerkschaften ist fest in die bürgerliche Gesellschaft eingeschrieben. Die ArbeiterInnen können sich nur durch einen unmittelbaren Kampf, der außerhalb der Kontrolle des ÖGB bzw. der Gewerkschaften ist, gegen kapitalistische Angriffe zur Wehr setzen und zusammenschließen. Die Gewerkschaft sabotiert und zersplittert diesen Kampf, egal, wie „demokratisch“ sie ist oder wie viel die obersten Funktionäre verdienen.
Gruppe Internationalistische Kommunisten (GIK), Österreich
Postfach 96, A-6845 Hohenems, Österreich
__________
1 Standard, 17.6. 2006, S.2
2 Herbert Langsner, in: FORMAT, Juni 2006
3 Richard Schneider: Das Syndikat der Totengräber. Eine Dokumentation über die
Hinrichtung des roten Bankenriesen BAWAG und seines Eigentümers ÖGB. Wien 2006.
S.26)
4 Prüfbericht der Nationalbank, zit. In NEWS, Juni 2006, zit. in: Richard Schneider, S.49
Geographisch:
- Österreich [61]
Erbe der kommunistischen Linke:
Flugblatt der IKS - AIRBUS: Wenn wir heute die Opfer hinnehmen, werden die Herrschenden morgen noch härter zuschlagen!
- 4055 reads
Nach wochenlangen Verrenkungen seitens der Airbus-Spitze und nach einem Treffen zwischen Chirac-Merkel ist das Fallbeil niedergegangen : 10.000 Stellenstreichungen in Europa, Schließung oder Verkauf mehrerer Standorte.
Die Geschäftsleitung beteuert : «Es wird keine harten Entlassungen geben », « Alles wird über Frühpensionierungen und freiwillige Kündigungen geregelt ».
Keine Entlassungen bei Airbus, aber hier handelt es sich nur um die Hälfte der Betroffenen. Die 5.000 Zeitarbeiter oder Beschäftigten der Zulieferer müssen woanders Arbeit suchen. Und die Airbus-Beschäftigten wissen selbst, was für sie « freiwilliges Ausscheiden » bedeutet: ständiges Mobbing durch die Vorgesetzen, um die Mitarbeiter heraus zu ekeln. Insgesamt wird es dabei noch mehr Arbeitslose vor allem unter den arbeitssuchenden Jugendlichen geben. Und für diejenigen, die ihren Job behalten, heißt dies – ein noch schlimmerer Arbeitsrhythmus, Arbeitszeitverlängerungen ohne Lohnausgleich und sogar noch weniger.
Nach wochenlangen Verrenkungen seitens der Airbus-Spitze und nach einem Treffen zwischen Chirac-Merkel ist das Fallbeil niedergegangen: 10.000 Stellenstreichungen in Europa, Schließung oder Verkauf mehrerer Standorte. Die Geschäftsleitung beteuert: «Es wird keine harten Entlassungen geben», «Alles wird über Frühpensionierungen und freiwillige Kündigungen geregelt». Keine Entlassungen bei Airbus, aber hier handelt es sich nur um die Hälfte der Betroffenen. Die 5.000 Zeitarbeiter oder Beschäftigten der Zulieferer müssen woanders Arbeit suchen. Und die Airbus-Beschäftigten wissen selbst, was für sie «freiwilliges Ausscheiden» bedeutet: ständiges Mobbing durch die Vorgesetzen, um die Mitarbeiter heraus zu ekeln. Insgesamt wird es dabei noch mehr Arbeitslose vor allem unter den arbeitssuchenden Jugendlichen geben. Und für diejenigen, die ihren Job behalten, heißt dies – ein noch schlimmerer Arbeitsrhythmus, Arbeitszeitverlängerungen ohne Lohnausgleich etc.
Wie die Bourgeoisie und die Gewerkschaften die Krise bei Airbus erklären
Um die Krise bei Airbus und die damit verbundenen Maßnahmen zu erklären, lenkt jeder auf seine Art von den wahren Ursachen ab. Gallois, Vorstandsvorsitzender von Airbus, zufolge, ist hauptsächlich der starke Euro schuld. Die Airbus-Flugzeuge seien daher zu teuer im Vergleich zu den von Boeing produzierten. Die Gewerkschaften wiederum sehen die Ursache allen Übels im schlechten Management oder in der Raffgier der Aktionäre. Für die Arbeitgeber jedoch ist der Staat der Schuldige, der sich zu sehr in die Industriepolitik eingemischt habe, denn dies sei auch gar nicht seine Aufgabe. Man müsse die Privatinvestoren alleine zurecht kommen lassen. Aber die linken Parteien nun werfen dem Staat vehement vor, seine Rolle als Aktionär nicht wahrgenommen zu haben. Für die französische Presse ist ganz klar der deutsche Staat schuld, denn der habe sich die besten Brocken in diesem Deal erhascht. Für die deutsche Presse wiederum – mit der herrschenden Klasse auf ihrer Seite – ist es schwierig, dieses Argument ebenso nun der französischen Regierung vorzuwerfen, schließlich sind bei Bayer-Schering 6.100 Stellenstreichungen vorgesehen und dafür kann man dann wohl doch kaum Frankreich den schwarzen Peter zuschieben. Und bei Deutsche Telekom ist die Auslagerung von 50.000 Stellen vorgesehen, was nur der Vorbereitung späterer Entlassungen dient, sobald die Beschäftigten auf eine Vielzahl kleinerer Betriebe verteilt sind. Diejenigen, die bei der Telekom ihren Arbeitsplatz behalten, müssen ohne Lohnausgleich länger arbeiten. Mit Hilfe der Medien versucht die deutsche Bourgeoisie daher eher, die Beschäftigten zu beschwichtigen und behauptet, es hätte noch viel schlimmer kommen können, zudem habe es die Franzosen am härtesten getroffen. Der gleiche Ton ist in der spanischen Presse zu vernehmen: Für uns ist es nicht so schlimm gekommen, weil wir wettbewerbsfähiger sind. Und als Beilage bei diesen nationalistischen Tönen werden die Deutschen und Franzosen beschuldigt, jeweils in ihrer Ecke ihr eigenes Süppchen zu kochen, ohne die Spanier zu konsultieren. Was die britische Presse betrifft, wird die ganze Sache eher diskret behandelt, denn just in diesem Moment sollen Hunderttausende Beschäftigte im Gesundheitswesen eine Einfrierung ihrer ohnehin schon niedrigen Löhne hinnehmen. Was schlagen uns diejenigen vor, die die Entscheidungen von Airbus verwerfen? Für die deutschen Gewerkschaften sind die Schwierigkeiten von Airbus lediglich ein Beispiel unter vielen für das schlechte Management der Arbeitgeber (so auch bei Deutsche Telekom und Bayer-Schering). Daher fordern sie mehr Mitbestimmung bei den Entscheidungsprozessen, obwohl sie praktisch schon über die Hälfte der Stimmen in den Aufsichtsräten verfügen und bereits bei allen Entscheidungen bei Airbus oder in anderen Firmen beteiligt wurden. In diesem Zusammenhang schlagen sie vor, dass die zur „Aufrechterhaltung der Zukunft von Airbus“ erforderlichen Maßnahmen vor Ort, in den Betrieben, zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern diskutiert werden. Die französischen Gewerkschaften wiederum prangern auch das schlechte Management der gegenwärtigen Geschäftsleitung an und schlagen vor, dass der Staat sich mehr an der Verwaltung von Airbus beteilige. Dieser Vorschlag wird ebenfalls vom gegenwärtigen Premierminister und den Kandidaten der Rechten und des Zentrums bei den nächsten Präsidentenwahlen, Sarkozy und Bayrou unterstützt. Die sozialistische Präsidentschaftskandidatin, Ségolène Royal, befürwortet zudem, dass die französischen Regionen Kapitalanteile erwerben und beim Management von Airbus einsteigen. Dies wäre also die gleiche Praxis, wie sie bereits in den Bundesländern Deutschlands gehandhabt wird, die schon Anteile von Airbus erworben haben. Man kann sehen, wohin dies geführt hat!
Wir dürfen uns durch die kapitalistische Konkurrenz nicht spalten lassen!
Bei einigen dieser Erklärungen mag ein Körnchen Wahrheit dran sein. Es stimmt, dass der starke Euro eine Hürde für den Verkauf von in Europa hergestellten Flugzeugen gegenüber der Konkurrenz von Boeing ist. Es stimmt, dass es Managementprobleme bei Airbus gibt. Es stimmt insbesondere, dass die Konkurrenz zwischen dem deutschen und französischen Staat die Sache nicht leichter macht. Jeder mag bis zu einem gewissen Maße recht haben, aber sie alle verbreiten die gleiche Lüge: Die Arbeiter, die heute für die Schwierigkeiten von Airbus aufkommen sollen, hätten die gleichen Interessen wie ihre Arbeitgeber. Kurzum – sie sollten sich alle dem Ziel unterwerfen, auf das alle Anstrengungen bei Airbus ausgerichtet sind – die Konkurrenzfähigkeit von Airbus gegenüber Boeing zu unterstützen. Genau dasselbe sagen die amerikanischen Unternehmer ihren Beschäftigten; und aus demselben Grunde mussten diese in den letzten Jahren Zehntausende von Stellenstreichungen hinnehmen. Letztendlich laufen alle Aussagen der «Verantwortlichen», ob Regierung, Arbeitgeber oder Gewerkschaften, darauf hinaus, dass die amerikanischen Arbeiter die Gegner der europäischen Arbeiter seien, genau so wie die französischen, deutschen, englischen und spanischen Arbeiter auch jeweils untereinander Gegner seien. Im gegenwärtigen Handelskrieg wollen alle Teile der Kapitalistenklasse die Arbeiter der verschiedenen Länder gegeneinander hetzen, genau so wie sie es in den militärischen Kriegen tun. Sie sagen uns immer wieder, dass die kapitalistischen Staaten in Konkurrenz zueinander stehen – und dies trifft natürlich zu. Die Kriege des 20. Jahrhunderts aber beweisen, dass die Arbeiter am meisten im Konkurrenzkampf der kapitalistischen Nationen untereinander zu verlieren haben, und dass sie kein Interesse daran haben, sich den Befehlen und den Interessen ihrer jeweiligen nationalen Bourgeoisie zu unterwerfen. Der Logik des Kapitalismus zufolge müssen die Arbeiter Europas und Amerikas immer mehr Opfer bringen. Wenn Airbus gegenüber Boeing wieder rentabel wird, werden die Beschäftigten bei Boeing neuen Angriffen ausgesetzt (jetzt schon sind 7000 Stellenstreichungen bei Boeing geplant), und dann werden im Gegenzug wieder die europäischen Beschäftigten erpresst. Jedes Zurückweichen der Arbeiter vor den Forderungen der Kapitalisten führt nur dazu, dass überall neue, noch heftigere Angriffe gegen die Arbeiter beschlossen werden. Daher bleibt dem Kapitalismus keine andere Wahl, denn das System steckt tief in einer unüberwindbaren Krise –und die einzige „Lösung“, die dem System übrig bleibt, sind immer mehr Stellenstreichungen und eine immer schrecklichere Ausbeutung der Arbeiter, die gegenwärtig noch das „Glück“ haben, ihren Arbeitsplatz zu behalten.
Eine einzige Lösung : Einheit und Solidarität der ganzen Arbeiterklasse!
Den von den Sparmaßnahmen bei Airbus-Betroffenen bleibt heute nichts anderes übrig als zu kämpfen. In den Airbus-Werken haben sie dies sofort verstanden: Gleich nach der Verkündung der Firmenpläne haben mehr als 1000 Beschäftigte in Laupheim spontan die Arbeit niedergelegt, während gleichzeitig in Meault, in der Picardie, die Arbeit niedergelegt wurde. Erst nachdem die Gewerkschaften meldeten, dass das Werk nicht verkauft werden würde, haben die Arbeiter in Meault wieder die Arbeit aufgenommen. Aber die Zusage der Gewerkschaften war eine Lüge. Doch die Airbus-Beschäftigten sind nicht die einzig Betroffenen. Alle Ausgebeuteten müssen sich solidarisch fühlen gegenüber den Angriffen, denen heute die Beschäftigten des Flugzeugbaus ausgesetzt sind, denn morgen werden die gleichen Angriffe auf die Beschäftigten der Automobilindustrie, der Telekom, der Chemie und aller anderen Bereiche niederprasseln. Überall müssen die Arbeiter in souveränen Vollversammlungen zusammenkommen, in denen sie über die Ziele und die Mittel des Kampfes diskutieren und entscheiden können. Ihr Kampf ist nicht nur eine Angelegenheit der Arbeiter selbst. Nicht die Kandidaten bei den Präsidentenwahlen werden für die Beschäftigten handeln, denn ihre Versprechungen werden – sobald sie an der Macht sind – vergessen sein. Auch die Gewerkschaften verteidigen die Arbeiter nicht. Denn die sorgen nur für die Spaltung der Arbeiter, sei es in den Betrieben, sei es innerhalb der gleichen Produktionsabteilung (wie man heute in Toulouse sehen kann, wo die größte Gewerkschaft ‚Force Ouvrière’ versucht, die „Blaumänner“ und die „Angestellten“ der Airbus-Zentrale zu spalten, obwohl diese auch sehr stark von Stellenstreichungen betroffen sind). Auch die Beschäftigten der betroffenen Länder, versuchen sie zu spalten, denn sie schwingen als erste die Nationalfahne (die französischen Gewerkschaften, mit Force Ouvrière an der Spitze, behaupten, „man muss kämpfen“, ja man müsse auch die Produktion lahm legen, um eine „bessere Verteilung der Opfer“ zu erreichen, mit anderen Worten, man will erreichen, dass die Beschäftigten in Deutschland noch härter getroffen werden). Und selbst wenn eine Gewerkschaft wie die IG-Metall für Mitte März einen Aktionstag aller Länder mit Airbus-Standorten ankündigt, handelt es sich nur um ein Manöver, das dazu dienen soll, die Arbeiter von der Bewusstseinsentwicklung abzuhalten, dass ihre Interessen nicht mit denen des nationalen Kapitals übereinstimmen, während sie gleichzeitig Stellung gegen Streiks beziehen, weil man sich „verantwortlich“ verhalten müsse. Aber die Gewerkschaften wollen auch eine „Solidarität“ der europäischen Beschäftigten von Airbus gegen die amerikanischen Arbeiter von Boeing herbeiführen, die sich im Herbst 2005 massiv mit Streiks gegen die Angriffe der Arbeitgeber gewehrt haben. Die notwendige Solidarität aller Beschäftigten zeigt sich ansatzweise insbesondere durch spontane Arbeitsniederlegungen in den etwas weniger hart betroffenen Standorten wie Bremen und Hamburg. Vor kurzem beteiligten sich die Beschäftigten von Airbus im Süden Spaniens, die heute ebenso angegriffen werden, an den Demonstrationen der Beschäftigten des Automobilzulieferers Delphi, der ein Werk in Puerto Real dicht machen will. Dies muss der Weg für alle Arbeiter sein. Während die Bosse dazu aufrufen, die Stellenstreichungen, die Lohnsenkungen und die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen hinzunehmen, müssen wir mit einer Stimme antworten: Wir weigern uns, diese Opfer zu bringen, die nur noch zu immer heftigeren Angriffen führen werden. Nur der Kampf lohnt sich! >
Gegen die Spaltungsversuche der Beschäftigten der verschiedenen Betriebe oder Länder - Solidarität der ganzen Arbeiterklasse!
Gegen die Isolierung, die immer zu Niederlagen führt, müssen wir die Ausdehnung der Kämpfe durchsetzen. Die Vollversammlungen müssen massive Delegationen zu den anderen Betrieben schicken, damit alle Arbeiter sich an einer Solidarisierungsbewegung beteiligen können.
Gegenüber einem kapitalistischen Weltsystem, das im Niedergang begriffen ist, und das nur noch zu immer heftigeren Angriffen gegen die Arbeiter in allen Branchen und allen Ländern in der Lage ist, haben die Arbeiter keine andere Wahl als immer entschlossener, immer solidarischer zu kämpfen und den Kampf stetig weiter auszudehnen.
Dies ist das einzige Mittel aller Beschäftigten, um der Zuspitzung ihrer Ausbeutung, der Verschlechterung ihrer immer unmenschlicher werdenden Lebens- und Arbeitsbedingungen entgegenzutreten, und auch um die Überwindung dieses Systems vorzubereiten, das Not und Elend, Krieg und Barbarei verbreitet.
Internationale Kommunistische Strömung, 5.3.07 www.internationalism.org [75]
E-mail: [email protected] [30]
Kontaktadresse: Postfach 410308, 50863 Köln
Als PDF herunterladen:
files/de/airbus_entlassungen50307.pdf [76]
Theoretische Fragen:
- Politische Ökonomie [66]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Proletarischer Kampf [37]
Mai 2007
- 748 reads
Airbus, Telekom, Opel, VW-Skoda - Kämpfen lohnt sich
- 3295 reads
Keine zwei Monate, nachdem die Turbulenzen bei Airbus in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gerückt waren, haben sich die Medien wieder anderen Themen zugewandt. Zumindest in Deutschland ist dieses Thema mittlerweile ins Abseits gedrängt worden. Die Lage bei Airbus ist wieder zu einer ausschließlichen Angelegenheit der „Spezialisten“ aus den Vorstandsetagen und den Gewerkschaftsführungen gemacht worden, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit nun diskret das Schicksal Tausender Beschäftigter „abwickeln“ wollen. Erneut beweisen sich die Gewerkschaften, auf deutscher Seite vor allem die IG Metall, als Virtuosen auf der Klaviatur der Spaltungsmanöver.
Keine zwei Monate, nachdem die Turbulenzen bei Airbus in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gerückt waren, haben sich die Medien wieder anderen Themen zugewandt. Zumindest in Deutschland ist dieses Thema mittlerweile ins Abseits gedrängt worden. Die Lage bei Airbus ist wieder zu einer ausschließlichen Angelegenheit der „Spezialisten“ aus den Vorstandsetagen und den Gewerkschaftsführungen gemacht worden, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit nun diskret das Schicksal Tausender Beschäftigter „abwickeln“ wollen. Erneut beweisen sich die Gewerkschaften, auf deutscher Seite vor allem die IG Metall, als Virtuosen auf der Klaviatur der Spaltungsmanöver. Völlig ungeniert spielen sie dabei mit der nationalistischen Karte, indem sie mit Argusaugen darauf achten, dass das eigene Land bei der Verteilung der Lasten des Krisenmanagements bei Airbus nicht übervorteilt wird. Dabei werfen sie sich auch noch in die Brust und behaupten, dies alles im Interesse der Beschäftigten zu tun. Das Gegenteil ist der Fall! Indem sie systematisch und bewusst die ArbeiterInnen des einen Landes gegen die Airbus-Beschäftigten anderer Länder, die Beschäftigten des einen Airbus-Betriebes gegen die Kollegen und Kolleginnen anderer Betriebe auszuspielen trachten, versuchen sie, die Airbus-Beschäftigten in Frankreich, Spanien, Großbritannien und Deutschland davon abzuhalten, zu ihrer wirkungsvollsten Waffe gegen derlei Attacken der Herrschenden zu greifen – zur buchstäblich grenzenlosen Solidarität der Arbeiterklasse, zur Solidarisierung unter den ArbeiterInnen über alle betrieblichen oder nationalen Grenzen hinweg. Offensichtlich sind die Gewerkschaften bisher recht erfolgreich bei ihren Bemühungen, den Kampfgeist der Airbus-Beschäftigten auf kleiner Flamme zu halten. Jedenfalls deuten die bisher recht müden Aktionen Letzterer eher auf eine Demoralisierung denn auf große Kampfbereitschaft der Betroffenen hin.
Dies die momentane Lage. Jedoch werden die Versuche der Gewerkschaften, die Illusion zu verbreiten, dass die Beschäftigten durch „Realismus“ und „kreative Mitgestaltung“ des Umstrukturierungsprozesses das Schlimmste verhindern und die Anzahl der Jobverluste minimieren könnten, an den unerbittlichen Realitäten zerschellen. Neuerdings wird aus der Konzernzentrale in Toulouse vernommen, dass jedenfalls in Hamburg und vielleicht auch anderswo weitaus mehr Arbeitsplätze gestrichen werden sollen als bislang angekündigt.
Was die Situation in Deutschland auch für die Herrschenden derzeit brisant macht, das ist die Tatsache, dass neben den Airbus-Beschäftigten auch andere Bereiche der Arbeiterklasse massiven Angriffen ausgesetzt sind. An erster Stelle seien hier die Beschäftigten der Deutschen Telekom genannt, die sich zurzeit mit einem der massivsten Angriffe in der jüngeren Geschichte Deutschland konfrontiert sehen. Vor dem Hintergrund schwerer Einbrüche auf dem Telekommunikationsmarkt sieht sich der Telekom-Vorstand gezwungen, zu drastischen Maßnahmen zu greifen. 50.000 Arbeitsplätze sollen aus dem Telekom-Konzern „ausgegliedert“ werden; die Betroffenen sollen dabei 12%ige Lohneinbußen hinnehmen und – als ob dies nicht schon genug wäre – darüber hinaus vier Stunden pro Woche länger arbeiten – natürlich unentgeltlich. Mitte April begannen die Verhandlungen zwischen dem Telekom-Vorstand und Ver.di. Von Anfang an war die Verhandlungsstrategie von Ver.di darauf ausgerichtet, irgendeine Art von „Kompensationen“ für die angestrebte Ausgliederung zu erhalten. Mit anderen Worten: Ver.di hoffte, dass sich die Telekom-Beschäftigten bereits in ihr Schicksal fügen, ehe sie überhaupt erst den Kampf aufgenommen zu haben. Doch anscheinend hat Ver.di die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Nicht nur, dass die dreitägigen Warnstreiks, an denen jeweils mehr als 10.000 Telekom-Beschäftigten Mitte April teilnahmen, von einem kämpferischen Geist beseelt waren. Hinzu kommt, dass die Beschäftigten keinesfalls das uneingestandene Ziel Ver.dis teilen. Die Äußerungen vieler Teilnehmer der Warnstreiks vor den zahlreich vertretenen Fernsehkameras deuten darauf hin, dass die Ausgliederung von 50.000 Arbeitsplätzen für die Beschäftigten selbst noch längst keine beschlossene Sache ist. Denn hier geht es nicht mehr darum, auf die Urlaubsreise oder ein neues Auto zu verzichten. Hier geht es um die nackte Existenz! Es wird berichtet, dass Tausende von Telekom-Beschäftigten ihr Heim werden verpfänden müssen, falls das Vorhaben des Vorstandes Realität wird. Unter diesen Umständen ist eine geräuschlose Abwicklung dieses üblen Plans nicht mehr möglich. Nachdem sie zwischenzeitlich versucht hatte, durch die vorläufige Suspendierung der Verhandlungen mit dem Telekom-Vorstand Zeit zu gewinnen und die Dinge etwas zu beruhigen, muss Ver.di nun wohl oder übel schärfere Töne anschlagen. Doch wenn die Gewerkschaftsführung nun unverhohlen von der Unvermeidlichkeit eines Streiks bei der Telekom spricht, so können wir getrost davon ausgehen, dass sie dies nicht freiwillig, aus Jux und Dollerei macht. Jeder große Streik, welcher um wirkliche Klassenforderungen geführt wird, birgt das Potential in sich, die Arbeiterklasse an ihre eigene Identität und Kraft als Klasse zu erinnern. Dies auch der Grund, weshalb Gesamtmetall und IG Metall sich so sehr einig waren, die diesjährigen Tarifverhandlungen in der wichtigsten Branche der deutschen Industrie ohne Streik zu beenden. Wenn also Ver.di nun offen vom Streik spricht, dann aus dem einfachen Grund, weil sie es muss. Die immer martialischeren Töne aus der gewerkschaftlichen Ecke sind nur dem Schein nach an den Telekom-Vorstand gerichtet. Der eigentliche Adressat, das sind die Telekom-Beschäftigten, deren Kampfgeist gezügelt, deren Wut ventiliert und deren Vertrauen in die Kompetenz der Gewerkschaft erhalten werden soll.
Am 18. April - am gleichen Tag, als Ver.di die Verhandlungen mit dem Telekom-Vorstand vorläufig einstellte – gab General Motors seinen jüngsten „Sanierungs“plan für die europäischen Werke bekannt. Er sieht u.a. die Vernichtung von 1.700 Arbeitsplätzen bei Opel Bochum vor. Für die ArbeiterInnen des Bochumer Werks ist dies dennoch ein „Glück“ im Unglück, denn anders als von den Experten und der Börse erwartet, wird das Bochumer Werk nicht nur nicht geschlossen, sondern sogar zum zentralen Standort für die Produktion des Erfolgsmodells, den Opel Astra, ausgebaut. Es stellt sich die Frage, warum das Opel-Werk in Bochum nicht geschlossen wird, obwohl viele Gründe gegen Bochum sprechen, nicht zuletzt die völlig veraltete Infrastruktur des dortigen Werkes. Die Antwort lautet unserer Auffassung nach schlicht und einfach: Die Verantwortlichen haben einen Heidenrespekt vor dem Kampfgeist der Bochumer Belegschaft. Bereits Anfang März, als die ersten Neuigkeiten über den Sanierungsplan durchsickerten und das Gerücht über eine eventuelle Schließung des Bochumer Werkes die Runde machten, warnte der Betriebsratsvorsitzende des betroffenen Werkes, dass eine solche Maßnahme einen „Krieg“ auslösen könnte, d.h. einen Klassenkrieg, und das mitten im Ruhrgebiet. Und er weiß, wovon er spricht. Die Belegschaft des Bochumer Werkes hat eine lange Kampftradition. Angefangen von den wilden Streiks in den siebziger Jahren bis hin zum mehrtägigen Streik im Sommer 2003 – nie haben die OpelarbeiterInnen in Bochum Zweifel an ihrer Kampfbereitschaft gelassen. Nun, die Warnung des als sehr konziliant geltenden Herrn Betriebsratsvorsitzenden scheinen erhört worden zu sein. Das Kapital geht, wie zumeist, den Weg des geringeren Widerstandes.
Bei einem anderen Automobilhersteller in Deutschland ist dagegen der worst case bereits eingetreten. Bei VW wurde gestreikt, nicht in Deutschland, sondern bei der VW-Tochter Skoda in Tschechien. Den dünnen Verlautbarungen der hiesigen bürgerlichen Medien zufolge sind am Montag, den 16. April, die ArbeiterInnen der Skoda-Werke in Pilsen und Mlada Boleslaw in den Ausstand getreten; die Produktion ist völlig zum Erliegen gekommen. 28.000 Beschäftigte waren an dem Ausstand beteiligt. Durch die allgemeine Unzufriedenheit unter Druck geraten, hatten die Gewerkschaften zu einem dreistündigen Warnstreik aufgerufen. Damit sollte Druck abgelassen und unwirksam gemacht werden. Nachdem jedoch der Streik über dieser dritte Stunde hinaus fortgesetzt wurde und die Beteiligten keine Anstalten machten, auch am darauf folgenden Tag die Arbeit wieder aufzunehmen, musste die Konzernleitung noch am selben Tag einlenken. Anlass des Kampfes ist eine 12%ige Lohnerhöhung gewesen, die die ArbeiterInnen vom VW-Konzern fordern. Solch eine hohe Lohnforderung in Zeiten des allgemeinen Lohnraubs ist ungewöhnlich und lässt erahnen, wie unerträglich das Lohnniveau für die ArbeiterInnen in Ländern wie der Tschechischen Republik mittlerweile geworden ist. Die Kapitalseite gab offenbar so schnell nach, weil sie eine weitere Ausdehnung des Kampfes innerhalb der tschechischen Republik, aber auch die internationale politische Signalwirkung eines solchen, größeren Kampfes fürchten musste. Denn ein solcher Kampf muss nicht zuletzt auch die Arbeiterklasse in Deutschland und Westeuropa ermutigen. Bis dato hat die hiesige Bourgeoisie gerne auf die niedrigen Löhne in den osteuropäischen und asiatischen Ländern hingewiesen, um die Löhne hierzulande in einem nie gekannten Ausmaß zu kürzen. Nun haben die Skoda-ArbeiterInnen gezeigt, dass es noch eine andere, eine proletarische Antwort auf das Problem des Lohngefälles gibt. Sollte ihr Kampf in den Billiglohnländern Schule machen, so wäre er eine große Ermutigung ihrer Brüder und Schwestern in den westlichen Industrieländern. Denn Lohnkämpfe in den Billiglohnländern erschweren es der hiesigen Bourgeoisie, die Arbeiterklasse in den Kernländern des Weltkapitalismus mit der Drohung der Auslagerung von Arbeitsplätzen zu erpressen und zum Stillhalten zu zwingen.
Airbus, Telekom, Opel und Skoda: vier aktuelle Beispiele aus der Chronik des Klassenkampfes, vier unterschiedliche Konstellationen und Erfahrungen, aber eine einzige Schlussfolgerung – Kampfbereitschaft zahlt sich aus. Sie bremst die Angriffslust der Herrschenden und hemmt sie bei der Verfolgung ihrer menschenverachtenden Logik, aber vor allem verschafft der Kampf der Arbeiterklasse erst das Gefühl für ihre eigene Stärke und Identität – ein Gefühl, das seit 1989 etwas verloren gegangen ist. Mögen die meisten Kämpfe heute noch mit Misserfolgen enden oder bestenfalls von sehr kurzfristigen Erfolgen gekrönt sein – die Tageskämpfe von heute werden spätestens in den revolutionären Kämpfen von morgen ihre „Rendite“ abwerfen. Weltrevolution - 7.5.07
Chavez-Regierung in Venezuela: „Sozialismus im 21. Jahrhundert“ (Einleitung zur Diskussionsveranstaltung)
- 5603 reads
Venezuela ist kein Land von internationaler Bedeutung und Macht wie die USA, Deutschland, Japan, Russland oder China.
Venezuela ist auch nicht einer der heutigen akuten kriegerischen Brandherde der Welt, wie der Irak oder Äthiopien.
Unsere heutige Diskussion will sich aber dennoch etwas genauer mit den Umständen in diesem Land befassen. Weshalb dies?
Die gegenwärtige Regierung in Venezuela unter Hugo Chavez verkörpert für viele Menschen, auch hier in Europa, ein internationales Sinnbild für eine neue Perspektive: das Projekt des „Sozialismus im 21. Jahrhundert“, die so genannte „Bolivarische Revolution“.
Kurz gesagt: Die Regierung in Venezuela sagt, sie führe ihr Land handfest und mit Taten „auf den Weg des Sozialismus“. Ein langsamer gesellschaftlicher Prozess sei ins Rollen gebracht worden, der die Kluft zwischen Arm und Reich stetig kleiner mache. Die Regierung um Hugo Chavez ist, verglichen mit anderen, die in der Vergangenheit von Sozialismus gesprochen haben, bescheiden: Sie behauptet nicht, wie die untergegangenen stalinistischen Bürokraten-Regimes des Ostblocks, dass der Sozialismus bereits verwirklicht sei, sondern dass „der Weg zum Sozialismus“ erst begonnen werde. Vermutlich sind wir uns einig: Der ehemalige Ostblock unter russischer Führung, der vor 18 Jahren in sich zusammenbrach, war nicht der „wirkliche Sozialismus“. Es ist kein Geheimnis, dass es dort eine gehobene Klasse der Staatsbürokratie gab, die ein besseres Leben führte als die einfachen Leute, die schufteten. Der Ostblock steckte ja auch alle Ressourcen in die militärische Rüstung und führte permanent irgendwo Kriege. Als der Ostblock 1989 kollabierte, schien für viele das Kapitel „Sozialismus“ abgeschlossen zu sein. Die Geschichte habe gezeigt, dass der edle Gedanke einer gerechten Gesellschaft leider nicht in die Wirklichkeit umzusetzen sei. Auch wenn viele Menschen den Ostblock richtigerweise nicht als einen „wirklichen Sozialismus“ betrachteten, so zerbrach für sie 1989 doch eine Hoffnung. Andere Regime, die sich „sozialistisch“ nennen, haben diese Zeit überlebt: Nordkorea oder Kuba. Doch diese Länder können uns ja auch kaum als Leitbilder des Sozialismus zu überzeugen. Sie sind Staaten einer immer größeren Armut, wo eine Clique von greisen Bürokraten wie Könige die Macht ausübt. Wer dort über die Gesellschaft bestimmt, dazu hat die einfache Bevölkerung nichts zu sagen.
Mit der Chavez-Regierung in Venezuela ist aber nun offenbar etwas anderes angebrochen:
-
Wurde sie nicht 1998 gerade in freien Volkswahlen gewählt?
-
Sie wurde am 3. Dezember 2006 mit 63% überzeugend wieder gewählt!
-
Die Ärmsten der Armen haben in Jahre 2006 mehr Sozialhilfe bekommen!
Also: im Gegensatz zu einem absurden, diktatorischen Armenhaus wie Nordkorea ein wirklicher „Sozialismus von unten“?
In einem bekannten Dokumentarfilm mit dem Titel „5 Fabriken – Arbeiterkontrolle in Venezuela“ wird von einem regierungstreuen Gefährten von Chavez (ein hoher nationaler Gewerkschaftsfunktionär und Leiter einer Aluminium-Gießerei) deutlich und offen gesagt, dass „Venezuela weiterhin ein kapitalistisches Land sei und Ausbeutungsverhältnisse existieren“. Es gilt also kaum darum zu streiten, ob Venezuela zum heutigen Zeitpunkt eine „Verwirklichung des Sozialismus“ darstellt oder nicht.
Die Frage, die sich uns stellt, ist demnach vielmehr folgende:
- Führt die Politik der Chavez-Regierung in die richtige Richtung, also hin zum Sozialismus?
- Oder verkörpert sie nicht eine Politik, welche die Interessen der Arbeiterklasse und anderer unterdrückter Schichten vertritt?
1998, kurz nach der Wahl von Chavez hätte man noch sagen können: ‚Schauen wir doch erst einmal, was die nächste Zeit bringt, und geben wir allen kommenden Versuchen den Kredit des Neuen!’ Doch heute, nach fast neun Jahren eines Venezuela unter dieser Regierung, ist es sicher möglich, eine Bilanz zu ziehen. Werfen wir doch kurz einen Blick auf drei Meilensteine, welche den sog. Weg zum Sozialismus in Venezuela markieren.
Eines der wichtigsten Argumente der Chavez-Regierung, auf dem richtigen „Weg zum Sozialismus“ zu sein, ist die staatliche Übernahme von Hunderten von Betrieben und Fabriken, welche nun von den Arbeitern selbst geführt werden.
Die meisten dieser Betriebe waren aufgrund der enormen wirtschaftlichen Krise dermaßen marode, dass sie von den ehemaligen Privateigentümern selbst stillgelegt worden waren. Gegen die Übernahme der Fabriken durch den Staat wurde von diesen Privateigentümern denn auch kein Widerstand geleistet, da sie mit den ausbezahlten Abfindungen noch ein letztes Mal Verdienst einfahren konnten. Handelte es sich in Tat und Wahrheit also nicht eher um die Übergabe der abgewirtschafteten und unrentablen Betriebe in die Hände des Staates? Ein Staat, der weiterhin der Staat eines kapitalistischen Landes ist? Auf jeden Fall können wir feststellen, dass es sich bei den Verstaatlichungen in Venezuela um eine ganz andere Sache handelt als um die Enteignung der herrschenden Klasse, wie dies bei vergangenen revolutionären Anläufen der Arbeiterklasse stattfand. Die Besitzer der Produktionsmittel wurden in der Zeit der Revolution in Russland 1917 davongejagt – im heutigen Venezuela sind sie vielmehr eine alte Last losgeworden, um in andere, einträglichere Sektoren zu investieren.
Die „Arbeiterselbstverwaltung“ in Venezuela wurde vom Staat unterstützt und eingeleitet, indem er diesen Betrieben Start-Kredite zur Verfügung stellte. Konkret wird die Leitung der Betriebe durch die Strukturen der regierungstreuen Gewerkschaften aufgebaut. Haben sich in den letzten Jahren dadurch die Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiterklasse auch wirklich verbessert?
Als Argumente dafür hört man folgendes:
- „Die Arbeiter der vormals geschlossenen Betriebe haben dadurch wieder Arbeit bekommen.“
- „Es gibt eine größere Identifikation der Arbeiter mit den Interessen des Betriebes und eine bessere Arbeitsmoral, denn - es sind ja nun ‚unsere’ Fabriken!“
- „Die Produktion konnte dadurch gesteigert werden, zum Teil um stolze 30%!“
Doch bei genauerem Hinsehen hat sich auch anderes für die Arbeiter verändert:
-
Es wurden flexiblere Arbeitszeiten eingeführt, um die Produktion in der „eigenen“ Fabrik lückenloser zu gewährleisten.
-
Es gibt eine gut funktionierende Überwachungsstruktur gegen Quertreiber, die den „kollektiven“ Betrieb behindern.
-
Wer gegen die Arbeitsbedingungen protestiert, oder gar von Streik spricht, wendet sich damit gegen seine Arbeitskollegen und sabotiert den „eigenen Betrieb“.
-
Um den „eigenen“ Betrieb über Durststrecken zu führen, müssen die Arbeiter auch Lohneinbußen in Kauf nehmen - sozusagen in „gemeinsamer Solidarität“.
Um noch einmal Mal auf den erwähnten Film über die „Arbeiterselbstverwaltung in Venezuela “ zurückzukommen, den man mit gutem Gewissen als eine Propaganda für die Politik von Chavez betrachten kann: Wir hatten ihn jüngst auf einer Diskussionsveranstaltung anlässlich der „Anarchistischen Woche“ in Winterthur, Schweiz, gesehen und mit zwei Dutzend sehr jungen Leuten danach beherzt diskutiert. Mit einem gesunden Instinkt versehen, hatten sich bei allen etwas die Haare gesträubt. Nachdem man ausführlich gesehen hatte, was sich für die venezolanischen Arbeiter durch die „Selbstverwaltung“ unter Chavez im Leben verändert, wurden Zweifel geäußert, ob dies nun wirklich der „Weg zum Sozialismus“ sei!
Wir können dieses Gefühl nur teilen. Es tut einem auch etwas weh zuzusehen, wie die Hoffnungen und der Enthusiasmus der Arbeiter für die Steigerung der Produktion verwendet werden: Produkte für den kapitalistischen Warenmarkt!
Möglicherweise müsste man die Politik der Chavez-Regierung bezüglich der „Selbstverwaltung“ der Betriebe nicht als Marsch auf dem „Weg zum Sozialismus“ bezeichnen, sondern folgendermaßen: „Arbeiter, hier habt ihr die Misere, verwaltet sie selbst und organisiert eure Ausbeutung selbst!“ Oder liegen wir komplett falsch mit dieser Einschätzung?
Der zweite Meilenstein, mit der die Politik von Chavez berühmt geworden ist, sind die Maßnahmen gegenüber den Ärmsten der Armen.
Jeder ehrliche Mensch, der sich die heutige Welt etwas genauer betrachtet, stößt auf die Frage der enormen Armut und Verelendung auf allen Kontinenten. Es ist schlicht notwendig und menschlich, dass in Zukunft für all die Millionen von Menschen, die gar nie Arbeit hatten, betteln, oder durch ihre Not in die Kriminalität und Prostitution getrieben werden, ein Ausweg gefunden werden muss. Die Situation gerade in den Städten Venezuelas ist seit langem eine der dramatischsten von ganz Lateinamerika. Unter den korrupten Regierungen der anderen großen Parteien hatte sich die Lage in den 80er Jahren laufend verschlechtert. Jedes Land in Lateinamerika kennt verzweifelte soziale Explosionen, wie Venezuela 1989 oder vor einigen Jahren in Argentinien. Leider sind sie oft ein Feld für die unverhohlene Manipulation durch die verschiedenen politischen Parteien, von links bis rechts.
Die vorherige Regierung wurde von der sozialdemokratischen „Demokratischen Aktion“ und der christlich-demokratischen „COPEI“ gestellt, unfähig, auch nur irgendeine soziale Stabilität aufrechtzuerhalten. Es lag also auf der Hand, dass die neu angetretene Chavez-Regierung nach 1998 sich dieser Frage annehmen musste. Gerade deshalb, weil das populistische Programm dieser Partei vor allem auf den Hoffnungen und den Wählerstimmen der verarmtem Bevölkerung aufbaut. Wenn wir heute eine Bilanz über die letzten Jahre ziehen, sehen wir, dass die Frage der Armut nicht, wie von anderen politischen Parteien, nach der gewonnenen Wahl still beiseite gelegt wurde. Im Gegenteil, sie wurde eine der zentralen Themen, welche die Regierung von Chavez auch über die Landesgrenzen hinaus berühmt gemacht hat. Chavez begegnete dieser Frage nicht nur mit einfachen Floskeln, sondern entwickelte ein so genanntes „Programm des sozialen Ausgleichs“. Die Reichen sollen abgeben zugunsten der Ärmsten. Doch wir wissen, dass in Venezuela die wirklich Reichen nicht ihr ganzes Geld hergeben mussten. Die Chavez-Regierung hat sich vor allem an den allzu hohen Löhnen der Arbeiter in der Ölindustrie oder niederer Staatsangestellter wie der Lehrer gestört. Die seien gegenüber dem, was die Bewohner der Slums in den Händen haben, einfach unverhältnismäßig. Man müsse diese Schicht als „Arbeiteraristokratie“ bezeichnen. Sie leben besser als die Ärmsten und sollen aus Gerechtigkeit und Solidarität etwas zurückschrauben. Gerade den Arbeitern in der Ölindustrie, welche das wirtschaftliche Herzstück Venezuelas bildet, wurden die Löhne in den letzten Jahren gekürzt. Es fanden auch massenhafte Entlassungen dieser angeblich „privilegierten Arbeiter“ statt. Also offenbar handfeste Taten der Regierung zum sozialen Ausgleich!
Wir haben - ehrlich gesagt - große Mühe, darin eine Solidarität zugunsten der Ärmsten zu sehen. Solidarität unter rudernden Sklaven auf einer römischen Galeere bedeutet kaum die Peitschenschläge gerechter unter alle zu verteilen – sondern sich gemeinsam dagegen zu erheben! Ist dies der eingeschlagene „Weg zum Sozialismus“? Oder werden die Arbeiter in Venezuela damit nicht eher gegeneinander aufgebracht und gespalten? Was denkt ihr dazu?
In den riesigen Slums rund um die großen Städte Venezuelas beschränkte sich die Politik der Regierung unter Hugo Chavez gerade im Jahre 2006 nicht auf leere Versprechungen. Staatlich subventionierte Lebensmittel wurden dort während des ganzen Jahres eingeführt und zu niedrigen Preisen verkauft. Also eine momentane Erleichterung für die Millionen von Armen!
Doch solche wohltätigen Maßnahmen sind in Venezuela nicht neu! Schon die vorherigen Regierungen hatten in den Monaten vor den Wahlen ähnliche Maßnahmen ergriffen. Weshalb? Um schnell Wählerstimmen zu gewinnen! Die Menschen in den Slums führen ein Hundeleben, das wissen wir alle. Und in Kreisen von Hundezüchtern gilt folgende Regel: „Ein Hund folgt demjenigen, der ihm zu Fressen gibt“.
Selbstverständlich sind für uns Kommunisten die Millionen von Slumbewohnern keine „Hunde“, sondern die am stärksten an den Rand und in die Perspektivlosigkeit gedrängten Teile der Arbeiterklasse. Leider oft auch ohne Chance, das Gefühl zu bekommen, einer proletarischen Klasse anzugehören, da sie nie Arbeit haben und in die Kriminalität abrutschen. Aber die herrschende Klasse behandelt sie als Hunde! Und ob die Chavez-Regierung in den Monaten vor den Wahlen 2006 wirklich einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat, sollten wir zusammen mit euch diskutieren.
Vergessen wir auch nicht die Tatsache, dass im Jahre 2006 die Staatsverschuldung Venezuelas um 58% gegenüber 2005 zugenommen hat und jetzt 35% des Bruttosozialprodukts ausmacht. Die „Politik der Spenden an die Ärmsten“ hat damit das Problem der generellen wirtschaftlichen Krise verschärft. Ein „Weg zum Sozialismus“ also auf der Basis von kapitalistischer Verschuldung? Die eiserne Hand der kapitalistischen Gesetze wird schnell zurückschlagen und den „Weg zum Sozialismus“ von Chavez steinig machen. Ausbaden wird es wohl die Arbeiterklasse.
Als Letztes wollen wir der Aussenpolitik der Chavez-Regierung kurz unsere Aufmerksamkeit widmen.
Vor ungefähr einem Monat machten zwei wichtige Häupter in der lateinamerikanischen Politik zur selben Zeit, aber jeder für sich, eine mehrtägige Besuchstour durch verschiedene Länder Lateinamerikas: Der US-Präsident Gorge Bush und Hugo Chavez. Der eine buchstäblich nach rechts rum im Kreise, der andere links rum. Die USA sind zweifellos diejenige Macht, welche von außen her den größten Einfluss in Lateinamerika hat. Jahrzehntelang hatten sich die USA und Russland auf diesem Kontinent in den Haaren gelegen und blutige Stellvertreterkriege geführt. Unterlegen ist Ende der 80er Jahre der russische Block durch seinen ruhmlosen Zusammenbruch. In Lateinamerika besteht eine lange Tradition des nationalistischen Widerstandes gegen den Einfluss der US-amerikanischen „Gringos“: Che Guevara, Fidel Castros Cuba, die Sandinisten in Nicaragua oder Dutzende von Guerillabewegungen. Der so genannte „Anti-Imperialismus“ aber wurde damals immer tatkräftig unterstützt durch den damals mächtigen russischen Imperialismus.
Hugo Chavez und seine Regierung treten heute auf ihrem Weg in die Fußstapfen dieses „Antiimperialismus“. „Leg dich nicht an mit mir, Mädchen!“ sagte Chavez zur amerikanischen Außenministerin Condoleeca Rice. Eines der wichtigsten politischen Projekte der Chavez-Regierung ist es, den Einfluss der USA in Lateinamerika zurückzudrängen. Dies war in den letzten Jahren auch tatsächlich von Erfolg gekrönt. Chavez hat seine Freunde in anderen Staatschefs gefunden: Lula in Brasilien, Ortega in Nicaragua, Correa in Equador und selbstverständlich den Castros in Kuba.
Der Spielraum, den Einfluss der USA zurückzudrängen, ist in den letzten Jahren durch die Krise der US-amerikanischen Außenpolitik, welche im Irakischen Debakel versinkt, zweifellos größer geworden.
Eine lateinamerikanische Front gegen die „Gringos“ zu schmieden ist Chavez sicher gelungen. Also auch wieder Taten statt Worte! Der Anti-Amerikanismus ist heute eine der wichtigsten Stützpfeiler der venezolanischen Regierung. Angesichts dessen, dass die USA seit Beginn des 20. Jahrhunderts definitiv zu einem der mächtigsten Staaten geworden sind und seither durch Kriege in aller Welt eine grausame imperialistische Politik betreiben, verbindet bei vielen Menschen den Begriff Imperialismus direkt mit den USA.
Doch wir hatten uns zu Beginn ja eine andere Frage gestellt als diejenige, welche Seite im Gerangel unter kapitalistischen Staaten die bessere sei! Wir wollen heute in dieser Diskussionsveranstaltung klären, ob der „Weg zum Sozialismus“ durch die Politik von Chavez eröffnet wird.
Es gibt noch andere Fronten gegen die „Gringos“, so zum Beispiel auf wirtschaftlicher Ebene die EU.
Und es gibt auch andere Regierungen oder politische Gruppen außer Chavez, welche pointiert anti-amerikanische Propaganda machen: Nicolas Sarkozy und seine Regierung in Frankreich, die Herrschenden in Nordkorea oder im Iran, die Hamas und Al-Kaida im Nahen Osten und im Irak, usw. Doch mit einem „Weg zum Sozialismus“ haben sie wohl kaum etwas zu tun!
Ob es also ein „Weg zum Sozialismus“ ist, die Arbeiterklasse für „Fronten gegen die USA“ zu mobilisieren, ist eine weitere Frage!
Soweit einige Gedanken der IKS. Und nun sind wir gespannt, was Ihr dazu denkt!
Geographisch:
- Venezuela [77]
Erbe der kommunistischen Linke:
- "Selbstverwaltung" [59]
Spontane Arbeitsniederlegungen bei Airbus-Frankreich
- 2701 reads
Zum Zeitpunkt der Drucklegung unserer Zeitung und am Tag nach der ersten Runde der Präsidentenwahlen in Frankreich, erfahren wir, dass die Beschäftigten bei Airbus erneut ihre Wut über die Angriffe des Kapitals zum Ausdruck gebracht haben.
Am Mittwoch, den 25. April, kündigte das Airbus-Management eine Prämienerhöhung für dieses Jahr von 2.88 Euro (!) an. (1)
Mit dem Gefühl, dass sie wie Hunde behandelt wurden, denen man ein paar Abfälle vorwarf, reagierten die Airbus-Beschäftigten sofort. Ausgehend von Toulouse nahmen die Arbeiter in den Fertigungshallen den Kampf auf. An einem Fließband wurde spontan und ohne Vorwarnung die Arbeit niedergelegt. Dann zogen die Arbeiter zu den anderen Abteilungen und forderten sie auf, mit ihnen zur Firmenleitung zu gehen. Von einer Abteilung zur anderen wuchs die Entschlossenheit, sich nicht über den Tisch ziehen zu lassen
Spontane Arbeitsniederlegungen bei Airbus – Frankreich
Arbeiter verschaffen sich Gehör Zum Zeitpunkt der Drucklegung unserer Zeitung und am Tag nach der ersten Runde der Präsidentenwahlen in Frankreich, erfahren wir, dass die Beschäftigten bei Airbus erneut ihre Wut über die Angriffe des Kapitals zum Ausdruck gebracht haben. Am Mittwoch, den 25. April, kündigte das Airbus-Management eine Prämienerhöhung für dieses Jahr von 2.88 Euro (!) an. (1) Mit dem Gefühl, dass sie wie Hunde behandelt wurden, denen man ein paar Abfälle vorwarf, reagierten die Airbus-Beschäftigten sofort. Ausgehend von Toulouse nahmen die Arbeiter in den Fertigungshallen den Kampf auf. An einem Fließband wurde spontan und ohne Vorwarnung die Arbeit niedergelegt. Dann zogen die Arbeiter zu den anderen Abteilungen und forderten sie auf, mit ihnen zur Firmenleitung zu gehen. Von einer Abteilung zur anderen wuchs die Entschlossenheit, sich nicht über den Tisch ziehen zu lassen. Ein Arbeiter schilderte folgendes: „Als ich gestern um 6.00 h eintraf, hatten alle in meiner Abteilung von der 2.88 Euro Prämie erfahren. Die Kollegen weigerten sich weiter zu arbeiten, sie legten spontan die Arbeit nieder. Die ganze Fließbandfertigung wurde stillgelegt.“ Und dieser Streikende betonte, dass es sich um eine spontane Reaktion handelte, die gegen die Ansicht der Gewerkschaften stattfand. „Ein offizieller Gewerkschaftsvertreter sprach mit uns und versuchte uns zur Wiederaufnahme der Arbeit zu bewegen; er meinte uns versichern zu können, die symbolische Handlung dieser Bewegung sei wahrgenommen worden, aber jetzt sei es besser wieder die Arbeit aufzunehmen“. Diese Zeugenaussage beweist, dass die Gewerkschaften geschickte Saboteure des Kampfes sind, und dass die Arbeiter mehr und mehr dazu gezwungen werden, auf sich selbst zu bauen, wenn sie sich wehren wollen. So versuchte ein Gewerkschaftsvertreter, der sehr besorgt war, die Kontrolle über die Lage zu verlieren, seine Gewerkschaft diskret über das Ausmaß der Kampfbereitschaft zu informieren und forderte sie indirekt auf, sich zu beruhigen. „Diese Aktion war keine Initiative der Gewerkschaften. Wir müssen aufpassen, was wir tun“.
Das gleiche Szenario in St Nazaire und Nantes. Auch hier war die Empörung groß. Die Arbeiter traten in die Fußstapfen ihrer Kollegen in Toulouse, indem sie auch wild streikten. Sie verließen massenhaft das Fabrikgelände, um die Fabriktore zu blockieren. Auch dieser Schritt wurde ohne und gar gegen die Zustimmung der Gewerkschaften vollzogen.
„Diese Initiative ging von keiner Gewerkschaft aus. Sie ist darauf zurückzuführen, dass die Arbeiter die Schnauze voll haben“ – berichtete ein Arbeiter den Medien. In beiden Werken wurde die Ankündigung dieser lächerlich geringen Prämienzahlung als eine Beleidigung aufgefasst, die wie ein Hohn auf all den Druck und das Leiden, das die Arbeit hervorruft, wirkt. „Man verlangt von uns, samstags Überstunden zu machen, obwohl sie keine Neueinstellungen vornehmen und die Verträge von Beschäftigten mit Zeitverträgen werden nicht erneuert“. 2.88 Euro – innerhalb weniger Stunden wurde diese Zahl zu einem Symbol der unmenschlichen Bedingungen der Arbeiter.
Natürlich haben die Gewerkschaften in Toulouse wie in St Nazaire, obwohl sie den Ausbruch der Wut der Arbeiter nicht verhindern konnten, sehr schnell wieder die Lage in den Griff bekommen, indem sie sich der Bewegung „anschlossen“. So bemerkte ein Beschäftigter des Toulouser Werkes: „einige Stunden später, vor der Mittagspause, hatte die Gewerkschaft FO (Force Ouvrière) eine Scheinarbeitsniederlegung organisiert, wobei sie aber sorgfältig vermieden, alle Arbeiter aufzufordern, sich daran zu beteiligen“.
Indem sie sich gemeinsam gegen ihre Ausbeuter zur Wehr setzten, sich weigerten, wie Vieh behandelt zu werden, haben die Airbus-Beschäftigten gezeigt, dass sie ihre Würde verteidigen. Sie haben klar gezeigt: In Anbetracht der endlosen Angriffe durch die Arbeitgeber und den Staat gibt es keine andere Lösung als den gemeinsamen Kampf. Trotz all der Spaltungsmanöver seitens der Herrschenden, die darauf abzielen, die Beschäftigten gegeneinander auszuspielen, ist die soziale Lage geprägt durch eine wachsende Tendenz hin zu aktiver Solidarität unter den Arbeitern. Ein Beschäftigter in St Nazaire meinte ausdrücklich: “Wir wollen uns mit der Bewegung in Toulouse solidarisieren". Indem sie von einer Abteilung und von einer Fertigungshalle zur anderen zogen, schließlich von Werk zu Werk, belegt diese Reaktion der Beschäftigten von Airbus, dass die gesamte Arbeiterklasse nur einen Weg einschlagen kann, um gegenüber den zahllosen Provokationen der Herrschenden zu reagieren. Erneut wurde deutlich, dass die Gewerkchaften ein Organ der kapitalistischen Disziplinierung sind. In den nächsten Monaten und Jahren werden die Arbeiter keine andere Wahl haben als sich der Sabotage der Gewerkschaften entgegenzustellen, um ihre Einheit und Solidarität als Klasse zu entfalten.
Schließlich zeigen diese Wutausbrüche bei Airbus (sowie die zahlreichen kleineren Streiks in der Automobilbranche, bei der Post und im Erziehungswesen), dass trotz des ganzen Wahlspektakels und des “Triumpfes der Demokratie” es keinen Waffenstillstand im Klassenkampf gibt. Beatrice 28.4.07 (Artikel aus der Presse der Internationalen Kommunistischen Strömung in Frankreich – www.internationalism.org [29])
(1) Diese besonders skandalöse Ankündigung könnte als Provokation aufgefasst werden, um die Ankündigung vom 27.April der Details des Arbeitsplatzabbaus in den Werken in den Hintergrund zu drängen. Nichtsdestotrotz ist diese spontane Reaktion exemplarisch.
Ägypten: Keime des Massenstreiks
- 3932 reads
In Worldrevolution 302 haben wir über eine Streikwelle berichtet, die zu Jahresbeginn über zahlreiche Sektoren in Ägypten schwappte: In Zement- und Geflügelbetrieben, in Bergwerken, bei den öffentlichen Verkehrsbetrieben wie Bus und Bahn, im Reinigungssektor und vor allem in der Textilindustrie setzten sich die Arbeiterinnen und Arbeiter mit einer Serie von illegalen Streiks gegen das massive Senken des realen Lohns und die enormen Kürzungen der Zulagen zur Wehr. Einen Einblick in das kämpferische und spontane Wesen dieser Kämpfe kann man durch den unten stehenden Bericht erhalten, der schildert, wie im letzten Dezember der Streik in dem großen Spinnerei-und Weberei-Komplex von Mahalla al-Kubra Misr nördlich von Kairo ausbrach. Dieser Komplex bildete das Epizentrum der Kämpfe. Der Auszug entstammt dem von Joel Beinin und Hossam el-Hamamawy verfassten Bericht „Ägyptische TextilarbeiterInnen konfrontieren die neue wirtschaftliche Ordnung“, der im Internet auf Middle East Report Online und auf libcom.org veröffentlicht wurde. Er basiert auf Interviews mit zwei Arbeitern der Fabrik, Muhammed ´Attar und Sayyid Habib.
„Die 24.000 Arbeiterinnen und Arbeiter des Spinnerei-und-Weberei-Komplexes von Mahalla al-Kubra Misr waren begeistert, als sie am 3. März 2006 die Nachricht erhielten, dass der Premierminister Ahmad Nazif einen Anstieg der jährlichen Zulagen für alle gewerblichen Beschäftigten im staatlichen Sektor von den gegenwärtigen 100 Ägyptischen Pfund (17$) auf zwei Monatslöhne verordnet hatte. Die jährlichen Zulagen waren zuletzt 1984 angehoben worden, damals von 75 auf 100 Pfund.
‚Wir lasen die Verordnung und begannen unverzüglich diese Neuigkeit im Betrieb zu verbreiten,‘ sagt ´Attar. ‚Ironischerweise veröffentlichten sogar die regierungsfreundlichen Gewerkschaftsfunktionäre diese Nachricht als eine ihrer Errungenschaften.‘ Und er fährt fort: ‚Als der Dezember kam (in dem die jährlichen Zulagen ausbezahlt werden), waren alle gespannt. Dann entdeckten wir, dass man uns hintergangen hatte. Sie boten uns nur die gleichen alten 100 Pfund. Genau genommen waren es sogar nur 89 Pfund, denn die Abzüge [für Steuern] fallen ja noch an.‘
Ein kämpferischer Geist lag in der Luft. In den nächsten zwei Tagen verweigerten ganze Gruppen von ArbeiterInnen aus Protest die Annahme ihrer Löhne. Dann, am 7. Dezember 2006, begannen die ArbeiterInnen der Frühschicht sich auf Mahallas Tal`at Harb-Platz zu versammeln, der vor dem Fabrikeingang liegt. Das Arbeitstempo war zwar bereits verlangsamt worden, aber die Produktion kam erst zum Stillstand, als etwa 3.000 Arbeiterinnen der Bekleidungsindustrie ihre Betriebe verließen und zu den Spinnerei- und Webereibetrieben herübermarschierten, wo ihre Kollegen die Maschinen noch nicht abgeschaltet hatten. Die Arbeiterinnen stürmten hinein und riefen: ‚Wo sind die Männer? Hier sind die Frauen!‘ Beschämt schlossen sich die Männer dem Streik an.
Nun versammelten sich etwa 10.000 ArbeiterInnen auf dem Platz und skandierten: ‚Zwei Monate! Zwei Monate!‘, um ihrem Anspruch auf die versprochenen Zulagen Nachdruck zu verleihen. Die schwarz gekleideten Sondereinheiten der Polizei wurden rasch um die Fabrik und in der ganzen Stadt aufgestellt, aber sie taten nichts, um den Protest niederzuschlagen. ‚Sie waren zu schockiert, als sie sahen, wie viele wir waren‘, sagt `Attar. ‚Sie hatten die Hoffnung, dass wir uns bis Einbruch der Nacht oder spätestens bis zum nächsten Tag auflösen würden.‘ Auf Anregung des Staatsschutzes bot das Management schließlich eine Zulage von 21 Tagen Lohn an. ‚Aber‘, wie sich `Attar sich lachend erinnert, ‚die Arbeiterinnen rissen jeden Vertreter vom Management, der zum Verhandeln kam, beinahe in Stücke.‘
‚Als die Nacht hereinbrach‘, sagt Sayyid Habib, ‚hatten die Arbeiter Schwierigkeiten, die Arbeiterinnen davon zu überzeugen, heimzugehen. Letztere wollten bleiben und in der Fabrik übernachten. Erst nach Stunden gelang es uns, sie davon zu überzeugen, zu ihren Familien nach Hause zu gehen und am folgenden Tagen wiederzukommen.‘ Breit grinsend fügt `Attar hinzu: ‚Die Frauen waren viel kämpferischer als die Männer. Obwohl sie Einschüchterungsversuchen und Drohungen ausgesetzt waren, hielten sie allem stand.‘
Noch vor den Morgengebeten drang das Sonderkommando der Polizei in die Fabrik ein. 70 Arbeiter, unter ihnen auch `Attar und Habib, schliefen noch in der Fabrik, wo sie sich eingeschlossen hatten. ‚Die Staatssicherheitleute sagten uns, wir seien nur wenige, und dass wir uns besser ergeben sollten‘, sagte `Attar. ‚Tatsächlich aber wussten sie nicht, wie viele von uns drinnen waren. Wir logen und behaupteten, wir seien Tausende. `Attar und Habib weckten schnell ihre Kollegen und gemeinsam begannen die Arbeiter dann so laut es ging, gegen die Eisentonnen zu hämmern. ‚So weckten wir alle in der Firma, aber auch in der Stadt. Bald hatten wir kein Guthaben mehr auf unseren Handys, weil wir alle unsere Familien und Freunde draußen anriefen und baten, sie sollten ihre Fenster öffnen und so den Staatsschutz wissen lassen, dass er beobachtet wird. Zudem riefen wir alle ArbeiterInnen, die wir kannten, dazu auf, so schnell wie möglich zur Fabrik zu kommen.‘
Bis dahin hatte die Polizei bereits das Wasser und den Strom in der Fabrik abgeschaltet. Staatliche Agenten hasteten zu den Bahnhöfen, um den aus der Stadt kommenden ArbeiterInnen zu erzählen, dass die Fabrik auf Grund eines elektrischen Kurzschlusses geschlossen worden sei. Diese List schlug jedoch fehl.
‚Mehr als 20.000 ArbeiterInnen erschienen‘, sagt `Attar. ‚Wir organisierten eine riesige Demonstration und inszenierten Scheinbeerdigungen für unsere Chefs. Die Frauen brachten uns Essen und Zigaretten und schlossen sich dem Demonstrationszug an. Die Sicherheitskräfte wagten es nicht einzugreifen. Schülerinnen und Schüler von den nahe gelegenen Grundschulen und weiterführenden Schulen gingen ebenfalls auf die Straße, um die Streikenden zu unterstützen.‘ Am vierten Tag der Werksbesetzung boten die inzwischen panischen Regierungsvertreter den Streikenden eine Zulage in Höhe von 45 Tageslöhnen an und versicherten, dass der Betrieb nicht privatisiert werde. Der Streik wurde nun ausgesetzt, nachdem die von der Regierung kontrollierte Gewerkschaftsföderation durch den Erfolg der nicht autorisierten Aktionen der ArbeiterInnen der Misr-Spinnerei und Weberei gedemütigt worden war.“
Der Sieg bei Mahalla inspirierte auch zahlreiche andere Sektoren, in den Streik einzutreten, und bis heute ist die Bewegung weit entfernt davon nachzulassen. Im April brach erneut eine Auseinandersetzung zwischen den Mahalla-ArbeiterInnen und dem Staat aus. Die ArbeiterInnen hatten nämlich beschlossen, eine große Delegation nach Kairo zu entsenden, um mit der Zentrale der Allgemeinen Förderation der Gewerkschaften über Lohnforderungen zu verhandeln (!) und um die Anschuldigungen gegen das Gewerkschaftskommitee der Mahalla-Fabrik weiter aufrechtzuerhalten, da dieses während des Dezemberstreiks die Firmenchefs unterstützt hatte. Die Antwort des Staatsschutzes war die Umstellung der Fabrik. Daraufhin traten die ArbeiterInnen aus Protest in den Streik und zwei weitere große Textilfabriken erklärten ihre Solidarität mit Mahalla: Ghazl Shebeen und Kafr el-Dawwar. Das Solidaritätsschreiben Letzterer war besonders beeindruckend und klar:
Die ArbeiterInnen von Kafr el-Dawwar sitzen im gleichen Boot wie die von Ghazl el-Mahalla
„Wir, die ArbeiterInnen von Kafr el-Dawwar, verkünden unsere ganze Solidarität mit euch; auf, dass ihr eure gerechtfertigten Forderungen durchsetzt, welche die gleichen sind wie die unsrigen. Wir verurteilen aufs Schärfste die Sicherheitsoffensive, welche die ArbeiterInnendelegation von Mahalla daran hinderte, zu Verhandlungen mit der Allgemeinen Föderation der Gewerkschaften in Kairo anzureisen. Außerdem verurteilen wir die Stellungnahme von Said el-Gohary an Al-Masry Al-Youm vom letzten Sonntag, wo er euren Schritt als ‚Unsinn‘ bezeichnete. Wir verfolgen mit großer Anteilnahme, was euch widerfährt, und verkünden unsere Solidarität mit dem Streik der ArbeiterInnen der Bekleidungsindustrie vorgestern und dem Streik in Teilen der Seidenfabrik.
Uns ist wichtig, dass ihr wisst, dass wir ArbeiterInnen von Kafr el-Dawwar und ihr, die ArbeiterInnen von Mahalla, zusammenstehen und einen gemeinsamen Feind haben. Wir unterstützen euren Kampf, weil wir die gleichen Forderungen haben. Seit dem Ende eures Streiks in der ersten Februarwoche hat die Betriebsabteilung der Gewerkschaft nichts getan, um unsere Forderungen durchzusetzen, die wir in unserem Streik vorgebracht haben. Im Gegenteil, sie haben unseren Interessen geschadet (…) Wir wollen unsere Unterstützung für eure Forderungen nach Reformierung der Löhne zum Ausdruck bringen. Wir, ebenso wie ihr, sind schon gespannt, ob Ende April die Arbeitsministerin unsere diesbezüglichen Forderungen in die Tat umsetzen wird oder nicht. Allerdings setzen wir nicht viele Hoffnungen in die Ministerin, da wir weder von ihr noch von der Betriebsabteilung der Gewerkschaft irgendeine Regung gesehen haben. Wir werden uns nur auf uns selbst verlassen können, um unsere Forderungen durchzusetzen.
Daher betonen wir:
-
Wir sitzen im gleichen Boot mit euch und werden zur gleichen Reise mit euch aufbrechen
-
Wir erklären unsere volle Solidarität mit euren Forderungen und bekräftigen, dass wir bereit stehen, solidarische Aktionen auszuführen, solltet ihr euch zum Arbeitskampf entschließen
-
Wir werden die ArbeiterInnen von Artificial Silk, El-Beida Dyes und Misr Chemicals über euren Kampf informieren, um so Brückenköpfe zur Ausweitung unserer solidarischen Front zu errichten. Alle ArbeiterInnen sind in Zeiten des Kampfes Brüder und Schwestern.
-
Wir müssen eine breite Front errichten, um eine Entscheidung in unserem Kampf gegen die staatlichen Gewerkschaften zu unseren Gunsten zu erreichen. Wie müssen diese Gewerkschaften heute überwinden und nicht erst morgen.“ (Übersetzung von der Arabawy Webseite und auf Englisch zuerst veröffentlicht bei libcom.org)
Dies ist eine exzellente Stellungnahme, denn sie verdeutlicht die grundlegende Basis jeglicher wirklichen Klassensolidarität über alle Berufs- und Betriebsgrenzen hinweg – das Bewusstsein, derselben Klasse anzugehören und den gleichen Feind zu bekämpfen. Zudem ist diese Stellungnahme beeindruckend klar hinsichtlich der Notwendigkeit, den Kampf gegen die staatlichen Gewerkschaften aufzunehmen.
Auch anderswo brachen in dieser Zeit Kämpfe aus: So stürmten etwa die Müllarbeiter in Giza aus Protest die Firmenzentrale, da ihre Löhne nicht ausgezahlt worden waren; 2.700 TextilarbeiterInnen besetzten eine Textilfabrik in Monofiya; 4.000 TextilarbeiterInnen streikten ein zweites Mal, nachdem das Management versucht hatte, die Lohnauszahlungen wegen des ersten Streiks zu kürzen. Auch dies waren illegale, inoffizielle Streiks.
Zudem hat es auch andere Versuche gegeben, Arbeitskämpfe mittels Gewalt zu brechen. Die Sicherheitspolizei schloss oder drohte mit der Schließung von ‚Zentren der Gewerkschaften und der Arbeiterdienste‘ in Nagas Hammadi, Helwan und Mahalla. Den Zentren wurde vorgeworfen, „eine Kultur des Streiks“ zu pflegen.
Die Existenz solcher Zentren deutet bereits an, dass es klare Anstrengungen gibt, neue Gewerkschaften aufzubauen. Es wird sich wohl kaum vermeiden lassen, dass in einem Land wie Ägypten, wo die ArbeiterInnen bisher nur mit Gewerkschaften konfrontiert waren, die offen als Polizei im Betrieb auftreten, die besonders kämpferischen Arbeiterinnen und Arbeiter für die Idee zugänglich sein werden, dass die Antwort auf ihre Probleme in der Gründung wirklich „unabhängiger“ Gewerkschaften liege; ähnlich, wie es damals, 1980-81, die polnischen ArbeiterInnen dachten. Die Art und Weise, wie der Streik bei Mahalla organisiert wurde (d.h. spontane Demonstrationsmärsche, massive Delegationen und Versammlungen an den Werkstoren), macht jedoch deutlich, dass die ArbeiterInnen am stärksten sind, wenn sie ihre Interessen selbst in die Hände nehmen, statt ihre Macht an einen neuen Gewerkschaftsapparat zu übergeben.
In Ägypten zeigten sich bereits deutlich die Keime des Massenstreiks, nicht nur durch die Fähigkeit der ArbeiterInnen, sich massenhaft und spontan zu organisieren, sondern auch durch das hohe Niveau des Klassenbewusstseins, wie es in dem Solidaritätsschreiben von Kafr el-Dawwar zum Ausdruck kommt.
Bis jetzt ist noch keine bewusste Verknüpfung zwischen diesen Ereignissen und anderen Kämpfen auf den verschiedenen Seiten der imperialistischen Spannungslinien des Nahen Ostens erkennbar. So gab es Streiks von Hafenarbeitern und Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Israel und kürzlich auch unter Lehrern für Lohnerhöhungen, wie auch von Studenten, welche in Demonstrationszügen gegen die Erhöhung der Studiengebühren die Polizei konfrontierten. Des Weiteren unterbrachen Tausende von Arbeitern die offiziellen, staatlich organisierten 1.Mai-Kundgebungen im Iran, indem sie regierungskritische Losungen anstimmten sowie an nicht genehmigten Kundgebungen teilnahmen und sich daher bald massiver Polizeirepression ausgesetzt sahen. Die Gleichzeitigkeit dieser Bewegungen jedoch entspringt in jedem Fall der gleichen Quelle – dem Drang des Kapitalismus, die Arbeiterklasse weltweit in großes Elend zu stürzen. In diesem Sinne tragen alle diese Kämpfe die Keime für die zukünftige internationalistische Einheit der Arbeiterklasse in der ganzen Welt in sich, durch welche alle Mauern des Nationalismus, der Religionen und der imperialistischen Kriege eingerissen werden.
(aus Worldrevolution, IKS-Zeitung in GB; Mai 2007)
Geographisch:
- Afrika [27]
Theoretische Fragen:
- Arbeiterklasse [58]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Proletarischer Kampf [37]
Juni 2007
- 752 reads
Bilanz des G-8-Gipfels: Das Rütteln am Zaun
- 2744 reads
Der G8-Gipfel in Heiligendamm ist zu Ende. Zeit, Bilanz zu ziehen. Eine Bilanz des Gipfels wie auch der Gipfelproteste. Was haben sie gebracht? Das Unbehagen der Mächtigen
Das Gipfeltreffen der Mächtigen hat – vom Standpunkt der Regierenden selbst betrachtet – einen verheerenden Eindruck hinterlassen. Das letzte Mal, als die Regierungchefs der führenden Industrieländer in Deutschland zusammenkamen – damals in Köln –, speisten sie im Schatten des Kölner Doms, im Herzen der Innenstadt. Heute undenkbar. Heutzutage treffen sie sich in der Abgeschiedenheit eines in Vergessenheit geratenen mecklenburgischen Ostseebades und müssen sich dennoch hinter Verteidigungslinien verschanzen. Nichts könnte eindrücklicher den Verlust an Ansehen und Popularität der demokratisch gewählten „world leaders“ in den Augen der eigenen Bevölkerungen verdeutlichen.
Der G8-Gipfel in Heiligendamm ist zu Ende. Zeit, Bilanz zu ziehen. Eine Bilanz des Gipfels wie auch der Gipfelproteste. Was haben sie gebracht? Das Unbehagen der Mächtigen
Das Gipfeltreffen der Mächtigen hat – vom Standpunkt der Regierenden selbst betrachtet – einen verheerenden Eindruck hinterlassen. Das letzte Mal, als die Regierungchefs der führenden Industrieländer in Deutschland zusammenkamen – damals in Köln –, speisten sie im Schatten des Kölner Doms, im Herzen der Innenstadt. Heute undenkbar. Heutzutage treffen sie sich in der Abgeschiedenheit eines in Vergessenheit geratenen mecklenburgischen Ostseebades und müssen sich dennoch hinter Verteidigungslinien verschanzen. Nichts könnte eindrücklicher den Verlust an Ansehen und Popularität der demokratisch gewählten „world leaders“ in den Augen der eigenen Bevölkerungen verdeutlichen.
Die Maßnahmen, die getroffen wurden, um die Sicherheit der Herrschenden zu garantieren, riefen in der ganze Welt üble Assoziationen hervor. Der millionenteure, zwölf Kilometer lange Sicherheitszaun mit „NATO-Stacheldraht“ erinnerte manchen an die Berliner Mauer, andere an die Sperranlagen der US-Grenze zu Mexiko oder an die Demarkationslinien der Kriegsparteien in Nordirland oder zwischen Israel und Palästina. Die Entnahme von „Geruchsproben“ „potenzieller Verbrecher“ im Vorfeld des Gipfels, um sie speziell abgerichteten Polizeihunden zuzuführen, belebte eine altbewährte Methode der ostdeutschen Staatssicherheit wieder. Was die Einsperrung Hunderter von Demonstranten in Käfigen nach der Demonstration vom 2. Juni in Rostock betrifft – wo sie die Nacht über ohne Kontakt zu ihren Anwälten und überhaupt zur Außenwelt festgehalten und bei ununterbrochener Beleuchtung wachgehalten und gefilmt wurden –, so musste jeder unwillkürlich an Guantanamo denken. Haben nicht die führenden Repräsentanten der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union jahrelang gegen die menschenunwürdige Unterbringung und Behandlung der Gefangenen in Guantanamo durch die Vereinigten Staaten protestiert? Die Tatsache, dass jetzt mitten in Europa Gefangene ebenfalls in Käfige eingesperrt werden, wirft ein anderes Licht auf diese Proteste. Es wird deutlich: Was die Führer Europas missbilligen wollten, war nicht die Unmenschlichkeit, sondern die in Guantanamo zum Ausdruck gekommene Machtdemonstration der USA.
Und tatsächlich: in Heiligendamm ist nicht nur der Ansehensverlust der Mächtigen der Industriestaaten und ihre Angst vor der eigenen Bevölkerung sichtbar geworden, sondern auch ihre Zerstrittenheit. Während die Sprecher von ATTAC und die Anführer der „künstlerischen Opposition“ wie Campino oder Grönemeyer die G8 als eine Art Weltregierung bezeichnen, knisterten die tödlichen Rivalitäten der führenden Industrieländer kaum verborgen unter der Oberfläche. So versuchte Russlands Präsidenten Putin, das amerikanische Vorhaben zu torpedieren, ein Raketenabwehrsystem in Osteuropa aufzubauen. Er tat so, als schenkte er den Beteuerungen Washingtons Glauben, dieses amerikanische Abwehrschild richte sich vornehmlich gegen den Iran, und schlug Bush vor, dieses System gemeinsam in Aserbaidschan (in unmittelbarer Nachbarschaft zum Iran also) zu errichten. Bush zeigte sich - nachdem er sich von einer plötzlichen Magenverstimmung erholt hatte - „offen“ und „interessiert“. Doch sobald der G8-Gipfel beendet war, eilte er nach Warschau, um zu versichern, dass der Abwehrschild auf jeden Fall dort errichtet werden soll. Hintergrund dieser pikanten Geschichte: vorausgesetzt, es funktioniert tatsächlich, würde dieses Militärprojekt die Vereinigten Staaten in die Lage versetzen, die Raketenarsenale aller anderen Staaten zu neutralisieren. Damit würden die USA ihre militärische Überlegenheit erheblich ausbauen, auch gegenüber anderen G8-Staaten wie Russland, Frankreich oder Großbritannien.
Aber nicht nur die Zerstrittenheit – genauer gesagt: die kapitalistischen Interessensgegensätze und die imperialistischen Rivalitäten – der führenden Industrieländer wurde sichtbar, sondern auch und noch mehr ihre Unfähigkeit, Antworten auf die großen Schicksalsfragen der Gegenwart zu finden. Gerade weil die Augen der Welt auf Heiligendamm gerichtet waren und gerade wegen der peinlichen Verschanzung der „Volksvertreter“ mussten die Gipfelteilnehmer darauf bedacht sein, jeden Eindruck eines Scheiterns dieses Gipfels zu vermeiden. Es war eher diesem „Erfolgsdruck“ als der Gipfeldiplomatie von Frau Merkel (der von einem deutschen Revolverblatt der Titel „unsere Miss World“ verliehen wurde) zu verdanken, dass Bush sich in der Klimafrage auf die Position der Europäer hinzubewegte und die Vereinten Nationen als „Dachorganisation“ der Klimapolitik nicht mehr prinzipiell ausschließt! Was kam dabei heraus? Eine Absichtserklärung, derzufolge die G8 „ernsthaft in Betracht zieht“, Maßnahmen zu ergreifen, um den Anstieg der Klimaerwärmung auf zwei Grad Celsius zu begrenzen. Wenn nicht der Gipfel von Heiligendamm, so wird wenigstens diese Formulierung in die Geschichte eingehen. Eines Tages werden sich vielleicht die ehemaligen Bewohner längst versunkener Küstenregionen daran erinnern.
Die Ohnmacht des schwarzen Blocks
Wie ein Überbleibsel aus einer längst versunkenen Welt wirkte die Kulisse des einst mondänen Seebads von Heiligendamm. Die Weltführer zeigten sich hinter ihrem Zaun zerstritten und zur planvollen Umgestaltung der Welt unfähig. Hatten sie wirklich so viel Angst vor einigen zehntausend Protestierenden? Kamen sie sich nicht ein wenig lächerlich vor?
Polizeitechnisch betrachtet, wäre es ein Leichtes gewesen, sich die Demonstranten auch ohne Zaun vom Halse zu schaffen. Das Sicherheitsproblem dieses Gipfels war nicht so sehr militärischer als politischer Natur. Wie die Protestierenden zur „Räson“ bringen, ohne das sinkende Ansehen der Regierungen in der Bevölkerung noch mehr zu schädigen? Soll heißen: Wie diejenigen einschüchtern, die es wagen, das System zu hinterfragen, ohne die diktatorische Fratze der parlamentarischen Demokratie sichtbar werden zu lassen?
Dieses Problem erwies sich als lösbar. Erheblich dazu beigetragen hat die politische Unbeholfenheit des „schwarzen Blocks“. Dabei stellen wir die antikapitalistischen Absichten der großen Mehrheit der autonomen Szene keineswegs in Frage. Aber der Weg zur Hölle ist bekanntlich mit guten Absichten gepflastert. Die großen Schwächen dieses Milieus sind die Theoriefeindlichkeit und die Gewaltverherrlichung. Diese Grundauffassungen teilt dieses Milieu leider mit manch anderer politischen Bewegung, die keineswegs antikapitalistisch eingestellt ist. Denn es ist ein Irrtum zu glauben, dass die Gewalt an sich revolutionär oder auch nur radikal ist. In diesen Irrtum gefangen, begriff der schwarze Block nicht, dass das Unbehagen der Regierenden von Heiligendamm nicht polizeilicher, sondern politischer Natur war. Die Staatsmacht suchte nach einem Vorwand für den eigenen Einsatz von Gewalt. Dazu war es lediglich nötig, die am 2. Juni nach Rostock zur Auftaktdemo Anreisenden kaum zu kontrollieren und den schwarzen Block ohne die übliche massive Polizeieinkesselung marschieren zu lassen. Provokateure unter den vermummten Demonstranten mögen das Ihre beigetragen haben, um eine Eskalation der Gewalt in Gang zu setzen. Es reichte jedenfalls, um gegenüber den Medien aus aller Welt den Eindruck zu erwecken, als sei die Staatsmacht die wehrlose, angegriffene Partei. Die Demonstranten, die vor Ort waren, wissen es besser. Die ganz große Mehrheit der während dieser Gipfeltage festgenommenen und zusammengeschlagenen Menschen hat keine Gewalt ausgeübt, ja vielfach versucht, sie zu verhindern. Dabei ging es aber nicht nur darum, die Protestierenden ordentlich zu verdreschen. Es ging auch um die Frage, welche Bilder um die Welt gehen und die Wirkung des Gipfels auf die Bevölkerung prägen. Das Image von angeblich wehrlosen Polizisten lässt vielleicht den Eindruck des Zauns vergessen machen... Mehr noch: nicht nur vor Ort wird die wirkliche Frage verdrängt. Man diskutiert, wenn überhaupt, nur noch um die Frage, ob man „friedlich“ oder „gewaltsam“ protestieren soll. Die wirkliche Frage wird verdrängt: Wofür kämpft man?
Die Sackgasse der Antiglobalisierungsbewegung
Aber nicht nur die Vermeidung von Debatten über die Perspektive unsere Gesellschaft droht das Potenzial der Infragestellung des Systems zunichte zu machen. Auch die Ideologie der „Globalisierungsgegner“ selbst erwies sich erneut als Sackgasse.
Auffallend: aus ganz Deutschland, teilweise aus der ganzen Welt kommen Menschen zusammen, um gegen Verarmung und Ausbeutung zu protestieren. Sie kommen in eine Gegend, wo eine Erwerbsloslosenrate von über 20 Prozent herrscht - Mecklenburg-Vorpommern. Sie protestieren in einem Land, in dem Massenentlassungen, Werksschließungen, Ausgliederungen von Produktionsstätten, Lohnsenkungen und Arbeitszeitverlängerungen zum Alltag gehören. Gerade während des Gipfels streikten Zehntausende bei der Telekom gegen eine 12%-ige Lohnkürzung sowie eine – unbezahlte – Ausdehnung der Arbeitszeit um wöchentlich vier Stunden. Die Lage in Deutschland ist stellvertretend für die Entwicklung in allen G8-Ländern, ja in allen Industrieländern. Dennoch wurde bei den Anti-G8-Protesten zu keinem Zeitpunkt die Verarmung, die zunehmende Ausbeutung, sprich: die soziale Lage in den Industrieländern thematisiert. Nirgends wurde die Verbindung des Kampfes der Lohnabhängigen in den Industrieländern zum Kampf gegen globale Armut, Krieg und Umweltzerstörung hergestellt!
Wie erklärt sich diese verblüffende Unterlassung? Sie ist kein Zufall. Die Ideologie der Antiglobalisierung schließt eine solche Verbindung aus. Diese Ideologie, ein Kind der Zeit nach dem Fall der Mauer, rühmt sich ihres praktischen Charakters. Sie ist stolz darauf, angeblich keine neuen Ideologien zu predigen und keinen Utopien nachzuhängen. Dennoch ist und bleibt das Weltbild von ATTAC und Freunden eine Ideologie. Es teilt die Welt in zwei Lager ein, in das Lager der Industrieländer und in jenes der Armenhäuser dieser Welt, und behauptet, das Erstere lebe von der Ausbeutung des Letzteren. Diese Sichtweise verschließt sich gegenüber dem Kampf der arbeitenden Bevölkerung in den Industrieländern, indem sie diese Länder undifferenziert als privilegierte Zonen betrachtet, ohne den Klassencharakter dieser Gesellschaften selbst zu berücksichtigen. Andererseits betrachtet sie die Bevölkerung der Armutsländer ebenfalls als eine undifferenzierte Masse. So werden die arbeitenden Menschen dieser Länder mit ihren Ausbeutern vor Ort in ein Boot geschmissen. Sie werden zu passiven Opfern herabgestuft, die ausgerechnet auf die Hilfe der G8 angewiesen seien. So verschließt man die Augen vor der Notwendigkeit, aber auch der Möglichkeit des gemeinsamen Kampfes der Lohnabhängigen aller Länder, die den Kampf der Ausgebeuteten der ganzen Welt gegen die herrschende Weltordnung anführen können und müssen.
Zaun und Kapitalismus
Ein wenig unbeholfen wirkte diese waffenstarrende Welt von Heiligendamm angesichts des jugendlichen Elans und des aufkeimenden Idealismus einiger Zehntausend Protestierender, die nach Alternativen zum Kapitalismus suchen. Um zu versuchen, diese Unbeholfenheit zu überspielen, ließen die Mächtigen der Welt „Gegengipfel“ organisieren. Ein unter dem Dach der UNESCO stehender Gipfel der Kinder und Jugend ließ acht handverlesene Jugendliche mit den sichtlich genervten und desinteressierten Staatschefs „diskutieren“.
Die protestierende Jugend lief indessen unentwegt zum Zaun. Viele waren wirklich sehr jung. Und schon wenden sie sich angewidert von der herrschenden Weltordnung ab. Sie träumten davon, den Gipfel zu stören, zu blockieren. Sie wollten ihn sogar belagern. Sie wollten am Zaun rütteln. Eine Illusion. Die waffenstarrende Macht des Staates lässt sich nicht so leicht in die Enge treiben. Aber die aufrüttelnde Jugend hat etwas anderes erreicht, etwas, was mehr bedeutet. Sie haben diesen Zaun zum Symbol gemacht. Zum Symbol dieses Gipfels. Zum Symbol dieser Weltordnung. Die Menschheitsgeschichte lehrt uns, wie wichtig Symbole sind für die Entwicklung des Klassenkampfes. So die Erstürmung der fast leerstehenden, aber symbolträchtigen Bastille am Anfang der französische Revolution.
Was bedeutet heute der Zaun? Zäune weisen die Verzweifelten ab, die dort Zuflucht und menschlichen Beistand suchen, wo noch kein Krieg, keine Dürre oder Hungersnot herrscht. Zäune riegeln den Besitz der Herrschenden ab. Die Reichen riegeln ihre Wohlviertel immer mehr ab. Sie leben verbarrikadiert. Zäune bzw. Mauern trennen irrsinnig aufeinander gehetzte Volksgruppen auf dem Balkan oder im Nahen Osten. Andere, unsichtbare Zäune halten die Produkte aus anderen Weltgegenden ab.
Die linken Professoren und Politiker von ATTAC wettern gegen die Globalisierung. Aber die Jugend spürt, dass das Problem nicht die wachsende Globalität der Gesellschaft ist, sondern die Zäune. Einst brach der Kapitalismus auf, um die ganze Welt zu erobern. Dabei riss er alle chinesischen Mauern nieder, wie Marx und Engels im Kommunistischen Manifest schrieben. Aber er vereinigte die Menschheit nicht. Er schuf lediglich die Voraussetzungen dafür. Zugleich erhob er etwas zum Weltprinzip, auf dem letztlich alle Zäune der modernen Geschichte ruhen, ob der Stacheldraht von Auschwitz oder die Berliner Mauer: das Prinzip der Konkurrenz. Die Jugend von Heiligendamm hat Recht. Es gilt, alle Zäune niederzureißen. Der Zaun ist entstanden mit dem Privateigentum, der Keimzelle des modernen Kapitalismus. Diese Keimzelle hat sich zur beherrschenden Macht aufgeschwungen, zur Bedrohung der Menschheit. Die Überwindung des Zauns bedeutet in Wahrheit die Überwindung des Privateigentums von Produktionsmitteln. Sie bedeutet die Ablösung der Konkurrenzgesellschaft durch eine Welt der gemeinschaftlichen Produktion und der Solidarität. 13.06.07
Tarifrunde 2007: Der Lohnraub geht weiter
- 3192 reads
Deutschland im Jahr 2007: die Wirtschaft boomt, die Auftragsbücher sind prall gefüllt, die Exportindustrie schlägt ein Rekord nach dem anderen, und das Wirtschaftswachstum wird Monat für Monat immer höher prognostiziert. Auch der Finanzminister der Großen Koalition in Berlin hat Grund zum Jubeln: Nicht nur, dass die Maastrichter Schuldenkriterien um fast die Hälfte unterboten wurden; Steinbrück erwartet darüber hinaus fürs nächste Jahr gar einen schuldenfreien Haushalt. Doch je optimistischer die Meldungen von der Wirtschaftsfront, desto größer auch die Begehrlichkeiten. Vor allem die Gewerkschaften verkündeten vor den diesjährigen Tarifverhandlungen, dass die Jahre des Verzichts für die ArbeitnehmerInnen angesichts der Gewinne der Unternehmen vorüber seien. „Plus ist Muss“ war das Motto der IG Metall für die diesjährigen Tarifverhandlungen. Jahrelang habe man den Beschäftigten angesichts der Rezession und der schwächelnden Unternehmen eine Reduzierung ihrer Nettoeinkommen zugemutet. Nun, wo die Wirtschaft brummt und die Unternehmen Rekordgewinne einfahren, sei es nur zu gerecht, wenn auch die Beschäftigten ihren Anteil daran fordern.
Es scheint, als habe das Kapital ein Einsehen gehabt. Eine der größten und wichtigsten Wirtschaftsbranchen Deutschlands, die Metallindustrie, gewährte ihren Beschäftigten ohne größeren Widerstand eine Tariferhöhung, die so hoch wie lange nicht mehr ist: 4,1 Prozent in diesem Jahr und 1,7 Prozent im Juni 2008 incl. Einmalzahlungen. Es liegt auf der Hand, dass die IG Metall dies als einen Erfolg für uns Beschäftigte feierte. Hat sich doch nach ihrer Lesart ihre Politik bewährt: Zurückhaltung, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, und kräftig zulangen, wenn sie boomt. Doch wie verhält es sich tatsächlich mit diesen – auf dem ersten Blick sehr hoch anmutenden – Tariferhöhungen in der Metallindustrie? Bewahrheitet es sich am Ende doch, dass, wenn es der Wirtschaft gut geht, es auch der Arbeiterklasse gut geht? Oder ist – umgekehrt - der aktuelle Aufschwung neben anderem nicht gerade durch eine massive Erhöhung der Ausbeutungsrate, d.h. durch die Verbilligung der Arbeitskraft zustande gekommen?
Die Prekarisierung greift um sich
In den 60er Jahren galt unter den ArbeiterInnen Westdeutschlands das geflügelte Wort: „Keiner arbeitet für Tariflohn!“ Die Tariflöhne bildeten nur die untere Grenze der tatsächlich bezahlten Löhne; sie stellten faktisch Mindestlöhne dar. Noch heute schwärmt diese Generation der Arbeiterklasse in Deutschland von jenen Zeiten, als die Unternehmen bei der Anwerbung von Arbeitskräften sich einander geradezu überboten. Nun, diese Zeiten sind unwiderbringlich vorbei. Denn sie waren mit einer Phase in der Bundesrepublik verknüft, als Vollbeschäftigung herrschte, als die Unternehmen noch händeringend nach Arbeitskräften suchten und den ersten Arbeitsimmigranten, die ins Land kamen, geradezu den roten Teppich ausrollten. Heute, fast 40 Jahre nach Ausbruch der Weltwirtschaftskrise, hat der eingangs zitierte Spruch eine andere Bedeutung bekommen. Infolge des sukzessiven Wachstums der Arbeitslosigkeit, die mittlerweile Millionen von ArbeiterInnen in die Reservearmee des Kapitals geworfen hat, hat sich das Blatt im wirtschaftlichen Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Arbeit gründlich zuungunsten Letzterer gewendet. Der Druck auf die Löhne hat heute Auswüchse angenommen, die es immer weniger Arbeiter und Arbeiterinnen erlauben, mittels Arbeit ihre reinen Reproduktionskosten zu decken, d.h. ihre bloße Existenz – das Dach über dem Kopf, die tägliche warme Mahlzeit, etc. – zu sichern. Obwohl sie einer Vollzeit-Beschäftigung nachgehen, sind sie auf öffentliche Unterstützung angewiesen. Die zu Hungerlöhnen schuftenden Callcenter-ArbeiterInnen, die wachsende Heerschar von ZeitarbeiterInnen und Tagelöhnern, das als „Generation P“ (P wie Praktikum) bezeichnete akademische Proletariat – all sie sind Ausdruck der Tatsache, dass die „working poor“, die noch vor wenigen Jahren als typisch amerikanisches Phänomen dargestellt wurden, nun auch hierzulande um sich greifen.
Doch wer meint, das sog. Prekariat als einen besonderen, in sich abgeschlossenen Teil der hiesigen Arbeiterklasse zu identifizieren, dem gegenüber der „privilegierte“ Kern der Facharbeiter stehe, übersieht, dass die wachsende Tendenz zur relativen und absoluten Pauperisierung längst sämtliche Teile unserer Klasse erfasst hat. Was wir gerade derzeit erleben, ist ein beispielloser Angriff gegen jene Bereiche der Arbeiterklasse in Deutschland, die noch zu Tariflöhnen arbeiten. Obwohl die Tariflöhne in den letzten 15 Jahren auf breiter Front schrumpften, bemühen sich immer mehr Unternehmen darum, sich vom Korsett der Tarifgemeinschaft zu lösen, indem sie große Teile ihrer Produktion auslagern. Jüngstes – und besonders krasses - Beispiel für die massive Verbilligung der Arbeitskraft auch in den Kernbereichen der Arbeiterklasse in Deutschland ist die Telekom (wir haben bereits an anderer Stelle darüber berichtet).
ERA und die Relativierung des Metallabschlusses
Eine besonders perfide Art des Lohnraubs findet derzeit in der Metallindustrie statt. Seit dem Frühjahr gelten die - bereits 2002 von der IG-Metall und den Arbeitgebern ausgehandelten - Bestimmungen eines neuen „Entgeltrahmentarifabkommens“ (kurz: ERA). Dieses neue Rahmentarifabkommen sollte angeblich mehr „Gerechtigkeit“ bei der Entlohnung der Beschäftigten in der Metallindustrie schaffen. Kernstück von ERA ist die Abschaffung der unterschiedlichen Kategorien von Lohn und Gehalt. Künftig sollen Arbeiter und Angestellte nach einem einheitlichen Tarif bezahlt werden. Unterschiedliche Bezahlungen für dieselbe Tätigkeit sollen so aus dem Weg geräumt werden. Doch was für die beiden Tarifparteien – IG-Metall und Metallarbeitgeberverband – eine „Revolution“ ist, entpuppt sich für Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende von Beschäftigten als böse Überraschung. Denn die Arbeitgeber nutzten die Gelegenheit, um die Anpassung der bisherigen Löhne und Gehälter an die neue Entgeltstruktur überwiegend durch Herabstufungen vorzunehmen. Massenhaft wurden hohe Gehalts- und Lohngruppen gekappt und in niedrigere ERA-Gruppen gedrückt. Neben den Angestellten ist vor allem eine Gruppe von diesen Herabstufungen betroffen, die den um Kostenminimierung bemühten Unternehmen bislang ein Klotz am Bein war – jene trotz Frühverrentung immer noch relativ große Schar an Beschäftigten (darunter viele Facharbeiter), die sich im Laufe ihrer langen Betriebszugehörigkeit höhere Lohngruppen erarbeitet hatten. „So kann es passieren, dass sich ein Facharbeiter mit der alten Lohngruppe 8 mit einem monatlichen Einkommen von 1970,13 Euro plötzlich in der neuen ERA-Gruppe 3 mit einem Einkommen von 1770 Euro wiederfindet. Aufs Jahr gerrechnet hätte er mehr als 2000 Euro Verlust.“ (1)
Vor diesem Hintergrund erscheinen die eingangs erwähnten Tariferhöhungen in der Metallindustrie in einem völlig neuen Licht. Für viele der 3,4 Millionen Beschäftigten ist der „kräftige Schluck aus der Pulle“, den IG-Metall-Vorsitzender Peters, stolz wie Oskar, am Abend des Abschlusses verkündete, nur ein leichtes Nippen an der Flasche. Denn um größeren Unmut unter den Betroffenen zu vermeiden, sollen die Herabstufungen nicht abrupt erfolgen, sondern durch den völligen oder teilweisen Ausschluss der Betroffenen von den diesjährigen und den kommenden Tariferhöhungen schrittweise vonstatten gehen. Doch die IG Metall hat noch ein weiteres Mittel in petto, um den Widerstand der Beschäftigten in Grenzen zu halten. Indem dieses famose Entgeltrahmentarifabkommen – typischer euphemistischer Beamtensprech – jedem Beschäftigten die Möglichkeit des „Widerspruchs“ einräumt und gleich mehrere Vermittlungsinstanzen bis zur endgültigen Entscheidung durch das Arbeitsgericht (!) vorsieht, soll der anschwellende Strom der Unruhe und des Missmuts in den Belegschaften in Abertausende kleine Rinnsale des individuellen Protestes auf dem (juristischen) Terrain des Klassengegners aufgespalten werden. Dennoch: es tut sich was. Belegschaftsversammlungen, die bislang tröge und monoton waren, haben sich mittlerweile zu lebhaften Veranstaltungen entwickelt. Die Betriebsräte haben alle Mühe, die erhitzten Gemüter der Kollegen und Kolleginnen zu besänftigen. Und plötzlich erwacht der Kampfgeist auch in Schichten der Arbeiterklasse, die diesbezüglich bis dahin noch nicht aufgefallen waren. So beteiligten sich zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte ihrer Branche die Sekretärinnen von Siemens-Erlangen an einer Demonstration gegen diesen Lohnraub. Es stellt sich die Frage, ob sich ERA nicht letztendlich als ein Bumerang für die herrschende Klasse erweisen wird. Denn ERA hebt nicht nur die formale Spaltung zwischen Angestellten und Arbeitern auf und trägt zur Proletarisierung des Bewusstseins der Ersteren bei, die einst als „Industriebeamte“ treu ihren Dienst für die Kapitalisten taten. ERA fördert zudem in immer größeren Teilen unserer Klasse die Einsicht, dass wir alle – ob Angestellte oder Arbeiter, ob festangestellte oder ZeitarbeiterInnen, ob Callcenter-Beschäftigte oder Facharbeiter – einer mal mehr, mal weniger drastischen Verschlechterung unserer Lebens- und Arbeitsbedingungen ausgesetzt sind. Das „Prekariat“ ist das Proletariat!
-
Spiegel, Nr. 22, 26. Mai 2007.
Nationale Situationen:
Aktuelles und Laufendes:
- Arbeiterkampf [40]
Erbe der kommunistischen Linke:
Werner Bräunigs wiederentdeckter Roman: Rummelplatz DDR
- 4570 reads
Der Anfang 2007 veröffentlichte Roman Rummelplatz von Werner Bräunig wird von der Kritik bereits als die Neuerscheinung des Jahres und als „literarische Sensation“ gefeiert. Vom Herausgeberverlag Aufbau wird es als der „berühmteste ungedruckte Roman der Nachkriegszeit“ gepriesen. Nicht zu Unrecht. Die 1965 im Oktoberheft der „Neuen Deutschen Literatur“, der Zeitschrift des Schriftstellerverbandes der DDR, lediglich in einem kurzen Auszug veröffentliche Schrift wurde rasch zur Zielscheibe einer öffentlichen Diffamierungskampagne der stalinistischen Regierungspartei SED. Als 1976 Werner Bräunig im Alter von nur 42 Jahren starb, befand sich das noch unveröffentlichte Manuskript des Buches in seiner winzigen Einzimmerwohnung in Halle-Neustadt. Ursprünglich wurde das Projekt „Der eiserne Vorhang“ tituliert und sollte auch einen zweiten Band umfassen, der die Zeit bis 1959 bearbeiten sollte. Diese Fortsetzungsarbeit wurde offenbar nicht mehr in Angriff genommen.
Der vorliegende Roman schildert das Leben von vier jungen Menschen in der DDR in der Zeit zwischen 1949 und 1953.
Rummelplatz DDR
Was das SED-Mitglied Bräunig ganz besonders erschüttert, ist die Entdeckung, dass der Rummelplatz mit allem, was er für ihn bedeutet, in der DDR fortdauert und sich als unentbehrliche Einrichtung erweist. „Hinter dem Platz lauert die Dunkelheit. Zwei Farben nur hat die Landschaft, weiß und grau, das Dorf ist schmutzig am Tag und schon finster am Nachmittag, abends ist es ein böses, geschundenes, heimtückisches Tier, zu Tode erschöpft und gierig. Es ist ein Tier auf der Lauer, ein Tier in der Agonie, es hat sich verborgen in der Dunkelheit, es schweigt. Der Platz aber ist hell, er täuscht Wärme vor und Lebendigkeit.(...) Der Platz aber ist hell, und die Menschen hier hungern nach Helligkeit stärker und verzweifelter als anderswo. Im Gebirge sind sie fremd, untertage sind sie allein, allein mit sich und dem Berg, allein mit ihren Hoffnungen, ihren Zweifeln, ihrer Gleichgültigkeit, allein mit der Dunkelheit und der Gefahr. Die Dunkelheit ist um sie und in ihnen, und ist auch kein bestirnter Himmel über ihnen, da ist nur der Berg mit seiner tödlichen Last und seiner Stille. Als Glücksritter sind sie aufgebrochen, als Gestrandete, Gezeichnete, Verzweifelte, als Hungrige. Sie sind über das Gebirge hergefallen wie die Heuschrecken. Jetzt zermürbt sie das Gebirge mit seinen langen Wintern, seiner Eintönigkeit, seiner Nacktheit und Härte. Wenn nichts sie mehr erschüttern kann, nach allem, was hinter ihnen liegt, das Licht erschüttert sie. Wenn sie nichts mehr ernst nehmen, das ‚Glück auf‘ nehmen sie ernst. Uralte Verlockung der Jahrmärkte. Locker sitzen die Fäuste in den Taschen, die Messer, die zerknüllten Hundertmarkscheine, der Rubel rollt.“ (S. 75-76). Wir zitieren aus dem Kapital IV des Romans, wo der - sagen wir mal: sozialistische - Rummelplatz im Bergwerkrevier des Erzgebirges thematisiert wird. Just jenes Kapitel, das von den Stalinisten ausgewählt, vorabgedruckt und angegriffen wurde. Auch die Kunstbanausen der SED, mit dem sicheren Instinkt der Ausbeuterklasse, wussten sofort, dass eine solche Symbolik eine Untergrabung des stalinistischen Systems bewirken müsse. Der damalige Parteiführer Walter Ulbricht meinte dazu: „Dort werden nun alle Schweinereien geschildert, die möglich sind und damals möglich waren (...) Wir geben uns Mühe zu erziehen. Aber mit solchen Romanen wie Rummelplatz kann man sie nicht erziehen.“1 [79]
Der Unrast des ausgehungerten Herzens
Tatsächlich ist Bräunigs Roman voller Hinweise auf das ausbeuterische Wesen der DDR: die Lohnabzüge für alles Mögliche, das Hochschrauben der Arbeitsnormen und die Aufrufe zur Mehrarbeit, die Bespitzelungen und die Sabotagevorwürfe gegen die Arbeiter, die die Sollvorgaben nicht erreichen, die Zwangsarbeit der Strafgefangenen. Auch erhalten wir Einblick in die Klassenstruktur der DDR. Einen seiner Charaktere lässt er darüber nachsinnen: „Immer wirst du unten bleiben mit der Nase im Dreck, Peter Loose, wirst dein Leben lang schuften in harter Mühle und dich für ein paar Stunden entschädigen auf den Rummelplätzen der Welt, beim Wodka, an der warmen Haut eines Mädchens, denn es fehlen dir ein paar Kleinigkeiten, ohne die man in dieser Zeit nicht hochkommt. Ein bißchen Anpassungsfähigkeit fehlt dir und ein bißchen Arschkriecherei, ein bißchen Gebetsmühlendreherei und ein bißchen fortschrittsträchtige Skrupellosigkeit (...) Die Kriecher und Musterknaben werden ins Kraut schießen, zu hohen Preisen werden die Jesuiten gehandelt werden, und für deinesgleichen werden sie die Mär vom befreiten Arbeitsmann herunterbeten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, vom Schöpfer aller Werke und Herrscher dieses Landstrichs, auf dass du bei der Stange bleibst und dir die Brust voll Ruhm und Hoffnung schaufelst, Ruhm, den sie einheimsen, Hoffnung, die sie gepachtet haben“ (S.82) Man ist erstaunt, solche Zeilen aus der Feder eines SEDlers zu lesen... Werner Bräunig, ein anti-stalinistischer Dissident, gar ein verkappter Revolutionär in Zeiten der Konterrevolution? Tatsächlich hat die SED, sobald sie seinen Roman zu Gesicht bekam, an seine Regimetreue gezweifelt. Interessanterweise wurde seine scheinbar parteikonforme Darstellung des 17. Juni 1953 ebenfalls beanstandet bzw. ihm nicht abgenommen. Bräunig und sein Roman geben Rätsel auf. Das er damals bereits verstanden hat, dass der Stalinismus kein Sozialismus war, sondern eine Sonderform des Staatskapitalismus, ist mehr als unwahrscheinlich. Denn zur damaligen Zeit – am Tiefpunkt der stalinistischen Konterevolution - gab es auf der ganzen Welt nur ganz wenige, echt marxistische Revolutionäre, die das verstanden hatten. Wir haben Grund zu der Annahme, dass Bräunig zumindest geglaubt haben wird, dass die DDR gegenüber der BRD einen Fortschritt darstellte, als er an seinem Roman arbeitete. Wie viele andere in dieser Zeit wird er in der Abschaffung der Klasse der Privatunternehmer, die in Deutschland den Zweiten Weltkrieg ausgelöst und den Holocaust organisiert hatte, einen Schritt in Richtung Sozialismus erblickt haben. Andernfalls bleibt unerklärlich, wie er überhaupt an eine Veröffentlichung seines Romans jemals geglaubt haben konnte. Zumindest ein Schlüssel zur Auflösung dieses Rätsels liegt in der Biographie des Schriftstellers. 1934 als Sohn eines Hilfsarbeiters und einer Näherin in Chemnitz („Manchester des Ostens“) geboren, erlebte er das Kriegsende und den Zusammenbruch als Elfjähriger. Dazu schrieb er später: „Es war das Hungerjahr 1945. Aber es war nicht nur der Hunger, der mich auf die Straße trieb, auf die Schwarzmärkte, hin zu den Rudeln heimatloser Halbwüchsiger, die in den unzähligen Ruinen hausten. Schlimmer als der leere Magen war der Hunger im Herzen. Hier, unter elternlosen, lungernden, allein untergehenden und deshalb zusammenhaltenden jungen Wölfen (..) war alles einfach, überschaubar und klar. Friß oder stirb, der Starke kommt durch...“ (Anhang, S.627). Es war eine entwurzelte, heimatlose, verwahrloste neue Generation. Es war eine entwurzelte, heimatlose, verwahrloste neue Generation. Unter den älteren Kinder gab es auch solche, die vor Kriegsende „ihren Geburtstag um zwei Jahre vorzuverlegen begann(en)“ (S. 235), um in den Krieg ziehen zu können. Jetzt wurden sie auch noch von quälenden Gewissenbissen gemartert. So gab es in den ersten Nachkriegsjahren Millionen von Menschen, darunter viele Kinder und Jugendliche, die ziellos über die Autobahnen wanderten und nachts in Bunkern schliefen. Andere, durch Hunger und Kälte, aber auch von Abenteuerlust getrieben, liefen zu Fuß bis nach Neapel oder sonstwo hin - nur weg. Bräunig aber gehörte zu jenen, die sich mit Schmuggel und Kleinkriminalität durchschlugen. Im Schicksalsjahr 1953 wurde er dafür in der DDR zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Er wurde als Strafgefangener in der Steinkohle und in einer Papierfabrik eingesetzt, nachdem er zuvor als Fördermann den Uranabbau in der Wismut kennengelernt hatte. Während dieser Zeit schwor er seinem bisherigen Leben ab – und geriet von einem Wolfsrudel in den anderen: in die stalinistische Jugendorganisation FDJ. Der Hunger im Herzen scheint ihn auch hier angetrieben zu haben. Und auch hier war alles „einfach, überschaubar und klar.“ Auch hier hieß es: Friß oder stirb! Nicht bei den Stalinisten fand Bräunig das, wonach sein Herz sehnte, sondern bei den Arbeitern auf der Wismut.
Die Wismut und der Kalte Krieg
Auf der Wismut scheint Bräunig den von ihm gesuchten Antworten auf die Probleme Krieg und Unmenschlichkeit näher gekommen zu sein. Die Wismut war das größte Reparationsunternehmen des 20. Jahrhunderts. Von der UdSSR nach Kriegsende beschlagnahmt, deckte es Ende der 1950er Jahre beinahe 60 Prozent des sowjetischen Uranerzbedarfs. Damals hatte es 200.000 Beschäftigte. Im Nachwort von Angela Drescher lesen wir dazu: „Die Objekte wurden von Militär bewacht, es gab ein auf militärischen Prinzipien beruhendes Betriebssystem, eigene Rechtvorschriften, härteste Arbeitsbedingungen, nahezu autarke Strukturen.“ (S.642) Andererseits fiel die Entlohnung höher aus als anderswo in der DDR, so dass es nicht nur Ausgehungerte dorthin zog, sondern auch Abenteurer und Desperados. Dazu Bräunig im Roman: „Die Wismut ist ein Staat im Staate, und der Wodka ist ihr Nationalgetränk.“ (S.76) Hier entdeckte Bräunig tiefere Wurzeln der Abstumpfung der arbeitenden Bevölkerung als den berühmt-berüchtigten Schachtkoller. „War Peter Loose etwa gern allein? Ja, manchmal schon. Aber das heulende Elend packte einen, wenn man nichts weiter hat als seine vier Barackenwände und seine acht Stunden mit der Schaufel am Stoß, der Stumpfsinn kriecht in die Gehirnwindungen und füllt den Schädel mit Blei, bis er platzt, bis man irgend etwas zerdrischt oder zur Flasche greift oder aufbrüllt wie ein Stier. Schachtkoller nannte man das. Als ob es nur der Schacht wäre! Es was das ganze Elend dieses verpfuschten Lebens, dieses Lebens ohne Aussicht, das einen herumstieß, das blindlings einprügelte auf Gerechte und Ungerechte, das wiedergeprügelt sein wollte, und wenn’s nur zur Erleichterung wäre. Denn ausrichten konnte man wenig, allein gegen alle, es war einem eingetränkt worden bis hoch übern Eichstrich.“ (S.79) Diese Perspektivlosigkeit liefert in der Tat die wichtigste der moralischen Erklärungen dafür, dass der Kapitalismus seine geschundenen Lohnsklaven mit in die Barbarei reißen kann. Auch ist diese Perspektivlosigkeit der sicherste Beweis dafür, dass die Arbeiter der DDR sich keinesfalls in einer Gesellschaft befanden, die dem Sozialismus entgegenstrebte. Für Bräunig stand die Wismut aber auch für ein anderes Phänomen, das den Tragödien des 20. Jahrhunderts zugrunde liegt. Es ist die relative Primitivität der Arbeitsmittel im Vergleich zu der Ausgefeiltheit der Zerstörungsmittel. Die USA hatten gegen Ende des Zweiten Weltkriegs Atomwaffen entwickelt und auch eingesetzt. Für die Sowjetunion war es zur Überlebensfrage geworden, sich ebenfalls mit Kernwaffen auszustatten, um damit ein Gleichgewicht des Schreckens herzustellen. Vor allem dazu diente die Schinderei in der Wismut. Einen der hiesigen Bergleute lässt er sagen: „Ja – ganze Städte in den Himmel blasen, das ging. Da hatten sie eine Mordstechnik entwickelt, da war Geld für da, ein Riesenerfindergeist investiert, und massenhaft Leut gab’s, da gab’s alles. Aber hier? Große Töne spucken, von wegen Kernphysik. Aber hier, am Ursprung, da gingen sie den Fels an wie vor zweitausend Jahren.“ (S.112) Der Kalte Krieg, das Damoklesschwert der nuklearen Vernichtung, das über der Menschheit schwebte (und heute noch schwebt), lässt die Figuren in Bräunigs Roman an den Unterschied zwischen Ost und West zweifeln. „Und die sagen, sie seien für friedliche Zeiten, sie haben allesamt das Schwert hinterm Rücken, sofern sie die Staatsmacht haben, oder wenigsten ein Messer, solange sie noch klein sind, und sie sagen: Wir wollen den vorzeitigen Tod abschaffen, dazu bedarf es des Tötens. Oder wenigstens der gewaltsamen Bekehrung. Oder also der Rüstung gegen die Gerüsteten. Denn wir sind die Friedlichen, und das Schwert ist nur geschmiedet zur Abschreckung, das sagen die anderen auch (...) Bleibt da ein Rest? Ja. Die Frau am Verpackungsautomaten, Persilwerke, Düsseldorf. Kenne ich eine, die sitzt am Fließband, Glühlampenwerke Ostberlin, Arbeiter-und-Bauern-Staat, und du kannst hingehen und Glühbirnen kaufen, falls es welche gibt, und kaufst immer ein Stück mit von ihr, und die sitzt acht Stunden jeden Tag, achtundvierzig die Woche, ob die Kinder krank sind, der Mann vermisst wird, jemand den nie gekannten Wohlstand verkündet, also in einer Zweizimmerwohnung lebt sie, Hinterhaus, ringsum Trümmer, da spielen die drei Kinder, und das Geld reicht grad so wie in Düsseldorf oder auch nicht, und dann muß sie noch zu Aufbaueinsätzen, freiwilligen, und zu Kundgebungen und Aufmärschen und Versammlungen, also wenn du das meinst. (...) Übrigens die Gefängnisse sind auch hier nicht leer, keine Spur, und verboten ist manches, ein freundliches innenpolitisches Klima, wie man so sagt, raus darf keiner. Kriegsverbrecher allerdings sind enteignet, das ist wahr.“
Die Toten an die Lebenden
Bräunig lebte in einer Zeit der schrecklichen politischen Verirrung. Es war die Zeit der welthistorischen Niederlage des Proletariats. Ab 1968 wehrte sich eine neue Generation der Arbeiterklasse, die nicht mehr durch die Weltkriege und die stalinistische Konterrevolution traumatisiert war. Und heute wächst eine zweite ungeschlagene Generation des Proletariats heran, die erst nach dem Zusammenbruch der Ostblockregimes 1989 zu politischem Bewusstsein gekommen ist und sich mit neuer Kraft an die Entwicklung einer wirklichen Alternative zum Kapitalismus heranmachen kann. Dieses Glück war der Generation von Werner Bräunig nicht beschieden. Der Weg zur politischen Klarheit war durch die Weltlage selbst weitestgehend versperrt. Aber Bräunig suchte die Wahrheit seiner Epoche mit den Mitteln der Kunst. Da er mit Ernst, Aufrichtigkeit und auch mit Begabung suchte, waren seine Bemühungen nicht umsonst. Nicht die Politik stand bei ihm im Mittelpunkt. Das Ziel seines Lebens wurde es, den Arbeitern und ihrem Leben eine Stimme zu geben. Er glaubte, dieses Ziel in der DDR erreichen zu können. Schließlich redete der ostdeutsche Staat der „Arbeiterliteratur“ das Wort. Der Stalinismus jedoch strebte nicht nach Kunst. Was er brauchte, war Propaganda. Es strebte nicht nach Wahrheit, sondern nach Verklärung – auch und gerade, wenn es um die Lage der Arbeiterklasse im eigenen Lager ging. Werner Bräunig hat sich nicht als Gegner der DDR gesehen. Aber seine Kunst wurde zur Herausfordererung des Systems. Hat Bräunig das verstanden? Die stalinistische Bourgeoisie hat es verstanden.
Werner Bräunig hat den öffentlichen Angriffen gegen seinen Roman tapfer widerstanden. Zu keinem Zeitpunkt ist er zu Kreuze gekrochen. Er verhinderte das Ansinnen der Herrschenden, seinen Roman in verstümmelter Form herauszugeben. Auch gegenüber den Überwachungs- und Einschüchterungsmaßnahmen der Stasi blieb er fest. Aber dass es ihm nicht mehr gelang, sein Lebenswerk zu erfüllen, das darin bestand, seinem Mitgefühl für die Arbeiter als Verkörperung der Entfremdung der ganzen Menschheit Ausdruck zu verleihen, verkraftete er nicht. Die Veröffentlichung von Rummelplatz heute bedeutet, dass es dem Stalinismus doch nicht gelungen ist, die Stimme des Dichters zum Schweigen zu bringen. Werner Bräunig starb zweiundvierzigjährig an Alkoholismus. Die DDR hat ihn umgebracht. In den Zeilen seines Roman erreicht uns die Verzweifelung seiner Generation, eine mahnende Stimme der Toten an die Lebenden. (S.477-478). „Früher lagen Zigarrenstummel, Apfelsinenschalen und Papier auf der Straße, Hoffnungen auch, ja, manchmal auch Hoffnungen; heute sind es Menschen, das sagt weiter nichts (...) und die Menschen gehen vorbei, achtlos, resigniert, blasiert, und gleichgültig, gleichgültig, so gleichgültig. Ach ja, wer fragt, wie es sich denn sitzt in dem Zug, wie denn der Komfort sei und welcher Platz einem zugedacht, aber wohin es geht, danach fragt keiner. Und wir gehen an ihnen vorbei, einer geht am anderen vorbei, alle gehen vorbei; wohin sollen wir denn auf dieser Welt? Warum schweigt ihr denn? Warum redet ihr denn nicht? Wo ist denn der alte Mann, der sich Gott nennt? Warum gibt er denn keine Antwort? Gibt keiner Antwort? Gibt denn keiner, keiner Antwort?“
1 [79] Zitiert von Angela Drescher im Nachwort zum Roman: „Aber die Träume, die haben doch Namen. Der Fall Werner Bräunig“, S.642.
Theoretische Fragen:
- Kultur [80]
Erbe der kommunistischen Linke:
Juli 2007
- 797 reads
Ein internationalistisches Flugblatt zum Flüchtlingstag 2007 in der Schweiz
- 2636 reads
Unter dem Titel „Wir sind nicht die Schweiz - Ein Aufruf zur Zerstörung der Nation“ schrieben und verteilten die Gruppen Eiszeit, Libertäre Aktion Ostschweiz und Systembruch im Juni 2007 ein zweisprachiges Flugblatt (deutsch und französisch), dessen deutsche Version wir nachstehend abdrucken. Das Flugblatt ist bei uns sofort auf Zustimmung gestossen, da es gegenüber der linken staatsbejahenden Ideologie Klartext spricht: Nicht irgendein Nationalstaat ist der Hebel für eine Veränderung, sondern die Arbeiterklasse, deren Interessen mit denjenigen des bürgerlichen Staates nicht zu vereinbaren sind, auch wenn dieser noch so demokratisch ist. Demokratie und Menschenrechte sind nicht eine Gefahr für die herrschende Ordnung, sondern „schlicht die Grundlage der kapitalistischen Gesellschaft“, wie das Flugblatt sagt.
Unter dem Titel „Wir sind nicht die Schweiz - Ein Aufruf zur Zerstörung der Nation“ schrieben und verteilten die Gruppen Eiszeit, Libertäre Aktion Ostschweiz und Systembruch im Juni 2007 ein zweisprachiges Flugblatt (deutsch und französisch), dessen deutsche Version wir nachstehend abdrucken. Das Flugblatt ist bei uns sofort auf Zustimmung gestossen, da es gegenüber der linken staatsbejahenden Ideologie Klartext spricht: Nicht irgendein Nationalstaat ist der Hebel für eine Veränderung, sondern die Arbeiterklasse, deren Interessen mit denjenigen des bürgerlichen Staates nicht zu vereinbaren sind, auch wenn dieser noch so demokratisch ist. Demokratie und Menschenrechte sind nicht eine Gefahr für die herrschende Ordnung, sondern „schlicht die Grundlage der kapitalistischen Gesellschaft“, wie das Flugblatt sagt.
Wir sind nicht die Schweiz
Ein Aufruf zur Zerstörung der Nation
Bereits zum dritten Mal findet unter dem Titel «Wir sind die Schweiz» eine schweizweite Grossdemonstration statt. «Gleiche Rechte für alle» fordern die OrganisatorInnen im Untertitel des Aufrufes und machen sich für ein «Recht auf Mitsprache im Staat» für alle stark. Dass Illegalisierte die gleichen Rechte fordern, welche SchweizerInnen besitzen, ist verständlich. Die Verbesserung des Rechtsstatus ist für viele MigrantInnen ein materielles oder gar existenzielles Interesse. Doch die Parole der Demonstration lautet nicht «Nieder mit den Grenzen» oder «für freies Fluten», was dringend nötig wäre: Es geht im Aufruf nicht um eine autonome Organisierung für materielle Interessen und uneingeschränkten Aufenthalt für alle. Stattdessen wird die konstruktive Teilnahme am Staat unter dem Motto «Wir sind die Schweiz» gefordert. Um zu erkennen, was diese Forderung letztlich bedeutet, muss man sich erstmal Rechenschaft darüber ablegen, was denn diese Schweiz ist, die wir alle sein sollen. Die Schweiz ist ein Staat mit festen Grenzen, Gesetzen und Institutionen zur Sicherung der bestehenden kapitalistischen Verhältnisse. Wenn sich nun einige (linke) PatriotInnen dazu bemüssigt fühlen, innerhalb dieser staatlichen Grenzen ein «Wir» zu konstruieren, so beziehen sie sich positiv auf die repressive Einrichtung namens Nationalstaat - auch wenn sie die MigrantInnen in dieses «Wir» mit einbeziehen. Das machen sie gleich selbst deutlich, indem sie sich auf die durch den Staat zumindest formell gewährten Rechte und Pflichten beziehen und eine Mitsprache – und damit faktisch eine konstruktive Beteiligung – am Staat fordern. Dem Aufruf ist der erste Artikel der «Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte» beigestellt. Wie alle Rechte brauchen auch die Menschenrechte eine bewaffnete Instanz, welche ihre Durchsetzung garantieren kann und so ist es auch: Noch im hinterletzten von einer demokratischen Nation geführten Krieg geht es doch hochoffiziell um die Durchsetzung der Menschenrechte. Sei dies nun im Kosovo, in Afghanistan oder kürzlich im Irak. Die realen nationalen Interessen verschwinden hinter humanem Geraune. In der Regel decken sich die wirklichen materiellen Interessen auch mit den Menschenrechten, da der Normalmodus kapitalistischer Ausbeutung in stabilen gesellschaftlichen Verhältnissen leichter rund läuft. Und genau dies versprechen die Menschenrechte, indem sie das Recht auf Privateigentum, die Freiheit, seine Arbeitskraft zu verkaufen, die Zugehörigkeit zu einer Nation und den Rechtsstatus als solchen garantieren. So ist die Frage zwischen Diktatur und demokratischer Herrschaft eine der ökonomischen und politischen Nützlichkeit. Kurzum: Die Menschenrechte sind (in Form der Bürgerrechte) schlicht die Grundlage der kapitalistischen Gesellschaft.
Natürlich ist es zu unterstützen, dass niemand gefoltert oder in Sklaverei gehalten wird! Doch dass dieser menschenvernünftige Umstand in Gesetze gegossen werden muss, sagt vieles über die kapitalistische Gesellschaft aus. In einer Welt, in der die Menschen in Konkurrenz gegeneinander geworfen werden und sich Klassen objektiv unversöhnlich gegenüberstehen – unabhängig davon, ob diese an der Oberfläche wahrnehmbar sind –, braucht es eine Rechtsform und deren Garanten, damit sich die einzelnen Menschen, die Klassen und letztlich die Staaten nicht gegenseitig an die Gurgel gehen. Dass der grösste Teil der Weltbevölkerung als Teil der ausgebeuteten Klasse allen Grund hätte, dem System und seinen RepräsentantInnen an die Gurgel zu gehen, das will weder die linke Politikerin, noch der nette Sozialarbeiter hören.
Ausbeutung findet immer statt, wo unter kapitalistischen Bedingungen gearbeitet wird. Denn Arbeitsplätze gibt es ganz grundsätzlich nur, wenn ein Mehr an Wert produziert wird, als den ArbeiterInnen ausbezahlt werden muss. Das ist auch schon der ganze Witz der Ausbeutung: Wir produzieren mehr, als wir erhalten. Dass diese Tatsache sich bei Illegalisierten in elenden Lebens- und Arbeitsverhältnissen widerspiegelt, ist dabei die krasseste Ausformung eines Systems, das grundsätzlich auf der Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft basiert. Was wir mit den Illegalisierten teilen, ist der Umstand, dass wir unsere Arbeitskraft verkaufen müssen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Dieser Erkenntnis steht eine nationale Identität («Wir sind die Schweiz») im Wege. Der Staat ist eben keine neutrale Sphäre, die über den wirtschaftlichen Zwängen schwebt, sondern er ist der Staat des Kapitals, der die optimalen Ausbeutungsbedingungen erst garantiert. Wirtschaftsflüchtlinge, Kriege und kontinentale Abschottungen sind Produkte des gesellschaftlichen Fundaments, der kapitalistischen Produktionsweise, welche durch den Nationalstaat aufrechterhalten wird. Diesen Zustand (den Kapitalismus) abzuschaffen, mitsamt den Kräften und Instanzen, die ihn zu verewigen trachten, dass ist das gemeinsame Interesse, welches wir als weltweite Klasse der Lohnabhängigen haben. Und genau da müssen wir gemeinsam ansetzen: An der Abschaffung dieser scheiss Verhältnisse; an der Abschaffung von Klassengesellschaft und Nationen!
Wir sind nicht die Schweiz
Klassenkampf statt (linkem) Nationalismus
Eiszeit | LAO | Systembruch
| [email protected] [82] | [email protected] [83] | [email protected] [84] ||| eiszeit.tk | lao.blogsport.de |
Eine Abrechnung mit der MLPD: Vorwort der IKS
- 5798 reads
Wir veröffentlichen hiermit einen Leserbrief, den wir aus Bayern erhalten haben. Es handelt sich um eine Abrechnung mit der linkskapitalistischen MLPD, geschrieben von einem Genossen, der einst unter dem Einfluss dieser Organisation stand. Wir begrüßen die Vorgehensweise des Genossen, die darin besteht, die politische Klärung ehrlich und systematisch zu betreiben, indem das Unzulängliche nicht unter den Teppich gekehrt, sondern kritisiert und überwunden wird.
Wir veröffentlichen hiermit einen Leserbrief, den wir aus Bayern erhalten haben. Es handelt sich um eine Abrechnung mit der linkskapitalistischen MLPD, geschrieben von einem Genossen, der einst unter dem Einfluss dieser Organisation stand. Wir begrüßen die Vorgehensweise des Genossen, die darin besteht, die politische Klärung ehrlich und systematisch zu betreiben, indem das Unzulängliche nicht unter den Teppich gekehrt, sondern kritisiert und überwunden wird.
Wie weit der Genosse sich von den Vorstellungen linksreformistischer und antifaschistischer Politik bereits entfernt hat, beweist sein Beitrag. Nichts zeigt die Dynamik bei der Überwindung der Einflüsse der radikaleren Ideologien der Bourgeoisie besser als die Klarheit, mit der der Genosse den Zweiten Weltkrieg als imperialistisches Gemetzel auf allen kriegsführenden Seiten bezeichnet und die Arbeiterklasse zur Verteidigung der eigenen Klassenautonomie aufruft. Neben dem Antifaschismus und der damit einhergehenden „kritischen“ Verteidigung der bürgerlichen Demokratie bezeichnet der Text auch die Gewerkschaften als Staatsorgane, die ein wesentlicher Bestandteil des Systems geworden sind. Wir freuen uns auf eine Fortsetzung dieser Diskussion über die Gewerkschaftsfrage, wo es dann beispielsweise um die Frage gehen könnte, warum die Gewerkschaften als einstige Organisationen der Arbeiterklasse für die Bedürfnisse des Klassenkampfes unzulänglich und gar schädlich geworden sind und warum sie ab diesem Zeitpunkt nicht einfach verschwanden, sondern in die Hände des Klassenfeindes fielen.
Besonders wichtig erscheint es uns, dass der Genosse nicht nur die politischen Positionen der MLPD (und vergleichbarer linker Organisationen) in Frage stellt, sondern ebenso sehr ihre Geisteshaltung (etwa die quasi-religiöse Gläubigkeit gegenüber den eigenen „Parteidoktrin“ wie etwa die der „Arbeiteroffensive“ der MLPD) oder ihre Interventionsweise (die Verpulverung der Energien und der Opferung des Idealismus von Militanten zugunsten eines sinnlosen Aktivismus). Er zeigt uns auf, wie die Politik solcher linker Organisationen – ähnlich der bürgerlichen Gesellschaft insgesamt, z.B. in der Werbung – systematisch Camouflage betreibt, um eine eigene, nicht vorhandene Wichtigkeit und Radikalität vorzutäuschen. Diese und andere Hinweise des Textes sind in der heutigen Zeit umso wichtiger, da die Mythen der linken Ideologie immer mehr ins Wanken geraten sind und immer mehr ihrer Militanten auf der Suche nach wirklich revolutionären Alternativen sind. Der Genosse schreibt in seinem Text, dass beispielsweise bei den antifaschistischen Mobilisierungen der Linken regelmäßig nur Kleinbürger anwesend sind. Dass dies nicht immer ganz der Fall ist, dass auch aufrichtig nach einer kommunistischen Perspektive suchende Klassenkämpfer unter den Einfluss solcher Kreise geraten, aber sich auch wieder davon lösen können, beweist am besten der Brief des Genossen selbst.
In einem Punkt des Briefes besteht offenbar eine wichtige Meinungsverschiedenheit des Genossen gegenüber den Positionen der Kommunistischen Linken. Der Genosse kritisiert die (klassisch maoistische) Vorstellung der MLPD, derzufolge der Kapitalismus in der UdSSR nach dem Tod Stalins wiedereingeführt wurde. Er weist zurecht darauf hin, dass die herrschende Nomenklatura vor und nach dem Tod Stalins dieselbe war. Es ist in der Tat mehr als unwahrscheinlich, dass zwei entgegengesetzte Gesellschaften wie der Sozialismus und der Kapitalismus von ein und derselben herrschenden Gruppe verwaltet wurden! Daraus schließt der Genosse allerdings, dass der Kapitalismus in Russland erst nach dem Sturz Gorbatschows und der Wiederentstehung einer konventionelleren Herrschergruppe, die auch persönliches Eigentum an Produktionsmitteln kannte, wiederhergestellt wurde. Der Genosse argumentiert, dass die herrschende Nomenklatura in der UdSSR keine Bourgeoisie war, da sie keine Produktionsmittel besaß und die Arbeiter auch keine freien Lohnarbeiter waren.
Es ist nicht leicht ist, den Klassencharakter der UdSSR nach der Niederlage der Weltrevolution zu verstehen, denn die Erscheinungsform der stalinistischen Gesellschaft war alles andere als die klassische Form des Kapitalismus. So ist es sozusagen nicht normal, dass im Kapitalismus die Herrschenden persönliche Anteile an den Produktionsmitteln nicht erwerben können, dass die Anteile der Herrschenden am Produkt der Mehrarbeit der Arbeiterklasse stattdessen von einer Behörde verteilt werden. Es ist auch nicht „normal“ – und für das gute Gelingen der kapitalistischen Ausbeutung alles anders als günstig –, wenn die Lohnarbeiter nicht entlassen werden oder wenn unproduktive Betriebe nicht pleite gehen können. Aber dass der Stalinismus kein normaler und auch kein halbwegs vernünftig funktionierender Kapitalismus war, beweist noch lange nicht, dass er kein Kapitalismus war oder dass die Arbeiter in der UdSSR keine Lohnsklaven waren.
Um sich von den äußeren Erscheinungen nicht blenden zu lassen, ist es unserer Meinung nach notwendig, auf die Grundlagen des Marxismus zurückzukommen. Und da sehen wir, dass der Kapitalismus, und somit das Lohnsystem, nur auf Weltebene überwunden werden kann. Dies hat beispielsweise Trotzki Mitte der 1920er Jahre gegenüber Stalins bürgerlicher Theorie des „Sozialismus in einem Land“ eindrucksvoll bewiesen – auch wenn Trotzki selbst nicht alle Konsequenzen daraus ziehen konnte. Für uns besteht die Hauptkonsequenz darin, dass der Kapitalismus in der UdSSR niemals abgeschafft wurde – auch damals nicht, als die Diktatur des Proletariat dort herrschte. Da die Weltrevolution scheiterte, da die Diktatur des Proletariats, die Macht der Arbeiterräte sich in der Isolation nicht halten konnte, kam eine konterrevolutionäre Nomenklatura an die Macht, die die Aufgabe vorfand, den Kapitalismus zu verwalten, und allein schon deshalb als ein Teil der Kapitalistenklasse verstanden werden muss.
Wir würden uns jedenfalls über die Fortsetzung dieser Debatte freuen. Denn anders als im Lager der Pseudolinken darf man – nein: muss man – offen, solidarisch und ohne Tabus über alle Fragen diskutieren, damit die kollektive Klärung vorangetrieben wird.
Zur Kritik an Politik und Ideologie der MLPD
Zwei Vorbemerkungen: Um gewollte Missverständnisse auszuschließen, einige der nachfolgenden Gedanken und Überlegungen sind keinesfalls dazu da, die Politik der NPD zu verteidigen oder zu relativieren.
Diese Kritik am Beispiel der MLPD gilt sinngemäß auch für vergleichbare Organisationen (Trotzkisten, die Gerontologen der DKP etc.). Die MLPD wurde deshalb ausgewählt, weil sie die größte und aktivste „linksradikale" Organisation der BRD ist.
I. Zur Gewerkschaftsfrage. Das Warten der MLPD im Rahmen ihrer ständigen Behauptung, wir befänden uns mitten in einer „Arbeiteroffensive" auf eine „linke, klassenkämpferische Gewerkschaftsspitze", entspricht dem Warten auf Godot. Anders formuliert, man wartet hier seitens der MLPD auf den St. Nimmerleinstag. Seit Ende der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts sind die Gewerkschaften aller entwickelten kapitalistischen Länder unwiderruflich Teile des die herrschende Bourgeoisie stützenden Machtapparates. Sie stabilisieren besonders die Herrschaft der sich „demokratisch" nennenden Kapitalisten. Sie sind so sehr in das herrschende System integriert, dass sie längst zu einem zentralen Bestandteil des bürgerlichen Herrschaftsapparates geworden sind. Die Vorstellung der MLPD, die Gewerkschaften bzw. deren Führer würden sich ausgerechnet von dieser kleinen Splitterpartei im Sinne ihres Kampfes für den „echten" Sozialismus instrumentalisieren lassen, ist so wirklichkeitsfremd, wie wenn man dies vom BDI oder der CDU erwarten würde: Jeder selbstorganisierte, „wilde" Streik, so beispielsweise der bei Opel Bochum, wird gegen die Gewerkschaftsbürokratie durchgesetzt. Auch von den famosen „linken" Gewerkschaftern ist bei solchen Aktivitäten in der Regel nichts zu sehen und nichts zu hören. Sei es, dass sie abwesend sind oder sei es, dass es sie gar nicht gibt. Das Ergebnis jedenfalls ist immer dasselbe: Ob „links" oder „rechts", die Gewerkschaftsführer sabotieren selbständige Streikbewegungen nach Kräften und das nicht erst seit kurzem, sondern seit langem. Angesichts dieses Sachverhaltes ist das Festhalten der MLPD an den Gewerkschaften bzw. ihr ständiger Versuch, etwaige Ausschlüsse ihrer Mitglieder aus diesen durch Anpassung oder das Ausschöpfen von Rechtsmitteln zu verhindern, rational kaum noch nachvollziehbar. Man kann es sich eigentlich nur noch so erklären, dass der Gründungsvater der MLPD, Willi Dickhut nach seinem Ausschluss aus der KPD in den Gewerkschaften so etwas wie eine politische Ersatzheimat gefunden hatte, an der er emotional hing. Das ist aber nun wirklich kein Grund für Marxisten, auf immer und ewig hinter der Gewerkschaftsbürokratie herzuhecheln, in der - man entschuldige den Ausdruck - wahnhaften Hoffnung, diese für die Sache der Arbeiterklasse an einem fernen Tag gewinnen zu können.
2. Antifaschismus und Faschismus. Der Antifaschismus nicht zuletzt der MLPD fesselt die Arbeiter an die Verteidigung des bürgerlichen Staates. Er lenkt die revolutionäre Linke ab vom Klassenkampf auf das Gebiet der bürgerlichen, der parlamentarischen Demokratie. Der Antifaschismus unterscheidet zwischen den „guten, demokratischen" Kapitalisten und den „bösen, faschistischen". Das klingt nicht nur ähnlich wie die Differenzierung der Faschisten zwischen den „guten, schaffenden" Kapitalisten und ihren „bösen, raffenden" Klassengenossen - es ist im Kern dieselbe Denkweise.
Für die Arbeiterklasse gibt es aber keine „gute, vernünftige, zu unterstützende, demokratische Fraktion", kein kleineres Übel innerhalb der Kapitalistenklasse im Gegensatz zu der „bösen, faschistischen Fraktion." Marxisten verteidigen die Kapitalistenklasse (auch keine Fraktion derselben) unter keinen Umständen, weil es zwischen dieser und der Arbeiterklasse keine Gemeinsamkeit gibt. Das sollte eigentlich eine Binsenweisheit sein, für die MLPD gilt das scheinbar aber nicht. Wer als Marxist meint, die „demokratischen" Kapitalisten und ihre Politiker verteidigen zu müssen, der integriert zwangsläufig die Arbeiterklasse in den nationalen Konsens, der da heißt: „Nie wieder Faschismus!" Bekanntlich hat aber die Arbeiterklasse kein Vaterland, auch keines, das von einer sich „demokratisch-antifaschistisch" tarnenden Bourgeoisie beherrscht wird. Einer Bourgeoisie, die als angebliche Hauptlosung den Kampf gegen den Faschismus ausgibt und glaubt, so die Massen an sich binden zu können. Stattdessen gilt ihr wirkliches Hauptaugenmerk dem Kampf gegen die Interessen der arbeitenden Klasse, ein Sachverhalt, den die MLPD in ihrem zunehmend hysterisch werdenden Antifaschismuskampf zu vergessen scheint.
Einige Beispiele, zu welch manchmal absurden Konsequenzen der Antifaschismus der MLPD zwangsläufig führen muss:
- Stichwort Abbau sozialer Errungenschaften. So habe ich die NPD als Autorin der Hartz IV Gesetze nicht mehr so deutlich in Erinnerung, um mich ganz vorsichtig auszudrücken. Vielmehr waren es aus meiner Sicht doch eher die „demokratisch-antifaschistischen" Parteien CDU/CSU, SPD und Grüne, die Millionen von Arbeitern ins soziale Elend gestürzt haben bzw. stürzen werden. Die Parteien also, die die MLPD als kleineres Übel ansieht und bei der Verteidigung ihrer Privilegien aktiv unterstützt.
- Ist es wirklich revolutionäre Politik, wenn Marxisten-Leninisten zusammen mit den reaktionärsten Vertretern der „demokratisch-antifaschistischen" Kapitalistenklasse, nämlich den Gefolgsleuten von Stoiber, Schäuble und Westerwelle, zusammen demonstrieren gehen? Oder um ein bekanntes Sprichwort abzuwandeln: „Sage mir, mit wem Du demonstrierst und ich sage Dir, wer Du bist!"
- Stichwort Antikriegstag I. September: Sind allen Ernstes nur faschistische Regimes wie das von Hitler oder Mussolini Kriegstreiber gewesen? Sind bzw. waren „demokratisch-antifaschistische" Bourgeoisien wie beispielsweise die US-Administration wirklich nie Kriegstreiber? War u.a. die englische, französische, spanische oder belgische Bourgeoisie zu keinem Zeitpunkt als Haupttäter an imperialistischen Kriegen beteiligt? Sind die Millionen Arbeiter auf Seiten der Alliierten im 2. Weltkrieg wirklich für ihre Klasseninteressen gestorben oder doch nicht eher für die Interessen ihrer jeweiligen Bourgeoisien? Diese Frage stellt sich die MLPD leider auch nicht.
Mit der Unterstützung des Antifaschismus unterwirft sich die MLPD bewusst oder unbewusst der ideologischen Hegemonie der SPD und gesellt sich zu deren Trabanten PDS, WASG und Grüne. Damit wird sie selbst zu einer weiteren - extrem linksliberalen bzw. kleinbürgerlichen – staatstragenden Partei, und dies trotz aller pseudorevolutionären Phraseologie. Für all diese Parteien ist der Antifaschismus konstitutiv und zur Staatsräson geworden. Für Marxisten sollte aber etwas anderes konstitutiv sein: nämlich die Zerschlagung der Kapitalistenklasse und die Errichtung der Arbeitermacht. Das Ziel einer kommunistischen Arbeiterpartei muss es sein, die Produktionsmittel in ihren Besitz zu bringen, den erwirtschafteten Mehrwert zu vergesellschaften und somit der privaten Aneignung zu entziehen. Auch diese Binsenweisheit ist der MLPD fremd. Stattdessen scheint sie bereits zufrieden zu sein, wenn der Austausch von Abgeordneten (z.B. SPD-Parlamentarier statt NPD-Abgeordnete) und sonstigen Würdenträgern des bürgerlichen Staates auf „antifaschistischer" Grundlage erfolgt.
Wie gedankenlos die MLPD ihren Antifaschismus betreibt, das zeigt das Interview mit dem Parteivorsitzenden Stefan Engel in der Roten Fahne 51/52 (2006) auf Seite 19: Dort beschwert er sich, die NPD würde die ihr zustehenden Staatsgelder dazu benutzen „... um ihren faschistischen Parteiaufbau zu forcieren.." Hatte er etwa erwartet, die NPD verwende die Gelder, um eine marxistisch-leninistische Partei aufzubauen? Nein, die Arbeiterklasse hat nun wirklich nicht darauf gewartet, dass auch noch die MLPD daherkommt, um den „demokratisch-antifaschistischen" Kapitalismus gegen dessen faschistischen Doppelgänger zu verteidigen. Das tun bereits alle anderen Parteien des „Verfassungsbogens", von der DKP bis zur FDP.
Wer demonstriert denn bei Antifademos, welche Menschen versuchen da welche Klasseninteressen zu vertreten? Klassenbewusste Arbeiter oder Kleinbürger? Es sind, wie jeder weiß, Kleinbürger (dazu natürlich viele Jugendliche, die in erster Linie ihren Spaß haben wollen), die bei einem zunehmenden Einfluss faschistischer Parteien tatsächlich in Gefahr geraten, ihre Posten im Rahmen des kapitalistischen Systems an die Parteigänger der NPD zu verlieren. Dabei denken sie aber doch nicht im Traum daran, das kapitalistische Wesen des bürgerlichen Staates, der gerade der ihre ist und von ihnen hauptsächlich getragen wird, in Zweifel zu ziehen oder diesen gar zu bekämpfen. Ganz im Gegenteil, sie wollen ihn behalten, genauso wie er ist, ihn konservieren und gegen alle Angriffe anderer - in diesem Falle der Faschisten - verteidigen. Es sind also konservative, gesellschaftlich betrachtet sogar rückschrittliche Personen, mit denen die MLPD hier zusammenarbeitet. Das kann insofern nicht überraschen, weil die MLPD selber ihre Klassenbasis im Kleinbürgertum hat. Dass übrigens die Faschisten noch reaktionärere Einstellungen haben, beweist doch nicht die Fortschrittlichkeit des kleinbürgerlichen Antifaschismus! Um ein Bild zu gebrauchen: Eine versalzene Suppe wird nicht dadurch schmackhafter und gesünder, weil eine andere Suppe noch stärker versalzen ist: Eine richtig gesalzene Suppe wäre die Alternative und zwar nicht nur aus dialektischer Sicht. Die MLPD hat sich so sehr von den Klassenpositionen des Proletariats entfernt, dass ihr die beschriebenen Sachverhalte gar nicht mehr aufzufallen scheinen.
Es sei noch darauf hingewiesen, dass es weitere, ernsthafte Kritikpunkte an der Ideologie und Politik der MLPD gibt. So beispielsweise ihre Behauptung, nach dem Tode Stalins sei in der Sowjetunion der Kapitalismus restauriert worden. Die angeblich neue Bourgeoisie, die Nomenklatura, die sich nach seinem Tode ausbreitete (abgesehen davon war sie natürlich auch schon vor seinem Tode vorhanden, nur vielleicht für manche nicht so offensichtlich erkennbar) besaß weder die Produktionsmittel (allenfalls hatte sie die Verfügungsgewalt über sie) noch mussten die Arbeiter ihre Arbeitskraft als Ware auf dem freien Markt verkaufen, denn ihre Arbeitsplätze waren staatlich garantiert. Diese angeblich kapitalistische Nomenklatura wehrte sich am heftigsten gegen die tatsächliche Einführung des Kapitalismus unter Gorbatschow. Es würde aber zu weit führen, diese Kritik an dieser Stelle weiter auszuführen. Dazu gehört auch der Hinweis, dass natürlich bereits unter Stalin die Macht der Arbeiterräte längst durch eine bürokratische Schicht, die eben erwähnte Nomenklatura, abgelöst worden war.
Abschließend soll nicht verschwiegen werden, dass in den beiden genannten Punkten die IKS (Internationale Kommunistische Strömung) Positionen vertritt, die man als Marxist weitaus besser nachvollziehen kann, weil sie strikt zwischen den Interessen der Arbeiter- und Kapitalistenklasse zu unterscheiden vermag. Sicher ist die IKS, nicht zuletzt in Deutschland, eine zahlenmäßig weitaus unbedeutendere Strömung als die MLPD. Wie die Geschichte aber der russischen Revolution zeigt, ist dies unerheblich. Unerheblich vor allem dann, sobald sich eine revolutionäre Situation ergibt. Es geht nicht darum, wer jetzt die meisten Infostände aufbauen kann oder wer heute bei Gewerkschaftsdemonstrationen die „schönsten" Transparente mit sich rumschleppt, sondern darum, was für eine Information, welche Ideologie, Strategie und Taktik für den zukünftigen Kampf dabei rübergebracht wird. Anders gesagt, wer in der revolutionären Situation in der Lage sein wird, massenwirksam am richtigen Ort das Richtige zu sagen, dem gehört die Zukunft. In einer solchen Situation wird es sich zeigen, wer in der Lage sein wird, die Massen für den Kampf zu mobilisieren und wer nicht. Eine sich vorher „antifaschistisch" ans alte System anbiedernde Kraft wird dabei genauso wenig gefragt sein wie jemand, der jahrzehntelang irgendwelchen Gewerkschaftsführern nachgelaufen ist, deren Interesse stets der Stabilisierung desselben alten Systems gegolten hatte. Eine Perspektive im Sinne eines revolutionären Marxismus sieht jedenfalls anders aus, als es sich die MLPD-Führung heute vorstellt. (Frühjahr 2007).
Zusammenstöße zwischen Hamas – Fatah: Die palästinensische Bourgeoisie ist ebenso blutrünstig wie die anderen
- 3187 reads
„Für einen freien und selbstständigen Palästinenserstaat - so lautet seit Jahrzehnten der Schlachtruf aller Linken auf dieser Erde. Sie prangern die barbarische Politik des israelischen Staates und die unmenschlichen Bedingungen der Menschen im Gaza-Streifen oder im Westjordanland an. Ihre „Lösung“ lautete stets – die Schaffung einer wahren palästinensischen Nation, mit einem eigenen Staat, einer eigenen Armee, einer eigenen Bourgeoisie.
„Für einen freien und selbstständigen Palästinenserstaat - so lautet seit Jahrzehnten der Schlachtruf aller Linken auf dieser Erde. Sie prangern die barbarische Politik des israelischen Staates und die unmenschlichen Bedingungen der Menschen im Gaza-Streifen oder im Westjordanland an. Ihre „Lösung“ lautete stets – die Schaffung einer wahren palästinensischen Nation, mit einem eigenen Staat, einer eigenen Armee, einer eigenen Bourgeoisie.
Die Bevölkerung in diesem Gebiet ist in der Tat ständig ihrem Elend, einer gewalttätigen Unterdrückung und dem Krieg ausgeliefert. Aber im Gegensatz zu allem Schein, allen „guten Absichtserklärungen“ seitens der Linken dienen ihre Krokodilstränen und humanitär klingenden Aufschreie nur der Rechtfertigung von immer mehr Schrecken und Gewalt. Die Perspektive eines selbstständigen palästinensischen Staates bedeutet in Wirklichkeit eine Sackgasse. Schlimmer noch, sie war immer ein Mythos zur Benebelung und Mobilisierung der palästinensischen Massen in den blutigen Auseinandersetzungen, wobei deren Wut und Verzweiflung ausgeschlachtet wurden, um dem imperialistischen Gemetzel im Mittleren Osten Kanonenfutter zuzuführen.
Die Kämpfe zwischen den Palästinensern während der letzten Wochen belegen dies erneut. Die Bevölkerung geriet ins Sperrfeuer von zwei korrupten und bis an die Zähne bewaffneten Fraktionen, die vorgeben, gemeinsam diesen schönen ‚selbstständigen, menschlicheren Staat“ errichten zu wollen. Tatsächlich aber stürzt der Krieg zwischen Hamas und Fatah die Bevölkerung in einen noch größeren Terror, noch mehr Chaos und Hunger.
Palästinensische Gebiete: Die Errichtung des nationalistischen Mythos‘
Warum kann man sagen, dass der Wunsch nach einem selbstständigen palästinensischen Staat ein Mythos ist? Hat nicht der nach der ersten Intifada 1987 eingeleitete „Friedensprozess“ das Gegenteil bewiesen? Ende der 1980er Jahre wurden in der Tat offizielle Diskussionen zwischen Israel und Repräsentanten der palästinensischen Bourgeoisie eröffnet. Die Organisation für die Befreiung Palästinas (PLO 1) wurde als „Repräsentant des palästinensischen Volkes“ durch die UNO anerkannt. Diese Organisation handelte anschließend das Osloer Abkommen mit der israelischen Regierung Yitzak Rabins aus, was zur Schaffung der Palästinensischen Autonomiebehörde führte. Nachdem sie 1988 einen eigenen Palästinenserstaat ausgerufen hatte, erhielt die PLO bei der UNO einen permanenten Beobachterstatus. 1996 änderte die PLO gar ihre Charta, die auf die Zerstörung des Staates Israel abzielte. Aber in Wirklichkeit belegte dieser ganze Prozess eigentlich nur, dass es gar keinen eigenständigen Palästinenserstaat geben kann. All diese Abkommen, diese „Fortschritte“, diese „Anerkennungen“ kamen unter dem Druck der USA zustande. Jahrelang verfügten die USA als Supermacht über die Mittel, die imperialistischen Ambitionen aller in dieser Region aktiven Hyänen zu bremsen, den Staat Israel eingeschlossen. Ihr Interesse bestand darin, dass die Lage in Palästina unter ihrer Vorherrschaft so ruhig wie möglich blieb.
Um ihre imperialistischen Interessen zu verteidigen, waren die USA Ende der 1990er Jahre dazu gezwungen, ihre Strategie zu ändern und an der Seite der israelischen Bourgeoisie eine immer offensivere Politik gegenüber der palästinensischen Bourgeoisie zu betreiben. Daraufhin stürzte das palästinensische „Volk“ noch mehr in Not und Verzweiflung.
2000 legte die zweite Intifada dieses Elend bloß. Unvergessen sind die mit Lumpen bekleideten Kinder, die israelische Panzer verzweifelt mit Steinen bewerfen. Unvergessen sind die in den Lagern eingepferchten Menschen, von denen viele ermordet wurden. Für die Palästinensische Autonomiebehörde und die PLO war es ein willkommener Anlass, um gemeinsam mit allen Linken ihr nationalistisches Gift zu verbreiten und die Forderung zu erheben, dass auch die Palästinenser Anspruch auf einen Staat hätten. Diese nationalistische Sprache versuchte nicht einmal, all die Skandale, den ganzen Betrug und die Ermordungen, an denen die verschiedenen Fraktionen der palästinensischen Bourgeoisie - PLO, Fatah und Hamas - beteiligt waren, zu vertuschen.
Der Gaza-Streifen – ein Bündel imperialistischer Spannungen
Heute kann der Konflikt zwischen Hamas und Fatah nicht mehr vertuscht werden. Er hat sich zu einem totalen Krieg entwickelt, bei dem der jeweilige Gegner vernichtet werden soll. Jede der beteiligten bürgerlichen Fraktionen hat sich mit ausländischen imperialistischen Mächten verbündet. Dies ist das wahre Gesicht – Blut, Krieg und imperialistische Allianzen; wenn es nach den Linken geht, sollten wir bürgerliche palästinensische Fraktionen unterstützen.
Der Gaza-Streifen befindet sich heute in den Händen der Hamas, man hat ihn gar in ‚Hamastan’ umbenannt. Diese 1978 von Scheich Yassin gegründete Fraktion verfolgt eine sunnitische Ausrichtung. Ihr militärischer Arm ist unter dem Namen Mudschahedin aktiv. Sie unterhält Ausbildungslager im Libanon, Sudan und Iran. Durch ihre Unterstützung hoffen Syrien und vor allem der Iran darauf, von der Schwächung der USA zu profitieren und ihre eigenen Schützlinge in Stellung zu bringen.
Was die Fatah betrifft, ist es kein Zufall, dass ihre bewaffneten Kämpfer nach Ägypten oder Jordanien flüchten konnten. In arabischen Staaten neigen die schiitischen und sunnitischen Gruppen immer mehr zu Zusammenstößen. Länder mit einer sunnitischen Bevölkerungsmehrheit wie Ägypten, Jordanien oder Saudiarabien sind besonders besorgt wegen des Machtzuwachs des schiitisch dominierten Irans. Diese Staaten versuchen also die dahinsiechende Regierung von Mahmud Abbas zu unterstützen. All diese Unterstützungen sind keineswegs beseelt von einer Sorge um das Wohlergehen der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen. Die Besorgnis ist sogar so groß, dass Ägypten auch den Einsatz von multinationalen Verbänden im Gazastreifen vorgeschlagen hat, der auch ohne die Zustimmung der palästinensischen Gruppen oder Israel durchgeführt werden sollte.
In den letzten Tagen haben sich all diese imperialistischen Haie, von den großen bis zu den kleinen, getroffen, um eine Eindämmung des Chaos anzustreben. In Scharm El Sheich haben Abbas und Olmert, der ägyptische Präsident Mubarak und der jordanische König Abdallah nach Mitteln zur Unterstützung der auseinanderfliegenden Fatah erörtert.
Der Mittlere Osten am Rande des Abgrunds
Das Drama im Gazastreifen offenbart, dass der ganze asiatische Kontinent am Abgrund kriegerischer Konflikte steht. Heute gibt es dort vier Epizentren von Konflikten und Spannungen: Irak, Iran, Syrien, Libanon und daneben den israelisch-palästinensischen Konflikt. Auch wenn diese Konflikte jeweils ihre eigene kriegerische und barbarische Dynamik haben, sind sie dabei, sich teilweise zu verschmelzen, so dass es nunmehr unmöglich wird, ihre tiefergehende Dynamik auseinanderzuhalten. Einige Wochen vor den kriegerischen Auseinandersetzungen im Gazastreifen wurde diese komplexe Dynamik uns vor Augen geführt durch die bewaffneten Zusammenstöße im Palästinenserlager Nah El Bared im Norden Libanons zwischen der libanesischen Armee und den von Fata-Al-Ilsam unterstützten Milizen, die wahrscheinlich wiederum von Syrien Hilfe erhalten. Die israelische Presse kommentierte dazu: „Die israelische Presse erörtert die Möglichkeit der Auslösung von Militäroperationen gegen Damaskus von diesem Sommer an, die politischen Führer werden aufgefordert, Entscheidungen zu treffen“. Das Chaos im Gazastreifen wird sich notwendigerweise auf die anderen Palästinenserlager im Libanon und Jordanien ausdehnen. Die palästinensische Regierung Abbas übt nur noch die Kontrolle in einigen wenigen Gebieten im Westjordanland aus. Ihre Macht wird noch weiter abnehmen; die Zusammenstöße zwischen Hamas und Fatah werden sich noch weiter verschärfen. Der Kampf um eine palästinensische Nation war seit jeher nur eine Verschleierung in den Händen der verschiedenen bürgerlichen palästinensischen Fraktionen, um die Arbeiter und die anderen Teile der Bevölkerung auf die Schlachtbank zu führen. Die von Hamas und Fatah betriebene Politik und die nunmehr nicht mehr abreißenden gewalttätigen Auseinandersetzungen zeigen, wohin dies führt: in die Barbarei und ins Nichts. Rossi, 6.Juli 2007 (aus der Zeitung der IKS in Frankreich).
(1) Die PLO wurde 1964 gegründet, sie setzte sich aus mehreren Organisationen zusammen – dazu gehörten Fatah, die Volksfront für die Befreiung Palästinas (FPLP) und die Demokratische Front für die Befreiung Palästinas (FDLP).
August 2007
- 688 reads
Arbeitsniederlegungen in Krefeld
- 3098 reads
Durch eine Vertreterin des Netzwerks Linke Opposition, die im Juli 2007 an unserer öffentlichen Diskussionsveranstaltung in Köln teilgenommen hat, haben wir über den Streik der Arbeiter der Firma Gellep-Stratum in Krefeld erfahren. Wichtig an diesem Streik ist die Solidarität, die dadurch zum Ausdruck gekommen ist, dass die ArbeiterInnen für ihre kranken und behinderten Kollegen gestreikt haben, die entlassen werden sollten. Ferner ist die Tatsache von großer Wichtigkeit, dass die ArbeiterInnen ohne Gewerkschaft gestreikt haben. Sie haben ihren Streik selber in die Hand genommen, haben ihn selber organisiert und durchgeführt.
Langsam beginnt sich wieder die Tendenz hin zu wilden Streiks zu zeigen, welche nach 1968 international so stark zum Ausdruck kam, um dann vor allem nach 1989 (Fall der Mauer) eine Zeitlang in den Hintergrund zu treten. Ausdrücke dieser Bewegung der unterirdischen Reifung, sind gerade das selbstständige Handeln der Klasse ohne Gewerkschaften und die Solidarität. Das Besondere an der Solidarität der Gellep-Stratum Belegschaft ist, dass sie sich schützend vor ihre kranken und behinderten Kollegen gestellt haben, derer sich die Geschäftsleitung in völligem Einklang mit der kapitalistischen Logik entledigen wollte. Wir alle kennen zu Genüge die hehren Sonntagsreden von verschiedenen Vertretern der Bourgeoisie, dass unsere demokratische Gesellschaft die „Schwächeren" schütze. Wer aber die „Schwächeren" in unserer Gesellschaft wirklich verteidigt, hat dieser Streik gezeigt: die Arbeiterklasse. Die Solidarität ist ein Wesensmerkmal der Arbeiterklasse, ohne die sie nicht kämpfen könnte. Die Solidarität der Arbeiterklasse bedeutet auch, dass man ein Bewusstsein darüber hat, dass ein Angriff der Bourgeoisie gegen einen Teil der Klasse einen Angriff gegen die gesamte Klasse bedeutet. Es ist wohl kaum ein Zufall, dass wir in den öffentlichen Medien möglichst wenig über Streiks wie bei Gellep-Stratum lesen können, weil die Arbeiterklasse ja erfahren könnte, dass man kämpfen kann und vor allem, dass sich das kämpfen lohnt!
IKS, August 2007
Gellep-Stratum: Kündigungen - Kollegen legen Werk lahm
Die Belegschaft des Autoteile-Herstellers TRW setzte sich durch: Die zehn Entlassungen sind „vom Tisch“.
Krefeld. Mit einer in heutiger Zeit ungewöhnlichen Solidaritätsaktion hat die 454-köpfige Belegschaft des Autoteileherstellers TRW Automotive GmbH in Gellep-Stratum die Werksleitung derart unter Druck gesetzt, dass zehn geplante Kündigungen nun vom Tisch sind. Die Mitarbeiter ließen einfach drei Schichten ausfallen. Acht Stunden standen sie jeweils auf dem Parkplatz des Werkes am Heidbergsweg.
Peter Behr, IG-Metall-Bevollmächtigter in Krefeld, war selbst überrascht. „So etwas habe ich noch nicht erlebt“, teilte er am Donnerstag mit. Das wegen zunehmenden Einsatzes von Leiharbeitern abseits des Haustarifvertrages ohnehin angespannte Verhältnis zwischen Betriebsrat und Werksleitung hatte vergangene Woche seinen Tiefpunkt erreicht.
Da legte der Arbeitgeber fünf Kündigungsanträge für Dauerkranke (länger als sechs Wochen arbeitsunfähig, bekommen keine Bezüge der Firma mehr) vor und offenbarte, auch noch fünf Schwerbehinderte entlassen zu wollen. Grund: Der Personalstand sei zu hoch, der Krankenstand ebenfalls.
Als der Werksleiter am vergangenen Freitag kurzfristig Mehrarbeit beantragte, so der Betriebsrat in seinem Flugblatt „Jagdzeiten 4“, habe er versichert, dass die beabsichtigten Kündigungen „auf Eis“ gelegt würden und noch keine Kündigung ausgesprochen worden sei. Fünf Minuten später habe dem Betriebsrat das Fax einer eigenhändig vom Chef unterschriebenen Kündigung vorgelegen.
Sonntagabend erschien die Nachtschicht um 22 Uhr – und blieb auf dem Parkplatz vor dem Werkstor stehen. Ebenso verfuhren die beiden folgenden Schichten. Die Leiharbeiter einer Zeitarbeitsfirma wurden heimgeschickt.
Nach 24 Stunden hatten die TRW-Mitarbeiter gesiegt. Unter Mitarbeit der Gewerkschaft und des Arbeitgeberverbandes wurde vereinbart, dass alle zehn Kündigungen vom Tisch sind, zwei Betriebsratsmitglieder bis zur nächsten Wahl freigestellt bleiben und jede Maßregelung von Beschäftigten unterbleibt. Nur die ausgefallene Arbeitszeit bekommen die Solidaritäts-Streikenden nicht bezahlt; sie können ihr Arbeitszeitkonto heranziehen.
In Gellep werden Querlenker und Spurstangen gefertigt
Weder Werksleiter noch Personalchef in Gellep-Stratum oder der für Europa zuständige Personalchef mit Sitz in Koblenz war en für die WZ erreichbar. „TRW Automotive Chassis Systems“ mit Standort Michigan (USA) beschäftigt weltweit 61 000 Mitarbeiter, in Deutschland an 19 Standorten 12 200. Am Heidbergsweg werden für Pkw Querlenker, Rad- und Flanschgelenke sowie Bremsmodule und für Lkw Lenk- und Spurstangen gefertigt.
06.04.2007
Von Alexander Alber/Westdeutsche Zeitung,
September 2007
- 763 reads
17. Kongress der IKS: Resolution zur internationalen Lage
- 2652 reads
Resolution zur internationalen Lage
1. Einer der wichtigsten Faktoren, die das derzeitige Leben der kapitalistischen Gesellschaft prägen, ist ihr Eintritt in die Zerfallsphase. Die IKS hat bereits seit dem Ende der achtziger Jahre auf die Ursachen und Wesenszüge dieser Zersetzungsphase der Gesellschaft hingewiesen. Sie hat insbesondere die folgenden Tatsachen hervorgehoben:
a) Die Phase des Zerfalls des Kapitalismus ist ein wesentlicher Bestandteil der Dekadenzperiode dieses Systems, die mit dem Ersten Weltkrieg eröffnet wurde (wie dies die große Mehrheit der Revolutionäre zu jenem Zeitpunkt erkannt hatte). In diesem Zusammenhang behält sie die Haupteigenschaften bei, die der Dekadenz des Kapitalismus eigen sind, wobei aber neue, bislang unbekannte Merkmale im gesellschaftlichen Leben hinzukommen.
b) Sie stellt die letzte Phase dieses Niedergangs dar, in der sich nicht nur die verhängnisvollsten Erscheinungen der vorhergehenden Phasen häufen, sondern das gesamte gesellschaftliche Gebäude am lebendigen Leib verfault.
c) Praktisch alle Aspekte der menschlichen Gesellschaft sind durch den Zerfall betroffen, auch und besonders jene, die für ihr Schicksal entscheidend sind, wie die imperialistischen Konflikte und der Klassenkampf. In diesem Sinn und vor dem Hintergrund der Zerfallsphase mit all ihren Begleiterscheinungen ist die gegenwärtige internationale Lage unter ihren hauptsächlichen Gesichtspunkten zu untersuchen, nämlich unter den Gesichtspunkten der wirtschaftlichen Krise des kapitalistischen Systems, der Konflikte innerhalb der herrschenden Klasse insbesondere auf der imperialistischen Bühne und schließlich unter dem Gesichtspunkt des Kampfes zwischen den zwei wesentlichen Gesellschaftsklassen, der Bourgeoisie und dem Proletariat.
2. Paradoxerweise ist die wirtschaftliche Lage des Kapitalismus am geringfügigsten vom Zerfall beeinträchtigt. Dies verhält sich hauptsächlich deshalb so, weil es gerade diese wirtschaftliche Lage ist, die in letzter Instanz die anderen Aspekte des Lebens dieses Systems bestimmt, einschließlich jener, die sich aus dem Zerfall ergeben. Ähnlich wie schon die Produktionsweisen, die dem Kapitalismus vorausgegangen waren, ist auch die kapitalistische Produktionsweise nach der Epoche ihres Aufstiegs, die Ende des 19. Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreicht hatte, zu Beginn des 20. Jahrhunderts in die Epoche ihres Niedergangs eingetreten. Die eigentlichen Ursachen dieser Dekadenz sind, wie auch bei den früheren Wirtschaftsordnungen, die wachsenden Spannungen zwischen den sich entwickelnden Produktivkräften und den Produktionsverhältnissen. Was konkret den Kapitalismus angeht, dessen Entwicklung durch die Eroberung außerkapitalistischer Märkte bedingt ist, so war der Erste Weltkrieg das erste bedeutende Anzeichen seiner Dekadenz. Als die koloniale und wirtschaftliche Eroberung der Welt durch die kapitalistischen Metropolen abgeschlossen war, waren diese dazu gedrängt, sich um die bereits verteilten Märkte zu streiten. In der Folge trat der Kapitalismus in eine neue Periode seiner Geschichte ein, die 1919 von der Kommunistischen Internationale als Ära der Kriege und der Revolutionen bezeichnet wurde. Das Scheitern der revolutionären Welle, die aus dem Ersten Weltkrieg entstanden war, ebnete so den Weg zu wachsenden Erschütterungen der kapitalistischen Gesellschaft: die große Rezession der dreißiger Jahre und ihre Folge, der Zweite Weltkrieg, der noch viel mörderischer und barbarischer war als der Erste Weltkrieg. Die darauffolgende Phase, von einigen bürgerlichen "Experten" als die "glorreichen Dreißig" bezeichnet, ließ die Illusion aufkommenen, dass der Kapitalismus seine zerstörerischen Widersprüche überwunden habe, eine Illusion, der selbst Strömungen erlegen waren, die sich auf die kommunistische Revolution beriefen. Ende der 1960er Jahre folgte auf dieser "Wohlstandsära", die sowohl auf zufälligen Umständen als auch auf spezifischen Gegenmaßnahmen zur Abmilderung der Auswirkungen der wirtschaftlichen Krise beruhte, erneut die offene Krise der kapitalistischen Produktionsweise, die sich Mitte der 70er Jahre noch verschärfte. Diese offene Krise des Kapitalismus deutete wieder auf die Alternative, die schon von der Kommunistischen Internationale angekündigt worden war: Weltkrieg oder Entwicklung der Arbeiterkämpfe mit der Perspektive der Überwindung des Kapitalismus. Der Weltkrieg ist im Gegensatz zu dem, was bestimmte Gruppen der Kommunistischen Linken denken, keineswegs eine "Lösung" der Krise, die es dem Kapitalismus erlauben würde, "sich zu regenerieren" und dynamisch einen neuen Zyklus zu beginnen. Die Sackgasse, in der sich dieses System befindet, die Zuspitzung der Spannungen zwischen den nationalen Sektoren des Kapitalismus führt auf der militärischen Ebene unweigerlich in die Flucht nach vorn, an deren Ende der Weltkrieg steht. Tatsächlich haben sich infolge der wachsenden wirtschaftlichen Zwänge des Kapitalismus die imperialistischen Spannungen ab den 1970er Jahren zugespitzt. Aber sie konnten nicht in dem Weltkrieg münden, da sich die Arbeiterklasse 1968 von ihrer historischen Niederlage wieder erholt hatte und sich gegen die ersten krisenbedingten Angriffe zur Wehr setzte. Trotz ihrer Fähigkeit, die einzig mögliche Perspektive (sofern man hier von "Perspektive" sprechen kann) der Bourgeoisie zu vereiteln, und trotz einer seit Jahrzehnten ungekannten Kampfbereitschaft, konnte aber auch die Arbeiterklasse ihre eigene Perspektive, die kommunistische Revolution, nicht in Angriff nehmen. Genau diese Konstellation, in der keine der beiden entscheidenden Klassen der Gesellschaft ihre Perspektive durchsetzen kann, in der sich die herrschende Klasse darauf beschränken muss, tagtäglich und sukzessiv das Versinken ihrer Wirtschaft in einer unüberwindbaren Krise zu "verwalten", ist die Ursache für den Eintritt des Kapitalismus in seine Zerfallsphase.
3. Eines der deutlichsten Anzeichen der fehlenden historischen Perspektive ist die Entwicklung des "Jeder-für-sich", das alle Ebenen der Gesellschaft, vom Individuum bis zu den Staaten, betrifft. Doch wäre es falsch zu meinen, dass es seit dem Beginn der Zerfallsphase im wirtschaftlichen Leben des Kapitalismus eine prinzipielle Änderung gegeben habe. Denn das "Jeder-für-sich", die Konkurrenz aller gegen alle gehört seit eh und je zum Wesen der kapitalistischen Produktionsweise Mit Eintritt in seine Dekadenzphase konnte der Kapitalismus diese Eigenschaften nur durch eine massive Intervention des Staates in die Wirtschaft bändigen; solche Staatsinterventionen begannen im Ersten Weltkrieg und wurden in den 1930er Jahren insbesondere mit den faschistischen und keynesianischen Programmen reaktiviert. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde dieser Staatsinterventionismus durch die Etablierung von internationalen Organisationen wie den IWF, die Weltbank und die OECD ergänzt, denen später die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft folgte (die Vorläuferin der heutigen Europäischen Union). Zweck dieser Institutionen war es, zu verhindern, dass die wirtschaftlichen Widersprüche in einer allgemeinen Auflösung münden, wie dies nach dem "Schwarzen Donnerstag" von 1929 der Fall gewesen war. Trotz aller Reden über den "Triumph des Liberalismus" und das "Gesetz des freien Marktes" verzichten die Staaten heute weder auf Interventionen in die Wirtschaft noch auf Strukturen, die die Aufgabe haben, die internationalen Beziehungen wenigstens ansatzweise zu regulieren. Im Gegenteil: in der Zwischenzeit sind weitere Institutionen geschaffen worden, wie beispielsweise die Welthandelsorganisation. Doch weder jene Programme noch diese Organisationen haben es erlaubt, die Krise des Kapitalismus zu überwinden, auch wenn sie das Tempo derselben beträchtlich gebremst hatten. Trotz ihrer Reden über die "historischen" Wachstumsraten der Weltwirtschaft und die außergewöhnlichen Leistungssteigerungen der beiden asiatischen Riesen, Indien und insbesondere China, ist es der Bourgeoisie nicht gelungen, mit der Krise fertig zu werden. In Tat und Wahrheit ist Letztere keineswegs Auswuchs eines "schlechten" Kapitalismus, der seine Verantwortung dafür "vergessen" habe, in wirklich produktive Sektoren zu investieren. Wie Marx schon im 19. Jahrhundert festgestellt hat, ist die Spekulation eine Folge der Tatsache, dass die Kapitalbesitzer angesichts des Mangels an zahlungskräftigen Absatzmärkten für ihre produktiven Investitionen es vorziehen, ihr Kapital zwecks Gewinnmaximierung kurzfristig in eine gigantische Lotterie zu stecken, eine Lotterie, die heute den Kapitalismus in ein weltumspannendes Kasino verwandelt hat. Der Wunsch, dass der Kapitalismus heutzutage auf die Spekulation verzichtet, ist so realistisch wie der Wunsch, dass aus Tigern Vegetarier werden. Darüber hinaus stellt die extreme Exportabhängigkeit der chinesischen Wirtschaft einen empfindlichen Punkt im Falle eines Nachfragerückgangs dar, eines Rückgangs, der unweigerlich kommen wird, insbesondere wenn die amerikanische Wirtschaft gezwungen wird, etwas Ordnung in die schwindelerregende Schuldenwirtschaft zu bringen, die es ihr momentan erlaubt, die Rolle der "Lokomotive" der weltweiten Nachfrage zu spielen. So wie das "Wunder" der asiatischen "Tiger" und "Drachen", die durch zweistellige Wachstumsraten geglänzt hatten, 1997 ein schmerzhaftes Ende fand, wird das heutige "chinesische Wunder", auch wenn es andere Ursachen hat und über wesentlich ernsthaftere Trümpfe verfügt, früher oder später unweigerlich in der historischen Sackgasse der kapitalistischen Produktionsweise landen. .
4. Die Gründe für die Wachstumsraten im weltweiten Bruttosozialprodukt im Laufe der letzten Jahre, welche die Bourgeois und ihre intellektuellen Lakaien in Euphorie versetzen, sind grundsätzlich nicht neu. Es sind dieselben wie jene, die verhindert haben, dass die Sättigung der Märkte, die den Ausbruch der Krise Ende der 1960er Jahre bewirkte, die weltweite Wirtschaft vollständig erdrosselt hatte; sie lassen sich unter dem Begriff der wachsenden Verschuldung subsummieren. Gegenwärtig stellt die gewaltige Verschuldung der amerikanischen Wirtschaft - sowohl in ihrem Staatsbudget als auch in ihrer Handelsbilanz - die wichtigste "Lokomotive" für den weltweiten Wachstum dar. Effektiv handelt es sich dabei um eine Flucht nach vorn, die weit entfernt davon ist, die Widersprüche des Kapitalismus zu lösen und uns nur eine noch schmerzhaftere Zukunft beschert, mit einer brutalen Verlangsamung des Wachstums, wie dies seit mehr als dreißig Jahren immer wieder der Fall gewesen war. Schon jetzt lösen die Gewitterwolken, die sich im Immobiliensektor in den Vereinigten Staaten - einer wichtigen Triebkraft der nationalen Ökonomie - mit der Gefahr von katastrophalen Bankenpleiten zusammenbrauen, große Sorgen in den maßgeblichen Wirtschaftskreisen aus. Diese Sorgen werden verstärkt durch die Aussicht auf andere Pleiten, die von "Hedgefonds" (spekulative Fonds) ausgehen, wie das Beispiel von Amaranth im Oktober 2006 veranschaulicht hat. Die Bedrohungslage ist um so ernsthafter, als diese Gebilde, deren Zweck darin besteht, kurzfristig große Profite zu machen, indem mit den Kursänderungen bei den Währungen oder den Rohstoffen spekuliert wird, keineswegs Heckenschützen des internationalen Finanzsystems sind. Vielmehr platzieren die "seriösesten" Finanzinstitute einen Teil ihrer Guthaben in diesen "Hedgefonds". So sind die in diesen Fonds investierten Summen derart gewaltig, dass sie dem jährlichen Bruttoinlandsprodukt eines Landes wie Frankreich gleichkommen, wobei sie wiederum einem noch sehr viel beträchtlicheren Kapitalverkehr als "Transmissionsriemen" dienen (etwa 700.000 Milliarden Dollar im Jahr 2002, das heißt 20 Mal mehr als die Transaktionen von Gütern und Dienstleistungen, also der "realen" Produkte). Und es gibt keine Weisheiten von "Globalisierungsgegnern" und anderen Gegnern der "Verfinanzung" der Wirtschaft, die daran auch nur das Geringste ändern könnten. Diese politischen Strömungen möchten einen "sauberen", "gerechten" Kapitalismus, der insbesondere die Spekulation unterbindet.
5. Die außergewöhnlichen Wachstumsraten, die gegenwärtig Länder wie Indien und insbesondere China erleben, stellen in keiner Weise einen Beweis für einen "frischen Wind" in der Weltwirtschaft dar, selbst wenn sie im Laufe der letzten Zeit beträchtlich zum erhöhten Wachstum derselben beigetragen haben. Die Grundlage dieses außergewöhnlichen Wachstums in beiden Ländern wiederum ist paradoxerweise die Krise des Kapitalismus. In der Tat resultiert die wesentliche Dynamik dieses Wachstums aus zwei Faktoren: den Ausfuhren und den Investitionen von Kapital, das aus den höchstentwickelten Ländern stammt. Wenn der Handel dieser Länder sich immer mehr auf Güter verlagert, die in China statt in den "alten" Industrieländern hergestellt werden, so geschieht dies, weil sie zu sehr viel niedrigeren Preisen verkauft werden können, was immer mehr zum obersten Gebot wird, je gesättigter die Märkte sind und je schärfer die Handelskonkurrenz wird. Gleichzeitig erlaubt dieser Prozess dem Kapital, die Kosten der Arbeitskraft in den Industrieländern zu vermindern. Der gleichen Logik gehorcht auch das Phänomen der "Auslagerung", des Transfers der Industrieproduktion der großen Unternehmen in Länder der Dritten Welt, wo die Arbeitskräfte unvergleichlich billiger sind als in den höchstentwickelten Ländern. Es ist übrigens festzustellen, dass die chinesische Wirtschaft einerseits von diesen "Auslagerungen" auf ihr eigenes Territorium profitiert, andererseits aber selbst dazu tendiert, genauso gegenüber Ländern zu verfahren, wo die Löhne noch niedriger sind.
6. Das "zweistellige Wachstum" Chinas (insbesondere seiner Industrie) findet vor dem Hintergrund einer hemmungslosen Ausbeutung der Arbeiterklasse dieses Landes statt, die oft Lebensbedingungen kennt, die mit jenen der englischen Arbeiterklasse in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vergleichbar sind – Arbeitsbedingungen, die von Engels 1844 in seinem bemerkenswerten Werk Die Lage der arbeitenden Klasse in England angeprangert wurden. Für sich genommen sind diese Bedingungen kein Kennzeichen des Bankrotts des Kapitalismus, denn dieses System hat sich einst mithilfe einer ebenso barbarischen Ausbeutung des Proletariats aufgemacht, die Welt zu erobern. Und doch gibt es grundlegende Unterschiede zwischen dem Wirtschaftswachstum und den Bedingungen der Arbeiterklasse in den ersten kapitalistischen Ländern des 19. Jahrhunderts einerseits und denjenigen im heutigen China andererseits:
- in den Erstgenannten hat die Erhöhung der Zahl der Industriearbeiter in dem einen Land nicht mit einer Verminderung in dem anderen korrespondiert; vielmehr haben sich die Industriesektoren in Ländern wie England, Frankreich, Deutschland oder den Vereinigten Staaten parallel entwickelt. Gleichzeitig haben sich die Lebensbedingungen des Proletariats insbesondere dank seines Widerstandes während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stetig verbessert;
- was das heutige China betrifft, so wächst die Industrie dieses Landes (wie die anderer Länder der Dritten Welt) auf Kosten zahlreicher Industriesektoren, die in den alten kapitalistischen Ländern verschwinden; gleichzeitig sind die "Auslagerungen" Waffen eines allgemeinen Angriffs auf die Arbeiterklasse dieser Länder, eines Angriffs, der begonnen hat, lange bevor die "Auslagerungen" zur gängigen Praxis geworden sind. Doch die Auslagerungen von Produktionsstätten erlaubt es der Bourgeoisie, den Angriff in puncto Arbeitslosigkeit, berufliche Dequalifizierung, Verelendung und Senkung des Lebensstandards zu intensivieren.
Somit ist das "chinesische Wunder" und anderer Länder der Dritten Welt weit entfernt davon, einen "frischen Wind" für die kapitalistische Wirtschaft darzustellen. Es ist nichts anderes als eine Variante des niedergehenden Kapitalismus.
7. In keinem Land dieser Erde kann die Wirtschaft den Zwangsläufigkeiten der Dekadenz entgehen. Und das mit gutem Grund, denn die Dekadenz geht vor allem von der ökonomischen Frage aus. Dennoch äußern sich heute die deutlichsten Zeichen des Zerfalls nicht auf der ökonomischen Ebene. Vielmehr zeigen sie sich im politischen Bereich der kapitalistischen Gesellschaft, in den Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Sektoren der herrschenden Klasse und insbesondere in den imperialistischen Auseinandersetzungen. So trat das erste bedeutende Anzeichen für den Eintritt des Kapitalismus in die Zerfallsphase auf der Ebene der imperialistischen Konflikte auf: des Zusammenbruchs des imperialistischen Ostblocks Ende der 1980er Jahre, der sehr schnell auch die Auflösung des westlichen Blocks nach sich zog. Es sind heute also vor allem die politischen, diplomatischen und militärischen Beziehungen zwischen den verschiedenen Staaten, in denen sich das "Jeder-für-sich", das Hauptmerkmal der Zerfallsphase, äußert. Das Blocksystem im Kalten Krieg beinhaltete zwar die Gefahr eines dritten Weltkrieges (der allerdings nicht ausbrach, weil seit Ende der 1960er Jahre die internationale Arbeiterklasse im Weg stand); gleichzeitig ermöglichte jedoch die Existenz der Blöcke, dass die imperialistischen Spannungen gewissermaßen in "geordnete Bahnen" gelenkt wurden, vor allem durch die Kontrolle, die in beiden Lagern durch die jeweils führende Macht ausgeübt wurde. Seit 1989 ist die Situation eine völlig andere. Zwar hat sich die akute Gefahr eines Weltkrieges vermindert, doch gleichzeitig fand eine wahre Entfesselung imperialistischer Rivalitäten und lokaler Kriege unter direkter Beteiligung der größeren Mächte statt, allen voran der USA. Das weltweite Chaos, das seit dem Ende des Kalten Krieges um sich griff, zwang die USA, ihre Rolle als "Weltpolizist", die sie seit Jahrzehnten spielt, noch zu verstärken. Jedoch führt dies keineswegs zu einer Stabilisierung der Welt; den USA geht es nur noch darum, krampfhaft ihre führende Rolle aufrechtzuerhalten. Eine Führungsrolle, die vor allem durch die ehemaligen Verbündeten permanent in Frage gestellt wird, da die Grundvoraussetzung der ehemaligen Blöcke, die Bedrohung durch den anderen Block, nicht mehr existiert. In Ermangelung der "sowjetischen Gefahr" bleibt das einzige Mittel für die USA zur Durchsetzung ihrer Disziplin das Ausspielen ihrer größten Stärke - der absoluten militärischen Überlegenheit. Dadurch wird die Politik der USA selbst zu einem der stärksten Zerrüttungsfaktoren der Welt. Seit Beginn der 1990er Jahre häufen sich die Beispiele dafür: Der erste Golfkrieg 1991 hatte zum Ziel, die sich auflösenden Verbindungen zwischen den Ländern des ehemaligen Westblocks wieder fester zu schnüren (es ging nicht, wie vorgetäuscht, um die "Verteidigung des verletzten Völkerrechts" und gegen die Besetzung Kuwaits durch den Irak). Kurz darauf zerrissen die Bande unter den Ländern des ehemaligen westlichen Blocks gänzlich: Deutschland schürte das Feuer in Jugoslawien, indem es Slowenien und Kroatien ermunterte, ihre Unabhängigkeit zu erklären. Frankreich und Großbritannien bildeten erneut, wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts, eine "Große Allianz", indem sie gemeinsam die imperialistischen Interessen Serbiens unterstützten, und die USA spielten sich als die Beschützer der Muslime Bosniens auf.
8. Die Niederlage der US-Bourgeoisie während der 1990er Jahre in den verschiedenen Militäroperationen, mit denen sie ihre Führungsrolle verankern wollte, hat sie dazu gezwungen, einen neuen "Feind" der "freien Welt" und der Demokratie zu suchen, mit dem sie die Großmächte, vor allem aber ihre ehemaligen Verbündeten, hinter sich scharen konnte: Sie fand ihn im islamistischen Terrorismus. Die Attentate des 11. September 2001, die in den Augen eines Drittels der amerikanischen Bevölkerung und der Hälfte der Einwohner von New York vom amerikanischen Staat wahrscheinlich so gewollt oder sogar vorbereitet wurden, dienten als Anlass für den neuen Kreuzzug. Fünf Jahre später ist das Ergebnis dieser Politik offenkundig. Wenn die Attentate des 11. September es den USA noch erlaubt hatten, Länder wie Frankreich und Deutschland in ihre Intervention in Afghanistan einzubinden, so hatte es nicht mehr dazu gereicht, diese in das Abenteuer im Irak 2003 zu zwingen. Im Gegenteil hatten diese beiden Länder zusammen mit Russland ein kurzfristiges Bündnis gegen die Intervention im Irak geschmiedet. Auch jene "Verbündete", die anfangs der "Koalition" angehörten, die im Irak intervenierte, wie Spanien und Italien, haben mittlerweile das sinkende Schiff verlassen. Die US-Bourgeoisie hat keines ihrer zu Beginn groß angekündigten Ziele erreicht: weder die Zerstörung von "Massenvernichtungswaffen" im Irak noch die Errichtung einer friedlichen "Demokratie" in diesem Land oder die Stabilisierung und Rückkehr des Friedens in der gesamten Region unter der Ägide der USA, die Zurückdrängung des Terrorismus oder die Akzeptanz der militärischen Interventionen ihres Regimes in der US-Bevölkerung. Das Geheimnis der "Massenvernichtungswaffen" hatte sich schnell gelüftet: Es wurde klar, dass die einzigen im Irak vorhandenen Massenvernichtungswaffen von der "Koalition" selbst mitgebracht worden waren. Dies enthüllte die Lügen, mit denen die Bush-Administration ihre Intervention in dieses Land rechtfertigen wollte. Bezüglich der Zurückdrängung des Terrorismus gilt festzustellen, dass die Invasion im Irak ihm keineswegs die Flügel gestutzt hat, sondern im Gegenteil zu dessen Verstärkung beigetragen hat, sei es im Irak selbst oder in anderen Teilen der Welt so wie auch in den Metropolen des Kapitalismus, wie aus den Anschlägen im März 2004 in Madrid und im Juli 2005 in London ersichtlich wird. Aus der geplanten Errichtung einer friedlichen "Demokratie" im Irak ist lediglich die Installation einer Marionetten-Regierung geworden, die ohne die massive Unterstützung der US-Truppen nicht die geringste Kontrolle über das Land ausüben könnte. Eine "Kontrolle", die sich ohnehin nur auf einige "Sicherheitszonen" beschränkt und den Rest des Landes der gegenseitigen Massakrierung der schiitischen und sunnitischen Bevölkerungsteile sowie den Terroranschlägen überlassen hat, die seit der Entmachtung Saddam Husseins Tausende von Menschenleben gefordert haben. Stabilität und Frieden im Mittleren und Nahen Osten waren noch nie so weit entfernt wie heute. Im 50-jährigen Konflikt zwischen Israel und Palästina hat es in den vergangenen Jahren eine neuerliche Zuspitzung der Situation als Ganzes sowie der Zusammenstöße unter den Palästinensern zwischen Fatah und Hamas gegeben; auch der ohnerhin schon beträchtliche Gesichtsverlust der israelischen Regierung wird immer dramatischer. Zweifellos ist der Autoritätsverlust des amerikanischen Riesen in der Region infolge seiner bitteren Niederlage im Irak eng mit dem Chaos und dem Scheitern des "Friedensprozesses", dem er Paten stand, verknüpft. Dieser Autoritätsverlust ist auch Grund für die vermehrten Schwierigkeiten der NATO-Truppen in Afghanistan und für en Kontrollverlust der Regierung Karzai gegenüber den Taliban. Überdies ist die zunehmende Dreistigkeit, die der Iran bei der Vorbereitung seiner Atomwaffenproduktion an den Tag legt, eine direkte Konsequenz aus dem Versinken der USA im irakischen Sumpf, was Letzteren weitere militärische Interventionen verunmöglicht. Und schlussendlich haben sich die Anstrengungen der US-Bourgeoisie, das "Vietnam-Syndrom" endlich zu überwinden, also den Widerstand innerhalb der heimischen Bevölkerung gegen die Entsendung von Soldaten auf das Schlachtfeld aufzuheben, gerade in ihr Gegenteil verkehrt. Nachdem die Emotionen, die durch die Attentate des 11. September geschürt wurden, zunächst die nationalistischen Aufwallungen, den Willen zur "nationalen Einheit" und die Entschlossenheit, sich am "Kampf gegen den Terrorismus" zu beteiligen, gestärkt hatten, sind mittlerweile die Zweifel am Krieg und an der Entsendung von amerikanischen Truppen wieder erheblich gewachsen. Heute steckt die US-Bourgeoisie im Irak in einer regelrechten Sackgasse. Einerseits haben die USA nicht die militärischen, wirtschaftlichen und politischen Mittel, um in diesem Land irgendeine "Ordnung" wiederherzustellen. Andererseits können die USA es sich nicht erlauben, sich aus dem Irak zurückzuziehen, die Niederlage ihrer Politik offen einzugestehen und den Irak einer totalen Zerstückelung sowie die gesamte Region einer wachsenden Destabilisierung zu überlassen.
9. Die Regierungsbilanz von Bush junior ist sicher eine der katastrophalsten in der Geschichte der USA. Die Beförderung der so genannten "Neokonservativen" an die Staatsspitze 2001 war ein regelrechtes Desaster für die US-Bourgeoisie. Weshalb hat die führende Bourgeoisie der Welt diese Bande von Abenteurern und Stümpern dazu berufen, ihre Interessen zu vertreten? Was war der Grund für die Blindheit der herrschenden Klasse des stärksten kapitalistischen Landes der Welt? Tatsächlich war die Beauftragung der Bande um Cheney, Rumsfeld und Konsorten mit den Regierungsgeschäften keineswegs eine ebenso simple wie gigantische "Fehlbesetzung" durch die US-Bourgeoisie. Wenn sich die Lage der USA auf dem imperialistischen Terrain noch sichtbarer verschlechtert hat, so ist dies vor allem Ausdruck der Sackgasse, in der sich dieses Land schon zuvor durch den zunehmenden Verlust ihrer Führungsrolle befand, und des allgemein herrschenden "Jeder-für-sich" in den internationalen Beziehungen, das die Zerfallsphase kennzeichnet. Dies beweist die Tatsache, dass die erfahrenste und intelligenteste Bourgeoise der Welt, die herrschende Klasse Großbritanniens, sich in das Irak-Abenteuer ziehen ließ. Ein anderes Beispiel für den Hang zu Unheil bringenden imperialistischen Schritten von Seiten der "fähigsten" Bourgeoisien - jener, die bisher meisterlich ihre militärische Stärke ausspielen konnten – ist, eine Nummer kleiner, das katastrophale militärische Abenteuer Israels im Libanon im Jahr 2006. Eine Offensive, die grünes Licht aus Washington erhalten hatte und die Hisbollah schwächen sollte, aber im Gegenteil eine Stärkung dieser Gruppierung zur Folge hatte.
10. Das militärische Chaos, das sich über die Erde ausbreitet und ganze Gebiete in einen Abgrund der Verwüstung stürzt - vor allem im Nahen und Mittleren Osten sowie in Afrika – ist keineswegs der einzige Ausdruck der historischen Sackgasse, in der sich der Kapitalismus befindet, und letztlich auch nicht die größte Bedrohung für die Gattung Mensch. Heute wird immer deutlicher, dass die Aufrechterhaltung des kapitalistischen Systems und seiner Funktionsweise auch die Zerstörung der Umwelt, die die Entwicklung der Menschheit erst ermöglichte, mit sich bringt. Der anhaltende Ausstoß von Treibhausgasen im heutigen Ausmaß und die Erwärmung des Planeten werden nie dagewesene klimatische Katastrophen auslösen (Orkane, Verwüstungen, Überschwemmungen, usw.), die mit schrecklichen menschlichen Leiden (Hunger, Vertreibung von Millionen von Menschen, Überbevölkerung in den bisher am meisten verschonten Regionen, usw.) einhergehen. Angesichts der unübersehbaren Anzeichen der Umweltzerstörung können die Regierungen und die führenden Teile der Bourgeoisie die Dramatik der Lage und die sich abzeichnenden Katastrophen nicht länger vor der Bevölkerung verheimlichen. Darum präsentieren sich die Bourgeoisien und fast alle bürgerlichen Parteien der Industrieländer im grünen Gewand und versprechen, Maßnahmen zu ergreifen, um die aufkommenden Katastrophen von der Menschheit abzuwenden. Doch mit dem Problem der Umweltzerstörung verhält es sich ähnlich wie mit den Kriegen: Alle Teile der herrschenden Klasse sind gegen den Krieg, und dennoch ist diese Klasse seit dem Eintritt des Kapitalismus in die Dekadenz unfähig, einen Frieden zu garantieren. Hier handelt es sich keinesfalls um eine Frage des guten oder schlechten Willens (auch wenn in den Fraktionen, die den Krieg am eifrigsten anfeuern, die schmutzigsten Interessen zu finden sind). Selbst die "pazifistischsten" Führer der herrschenden Klasse können der objektiven Logik nicht entfliehen, die ihren "humanistischen" Anwandlungen und der "Vernunft" keinen Raum lässt. Im gleichen Maße ist der von den Spitzen der herrschenden Klasse plakativ zur Schau gestellte "gute Wille", die Umwelt zu schützen, angesichts der Zwänge der kapitalistischen Wirtschaft wirkungslos. Meist handelt es sich eh nur um Lippenbekenntnisse, mit denen möglichst viele Wählerstimmen erschlichen werden sollen. Sich dem Problem des Ausstoßes von Treibhausgasen ernsthaft zu stellen würde beträchtliche Veränderungen in der Industrie, der Energieproduktion, dem Transportwesen und den Wohnverhältnissen erfordern und massive Investitionen in diese Sektoren nach sich ziehen. Es würde überdies die gewichtigen ökonomischen Interessen der großen Masse der Unternehmer, aber auch des Staates selbst in Frage stellen. Konkret: Jeder Staat, der die notwendigen Maßnahmen ergreifen würde, um einen wirkungsvollen Beitrag zur Lösung des Problems beizusteuern, fände sich sofort und massiv in seiner Konkurrenzfähigkeit auf dem internationalen Markt eingeschränkt. Die Staaten verhalten sich bezüglich der Maßnahmen zur Eindämmung der Erderwärmung so wie die Fabrikanten gegenüber den Lohnerhöhungen der Arbeiter: Sie sind alle dafür… solange die anderen davon betroffen sind. So lange die kapitalistische Produktionsweise besteht, ist die Menschheit dazu verdammt, unter einer immer dickeren Rußschicht zu leiden, die dieses System in seiner Agonie über den Erdball zieht, ein Phänomen, das das System selbst zu bedrohen beginnt. Wie die IKS schon vor mehr als 15 Jahren hervorgehoben hat, bedeutet der zerfallende Kapitalismus eine Bedrohung für das Überleben der Menschheit. Die von Engels Ende des 19. Jahrhunderts formulierte Alternative "Sozialismus oder Barbarei" ist im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einer schrecklichen Realität geworden. Was uns das 21. Jahrhundert in Aussicht stellt, ist in der Tat "Sozialismus oder Zerstörung der Menschheit". Und das ist die Herausforderung, vor der die einzige Klasse in der Gesellschaft steht, die den Kapitalismus überwinden kann, die Arbeiterklasse.
11. Mit dieser Aufgabe ist die Arbeiterklasse konfrontiert, seit sie 1968 wieder auf die historische Bühne getreten war und damit der schlimmsten Konterrevolution in ihrer Geschichte ein Ende bereitet hatte. Ihr Wiederauftreten verhinderte, dass der Kapitalismus seine Lösung für die offene Wirtschaftskrise, den Weltkrieg, durchsetzen konnte. In den darauffolgenden zwei Jahrzehnten fanden Kämpfe der Arbeiterklasse mit all ihren Höhen und Tiefen, Fortschritten und Rückschlägen statt; Kämpfe, die es der Arbeiterklasse erlaubten, Erfahrungen zu sammeln, vor allem über die Rolle der Gewerkschaften als Saboteure des Klassenkampfes. Doch gleichzeitig wurde die Arbeiterklasse zunehmend dem Gewicht des Zerfalls ausgesetzt, was vor allem erklärt, dass die Ablehnung der klassischen Gewerkschaften vom Rückzug in den Korporatismus begeleitet war, eine Folge des Jeder-gegen-Jeden, das selbst im Klassenkampf seinen Ausdruck findet. Es war tatsächlich der Zerfall des Kapitalismus, der durch seine spektakulärste Äußerung, den Zusammenbruch des Ostblocks und der stalinistischen Regimes 1989, dieser ersten Reihe von Arbeiterkämpfen ein Ende bereitet hatte. Die ohrenbetäubende Kampagne der Bourgeoisie über das "Ende des Kommunismus", den "endgültigen Sieg des liberalen und demokratischen Kapitalismus" und das "Ende des Klassenkampfes", ja der Arbeiterklasse selbst haben dem Proletariat auf der Ebene des Bewusstseins und der Kampfbereitschaft einen herben Rückschlag versetzt. Dieser Rückschlag war nachhaltig und dauerte über zehn Jahre. Er hat eine ganze Generation von Arbeitern geprägt und Ratlosigkeit, ja selbst Demoralisierung ausgelöst. Diese Ratlosigkeit machte sich aber nicht lediglich aufgrund der Ereignisse Ende der 1980er Jahre breit, sondern auch angesichts ihrer Folgeerscheinungen wie den ersten Golfkrieg 1991 und den Krieg in Ex-Jugoslawien. Diese Ereignisse widerlegten zwar klar und deutlich die euphorischen Erklärungen von US-Präsident Bush senior nach dem Ende des Kalten Krieges, dass nun eine "Ära des Friedens und Wachstums" angebrochen sei, doch bewirkten sie angesichts der allgemeinen Ratlosigkeit in der Klasse keine Weiterentwicklung des Bewusstseins. Im Gegenteil hatten diese Ereignisse ein tiefes Gefühl der Machtlosigkeit in der Arbeiterklasse hinterlassen, was das Selbstvertrauen und die Kampfbereitschaft weiter sinken ließ.
Doch auch in den 90er Jahren hatte die Arbeiterklasse den Kampf nicht völlig aufgegeben. Die anhaltenden Angriffe des kapitalistischen Systems zwangen sie zur Gegenwehr. Doch diese Kämpfe wiesen nicht die Dimension, das Bewusstsein und die Fähigkeit auf, den Gewerkschaften so entgegenzutreten, wie dies noch in der vorangegangenen Periode der Fall gewesen war. Erst im Laufe des Jahres 2003 begann sich das Proletariat vor allem in Gestalt der großen Mobilisierungen in Frankreich und Österreich gegen die Angriffe auf die Altersrenten wieder von den Rückschlägen nach 1889 zu erholen. Seither hat sich die Tendenz zur Wiederaufnahme des Klassenkampfes und zur Weiterentwicklung des Bewusstseins bestätigt. Überall in den zentralen Ländern haben Arbeiterkämpfe stattgefunden, auch in den wichtigsten wie in den USA (Boeing und öffentlicher Verkehr in New York 2005), in Deutschland (Daimler und Opel 2004, Spitalärzte im Frühling 2006, Deutsche Telekom im Frühling 2007), Großbritannien (Londoner Flughafen im August 2005, öffentlicher Dienst im Frühling 2006), Frankreich (Studenten und Schüler gegen den CPE im Frühling 2006), aber auch in einer eine ganze Reihe von peripheren Ländern wie Dubai (Bauarbeiter im Frühling 2006), Bangladesh (Textilarbeiter im Frühling 2006), Ägypten (Textil- und Transportarbeiter im Frühling 2007).
12. Engels schrieb einst, dass die Arbeiterklasse ihren Kampf auf drei Ebenen führt: auf der ökonomischen, der politischen und der theoretischen Ebene. Erst wenn wir die Welle von Kämpfen nach 1968 und jene seit 2003 auf diesen Ebenen vergleichen, können wir die Perspektive der gegenwärtigen Phase ausmachen. Die Kämpfe nach 1968 hatten eine große politische Bedeutung: Sie stellten das Ende der Periode der Konterrevolution dar. Sie riefen auch einen theoretischen Denkprozess hervor, der das Wiederauftauchen von linkskommunistischen Strömungen begünstigte, von denen die Gründung der IKS 1975 der wichtigste Ausdruck war. Die Arbeiterkämpfe vom Mai 1968 in Frankreich und der "Heiße Herbst" 1969 in Italien ließen angesichts ihrer politischen Forderungen vermuten, dass eine Politisierung der Arbeiterklasse auf internationaler Ebene bevorsteht. Doch diese Erwartungen wurden nicht erfüllt. Die Identität, die sich innerhalb der Klasse durch diese Kämpfe entwickelte, war vielmehr von ökonomischen Kategorien geprägt und weniger eine Identifizierung mit ihrer politischen Kraft innerhalb der Gesellschaft. Die Tatsache, dass diese Kämpfe die herrschende Klasse daran hinderten, den Weg zu einem dritten Weltkrieg einzuschlagen, wurde von der Arbeiterklasse (inklusive der Mehrheit der revolutionären Gruppierungen) nicht wahrgenommen. Der Massenstreik in Polen 1980 hatte, auch wenn er einen (seit dem Ende der revolutionären Welle nach dem Ersten Weltkrieg) neuen Höhepunkt in puncto Organisationskraft der Arbeiterklasse darstellte, eine entscheidende Schwäche: Die einzige "Politisierung", die stattfand, war die Annäherung an bürgerlich-demokratische Ideen und an den Nationalismus. Die IKS hatte schon damals folgende Feststellungen gemacht:
- das langsame Tempo der Wirtschaftskrise machte es im Gegensatz zum imperialistischen Krieg, aus dem die erste globale revolutionäre Welle hervorgegangen war, möglich, den Niedergang des Systems zu verschleiern, was Illusionen über die Fähigkeit des Kapitalismus schürte, der Arbeiterklasse ein gutes Leben zu sichern;
- es existierte aufgrund der traumatischen Erfahrung mit dem Stalinismus ein Misstrauen gegenüber den revolutionären politischen Organisationen (unter den Arbeitern in den Ländern des Ostblocks hatte dies gar große Illusionen über die "Vorteile" der traditionellen bürgerlichen Demokratie hervorgerufen);
- der organische Bruch hatte die revolutionären Organisationen von ihrer Klasse abgeschnitten.
13. Die Situation, in der sich heute die neue Welle von Klassenkämpfen entfaltet, ist eine völlig andere:
- nahezu vierzig Jahre der offenen Krise und Angriffe gegen die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse und vor allem die wachsende Arbeitslosigkeit und Prekarisierung haben die Illusionen weggefegt, "dass es uns morgen besser gehen wird": Die alten und auch die jungen Generationen werden sich immer bewusster, dass es ihnen morgen noch schlechter ergehen wird als heute;
- das Andauern der immer barbarischeren kriegerischen Auseinandersetzungen sowie die Bedrohung durch die Umweltzerstörung erzeugen eine (wenn auch noch konfuse) Ahnung, dass sich diese Gesellschaft grundsätzlich ändern muss. Das Auftauchen der Antiglobalisierungs-Bewegung mit ihrer Parole: "Eine andere Welt ist möglich" stellt dabei ein Gegengift dar, das von der bürgerlichen Gesellschaft verbreitet wird, um diese Ahnungen auf falsche Bahnen zu lenken;
- das Trauma, das durch den Stalinismus und die nach seinem Zerfall vor fast zwanzig Jahren ausgelösten Kampagnen verursacht wurde, klingt langsam ab. Die Arbeiter der neuen Generation, die heute ins aktive Leben treten und sich damit auch potenziell am Klassenkampf beteiligen, befanden sich zur Zeit der schlimmsten Kampagnen über den so genannten "Tod des Kommunismus" noch im Kindesalter.
Diese Bedingungen bewirken eine Reihe von Unterschieden zwischen der heutigen Welle von Kämpfen und jener, die 1989 endete. Auch wenn sie eine Reaktion auf ökonomische Angriffe sind, die ungleich heftiger und allgemeiner sind als jene, die das spektakuläre und massive Auftauchen der ersten Welle verursacht hatten, so haben die aktuellen Kämpfe in den zentralen Ländern des Kapitalismus noch nicht denselben massiven Charakter. Dies vor allem aus zwei Gründen:
- das historische Wiederauftauftauchen der Arbeiterklasse Ende der 1960er Jahre hatte die herrschende Klasse überrascht. Heute dagegen ist dies nicht mehr der Fall. Die Bourgeoisie unternimmt alles Mögliche, um der Arbeiterklasse zuvorzukommen und die Ausdehnung der Kämpfe vor allem durch ein systematisches mediales Ausblenden zu verhindern;
- der Einsatz von Streiks ist heute viel heikler, weil das Gewicht der Arbeitslosigkeit als Druckmittel gegen die Arbeiterklasse wirkt und Letztere sich auch bewusst ist, dass der Spielraum der Bourgeoisie zur Erfüllung von Forderungen immer kleiner wird.
Dieser letzte Aspekt ist jedoch nicht nur ein Faktor, der die Arbeiter vor massiven Kämpfen zurückschrecken lässt. Er erfordert auch ein tiefes Bewusstsein über das endgültige Scheitern des Kapitalismus, das eine Bedingung dafür ist, dass sich ein Bewusstsein über die Notwendigkeit der Überwindung dieses Systems bildet. In einer gewissen Weise sind die Hemmungen der Arbeiterklasse, sich in den Kampf zu stürzen, durch das schiere Ausmaß der Aufgaben bedingt, mit denen die kämpfende Klasse konfrontiert wird, nämlich mit nichts Geringerem als die proletarische Revolution. Auch wenn die ökonomischen Kämpfe der Klasse momentan weniger heftig sind als die Kämpfe nach 1968, enthalten sie eine gewichtigere politische Dimension. Bereits jetzt machen sich die Kämpfe, die wir seit 2003 erleben, mehr und mehr die Frage der Solidarität zu eigen, eine Frage von höchster Wichtigkeit, da sie das wirksamste "Gegengift" zum für den gesellschaftlichen Zerfall typischen "Jeder-für-sich" darstellt und vor allem weil sie in ihrem Kern die Fähigkeit des Weltproletariates ausmacht, nicht nur die gegenwärtigen Kämpfe zu entfalten, sondern auch den Kapitalismus zu überwinden:
- der spontane Streik der Daimler-Arbeiter in Bremen gegen die Angriffe auf die Belegschaft ihres Betriebes in Stuttgart;
- der Solidaritätsstreik der GepäckarbeiterInnen in einem Londoner Flughafen gegen die Entlassungen von Angestellten eines Catering-Unternehmens, und dies trotz der Illegalität des Streiks;
- der Streik der Transportangestellten in New York aus Solidarität mit der jungen Generation, die die Direktion unter schlechteren Konditionen einstellen wollte.
14. Die Frage der Solidarität stand auch im Zentrum der Bewegung gegen das CPE-Gesetz in Frankreich im Frühjahr 2006, die sich -unter hauptsächlicher Beteiligung von StudentInnen und OberschülerInnen – voll und ganz auf dem Terrain der Arbeiterklasse befand:
- aktive Solidarität der Studierenden besser gestellter Universitäten mit den StudentInnen anderer Universitäten;
- Solidarität gegenüber den Kindern der Arbeiterklasse in den Vorstädten, deren Revolten im Herbst 2005 die miserablen Lebensbedingungen und die fehlenden Perspektiven, die ihnen der Kapitalismus bietet, ans Licht gebracht hatten;
- Solidarität unter den verschiedenen Generationen: zwischen jenen, die vor der Arbeitslosigkeit und prekären Arbeitsbedingungen stehen, und jenen, die sich bereits in einem Lohnarbeitsverhältnis befinden; zwischen jenen, die nun in den Klassenkampf eintreten, und jenen, die bereits einschlägige Erfahrungen gesammelt haben.
15. Diese Bewegung war auch beispielhaft für die Fähigkeit der Klasse, ihre Kämpfe selbst in die Hand zu nehmen, mit Vollversammlungen und ihnen gegenüber verantwortlichen Streikkomitees (dies haben wir auch während des Streiks in den Metallbetrieben im spanischen Vigo Frühjahr 2006 gesehen, wo tägliche Vollversammlungen aller beteiligten Belegschaften auf der Straße abgehalten wurden). Die extreme Schwäche der Gewerkschaften im studentischen Milieu hatte dies ermöglicht; die Gewerkschaften konnten ihre traditionelle Rolle als Saboteure des Klassenkampfes nicht ausüben, eine Rolle, die sie bis zur Revolution verkörpern werden. Ein Beispiel für die arbeiterfeindliche Rolle der Gewerkschaften ist die Tatsache, dass die jüngsten Kämpfe oft in Ländern stattfanden, in denen die Gewerkschaften noch sehr schwach vertreten sind (wie in Bangladesh) oder direkt als Organe des Staates auftreten (wie in Ägypten).
16. Die Bewegung gegen das CPE-Gesetz, die in jenem Land stattfand, in dem auch die erste und spektakulärste Manifestation des historischen Wiedererwachens der Arbeiterklasse stattgefunden hatte, der Generalstreik in Frankreich 1968, deutet noch auf andere Unterschiede zwischen der heutigen Welle von Klassenkämpfen und der vorangegangenen hin:
- 1968 waren die Studentenbewegung und die Kämpfe der Arbeiterklasse, auch wenn sie sich zeitlich überschnitten und eine gegenseitige Sympathie vorhanden war, Ausdruck von zwei verschiedenen Realitäten zurzeit des Eintritts des Kapitalismus in seine offene Krise: einerseits eine Revolte des intellektuellen Kleinbürgertums in Gestalt der Studenten gegen die Degradierung ihres Status‘ innerhalb der Gesellschaft, andererseits ein ökonomischer Kampf der Arbeiterklasse gegen die Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen. Die Bewegung der StudentInnen im Jahr 2006 war eine Bewegung der Arbeiterklasse und zeigte klar auf, dass die Veränderungen in der Arbeitswelt in den entwickeltsten Ländern (Vergrößerung des tertiären Sektors auf Kosten des industriellen Sektors) die Fähigkeit der Arbeiterklasse, Klassenkämpfe zu führen, nicht in Frage stellen;
- in der Bewegung von 1968 wurde die Frage der Revolution tagtäglich diskutiert. Doch dieses Interesse ging hauptsächlich von den StudentInnen aus, von denen sich die große Mehrheit bürgerlichen Ideologien hingab: dem Castrismus aus Kuba oder dem Maoismus aus China. In der Bewegung von 2006 wurde die Frage der Revolution viel weniger diskutiert, dafür herrschte aber ein viel klareres Bewusstsein darüber, dass nur die Mobilisierung und Einheit der gesamten Arbeiterklasse ein wirkungsvolles Mittel sind, um den Angriffen der Bourgeoise entgegenzutreten.
17. Diese letzte Frage führt uns zum dritten Aspekt des Klassenkampfes, den Engels formuliert hatte: zum theoretischen Kampf, zur Entwicklung des Bewusstseins innerhalb der Arbeiterklasse über die grundsätzlichen Perspektiven ihres Kampfes und zum Auftauchen von Elementen und Organisationen, die ein Produkt dieser Anstrengungen sind. Wie 1968 geht heute die Zunahme der Arbeiterkämpfe mit einem vertieften Nachdenken einher. Dabei stellt das Auftauchen neuer Leute, die sich den Positionen der Kommunistischen Linken zuwenden, lediglich die Spitze des Eisbergs dar. Jedoch bestehen auch hier erhebliche Unterschiede zwischen dem heutigen Denkprozess und den Reflexionen nach 1968. Damals setzte das Nachdenken aufgrund massiver und spektakulärer Kämpfe ein, wohingegen der heutige Denkprozess nicht darauf wartet, bis die Arbeiterklasse Kämpfe derselben Dimension entfacht. Dies ist ein Resultat der unterschiedlichen Bedingungen, mit denen das Proletariat heute - im Gegensatz zu denen Ende der 1960er Jahre - konfrontiert ist: Ein Charakteristikum der Kampfwelle, die 1968 begann, bestand darin, dass sie aufgrund ihrer Ausbreitung das Potenzial einer proletarischen Revolution erahnen ließ. Ein Potenzial, das infolge der schlimmen Konterrevolution und der Illusionen, die das "Wachstum" des Kapitalismus nach dem Zweiten Weltkrieg produziert hatte, aus den Köpfen verschwunden war. Heute ist es nicht die Möglichkeit einer Revolution, die den Denkprozess nährt, sondern – angesichts der katastrophalen Perspektive des Kapitalismus – ihre Notwendigkeit. Aus diesem Grund vollzieht sich alles langsamer und weniger sichtbar als in den 1970er Jahren. Der ganze Prozess ist jedoch viel nachhaltiger und nicht so abhängig von Schwankungen im Kampf der Arbeiterklasse. Der Enthusiasmus für die Revolution, der sich 1968 und in den darauffolgenden Jahren ausgedrückt hatte, trieb die Mehrheit der Menschen, die an eine Revolution glaubten, in die Arme linksextremistischer Gruppen. Nur eine kleine Minderheit, die den radikalen kleinbürgerlichen Ideologien und der Momentbezogenheit der Studentenbewegung weniger stark ausgesetzt war, konnte sich den Positionen des Linkskommunismus annähern und seinen Organisationen beitreten. Die Schwierigkeiten, auf welche die Arbeiterklasse angesichts diverser Gegenoffensiven der herrschenden Klasse gestoßen war, und der gesellschaftliche Kontext, der noch Illusionen in die Überlebensfähigkeit des Kapitalismus erlaubte, ließen reformistische Ideologien wiederaufleben, die vor allem die "extremen" Gruppen links des offiziellen, diskreditierten Stalinismus förderten. Heute, nach dem Zusammenbruch des Stalinismus, nehmen die linken Gruppen seinen frei gewordenen Platz ein. Die "Etablierung" dieser Gruppierungen im politischen Spiel der Bourgeoisie löst eine Gegenreaktion ihrer ehrlichsten Anhänger aus, die auf der Suche nach Klassenpositionen sind. Aus diesem Grund drückt sich das Nachdenken in der Arbeiterklasse nicht nur durch das Auftauchen junger Leute aus, die sich dem Linkskommunismus zuwenden, sondern auch durch Ältere, die bereits Erfahrungen in Organisationen der bürgerlichen Linken gesammelt haben. Dies ist ein sehr positives Phänomen, das uns verspricht, dass die revolutionären Kräfte, die unvermeidlich aus den Kämpfen der Arbeiterklasse auftauchen, nicht mehr so einfach sterilisiert und eingebunden werden können, wie dies im Laufe der 1970er Jahre noch der Fall gewesen war, und dass sie sich vermehrt den Positionen und Organisationen der Kommunistischen Linken anschließen. Die Verantwortung der revolutionären Organisationen, und vor allem der IKS, besteht darin, aktiver Teil in diesem Denkprozess innerhalb der Klasse zu sein. Dies nicht nur durch aktive Interventionen in den sich entwickelnden Klassenkämpfen, sondern auch durch die Stimulierung der Gruppen und Einzelpersonen, die sich diesem Kampf anschließen wollen.
August 2007
Geographisch:
- China [72]
Theoretische Fragen:
- Imperialismus [3]
Erbe der kommunistischen Linke:
30 Jahre nach dem Deutschen Herbst: Staatsterror damals und heute
- 3250 reads
Wir haben untenstehend einen Artikelbeitrag zum sog. Deutschen Herbst von 1977 veröffentlicht. Damals lieferte die Entführung und Ermordung des Arbeitergeberpräsidenten Schleyer durch die Rote Armee Fraktion (RAF) den Vorwand für eine in der westdeutschen Nachkriegszeit beispiellosen Welle der staatlichen Repression, des Ausschwärmens der Sicherheitskräfte und der Einschüchterungen der Bevölkerung durch die bürgerliche Staatsmacht. Allerorts wurden Razzien durchgeführt, ganze Wohnblocks abgeriegelt, ja sogar öffentliche Verkehrsmittel auf offener Strecke angehalten und mit vorgehaltenen Maschinengewehren durchsucht. Welche Atmosphäre der Angst, der Hysterie und der öffentlichen Verdächtigungen damals erzeugt wurde und welche Rolle die bürgerlich-demokratischen Medien dabei gespielt haben, kann in Heinrich Bölls Roman „Die verlorene Ehre der Katharina Blum" nachgelesen und nachempfunden werden. Wie sehr die Schleyer-Entführung lediglich den Vorwand lieferte, um diese Machtdemonstration durchzuführen bzw. um neue Repressionsmaßnahmen zu rechtfertigen, ließ im Nachhinein die Zeitschrift Stern durchblicken, indem sie andeutete, wie gut die Polizeikräfte schon frühzeitig über den Aufenthaltsort von Schleyer und seiner Entführer Bescheid wussten.
Wir haben untenstehend einen Artikelbeitrag zum sog. Deutschen Herbst von 1977 veröffentlicht. Damals lieferte die Entführung und Ermordung des Arbeitergeberpräsidenten Schleyer durch die Rote Armee Fraktion (RAF) den Vorwand für eine in der westdeutschen Nachkriegszeit beispiellosen Welle der staatlichen Repression, des Ausschwärmens der Sicherheitskräfte und der Einschüchterungen der Bevölkerung durch die bürgerliche Staatsmacht. Allerorts wurden Razzien durchgeführt, ganze Wohnblocks abgeriegelt, ja sogar öffentliche Verkehrsmittel auf offener Strecke angehalten und mit vorgehaltenen Maschinengewehren durchsucht. Welche Atmosphäre der Angst, der Hysterie und der öffentlichen Verdächtigungen damals erzeugt wurde und welche Rolle die bürgerlich-demokratischen Medien dabei gespielt haben, kann in Heinrich Bölls Roman „Die verlorene Ehre der Katharina Blum" nachgelesen und nachempfunden werden. Wie sehr die Schleyer-Entführung lediglich den Vorwand lieferte, um diese Machtdemonstration durchzuführen bzw. um neue Repressionsmaßnahmen zu rechtfertigen, ließ im Nachhinein die Zeitschrift Stern durchblicken, indem sie andeutete, wie gut die Polizeikräfte schon frühzeitig über den Aufenthaltsort von Schleyer und seiner Entführer Bescheid wussten.
Unser Artikel zeigt auf, wie der Terrorismus der RAF und der Bewegung 2. Juni in Deutschland oder der Roten Brigaden in Italien Ausdruck der Empörung über den Kapitalismus war, aber auch der Zweifel, ja der Verzweifelung über die Rolle der Arbeiterklasse. Dies führte zu einer ohnmächtigen, in Grunde genommen kleinbürgerlichen - weil individualistischen - Auflehnung gegen den Staat, die die Obrigkeit nicht nur nicht gefährden konnte, sondern ihr sogar in den Kram passte. Wie sehr die Herrschenden diese terroristische Auflehnung nicht nur auszunutzen, sondern auch zu manipulieren wussten, darüber klärte uns schon damals das Buch eines Augenzeugen dieser Bewegung auf: Bommi Baumanns „Wie alles anfing". Hier wurde geschildert, wie die ersten bewaffneten Kämpfer, ohne es zu wissen oder auch nur zu ahnen, ihre ersten Waffen von Agenten des Verfassungsschutzes erstanden hatten.
Die Bourgeoisie als Nutznießer des Terrorismus
Die bürgerliche Klasse nutzte diese Generation des „bewaffneten Kampfes" auf zweifache Weise auf. Zum einem musste Letztere als Schreckgespenst herhalten, um eine Aufrüstung des Staates zu rechtfertigen, die sich nicht so sehr gegen den „Terrorismus" als vielmehr – präventiv - gegen die „eigene" Bevölkerung und vor allem gegen die Arbeiterklasse richtete. Zum anderen wurden die bewaffneten Gruppen aufgrund ihrer politischen Konfusionen und nicht zuletzt aufgrund der eigenen Ohnmacht unweigerlich in die innerbürgerlichen Machtkämpfe verwickelt (ob nun in den Ost-West-Konflikt oder in den palästinensischen Nationalismus). Ohnehin war der Terrorismus bereits damals in erster Linie ein Mittel des imperialistischen Kampfes zwischen kapitalistischen Staaten und Fraktionen (IRA, PLO usw.)
Wie wenig die zwei Hauptanwendungen des Terrorismus durch den Staat – als Waffe des imperialistischen Krieges und als Rechtfertigung der Repression gegen die Arbeiterklasse – einander ausschließen, wie sehr sie sich stattdessen ergänzen und sich gegenseitig potenzieren, zeigt am besten die Welt von heute. Das Aufkommen des islamischen Terrorismus ist in erster Linie eine Waffe in den Händen einer Reihe von Staaten und Cliquen gegenüber ökonomisch und militärisch häufig überlegenen imperialistischen Gegnern. Vor allem aber ist der „Kampf gegen den Terrorismus" spätestens seit „9/11" zur Kriegsparole sämtlicher führender Industriestaaten dieser Erde geworden. Dies trifft nicht nur auf die USA zu, die zuletzt die Invasion und Besetzung Iraks damit rechtfertigten. Es trifft nicht weniger auf den deutschen Imperialismus zu, der offen gegen den amerikanischen Irakkrieg opponierte, aber die eigenen kriegerischen Einsätze in Afghanistan, Afrika oder vor der libanesischen Küste ganz ähnlich rechtfertigt. Auch bei den gewaltigen Repressionsmaßnahmen im Inneren, die zuletzt auch in Deutschland nicht gefehlt haben, stand zunächst die Abwehr von Terrormaßnahmen feindlicher Staaten und Cliquen noch im Vordergrund. Aber die Herrschenden wissen sehr genau, dass ihr natürlicher und eigentlicher Todfeind das Proletariat ist: Dies ist der Feind sowohl „im eigenen Land" wie auch weltweit. Gegenüber dem Terrorismus hingegen kennt der kapitalistische Staat keine Berührungsängste. Denn der Terrorismus ist nicht nur eine Waffe „der Anderen" gegen „unsere Zivilisation", sondern auch eine Waffe, zu der beispielsweise die Bundesrepublik selbst gern greift. Hinlänglich bekannt ist, wie die USA Bin Ladens Organisation ursprünglich mit aufbauten, aufrüsteten und ausbildeten. Aber es würde sich auch lohnen, die länger bestehenden, engen Beziehungen der bundesdeutschen Politik zu Terrorgruppen in Nahost, auf dem Balkan oder aber die jüngst geknüpften Beziehungen in Afghanistan eingehender zu recherchieren.
Aufrüstung des Staates damals und heute
Die Ereignisse im Jahr 2007 in Deutschland haben nun, sechs Jahre nach den Anschlägen in New York, auf eindrucksvolle Weise die zweite Speerspitze des „Krieges gegen den Terrorismus" - gegen die Radikalisierung an der sozialen Front - sichtbar werden lassen. 30 Jahre nach dem „Deutschen Herbst" folgt 2007 sozusagen der „deutsche Sommer". Zum einem hat man die überwiegend jugendlichen Demonstranten, die gegen den G8-Gipfel in Rostock und Heiligendamm marschierten, um eine „andere Welt" einzufordern, mit den Mitteln des staatlichen Terrors traktiert, sie, wie in Guantanamo, in Käfige eingesperrt. Zum anderen hat man die Aktivitäten einer sog. Militanten Gruppe (MG) zum Anlass genommen, um „systemkritisches", sprich: antikapitalistisches Denken in die Nähe des Terrorismus zu rücken und auch mit Verhaftung, Kontaktsperre, Isolationshaft zu ahnden. Diese Gruppe soll an Sachbeschädigungen gegen „Symbole des Kapitalismus" wie Luxusautos oder Lastwagen der Bundeswehr beteiligt gewesen sein.
Über das Wesen dieser in der Öffentlichkeit recht nebulös gebliebenen Gruppe gibt es bis heute kaum gesicherte Erkenntnisse. Sicher und auch auffallend ist die Art und Weise, wie der Staat darauf reagiert. Die symbolischen Sachbeschädigungen werden mit der ganzen Wucht des „Krieges gegen den Terrorismus" geahndet. Wir zitieren aus einem Offenen Brief an die Generalbundesanwaltschaft gegen die Kriminalisierung kritischer Wissenschaft und politischen Engagements, der am 15. August von Kolleginnen und Kollegen eines der Verhafteten aus dem In- und Ausland verfasst wurde.
„Am 31. Juli 2007 wurden die Wohnungen und teilweise auch die Arbeitsplätze von Dr. Andrej Holm und Dr. Matthias B. sowie von zwei weiteren Personen durchsucht. Dr. Andrej Holm wurde festgenommen, mit einem Hubschrauber zum Bundesgerichtshof nach Karlsruhe geflogen und dort dem Haftrichter vorgeführt. Seitdem befindet er sich in Untersuchungshaft in Berlin. Der Vorwurf lautet bei allen ‚Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung gemäß § 129a StGB’. Sie sollen Mitglieder einer ‚militanten gruppe’ (mg) sein. Wie im Rahmen der Hausdurchsuchungen bekannt wurde, läuft das Ermittlungsverfahren unter diesem Vorwurf gegen die vier bereits seit September 2006 – und sie wurden seitdem rund um die Uhr observiert. Wenige Stunden vor den Hausdurchsuchungen wurden in Brandenburg Florian L., Oliver R. und Axel H. festgenommen. Ihnen wird versuchte Brandstiftung auf vier Fahrzeuge der Bundeswehr vorgeworfen. Andrej Holm soll einen der drei im ersten Halbjahr 2007 zweimal unter angeblich konspirativen Umständen getroffen haben. Die Bundesanwaltschaft geht deshalb davon aus, dass sowohl die vier oben Genannten als auch die drei in Brandenburg Festgenommenen Mitglieder einer ‚militanten gruppe’ seien und ermittelt gegen alle sieben wegen des Verdachts der ‚Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung’ (§129a StGB).
Der Vorwurf gegen die vier Erstgenannten wird laut Haftbefehl gegen Andrej Holm derzeit so begründet:
Dr. Matthias B. habe in seinen wissenschaftlichen Abhandlungen ‚Phrasen und Schlagwörter’ verwendet, die auch die ‚mg’ verwende;
Dr. Matthias B. sei als promovierter Politologe intellektuell in der Lage, ‚die anspruchsvollen Texte der 'militanten gruppe’ zu verfassen. Darüber hinaus stünden ihm ‚als Mitarbeiter eines Forschungsinstituts Bibliotheken zur Verfügung, die er unauffällig nutzen kann, um die zur Erstellung der Texte der 'militanten gruppe' erforderlichen Recherchen durchzuführen’;
Ein weiterer Beschuldigter habe sich mit Verdächtigen konspirativ getroffen: ‚So wurden regelmäßig Treffen vereinbart, ohne jedoch über Ort, Zeit und Inhalt der Zusammenkünfte zu sprechen’; er sei zudem in der ‚linksextremistischen Szene’ aktiv gewesen.
Bei einem dritten Beschuldigten sei eine Adressenliste gefunden worden, auf der auch die Namen und Anschriften der anderen drei standen;
Dr. Andrej Holm, der als Stadtsoziologe arbeitet, habe enge Kontakte zu allen drei in Freiheit befindlichen Beschuldigten,
Dr. Andrej Holm sei ‚in dem von der linksextremistischen Szene inszenierten Widerstand gegen den Weltwirtschaftsgipfel 2007 in Heiligendamm aktiv’ gewesen.
Als konspiratives Verhalten wird u.a. gewertet, dass er angeblich absichtlich sein Mobiltelefon nicht zu einem Treffen mitnahm
Andrej Holm sowie Florian L., Oliver R. und Axel H. sind seit dem 01.08.2007 unter sehr rigiden Bedingungen in Berlin-Moabit inhaftiert: Sie sind 23 Stunden am Tag in einer Einzelzelle und haben eine Stunde Hofgang. Sie können alle 14 Tage für insgesamt eine halbe Stunde besucht werden, Kontakte sind nur mit Trennscheibe erlaubt. Auch die Anwälte können mit ihren Mandanten nur mit Trennscheibe sprechen, die Verteidigerpost wird kontrolliert.
Aus den Vorwürfen in den Haftbefehlen wird ein Konstrukt deutlich, dass auf abenteuerlichen Analogieschlüssen basiert. Es ist von vier grundlegenden Hypothesen getragen, die alle von der Bundesanwaltschaft (BAW) [Attorney of the Federal Supreme Court] nicht genauer belegt werden können, aber durch ihre Zusammenstellung den Eindruck einer ‚terroristischen Vereinigung’ hinterlassen sollen.
Die Sozialwissenschaftler seien wegen ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit, ihrer intellektuellen Fähigkeiten und dem Zugang zu Bibliotheken die geistigen Köpfe der angeblichen ‚Terror-Organisation’. Denn eine Vereinigung ‚militante gruppe’ soll laut BAW dieselben Begriffe verwenden wie die beschuldigten Sozialwissenschaftler. Als Beleg dafür gilt ihr der Begriff ‚Gentrification’, einer der Forschungsschwerpunkte von Andrej Holm und Matthias B. in den vergangenen Jahren, zu dem sie auch international publiziert haben. Ihre Forschungsergebnisse haben sie dabei nicht im ivory tower (Elfenbeinturm, die Red.) gelassen, sondern ihre Expertise auch Bürgerinitiativen und Mieterorganisationen zur Verfügung gestellt – so wird eine intellektuelle Urheberschaft konstruiert."
Die Repressionsorgane bereiten sich auf den Klassenkampf vor
Nicht weniger auffallend ist die Art und Weise, wie über diese Vorgänge in den Medien berichtet wird. Zum einem wird diesem Thema keine breite Öffentlichkeit gewidmet. Man ist offenbar bemüht, die Sache herunterzuspielen, um die Bevölkerung nicht zu sehr gegen sich aufzubringen. Denn anders als die RAF-Morde im Vorfeld des „Deutschen Herbstes" taugen die Sachbeschädigungen in Berlin oder Brandenburg kaum dazu, eine Stimmung der öffentlichen Angst und Entrüstung auszulösen. Darüber hinaus ist die Zeit seit 1977 nicht stehen geblieben. Im Zeitalter der offenen Wirtschaftskrise, des massiven Sozialabbaus und der behördlichen Drangsalierung der Bevölkerung ist es deutlich schwieriger geworden, die Bevölkerung auch nur vorübergehend hinter den Staat zu scharen (wie sich nach den Anschlägen in New York rasch herausstellte). Es scheint die Repressionsorgane vielmehr darum zu gehen, die politisch suchenden Minderheiten, die begonnen haben, die bürgerliche Gesellschaft in Frage zu stellen, einzuschüchtern und abzuschrecken. Zum anderen werden die Anschläge, dort wo sie zur Sprache kommen, mit einem „geistigen Umfeld" in Zusammenhang gebracht, das als „Nährboden des Terrorismus" bezeichnet wird. So haben die Medien mehrmals das „Gerede von der Weltrevolution" als ein Merkmal dieses Milieus bezeichnet (die 3SAT-Sendung Kulturzeit hat zu Recht kritisch auf diese Tendenz im öffentlichen Diskurs hingewiesen). Man spricht von ominösen Theoretikern, die aufgrund der Radikalität ihrer Auffassungen auch dann als „geistige Brandstifter" gelten sollen, wenn sie selbst mit Terrorismus nichts am Hut haben. In diesem Zusammenhang passt es auch, dass die jüngste Welle von Razzien in Berlin vor dem Roten Antiquariat nicht halt machte – ein Buchladen, der wie kaum ein anderer in Deutschland die Möglichkeit bietet, die Ideen und Publikationen internationalistischer revolutionärer Gruppen kennenzulernen. Auch hier ist der Unterschied zum Vorgehen der Bourgeoisie in den 70er Jahren auffallend. Damals scherten sich die Medien in Deutschland oder Italien einen Dreck um die politischen Ideen der RAF oder der Roten Brigaden. Die Anschläge dieser Gruppen wurden vielmehr als Ausgeburt einer Geistesgestörtheit hingestellt, der sogar mit Hirnoperationen zu Leibe gerückt werden sollte. Damals war das Gros der Politisierten sehr aktivistisch und folgte zumeist mehr oder weniger unkritisch bis gedankenlos den Parolen des Stalinismus. Was heute die neue Generation auszeichnet – allem Aktivismus zum Trotz –, ist ein viel kritischeres und tieferes Nachdenken, das für den Kapitalismus entsprechend gefährlicher zu werden droht. Daher die Kriminalisierung der radikalen Theorie.
Das Wiederauftauchen einer Praxis von Anschlägen gegen „Symbole des Systems" mutet ein wenig merkwürdig an. Auch wenn diese Aktionen sich derzeit nicht mehr gegen Personen richten, so weisen sie darauf hin, dass die Lehren aus den Erfahrungen mit der RAF oder den Roten Brigaden nicht oder nur sehr unzureichend gezogen worden sind. Solche sinnlosen Verzweifelungstaten sind auch heute Ausdruck einer tiefen Empörung gegen das herrschende System. Eine Empörung, die wir voll und ganz teilen. Daher unsere Solidarität mit den Opfern des staatlichen Terrors, ungeachtet, ob die Verhafteten und Drangsalierten an solchen Aktionen beteiligt waren oder nicht. Aber solche Taten sind auch Ausdruck einer großen Schwierigkeit, die wirkliche revolutionäre Kraft innerhalb dieser Gesellschaft zu erkennen. Diese Schwierigkeit ist nicht verwunderlich. Denn was die Welt von heute im Vergleich zu 1977 auszeichnet, ist nicht nur die weitaus dramatischere und gefährlichere Sackgasse, in die der Kapitalismus die Menschheit geführt hat, sondern auch der weitgehende Verlust an Klassenidentität des Proletariats nach 1989. Jedoch beginnt heute das Weltproletariat die eigene Kraft wieder zu entdecken. Und die politischen Vordenker dieser Klasse beginnen die eigenen revolutionären Theorien und Positionen zu entdecken und weiter zu entwickeln. Zur Solidarität des Proletariats mit den Opfern des staatlichen Terrors gehört der Kampf, um auch die Verzweifelten für die Sache und für die Methoden der Arbeiterklasse zu gewinnen (siehe untenstehenden Artikel).
31.08.2007.
Die Lehren aus dem Deutschen Herbst 1977
- 3132 reads
Die bürgerlichen Medien haben mit viel Aufwand über den „Deutschen Herbst" 1977 berichtet. Schon im letzten Winter, als der Bundespräsident über die Begnadigung der noch in Haft sitzenden Terroristen zu entscheiden hatte, wurden die damaligen Anschläge wieder in Erinnerung gerufen. Meist drehten sich die Artikel und Berichte um noch ungeklärte Tatabläufe, unbekannte Täter, die Rolle dieses oder jenes Beschuldigten. Wir wollen dagegen in diesem Artikel der Frage nachgehen, warum seinerzeit der Terrorismus solch einen Auftrieb erhalten hatte und warum die Kommunisten ihn ablehnen.
Die bürgerlichen Medien haben mit viel Aufwand über den „Deutschen Herbst“ 1977 berichtet. Schon im letzten Winter, als der Bundespräsident über die Begnadigung der noch in Haft sitzenden Terroristen zu entscheiden hatte, wurden die damaligen Anschläge wieder in Erinnerung gerufen. Meist drehten sich die Artikel und Berichte um noch ungeklärte Tatabläufe, unbekannte Täter, die Rolle dieses oder jenes Beschuldigten. Wir wollen dagegen in diesem Artikel der Frage nachgehen, warum seinerzeit der Terrorismus solch einen Auftrieb erhalten hatte und warum die Kommunisten ihn ablehnen.
Die Lage nach 1968
Als 1968 in Frankreich mit dem imposanten Massenstreik unter Beteiligung von zehn Millionen ArbeiterInnen ein gewaltiger Ruck durch die Gesellschaft ging und auch in einer Reihe von anderen Ländern (wie in Italien, Deutschland, Großbritannien, Polen, Argentinien) Arbeiterkämpfe aufflammten, keimte neue Hoffnung auf. Die seit den 1920er Jahren über der Arbeiterklasse niedergegangene Konterrevolution war zu Ende. Das Kräfteverhältnis zwischen den Klassen verschob sich. Das Proletariat trat wieder auf die Bühne der Geschichte. Damit tauchte erneut die Perspektive der Überwindung der kapitalistischen Gesellschaft auf – auch wenn dies damals nicht von allen verstanden wurde. Aber der endlich wieder spürbare Widerstand der Arbeiterklasse gegen den Kapitalismus zog unzählige Menschen, die ihre Ablehnung der kapitalistischen Gesellschaft zum Ausdruck bringen wollten, in seinen Bann. Vor allem viele junge Leute wurden politisiert und fingen an, nach Mitteln des Kampfes gegen diese Gesellschaft zu suchen.
Der herrschenden Klasse gelang es jedoch nach einiger Zeit, die sich entfaltenden Arbeiterkämpfe wieder in den Griff zu bekommen. Aufgrund der Gegenoffensive, die vor allem von den Gewerkschaften und den linken Parteien getragen wurde, konnte das Kapital eine weitere Radikalisierung der Kämpfe verhindern. Bei den meisten Menschen, die zuvor noch von den Arbeiterkämpfen angezogen worden waren und sich in den Widerstand gegen die bürgerliche Gesellschaft einreihen wollten, aber nun keinen Bezugspunkt mehr in der Arbeiterklasse finden konnten, machte sich eine große Desorientierung breit.
Die Flucht in die Verzweiflung
Ein Teil von ihnen ließ sich von linkskapitalistischen Organisationen (Trotzkisten, Maoisten u.a.) einfangen und irreführen. Diese Organisationen sorgten dafür, dass ihr „anti-kapitalistischer“ Elan schnell verpuffte. So wurde z.B. ihre anfängliche Ablehnung des Kapitalismus in eine Unterstützung der „anti-imperialistischen Befreiungsbewegungen“ umgeleitet. In den zahlreichen Stellvertreterkriegen, die damals, zurzeit des Kalten Krieges, tobten, ließen sich viele vom Mythos der nationalen Befreiungskämpfe beeindrucken und hatten für die Arbeiterklasse nur noch Spott und Hohn übrig. Einige Elemente aus den linksextremistischen Kaderorganisationen machten später steile Karrieren. Ob der einstige Pressesprecher des maoistischen Kommunistischen Bundes Norddeutschland (KB Nord), Jürgen Trittin, das ehemalige Mitglied des gleichermaßen maoistischen Kommunistischen Bundes Westdeutschland (KBW), Renate Schmidt, der einstige Jusovorsitzende Gerhard Schröder, Joschka Fischer, in den 1970er Jahren Aktivist in der Frankfurter Krawallszene, oder Otto Schily, der einst Strafverteidiger der RAF in den Stammheim-Prozessen gewesen war – sie alle, die ihr Handwerk bei den Linken gelernt hatten, sind in der rot-grünen Ära in Staats- oder andere Führungsämter der kapitalistischen Wirtschaft aufgestiegen. Andere wiederum wandten sich vollends von der Politik ab oder wurden gar zu Vordenkern der Neonazis, wie Horst Mahler, der seinerzeit mit der RAF geliebäugelt und sie vor Gericht verteidigt hatte.
Doch daneben gab es noch jene, die darüber verbittert waren, dass die kapitalistische Gesellschaft den wiedererwachten Kampfgeist der Arbeiterklasse so schnell wieder in den Griff bekommen hatte, die aber dennoch nicht bereit waren, sich mit der Gesellschaft zu arrangieren oder den Rückzug aus der Politik anzutreten. Stattdessen stemmten sie sich mit aller Macht gegen dieses System. Ihre Devise lautete: Wenn die ArbeiterInnen nicht aus eigener Kraft den Kampf aufnehmen, dann müssen wir sie nach vorn treiben. So bestand denn ihre Strategie darin, den bürgerlichen Staat durch symbolische Schläge gegen dessen Repräsentanten dergestalt zu provozieren, dass er gegenüber der Arbeiterklasse seine „faschistische Fratze“ enthüllte. So die damals in diesem Milieu vorherrschende Denkrichtung. Man begann also, sich terroristischen Methoden zuzuwenden und den bewaffneten Kampf zu propagieren. Die Serie von Anschlägen, Entführungen, terroristischen Angriffen gegen Personen und Einrichtungen kulminierte schließlich im berüchtigten „Deutschen Herbst“ mit seinen Morden an Ponto, Buback und Schleyer. Schwerpunkte der Aktivitäten dieser terroristischen Gruppen war dabei vor allem Deutschland und Italien.
Kommunisten gegen Terrorismus
Von den Abertausenden vorwiegend jungen Menschen, die durch die Arbeiterkämpfe inspiriert worden waren, gelang es nur ganz wenigen, sich in geduldiger, mühevoller Arbeit mit der Geschichte, dem Vermächtnis und der Erfahrung insbesondere der linkskommunistischen Kräfte zu befassen, die den Jahrzehnten der Konterrevolution widerstanden, die Lehren der Niederlage in Russland 1917 gezogen und die zukünftigen Kämpfe vorbereitet hatten. Vor allem in Deutschland beschränkte sich der Kreis der Leute, die sich intensiv mit dem Linkskommunismus im Besonderen und mit der Geschichte der Arbeiterbewegung im Allgemeinen befassten, auf ganz wenige, die sich auch durch die fortdauernden Schwierigkeiten des Klassenkampfes nicht entmutigen ließen.
Die Internationale Kommunistische Strömung, die aus den Kämpfen von 1968 hervorgegangen ist und als ein Zusammenschluss auf internationaler Ebene 1976 gegründet wurde, hat stets terroristische Methoden abgelehnt. In einem Text, der nach dem „Deutschen Herbst“ 1977 veröffentlicht wurde, betonten wir: „Der Terror ist ein strukturiertes, permanentes von den ausbeutenden Klassen ausgeübtes Herrschaftssystem. Der Terrorismus dagegen ist eine Reaktion der unterdrückten Klassen. Es handelt sich um eine vorübergehende Reaktion, um Racheaktionen, die ohne Kontinuität und Zukunft sind. Als ein gewaltsames Aufmucken der Machtlosen kann der Terrorismus nicht den Terror der herrschenden Klasse erschüttern. Es ist wie ein Mückenstich in die Haut einen Elefanten. Dagegen kann er und wird er oft vom Staat zur Rechtfertigung und Verstärkung dessen Terrors benutzt. Wir müssen unbedingt den Mythos verurteilen, demzufolge der Terrorismus als Sprengkapsel dazu diene oder dazu dienen könne, den Kampf des Proletariats in Gang zu setzen. Es ist vollkommen absurd vorzutäuschen, dass der Terrorismus der radikalisierten Schichten der Kleinbourgeoisie das Verdienst habe, in der Arbeiterklasse die Auswirkungen der demokratischen Verschleierungen der bürgerlichen Legalität zu zerstören und ihr den unvermeidbaren Weg zur Gewalt klarzumachen. Das Proletariat hat von dem radikalen Terrorismus keine Lehren zu ziehen, abgesehen davon, dass er von ihm abrücken und ihn zurückweisen soll, denn die im Terrorismus beinhaltete Gewalt befindet sich grundsätzlich auf bürgerlichem Boden. Zu einem Verständnis der Notwendigkeit und Unabdingbarkeit der Gewalt kommt das Proletariat aufgrund seiner eigenen Existenz, mittels seines eigenen Kampfes, seiner eigenen Erfahrung, der Konfrontationen mit der herrschenden Klasse. Es ist eine Klassengewalt, die sich ihrem Wesen, ihrem Inhalt, ihrer Form und in ihren Methoden sowohl vom kleinbürgerlichen Terrorismus als auch vom Terror der herrschenden ausbeutenden Klasse unterscheidet.
Es stimmt, daß die Arbeiterklasse im Allgemeinen eine Haltung der Solidarität und der Sympathie einnimmt, zwar nicht gegenüber dem Terrorismus, den sie als Ideologie, als Organisationsform und als Methode verurteilt, sondern gegenüber den Elementen, die vom Terrorismus in die Sackgasse geführt werden. Dies aus den folgenden Gründen:
1. weil diese Elemente gegen die bestehende Ordnung des Terrors revoltieren, auf dessen grundlegende Zerstörung das Proletariat hinarbeitet ;
2. weil diese Elemente genau wie die Arbeiterklasse ebenso die Opfer der schrecklichen Ausbeutung und Unterdrückung durch die Todfeinde des Proletariats sind (...) Die einzige Art für das Proletariat, seine Solidarität mit diesen Opfern zu zeigen, liegt darin, zu versuchen, sie aus der tödlichen Sackgasse des Terrorismus zu holen, in die sie sich verrannt haben und sie vor den Henkern des staatlichen Terrors zu retten.“ („Terror, Terrorismus und Klassengewalt“, Internationale Revue, Nr. 3, 1979, www.internationalism.org [29])
Mit diesem Standpunkt stellten wir uns in die Tradition der Kommunisten. Schon früh hat die Arbeiterbewegung terroristische Methoden abgelehnt, weil sie der Auffassung war, dass Ziel und Mittel des Kampfes miteinander im Einklang stehen müssen. Auch haben die Kommunisten immer betont, dass die historisch notwendige Revolution von der großen Mehrheit der Bevölkerung getragen werden muss. Und gegenüber jenen, die sich zu gewaltsamen Aktionen hinreißen lassen, weil sie es ablehnen, das Bewusstsein der Arbeiterklasse geduldig voranzutreiben, haben die Kommunisten auch stets unterstrichen, dass die Arbeiterklasse keinen Hass, keine Rachegelüste gegenüber Personen ausleben darf, sondern die Überwindung der kapitalistischen Gesellschaft anstreben muss.
In den Fangarmen des bürgerlichen Staates
Die Spirale des Terrorismus und der staatlichen Repression nahm schließlich ihren Lauf. Schließlich verfing sich die RAF, auf der Suche nach Rückzugsräumen vor dem sich immer enger zusammenziehenden Fahndungsnetz des westdeutschen Repressionsapparates, in den Maschen der ostdeutschen Staatssicherheitsorgane, die in ihr ein Vehikel zur Destabilisierung des westdeutschen Staates sahen. Bereit, mit dem Feind des Feindes zu kooperieren, geriet die RAF so vom Regen in die Traufe. Zudem begann sie – neben anderen terroristischen Gruppen Europas - auch mit Terrorgruppen im Nahen Osten zusammenzuarbeiten, die sich im imperialistischen Krieg gegen Israel aller Mittel, einschließlich des nackten Terrors, bedienten. Die Spirale der Barbarei hat diese Kräfte, von denen sich die Terroristen vor 30 Jahren ausbilden ließen, mittlerweile dazu getrieben, systematisch Massenmorde mit Selbstmordattentätern zu planen, in denen es nur noch darum geht, möglichst viele Zivilisten in den Tod zu reißen, und in denen Kinder als Bombenwerfer oder Kuriere missbraucht werden.
Von dem anfänglichen Wunsch, den Kapitalismus zu bekämpfen, war nichts mehr übrig geblieben. Stattdessen war man in die Fangarme eines der beiden Lager im Kalten Krieg geraten. Der westdeutsche Staat wiederum nutzte die Anti-Terrorismus-Kampagne, die er gegen die RAF entfachte hatte, aus, um seinen Repressionsapparat, den er schon 1969, unmittelbar nach dem Wiederaufflammen der Arbeiterkämpfe, mit der Verabschiedung der Notstandsgesetze aufgerüstet hatte, weiter auszubauen. So schuf er sich u.a. ein ganzes Arsenal an Anti-Terrorismus-Gesetzen wie beispielsweise den berüchtigten Paragraphen 129, mit denen er heute jene drangsaliert, die sich, wenn auch oftmals mit untauglichen Mitteln, auf die Suche nach Antworten auf die immer dringendere Frage der Systemüberwindung begeben (s. den Artikel in dieser Ausgabe über die sog. Militante Gruppe). Mittlerweile verfügt der Staat über ein noch viel breiter gefächertes Überwachungssystem, das er unablässig verfeinert, wie die Gesetzesinitiativen von Innenminister Schäuble veranschaulichen.
Die Herausforderung heute: Die Tragödie von damals vermeiden
Jenen, die wegen der damaligen historischen Umstände ins Fahrwasser dieser Bewegung gerieten, sagen wir: Wer aufrichtig an der Perspektive festhält, dieses verrottete System zu überwinden, wer auch heute meint, dass der Kapitalismus auf den Misthaufen der Geschichte gehört, der muss ohne Scheuklappen eine schonungslose Bilanz der politischen Entwicklung und der Irrwege ziehen, in denen er gelandet war. Es ist nie zu spät, diese Bilanz zu ziehen. Im Gegenteil, diese Methoden zu kritisieren und zu begreifen, wie man in dieser Sackgasse landen konnte, ist nicht nur unabdingbar, sondern auch ein wertvoller Beitrag gerade für all jene, die heute politisiert werden und nach Antworten und Perspektiven suchen und denen wir solche Sackgassen ersparen müssen.
Nachdem vor 30 Jahren viele junge Menschen in ihrer Konfusion und Ratlosigkeit durch linkskapitalistische Kräfte politisch vergewaltigt, irregeführt oder zermürbt wurden und einige davon aus Verzweiflung im Terrorismus landeten, müssen wir heute alles daran setzen, dass solch eine Tragödie sich nicht wiederholt. Dies ist die Herausforderung, vor denen wir uns als Revolutionäre heute sehen: jene, die heute politisiert werden und nach Antworten und Mitteln des Kampfes suchen, für einen langfristigen, geduldigen Kampf gegen das verbrecherische Gesellschaftssystem des Kapitalismus zu gewinnen. 31.08.07
0 0 0
„In den bürgerlichen Revolutionen waren Blutvergießen, Terror, politischer Mord die unentbehrliche Waffe in der Hand der aufsteigenden Klassen. Die proletarische Revolution bedarf für ihre Ziele keines Terrors, sie haßt und verabscheut den Menschenmord. Sie bedarf dieser Kampfmittel nicht, weil sie nicht Individuen, sondern Institutionen bekämpft, weil sie nicht mit naiven Illusionen in die Arena tritt, deren Enttäuschung sie blutig zu rächen hätte. Sie ist kein verzweifelter Versuch einer Minderheit, die Welt mit Gewalt nach ihrem Ideal zu modeln, sondern die Aktion der großen Millionenmasse des Volkes, die berufen ist, die geschichtliche Mission zu erfüllen und die geschichtliche Notwendigkeit in Wirklichkeit umzusetzen“ (Was will der Spartakusbund?, 14. 12.1918).
Die Studentenbewegung in Venezuela
- 2912 reads
In Caracas begannen am 28. Mai Studentendemonstrationen, die sich rasch auf verschiedene Städte quer durch das ganze Land ausbreiteten[1]; das vordergründige Motiv war der Beschluss der Regierung, den Fernsehsender Radio Caracas Televisión (RCTV) zu schließen, das bis dahin das wichtigste Sprachrohr unter den Medien für jene Bereiche des nationalen Kapitals war, die gegen die Regierung von Chávez opponieren. Dies führte dazu, dass die soziale Unzufriedenheit geweckt wurde, die innerhalb der arbeitenden Massen und der gesamten Bevölkerung herangereift war, diesmal ausgedrückt durch die Studentendemonstrationen.
Angesichts dieser Proteste rief Chávez selbst am 29. Mai die Bewohner der Slumsiedlungen dazu auf, "die Revolution zu verteidigen"; etwas später unterstützten die "radikalen" Abgeordneten der Nationalversammlung (ausschließlich von Abgeordneten gebildet, die die so genannte "bolivarische Revolution" unterstützen) vorbehaltlos den Aufruf ihres Führers an die Bewohner der Barrios, gegen die Studentenbewegungen zu demonstrieren. Jedoch ließen sich die Einwohner der Slumsiedlungen und der Armenviertel, die den Ruf haben, hinter dem Chávismus zu stehen, bis jetzt nicht mobilisieren. Dies zeigt eine gewisse Sympathie für die Parolen der Bewegung, die die Medien als zweitrangig behandelt haben, wie die Notwendigkeit, den Problemen der Arbeitslosigkeit, Kriminalität, Gesundheit und der allgemeinen Armut gegenüberzutreten [2].
Ein neuer Versuch, sich von der falschen Alternative zwischen Chávismus und Opposition zu befreien
In Caracas begannen am 28. Mai Studentendemonstrationen, die sich rasch auf verschiedene Städte quer durch das ganze Land ausbreiteten[1]; das vordergründige Motiv war der Beschluss der Regierung, den Fernsehsender Radio Caracas Televisión (RCTV) zu schließen, das bis dahin das wichtigste Sprachrohr unter den Medien für jene Bereiche des nationalen Kapitals war, die gegen die Regierung von Chávez opponieren. Dies führte dazu, dass die soziale Unzufriedenheit geweckt wurde, die innerhalb der arbeitenden Massen und der gesamten Bevölkerung herangereift war, diesmal ausgedrückt durch die Studentendemonstrationen.
Angesichts dieser Proteste rief Chávez selbst am 29. Mai die Bewohner der Slumsiedlungen dazu auf, "die Revolution zu verteidigen"; etwas später unterstützten die "radikalen" Abgeordneten der Nationalversammlung (ausschließlich von Abgeordneten gebildet, die die so genannte "bolivarische Revolution" unterstützen) vorbehaltlos den Aufruf ihres Führers an die Bewohner der Barrios, gegen die Studentenbewegungen zu demonstrieren. Jedoch ließen sich die Einwohner der Slumsiedlungen und der Armenviertel, die den Ruf haben, hinter dem Chávismus zu stehen, bis jetzt nicht mobilisieren. Dies zeigt eine gewisse Sympathie für die Parolen der Bewegung, die die Medien als zweitrangig behandelt haben, wie die Notwendigkeit, den Problemen der Arbeitslosigkeit, Kriminalität, Gesundheit und der allgemeinen Armut gegenüberzutreten [2].
Mehr noch, der Unwille sich von den martialischen Aufrufen des "Comandante" mobilisieren zu lassen, könnte darauf hindeuten, dass dem lügnerischen Geschwätz von Chávez, er sei der "Vertreter der Armen", nicht mehr so wie bisher von diesen Bevölkerungsschichten geglaubt wird, die einst gehofft hatten, er würde ihre Armut mindern.
Inzwischen führen der Präsident, seine Familie und seine Gefolgsleute das Leben der Reichen wie die vergangenen Regierungen auch[3].
Was Chávez und seiner Anhänger betrifft, die diesen Aufruf erließen, so mobilisierten diese die Repressionskräfte und bewaffneten Banden, um die Studenten und jene einzuschüchtern und zu unterdrücken, die aus ihren Häusern und Wohnungen herauskamen, um ihre Unterstützung zu zeigen. Gleich beim ersten Angriff wurden 200 Studenten festgenommen, etliche verletzt, darunter zahlreiche junge Menschen. Während diese wildgewordene Meute die Protestierenden attackierte, kriminalisierte und als „Lakaien des Imperialismus“, „Verräter des Vaterlandes“ sowie als „Wohlstandskinder“ beschimpfte, schloss sich Daniel Ortega, der „revolutionäre“ Mandatsträger Nicaraguas, während eines Besuches der Nationalversammlung diesen Angriffen an, als er die protestierenden Studenten beschuldigte von den reichsten Klassen Venezuelas zu stammen und ihrem „Traum vom Aufruhr der Straßen“ dienen. Jedoch diente die Repression und Verunglimpfung zur Einschüchterung der Studenten nur dazu, die Bewegung zu radikalisieren und weiter zu verbreiten.
Was steckt hinter dieser Studentenbewegung?
Sind diese Demonstrationen ein weiterer Ausdruck der Konfrontation zwischen den bürgerlichen Fraktionen von Chávez und der Opposition? Geht es den Studenten dabei nur um ihre eigenen Angelegenheiten?
Wir denken nein. Diese Bewegung von eines wichtigen Teils der Studenten hat zur Überraschung der Regierung und der Opposition einen Charakter angenommen, der dazu tendiert, mit den starren Schemata der politischen Polarisierung zwischen bürgerlichen Fraktionen zu brechen. Die Bewegung drückt vielmehr eine soziale Unzufriedenheit aus, die bis jetzt in dieser Polarisation gefangen war. Sie ist daher mehr als ein bloßer studentischer Protest:
- Es ist unbestreitbar, dass die politischen Kräfte der Regierung und der Opposition versucht haben, die Bewegung für ihre eigenen Zwecke zu missbrauchen: Erstere stellen die Bewegung als bloße Manipulation durch die der Regierung entgegengesetzten politischen Kräfte dar (einschließlich des US-Imperialismus); Letztere sagen, dass es eine politische Bewegung der Opposition sei, die ihre Parolen für Meinungsfreiheit und gegen "Staatstotalitarismus" teile; bürgerliche Parolen, die von der Opposition vertreten werden, um die Chávez-Regierung zu stürzen. Jedoch hat die Bewegung versucht, sowohl zur Regierung als auch zur Opposition auf Distanz zu gehen. Die Studenten haben den politischen Charakter des Protests nicht versteckt, sondern klar gemacht, dass sie weder der Regierung noch der Opposition Gehorsam schulden. Die Erklärungen der Anführer dieser Bewegung waren eindeutig: "Die Politiker haben ihre Tagesordnung, wir haben unsere".
Mit diesem Ziel hat die Bewegung sich organisatorische Formen gegeben wie die Versammlungen, in denen sie diskutieren, Kommissionen wählen und entscheiden können, was zu tun ist: dies hat auf der lokalen und nationalen Ebene stattgefunden. In diesen Versammelungen, die in mehreren Universitäten gebildet wurden, erörterten sie das Ziel der Bewegung und bereiteten die ersten Aktionen vor, welche den restlichen Studenten mitgeteilt wurden. Die Studenten organisierten auch die Deckung der Kosten für die Mobilisierungen durch ihre eigenen Mittel, durch Geldsammlungen unter den Studenten und in der Öffentlichkeit.
In diesem Sinn befindet sich die sich entfaltende Studentenbewegung in einem "latenten" Zustand, teils aufgrund der Maßnahmen der Regierung und Opposition, sie zu kontrollieren und zu einzudämmen. Doch sie strebte danach, mit den Schemata der vergangenen Studentenbewegungen zu brechen, und drückte einen sozialen Inhalt aus, beeinflusst von Tendenzen in ihr, die den Interessen der Lohnarbeiter Ausdruck verliehen.
Ein anderes wichtiges Merkmal der Bewegung bestand von Anfang an darin, die Notwendigkeit des Dialogs und der Diskussion über die Hauptprobleme der Gesellschaft zu betonen: Arbeitslosigkeit, soziale Unsicherheit, Solidarität mit den ärmsten Sektoren. Zu diesem Zweck haben die Studenten die gesamte Bevölkerung - ob Chavisten oder nicht – zu einem offenen Dialog in den Universitäten, in den Barrios und auf den Straßen, außerhalb der von der Regierung als auch der Opposition kontrollierten Organe und Institutionen aufgerufen. In diesem Sinn verstanden es die Studenten, die Fallen der Regierung zu umgehen, als diese vorschlug, mit den Chávez-treuen Studenten in der Nationalversammlung zu diskutieren. Der Plan schlug fehl: Andere Studenten mobilisierten sich und lasen mutig aus einem Dokument vor, in dem die Abgeordneten der Versammlung angeklagt wurden, die Bewegung zu kriminalisieren, und in dem die Versammlung angeprangert wurde, kein unparteiischer Ort zu sein, an dem sie debattieren und ihre Forderungen formulieren können. Sie verließen das Gebäude angesichts des Zorns und der Überraschung der Abgeordneten und der chavistischen Anhänger [4].
Die Parolen der Bewegung haben einen zunehmend politischen Charakter angenommen. Obwohl die Medien, hauptsächlich jene von der Opposition kontrollierten, den "Kampf für Meinungsfreiheit", den "Stopp der Schließung von RCTV" und die "Verteidigung die Autonomie der Universitäten " zur Hauptsache gemacht hatten, vertrat die Mehrheit der Studenten von Anfang offen politische Forderungen: Ende der Unterdrückung, Freilassung der verhafteten Studenten und jener, die sich täglich bei der Polizei melden müssen, Solidarität mit den 3.000 Angestellten von RCTV, gegen Kriminalität und Armut und für die Notwendigkeit, "eine bessere Welt zu schaffen", etc.
Woher kamen diese Merkmale der neuen Studentenbewegung?
Die Entstehung dieser Bewegung hat ihre Ursachen in der Verschlimmerung der ökonomischen und politischen Krise in diesem Land. Eine Wirtschaftskrise, die der Chávismus hinter den enormen Ressourcen des Ölreichtums zu verschleiern versucht, der nur dazu gedient hat, den Machterhalt der neuen "revolutionären" Elite zu stärken, während der Rest der Bevölkerung trotz der vom Staat durch „Wohltätigkeitsorganisationen“' verteilten Brosamen fortschreitend ärmer wird. Einer der Hauptausdrücke dieser Krise wird im unaufhörlichen Wachstum der Inflation gesehen, welches entsprechend den unzuverlässigen amtlichen Zahlen im Durchschnitt während der letzten drei Jahre 17% (dem Höchststand in Lateinamerika) beträgt. In der Tat sind die Zunahmen des von der Regierung geleiteten Mindestlohns im Grunde genommen durch die unaufhörlichen Erhöhungen der Preise der Nahrung, Waren und Dienstleistungen verursacht. Das viel publik gemachte Wirtschaftswachstum, das durchschnittlich in derselben Zeit bei einer 10% Zunahme des BIP gelegen hat, ist im Wesentlichen auf einer Zunahme der Ausbeutung basiert, einem Wachstum prekärer und informeller Arbeit (getarnt als Genossenschaften und Regierungsaufträge), welche etwa 70% der wirtschaftlich aktiven Bevölkerung einschließlich der Arbeitslosen betrifft. Dies alles bedeutet, dass die große Mehrheit der Lohnarbeiter keine legalen Sozialleistungen erhält und dass sie nicht einmal den offiziellen Mindestlohn verdienen. Diese Wirtschaftskrise, das Ergebnis der Krise, die das ganze kapitalistische System betrifft, existierte lange vor der Chávez Regierung, aber sie während der 8 Jahre dieser Regierung verschlimmert und zu einer zunehmenden Verarmung der Gesellschaft [5] geführt.
Zusammen mit den dauernd steigenden Lebenshaltungskosten und dem Wachstum prekärer Arbeit, haben wir die Knappheit der Nahrung, Mangel an Wohnungen gesehen, eine gesteigerte Kriminalität welche im Jahr 2006 1700 Venezolanern das Leben kostete, hauptsächlich junge Leute aus den ärmsten Schichten. Es tauchen wieder Krankheiten wie Malaria und Denguefieberfieber auf, was herrührt von der schlechten Körperkonstitution der Verschlechterung von öffentlichen Gesundheitsversorgung. Wir könnten die Reihe fortsetzen.
Diese Situation ist nichts, als der Ausdruck Staatskapitalismusmodell a la Chávez Bewegung, der keinen anderen Kurs hat, als fortzufahren, die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse und der ganzen Bevölkerung anzugreifen, gerade so wie vorherige Regierungen es auch taten, Prekasierung der Arbeiter und Verarmung. aber diesmal im Namen des "Sozialismus".
Eindeutig sind die Studenten über diese Situation nicht uninformiert, da die Mehrheit von ihren aus proletarischen Familien stammt oder von Familien, die durch die Krise verarmt sind. Viele Studenten in den öffentlichen und privaten Universitäten erfahren Ausbeutung, weil sie formell oder informell arbeiten müssen, um die Kosten für das Studium wenigstens teilweise aufzubringen, oder umd ihren Familie zu helfen. Noch sind sich die Studenten über die Tatsache nicht , dass sich ihre Hoffnungen in die Zukunft nicht realisieren werden: Die Mehrheit kleiner Berufstätiger, die in letzten Jahrzehnten aus den Universitäten herausgekommen sind, ist zunehmend proletarisiert worden, wie es Tausende von Gesundheits-, Bildungsberufstätige und Ingenieure erfahren haben. Sie haben Schwierigkeiten, mehr als zweimal den offiziellen Mindestlohn [6] zu verdienen, während die Verschlechterung des Soziallohns die Möglichkeit unterhöhlt, ein würdevolles Leben zu haben, sogar wenn du zu den "Privilegierten", gehörst, wie sie von den Regierungssprechern genannt werden.
Ebenso hat ein guter Teil der Jugend, die auf den Straßen protestiert, gesehen, was die Verwüstungen ihren Familien und der Gesellschaft zugefügt haben durch von der Chávez Bewegung und den Oppositionsführern hervorgerufenen Polarisierung in ihrem Konkurrenzkampf um die Macht. Sie sind Opfer der Teilung der Gesellschaft und einer Schwächung der sozialen Bindungen und der Solidarität; viele von ihnen und ihre Eltern sind in den Netzen politischer Polarisierung gefangen worden, indem sie sogar Fanatiker der einen oder anderen bürgerlichen Fraktion geworden sind, und dabei jeden Ausblick verloren haben. Sie haben auch Opfer des Kampfes der herrschenden Klasse und ihrem Motto "Der Zweck heiligt die Mittel" geworden", Opfer der skrupellosen Lügen und der Manipulationen als Ergebnis des Zerfalls bürgerlichen Moral.
Deshalb ist die Studentenbewegung, obwohl sich spontan ergeben, nicht das Ergebnis einer "Kinderkrankheit" noch ist sie von geheimen Führern geschaffen worden; viel weniger ist es etwas, das aus den Hirnen der Oppositionsführer oder vom CIA stammt, wie Chávez und seine Anhänger endlos wiederholt haben. Es ist das Produkt eines Prozesses der Reflexion, die seit mehreren Jahren im Gang innerhalb der Gesellschaft gewesen ist, und besonders unter den neuen Generationen, die damit konfrontiert sind, in einer Gesellschaft zu leben, wo es keine Chance gibt, ein würdevolles Leben zu führen. Daher ist es kein Zufall, dass der Student protestiert, dass Slogans mit einem eindeutig sozialen Inhalt angenommen wurden: der Kampf gegen Arbeitslosigkeit und Kriminalität, Hilfe für Kinder und Mütter, gegen Armut, aber auch gegen Lüge, Intoleranz Unmoral und Unmenschlichkeit, die die Gesellschaft verzehren.
Diese Merkmale zeigen, dass diese Bewegung den Konflikt zwischen Opposition und Regierung überstiegen hat und die Saat enthält, das Ganze des kapitalistischen Systems der Ausbeutung in Frage zu stellen; auf diese Art hat es sich fraglos in den gesamten Kampf der Lohnarbeiter eingetragen. Die Mittel und Methoden, die es dem Kampf gegeben hat, (Versammlungen, Wahl von der Versammlung gegenüber verantwortlichen Delegierten, die Tendenz, sich zu vereinigen, der Aufruf zu Diskussion nach außerhalb der Universitäten usw.) sind jene des Proletariats in seinen Kämpfen für die Verteidigung seiner Interessen. Obwohl noch wenig entwickelt und unbewusst, es gibt die Tendenz in dieser Bewegung, die Interessen der Arbeiterklasse auszudrücken, und dies hat es vorangetrieben.
In den letzten Jahre hat es Studentenbewegungen in anderen Teilen der Welt wie Brasilien, Chile, Frankreich gegeben, mehr oder weniger entwickelt, aber alle mit denselben Merkmalen. In Frankreich waren es Proteste und Demonstrationen, die von den Studenten im Mai 2006 gegen die Regierungsversuche geführt wurden, prekäre Arbeit aufzuerlegen, die Millionen von Menschen in Frankreich [7] mobilisierten. Die Studentenbewegung in Venezuela hat viele Ähnlichkeiten mit diesen Bewegungen. Diese Bewegungen zeigen, dass die Studenten in Venezuela nicht isoliert sind, sondern denselben Prozess der Reflexion ausdrücken, die innerhalb der neuen Generationen stattfindet, die nach einer Perspektive suchen, in einer Gesellschaft, die keine Zukunft anbietet.
Gefahren, die der Bewegung drohen
Die Studentenbewegung hat sich in einer zerbrechlichen und unsicheren Situation entfaltet. Der von der Bourgeoisie ausgeübte Druck zu kontrolliern und zu zerschlagen, ist sehr stark. Beide Regierung und Opposition machen dabei vollen Gebrauch von ihren Parteimaschinen, materiellen Mitteln und den Medien. Es gibt auch die Polarisierung und Spaltung der Gesellschaft durch die Regierung und die Opposition, die eine Wichtigkeit hat, die nicht unterschätzt werden kann. Nicht unterschätzt werden darf die Einschüchterung und Unterdrückung, die ausgeführt wurden, nicht nur durch den offiziellen Repressionsapparat, sondern auch von den Banden der Chávez Bewegung.
Jedoch sind eine der wichtigsten Gefahren für diese Bewegung die demokratischen Illusionen. Slogans wie der Kampf für "Meinungsfreiheit" oder "bürgerliche Rechte" u.a., selbst wenn damit gemeint die Notwendigkeit, den Institutionen des Staates gegenüberzutreten, die dem Kampfs im Wege stehen, sind sie im Wesentlichen Ausdrücke von Illusionen über die Möglichkeit, in der Lage zu sein, Freiheit und "Rechte" innerhalb des Kapitalismus haben zu können; dass es möglich (vielleicht mit einer anderen Regierung) ist, die Demokratie zu verbessern, um in der Lage zu sein, es wirklich in etwas zu verwandeln, das das Überwinden der Schwierigkeiten ermöglichen würde, die Gesellschaft zu reformieren. Demokratie mit seinen Institutionen, Parteien, Mechanismen (hauptsächlich Wahlen) ist das System, das die Bourgeoisie perfektioniert hat, um das System der Vorherrschaft durch eine Minderheit über der Mehrheit der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. "Meinungsfreiheit" ist Teil der Gesamtheit von "demokratischen Freiheiten", die das Bürgertum seit der französischen Revolution am Ende des 18. Jahrhunderts verkündet hat, welche nur dazu gedient haben, die ausgenutzte Masse zu verwirren, um seine Klassenherrschaft zu behaupten. Alle diese "Rechte" sind nichts als die Kodierung von diesen Illusionen. Alle bürgerlichen Regimes können "Freiheit" und "Rechte" anerkennen, solange die kapitalistische Ordnung und der Staat, der sie sichert, nicht bedroht werden. Deshalb ist es kein Zufall, dass in der Konfrontation zwischen den Regierungs- und Oppositionsgangstern jeder von ihnen behauptet, die wahren Verteidiger der demokratischen Ordnung zu sein.
Der Kampf für die "Autonomie von den Universitäten" ist ein anderer Ausdruck dieser demokratischen Illusionen. Es ist eine alte Forderung des Universitätsmilieus, das die Idee verteidigt, dass diese Institutionen von Staatseingriff frei sein können. Das ignoriert die Tatsache, dass Universitäten und Schulen das Hauptmittel dafür sind, die Ideologie der herrschenden Klasse zu verbreiten (ob von den Linken oder Rechten) unter der neuen Generation und für das Trainieren des Kaders, für das Verwalten dieser Ordnung. Diese Forderung, vorgebracht hauptsächlich von den Studentenföderationen und Universitätsverwaltungen, versucht, den auftauchenden Kampf innerhalb der vier Mauern der Universitäten gefangen zu halten, es vom Ganzen der Gesellschaft isolieren. [8]
Eine andere Gefahr, der die Bewegung gegenübersteht, ist die Ähnlichkeit zwischen seinen Forderungen und jenen der Opposition. Das spielt den Interessen in die Hände, die versuchen die Bewegung zu kontrollieren und die Regierung in die Lage zu versetzen, die Bewegung mit der Opposition zu identifizieren. Die Bewegung muss derselben Klarheit und Vehemenz, wie sie die Regierung hat, haben. Wenn sie das nicht hat, wird sie aufgehen in einer Bewegung, die nur dazu dient, die Opposition an die Macht zu bringen, wie das schon in anderen Ländern geschehen ist, wobei die grundsätzliche Situation unverändert und das kapitalistischen System intakt bleibt. Die Studenten müssen verstehen, dass die Opposition ebenso wie die Regierung für die Situation, in der wir leben, verantwortlich ist, dass die Opposition als Steigbügelhalter fungierte, auftrat, um Chávez an die Macht zu bringen. und dass, wenn sie zur Macht zurückkehrt, sie die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse ebenso angreifen wird wie die Chávez Bewegung heute, und dass sie beide bürgerliche Kräfte sind, die versuchen, die vorhandene Ordnung zu verteidigen.
Perspektiven
Diese Studentenbewegung, die wir begrüßen und unterstützen, hat die große Tugend, zu versuchen, mit dem giftigen Teufelskreis der Polarisierung zu brechen, indem sie auf Dialog und Diskussion durch Versammlungen setzt, die entscheiden sollen, was zur Diskussion ansteht und die Bedingungen festlegen. Dies ist ein Gewinn für die Studenten, für die Arbeiter und für die Gesellschaft als Ganzes, da es die wirklichen Verbindungen der Solidarität stärkt.
Jedoch wäre es illusorisch, zu denken, dass der Kampf der Studenten, ganz gleich, wie tapfer und mutig er gewesen ist, den gegenwärtigen Zustand der Dinge ändern wird. Diese Bewegung trägt wirklich Früchte, wenn es zum Verbreiten der proletarischen Elemente führen kann, die es nicht nur in den Barrios gibt, sondern noch bedeutsamer für die Arbeiter in den Fabriken und in den privaten und öffentlichen Unternehmen. Dies kann nicht durch die Gewerkschaften und die politischen Parteien, sondern nur durch die Einladung an Arbeiter aus allen Sektoren und an Arbeitslosen an den Versammlungen teilzunehmen, getan werden. Auf diese Weise werden die Arbeiter in der Lage sein, zu sehen, wie die proletarische Ader durch die Bewegung läuft. Zur gleichen Zeit wird dies das Nachdenken und auch den Kampf des Proletariats stimulieren, dessen Taten unentbehrlich sind dem Staat gegenüberzutreten und fähig zu sein, um die Hauptursachen für die Barbarei, in der wir leben - das kapitalistische System der Ausnutzung anzugreifen, und einen wirklichen Sozialismus basierend auf der Macht der Arbeiterräte durchzusetzen. Jedoch wenn es eine flüchtige Bewegung bleibt, eingespannt in Kampf zwischen bürgerlichen Fraktionen, wird sie zerschlagen werden..
Die fortschrittlichsten Teilnehmer der Bewegung müssen versuchen, sich in Diskussionszirkeln umzugruppieren, um in der Lage zu sein, eine Bilanz der Bewegung bis jetzt zu ziehen, und nach Möglichkeiten zu suchen, die proletarischen Elemente der Bewegung zu stärken, welche sich erst im Embryozustand befinden. Sie werden sich vertiefen mit der Verschlimmerung der ökonomischen und sozialen Krise.
Unabhängig von der Zukunft dieser Bewegung etwas für den zukünftigen Klassenkampf sehr wichtiges ist aufgetreten: die Eröffnung eines Prozesses der Reflexion und Diskussion. Internacionalismo, Sektion der IKS in Venezuela
Juli 2007.
[1] Laut dem Minister des inneren Pedro Carrenos am ersten Tag, als es 94 Demonstrationen überall in dem Land gab.
[2] "Wir wollen nicht gegen unsere Brüder kämpfen", erklärte ein Mitglied des Gemeinderats des Barrios von Patarse im Osten von Caracas, sich auf den Aufruf des Präsidenten Chávez beziehend, der die Barrios gegen die Studenten mobilisieren wollte.
[3] "Reich zu sein, ist schlecht" das wiederholt Chávez endlos in seinen häufigen Mediendarstellungen, während das Proletariat und seine Anhänger (in der Mehrheit die ärmsten Schichten der Bevölkerung) daran gewöhnt sind, eine prekäre Existenz zu leben das wirkliche Ziel des "21. Jahrhundertsozialismus". Jedoch, er und seine Familie, zusammen mit der höchsten Ebene der Bürokraten, befolgen dieses Motto nicht. Um das zu erläutern bringt die französische Zeitung Le Monde im Juni eine Artikelserie unter der Titel "Les Bons affaires DE La famille chavez" ('die Geschäftsangelegenheiten der Familie Chávez') heraus, wo sie die Art beschrieben, wie die Neureichen der so genannten "bolivarianischen Bourgeoisie" leben. Diese Artikel zeigten, dass Chávez ein Objekt des Interesses seitens der französischen Bourgeoisie geworden ist, die die "bolivarianische Revolution" und ihren fanatischen "Antiamerikanismus" zu ihrem Vorteil verwenden will.
[4] Die Studenten wurden von der Polizei eskortiert, als sie in die Versammlung gingen oder sie verließen. Die Chávez Banden umlagerten das Versammlungsgebäude.
[5] Entsprechend den offiziellen Zahlen der Regierung wurde die Armut von 54% 2003 auf 32% im Jahr 2006 reduziert. Jedoch gibt es hinter diesen Zahlen Staatsmanipulation (vornehmlich was die Preise der Nahrungsmittel anbetrifft), um sicher zu stellen, dass die Rede der Regierung darüber, ein Ende der Armut, wie sie 2001 herrschte, herbeizuführen, den Zahlen entspricht. Dennoch zur gleichen Zeit hat es die Zunahme der Anzahl von Bauchladenverkäufer, Straßenverkäufer) gegeben. Die Zunahme des im Jahr 2006 amtlich eingetragenen Verbrauchs war durch die Zunahme von öffentlichen Ausgaben, die durch die Wahlen verursacht wurden, aber nicht zu einer Verminderung der Armut führten. Die katholische Andrés Bello Universität, die die Armutsniveaus seit Jahren verfolgt hat, sagt, dass die Armut um 58% im Jahr 2005 zunahm.
[6] Über $ 300 laut amtlichen Wechselkurses 2150 Bolivars gegenüber $, die weniger als $ 150 zum Schwarzmarktwechselkurs beträgt.
[7] Siehe "Thesen zur Studentenbewegung im Frühjahr in Frankreich"
[8] Ein Beweis davon war die am 22. Juni im Basketballstadion der Universidad Central de Venezuela von der Föderation der Centros Universitarios gehaltene Versammlung, die Universitätsverwaltungen und die Opposition unterstützten. Dies war eine Schau, um Aufmerksamkeit von den wirklichen Versammlungen abzulenken. Angesichts dessen riefen einige Studenten: "Wir wollen keine Schaus, wir wollen Versammlungen".
[9] Siehe u.a.: ' Ukraine: Das autoritäre Gefängnis und die Falle der Demokratie ' https://en.internationalism.org/ir/126_authoritarian_democracy [85]
Geographisch:
- Venezuela [77]
Frankreich - Die Regierung Sarkozy offenbart die bürgerliche Natur der Linken
- 2779 reads
Die Regierung Fillon-Sarkozy reißt sich ihre Wahlkampfmasken vom Gesicht und zeigt den Arbeitern, dass ihr Slogan einer „wieder gefundenen Rechten“ kein Vergnügen ist. Die neue französische Regierung hat nicht einmal die Parlamentswahlen abgewartet, um eine Reihe von schweren Angriffen zu starten: Überstunden, Erschwernisse beim Zugang zu Krankenpflegeleistungen, Erhöhung der indirekten Steuern, eine massive Reduktion der Stellen im öffentlichen Dienst (zwischen zehn- und zwanzigtausend bei den Lehrkräften). – Kurzum, ein Vorgeschmack auf die Zukunft, in der der so genannte „Wandel des Lebensstils“, den die herrschende Klasse in Frankreich während dem ganzen Wahlkampf 2007 propagierte, in die Tat umgesetzt werden soll.
Die Regierung Fillon-Sarkozy reißt sich ihre Wahlkampfmasken vom Gesicht und zeigt den Arbeitern, dass ihr Slogan einer „wieder gefundenen Rechten“ kein Vergnügen ist. Die neue französische Regierung hat nicht einmal die Parlamentswahlen abgewartet, um eine Reihe von schweren Angriffen zu starten: Überstunden, Erschwernisse beim Zugang zu Krankenpflegeleistungen, Erhöhung der indirekten Steuern, eine massive Reduktion der Stellen im öffentlichen Dienst (zwischen zehn- und zwanzigtausend bei den Lehrkräften). – Kurzum, ein Vorgeschmack auf die Zukunft, in der der so genannte „Wandel des Lebensstils“, den die herrschende Klasse in Frankreich während dem ganzen Wahlkampf 2007 propagierte, in die Tat umgesetzt werden soll.
Gegen die Arbeiterklasse…
Die Parole des Präsidentschaftskandidaten Sarkozy „Mehr Arbeiten, um mehr zu verdienen“ war selbst schon eine Frechheit. Bereits am 6. Juni wurde eine Vorlage eingereicht, welche die Steuerbefreiung von Überstunden vorsieht und am 1. Oktober in Kraft treten wird. Mit dieser Steuerbefreiung kosten die Überstunden die Unternehmer (privat und öffentlich) fast gleichviel wie die normalen Arbeitsstunden. So wäre es ja fast schade für das Kapital, nicht Profit daraus zu schlagen! Damit ist die Bahn geebnet und grünes Licht an die Unternehmer gegeben worden, das maximale Kontingent von 220 jährlichen Überstunden voll auszuschöpfen. Unter diesen Bedingungen werden die Löhne schnell eingefroren. Doch welch „wunderbare Kompensationsmöglichkeit“ für die Arbeiter, um einige Euros „mehr zu verdienen“! Die Belegschaft des Kronenbourg-Betriebes in Obernai hatte, als sie Anfang Juni in den Streik trat, sehr wohl verstanden, dass es sich dabei in Tat und Wahrheit um „Mehr arbeiten, um schneller zu sterben“ handelte. Schon als das neue Gesetz, welches den Rückgriff auf Überstunden erleichtert, noch nicht in Kraft getreten war, hatten die Angestellten von Kronenbourg mit ihren 50-Stunden Wochen das Gefühl „ihr Leben im Betrieb zu verbringen“. „Das sind vier Wochen, in denen ich Sonntagmorgens um 6 Uhr mit arbeiten aufhörte und dann am Montagmorgen um 6 Uhr wieder beginne“, erklärt ein Arbeiter.
Ist das Ziel dieser Steuerbefreiungspolitik eine Erleichterung für die Unternehmer, und woher will der Staat denn seine Einkünfte beziehen? Ganz einfach, es geht darum, die Arbeiterklasse unter Druck zu setzen. Im französischen Fernsehen wurde das folgendermaßen auf den Punkt gebracht: „Man muss alles in Betracht ziehen, auch die Möglichkeit einer Erhöhung der Mehrwertsteuer.“ Die Steigerung der indirekten Steuer auf Konsumgütern hat eine drastische Senkung der Kaufkraft für Lebensmittel zur Folge.
Auch bei der Krankenpflege kündigt die Einführung eines neuen Selbstbehalts bis im Herbst den Abbau des Gesundheitssystems an; diese Demontage wird von allen Regierungen weiter getrieben, seien sie linke oder rechte.
Jedes Jahr muss beim ersten Arztbesuch oder Krankenhausaufenthalt, bei der ersten Laboruntersuchung oder dem ersten Kauf von Medikamenten der Kranke erneut einen Selbstbehalt bezahlen, bevor er von der Krankenversicherung eine Rückerstattung erhält.
Hier geht es zweifellos darum, aus den medizinischen Rückerstattungen einen Spießrutenlauf zu machen, so dass die Erkrankten dann schlussendlich eine Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen aufgeben. In Wirklichkeit führen die seit 2004 eingeführten Reformen immer mehr Leute dazu, Behandlungen zu verschieben oder ihre Schulden gegenüber Krankenhäusern zu vergrößern.
¡ Rechts oder Links, gehupft wie gesprungen!
Und wenn die Linke die Wahlen gewonnen hätte, wäre dann die Zukunft nicht ein etwas rosiger - oder wenigstens nicht so knallhart? Weit gefehlt!
Um sich davon zu überzeugen, reicht es, sich die Umstände anzuschauen, die die gegenwärtige Regierung für all diese Angriffe veranstaltet. So sind hier einige Köpfe (und nicht die geringsten) der Linken zu finden, die sich brüderlich neben diejenigen der Sarkozy-Rechten gesellen. Es handelt sich um eine unübertreffliche Veranschaulichung der Wahlkampfparole von Ségolène Royal: „gagnant, gagnant“ („jeder gewinnt“)! So leistet sich die Linke, nachdem sie bereits die befürchtete blaue Welle bei der ersten Runde der Parlamentswahlen eingedämmt hat, den Luxus, Sitze zu gewinnen – und zwar in der Regierung Fillon II selbst.
Bis jetzt haben sich linke und rechte Regierungen abgewechselt, indem sie versicherten, die Kontinuität der Angriffe in den wichtigen Bereichen zu wahren (Gesundheit, Altersrenten, Beschäftigung usw.). Heute verlangt der präsidiale „neue Stil“, dass die Schläge gegen die Arbeiterklasse kollegial von der rechten Regierung ausgeteilt werden, in welcher der linke Partner seinen Platz hat: Kouchner (der Humanitäre ohne Grenzen), Jouyet (Vertrauter des Ex-Paares Hollande/Royal), Hirsch (der Freund der Armen, der schnell begriffen hat, dass die Wohltätigkeit bei sich selber beginnt), bis zu den zuletzt in die Regierung eingetretenen, dem sozialistischen Bürgermeister von Mülhausen, Jean-Marie Bockel, und Fadela Amara (Präsidentin des Vereins „Ni Putes Ni Soumises“ („Weder Huren noch Unterwürfige“), aber unter dem Strich dann doch etwas „Hure“). Die Bourgeoisie hat viel Wert darauf gelegt, uns klar zu machen, dass Rechte und Linke nicht „Jacke wie Hose“ sind. So verkündete eine sozialistische Abgeordnete des Departements Deux-Sèvres vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen, dass „die Linke und die Rechte nicht gleich sind … es handelt sich um zwei verschiedene Arten, die Welt zu sehen, die Früchte der Arbeit zu verteilen“. Na mal sehen!
Auch die extreme Linke verbreitete in den beiden Wahlgängen mit ihrer Parole: „Alles außer Sarkozy“ genau diese Botschaft.
So viel Anstrengungen, ideologischer Verbissenheit und – schwuppdiwupp: Die Gewählten haben ihr „Coming out“ mit einer innigen Umarmung Sarkozys.
Die Sozialistische Partei kann immer noch erklären, dass es sich dabei bloß um Judasse handle, üble Verräter, die ihr „soziales Ideal“ für ein Linsengericht dem Teufel verkauft haben. Es bleibt dabei, dass die Transplantation nicht möglich gewesen wäre ohne eine gewisse Verträglichkeit.
Sarkozy hatte wirklich die Qual der Wahl im großen Laden der Linken. Heute noch geben die historischen Führer, unter ihnen die einflussreichsten der Sozialistischen Partei, Fabius oder Jack Lang, auf der Treppe zum Regierungspalast Pfote und wedeln mit dem Schwanz in der Hoffnung, dass sie mit irgend einem Schlüsselposten (Präsidentschaft des IWF) oder weiteren Ministeraufgaben belohnt werden.
Malek Boutih (früherer Vorsitzender von SOS Racisme und Mitglied der Sozialistischen Partei) brach auch ohne weiteres ein Lanze für Fadela Amara, als er ihre Ernennung als „gute Nachricht“ feierte und ausrief: „Man darf nicht im Namen von politischen Divergenzen Personen verurteilen!“
Doch von welcher Divergenz spricht er? Handelt es sich etwa um diejenige zwischen einer Linken, die „historisch im Gesellschaftlichen verankert“ ist, der „ausländischen“, der „Erbfeindin“ der Rechten, und dieser Rechten, die „an das Unternehmertum gebunden“ ist – mal ehrlich: Dieser Schwindel hatte schon vorher viel Blei in den Flügeln und fliegt in Zukunft so gut wie ein Amboss.
Die Eile, mit der einige sozialistische Parlamentarier und linke Verbündete in die Regierung Fillon eintreten, nachdem sie eine (harte) Kampagne gegen Sarkozy geführt haben, sagt ebenso viel über die Überzeugungen dieser linken Galionsfiguren aus, die angeblich die Arbeiterklasse und die Armen vertreten, wie die kürzlich erfolgte Erklärung von Ségolène Royal, wonach sie nie an das von ihr verteidigte Programm der Sozialistischen Partei geglaubt habe (insbesondere mit dem Mindestlohn von € 1500.--).
Was schließlich die einzige Überzeugung der Politiker von rechts bis links ist und wovon wir uns selber überzeugen müssen, ist ihre Zugehörigkeit mit Haut und Haar zur Klasse der Ausbeuter. 28.06.07
(aus Révolution Internationale
von Juli/August 2007)
Oktober 2007
- 775 reads
Wiederveröffentlichung: Gegenwärtige Probleme der Arbeiterbewegung - Internationalisme Nr. 25 – August 1947
- 3248 reads
Einleitung der IKS
Dieser Text von Internationalisme ist ein Auszug aus einer Artikelreihe, die während des Jahres 1947 unter dem Titel „Gegenwärtige Probleme der Arbeiterbewegung“ veröffentlicht wurde. Wir verweisen unsere Leser/Innen auf die Vorstellung des ersten Teils in der Nr. 33 der englisch/französisch/spanischen Ausgabe unserer Internationalen Revue, in der die Kritik von Internationalisme an den Organisationsauffassungen des Parti Communiste Internationaliste Italiens (PCInt) in den historischen Kontext der damaligen Epoche eingebettet wird. Nach der Kritik im ersten Teil an der Auffassung vom „brillanten Führer“, derzufolge nur besondere Individuen die Fähigkeit besitzen, die revolutionäre Theorie zu vertiefen, greift Internationalisme im zweiten Teil die „Disziplin“ an, dem Analogschluss dieser Auffassung, demzufolge die Mitglieder der Organisation schlicht und einfach als Roboter betrachtet werden, die über die politischen Orientierungen der Organisation nicht diskutieren dürften. Internationalisme unterstreicht: „Die Organisation und das konzertierte Handeln der Kommunisten stützen sich ausschließlich auf das Bewusstsein der Mitglieder der Organisation. Je größer und klarer dieses Bewusstsein ist, desto stärker ist die Organisation und desto konzertierter und wirksamer ist ihr Handeln.“Seit den 1940er Jahren gründeten sich die wiederholten Abspaltungen vom PCInt auf dieser ruinösen Vision der Organisation, bis zur heutigen Auflösung der größten dieser Abspaltungen (der Parti Communiste Internationale - „Programme Communiste“), was lediglich die Richtigkeit der Warnung von Internationalisme vor diesen Auffassungen bestätigt hatte.
„Disziplin – unsere Hauptstärke“
Während der Parlamentswahlen in Italien Ende 1946 ist im Zentralorgan des PCInt ein Leitartikel erschienen, der als solcher programmatisch war. Seine Überschrift lautete: „Unsere Stärke“, sein Verfasser war der Generalsekretär der Partei. Worum ging es in dem Artikel? Um die Unruhe, die in den Reihen des PCInt aufgrund der Beteiligung an den Parlamentswahlen entstanden war. Ein Teil der Genossen, die allem Anschein nach lediglich an der abstentionistischen Tradition der Fraktion um Bordiga hingen und dieser folgten, anstatt eine klare Gesamtposition zu vertreten, erhob sich gegen die Politik der Wahlbeteiligung. Diese Genossen reagierten eher auf ein Unbehagen in ihren Reihen, auf eine mangelnde Begeisterung und auf praktische „Nachlässigkeiten“ in der Wahlkampagne und nicht so sehr aufgrund eines offenen politischen und ideologischen Kampfes innerhalb der Partei. Ein anderer Teil der Genossen ging in seiner Begeisterung für die Wahlen gar soweit, sich am Referendum „Für die Monarchie oder die Republik“ zu beteiligen, wobei er ungeachtet der abstentionistischen Position der Partei und des Zentralkomitees gegenüber dem Referendum für die Republik stimmte.
Indem sie vermeiden wollten, wegen einer allgemeinen Diskussion über den Parlamentarismus „Unruhe“ in der Partei zu verbreiten, und sich dabei auf die längst hinfällig gewordene Politik des „revolutionären Parlamentarismus“ beriefen, haben sie in Wirklichkeit nur das Bewusstsein der Mitglieder getrübt, die nicht wussten, welchem „Führer“ man folgen sollte. Die einen beteiligten sich zu eifrig an der Kampagne, die anderen zu wenig; die Partei ging dabei jedenfalls durch ein Wechselbad der Gefühle und ist aus diesem Wahlkampfabenteuer nicht ganz unbeschadet herausgekommen. (1).
Der Generalsekretär stemmte sich in seinem Editorial vehement gegen diese Entwicklung. Er drohte mit dem Bannstrahl der Disziplin und prangerte die örtlichen linken oder rechten politischen Dissidenten an. Er meinte, dass es nicht darauf ankomme, ob eine Position richtig oder falsch ist, sondern darauf, die allgemeine politische Linie anzuerkennen, nämlich die des Zentralkomitees, der man Gehorsamkeit leisten müsse. Das sei eine Sache der Disziplin. Die Disziplin sei die Hauptstärke der Partei… und der Armee, würde ein jeder Unteroffizier hinzufügen. Es stimmt, dass der Sekretär von einer freiwillig vereinbarten Disziplin spricht. Gott sei Dank! Mit diesem Zusatz fühlen wir uns gleich viel sicherer…
Welche tollen Ergebnisse sind nach dem Aufruf zur Disziplin zu verbuchen gewesen? Vom Süden bis zum Norden, von links bis rechts hat eine wachsende Zahl von Genossen auf ihre Weise diese „freiwillig vereinbarte Disziplin“ umgesetzt und ist freiwillig aus der Partei ausgetreten. Die Führer des PCInt haben uns bis zum Überdruss erzählt, dass es sich hier um eine „Umwandlung von Quantität in Qualität“ gehandelt habe und dass die zahlreichen Parteiaustritte die Partei von einer falschen Auffassung über die kommunistische Disziplin gewahrt haben. Wir antworten darauf, dass wir davon überzeugt sind, dass jene, die in der Partei verblieben sind - das Zentralkomitee an erster Stelle -, nicht einer falschen Disziplinauffassung aufgesessen sind, sondern einer falschen Auffassung über den Kommunismus schlechthin.
Was ist Disziplin? Ein Aufzwingen des Willens auf Andere. Das Adjektiv „freiwillig vereinbart“ ist letztendlich nur eine rhetorische Beschönigung, um die Sache attraktiver zu machen. Wenn sie von denen ausgeübt wird, die sich ihr unterwerfen, ist es nicht notwendig, sie daran zu erinnern – und sie vor allem pausenlos daran zu erinnern, dass sie eine „freiwillig vereinbarte“ Disziplin ist.
Die Bourgeoisie hat stets behauptet, dass ihre Gesetze, ihre Ordnung, ihre Demokratie Ausdruck des Volkswillens seien. Im Namen dieses „freien Willens“ wurden Gefängnisse an der Front gebaut, an deren Tore in Blut geschrieben stand: „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“. So wurde das Volk in den Armeen mobilisiert, deren Massaker in den Feuerpausen als „freier Wille“ verkauft wurden, der sich „Disziplin“ nannte.
Die Ehe ist, so scheint es, ein freier Vertrag, so dass die Scheidung, die Trennung als nicht hinnehmbare Farce erscheint. „Unterwerfe dich deinem eigenen Willen“, war die Vervollkommnung der jesuitischen Devise der ausbeutenden Klassen gewesen. So wird die Unterdrückung – hübsch in Geschenkpapier eingepackt und mit Bändern geschmückt – den Unterdrückten präsentiert. Jeder weiß, dass die christliche Inquisition die Ketzer aus Liebe, aus Respekt vor ihrer göttlichen Seele, die sie retten wollte, und aus Mitleid verbrannte. Die göttliche Seele der Inquisition von damals ist heute zur „freiwillig vereinbarten“ Disziplin geworden.
„Eins - zwei, eins - zwei, links, rechts … vorwärts Marsch!“ Übt eure „freiwillig vereinbarte“ Disziplin aus, und ihr werdet glücklich sein!
Worin besteht die kommunistische Auffassung über die Organisation und die Handlungsweise, wenn es nicht – um es zu wiederholen – die Disziplin ist? Sie geht von dem Postulat aus, dass die Menschen nur dann frei handeln, wenn sie sich ihrer Interessen voll bewusst sind. Die historische, ökonomische und ideologische Entwicklung bedingt diese Bewusstseinsentwicklung. Die „Freiheit“ existiert nur, sofern dieses Bewusstsein erlangt ist. Da, wo es kein Bewusstsein gibt, ist Freiheit nur eine Worthülse, eine Lüge; sie bedeutet lediglich Unterdrückung und Unterwerfung, auch wenn sie formal „freiwillig vereinbart“ ist.
Die Kommunisten haben nicht die Aufgabe, der Arbeiterklasse irgendeine Freiheit zu verschaffen. Sie haben keine Geschenke zu verteilen. Ihre Aufgabe besteht lediglich darin, der Arbeiterklasse zu helfen, sich über die allgemeinen Ziele der Bewegung bewusst zu werden, wie es das Kommunistische Manifest sehr treffend formuliert.
Der Sozialismus ist nur als ein bewusstes Handeln der Arbeiterklasse möglich. Alles, was die Bewusstwerdung begünstigt, ist sozialistisch, und nichts anderes. Man kann den Sozialismus nicht mit dem Knüppel einführen. Nicht weil der Knüppel unmoralisch ist - wie es ein Koestler behauptet -, sondern weil der Knüppel nicht das Element des Bewusstseins enthält. Der Knüppel ist durchaus moralisch, wenn das Ziel, das man verfolgt, Unterdrückung und Klassenherrschaft sind, weil er solche Ziele konkret umsetzen kann. Es gibt keine anderen Mittel für diesen Zweck, und kann sie auch nicht geben. Wenn man auf den Knüppel zurückgreift – und die Disziplin ist ein moralischer Knüppel –, um das mangelnde Bewusstsein zu ersetzen, wendet man sich vom Sozialismus ab und führt die Bedingungen für einen Nicht-Sozialismus herbei. Deshalb wenden wir uns kategorisch gegen die Gewalt innerhalb der Arbeiterklasse nach dem Triumph der proletarischen Revolution und sind entschiedene Gegner einer Hingabe gegenüber der Disziplin innerhalb der Partei.
Um Missverständnisse auszuschließen: Wir lehnen nicht die Notwendigkeit der Organisation ab, auch nicht die Notwendigkeit eines konzertierten Vorgehens. Im Gegenteil. Wir lehnen jedoch die Idee ab, dass Disziplin jemals als Grundlage des Handelns dienen kann, da ihr Wesen Letzterem fremd ist. Die Organisation und die konzertierte Handlung der Kommunisten stützen sich ausschließlich auf das Bewusstsein der Mitglieder der Organisation. Je größer und klarer dieses Bewusstsein ist, desto stärker ist die Organisation und desto konzertierter und wirksamer ist ihr Handeln.
Lenin hat mehr als einmal entschieden die Zuflucht zur „freiwillig vereinbarten Disziplin“ als einen Knüppel der Bürokratie verurteilt. Wenn er von Disziplin sprach, so meinte er damit – und er äußerte dies vielmals - immer den Willen zum organisierten Handeln, das sich auf ein revolutionäres Bewusstsein, auf die feste Überzeugung eines jeden Militanten stützt.
Man kann von den Mitgliedern nicht verlangen (wie es das Zentralkomitee der PCInt tut), eine Handlung auszuführen, die sie nicht verstehen oder die gegen ihre Überzeugung gerichtet ist. Das hieße zu glauben, dass man revolutionäre Arbeit mit einer Masse von Kretins oder Hörigen betreiben kann. Die Notwendigkeit der Disziplin als revolutionäre Theologie wird dann verständlich. In Wirklichkeit kann die revolutionäre Aktivität nur von bewussten und überzeugten Mitgliedern ausgeführt werden. Nur dann zerbricht diese Aktivität alle Ketten und somit auch jene, die durch die heilige Disziplin auferlegt werden.
Die alten Militanten erinnern sich daran, welch eine Falle, welch fürchterliche Waffe gegen die Revolutionäre diese Disziplin in den Händen der Bürokraten und Führer der Komintern gebildet hat. Die Nazis hatten ihre heiligen Tribunale, die Sinowjews an der Spitze der Komintern ihre heilige Disziplin: eine wahrhaftige Inquisition, mit ihren Kontrollkommissionen, die die Seele eines jeden Genossen quälten und untersuchten. Die Parteien wurden in eine Zwangsjacke gesteckt, die jede Manifestation der Entwicklung von revolutionärem Bewusstsein erstickte. Der Gipfel der Durchtriebenheit bestand darin, Militante dazu zu zwingen, öffentlich das zu verteidigen, was sie in den Organisationen und Organen, deren Teil sie waren, verurteilten. Dies war der Test des perfekten Bolschewiki. Die Moskauer Prozesse unterschieden sich in ihrem Wesen nicht von dieser Auffassung der freiwilligen vereinbarten Disziplin. Wenn die Geschichte der Klassenunterdrückung diesen Begriff der Disziplin nicht geschaffen hätte, dann hätte ihn spätestens die stalinistische Konterrevolution erfinden müssen.
Wir kennen erstrangige Mitglieder des PCInt, die, um diesem Dilemma, sich gegen ihre Überzeugung an der Wahlkampagne zu beteiligen, zu entkommen oder sich der Disziplin zu entziehen, nichts anderes zu tun wussten, als zu der List zu greifen, rechtzeitig zu verreisen. Bewusst zur List, zur Täuschung zu greifen, nicht einverstanden zu sein und trotzdem den Mund zu halten - das ist das deutlichste Ergebnis dieser Methode. Welche Erniedrigung der Partei, welche Entwürdigung der Mitglieder!
Die Disziplin des PCInt beschränkt sich nicht nur auf die Mitglieder der Partei Italiens, sie wird ebenfalls von den belgischen und französischen Fraktionen verlangt. Der Abstentionismus war in der Internationalen Kommunistischen Linken selbstverständlich. So schrieb eine Genossin der Französischen Fraktion der Kommunistischen Linken einen Artikel in deren Zeitung, mit dem sie versuchte, den Abstentionismus mit der Politik der Wahlbeteiligung des PCInt in Einklang zu bringen. Ihr zufolge handle es sich nicht um eine Prinzipienfrage; die Wahlbeteiligung des PCInt sei sehr wohl zulässig, auch wenn sie einer Enthaltung des PCInt den „Vorzug“ gegeben hätte. Wie man sehen kann, keine allzu „bissige“ Kritik – diktiert vor allem von der Notwendigkeit, die Kritik der Französischen Fraktion an der Wahlbeteiligung der Trotzkisten in Frankreich zu rechtfertigen.
Doch selbst diese Kritik reichte aus, dass der Parteisekretär in Italien die sündige Genossin zur Ordnung rief. Mit großem Tamtam erklärte der Sekretär, dass die Kritik im Ausland an der Politik des Zentralkomitees des PCInt nicht zulässig sei. Erneut wurde der Dolchstoß-Vorwurf erhoben, doch diesmal kam die Beschuldigung aus Italien und richtete sich gegen Frankreich.
Marx und Lenin sagten stets: Lehren, erklären, überzeugen. „Disziplin, Disziplin und noch einmal Disziplin“ hallte es dagegen aus dem Zentralkomitee zurück. Es gibt keine wichtigere Aufgabe als die Bildung von bewussten Militanten durch eine stetige Arbeit der Erziehung, der Erklärung und der politischen Diskussion. Diese Aufgabe ist gleichzeitig das einzige Mittel, mit dem das revolutionäre Handeln garantiert und gestärkt werden kann. Der PCInt hat jedoch ein wirksameres Mittel entdeckt: die Disziplin. Das überrascht uns nach alledem nicht. Wenn man sich zum Konzept des Genius bekennt, der nur auf sich hört und sich in seinem Licht aalt, dann wird das Zentralkomitee zum Generalstab, der dieses Licht in Anordnungen und Ukasse destilliert und umwandelt. Die Militanten werden zu Leutnants, Offizieren und Unteroffizieren – und die Arbeiterklasse zu einer Masse von Soldaten, der beigebracht werden soll, dass „Disziplin unsere Hauptstärke“ sei.
Diese Auffassung über den Kampf der Arbeiterklasse und der Partei entspricht den Auffassungen eines Ausbildungsoffiziers der französischen Armee. Sie ist verwurzelt in der uralten Unterdrückung und Herrschaft des Menschen über den Menschen. Es ist die Aufgabe der Arbeiterklasse, dies ein für allemal zu überwinden.
Das Recht auf Fraktionsbildung und die Funktionsweise der revolutionären Organisation
Nach so vielen Jahren gewaltiger Kämpfe innerhalb der Komintern um das Fraktionsrecht mag es unglaublich sein, heute auf diese Frage wieder zurückkommen zu müssen. Sie schien für jeden Revolutionär aufgrund der erlebten Erfahrung gelöst zu sein. Und trotzdem müssen wir dieses Fraktionsrecht heute gegen die Führer des PCInt verteidigen.
Kein Revolutionär kann von der Freiheit oder der Demokratie im Allgemeinen sprechen. Denn kein Revolutionär lässt sich durch die Allgemeinplätze irreführen, weil er immer versuchen wird, ihren wirklichen gesellschaftlichen Inhalt, ihren Klasseninhalt aufzuzeigen. Mehr als irgendeinem Anderen kommt Lenin das Verdienst zu, den Schleier zerrissen und die schamlose Lüge bloßgelegt zu haben, die von den schönen Worten der „Freiheit“ und „Demokratie“ im Allgemeinen verdeckt wurde.
Was für die Klassengesellschaft gilt, trifft auch auf die politischen Gruppierungen zu, die innerhalb der Klassengesellschaft aktiv sind. Die II. Internationale war sehr demokratisch, aber ihre Demokratie lief darauf hinaus, den revolutionären Geist in einem Meer des bürgerlichen ideologischen Einflusses zu ertränken. Die Kommunisten wollen nichts mit solch einer Demokratie zu tun haben, mit der die revolutionäre Flamme gelöscht werden soll. Der Bruch mit den Parteien der Bourgeoisie, die von sich behaupteten, sozialistisch und demokratisch zu sein, war notwendig und gerechtfertigt. Die Gründung der III. Internationale auf der Grundlage des Ausschlusses der so genannten Demokratie war eine historische Reaktion darauf. Diese Antwort ist definitiv eine Errungenschaft der Arbeiterbewegung.
Wenn wir von der Arbeiterdemokratie sprechen, von der Demokratie innerhalb der Organisation, dann meinen wir damit etwas ganz Anderes als die sozialistische Linke, die Trotzkisten und andere Demagogen. Die Demokratie, die sie uns mit bebender und honigsüßer Stimme verkaufen wollen, ist eine Demokratie, in der die Organisation die „Freiheit“ hat, Minister für die Verwaltung des bürgerlichen Staates zu stellen, ist eine Demokratie, die es uns ermöglicht, „freiwillig“ am imperialistischen Krieg teilzunehmen. Diese organisierten Demokratien liegen uns nicht näher als die nicht-demokratischen Organisationen Hitlers, Mussolinis und Stalins, die genau die gleiche Arbeit verrichten. Nichts ist verwerflicher als die Vereinnahmung Rosa Luxemburgs für diese Zwecke (die sozialistischen Parteien sind Meister darin) durch die Taschenspieler der sozialistischen Linken, die damit versuchen, ihren „Demokratismus“ der bolschewistischen „Intoleranz“ entgegenzusetzen. Rosa Luxemburg hatte noch weniger als Lenin alle Probleme der Arbeiterdemokratie gelöst, doch beiden wussten, was diese sozialistische Demokratie bedeutete, und beide prangerten sie entsprechend an.
Wenn wir vom inneren Regime sprechen, meinen wir eine Organisation, die sich auf Klassenkriterien stützt, auf ein revolutionäres Programm, das nicht den Advokaten aus den Reihen der Bourgeoisie offen steht. Unsere Freiheit ist keine abstrakte Freiheit, keine Freiheit als solche, sondern äußert sich hauptsächlich konkret. Es ist die Freiheit von Revolutionären, die gemeinsam versuchen, die besten Mittel zu finden, um für die gesellschaftliche Befreiung zu handeln. Auf dieser gemeinsamen Grundlage treten bei dem Versuch, auf das gemeinsame Ziel hinzuarbeiten, unvermeidlich etliche Divergenzen auf. Diese Divergenzen bringen immer entweder den Mangel einer richtigen Antwort, wirkliche Schwierigkeiten des Kampfes oder auch eine Unreife der Gedanken zum Ausdruck. Sie können weder verschwiegen noch verboten werden, sondern müssen im Gegenteil durch die Erfahrung des Kampfes und durch die freie Auseinandersetzung der Ideen überwunden werden. Die Funktionsweise der Organisation besteht also nicht darin, diese Divergenzen zu ersticken, sondern die Bedingungen für ihre Lösung zu schaffen. Das heißt, sie zu fördern, ans Tageslicht zu bringen, statt zuzulassen, dass sie sich heimlich ausbreiten. Nichts vergiftet mehr die Atmosphäre in der Organisation als Divergenzen, die verborgen bleiben. Damit verzichtet die Organisation nicht nur auf jede Möglichkeit, sie zu überwinden; sie untergräbt auch langsam ihre eigenen Grundlagen. Bei der ersten Schwierigkeit, beim ersten ernsthaften Rückschlag gerät das Gebäude, das vorher so solide erschien, ins Wanken, bricht zusammen und hinterlässt nur einen Haufen Steine. Was anfänglich nur ein Unwetter war, wird zu einer verheerenden Katastrophe.
Die Genossen des PCInt sagen uns: Wir brauchen eine starke Partei, eine geeinte Partei. Die Existenz von Tendenzen, von Fraktionskämpfen spalte und schwäche sie. Zur Unterstützung dieser Thesen berufen sich die Genossen auf die von Lenin vorgestellte und vom 10. Kongress der russischen KP verabschiedete Resolution, die die Existenz von Fraktionen innerhalb der Partei verbot. Die Berufung auf die berühmte Resolution Lenins und ihre Verabschiedung heute charakterisiert am klarsten die ganze Entwicklung der zur Partei gewordenen Italienischen Fraktion. Das, wogegen die Italienische Linke und die ganze Linke der Komintern sich mehr als 20 Jahre lang aufgelehnt und was sie bekämpft haben, wird heute zu einem Glaubensbekenntnis des „perfekten“ Militanten des PCInt. Müssen wir in Erinnerung rufen, dass die erwähnte Resolution drei Jahre nach der Revolution (vorher hätte sie nie ins Auge gefasst werden können) von einer Partei verabschiedet wurde, die vor einer endlosen Zahl von Problemen stand: äußere Blockade, Bürgerkrieg, Hungersnot, wirtschaftlicher Ruin im Inneren? Die Russische Revolution steckte in einer fürchterlichen Sackgasse. Entweder würde die Weltrevolution sie retten, oder sie würde unter dem vereinten Druck von außen und der inneren Schwierigkeiten zerbrechen. Die an der Macht befindlichen Bolschewiki unterwarfen sich diesem Druck und wichen auf ökonomischer Ebene und – was tausendmal schlimmer war – vor allem auf politischer Ebene zurück. Die Resolution zum Verbot der Fraktionen, die Lenin übrigens als vorübergehend präsentierte und die von den furchtbaren Bedingungen diktiert wurde, war nur eine von einer Reihe von Maßnahmen, die die Revolution alles andere als verstärkten, sondern den Niedergang der Revolution nur beschleunigten.
Der 10. Kongress erlebte, als diese Resolution angenommen wurde, gleichzeitig auch die Niederschlagung des Arbeiteraufstandes in Kronstadt durch die Staatsgewalt und den Beginn der massenhaften Deportationen von innerparteilichen Opponenten nach Sibirien. Die ideologische Erstickung innerhalb der Partei ging einher mit der Anwendung von Gewalt innerhalb der Klasse. Der Staat, das Organ der Gewalt und des Zwangs, trat anstelle der ideologischen, wirtschaftlichen Einheitsorganisationen der Klasse - der Partei, der Gewerkschaften und der Sowjets. Die GPU ersetzte die Diskussion. Die Konterrevolution ertränkte unter dem Banner des Sozialismus die Revolution; ein inquisitorisches staatskapitalistisches Regime wurde konstituiert.
Marx sagte hinsichtlich Louis Bonaparte, dass die großen Ereignisse der Geschichte zweimal stattfinden: „das erste Mal als Tragödie, das zweite Mal als Farce“. Was der PCInt vorführte, war eine Farce im Vergleich zur Erhabenheit und Tragödie der Russischen Revolution und der bolschewistischen Partei. Das Antifaschistische Koalitionskomitee von Brüssel trat an die Stelle des Petrograder Sowjets, Vercesi an die Stelle von Lenin, das armselige Zentralkomitee von Mailand an die Stelle der Kommunistischen Internationale in Moskau, wo die Revolutionäre aller Länder zusammengekommen waren, und die kleingeistigen Intrigen einiger provinzieller Führer traten an die Stelle des tragischen Kampfes von Dutzenden von Millionen Menschen. Das Schicksal der Russischen und Weltrevolution entschied sich 1921 rund um die Frage des Fraktionsrechts. „Keine Fraktion“ war 1947 in Italien der Schrei der Hilfslosen, die nicht dazu gezwungen werden wollten, kritisch zu denken, und in ihrer Ruhe nicht gestört werden wollten. „Keine Fraktion“ führte 1921 zur Auslöschung der Revolution. „Keine Fraktion“ ist 1947 nichts als die Fehlgeburt einer nicht überlebensfähigen Partei.
Aber noch als Farce wurde das Fraktionsverbot zu einem ernsthaften Handikap beim Wiederaufbau einer revolutionären Organisation. Der Wiederaufbau des Internationalen Büros der Kommunistischen Linken diente als offensichtliches Beispiel der vorherrschenden Methoden. Wir wissen, dass das Internationale Büro bei Ausbruch des Krieges auseinanderfiel. Während des Krieges manifestierten sich politische Divergenzen in und zwischen den Gruppen, die zur Internationalen Kommunistischen Linken (IKL) gehörten. Welche Methode hätte man beim Aufbau der organisatorischen und politischen Einheit der IKL verfolgen müssen? Unsere Gruppe trat für die Einberufung einer internationalen Konferenz aller Gruppen ein, die der IKL angehörten, und bezweckte damit eine breite Diskussion der anstehenden Fragen. Uns wurde die andere Methode entgegengesetzt, die darin bestand, die Divergenzen so weit wie möglich zu verschweigen, die Gründung der Partei in Italien zu begrüßen und für den Zusammenschluss um sie herum einzutreten. Weder eine internationale Diskussion noch eine internationale Kritik wurden akzeptiert. Und Ende 1946 gab es dann das Trugbild einer Konferenz. Unser kritischer Geist und unsere offene Diskussion wurden als nicht hinnehmbar und nicht vertretbar aufgefasst. Und als Antwort auf unsere Dokumente (die einzigen, die als Diskussionsbeitrag der Konferenz vorgelegt wurden) zog man es vor, sie nicht nur nicht zu diskutieren, sondern uns darüber hinaus schlicht und einfach von der Konferenz auszuschließen.
Wir haben in Internationalisme Nr. 16 im Dezember 1946 unser Dokument veröffentlicht, das - mit Blick auf die Konferenz - an alle Gruppen gerichtet war, die der IKL angehören. In diesem Dokument haben wir der alten Tradition entsprechend alle bestehenden politischen Divergenzen in der IKL artikuliert und unseren Standpunkt dazu offen dargelegt. In der gleichen Ausgabe von Internationalisme wurde auch die Antwort dieses eigenartigen Internationalen Büros veröffentlicht. In der Antwort steht: „Da Eurer Brief erneut Tatsachen und politische Positionen verzerrt, die vom PCInt oder von der Französischen und Belgischen Fraktion vertreten wurden“, und weiter, „da Eure Aktivität sich darauf beschränkt, Verwirrung zu stiften und unsere Genossen mit Dreck zu bewerfen, haben wir es einstimmig abgelehnt, dass Ihr Euch an dem internationalen Treffen der Organisationen der IKL beteiligt.“
Bezüglich des Geistes, der in dieser Antwort zum Ausdruck kam, mag man denken, was man will. Doch muss man feststellen, dass diese Entscheidung in Ermangelung politischer Argumente vor bürokratischer Energie nur so strotzt. Was die Antwort nämlich verschweigt und was für die Auffassung über die allgemeine Disziplin bezeichnend ist, die von dieser Organisation vertreten und praktiziert wird, ist die Tatsache, dass diese Entscheidung heimlich getroffen wurde (2). Dazu schrieb uns ein Genosse des PCInt unmittelbar nach diesem internationalen Treffen: „Am Sonntag, den 8. Dezember, fand das Treffen der Delegierten des Internationalen Politischen Büros der IKL Italiens statt. Bezüglich Eures Briefs, der an die Genossen der Fraktion der IKL Italiens gerichtet war, werdet Ihr bald eine offizielle Antwort erhalten. Eure Bitte um gemeinsame Treffen für spätere Diskussionen wurde abgelehnt. Abgesehen davon wurde jedem Genossen die Anweisung erteilt, jede Verbindung mit den als Dissidenten bezeichneten Fraktionen abzubrechen. Ich bedauere deshalb Euch mitteilen zu müssen, dass ich meine Verbindungen mit Eurer Gruppe nicht aufrechterhalten darf.“ (Jober, 9. 12. 1946).
Bedarf diese intern und heimlich getroffene Entscheidung noch eines Kommentars? Sicherlich nicht. Wir möchten nur hinzufügen, dass in Moskau Stalin natürlich über geeignetere Mittel verfügt, um die Revolutionäre zu isolieren: Gefängniszellen in der Ljublanka, die Isolationshaft in Verkni Uralsk und, wenn nötig, den Genickschuss. Gott sei Dank hat die GCI noch nicht diese Macht - und wir werden alles unternehmen, damit sie diese auch nicht erhält -, doch dies trägt nicht zu ihrer Entlastung bei. Was aber zählt, ist das verfolgte Ziel und die Methode, die in dem Versuch besteht, die Gegner zu isolieren, in dem Wunsch, Andersdenkende zum Schweigen zu bringen. Dies beinhaltet eine fatale Logik: Entsprechend der Stellung und Macht, über die man verfügt, werden immer gewaltsamere Mittel ergriffen. Der Unterschied zum Stalinismus ist keine Frage des Wesens, sondern nur des Ausmaßes.
So ist der PCInt bedauerlicherweise dazu gezwungen, auf jämmerliche Mittel zurückzugreifen und den Mitgliedern jeden Kontakt mit den kritischen Fraktionen zu verbieten. Die Auffassung über die Funktionsweise der Organisation und über ihr Verhältnis zur Klasse wird nach unserer Auffassung durch diese monströse und abstoßende Entscheidung verdeutlicht und konkretisiert. Exkommunizierung, Verleumdung, ein erzwungenes Schweigen - das sind die Methoden, die an die Stelle der Erläuterung, der politischen Diskussionen und der ideologischen Konfrontation treten. Dies ist ein typisches Beispiel für die neue Organisationsauffassung.
Schlussfolgerung
Ein Genosse der IKL hat uns einen langen Brief geschrieben, um, wie er schrieb, „all das loszuwerden, was mir angesichts der Antifaschistischen Koalition und der neuen Parteiauffassung auf dem Magen liegt.“ Er schrieb: „Die Partei ist nicht das Ziel der Arbeiterbewegung, sie ist nur ein Mittel. Aber das Ziel rechtfertigt nicht alle Mittel. Die Mittel müssen vom angestrebten Ziel durchdrungen sein. Das Ziel muss bei jedem der eingesetzten Mittel erkennbar sein. Folglich kann die Partei nicht mittels leninistischer Auffassungen aufgebaut werden, denn das würde - einmal mehr – die Abwesenheit der Demokratie bedeuten: militärische Disziplin, Verbot der freien Meinungsäußerung und des Fraktionsrechts, die Mystifikation des Monolithismus der Partei. Auch wenn die Demokratie der größte Schwindel aller Zeiten ist, darf uns das nicht daran hindern, für die proletarische Demokratie in der Partei, für die proletarische Demokratie in der Arbeiterbewegung und in der Arbeiterklasse einzutreten. Oder man soll uns einen anderen Begriff vorschlagen. Das Wichtigste ist jedoch, dass sich an der Sache nichts geändert hat. Proletarische Demokratie bedeutet Meinungsfreiheit, Freiheit der Gedanken, die Möglichkeit, nicht einverstanden zu sein, das Verbot nackter Gewalt und jeglichen Terrors in der Partei - und natürlich in der Klasse“. Wir verstehen und teilen vollständig die Empörung dieses Genossen, wenn er gegen das Gebilde der Partei als Kaserne und Diktatur über die Arbeiterklasse kämpft. Wie sehr sich diese gesunde und revolutionäre Auffassung über die Funktionsweise der Organisation von dem unterscheidet, was neulich ein Führer des PCInt zum Besten gegeben hat! Er sagte wörtlich: „Unsere Auffassung der Partei ist die einer monolithischen, homogenen und monopolistischen Partei“.
Solch eine Auffassung hat, verbunden mit dem Konzept des brillanten Führers und einer militärischen Disziplin, überhaupt nichts mit der revolutionären Aufgabe der Arbeiterklasse zu tun, nach der alles durch die Anhebung des Bewusstseins, durch die ideologische Reifung der Arbeiterklasse bedingt ist. Monolithismus, Homogenität und Monopolismus sind die heilige Dreifaltigkeit des Faschismus und des Stalinismus.
Die Tatsache, dass eine Person oder Partei, die sich als revolutionär bezeichnet, sich auf diese Formel beruft, zeigt tragischerweise die ganze Dekadenz, den ganzen Niedergang der Arbeiterbewegung auf. Die Partei der Revolution wird nicht auf dieser Dreifaltigkeit aufgebaut werden können, sondern nur eine neue Kaserne für die Arbeiter. Damit trägt man in Wirklichkeit nur dazu bei, dass die Arbeiter in einem Zustand der Unterwerfung und Beherrschung gehalten werden. Es handelt sich um eine konterrevolutionäre Handlung.
Was uns an der Möglichkeit der Wiederaufrichtung des PCInt zweifeln lässt, sind, mehr noch als die eigentlichen politischen Irrtümer, die Organisationsauffassungen und ihr Verhältnis zur gesamten Klasse. Die Ideen, die das Ende des revolutionären Lebens der bolschewistischen Partei zum Ausdruck brachten und den Beginn des Abstiegs verdeutlichten - Fraktionsverbot, Abschaffung der Meinungsfreiheit in der Partei und in der Klasse, die Verherrlichung der Disziplin, die Lobpreisung des unfehlbaren Führers - dienen heute als Grundlage für den PCInt und die IKL. Wenn der PCInt diesen Weg fortsetzt, wird er niemals der Sache des Sozialismus dienen können. In vollem Bewusstsein über die ganze Tragweite dessen, was wir sagen, rufen wir aus: „Stopp! Macht kehrt, denn hier beginnt der Abgrund“.
Marc
(1) Den jüngsten Nachrichten zufolge wird der PCInt sich nicht an den nächsten Wahlen beteiligen. So hat das Zentralkomitee entschieden. Erfolgt dieser Beschluss nach einer Überprüfung der Position und einer Diskussion in der Partei? Täuscht euch nicht! Es ist immer noch zu früh, eine Diskussion zu eröffnen, die die Gefahr birgt, die Genossen zu verunsichern, antwortete der bekannte Führer. Aber was waren dann die Gründe? Ganz einfach: die Partei hat eine Reihe von Mitgliedern verloren, und die Parteikasse ist leer. So hat das Zentralkomitee wegen fehlender Munition beschlossen, den Krieg zu beenden und sich nicht an den nächsten Wahlen zu beteiligen. Diese Position passt jedem in den Kram, zudem bereitet sie niemand Probleme. Es handelt sich um das, was unser Führer „die umgekehrte Umwandlung von Quantität in Qualität“ nennen.
(2) Es handelt sich um den Genossen Jober, der schließlich im Auftrag der Föderation Turins in Diskussionen mit uns stand, deren Repräsentant er war. Seitdem hat die Föderation von Turin, die gegen die Methoden des Zentralkomitees protestiert hat, ihre Unabhängigkeit erklärt und in dieser Eigenschaft an der Internationalen Kontaktkonferenz teilgenommen (siehe Internationalisme Nr. 24).
Politische Strömungen und Verweise:
- Kommunistische Linke [70]
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
- Italienische Linke [86]
Erbe der kommunistischen Linke:
Worin unterscheidet sich die Kommunistische Linke von der 4. Internationale
- 3261 reads
Die Bolschewiki standen an der Spitze der Revolution in Russland und der weltweiten revolutionären Kämpfe von 1917-23. Die Bolschewiki diskutierten mit den revolutionären Tendenzen, die sich dem imperialistischen Krieg widersetzten, und trieben den Kampf für die internationale proletarische Revolution voran. Sie debattierten mit den Spartakisten, den Tribunisten, den italienischen Maximalisten, mit all den Tendenzen des linken Flügels der II. Internationale; aber auch mit den revolutionären Anarchisten und Syndikalisten. Die Bolschewiki standen an der Spitze der Revolution in Russland und der weltweiten revolutionären Kämpfe von 1917-23. Die Bolschewiki diskutierten mit den revolutionären Tendenzen, die sich dem imperialistischen Krieg widersetzten, und trieben den Kampf für die internationale proletarische Revolution voran. Sie debattierten mit den Spartakisten, den Tribunisten, den italienischen Maximalisten, mit all den Tendenzen des linken Flügels der II. Internationale; aber auch mit den revolutionären Anarchisten und Syndikalisten. Sie standen an der Spitze des Prozesses der Bildung der III. Internationale, deren erster Kongress im März 1919 in Moskau abgehalten wurde. Dieser verabschiedete Resolutionen, Manifeste und Thesen, die der höchste Ausdruck des proletarischen Bewusstseins der damaligen Zeit waren. (1) Jede proletarische Organisation läuft Gefahr, vom Opportunismus zerfressen zu werden, denn die Arbeiterklasse und damit auch die revolutionären Organisationen leiden unter dem Gewicht der bürgerlichen Ideologie. Der Opportunismus ist die Kristallisierung des Gewichtes der bürgerlichen Ideologie in den Reihen der politischen Organisationen des Proletariats. Die Bolschewiki, die die Führung der Weltrevolution mit übernommen und einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet hatten, fielen einem schnellen opportunistischen Degenerationsprozess anheim: 1920 und 1921 waren entscheidende Jahre beim Aufkommen dieser Tendenz. Einige Meilensteine: die Verabschiedung der Thesen über die Gewerkschaftsfrage und zur nationalen Frage auf dem II. Kongress der Kommunistischen Internationale; die Position zum so genannten revolutionären Parlamentarismus wie die Kritik an der Einheitsfront und den Arbeiterregierungen auf dem III. Kongress der Komintern. Auf dem X. Kongress der bolschewistischen Partei wurde die Bildung von Fraktionen innerhalb der Partei verboten (...)
Wir können hier nicht im Einzelnen auf diesen Prozess eingehen, doch soviel sei gesagt: 1922 war die bolschewistische Partei nur noch eine Karikatur dessen, was sie fünf Jahre zuvor gewesen war. Die wahren Bolschewiki waren verdrängt und marginalisiert worden; an ihre Stelle trat schrittweise eine Reihe von Karrieristen und Aufsteigern; zu diesen gehörten auch ehemalige Anhänger des Zaren (2). Wie konnte es dazu kommen? Die Partei war in die Klauen des russischen Staates geraten und stellte mit schöner Regelmäßigkeit die Interessen desselben (d.h. die nationalen Interessen) über die Interessen der Weltrevolution. Sie befürwortete das Bündnis mit den Sozialdemokraten und den Eintritt in die reaktionären Gewerkschaften. Wie ein Krebs hatte der Opportunismus allmählich die Substanz und das proletarische Leben der bolschewistischen Partei vernichtet. Gegen 1924, als Lenin starb, war die bolschewistische Partei praktisch zu einer Staatspartei geworden; ihre neuen Existenzbedingungen wurden durch Stalin und seine Funktionärsriege bestimmt. Diese verhielten sich immer machtbewusster und entfernten zunächst (und verfolgten schließlich) die alte bolschewistische Garde, die eine führende Rolle in der Revolution gespielt hatte und innerhalb der Partei immer mehr in die Minderheit gedrängt worden war. (3)
Im Oktober 1923 wurde die „Gruppe der 46“ gegründet, die zum Keim der Linksopposition werden sollte. Ihr prominentestes Mitglied war von Anfang an Trotzki. Dem Kampf der Opposition gegen den Aufstieg des Stalinismus gebühren wichtige Verdienste; es gab einige wichtige Episoden wie den Kampf gegen die verheerende Politik der Komintern in China. Aber es ist wichtig festzustellen, dass die politischen Grundlagen der Linksopposition sehr zerbrechlich und schwach waren. Sie berief sich auf die ersten vier Kongresse der Komintern. Sie theoretisierte also den Opportunismus und ließen ihm freien Lauf - Stichwort Einheitsfront, Arbeiterregierung, ihre Position zu den Gewerkschaften, der Sozialdemokratie und der nationalen Befreiung, die Theorie des schwächsten Gliedes. Anders ausgedrückt: die Linke Opposition nahm für sich in Anspruch, gegen den Stalinismus zu kämpfen, doch stützte sie sich dabei auf die politischen Postulate des Opportunismus, die diesem zum Aufstieg verholfen hatten. Als 1928 die Tendenz um Stalin einen „Linksschwenk“ vollzogen und die Linke Opposition die irrigen Thesen zur Industrialisierung und die Politik gegenüber den Bauern übernommen hatte, kapitulierte eine Reihe von ihnen und schloss sich dem stalinistischen Lager an.
Davon hob sich die Haltung der Kommunistischen Linken ab. Schon seit Beginn der 1920er Jahre führten sie einen viel klareren und entschlosseneren Kampf gegen die Degeneration der bolschewistischen Partei und die proletarische Bastion, die zuvor in Russland errichtet worden war. Die Fraktionen der Kommunistischen Linken (1) kritisierten eine Reihe von Positionen, die vom II. Kongress der Komintern verabschiedet worden waren, die in Wirklichkeit dem Stalinismus den Weg bereiteten. Es ging um die Frage der nationalen Befreiung, um die Gewerkschaftsfrage und die Beteiligung an Parlamentswahlen. Entgegen der theoretischen Inkonsequenz und den Schwankungen und Widersprüchen der Linksopposition vertrat die Kommunistische Linke eine viel kohärentere und kritischere Position, die es ihr ermöglichte, eine Bilanz der weltweiten Welle von revolutionären Kämpfen und des darauf folgenden Zeitraums (die Konterrevolution, der Aufstieg des Faschismus, der Weltkrieg) zu ziehen (2). Auch wenn dies sehr schematisch sein mag, können wir die Unterschiede zwischen der Kommunistischen Linken und der Linksopposition tabellarisch folgendermaßen zusammenfassen:
|
Kommunistische Linke |
Linksopposition |
|
Sie berief sich auf den I. Kongress der Komintern und bezog eine kritische Haltung gegenüber den Positionen des II. Kongresses. Sie lehnte die meisten Positionen des III. und IV. Kongresses ab. |
Sie berief sich auf die ersten vier Kongresse – ohne eine kritische Bewertung derselben. |
|
Sie bewertete die Ereignisse in Russland kritisch und kam zu der Schlussfolgerung, dass man die russische Bastion nicht unterstützen dürfe, da sie in die Hände des Weltkapitalismus gefallen sei |
Sie schätzte Russland als einen degenerierten Arbeiterstaat ein, der dennoch unterstützt werden müsse. |
|
Isbesondere die deutsch-holländische Linke weigerte sich, in den Gewerkschaften zu arbeiten, und kam zu der Schlussfolgerung, dass die Gewerkschaften zu Staatsorganen geworden waren. |
Sie befürwortete die Gewerkschaften als Arbeiterorgane und verteidigte die Notwendigkeit, in den Gewerkschaften zu arbeiten. |
|
Sie lehnte die nationalen Befreiungskämpfe ab. |
Sie unterstützte nationale Befreiungskämpfe. |
|
Sie lehnte das Parlament und die Wahlbeteiligung ab. |
Sie befürwortete die Wahlen und den „revolutionären Parlamentarismus“. |
|
Sie betrachtete die Fraktionsarbeit als notwendig, um die Lehren aus den Niederlagen zu ziehen und die Grundlagen für den späteren Aufbau der Weltpartei des Proletariats zu legen. |
Sie befürwortete eine Oppositionsarbeit, die soweit ging, dass man Entrismus in den sozialdemokratischen Parteien betrieb. |
|
In den 1930er Jahren und insbesondere durch die Stimme Bilans (dem Organ der Italienischen Kommunistischen Linken) erwartete die Kommunistische Linke einen Kurs zum II. Weltkrieg. Infolgedessen könne die Partei nicht gegründet werden. Stattdessen gehe es darum, die Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen und die Zukunft vorzubereiten. Deshalb gab Bilan als Gebot der Stunde aus: „Keinen Verrat üben“. |
Mitten in der Konterrevolution glaubte Trotzki, dass die Bedingungen für die Schaffung der Partei vorhanden seien; 1938 wurde die IV. Internationale gegründet. |
|
Ablehnung des II. Weltkrieges. Beide kriegführenden Seiten wurden abgelehnt. Die Kommunistische Linke trat stattdessen für die proletarische Weltrevolution ein. |
Mit ihrer Unterstützung für das eine bzw. andere Lager gab sie den Internationalismus auf. |
1938 gründete die Linksopposition die IV. Internationale. Es handelte sich hierbei um ein opportunistisches Manöver, da eine Weltpartei zu einer Zeit, in der alle Zeichen auf einen neuerlichen imperialistischen Krieg standen, nicht gegründet werden kann, weil Letzterer bedeutete, dass die Arbeiterklasse eine tiefe Niederlage erlitten hat. Die Ergebnisse waren eine einzige Katastrophe: 1939-1940 bezogen die Gruppen der IV. Internationale unter den unterschiedlichsten Vorwänden Stellung für den Weltkrieg: Die Mehrheit unterstützte das russische „sozialistische Vaterland“, eine Minderheit hingegen das Frankreich Pétains, das wiederum ein Satellit der Nazis war. Auf diese Degeneration der trotzkistischen Organisationen reagierten die letzten verbliebenen internationalistischen Kräfte, die in ihren Reihen verblieben waren: insbesondere die Frau Leo Trotzkis und der spanische Revolutionär G. Munis (3).
Seitdem sind die trotzkistischen Organisationen zu radikalen Verfechtern des Kapitals geworden (4), die die Arbeiterklasse mit allerlei „revolutionären Themen“ täuschen wollten – Themen, die im Allgemeinen zur Unterstützung antiimperialistischer Fraktionen der Bourgeoisie führen (wie heute z.B. den berüchtigten Offizier Chávez). Ebenso treiben sie die vom parlamentarischen Spektakel abgestoßenen Arbeiter wieder an die Wahlurnen zurück, indem sie diese dazu aufrufen, die Sozialisten „kritisch“ zu unterstützen. Nur so könne man den vordringenden Rechten den Weg versperren. Schließlich verbreiten sie die Illusion, dass man die Gewerkschaften zurückerobern könne. So mobilisieren sie für „kämpferische“ Kandidaten, womit sie die Basisorgane dieses kapitalistischen Apparates unterstützen. Unsere Haltung besteht darin, die trotzkistischen Organisationen zu entblößen und einen politischen Kampf gegen sie zu führen, genauso wie wir die Rechten, die „Sozialisten“ und die Stalinisten (die sich als Kommunisten bezeichnen) bekämpfen.
Dabei richten wir uns jedoch nicht gegen Personen. Einzelne können sich durchaus in der Ideologie und den Organisationen der Trotzkisten verfangen, obwohl sie ehrlich und aufrichtig für die Befreiung der Menschheit und die Interessen des Proletariats eintreten. Unsere Haltung gegenüber diesen Menschen ist, dass wir mit ihnen aufrichtig und nachhaltig diskutieren, mit der Absicht, ihnen zu helfen, eine kohärente revolutionäre Position zu finden. Gegenwärtig gibt es Gruppen und Einzelpersonen, die ihren politischen Werdegang zwar bei den Trotzkisten begonnen haben, aber mittlerweile ernsthaft diese Ideologie kritisieren und nach einer revolutionären Alternative suchen. Unsere Haltung ihnen gegenüber ist die der Debatte und Bemühungen der Klärung.
IKS, 8.6.2007
Politische Strömungen und Verweise:
- Kommunistische Linke [70]
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
- Linke Opposition [87]
November 2007
- 819 reads
Der Streik der Eisenbahner ist die Sache der gesamten Arbeiterklasse
- 3657 reads
Das Urteil des Chemnitzer Landesarbeitsgerichtes vom 2. November, das der Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer (GDL) in allen Belangen rechtgab und die Bahn freimachte für Streiks auch im Fern- und Güterverkehr, ist, sofern man die jüngsten Entwicklungen genau verfolgt hat, keineswegs überraschend. Schon vor diesem Urteil gab es einige Anzeichen, die auf eine Verschärfung der Auseinandersetzung zwischen den Lokführern und der Bahn hindeuteten. Bereits vor der Berufung der GDL gegen das erstinstanzliche Verbot einer Ausweitung des Streiks auf den Fern- und Güterverkehr war absehbar, dass dieses Verbot nicht der letzten Weisheit Schluss war. Weit entfernt, ein Ausdruck des „demokratischen Pluralismus“ zu sein, ist die Tatsache, dass dieses Verbot vom Landesarbeitsgericht kassiert wurde, nichts weiter als das Eingeständnis der deutschen Bourgeoisie, dass der Streik der Lokführer nicht mehr mit juristischen Mitteln eingedämmt werden kann. In der Tat ließ sich die bis dahin von ihr vertretene Argumentationsweise, die nach dem Motto verfuhr: Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass und die „Unverhältnismäßigkeit“ des Streiks im Güter- und Fernverkehr als Grund für sein Verbot anführte, zuletzt immer weniger in der Öffentlichkeit und besonders unter den betroffenen Arbeitern aufrechterhalten.
Die GDL und der ungebrochene Kampfgeist der Lokführer
Es war sicherlich ein einmaliger Vorgang, als ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als die Auseinandersetzung mit dem Bahnvorstand nach dem Scheitern des Vermittlungsversuchs durch Geißler und Biedenkopf zu eskalieren drohte, der GDL-Vorsitzende Schell den Vorsitz vorläufig an seinen designierten Nachfolger und jetzigen Vize Weselsky abgab, um... in die Kur zu gehen. Die Sache wird auch dadurch nicht weniger erstaunlich, dass, wie Weselsky der Öffentlichkeit auftischte, Schell wegen des Streiks bereits zweimal seine Kur verschoben habe. Dies um so weniger, als mit dem „vorläufigen“ Personalwechsel an der Spitze der GDL auch eine gewisse Kurskorrektur der GDL einherging. In der Zeit zwischen seinem Abgang und seinem Wiedererscheinen in der Öffentlichkeit (anlässlich der Urteilsverkündung des Chemnitzer Landesarbeitsgerichtes) fand eine leise, aber effektive Umorientierung der GDL statt: Die einseitige Ausrichtung der GDL-Führung unter Schell - einem altgedienten westdeutschen Gewerkschaftsfunktionär - auf die Durchsetzung der Forderung nach Anerkennung als Spartengewerkschaft der Lokführer wurde unter der Führung des Leipzigers Weselsky aufgegeben. Nun demonstrierte die GDL plötzlich auch Härte bei ihrer Lohnforderung von 30 Prozent. Forsch kündigte Weselsky eine härtere Gangart in der Konfrontation mit Mehdorns Bahnvorstand an und ließ seinen Worten auch Taten folgen – den 30-stündigen Streik im Nah- und Regionalverkehr vom 25./26. Oktober. Betroffen von diesem Streik war vor allem der Osten Deutschlands, wo der Schienennahverkehr in einigen Städten (wie Cottbus) praktisch zum Erliegen kam. Im Vergleich dazu kam der Rest Deutschlands glimpflich davon; in Süddeutschland lief der Schienenverkehr gar ohne Einschränkungen. Beides – die andere Akzentuierung der GDL-Politik unter dem Vorsitz von Weselsky und die Konzentration des Streiks auf Ostdeutschland – hat gemeinsame Ursachen. Die GDL hat ihre stärksten Bataillone in Ostdeutschland, wo die übergroße Mehrheit nicht, wie in den Gebieten der alten Bundesrepublik, verbeamtet ist. So liegt es auf der Hand, dass die GDL die meisten ihrer Mitglieder aus den ostdeutschen Bundesländern rekrutiert hat. Und genauso erklärlich ist es, dass es den angestellten Lokführern selbst weniger um die Anerkennung der GDL als eigenständiger Tarifpartner neben den beiden anderen Eisenbahner-Gewerkschaften Transnet und GDBA ging. Die GDL war in ihren Augen nur das Vehikel für die Durchsetzung ihrer allzu berechtigten Lohnforderungen. Wenn es nach den Funktionären der GDL gegangen wäre, wäre der Streik spätestens nach den von Geißler und Biedenkopf moderierten Vermittlungsgesprächen zwischen GDL und Bahngesellschaft beendet worden, war der GDL doch im Grundsatz zugesichert worden, künftig über Entgelte und Arbeitszeiten der Lokführer – allerdings in „enger Abstimmung“ mit den beiden anderen Gewerkschaften – zu verhandeln. Dass diese Rechnung nicht aufging, dass die GDL stattdessen eine schärfere Tonart gegenüber der Bahnzentrale anschlug, hat keineswegs mit einer Läuterung der GDL-Funktionäre zu tun. Sie haben genauso wenig wie die bürgerliche Justiz, die nun den Lokführern das „volle“ Streikrecht einräumt, plötzlich ihr Herz für die Sache der ArbeiterInnen entdeckt. Vielmehr kann man davon ausgehen, dass sich hinter ihrem Umdenken die Erkenntnis verbirgt, dass es besser ist, selbst in die Offensive zu gehen, ehe die Dinge aus der Kontrolle geraten.In der Tat scheint die Wut der Lokführer über die Hinhaltetaktik durch die GDL, die es sich bis dahin hinter dem gerichtlichen Verbot einer Ausweitung der Streiks auf den Güter- und Fernverkehr bequem gemacht hatte, mit jedem Streiktag gewachsen zu sein. Wie groß der Unwille der Lokführer zuletzt war, die gerichtlichen Auflagen zu akzeptieren, zeigt der Fall jener beiden Lokführer, die in der vergangenen Woche fristlos gekündigt wurden. Sie hatten ihre Loks auf freier Strecke verschlossen abgestellt, um sich am Streik zu beteiligen, wobei es naheliegt, dass sie die Blockade des Zugverkehrs wissentlich in Kauf nahmen, wenn nicht sogar beabsichtigten. Für sie – und jene Dutzenden von Kollegen, die eine Abmahnung erhielten - muss es eigentlich wie Hohn vorkommen, dass die GDL nun ihretwegen vor das Arbeitsgericht ziehen will. Es gibt nur eine Macht, die in der Lage ist, Mehdorn zur Rücknahme dieser Kündigungen zu zwingen: die Solidarisierung ihrer Kollegen mit ihnen und ganz gewiss nicht die Winkeladvokaten der bürgerlichen Justiz.
Die Rolle der Justiz: „Pluralistische“ Spielchen zur Aufwertung der GDL
Von Anbeginn war die GDL darum bemüht, sich peinlich genau an die „demokratischen Spielregeln“ zu halten. Klaglos akzeptierten ihre Funktionäre die abschlägigen Urteile der Arbeitsgerichte in Düsseldorf, Mainz, Nürnberg und Chemnitz, deren Begründung die wirtschaftlichen Schäden eines bundesweiten Streiks der Lokführer beanstandete. (Als ob der Sinn von Streiks nicht zuletzt darin besteht, Druck auf die Arbeitgeber auszuüben, indem ihnen durch die Arbeitsverweigerung der Ausgebeuteten eben ein solcher wirtschaftlicher Schaden zugefügt wird.) Nun, das Urteil des Chemnitzer Landesarbeitsgerichtes zeigt deutlich, dass die Justiz durchaus nicht bereit ist, die Gewerkschaften im Allgemeinen und die Spartengewerkschaft GDL im Besonderen im Regen stehenzulassen. Nachdem sich herausgestellt hat, dass die erstinstanzlichen Urteile dem Kampfgeist der Lokführer keinen Einhalt geboten haben, sondern im Gegenteil ihn noch angestachelt haben, soll nun das jüngste Urteil, das der GDL ab sofort und ohne Abstriche gestattet, den Streik auf den Fern- und Güterverkehr auszuweiten, die Reputation der GDL unter den Lokführern, die Schaden zu nehmen drohte, wieder aufpolieren. Um zu vermeiden, dass es zu einer Radikalisierung der Streikenden – womöglich außerhalb des gewerkschaftlichen Korsetts – kommt, nimmt das staatskapitalistische Regime in Gestalt der Gerichte sogar gewisse wirtschaftliche Schäden für die Privatwirtschaft in Kauf, wohl wissend, dass die Bonzen der GDL ihre neuen Freiheiten mit „Augenmaß“ nutzen werden. Wie wir bereits in unserem Artikel „Spartengewerkschaften oder Einheitsgewerkschaft – eine falsche Alternative“ in der Weltrevolution Nr. 144 berichteten, beteuerte auf einer Veranstaltung des Netzwerkes Linke Opposition der Chef der GDL Nordrhein-Westfalen in entlarvender Offenheit, dass die Forderung nach einer 30%-igen Lohnerhöhung für die Lokführer ursprünglich gar nicht beabsichtigt war, sondern der GDL vom Bahnvorstand sozusagen in den Mund gelegt worden war. Wie bereits deutlich gemacht, war es das Hauptziel der GDL lediglich, als eigenständiger Tarifpartner neben der Transnet und GDBA anerkannt zu werden. Den GDL-Bonzen ging es von Anfang nur darum, in den Genuss des Privilegs eines gleichrangigen Verhandlungspartners der Bahn neben den beiden anderen Hausgewerkschaften zu gelangen. Über alles Weitere könne man durchaus reden....
Die Rolle des Gerichts
Das Chemnitzer Arbeitsgericht hat Recht gesprochen. Die bürgerliche Rechtssprechung – und gerade das Arbeitsrecht - wird nicht zuletzt deshalb so umständlich, zweideutig und widersprüchlich formuliert, um den Gerichten einen politischen Spielraum zu lassen, um nach eigenem Ermessen der realen Entwicklung eines „Sachverhalts“ Rechnung tragen zu lassen. Dabei werden die Meinungen und Argumente der Sachverständigen ebenso berücksichtigt wie die der „Streitparteien“ vor Gericht (also in diesen Fall die Deutsche Bahn und die GDL). So kann und soll ein Gericht Repressionsmaßnahmen gegen die arbeitende Bevölkerung beschließen, bestätigen, gegebenenfalls verschärfen usw. Aber in einer „funktionierenden Demokratie“ wird die Gerichtsbarkeit dazu angehalten, Urteile nach Möglichkeit zu vermeiden, die die Autorität von Justiz und Staat in den Augen der Bevölkerung untergraben könnten. Das Chemnitzer Gericht hatte also den Tatbestand zu berücksichtigen, dass es erste Anzeichen für eine Bereitschaft der kämpfenden Eisenbahner gab, angesichts von Streikverboten zu illegalen Aktionen überzugehen. Mit anderen Worten, es zeichnete sich ab, dass das bisherige Streikverbot nicht einschüchternd und dämpfend, sondern eskalierend auf die Kampfbereitschaft eingewirkt hat. Selbstverständlich gehört es zum Handwerk der Jurisprudenz, dass in der Urteilsverkündung solche Erwägungen nicht in den Vordergrund gestellt werden. Die Streikenden sollen auf keinen Fall zu der Einsicht gelangen, dass es ihre Militanz war - und nicht etwa die Winkelzüge der Anwälte der GDL –, die diesen taktischen Rückzug des Staates erzwungen hat!Aber die Chemnitzer Richter haben nicht nur auf die Empörung der Streikenden Rücksicht nehmen müssen. Eine Woche nach dem Urteil von Chemnitz förderte das „ZDF Politbarometer“ eine Entwicklung an den Tag, womit die Richter sich ebenfalls befasst haben werden: Aller Hetze der Medien zum Trotz steigt die Beliebtheit dieses Streiks innerhalb des breiten Publikums unaufhörlich weiter! Die angeblich unabhängige Justiz hinter den Arbeitgebern einerseits, die arbeitende Bevölkerung hinter den Streikenden andererseits – eine solche Gegenüberstellung wollte der bürgerliche Staat in dieser Deutlichkeit unbedingt vermeiden! Nun sollen nicht mehr Justiz und Polizei, sondern die „politischen Instanzen“ wieder in den Vordergrund rücken, um die Kampfbereitschaft der Arbeiterschaft zu entschärfen. Und dazu gehört die GDL selbst.
Die Herrschenden: All ihrer Rivalitäten zum Trotz einig gegen die Arbeiterklasse
Wenn wir die Behauptung aufstellen, dass die GDL ein wichtiges Instrument der herrschenden Klasse gegen die langsam steigende Kampfbereitschaft der Lohnabhängigen ist, so übersehen wir nicht, dass diese Spartengewerkschaft keineswegs auf ungeteilte Sympathie innerhalb der Kapitalistenklasse stößt. Das Management der Deutschen Bahn gehört ebenso wenig zu den Freunden der GDL wie die Transnet, der DGB-Gewerkschaft unter den Eisenbahnern. Diese beiden mächtigen Organisationen haben in den letzten Jahren gemeinsam, unter der Leitung ihres Vorsitzenden Mehdorn und Hansen, erfolgreich mehrere Hunderttausend Arbeitsplätze bei der Bahn abgebaut und die ohnehin unerfreuliche Arbeitswelt der verbleibenden Eisenbahner in eine Hölle verwandelt. Mit diesen gemeinsam erzielten Erfolgen im Rücken wollen Konzernspitze und Transnet – vom Staat unterstützt und vorangepeitscht – die DB in ein weltweit operierendes Logistikunternehmen verwandeln, in einen „Global Player“ nach dem Vorbild der aus der Deutschen Post hervorgegangenen DHL. Diese fette Beute wollen sie nicht mit einem Quereinsteiger wie die GDL teilen!Zu den von der GDL wenig Begeisterten gehört auch die SPD. So haben sich in diesen Tagen Parteichef Beck und der Fraktionsvorsitzende Struck öffentlich und resolut hinter Mehdorn und Hansen gestellt. Auch das nimmt nicht Wunder. Der DGB ist im Wesentlichen der Gewerkschaftsbund der Sozialdemokratie. Mittels dieser Organisation sind die Sozialdemokraten an der Leitung der Wirtschaft auf zweifache Weise direkt beteiligt: nicht nur durch ihre Parteifreunde und andere Freunde in den Konzernspitzen, wie die CDU auch, sondern darüber hinaus durch die Macht der Gewerkschaften in diesen Unternehmen. Das geht ganz offiziell vor sich, wie in der Metallindustrie mit seiner gewerkschaftliche Mitbestimmung. Oder es vollzieht sich mittels einer „ausgezeichneten“, zugleich beinahe monopolartigen Partnerschaft, wie im Falle von Transnet. Nun, Schell und seine Freunde wollen an dieser Goldgrube mit beteiligt sein. Dies behagt der Sozialdemokratie umso weniger, da sie im Kampf um die Futterplätze am Trog des Kapitals neuerdings von einer anderen Seite Konkurrenz zu spüren bekommt – von Lafontaine und der jetzt auch im Westen stärker werdenden Linkspartei. Wie dem auch sei: Das bürgerliche Establishment wird am Ende Platz machen, Platz machen müssen für eine der Ihren, für die GDL. Auch Mehdorn, Hansen und die SPD werden das zu akzeptieren haben. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat das längst erkannt und findet dieser Entwicklung auch gar nicht so schlecht. Zwar könne das Aushandeln von Tarifverträgen bei der Bahn demnächst komplizierter werden – so die Zeitung. Aber Konkurrenz (unter den Gewerkschaften) belebt das Geschäft. Man darf jedoch nicht übersehen, um welche Art von Konkurrenz es sich hier handelt. Die Gewerkschaften konkurrieren untereinander um ihren Anteil am Profit, der aus der Ausbeutung der Arbeiterklasse herausgepresst wird. Aber die Konkurrenz, deren Förderung das Ur-Anliegen des Kapitals ist, ist die Konkurrenz unter den Arbeitern - einer Konkurrenz, die notwendig ist, um den Profit an sich erst zu sichern. Zusätzliche Gewerkschaften, die eigene Tarifverträge abschließen können, bedeuten, dass man nunmehr auch in Deutschland zunehmend das kämpfende Proletariat nicht nur nach Unternehmen, Beruf, nach Ost oder West usw. spalten kann, sondern auch in ein und denselben Beruf und Unternehmen voneinander absondern, gegeneinander ausspielen kann. Und das ist der Grund, warum selbst die SPD und der DGB sich mit der GDL anfreunden werden und sie schon jetzt nicht nur als lästigen Konkurrent, sondern vor allem auch als Schützenhilfe gegen die Arbeiterklasse sieht.Denn was steckt hinter dem kometenhaften Aufstieg dieser ältesten aller deutschen Gewerkschaften, die Jahrzehnte lang wie eine verstaubte Mumie überlebte? Was hat diesem Altherrenverein so plötzlich die Gelegenheit verschafft, Anspruch zu erheben, als Mitspieler bei der „neuen Bahn“ mitzumischen? Nichts anderes als die massive Unzufriedenheit der Eisenbahner mit den bestehenden Gewerkschaften. Scharenweise und verbittert verließen sie Hansens Transnet, verzweifelt auf der Suche nach Alternativen. Und hier wird ein Problem offenbar, das die Arbeitsgerichte vermutlich auch berücksichtigen müssen: die Unerfahrenheit der GDL. Die Arbeiterinnen und Arbeiter gingen zur GDL, nicht weil sie Spartengewerkschaften toll finden und als Lokführer unter sich sein wollen, sondern weil sie kämpfen wollen und es sich (noch) nicht zutrauen, dies auf eigene Faust zu tun. Dies beweist schon die Tatsache, dass nicht allein Lokomotivführer, sondern Tausende vom Bordpersonal (darunter auch Ausländer) zur Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer gegangen sind. Und da geht ein Manfred Schell hin und erzählt immer wieder vor laufender Kamera, dass es ihm nicht um das Anliegen der Lokführer, sondern um den eigenständigen Tarifvertrag der eigenen Gewerkschaft geht! Da geht sein Vorsitzender in Nordrhein-Westfalen hin und erzählt, dass man die anderen Arbeiter, die keine Lokomotivführer sind, eigentlich gar nicht haben will! Und während die Medien versuchen, Schell als einen unbeugsamen, besessenen Arbeiterführer darzustellen - fast so einer wie Trotzki als Vorsitzender des Arbeiterrates von Petrograd während der Russischen Revolution –, tritt der Mann mitten im Streikgetümmel seine wohlverdiente Kur an!Die Bourgeoisie wird also die GDL nicht nur als gleichberechtigten Partner in die „Tarifgemeinschaft“ aufnehmen. Sie greift dieser Gewerkschaft heute schon massiv unter die Arme, damit sie helfen kann, den Bestrebungen des Proletariats entgegenzutreten. Denn heute gibt es wieder weltweit ein Bestreben der Arbeiterklasse, das man bereits in der Zeit nach 1968 auf breiter Front beobachten konnte. Es ist das Bestreben, die gewerkschaftliche Kontrolle über die Klasse und deren Kämpfe in Frage zu stellen. Damals, im Mai 1968 in Frankreich, im heißen Herbst 1969 in Italien, aber auch in den Septemberstreiks von 1969 in der Bundesrepublik, äußerte sich dieses Bestreben sehr direkt durch wilde, selbstorganisierte, durch Vollversammlungen und gewählte Streikkomitees geführte Streiks. Heute sind die Kampfesschritte ungleich zaghafter, denn die Kämpfenden haben momentan viel weniger Selbstvertrauen, während die Herrschenden auf diese Entwicklung viel besser vorbereitet sind als damals. Und dennoch: die Tendenz des proletarischen Klassenkampfes bewegt sich nicht in Richtung Spartengewerkschaften, sondern in Richtung Infragestellung der Gewerkschaften. Nur dass heute die materielle Lage der Arbeiterklasse viel schlechter, die Wirtschaftskrise viel tiefer, der Zustand der Welt viel dramatischer ist, so dass die Reifung innerhalb der Klasse am Ende viel tiefere Wurzeln schlagen muss und auch wird. IKS 9. November 2007
Nationale Situationen:
Aktuelles und Laufendes:
- Arbeiterkampf [40]
Erbe der kommunistischen Linke:
Hinter dem Lokführerstreik: Die wachsende Kampfkraft und Solidarität der Arbeiterklasse
- 2530 reads
16. November: Der jetzige Streik der Lokomotivführer in Deutschland ist ein großartiges Beispiel für die wiedererstarkte Kampfkraft und Kampfbereitschaft der Arbeiterklasse. Seit sieben Monaten schwelt nun der Konflikt um die Lohnforderungen der Zugführer und auch eines Teils des Bordpersonals. Seit sieben Monaten versucht die Deutsche Bahn mit Drohungen, mit Repressalien, mit Kraftmeierei die Beschäftigten einzuschüchtern. Seit sieben Monaten versuchen die Medien Stimmung gegen die Streikenden zu machen.
16. November: Der jetzige Streik der Lokomotivführer in Deutschland ist ein großartiges Beispiel für die wiedererstarkte Kampfkraft und Kampfbereitschaft der Arbeiterklasse. Seit sieben Monaten schwelt nun der Konflikt um die Lohnforderungen der Zugführer und auch eines Teils des Bordpersonals. Seit sieben Monaten versucht die Deutsche Bahn mit Drohungen, mit Repressalien, mit Kraftmeierei die Beschäftigten einzuschüchtern. Seit sieben Monaten versuchen die Medien Stimmung gegen die Streikenden zu machen. Seit sieben Monaten versuchen Gerichte und Politiker, den sich Wehrenden das Streiken zu verbieten oder auszureden. Seit sieben Monaten hetzen die nicht am Streik beteiligten Gewerkschaften gegen die Kämpfenden, und zwar auf eine Art und Weise, die an Feindseligkeit und Niederträchtigkeit alles in den Schatten stellt, was die Arbeitgeber und die Politiker bisher von sich gegeben haben. Seit sieben Monaten versucht die GDL, die Kampfbereitschaft der Lokführer hinzuhalten, es bei symbolischen Aktionen bewenden zu lassen, wobei sie kaum eine Gelegenheit ausgelassen hat zu beteuern, es gehe der GDL nicht in erster Linie um Lohnforderungen oder um die Arbeitsbedingungen der Lokführer, sondern um das Recht der eigenen Gewerkschaft, eigenständige Tarifverträge abzuschließen.
Aber die Eisenbahner haben sich nicht zermürben lassen. Jetzt, nach sieben Monaten, haben sie den größten Eisenbahnerstreik in der Nachkriegsgeschichte Deutschlands vom Zaun gebrochen. Drei Tage lang wird der Güterverkehr bestreikt, zwei Tage lang der Personenverkehr in ganz Deutschland. Die Folgen: ein Drittel aller Fernzüge, die Hälfte aller Regionalzüge fielen aus. Im Osten verkehrten nur 10% aller Züge. In den Seehäfen begannen sich die Container zu stauen, und bei Audi in Brüssel standen die Bänder still, weil Zulieferteile aus der Slowakei in Ostdeutschland liegen geblieben waren.
Zugegeben: das erwartete "große Chaos" blieb aus. Kein Wunder! Das Chaos, das angerichtet wurde, war das Werk von nur 6.000 Lokomotivführern und Zugbegleitern, während die Mitglieder der anderen Gewerkschaften durch ihre angeblichen Interessensvertretungen vom Streik ferngehalten wurden, während das noch verbeamtete Zugpersonal schwerste Repressalien durch "Vater Staat" zu befürchtet hat, sollten es sich am Streik beteiligen.
Das Wichtigste an diesem Streik - an jedem Streik letztendlich - ist nicht das Ausmaß des Chaos, das er verursacht. Das Kennzeichen der Arbeiterklasse ist nicht, dass sie Chaos bewirkt, sondern dass sie in der Lage ist, eine Perspektive aufzuzeigen gegenüber dem Chaos, in das der Kapitalismus die Menschheit gestürzt hat.
Der Klassenkampf rückt ins Zentrum der Gesellschaft
Der Streik bei der Deutschen Bahn hat nicht nur die Kampfbereitschaft der Lohnabhängigen unter Beweis gestellt, er hat die Kampfkraft unserer Klasse angedeutet. Er hat die ganze Gesellschaft wieder daran erinnert, dass wir in einer Klassengesellschaft leben, in der alles von der Arbeit der entrechteten, eigentumslosen, arbeitenden Bevölkerung abhängt. Die verzweifelte Lage der Eisenbahner, die sie dazu zwingt, sich zu wehren, macht deutlich, dass diese Klasse der Gesellschaft nicht nur schlecht behandelt, sondern ausgebeutet wird. Zugleich deutet er die potenzielle Macht dieser Klasse an, die daher rührt, dass die Lohnabhängigen durch ihre Arbeit die ganze Gesellschaft auf ihren Schultern trägt. Außerdem sind diese Produzenten nicht voneinander isoliert, sondern durch Produktion, Verkehr, durch die Gesellschaft miteinander verbunden. Nach dem Fall der Berliner Mauer hieß es: Die Idee der Klassengesellschaft, des Klassenkampfes, des Sozialismus, einer Arbeiterbewegung aus dem 19 Jahrhundert - mit einem Wort: die Ideen des Marxismus - seien tot, es lebe die klassenlose Leistungsgesellschaft. Jetzt beginnt es vielen zu dämmern: Wir leben in einer Klassengesellschaft. Der Klassenkampf lebt.
Der lebendige Klassenkampf der Eisenbahner ist auch deshalb so wichtig, weil aufgrund der Abhängigkeit der modernen Gesellschaft von ihren Verkehrsmitteln dieser Streik nicht totgeschwiegen werden kann. Jeder ist davon betroffen. Jeder fühlt sich aufgefordert, sich dazu zu positionieren. So trägt dieser Kampf in nicht geringem Maße dazu bei, die soziale Atmosphäre in der Gesellschaft zu verändern. Dabei sind zwei Gegebenheiten von besonderer Bedeutung.
Der Arbeiterkampf ist international
Zum einem wurde zufällig zur gleichen Zeit in Deutschland und in Frankreich der Schienenverkehr bestreikt. Dass es links des Rheins um die Rentenbezüge, rechts des Rheins um Gehälter und Arbeitsbedingungen geht, zeigt nur auf, wie umfassend die Angriffe des Kapitals heute sind. Aber die Gleichzeitigkeit des Streiks zeigt vor allem auf, dass der Kampf der Arbeiterklasse wirklich international ist, wie das Kommunistische Manifest von Marx und Engels es einst formulierte ("Proletarier aller Länder, vereinigt euch"). In Deutschland versucht die GDL, die Lage der Eisenbahner in Deutschland als eine Ausnahme hinzustellen. Die Gehälter der Lokführer bei der DB seien im europäischen Vergleich erschreckend niedrig, von daher könne man diese Sparte besondere Zuwendungen zukommen lassen, ohne die allgemeine Notwendigkeit für die Lohnabhängigen in Abrede zu stellen, den Gürtel enger zu schnallen. In Frankreich wiederum behauptet die Regierung Sarkozy, die französische Eisenbahner seien eine privilegierte Minderheit, der man ruhig zumuten könne, bis zur Rente länger zu arbeiten. Gerade die internationale Dimension des Klassenkampfes macht aber deutlich, wie weltweit alle Arbeiter mit denselben Unzumutbarkeiten konfrontiert werden.
Das Geheimnis des Arbeiterkampfes ist die Solidarität
Zum anderen ist die große Popularität des Streiks bei der Deutschen Bahn innerhalb der Bevölkerung sehr bedeutsam. Die Medienmacher selbst sind verdutzt wegen dieser Tatsache. Wie kann es sein, dass eine kleine Gruppe, im Wesentlichen aus einer Berufssparte bestehend, Lohnforderungen von angeblich bis zu 31% für sich beansprucht und zu diesem Zweck einen Streik veranstaltet, der die arbeitende Bevölkerung, vor allem die Berufspendler trifft - und dennoch eine solche Beliebtheit erfährt? Am heutigen dritten Streiktag ergab eine Blitzumfrage der ARD eine Zustimmung zum Streik von 61% der Befragten - allen Unannehmlichkeiten und aller Hetze der herrschenden Klasse zum Trotz!
Auf dieses Rätsel angesprochen, gab einer der Chefredakteure des deutschen Staatsfernsehens, der ARD, Ressort Politik, folgende Antwort: Die Stimmung in der Bevölkerung sei in den letzten paar Jahren "gekippt". Bis dahin habe man die Notwendigkeit der "Lohnmäßigung" hingenommen, wenn auch mit Widerwillen. Inzwischen herrsche aber eine breite Verärgerung und ein "Ungerechtigkeitsgefühl" gegenüber der wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich. Man begrüße den Streik der Eisenbahner vor allem deshalb, weil man sie sozusagen als Vorkämpfer betrachtet, den man am liebsten nachmachen möchte. Und während die "Politik" schon länger eine allgemeine und wachsende Empörung gegenüber den Angriffen auf die Sozialleistungen für Arbeitslose registriert habe (die sie nunmehr durch kleinere Korrekturmaßnahmen zu beschwichtigen versucht), habe man bislang unterschätzt, wie groß der Unmut vor allem angesichts der Lohnentwicklung in den letzten Jahren inzwischen geworden ist.
Der gute Mann hat recht. Genau hier liegt der springende Punkt dieses Streiks; das, was viele Kommentatoren das Paradoxon des Kampfes der Eisenbahner genannt haben. Die GDL als Organisator des Streiks propagiert offen die Aufkündigung der Solidarität innerhalb der Arbeiterklasse. Jede Berufsgruppe soll allein für sich im Kampf dastehen. Es steht für einen Trend, der im Nachkriegsdeutschland relativ neu ist, international aber sattsam bekannt ist: der Trend zu Spartengewerkschaften. Nach der Vereinigung Cockpit für die Piloten und dem Marburger Bund für die Klinikärzte kommt nun die GDL mit ihrem Versprechen einer heilen Welt für Lokführer. Ihr Motto, ganz offen herausposaunt, lautet: Was mit den anderen Berufsgruppen geschieht, geht uns nichts an! Die Einheitsgewerkschaften des DGB wiederum übernehmen den Part, im Namen der "Einheit" und der "Solidarität" gegen die streikenden Piloten, Klinikärzte oder Lokführer zu hetzen und sie als Privilegierte, ja als Feinde der anderen Berufsgruppen zu verfemen. Was hinter diesem Trend zur Spartengewerkschaft steckt, ist Folgendes: Zum einem versucht man, die scharenweise sich von den bestehenden Gewerkschaften abwendenden Arbeiterinnen und Arbeiter in "alternativen" Gewerkschaften aufzufangen, damit die Arbeiterklasse nicht wieder damit anfängt, wie in den Jahren nach 1968 eigenständig und selbstorganisiert zu kämpfen. Zugleich will man die Lohnabhängigen vor die falsche Alternative zwischen Unterordnung unter die sozialdemokratischen Einheitsgewerkschaften einerseits und isolierten bis unsolidarischen Aktionen unter der Regie der Spartengewerkschaften andererseits stellen. Dass die SPD und der DGB unwirsch auf diese neue Macht der Spartengewerkschaften reagieren, weil sie eine Schwächung der eigenen Macht und Privilegien innerhalb des Staatsapparates fürchten, ändert nichts an der Tatsache, dass diese falsche Alternative zwischen zwei Gewerkschaftsformen der gesamten herrschenden Klasse im Kampf gegen die Arbeiterklasse zugute kommt. Im Gegenteil verleiht es dieser Alternative - und momentan vor allem der Spartengewerkschaft - eine zusätzliche Glaubwürdigkeit.
Dass die herrschende Klasse mit diesem Vorgehen Erfolge verbuchen kann, zeigt der derzeitige Auftrieb der GDL. Schaut man genauer hin, so erkennt man, dass das, was die arbeitende Bevölkerung heute umtreibt, nicht der Traum von voneinander isoliert kämpfenden Berufsgruppen ist - was für die Arbeiterinnen und Arbeiter ein Albtraum wäre. Hinter dem Streik der Eisenbahner zeigt sich ein wachsendes Gefühl der Arbeitersolidarität. Allein die Tatsache, dass nicht allein Lokführer sondern auch Zugbegleiter zur Lokführergewerkschaft gingen, zeigt, dass es den Betroffenen nicht um Berufsdünkel geht, sondern um die Suche nach Alternativen zu den bestehenden Gewerkschaften. Und die Beliebtheit des Eisenbahnerstreiks innerhalb der Bevölkerung zeigt uns das Gleiche. Das, wonach die Arbeiterklasse noch unsicher tastend zu suchen begonnen hat, wird sie nicht bei den Gewerkschaften finden (egal welchen) sondern im gemeinsamen, solidarischen Kampf.
Wie weiter?
Dieses Tasten, das sich dahinter verbergende Potenzial des Widerstands gegen die kapitalistischen Angriffe, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die kämpfenden Eisenbahner durch die Gewerkschaften in eine faktische Isolierung geführt worden sind. Sie mussten bisher ohne die ganz große Mehrheit ihrer Kolleginnen und Kollegen bei der Deutschen Bahn, isoliert und abgeschirmt auch von anderen Teilen ihrer Klasse ihren Kampf ausfechten. Es gilt jetzt, Initiativen zu entwickeln, um dieser Isolierung entgegenzutreten, indem man das Gespräch mit anderen Eisenbahnern sucht, indem man die arbeitende Bevölkerung insgesamt nicht mehr nur als "Bahnkunden" betrachtet, wie die GDL das tut, sondern als Mitstreiter, die als Lohnabhängige alle die gleichen Interessen haben. Die spontane Sympathie der Bevölkerung zeigt auf, wie falsch es wäre, den Kampf gegen Hungerlöhne und schlimme Arbeitsbedingungen als eine Besonderheit der Bahn aufzufassen. Wenn die Herrschenden in den letzten Wochen gelernt haben, den Kampf der Eisenbahner zu fürchten, und sich nun nicht mehr ohne Weiteres trauen, mit Streikverboten vorzustoßen, dann vor allem deswegen, weil sie wissen, dass sich dahinter eine allgemeine Unzufriedenheit der Arbeiterklasse anstaut.
Außerdem gilt es, wachsam zu sein gegenüber dem, was die "Tarifparteien" an "Lösungen" auf Kosten der Betroffenen auszutüfteln versuchen werden.
Für die gesamte Arbeiterklasse gilt es, die Kampfkraft der Eisenbahner zum Beispiel zu nehmen, damit aus einer isolierten Auseinandersetzung allmählich ein allgemeiner und solidarischer Kampf werden kann. IKS 16. November 2007
Leserbrief: Gore: Friedensengel?
- 3125 reads
Wieder einmal wurde weltweit die Bekanntgabe aus Oslo erwartet. Wer hat sich dieses Jahr den Friedensnobelpreis verdient für besondere Bemühungen um den Weltfrieden? Da schau her, der Al Gore. Der selbsternannte Klimaschutzapostel. Was ist denn eigentlich sein besonderes Verdienst für die Menschheit? Der fliegt, laut seinem Film "Eine unbequeme Wahrheit" mit Flugzeugen durch die ganze Welt, um seinen Vortrag über die gefährlichen Umweltsünden zu halten und wie wenig Zeit der Menschheit wohl noch
Wieder einmal wurde weltweit die Bekanntgabe aus Oslo erwartet. Wer hat sich dieses Jahr den Friedensnobelpreis verdient für besondere Bemühungen um den Weltfrieden? Da schau her, der Al Gore. Der selbsternannte Klimaschutzapostel. Was ist denn eigentlich sein besonderes Verdienst für die Menschheit? Der fliegt, laut seinem Film "Eine unbequeme Wahrheit" mit Flugzeugen durch die ganze Welt, um seinen Vortrag über die gefährlichen Umweltsünden zu halten und wie wenig Zeit der Menschheit wohl noch bleiben wird, wenn nicht bald handfeste Maßnahmen ergriffen werden, um die Zerstörung des Planeten Erde aufzuhalten. (Übrigens kostet sein Dienst an der Menschheit, also jeder Vortrag nur wenig mehr als 150.000 $!) In einem Punkt hat Gore aber leider recht. Die Zeit drängt in der Tat. Zwar kann unser Planet auf eine Milliarden alte Geschichte zurückblicken, doch die letzten 200 Jahre haben Mutter Erde arg zugesetzt. Es sind eben die letzten 200 Jahre, die den Sieges- und Zerstörungszug des Kapitalismus gesehen haben mit rauchenden Schornsteinen, Atombomben, Leerfischung der Meere etc.
Nach Al Gores Verständnis gibt es einen klaren Schuldigen: den Menschen. Aber nicht verzweifeln, es gibt auch einen Weg aus der Sackgasse. Es braucht nämlich nur einen solch tollen Kerl wie Gore, der der Welt mit dramatischen Bildern ein schlechtes Gewissen macht und dann wie ein wahrer Held die Lösung parat hat. So verkündet er zum Schluss seines Films auf die Frage, was tun, stolz, kauft neue stromsparendere Kühlschränke und Autos. Denn wenn alle dies täten, dann würde die Zerstörung der Erde auf den Stand der 1970er (!) zurückgehen. Danke, Mister Gore, welch revolutionärer und wirksamer Ansatz!
Für eben diesen wahnsinnig effektiven Ansatz hat Gore also den Friedensnobelpreis erhalten. Was fällt hier auf? Zum einen, dass jeder allein seinen Lösungsweg durchziehen soll. Zudem konsumiert man so mehr und kurbelt nebenbei auch noch die Wirtschaft an (notfalls auf Pump). Zum anderen aber fällt gerade auf, dass dies überhaupt keine Lösung darstellt. Natürlich sind umweltfreundlichere Kühlschränke begrüßenswert, aber mal ehrlich, reicht dies, um die Erde und die Menschheit vor einer ökologischen Katastrophe zu bewahren? Sicher nicht.
Unkraut wächst schließlich immer wieder nach, es sei denn, man reißt es an der Wurzel raus. Die Wurzel des Übels liegt aber nicht im Kühlschrank, sondern im Kapitalismus höchst selbst. Ein System, dessen wichtigstes Lebensprinzip ist: MEHR Profit, um JEDEN Preis, so kann er nichts und niemanden zu liebe auf Profit verzichten. Auch nicht der Umwelt zuliebe. Sonst geht das eigene Unternehmen noch unter.
Wenn es stimmen würde, dass man rein auf indivudeller Ebene einen echten Fortschritt in Sachen Umweltschutz erzielen könnte, weshalb hat denn dann der gute Mister Gore nicht selbst die Welt erretten können? Schließlich war Gore zwei Legislaturperioden (sprich acht Jahre) lang der Vizepräsident der Vereinigten Staaten, der Weltmacht Nr.1 und nebenbei bemerkt als Industriemacht einer der Haupterzeuger der Umweltverschutzungen. Der ehemals zweitwichtigste Mann der Erde und beinahe-Präsident - und dennoch keine Kehrtwende in Sachen Umweltschutz? Und nicht nur das. Zum Umweltschutz gehört natürlich auch, dass es keine Kriege mehr gibt. Darum geht es ja zumindest dem Namen nach auch bei der Vergabe des Friedensnobelpreises. Aber siehe da. Gore und seine Regierung zogen seinerzeit in den Balkankrieg. So erhält wieder einmal ein Kriegstreiber einen Friedensnobelpreis.
Aber es ist ja auch bekannt, dass die Vergabe des Friedensnobelpreises stets politisch motiviert ist. In diesem Jahr ist die Botschaft wohl ein Schuss vor den Bug der Bushregierung. Ein europäischer Aasgeier versucht dem amerikanischen ein Auge auszuhaken.
Wem wirklich ernsthaft an Frieden, Menschlichkeit und an einer lebensfähigen Umwelt gelegen ist, der kann unmöglich auf diesen oder irgendeinen von der herrschenden Klasse gekürten Friedensheiligen schauen. Was wir als arbeitende Bevölkerung brauchen, ist Mut und Zuversicht, dass unser Kampf für eine klassenlose Gesellschaft gelingen kann. Erst in einer solchen Welt ohne Krieg, Profitgier und Ausbeutung können Mensch und Natur in Einklang miteinander leben. Es mag verrückt klingen, aber auch die Natur braucht dringend den Klassenkampf und die Weltrevolution, keinesfalls aber diese lahme Friedenstaube von Gore. 7.11.2007
Rede der EKS auf dem 17. Internationalen Kongress der IKS: Probleme des dekadenten Kapitalismus in der Türkei
- 3063 reads
Dies ist der Wortlaut der Rede, die ein Genosse der türkischen Gruppe Enternasyonalist Komünist Sol (Internationalistische Kommunistische Linke) auf dem 17. Internationalen Kongress der Internationalen Kommunistischen Strömung im Mai dieses Jahres zur Situation in der Türkei gehalten hatte. Wir denken, dass wir unseren Lesern die Aussagen dieser Rede nicht vorenthalten dürfen. Dies ist der Wortlaut der Rede, die ein Genosse der türkischen Gruppe Enternasyonalist Komünist Sol (Internationalistische Kommunistische Linke) auf dem 17. Internationalen Kongress der Internationalen Kommunistischen Strömung im Mai dieses Jahres zur Situation in der Türkei gehalten hatte. Wir denken, dass wir unseren Lesern die Aussagen dieser Rede nicht vorenthalten dürfen. Gerade die Äußerungen des Genossen über die imperialistischen Ambitionen der Türkei im Nordirak, haben bis heute nichts an ihrer Richtigkeit und Aktualität eingebüßt, wie der erst in jüngster Zeit erfolgte Aufmarsch von über 100.000 türkischen Soldaten an der Grenze zum Irak zeigt.
In den letzten fünf Monaten passierten etliche Besorgnis erregende Ereignisse in der Türkei. Nach dem Mordanschlag auf Hrant Dink (einem armenischstämmigen Journalisten) im Januar hat es äußerst brutale Angriffe gegen Ausländer, etliche nationalistische Massendemonstrationen, Bombenanschläge wegen des andauernden blutigen Krieges zwischen bewaffneten kurdischen Nationalisten und der türkischen Armee gegeben. Es hat den Anschein, als wird die Lage immer schlimmer. Die letzte Bombe der Bourgeoisie explodierte vor einigen Tagen in Ankara; sie tötete sechs Menschen und verletzte mehr als hundert. Daraufhin rief der Ministerpräsident zur nationalen Einheit gegen den Terrorismus auf, dem sich auch die meisten linksbürgerlichen Organisationen anschlossen.
Die Türkei ist besonders in den Großstädten mittlerweile in eine künstliche Polarisierung zwischen der säkular-bürokratischen Opposition und den Anhängern der liberalen islamistischen Regierung geraten. Die Presseorgane der säkular-bürokratischen Opposition, die sich wichtiger nimmt, als sie tatsächlich ist, setzten die Behauptung in Umlauf, dass das „Regime in Gefahr“ sei, und begannen Massendemonstrationen gegen ihre politischen Gegner zu organisieren. Obwohl die bürgerlichen, säkular-nationalistischen Medien behaupteten, dass es sich hierbei um eine „Basis“-Bewegung handle, war offensichtlich, dass jenen, die demonstrieren gingen, dies auch leicht gemacht wurde und sie die Unterstützung einer starken Fraktion der Bourgeoisie genossen. Der vielleicht bedeutendste Aspekt dieser Demonstrationen waren jedoch die linksnationalistischen Parolen, die skandiert wurden. Was diese Parolen zeigten, ist, dass das Elend der verknöcherten Staatsbourgeoisie durch den Zerfall der alten kemalistischen Staatsideologie verursacht wird. Die Probleme dieser Ideologie beschränken sich nicht auf solche Parolen: Winzige faschistische Sekten, die von Generälen a.D. gegründet wurden, schwören, zu töten und zu sterben, um das Land zu retten; alte linksextremistische Gruppen, die sich offenbar dem Rechtsextremismus zugewandt haben, schreiben Parolen an die Mauern, mit denen zur Invasion des Nordirak und mehr aufgerufen wird; und gelegentlich rufen hochrangige Armeekader zur „Befreiung“ der irakischen Turkmenen auf. Die Armeebürokratie ist noch immer eine der stärksten Mächte in der Türkei. Jedoch ist nicht alles Gold, was glänzt; die Propaganda ist ein Beweis dafür. Niemals zuvor hatte diese Fraktion der Bourgeois eine solch massive Propaganda machen müssen, um sich den Anschein zu geben, als erhielte sie massive Unterstützung. Auch wenn es ihr gelang, Hunderttausende dazu zu bringen, durch die Straßen zu marschieren, so handelt es sich hier um einen Akt der Verzweiflung. Je verzweifelter die Bourgeoisie ist, desto bösartiger wird sie.
Was den anderen Flügel der Bourgeoisie anbelangt, so scheint auch er große Probleme zu haben. Als die Regierung von Tayyip Erdoğan mit der Unterstützung der Hauptfraktion der kapitalistischen Klasse gewählt worden war, bestand die Absicht, den alten Traum zu verwirklichen, eine Brücke nach Europa für das Öl von Baku zu bilden, um so der Europäischen Union beitreten zu können. Noch bis vor kurzem hatte es den Anschein, als habe der Traum eine Chance auf Verwirklichung; doch anders als Russland, dem es gelang, wovon die Türkei träumte, wurden die imperialistischen Ambitionen der Türkei inzwischen größtenteils zerstört. Die Möglichkeit, der Europäischen Union beizutreten, schwindet. Obwohl Erdoğans Regierung noch immer sehr stark ist, erscheint es höchst unwahrscheinlich, dass sie auch nach den kommenden Wahlen noch so stark sein wird wie heute. Erdoğans Regierung schien kein Interesse daran zu haben, den Irak zu betreten, als sie von den Vereinigten Staaten dazu eingeladen wurde. Sie wollte durchaus imperialistische Interessen im Nordirak verfolgen, doch sie wollte nicht dorthin gehen, wo es die Vereinigten Staaten wünschten - und dies war damals sicherlich nicht der Nordirak. Es ist auch wichtig zu bemerken, dass die sozialen Bedingungen angesichts der massiven Antikriegswelle sich damals nicht wirklich für eine massenhafte Kriegsmobilisierung eigneten. Doch nun werden Hunderttausende für den Nationalismus mobilisiert und von antikurdischen Ressentiments aufgestachelt. Es stellt sich hier die Frage, ob die Invasion des Nordirak der Fantasie winziger faschistischer Sekten entsprungen ist oder eine tatsächliche Option ist. Wird der amerikanische Imperialismus den türkischen Imperialismus gegenüber den bürgerlichen kurdischen Fraktionen vorziehen, denen es nicht gelang, das Gebiet zu kontrollieren? Könnte die türkische Bourgeoisie ihre imperialistischen Ambitionen auf die Kontrolle des Erdöls im Nordirak richten? Ein neuer imperialistischer Krieg im Mittleren Osten könnte früher als erwartet ausbrechen. Die wichtigsten Fernsehsender in der Türkei, einschließlich des berüchtigten Fox Television Network, der erst kürzlich seinen Sendebetrieb in der Türkei aufgenommen hat, haben bereits mit der Debatte begonnen, ob die Türkei in den Nordirak eindringen soll oder nicht. Obwohl die Linksextremisten in der Türkei eifrig dabei sind, unabhängige Kandidaten für die kommenden Wahlen aufzustellen, um die bürgerliche Versammlung in einen herzlichen und freudvollen Ort zu verwandeln, könnten die Wahlen mit der Bildung eines Kriegskabinetts enden, das die Unterstützung jener erhält, die für die Verteidigung des Säkularismus und Kemalismus mobilisiert worden waren. Es ist eine Möglichkeit: vielleicht nicht die wahrscheinlichste, aber doch eine bedeutende und gefährliche Möglichkeit. Was diese Möglichkeit zeigt, ist die Mentalität der Bourgeoisie in Bezug auf imperialistische Kriege. Im dekadenten Kapitalismus werden imperialistische Kriege der Kriegsführung wegen geführt.
1974, als die türkische Armee in Zypern einmarschierte, schickten Armeekommandeure Panzer und Soldaten an die Grenze zu Griechenland. Wäre es möglich gewesen, hätten sie nicht gezögert, einen blutigen Krieg mit Griechenland anzuzetteln. Heute werden sie, wenn es die Bedingungen ermöglichen, den Nordirak anzugreifen und die endlosen Konflikte, die Zerstörungen, die Gewalt und das Leid ignorieren, die dies mit sich bringen würde. Die Bourgeoisie in der Türkei hat ernste Probleme: Es gibt schwere Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Fraktionen der Bourgeoisie, der Sozialstaat ist im Rückzug begriffen, das alte bürgerliche Konzept vom Staatsbürgertum zerbröselt, die türkische Bourgeoisie ist hinsichtlich ihrer Beziehungen zur kurdischen Bourgeoisie gescheitert, und die alten politischen und ideologischen Strukturen des Kemalismus, die das Fundament des türkischen Regimes bilden, erweisen sich als zu belastend für die Bourgeoisie. Und doch bedeutet die Zerstörung jener alten Strukturen das gesamte Regime aufs Spiel zu setzen, da die politische Rechtfertigung des bürgerlichen Regimes auf dem Kemalismus beruht. Die türkische Bourgeoisie wandelt auf dünnem Eis. Die einzige Lösung, die sie gegenüber ihren Problemen anbieten kann, ist ein neuer imperialistischer Krieg. Wenn dies heute nicht im Nordirak passiert, wird es morgen vielleicht anderswo passieren: Doch es wird passieren. Wie das Manifest der Kommunistischen Linken an die Arbeiter Europas, im Juni 1944 von der Gauche Communiste de France verfasst, erklärte: „Solange es Ausbeuter und Ausgebeutete gibt, ist der Kapitalismus Krieg und der Krieg Kapitalismus.“ Und wenn wir all die vielen endlosen lokalen Kriege, die Explosionen in den Städten, die brutalen Morde auf der Welt betrachten, sehen wir deutlich, dass der Kapitalismus die Menschheit in die Barbarei führt.
Die proletarische Weltrevolution ist die einzige Alternative zur kapitalistischen Barbarei
Dies führt zur Frage der Lage des Proletariats in der Türkei. Nach der Niederlage der massiven Welle proletarischer Kämpfe in der Türkei, die 1989 mit den Streiks der öffentlichen Bediensteten begann und sich schnell auf gewerkschaftliche und nicht gewerkschaftliche ArbeiterInnen in den privaten Sektoren ausbreitete, zur Bildung von unabhängigen Fabrikkomitees führte und 1995, nach der Besetzung des Kizilay-Platzes in Ankaras, wo sich die Verwaltungszentren der türkischen Regierung befinden, durch Arbeiter des Öffentlichen Dienstes endete, gelang es den Gewerkschaften, einen sehr großen Einfluss auf das Proletariat zu erringen. In den letzten Jahren gab es ein bemerkenswertes Wachstum in der Zahl von Klassenkämpfen. Besonders in den letzten Monaten gab es etliche ziemlich große Arbeiterdemonstrationen, eine erhebliche Welle von Fabrikbesetzungen und zahllose Streiks in einer ganzen Reihe von Industriezweigen. Jedoch gelang es in nahezu keinem dieser Kämpfe, einen bedeutenden Erfolg zu erlangen, was zumeist auf die Tatsache zurückzuführen war, dass jene Kämpfe – auch wenn sie zahlreich waren – sich auf einzelne Sektoren oder gar einzelne Arbeitsplätze beschränkten und sich nicht ausweiteten. Da es keinen vereinten Kampf gab, hatte die Bourgeoisie keine große Mühe, die kämpfende Arbeiterklasse zu besiegen. Es ist auch wichtig zu bemerken, dass die meisten jener Kämpfe aktiv von den Gewerkschaften sabotiert wurden; beispielsweise bestand während einer Fabrikbesetzung die Methode der Gewerkschaft, um die Arbeiter zum Einlenken zu zwingen, darin, ihnen eine türkische Flagge auszuhändigen, um sie über das Fabriktor aufzuspannen. In der Tat machten Arbeiter in den meisten dieser Kämpfe ihren Unmut über die Gewerkschaften kund. Tatsächlich beteiligen sich die Gewerkschaften in der Türkei zwar nicht aktiv an der Sabotierung des Kampfgeistes der Arbeiter durch die türkische Bourgeoisie, aber sie spielen eine aktive Rolle bei der Mobilisierung des Proletariats für die nationalistische Sache. Selbst linksextreme Gewerkschaften beteiligten sich aktiv dabei, die Arbeiter in den säkularistischen Demonstrationen hinter einer Abteilung der Bourgeoisie aufzustellen.
Die Rolle der Gewerkschaften wurde noch sichtbarer während der letzten 1.Mai-Demonstration in Istanbul. Die wichtigste linksnationalistische Gewerkschaft hatte erklärt, dass sie den Mai-Feiertag in einer „verbotenen“ Zone in Istanbul, auf dem Taksim-Platz, begehen wollte, da sich dieses Jahr der berüchtigte Blutige 1.Mai zum dreißigsten Mal jährte. Damals hatten sich fast eine Million Demonstranten auf dem Taksim-Platz versammelt und waren von unbekannten Schützen aus zwei Gebäuden und einem Auto nahebei unter Feuer genommen worden. Der Istanbuler Bürgermeister, der wegen seiner Sympathien für Erdoğans Partei bekannt ist, war entschlossen, solch eine Demonstration zu verbieten; jedoch hatten etliche linksextremistische Gruppierungen und Parteien bereits erklärt, dass sie sich der Gewerkschaft auf dieser Demonstration anschließen würden. Bald darauf geriet dieses Ereignis aus der Kontrolle der Gewerkschaft und der linksextremistischen Gruppierungen. Der diesjährige 1.Mai in Istanbul war ziemlich brutal: Die Istanbuler Stadtregierung hatte die Polizei angewiesen, kompromisslos einzuschreiten, was diese auch tat. Wo immer sich ArbeiterInnen versammelten, um den Taksim-Platz zu betreten, wurden sie von der Polizei angegriffen. Viele von ihnen wurden zusammengeschlagen, rund eintausend wurden festgenommen, und eine alte Person starb in ihrer Wohnung infolge des Tränengases, mit dem die Polizei um sich warf. Während die rechtsbürgerlichen Medien die Polizisten als Helden darstellten, gaben die liberalen Nationalisten und die Linksextremisten dem Bürgermeister die Schuld an den Verkehrsproblemen, die auftraten, und die Gewerkschaftsführer, denen es von der Polizei gestattet wurde, den Platz zu betreten, und die ihn sogleich wieder verließen, um später vor den Fernsehkameras ihren Sieg zu erklären, wurden als Helden gefeiert. Jedoch hatten die Gewerkschaften erwartungsgemäß nichts zum Klassenkampf beigetragen. Auch wenn die einfache Androhung eines eintägigen Streiks ausgereicht hätte, um viele davor zu bewahren, zusammengeschlagen oder festgenommen zu werden, bewiesen die Gewerkschaften einmal mehr, dass sie der Arbeiterklasse nichts zu geben haben. Stattdessen nannte die Gewerkschaft diesen 1.Mai einen Kampf für die Demokratie, und die Gewerkschaftsführer gingen gar so weit, die Polizeiattacken gegen das Proletariat als die Rache gegen die jüngsten säkular-nationalistischen Demonstrationen darzustellen.
Wenn wir die Lage des Proletariats in der Türkei betrachten, sehen wir, dass das Proletariat unter sehr schlechten Bedingungen lebt. Die Bedingungen des Industrie- und Landproletariats sind in einigen Teilen der Türkei unvorstellbar. Große Teile der Akademiker, selbst Ärzte und Ingenieure, sind stark proletarisiert und äußerst ausgebeutet, wenn sie denn einen Job haben. Es gibt eine massive Arbeitslosigkeit, besonders unter jungen Menschen, und mit dem Zerfall der Staatsideologie sowie in Ermangelung einer starken kommunistischen Stimme werden die meisten Arbeitslosen in bürgerliche Ideologien wie den Islamismus, Nationalismus und die nationale Befreiung hineingezogen. Es gibt sehr kämpferische Teile der Arbeiterklasse, doch die Vorherrschaft der Gewerkschaften und der Einfluss bürgerlicher Ideologien auf die ArbeiterInnen hindern dieselben an einer Vereinigung auf Klassengrundlage. Die einzige Lösung der Probleme des Proletariats, das einzige Heilmittel gegen die Bedrohung des proletarischen Kampfes durch bürgerliche Ideologien ist der proletarische Internationalismus und die internationale Klassensolidarität.
Die Bourgeoisie führt das Proletariat zu noch mehr Leid, zu noch mehr Elend und noch mehr Toten. Der Kommunismus ist die einzige realistische Alternative zum Versinken in die Barbarei. Unter diesen Umständen denken wir, dass es äußerst wichtig für die verschiedenen proletarischen Gruppierungen ist, sich in regelmäßigen Diskussionen und in internationaler Solidarität zu üben.
Dieser Text wurde auch veröffentlicht auf: en.internationalism.org/forum [88] und auf Libcom.
EKS
Juli 2007
Geographisch:
- Naher Osten [2]
Theoretische Fragen:
- Imperialismus [3]
Erbe der kommunistischen Linke:
Vom Streik zur Bewegung? Überlegungen zum Arbeitskampf bei BSH Berlin
- 3564 reads
Wir veröffentlichen im Folgenden ein Flugblatt, dass die Freunde und Freundinnen der klassenlosen Gesellschaft vor rund einem Jahr anlässlich des Streiks der Beschäftigten der Bosch-Siemens Haushaltsgeräte (BSH) in Berlin herausgegeben haben. Wir stimmen den in dieser Flugschrift geäußerten Aussagen hinsichtlich der Rolle der Gewerkschaften – hier der IG Metall – und der Notwendigkeit einer Ausweitung des Kampfes im Wesentlichen zu. Wir denken ferner, dass der Kampf der ArbeiterInnen der BSH eine viel größere Öffentlichkeit verdient hat, als ihm die bürgerlichen Medien eingeräumt haben, die naturgemäß kein Interesse daran haben konnten, seinem Anliegen mehr Gehör zu verschaffen. In diesem Sinne begrüßen wir, dass die Genossen und Genossinen dieser Gruppe sich darum bemüht haben, ihre Stimme gegen die Ignoranz der bürgerlichen Medien zu erheben und auf die Bedeutung dieses Kampfes hinzuweisen. Dieser Kampf war in der Tat eine wichtige Episode im Kampf unserer Klasse, da die Beschäftigten der BSH wichtige Erfahrungen gesammelt haben, die unbedingt weiteren Kreisen der Arbeiterklasse selbst ein Jahr danach zugänglich gemacht werden sollten.
Tatsache ist: Die deutsche Disziplin und Ruhe könnten trügerisch sein. Eine neue RAF… ist nicht in Sicht. Aber wenn irgendwo 200 empörte Arbeiter, die entlassen werden sollen, obwohl der Konzern insgesamt schwarze Zahlen schreibt, alles kurz und klein schlagen, kann ein einziger Gewaltausbruch dieser Art einen Flächenbrand auslösen, wie einst der unpolitische Mordversuch an Rudi Dutschke zu Ostern 1968.
Peter Glotz (SPD), Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 12.5.2005
Trotz einiger Kämpfe gegen Massenentlassungen und Betriebsschließungen, beispielsweise bei Opel Bochum, AEG Nürnberg und dem Berliner Baumaschinenwerk CNH, kam es bisher nicht zu dem von Peter Glotz befürchteten Flächenbrand. Die verschiedenen Streiks und Auseinandersetzungen, die in den letzten Jahren stattfanden, blieben weitestgehend isoliert voneinander. Auch der Kampf bei Bosch-Siemens-Hausgeräte (BSH) Berlin im Herbst 2006, der sich gegen die geplante Schließung des Produktionsstandorts richtete, war kein Startschuss für eine breitere Bewegung. Im Gegensatz zu anderen Auseinandersetzungen suchten die BSH-Arbeiter jedoch den Zusammenschluss mit anderen Beschäftigten und probten den Aufstand gegen die Gewerkschaft. Dennoch gelang es ihnen nicht, dem Unternehmen ihren Willen aufzuzwingen und den Erhalt aller Arbeitsplätze durchzusetzen. Auf ihrem Solidaritätsmarsch durch die Bundesrepublik traten sie in direkten Kontakt mit anderen Arbeitern und entwickelten im Laufe dieser Reise durch die ihnen entgegengebrachte Solidarität ein Gefühl der eigenen Stärke. Sie lehnten den von der IG Metall ausgehandelten und als Sieg verkauften Kompromiss mit einer satten Zweidrittelmehrheit ab und äußerten lautstark ihren Unmut über dieses Ergebnis. Dennoch fügten sie sich letztendlich der Aufforderung zur Beendigung aller Kampfmaßnahmen, denn die Enttäuschung über die Verhandlungsführer führte nur zu Frustration, Wut und Resignation. So schafften die Streikenden es nicht, sich aus der gewerkschaftlichen Gängelung zu befreien und das weitere Vorgehen selbst zu bestimmen.
Nachdem zwei Wochen lang täglich Betriebsversammlungen durchgeführt wurden und die Produktion still stand, entschloss sich die Gewerkschaft Ende September zu einem offenen Streik gegen die drohende Betriebsschließung zum Jahresende. Es folgte das übliche Ritual: Tische und Stühle wurden aufgestellt, IG Metall-Fähnchen in den Boden gesteckt, beschriftete Müllsäcke über den Kopf gezogen, das Firmenlogo mit der obligatorischen Botschaft („Dieser Betrieb wird bestreikt“) geschmückt und nicht sonderlich originelle Transparente mit Aufschriften wie „Wir wollen arbeiten“ und „Siemens entlässt seine besten Kinder“ aufgehangen. Ganz im sozialpartnerschaftlichen Sinne war sich die IG Metall mit der Unternehmensleitung schon im Voraus einig, ihren Beitrag zu der geplanten „Kostensenkung“ im Umfang von 8,5 Millionen Euro leisten zu wollen – nur über das Wie herrschte Uneinigkeit.Hier und da wurde zwar über den angebotenen Lohnverzicht gemurrt, aber wenn man die Beschäftigten in jenen Tagen fragte, wie es denn weitergehen solle und welche Aktionen geplant seien, verwiesen sie achselzuckend auf ihre Anführer. Es machte den Anschein, als hätten die Arbeiter den Lohn des Betriebs gegen den Scheck der Gewerkschaft getauscht, die Anweisungen des Vorarbeiters gegen jene der Funktionäre und die monotone Beschäftigung im Werk gegen das gelangweilte Herumsitzen außerhalb.So plätscherte der Streik vor sich hin, weitestgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit. Es folgten ein paar kleinere Aktionen, eine Demonstration durch Siemensstadt und ein Solidaritätsfest auf dem Betriebsgelände. Einige Politiker ließen sich sehen und bekundeten ihre Solidarität – die Beschäftigten dankten es ihnen mit Applaus. Von Selbsttätigkeit und Leidenschaft war, zumindest auf dem Werksgelände, wenig zu spüren und so könnte man diesen Streik in eine Reihe von Abwehrkämpfen stellen, wie sie selbst in diesem beschissenen Land in letzter Zeit des öfteren aufflammten, z. B. bei der AEG Nürnberg oder dem Berliner Baumaschinenwerk CNH.
Solidarität und Selbsttätigkeit
Der Streik nahm jedoch eine andere Entwicklung, als man es in diesen Tagen vermutet hätte – ausgehend von einer Idee des Kampfes, der über die Grenze des eigenen Betriebes hinausgehen sollte. Während in Berlin weiter die Toreinfahrten bewacht wurden, um einen möglichen Abtransport der Maschinen zu verhindern, machten sich etwa 50 Arbeiter auf, um andere Produktionsstandorte in ganz Deutschland zu besuchen. Auf dem so genannten Marsch der Solidarität besuchten sie verschiedene Betriebe, diskutierten mit anderen Lohnabhängigen über ihre Situation und verteilten Flugblätter in den jeweiligen Fußgängerzonen. Sie warben um Solidarität mit dem Ziel, zusammen mit möglichst vielen Arbeiterinnen aus den verschiedensten Fabriken vor der Siemenszentrale in München mit einer Großkundgebung ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.In Nauen blockierten sie einen Tag lang das dort ansässige BSH-Werk, in Kamp Lintfort schlossen sie sich mit den Beschäftigten der ehemaligen Siemens-Mobiltelefonsparte BenQ zusammen und demonstrierten durch den Ort, begleitet von der städtischen Feuerwehr, den ortsansässigen Stahlkochern und weiten Teilen der Bevölkerung. Doch nicht nur Betriebe des Siemens-Konzerns waren das Ziel, auch den Beschäftigten von Miele statteten sie einen Besuch ab und leisteten dadurch einen Beitrag, der Konkurrenz unter den Arbeitern praktisch entgegen zu wirken. Eine weitere positive Erfahrung machten sie bei AEG Nürnberg, wo ein großer Teil der dort Beschäftigten seine Arbeit unterbrach, um mit den Berliner Streikenden zu diskutieren.Durch die ihnen entgegengebrachte Solidarität entwickelte sich allmählich Vertrauen in die eigene Macht. Verteilten sie anfänglich noch Flugblätter, die ihnen die Gewerkschaft mit auf den Weg gab, schrieben sie später ihre eigenen mit selbst aufgestellten Forderungen. Sie traten immer selbstbewusster auf, und, gestärkt durch die Zusage vieler anderer Arbeiter auch nach München kommen zu wollen, diskutierten sie auch andere von kämpfenden Arbeitern gemachte Erfahrungen jenseits des Legalismus wie z. B. Bahnhofs- und Autobahnbesetzungen. Das Neue gegenüber vergleichbaren Streiks in den letzten Jahren bestand nicht darin, dass die Ziele radikaler gewesen wären. Genau wie bei Opel oder AEG waren die Arbeiter von BSH in der Defensive. Das Neue lag in der Tatsache, dass sie sich nicht einfach in ihrem Werk verbunkert, sondern den ersten und unverzichtbaren Schritt für jede Bewegung von Lohnabhängigen gegen das Kapital gemacht haben: Sie suchten den Kontakt zu anderen Arbeitern, selbst zu Arbeitern von Konkurrenzbetrieben. Und sie haben begonnen, Selbsttätigkeit zu entwickeln.
Die Gewerkschaft würgt den Streik ab
Eben das missfiel nicht nur der Unternehmensleitung, sondern auch der Gewerkschaft. Einerseits brauchen Gewerkschaften eine auch mal grollende Basis, mit der sie Unternehmern und Regierung drohen können. Andererseits haben sie vor nichts so viel Angst wie vor eben der „Aufkündigung des sozialen Friedens“, von der sie immer reden, wenn sie ihre Verhandlungsposition verbessern wollen. Wenig verwunderlich daher, dass die IG Metall der sich entwickelnden Dynamik des Solidaritätsmarsches in einer Nacht- und Nebelaktion ein jähes Ende bereitete – genau einen Tag vor dem erwarteten Höhepunkt: der Großkundgebung vor der Siemens-Zentrale in München. Die Verhandlungsführer unterzeichneten einen „Kompromiss“ ganz nach Geschmack der Unternehmensleitung und teilten diesen schon der Öffentlichkeit in einer Pressemeldung mit, bevor die davon betroffene Belegschaft im Ganzen auch nur informiert worden war: 216 Entlassungen, Verlängerung der wöchentlichen Arbeitszeit ohne Lohnausgleich, Wegfall der Schichtzulage, Streichung der Jahreszulage, Kürzungen bei der Urlaubsvergütung und den Sonderzahlungen. Die Gegenleistung: Eine unverbindliche Absichtserklärung, das Werk in Spandau bis 2010 zu erhalten. Die Kundgebung wurde abgeblasen, die Arbeiter, die bereits in Bussen auf dem Weg nach München waren, wurden kurzerhand zurückgerufen, nachdem sie wochenlang durchs Land gezogen waren und Solidarität mit ihrem Streik eingefordert hatten. „Wir sind von der IG-Metall, der wir zu hundert Prozent vertraut haben, vollkommen benutzt und verarscht worden“, so ein BSH-Arbeiter (siehe das nachstehende Interview).
Zwischen Rebellion und Resignation
Wie sehr es bei dem Deal darum ging, die durch den Streik entstandene Unruhe und Bewegung so schnell wie möglich zu beenden, wurde bei der Präsentation des Verhandlungsergebnisses deutlich: Ein Punkt in der Einigung zwischen Siemens und IG Metall lautete, dass es keine Kundgebungen und Demonstrationen außerhalb Berlins mehr geben dürfe. Ob ein solcher Knebelvertrag überhaupt legal ist, mögen die Rechtsgelehrten entscheiden und tut hier nichts zur Sache. Die BSH-Belegschaft jedenfalls traute ihren Ohren nicht, als die Einigung vorgetragen wurde, erhob sich von den Bänken und forderte in einer öffentlichen Abstimmung die Fortführung des Streiks. Wutentbrannt verließen die Arbeiterinnen das Streikzelt und beschimpften die Verhandlungsführer als Streikbrecher. Bei der Urabstimmung fiel das miserable Verhandlungsergebnis dann auch durch: Zwei Drittel der Belegschaft votierten dagegen, ein Drittel dafür. Doch das deutsche Streikrecht ist eine ausgeklügelte Technik des sozialen Friedens: Während ein Streik nur mit 75 Prozent Zustimmung begonnen werden darf, reichen 25 Prozent Zustimmung, um ihn zu beenden. Die Mehrheit der Arbeiter war gegen das Ende des Streiks, aber juristisch betrachtet hatten IG Metall und Unternehmensleitung ihr Ziel erreicht. Für kurze Zeit schien alles möglich, zwischen den Arbeiterinnen und ihren Repräsentanten hatte sich eine Kluft aufgetan, die nur mühsam wieder geschlossen werden konnte.Nach zwei Tagen Ungewissheit wurde der Streik auf einer Versammlung endgültig begraben. Der Betriebsratsvorsitzende Güngor Demirici machte den verständnisvollen demokratischen Moderator; er hatte offensichtlich die Hosen voll und erklärte vor etwa 200 Arbeiterinnen und Arbeitern gebetsmühlenartig, jetzt könne man ja „miteinander reden“. Und tatsächlich: Er redete wie ein Wasserfall – nur die Gegner des Streikabbruchs blieben stumm, abgesehen von einigen Zwischenrufen. Die Versammlung wurde beendet und der Streik war erledigt. Wilde Streiks und Fabrikbesetzungen sind in Deutschland ungewöhnlich und nicht unriskant. Es wäre dreist, den BSH-Arbeitern vorzuhalten, dass sie diesen Schritt nicht gemacht haben – zumal wenn man selbst nur Unterstützer des Streiks ist, der nichts riskiert. Aber es war bitter zu sehen, wie eine Belegschaft, die sich noch kurz zuvor gegen die Gewerkschaft aufgelehnt hatte, plötzlich, als es ernst wurde, ratlos und sprachlos da stand. Der kurze Moment des Aufruhrs war verstrichen und die Macht des Gewerkschaftsapparates und die Angst vor dem Existenzverlust erdrückten alles Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.
Vom Kampf gegen Betriebsschließungen zur Kritik des Lohnsystems?
Das Ende des Streiks bei BSH hat wieder einmal gezeigt, dass die Drohung der Produktionsverlagerung ein wirksames Mittel ist, um Lohnkosten zu senken und Kündigungen in großem Umfang durchzusetzen. Die sich zur Wehr setzenden Arbeiterinnen und Arbeiter sind in der Defensive, und sogar die traditionellen gewerkschaftlichen Forderungen nach Lohnerhöhung oder besseren Arbeitsbedingungen bleiben in der allgemeinen Stimmung des Durchpeitschens sozialer Angriffe immer öfter auf der Strecke. Die Ausgangslage für Arbeitskämpfe scheint sich verschlechtert zu haben, und die Gewerkschaften geben sich mittlerweile meist schon mit dem bloßen Standorterhalt zufrieden. Entsprechend feiert die IG Metall den ausgehandelten Kompromiss bei BSH als einen Sieg: „Wichtigstes Ziel erreicht: Arbeit und Produktion bleiben erhalten!“ Die BSH-Arbeiter fühlen sich zu Recht verarscht, denn ihnen ging es um den Erhalt aller Arbeitsplätze, und die Gewerkschaft hat den Kampf genau in dem Moment sabotiert, als er an Schwung gewann. Keine Frage: Solche Streiks gegen Betriebsschließungen stellen die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht in Frage. Aber sie beschneiden die Freiheit des Kapitals, nach Belieben hier ein Werk dicht und dort eines mit billigeren Arbeitern aufzumachen. Moralische Empörung darüber ist lächerlich. Das Kapital kennt keine andere Logik als die, aus einem Euro zwei zu machen. Es lebt von der Konkurrenz unter den Arbeitern. Mit dem Marsch der Solidarität hat die BSH-Belegschaft begonnen, diese Konkurrenz zu überwinden. Wenn die Arbeiterinnen anfangen sich auszutauschen und feststellen, dass alle in der gleichen Situation stecken, sie ständig damit bedroht sind, ausrangiert und auf Hartz IV gesetzt zu werden, dann ist immerhin ein Anfang gemacht. Aber es kann nicht um eine Bewegung für den Erhalt von Arbeitsplätzen gehen. Die ständige Unsicherheit und die Erpressung durch die Unternehmen sind zwingende Folgen des Lohnsystems, also einer Gesellschaft, in der wir unsere knappe Lebenszeit verkaufen müssen, um überleben zu können. In der wir nicht darüber bestimmen können, was und wie produziert wird. In der Arbeiter darum kämpfen, weiterhin 40 Stunden die Woche in einer beschissenen Fabrik arbeiten zu dürfen, weil ihnen andernfalls der soziale Abstieg droht. Aus diesem Elend könnte nur eine Bewegung für die Vergesellschaftung der Produktion herausführen, die mit der Lohnarbeit Schluss macht. Nur dann wäre die weltweit steigende Produktivität auch nicht länger eine Bedrohung, die Angst um die eigene Existenz auslöst, sondern die Grundlage für ein von der Schufterei befreites Leben. Die Abschaffung der Lohnarbeit ist nichts, was sich eine einzelne Belegschaft auf die Fahnen schreiben könnte. Sie wird erst zur praktischen Möglichkeit, wenn die soziale Krise eine breite Bewegung auf den Plan ruft. Der Kampf der BSH-Arbeiter hätte der Anfang einer solchen Bewegung werden können. Mit ihrer Sabotage des Streiks hat die Gewerkschaft in aller Deutlichkeit gezeigt, dass sie daran kein Interesse hat. Zukünftige Auseinandersetzungen werden sich nicht zuletzt daran entscheiden, ob die Arbeiterinnen und Arbeiter die Konsequenzen daraus ziehen und ihre Angelegenheiten in die eigenen Hände nehmen. freundinnen und freunde der klassenlosen gesellschaft, Dezember 2006
„Es muss sich in dieser Scheiß-Republik was bewegen!“
Interview mit einem Schicht-Arbeiter, seit rund 20 Jahren bei BSH Berlin.
Wie ist nach dem Streik die Stimmung im Werk? Vergiftet und demoralisiert. Es besteht allgemein Wut auf den Gesamtbetriebsrat und die IG Metall. Die Kolleginnen und Kollegen fühlen sich von der Gewerkschaft verraten. Ich persönlich vermeide heute den Kontakt zum Betriebsrat, mit einer Ausnahme. Auch mit den Kollegen, die sich als Streikbrecher entpuppt haben, will ich keinen Kontakt haben. Vierzehn Tage vor Beginn des Streiks ist noch eine erstaunlich hohe Anzahl von Kollegen in die IG Metall eingetreten. Die haben teilweise ein höheres Streikgeld bekommen als Leute die seit über 20 Jahren einbezahlt haben, da sie einen höheren Monatssatz abdrückten. Für die Zukunft müsste man sich überlegen, ob man es zulässt, dass kurzfristig Leute in die Gewerkschaft eintreten. Außerdem waren das vor allem Leute, die sich an den vorherigen Auseinandersetzungen nie beteiligt und auch sonst sehr unsolidarisch verhalten haben. Meine Vermutung ist, dass ihnen unter der Hand ein Angebot der Übernahme unterbreitet wurde, was dazu geführt hat, dass besonders diese Gruppe von Kolleginnen und Kollegen bei der Urabstimmung für die Beendigung des Streiks gestimmt und dies auch öffentlich erklärt hat. Ich persönlich möchte mit diesen Leuten nichts zu tun haben, weil ich der Meinung bin, dass man mit Streikbrechern und Mobbern keine Diskussionen führen sollte.
Diskutiert ihr gemeinsam über eure Zukunft oder regelt das jeder für sich alleine? Und gibt es Tendenzen im Werk, sich die Abfindung zu schnappen und damit endlich eine Möglichkeit zu haben, dem grauen Fabrikalltag zu entfliehen?
Die Auseinandersetzung um die Abfindungen und die Zukunft der Kollegen ist keine berufliche, sondern eine existenzielle Frage. Die meisten Kollegen wollen kündigen und sich mit einer guten Abfindung aus dem Werk verabschieden. Denn ein Großteil der Leute sieht für sich keine Zukunft mehr bei BSH Berlin. Neue Investitionen in das Werk sind nicht vorgesehen, dafür gehen viele Aufträge an das Werk in Nauen, nach Polen und in die Türkei. Es ist momentan noch total unklar, wer gekündigt und wer übernommen werden soll. Der Krankenstand im Berliner Werk ist dementsprechend hoch. Die Kollegen haben keine Energie mehr für einen erneuten Arbeitskampf. Deshalb wird es wahrscheinlich viel mehr Kollegen geben, die freiwillig kündigen wollen, als im Verhandlungsergebnis vereinbart wurde. Ich schätze die Zahl auf etwa 400 Leute, aber es soll ja nur für 216 Kollegen aus dem Siemens-Fonds eine Abfindung gezahlt werden. In diesem Fonds sind 23 bis 25 Millionen Euro, pro Person macht das eine Abfindungssumme von etwa 90.000 Euro brutto – verdammt wenig für Leute die teilweise 20 oder 25 Jahre hier arbeiten! Es ist übrigens kaum bekannt, dass Siemens die Abfindungen nicht allein aus eigener Tasche bezahlt, sondern dafür durch das deutsche Steuerabschreibungsrecht auch staatlich bezuschusst wird. Einerseits wollen die Leute gehen, andererseits haben sie aber auch Angst davor, da das Geld wahrscheinlich nicht reichen wird. Diese Entwicklung ist brisant und kann zu einem neuen Konflikt nach der Verkündigung des Ergebnisses der Sozialtarifverhandlungen führen. Versucht die Konzernzentrale, oder auch die Gewerkschaft, unliebsame Kollegen auszusortieren?Ich persönlich rechne damit gekündigt zu werden. Es ist ziemlich sicher, dass die Personalabteilung eine so genannte Schwarze Liste mit unliebsamen Kolleginnen und Kollegen führt, die sich schon vor oder während des Streiks engagiert und gestört haben.
„Im Streik wurden die ethnischen Trennungen überwunden“
Täuschte unser Eindruck, dass die Belegschaft stark nach Nationalitäten und Geschlecht gespalten ist? Und wurden diese Trennungen während des Streiks aufgebrochen?
Bis zum Streik gab es sehr strikte Trennungen zwischen den verschiedenen Gruppen. Dabei spielten hohe Sprachbarrieren eine große Rolle, besonders bei den asiatischen und türkischen Kolleginnen und Kollegen. Vor allem zum vorwiegend aus türkischen Kollegen zusammengesetzten Betriebsrat blieben die anderen Nationalitätengruppen auf Distanz, da dieser nur seine eigenen Leute informierte. Die Konzernführung übte in der Vergangenheit systematisch Druck auf die verschiedenen Gruppen – vor allem auf die Frauen – aus und hat gezielt Gerüchte gestreut und damit die Unterteilung in ethnische Gruppen gestützt. Die türkischen Frauen wendeten sich ab, sobald ein Deutscher in ihre Nähe kam. Während des Streiks hat sich die Beziehung allerdings sehr verbessert, es gab viele persönliche Gespräche und gegenseitige Unterstützung. Vor allem beim Solidaritäts-Marsch spielten ethnische Zugehörigkeiten keine Rolle mehr. Am Streik, wie auch an einer spontanen Demo, haben sich türkische Frauen stark beteiligt. Der Druck gegenüber Frauen im Werk ist stark und sie sind in den letzten Jahren massiv zusammengestrichen worden, aber die Streikbereitschaft der Verbliebenen war sehr hoch.
Habt ihr euch nach Ausbruch des Streiks neu zusammengefunden oder liefen die Diskussionen weitestgehend in den schon vorher vorhandenen Grüppchen ab?
Meine persönlichen Kontakte zu anderen Kolleginnen und Kollegen haben sich seit dem Streik vermehrt, es werden auch mehr persönliche Gespräche geführt. Es kommen viele Kollegen mit ihren Problemen zu mir, auch türkische, polnische, afrikanische und vietnamesische. Es handelt sich dabei aber eher um individuelle Kontakte, es haben sich meines Wissens keine neuen Gruppen gebildet. Die Kommunikation lief und läuft dabei mehr über meine Person als untereinander ab. Meine guten Kontakte haben vor dem Streik dazu geführt, dass der Betriebsrat versucht hat, mich in die Streikvorbereitungen einzubinden und als Vermittler zwischen ihm und der Belegschaft einzusetzen, nachdem er es bis zum letzten Moment unterlassen hat, die Kostensenkungs- und Standortschließungspläne der Unternehmensleitung der Belegschaft mitzuteilen. Der Betriebsrat war eigentlich ohnehin nicht gut auf mich zu sprechen und hatte in der Vergangenheit bereits versucht, mir ein Redeverbot auf den Vollversammlungen zu erteilen.
„Die Informationsveranstaltung über Hartz IV war der Wendepunkt“
Was ist auf den über zwei Wochen dauernden Betriebsversammlungen passiert?Zunächst fanden Informationsveranstaltungen statt. Zum Beispiel hat jemand vom Finanzamt erklärt, dass ein Drittel der Abfindung an den Staat geht und man dies Geld zusätzlich einfordern muss. Als nächstes kam jemand von einem Schöneberger Stadtteil-Laden und hat uns über Hartz IV informiert, zum Beispiel darüber, dass unsere Abfindung zu 60 Prozent aufgebraucht sein muss, bevor wir ein Anrecht auf ALG II haben. Diese Informationsveranstaltung war der Wendepunkt. In diesem Moment haben alle realisiert, was ihnen blüht, wenn sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Alle waren bestürzt, und man hätte eine Nadel fallen hören können, nachdem der Referent seinen Vortrag beendet hatte. Eine Kollegin musste sich übergeben und Kerlen standen die Tränen in den Augen. Den meisten war nun klar geworden, dass sie für ihren Job kämpfen müssen. Und das wurde dann auch in der anschließenden Debatte so diskutiert. Es gab zwar auf den Betriebsversammlungen eine breite Redebeteiligung, auch von den Frauen, aber erst nach dem Hartz IV-Vortrag wurde so etwas wie Kampfgeist unter den Kollegen deutlich, den die IG Metall ja auch unterstützt hat. Bis zum Verhandlungsabschluss nach dem Streik hatten die Kollegen u. a. deshalb auch hundertprozentiges Vertrauen zur Gewerkschaft!Es war auf den Betriebsversammlungen auch klar, dass die Unternehmensleitung über ein Mikrofon zuhört, das in der Mitte des Raumes an der Decke hing. Mit der Behauptung, zu Beginn des Streikes anonyme Drohbriefe bekommen zu haben, versuchte die Unternehmensleitung die Belegschaft zu kriminalisieren und kam sogar mit Leuten vom Wachschutz in die Versammlung. Das machte aber überhaupt keinen guten Eindruck auf die Kollegen, die den Abzug des Wachschutzes durchsetzten. Die Unternehmensleitung hat sich dann auch nicht mehr blicken lassen, aber es war klar: Wir lassen uns nicht kriminalisieren! Und deshalb konnten die ruhig hören, was wir in den Versammlungen zu besprechen hatten. Wie ist die Idee für den Solidaritätsmarsch entstanden?Die Idee hatte ein Kollege auf der fortlaufenden Betriebsversammlung geäußert, die Gewerkschaft hat sich eher drangehängt. Es war anfänglich völlig unklar, wie viele sich an dem Marsch beteiligen würden und ich war eher skeptisch, ob er zustande kommt. Letztendlich waren dann aber etwa 50 Leute kontinuierlich mit dabei, an manchen Orten kamen noch weitere aus Berlin hinzu und wir haben gut 4500 km zurückgelegt.Bevor es los ging hatten wir riesengroßen Schiss, überhaupt auf die Öffentlichkeit zuzugehen, aber mit der Zeit legte sich das. Der Marsch war von Anfang an mit der Idee verbunden, eine soziale Bewegung in Gang zu bringen. Wir haben die Öffentlichkeit über die Situation bei BSH und die Konzern-Politik informiert, zum Beispiel darüber, dass die Verluste, von denen geredet wird, oft nur bedeuten, dass dem Unternehmen zusätzlicher Gewinn entgangen ist. Wir haben auch Kolleginnen und Kollegen aus anderen Werken besucht, auch von Konkurrenzunternehmen wie zum Beispiel Miele. Ein Arbeiter von CNH hatte uns auf einer der Betriebsversammlungen darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig die mediale Öffentlichkeit für die Vermittlung des eigenen Anliegens ist.
„Der Solidaritätsmarsch sollte eine soziale Bewegung in Gang bringen“
Welche Erfahrungen habt ihr auf dem Marsch gemacht?Die erste Station unseres Marsches war unser Schwesterwerk in Nauen. Dort haben wir die Zufahrten blockiert und versucht, mit den Beschäftigten ins Gespräch zu kommen. Wir wollten sie unbedingt bei unserem Protest dabeihaben, aber es war sehr schwierig an sie heranzukommen. Ich habe noch nie so viele verängstigte und eingeschüchterte Gesichter gesehen und wir haben es leider bis zum Ende nicht geschafft, dass sie sich mit uns solidarisieren. Man muss allerdings bedenken, dass die Arbeitsplatzsituation in Nauen noch viel schlimmer ist als in Berlin. Viele von ihnen haben Zeitverträge, verdienen weniger, obwohl sie im Vergleich zu anderen mehr arbeiten müssen, und waren verunsichert ohne Ende.Ziemlich krass war auch, dass einige Kollegen aus unserem Werk dort als Streikbrecher weiter arbeiteten. Sie quetschten ihre Gesichter an die Decke des Busses, als sie an uns vorbeifuhren, um sich zu verstecken. Das war einfach nur lächerlich und ich habe große Verachtung für diese Leute. Im Nauener Werk sind sie übrigens nicht gut angesehen - allerdings nicht, weil sie Streikbrecher sind, sondern weil sie zu dem bei uns gültigen Tariflohn arbeiten und damit mehr verdienen. Das Werk in Nauen ist zwar nicht mehr im Tarifverbund, dafür gilt der Fortbestand des Werkes aber zunächst als sicher.Ein besonderes Gänsehauterlebnis hatte ich in Kamp Lintfort. Dort haben wir uns mit den Kollegen von BenQ getroffen und eine Demo durch die Innenstadt gemacht. Es beteiligten sich 4000 bis 5000 Leute, die städtische Feuerwehr, Stahlkocher, Kindergärten, kirchliche Gruppen... eigentlich war der ganze Ort auf den Beinen.Wir haben noch viele weitere Fabriken und Städte besucht, mit den Leuten vor Ort über unsere Situation diskutiert, aber auch die Politik der großen Konzerne thematisiert. Vor allem junge Leute zwischen 20 und 35 Jahren, die ja vor allem in befristeten Verträgen stecken, waren für unsere Ideen sehr empfänglich. Unsere Forderungen waren: Keine Entlassungen, kein Arbeitsplatzabbau aus Profitgründen und die Schaffung neuer Ausbildungsplätze.Uns war wichtig, dass dies keine rein betriebliche Auseinandersetzung ist, sondern eine politische. Wir haben anderen Kollegen angeboten, ihnen zu Hilfe zu kommen und es zu einer Angelegenheit aller Beschäftigten zu machen, wenn ihr Werk von Verlagerung bedroht ist und geschlossen werden soll. Überall wurde uns zugesagt, zu der großen Kundgebung vor der Siemens-Zentrale in München zu kommen, die dann 24 Stunden vorher von der IG Metall-Führung abgesagt wurde. War der Marsch eher eine Gewerkschaftsveranstaltung oder habt ihr eigene Ziele und Forderungen entwickelt?Der IG Metall ist der Marsch langsam aus den Händen geglitten, und deshalb hat sie einfach einen Rückzieher gemacht. Stuttgart war in dieser Hinsicht ein Wendepunkt. Hier, wie auch in Kamp Lintfort und Dillingen, haben wir angefangen, eigene Kontakte zu Betriebsräten zu knüpfen und unsere Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Wir haben gemerkt, dass wir wesentlich besser bei den Leuten ankommen, wenn wir unsere eigenen Inhalte vertreten. Die Flugblätter, die wir von der IG Metall zum Verteilen in die Hände gedrückt bekamen, haben nicht das vermittelt, um was es uns ging.Dafür bildeten wir eine Kreativgruppe, an der sich sieben bis acht Leute beteiligten. Wir haben eigene Flugblätter geschrieben, neue Buttons entworfen, mit denen wir dann die IG Metall-Logos überklebt haben, und selbst Transparente gemalt. Unsere Flugblätter mussten wir selbst finanzieren, und so kam auch die grundsätzliche Frage auf, welche Möglichkeiten der Eigenfinanzierung von Selbstorganisierung bestehen. Viele Kollegen waren auf jeden Fall bereit, auf einen Monatslohn zu verzichten.Ein weiteres Problem war unser Streikleiter, der gleichzeitig Schichtleiter im Betrieb war. Er wurde von der IG Metall-Führung eingesetzt und hat, wie wir später erfahren haben, falsche Infos über unseren Protest nach Berlin weitergegeben. Der Streikleiter hat auch eingefordert, alle Reden zu halten, wir haben dann aber einen Wechsel durchgesetzt. Wir wurden im Verlauf unserer Reise immer selbstbewusster, standen nicht mehr als Horde rum, sondern haben verschiedene Trupps mit fünf bis acht Leuten gebildet. Wir haben uns über die ganze Stadt verteilt und allmählich unsere Macht gespürt. Die Chefs hatten schon Angst vor uns und beschäftigten sich intensiv mit unserem Protest. Das wurde uns in einem Gespräch mit dem Bosch-Chef klar, der eine Delegation in seinem Zimmer empfing und den Kollegen klar machte, dass er unsere Aktionen und T-Shirts mit den Aufschriften „Wir machen die Plattmacher platt“ nicht gut fände und sie aufforderte: „Beenden Sie das sofort“. Die Unternehmensleitung von Siemens hatte noch mehr Schiss. Sie gerieten unter Druck und standen auch in der Presse ziemlich schlecht da, unter anderem wegen der geplanten Erhöhung der Managergehälter um 30% und der Schmiergelder, die bei BenQ gezahlt wurden. Wann habt ihr von dem beschissenen Abschluss und der Absage der Kundgebung in München durch die IG Metall erfahren? Wir waren gerade in Ulm, als uns der dortige Jugendgewerkschaftssekretär frühmorgens darüber informierte, dass alles abgeblasen sei. Wir wollten eigentlich gerade weiter fahren und waren völlig überrascht. Später gab es dann noch einen Anruf aus Berlin, der uns noch mal bestätigte, dass es zu einem Abschluss kam und alle Proteste beendet seien. Nach einigen Telefonaten hin und her packten wir unsere Sachen und traten die Heimreise an. Gab es Überlegungen, die Kundgebung auf eigene Faust durchzuziehen?Wir kamen auf der Rückfahrt immer näher an München ran und fingen an zu diskutieren, was wir jetzt machen sollen. Ab auf die nächste Raststätte und uns Bier besorgen oder doch einfach nach München fahren? Wir waren aber völlig führungslos und die Stimmung im Bus war auch nicht eindeutig für eine Weiterfahrt auf eigene Faust. Die Enttäuschung war riesengroß und wir haben uns dann für die nächste Raststätte entschieden...Wir wollten unbedingt nach München, mit den anderen Arbeitern zusammen kämpfen und haben auch schon über weitere Schritte nachgedacht.Immerhin hatte der IG Metall-Sekretär Luis Sergio zu Beginn des Marsches noch verkündet: „In München lassen wir die Puppen tanzen!“, und dann sagt die Gewerkschaft in letzter Minute alles ab. Das war das Ende eines Traums! Wir sind von der IG Metall, der wir zu 100 % vertraut haben, vollkommen benutzt und verarscht worden. Es muss endlich eine soziale Bewegung her, damit sich in dieser Scheiß-Republik was bewegt, damit der lohnabhängige Arbeiter bei Entlassung nicht nur die Alternative Arbeitsamt und Hartz IV hat, sondern gegen seinen möglichen Arbeitsplatzverlust und sozialen Abstieg kämpfen und streiken darf!
Im Berliner Werk hat das Verhandlungsergebnis zu Tumulten geführt, die Mehrheit der Belegschaft hat sich gegen die Gewerkschaftsvertreter aufgelehnt.
Wir sind zurückgekommen, als die Tumulte schon im Gange waren. Die ruhigsten Leute waren auf einmal am Schreien. Wir hätten nie für möglich gehalten, dass die IG Metall uns so verarschen könnte. Aber nachdem die IG Metall kurzfristig die Kontrolle über den Streik verloren hatte, konnte sie wie auch die Unternehmensleitung den ausgehandelten Kompromiss in der Öffentlichkeit als ihren Sieg verkaufen.
"Unser Fehler war, der Gewerkschaft zu vertrauen"
Woran lag das? Unser Eindruck war, dass die „guten“ Führer beklatscht und die „schlechten“ ausgebuht wurden, aber jede Vorstellung davon fehlte, das Heft des Handelns in die eigenen Hände zu nehmen.
Die Kollegen bei BSH sind nicht streikerprobt gewesen, denn auch bei den vorherigen Kündigungswellen hat es keinen Streik gegeben! Es gab somit auch keine konkrete Planung für eine selbstorganisierte Versammlung, und es herrschte Angst davor eine einzuberufen, da der Kollege, der es machen sollte, akut von Kündigung bedroht gewesen wäre. Immerhin hätte nicht nur die Unternehmensleitung gegen die Belegschaft gestanden, sondern auch der IG Metall-Vorstand und der Betriebsrat hätten gegen eine eigenständige Weiterführung des Streiks agiert. In den Betriebsratsvorsitzenden Demirci fehlte das Vertrauen. Somit herrschte eine gewisse Führungslosigkeit unter den kampfbereiten Arbeitern. Es hätte aber sowieso einer doppelten Führung während des Streiks bedurft: Am besten wären zwei Streikführer, die sich nicht leiden können, um Kungeleien zu verhindern. Aber es war auch die Angst vor dem Verlust der Abfindung, die die Kampfbereitschaft verringerte. Denn es gab Überlegungen weiter zu machen und das Werk zu besetzen, aber dies hätte zur Folge haben können, dass man alles verliert. Welche Lehren könnte man aus dem Streik ziehen? Was hätte anders laufen können?Mir ist klar geworden, dass man sich nicht auf die Gewerkschaft verlassen darf, und dass man Mut zu kritischen Fragen auf den Betriebsversammlungen haben muss. Wichtig ist außerdem, sich nicht einschüchtern zu lassen. Man muss auch die Kontakte selber knüpfen und darauf achten, dass Informationen nicht monopolisiert werden. Ein Fehler war sicherlich, dass wir hundertprozentig der IG Metall vertraut haben. Aber was hätten wir denn auch ohne Führung ausrichten können? Was wäre gewesen, wenn wir, was auch diskutiert wurde, mit 200, vielleicht 300 Leuten ohne Rückhalt der Gewerkschaft das Werk besetzt hätten? Wir waren auf das Streikgeld angewiesen und hatten außerdem durch die Pressemitteilungen der IG Metall nach der Urabstimmung den Rückhalt in der Öffentlichkeit verloren. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass das Streikrecht dahingehend geändert werden muss, dass die einfache Mehrheit für eine Weiterführung des Streiks reicht. Was rätst Du Kollegen, die durch angedrohte Betriebsschließungen in eine ähnliche Situation geraten?Das wichtigste ist die Solidarität. Man muss auf jeden Fall andere Betriebe aufsuchen und sie um Hilfe bitten. Ein weiterer Vorschlag wäre, Betriebsversammlungen im Werk zu veranstalten, zu denen man Beschäftigte aus allen anderen Betrieben einlädt, um zusammen die weiteren Schritte zu diskutieren.Und selbstverständlich das Erstellen von Infoblättern, in denen man klarstellt, worum es geht und was man eigentlich will, am besten auch zweisprachig, was wir leider nicht hingekriegt haben. Die Forderungen sollte man als existenziell Betroffene aufstellen, die eigenen Probleme selbst darstellen und sich nicht auf höhere Instanzen verlassen.Es ist wichtig eigene Netzwerke aufzubauen und die Leute dazu zu bringen, dass sie das Thema Fabrik-Verlagerungen und die Bedeutung des Arbeitsplatzverlustes an ihren Schulen und in den Familien diskutieren. Als persönlichen Erfolg würde ich verbuchen, dass an einer Berliner Schule ein selbstgeschriebenes Flugblatt zur Grundlage genommen wurde, um über Standortverlagerungen von Betrieben zu diskutieren. Wie ist heute Dein Verhältnis zur Gewerkschaft?Ich bin immer noch Mitglied der IG Metall, obwohl ich von ihr sehr enttäuscht bin. Ich möchte bei zukünftigen IG Metall-Versammlungen sprechen und erzählen, wie sie uns in den Rücken gefallen ist – und dafür muss ich weiterhin Mitglied der Gewerkschaft sein.
Gibt es noch Kontakte zu Leuten die ihr auf eurer Reise kennen gelernt habt? Und wie haben sie auf die Absage der Großkundgebung reagiert?
Vereinzelt gibt es noch Kontakte. Andere wiederum habe ich mehrmals angerufen, aber es kam keine Rückmeldung mehr. Ich habe den Eindruck, dass sich die Kollegen vor allem von BenQ von uns im Stich gelassen fühlen. Ich wehre mich allerdings dagegen ein Verräter zu sein. Der Abbruch der Protestaktionen wurde uns vom IG Metall-Vorstand aufgezwungen.
Wie haben die Streikenden die Unterstützung durch linke Gruppen aufgenommen?Ich habe mich sehr über die Unterstützung dieser Gruppen gefreut und die übergroße Mehrheit der Belegschaft sieht das genauso. Wir fragen nicht nach Parteibuch, Religion usw. und ohne diese Gruppen wären wir ein einsamer Haufen geblieben. Sie haben uns teilweise mit wertvollen Informationen versorgt und besonders hilfreich war es, wenn sie Kontakte zu Kollegen aus anderen Werken herstellten oder uns bestimmte Printmedien zur Verfügung stellten. Ohne diese Gruppen hätten wir auf jeden Fall weniger Wirkung gehabt. Wie stellst Du Dir Deine persönliche Zukunft vor? Nicht besonders rosig . Ich nehme wohl die Abfindung plus Übernahme in die Transfergesellschaft und hoffe, einen anderen Job zu kriegen. Mal sehen was kommt. Für mich ist jedenfalls nach dem Kampf vor dem Kampf! Das Interview wurde Mitte November 2006 geführt.
Aktuelles und Laufendes:
- Arbeiterkampf [40]
Theoretische Fragen:
- Arbeiterklasse [58]
Erbe der kommunistischen Linke:
Dezember 2007
- 775 reads
Der Kampf der Bahnarbeiter hat das Potential zu einem Kampf mit Weichenstellung
- 2700 reads
Zunehmend wird deutlich, dass das Kapital an Grenzen stößt, die Arbeiterklasse mit den herkömmlichen Mitteln zu erpressen und und zu disziplinieren. Der drohende Zeigefinger der ökonomischen Krise, die Argumentation mit der Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen auf dem Weltmarkt, verliert seine Integrationsfähigkeit, mit der sich die Belegschaften hinter die Rezepte ihres Managements und der politische Bourgeoisie einreihen.
Der nachfolgende Text wurde uns als Stellungnahme zum Eisenbahnerstreik zugeschickt. Da wir mit den Hauptaussagen übereinstimmen, veröffentlichen wir ihn hier nachfolgend. IKS
Zunehmend wird deutlich, dass das Kapital an Grenzen stößt, die Arbeiterklasse mit den herkömmlichen Mitteln zu erpressen und und zu disziplinieren. Der drohende Zeigefinger der ökonomischen Krise, die Argumentation mit der Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen auf dem Weltmarkt, verliert seine Integrationsfähigkeit, mit der sich die Belegschaften hinter die Rezepte ihres Managements und der politische Bourgeoisie einreihen. Die ritualisierten Tarifverhandlungen reichen immer weniger aus um das gestörte Gerechtigkeitsempfinden und die materielle Unzufriedenheit der Werktätigen zu dämpfen. Das Gefühl einen Arbeitsplatz zu haben und ihn mittels Schulterschluss mit der Geschäftsleitung gegen die Marktkonkurrenten zu verteidigen, weicht immer mehr der Erkenntnis, dass man vorgeführt wird. War man durchaus massenhaft bereit reale Einkommensverluste und Ausdehnung unbezahlter Arbeit zur Sicherung des eigenen Arbeitsplatzes hin zu nehmen, und schenkte der Propaganda der politischen Bourgeoisie glauben, beweist die Realität der Werktätigen das genaue Gegenteil und es macht sich die Erkenntnis breit, das Glauben-Warten-Hoffen zu einer immer größeren Verschlechterung der eigenen Situation führt. Die durchaus realen und steigenden Unternehmensprofite sind nicht Ausdruck wachsender Prosperität der Warenproduktion in ihrer Gesamtheit, sondern vor allem durch massive Ausdehnung der unbezahlten Arbeit, Lohnverzicht und Verfügbarkeit für die Unternehmensinteressen erzielt.
Die steigenden Unternehmensprofite erhöhen eben nicht den Wohlstand der Werktätigen, sondern fördern lediglich die weitere Forcierung der nationalen und weltweiten Konkurrenzsituation unter den Lohnabhängigen selber. Das die wachsenden Profite der Konzerne auch gar nicht dafür vorgesehen sind, den allgemeinen Wohlstand der Arbeiterschaft zu erhöhen, sondern lediglich dazu dienen in der Konkurrenzwirtschaft die Ausgangsposition für die eigene Akkumulation zu erhöhen, beweist sich durch die permanenten Mahnungen seitens des Staates und des Kapital, das zarte Pflänzchen ihres Aufschwungs nicht durch überzogene Lohnforderungen zu zerstören.
Die Profite von heute sind eben die Investitionen von morgen.
Genau so argumentieren die Vertreter der Bahn AG. Stolz erklären sie uns ihre Sanierungserfolge der Vergangenheit, um gleichzeitig mahnend an zu heben, welche überlebensnotwendigen, riesigen Investitionssummen im internationalen Konkurrenzkampf, unmittelbar auf sie zu kommt und begründet so die Unverantwortlichkeit der Forderungen der Bahnarbeiter, nach mehr Lohn und Verkürzung der Arbeitszeit, die über die GDL in den Spielregeln des bürgerlichen Tarifkonflikts transformiert werden.
Kapital benötigt eben mehr Kapital um den nächsten Akkumaltionszyklus zu finanzieren.
Die Bahn AG ist nicht fähig das notwendige Investitionskapital für ihre strategischen Ziele aus der Unternehmenskasse zu finanzieren, sondern bedarf der Finanzierung durch Fremdkapital, das man aus einer Umwandlung in eine offenen AG erzielen möchte. Da Aktien Vorschusslorbeeren auf gelungene Geschäfte in der Zukunft sind, muss man bei den Investoren natürlich das Vertrauen in die Rentabilität ihrer Investition erzeugen. Dies funktioniert nur mit einer folgsamen und zugerichteten Belegschaft, die, die strategischen Ziele und Interessen der Geschäftsleitung verinnerlicht hat und bereit ist sich weiter zu opfern.
Das überraschende, bzw. das besondere an diesem Konflikt ist allerdings, wie wenig sich die Arbeiter auf die Argumentation und Szenarien der Unternehmensleitung ein und die Militanz eine konkrete Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen zu erkämpfen.
War die GDL bisher fähig das ganze als einen Konflikt für ihre Anerkennung
als eigenständiger Tarifpartner darzustellen und zu kanalisieren, wird im Verlaufe des Konflikts immer deutlicher, dass diese Forderung eigentlich ein Klotz am Bein der kämpferischen Arbeiter ist. Verhindert sie doch eine Solidarisierung unter der Gesamtbelegschaft der Bahn AG und der Werktätigen im Allgemeinen.
Die GDL fokussiert auf ihre Anerkennung als Tarifpartner mit der Argumention, dass die sparten übergreifenden Konkurrenzgewerkschaften des DGB nicht fähig oder willens sind, die Interessen der Lokführern in angemessenen Maße zu vertreten. Sei ihre Anerkennung als tariflicher Ansprechpartner erst einmal durchgesetzt, werde man die Verbesserung der Arbeitsbedingungen schon den richtigen Ausdruck verleihen können. Diese Argumentation ist ein trojanisches Pferd, das die Kampfbereitschaft der Arbeiter von innen angreift. Denn der Anerkennung der GDL als Tarifpartner werden die unmittelbare Verbesserung der Lebens.- und Arbeitsbedingungen der Bahnarbeiter geopfert und diese Forderungen dienen der GDL Führung lediglich als Druckmittel und Verhandlungsmasse und spaltet die die Gesamtinteressen der Arbeiter in Berufsgruppen auf.
Das Interesse der Arbeiter kann aber nicht eine weitere wie auch immer geartete Gewerkschaft sein, sondern eben nur eine wirkliche Verbesserung ihrer Arbeits.- und Lebensbedingungen. In der GDL sehen sie momentan nur das realistische Instrument zur Durchsetzung dafür.
Allerdings dient die GDL der Bourgeoisie als Kontrollinstrument des Arbeitskampfes, dass die Wut der Bahnarbeiter nicht auf andere Belegschaften überspringt und die Kämpfe sich spontan ausdehnen, oder gar einen internationalen Bezug auf die Situation in Frankreich erhalten.
Dieses Szenario ist nicht abwegig, wenn man die Gleichzeitigkeit des Kampfes der französischen Transportarbeiter und die direkten Folgen eines erfolgreichen Streiks bedenkt.
Der Erfolg des Streiks wäre nicht nur an den Prozenten der Lohnerhöhung zu messen, sondern dass er der Arbeiterschaft als gesamte Klasse eine kämpferische Perspektive eröffnet, die die gesamten Argumentationsketten der Bourgeoisie durchbricht und die autonomen Interessen der Arbeiterschaft als Klasse wieder in den Fokus der gesellschaftlichen Auseinandersetzung bringt.
Die Herrschenden verpacken dies zwar vorsorglich propagandistisch mit den negativen Folgen
auf die gesamtwirtschaftliche Situation und erklären die Streikenden schon mal im Voraus als Schuldige für die nächsten Angriffe auf unsere Lebensbedingungen, ihnen ist allerdings auch nur zu bewusst, dass die Bahnarbeiter nicht ohne Sympathie und unter genauster Beobachtung der gesamten Arbeiterklasse kämpfen.
Eine aktive Solidarisierung muss unter allen Umständen verhindert werden. Deswegen wird der politische Druck auf Tiefensee, Mehdorn und GDL wachsen am Verhandlungstisch rasch eine Lösung zu finden. Ob die Bahnarbeiter auf den Leim der GDL gehen und sich mit der Anerkennung der Gewerkschaft zufrieden geben, sich ihre Kampfkraft erschöpft und sie gedemütigt und geschlagen werden, oder einen neuen Zyklus des Kampfes einläuten, ist abhängig von der Solidarität und Unterstützung der gesamten Arbeiterschaft, die erkennen muss, dass dieser Konflikt weit über das Niveau der üblichen Tarifkonflikte hinausgeht.
Werden die Bahnarbeiter geschlagen, hat dies unmittelbare Auswirkungen auf uns alle. Denn dafür hat dieser Arbeitskampf schon viel zu große politische Kreise gezogen und an Gesamtbedeutung auf das Bewusstsein der Arbeiterklasse gewonnen.
Die Wechselwirkung der Solidarität unter der Arbeiterschaft ist der Kern dieses Konflikts und der wirkliche Gradmesser des Erfolgs. Hier zeigen sich auch die direkten Aufgaben der Kommunisten, genau dies zu unterstützen und von den Werktätigen einzufordern.
Bruno
Geographisch:
- Deutschland [36]
Aktuelles und Laufendes:
- Arbeiterkampf [40]
Krupp- Rheinhausen - vor 20 Jahren
- 2780 reads
Wir veröffentlichen nachfolgend einige Artikel, die wir in unserer Zeitung Weltrevolution vor 20 Jahren zum Kampf der Beschäftigten von Krupp-Rheinhausen (Duisburg) veröffentlichten. Lehren aus den Dezember-Kämpfen
Wir veröffentlichen nachfolgend einige Artikel, die wir in unserer Zeitung Weltrevolution vor 20 Jahren im Jan. 1988 zum Kampf der Beschäftigten von Krupp-Rheinhausen (Duisburg) veröffentlichten.
Lehren aus den Dezember-Kämpfen Solidarität muß zum Zusammenschluß der Kämpfe führen
Am 27. Nov. letzten Jahres brach der Kampf um Krupp-Rheinhausen aus. Zu einer Zeit, in der die Bourgeoisie massive Angriffe gegen die gesamte Arbeiterklasse vornimmt, wurden die Schließung des Duisburger Werkes von Krupp-Rheinhausen und die Entlassung von über 5.000 Arbeitern angekündigt. Diese Nachricht löste den massivsten Kampf aus, der seit den 1920er Jahren in Deutschland stattgefunden hat.. Die Arbeiter dehnen den Kampf aus Als die Entlassungen bekannt wurden, reagierten die Arbeiter sofort: sie legten die Arbeit nieder und riefen alle Arbeiter der Stadt zu einer Vollversammlung auf. Die Belegschaften von Thyssen und Mannesmann in Duisburg traten sofort in Solidaritätsstreiks. Somit wurde klar, daß die Entlassungen bei Krupp alle Arbeiter angehen, und daß vor allem im Ruhrgebiet die aktive Solidarität nicht ausbleiben durfte. Am 30.11. fand eine Vollversammlung mit 9.000 Arbeitern von Krupp und massiven Delegationen der anderen großen Fabriken in Duisburg statt. Die Versammlung rief zum gemeinsamen Kampf im Ruhrgebiet auf. Am 1.12. fanden in 14 Krupp-Werken im Bundesgebiet Demos und Vollversammlungen statt, an denen sich starke Delegationen aus Rheinhausen beteiligten. Am 3.12. demonstrierten 12.000 Schüler in Rheinhausen gegen die geplanten Entlassungen. Eine Delegation von Bergarbeitern forderte einen gemeinsamen Kampf von Berg- und Stahlarbeitern. Das gesamte Ruhrgebiet war mobilisiert und kampfbereit! Am 8.12. demonstriertem Bedienstete der Stadt Duisburg (über 10.000) in Rheinhausen, um ihre Solidarität zu bekunden. Die Gewerkschaften, die zunächst Schwierigkeiten hatten, diese Flut der Solidarität der Arbeiter einzudämmen. traten auf den Plan. Sie kündigten am 5.12. einen Aktionstag für den 10.12. an, an dem sich das ganze Ruhrgebiet beteiligen sollte. Ihr Ziel war es, die Kampfbewegung unter ihre Kontrolle zu bringen und sie somit scheitern zu lassen. Da der Solidaritätswille der Arbeiter nicht leicht zu brechen und die Notwendigkeit eines gemeinsamen Kampfes für alle Arbeiter klar war, mußten die Gewerkschaften diesen Drängen der Arbeiter zum Schein nachgeben, um der Bewegung so die Spitze zu brechen. Der Aktionstag sollte angeblich den Verkehr im Ruhrgebiet lahmlegen. Was geschah aber tatsächlich? Denn in Wirklichkeit bedeutete dies, daß die Arbeiter nicht gemeinsam und vereinigt demonstrierten, nicht in Massenversammlungen den weiteren Verlauf des Kampfes diskutieren konnten, sondern daß sie isoliert voneinander, über das ganze Ruhrgebiet zerstreut, in Gruppen zersplittert Straßen blockierten. Nach einigen Stunden dieser Aktion waren nur noch wenige Arbeiter an den Straßenkreuzungen von Duisburg anzutreffen. Die meisten waren mit einem miesen Gefühl nach Hause gegangen. Und dennoch hätte es ganz anders kommen können. An diesem Tag fand eine Vollversammlung um 7.30 Uhr bei Krupp statt, an der 3.000 Arbeiter teilnahmen. Um 10.00 Uhr fand eine weitere Vollversammlung der Thyssen-Arbeiter statt. Postbeschäftigte und Arbeiter aus Süddeutschland kamen nach Rheinhausen. 90.000 Stahlarbeiter standen im Kampf, gleichzeitig legten 100.000 Bergleute aus Solidarität für einige Stunden die Arbeit nieder. An verschiedenen Orten verließen die Arbeiter die Fabriken und demonstrierten wie z.B. bei Opel-Bochum. Das Ausmaß der Mobilisierung und der Kampfbereitschaft an diesem Tag hätte zu einer riesigen Machtdemonstration der Kraft der Arbeiterklasse werden können. Wenn all die mobilisierten Arbeiter nicht durch unendlich viele Straßenblockaden zerstreut voneinander gewesen, sondern geschlossen, zusammen auf die Straße gegangen wären, hätte die Kampfbewegung einen starken Impuls bekommen. Der 10.12. war der Höhepunkt des Kampfes um Rheinhausen, gleichzeitig aber zeigte er all die Schwächen des Kampfes auf, die die Gewerkschaften ausnutzen konnten, um den Kampf zu entschärfen. Am 11.12 kündigte Bonn die Entlassung von 30.000 Bergleuten an. Es kam aber nicht zu einem gemeinsamen Kampf von Berg- und Stahlarbeitern. Dafür hatte die IG-Bergbau gesorgt, die vor Solidaritätsaktionen gewarnt hatte mit den Vorwand, daß die Forderungen der Bergarbeiter dann untergehen würden, wenn sich die Bergleute mit den Stahlarbeitern solidarisierten.Die Gewerkschaften ließen dann eine Woche verstreichen, bevor eine erneute Massenaktion stattfand (18.12.)... ein Fackelzug mit anschließendem Gottesdienst. Sicherlich das beste Mittel, um die kämpferischsten Arbeiter fernzuhalten. In den nachfolgenden Wochen wurde klar, daß die Kampfbereitschaft der Kruppianer weiterhin sehr stark war, wie die spontane Reaktion in der Nacht des. 6. Januar aufzeigt, als die Arbeiter die Nachtschicht verließen und auf die Straße gingen, nachdem die Schließung von Rheinhausen als unvermeidlich angekündigt worden war. Dennoch ist die „aufsteigende Dynamik“ die der Kampf bis zum 10.12. aufwies, durch die Sabotagearbeit der Gewerkschaften gebrochen worden. Im neuen Jahr veranstalteten- die Gewerkschaften Aktionswochen in Form von sog. "Spaziergängen" mit Bus und Autos zu anderen Fabriken. Das ist eine Karikatur von dem, was die Arbeiter Anfang Dezember als eine Notwendigkeit spürten: die Ausdehnung und Vereinigung des Kampfes.Lehren aus dem Kampf – Nur die Vereinigung der Kämpfe kann die Angriffe zurückdrängenAls Anfang Dezember die Arbeiter in Rheinhausen den Kampf aufnahmen, dehnte er sich innerhalb von ein paar Tagen auf das ganze Ruhrgebiet aus. Heute hingegen "spazieren" die Krupp-Arbeiter von einem Betrieb zum anderen und erhalten schön klingende Solidaritätserklärungen der Betriebsräte dieser Betriebe. Es ist keine Rede mehr vom gemeinsamen Kampf. Das weiß auch die Bourgeoisie, die ihre Position verhärtet und die Schließung von Rheinhausen als unausweichlich erklärt. Die Frage muß also gestellt werden, was diese Wende herbeigeführt hat, wieso nach dem anfänglich so breiten Kampf letztendlich die Krupp-Arbeiter alleine zurückbleiben? Und die Lehre, die man ziehen muß, ist, daß Sympathiestreiks und Solidaritätsbekundungen zwar ein wichtiger Schritt sind, daß sie aber nicht ausreichen, um die Entlassungen und die Angriffe der Bourgeoisie zurückzudrängen. Die Solidarität muß zur Vereinigung der Kämpfe selber führen. Aber was heißt Vereinigung?Wenn die Arbeiter in Rheinhausen den Kampf gegen Entlassungen aufnehmen, dann sind ihr Kampf und ihre Forderungen grundsätzlich die gleichen wie in anderen Betrieben und Branchen. Die Bergleute werden wie die Stahlarbeiter von Massenentlassungen betroffen. Aber auch im öffentlichen Dienst werden die Angriffe stärker Haushaltskürzungen, Streichung von Krankenhausbetten, Privatisierungspläne bei der Post, Stellenstreichungen bei der Bahn...Die Solidarität mit Rheinhausen bedeutet den Kampf für die eigenen Forderungen aufnehmen. Grund genug dazu gibt es.Gerade für die Bergleute bestand kein Anlaß, sich zu verkriechen und sich zurückzuhalten, als die Stahlkocher zum gemeinsamen Kampf, zur Solidarität aufriefen. Denn wenn sich so wichtige Teile wie die Bergleute und die Stahlkocher zusammen in Bewegung setzen und gemeinsam ihr Gewicht in die Waagschale werfen, wenn sich bei; dieser Bewegung andere Beschäftigte anschließen, wie das Beschäftigte des öffentlichen Dienstes und Opel-Arbeiter ansatzweise taten, entsteht eine Sogwirkung, in der immer mehr Teile der Arbeiterklasse in Fluß geraten. Dann geraten die Kapitalisten und ihr Staat erst richtig unter Druck, und kein Teil der Arbeiterklasse steht dann mehr allein mit seinen Forderungen dem Kapital gegenüber. So haben die Bergleute im Dezember eine große Gelegenheit verpaßt, und es ist kein Zufall, daß just einen Tag nach dem 10.12., als der Zusammenschluß zwischen Bergbau und Stahl nicht hergestellt wurde, der Staat den Abbau von ca. 30.000 Arbeitsplätzen im Bergbau beschloß. Es liegt auf der Hand. Die besten Kampfmöglichkeiten bestehen dann, wenn andere Arbeiter schon in den Kampf getreten sind. Dann sind gemeinsames Auftreten, gemeinsame Demos, gemeinsame Vollversammlungen und Massendelegationen, gemeinsame Aktionen überhaupt einfacher durchzuführen. Aber um das zu erreichen, müssen sich die Arbeiter darüber bewußt werden, daß wenn heute die Arbeiter in einer Fabrik von Angriffen getroffen werden, sie selbst wenig später in die Schußlinie geraten werden. Deshalb: der Kampf der einen Arbeiter muß der Kampf der anderen Arbeiter werden!Und wenn es die Arbeiter irgendwo schaffen, die Angriffe des Kapitals zurückzudrängen, dann nur weil andere Arbeiter ebenfalls in den Kampf getreten sind. So können die Rheinhausener Arbeiter die Entlassungen nur abwehren, wenn das ganze Ruhrgebiet dahintersteht und mitkämpft.Die Krupp-Arbeiter haben durch ihren Kampf eine große Solidaritätswelle hervorgerufen Diese explosiven Reaktionen lassen darauf schließen, daß die aufsteigende Kampfbereitschaft immer größere Teile der Klasse zu neuen, heftigen Klassenauseinandersetzungen führen wird, In diesen werden die Arbeiter wieder den gleichen Schwierigkeiten und Spaltungstaktiken der Gewerkschaften gegenübertreten. Deshalb müssen sich bereits heute alle Arbeiter die Lehre zu Eigen machen, daß aktive Solidarität mehr als Sympathiebekundungen verlangt. Ja, nun muß selbst in den Kampf treten und versuchen, den Widerstand aller Arbeiter wirkungsvoll zusammenzuschließen, ihn zu "vernetzen", wie es von den Rheinhausener Arbeitern formuliert wurde. Dies heißt aber. daß sich die Arbeiter nicht mehr in den Fangnetzen der Gewerkschaften fangen lassen dürfen. Die Bestrebungen zum Zusammenschluß der Kämpfe können nur gegen den Widerstand, gegen die Sabotagetaktik der Gewerkschaften erfolgen. Und dies erfordert nichts anderes, als daß die Arbeiter selbst die Initiative in die Hand nehmen. Daß diese Perspektive keine Utopie, sondern eine reale Möglichkeit ist, beweist die Initiative von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, wie wir in dieser Zeitung zeigen.17.1.1988 Nat. (Weltrevolution Nr. 30, Jan-März 1988)
Die Intervention der IKS in den Kämpfen
In Weltrevolution Nr. 29 schrieben wir einen Artikel zum Klassenkampf in der BRD mit dem Titel: "Massive Kämpfe rücken näher". Wir zeigten anhand vieler Beispiele des Widerstands gegen die Flut der Angriffe auf allen Ebenen auf, wie in der BRD zunehmend das Potential für einen breiten Abwehrkampf der Arbeiter heranreift. Diese Einschätzung war Anlaß für die IKS, ein Flugblatt mit dem Titel: "Für bundesweite Aktionen aller Arbeiter gegen alle Angriffe" herauszugeben. Die Gleichzeitigkeit des Widerstands bei Stahl, Kohle und im öffentlichen Dienst bietet die Möglichkeit der massiven Ausdehnung und Vereinigung des Arbeiterkampfes. Demonstrationen und Versammlungen sind dazu besonders geeignete Mittel. "Entschlossene Arbeiter müssen jetzt schon dafür eintreten, bei Diskussionen, Versammlungen, Demonstrationen das Wort ergreifen, um sich für diese Perspektive des gemeinsamen Kampfes stark zu machen. Arbeiter verschiedener Betriebe und Branchen müssen direkten Kontakt zueinander aufnehmen, um den Zusammenschluß der Kämpfe in die Wege zu leiten" (17. Nov.'87). Im Rahmen ihrer Analyse der Lage in der BRD wurde die IKS vom Ausbruch des Kampfes der Krupp-Beschäftigten dessen Ausbreitung nicht überrascht. Das oben erwähnte Flugblatt wurde vor und während des 10. Dezembers an Fabriken im Ruhrgebiet und in Köln, die unterschiedlichen Branchen von Chemie und Automobil über öffentlichen Dienst, Maschinenbau bis zur Stahlindustrie angehören, verteilt. Der 10. Dezember 1987 konnte schon im voraus zumindest als der erste Höhepunkt dieser Kampfbewegung eingeschätzt werden - der Tag, an dem sich das Schicksal der weiteren Bewegung entscheiden sollte. Auf dem Spiel stand, ob es den Arbeitern gelingen würde, der Ausdehnung des Kampfes auf andere Betriebe Schritte näher zu kommen, oder ob die Gewerkschaften trotz der massenhaften Mobilisierung dcr Arbeiter die einzelnen Bereiche voneinander isolieren könnten. In dieser Lage konzentrierte sich unsere Intervention entsprechend unserer bescheidenen Kräfte auf Punkte, wo möglichst viele Arbeiter in Versammlungen zusammenkamen - die Kundgebung um 7 Uhr vor den Tor I von Krupp-Rheinhausen und die Belegschaftsversammlung bei Thyssen. Ziel war es, für massive Versammlungen bzw. Demonstrationen zu werben, auf denen die Arbeiter aus verschiedenen Branchen über die Fortführung des Kampfes debattieren und entscheiden könnten, und die Isolierungsstrategie der Gewerkschaften mit ihren Straßenblockaden als Falle zu entblößen. Tatsächlich hat das gewaltsame Eindringen der Rüttger-Arbeiter bei der Thyssen-Versammlung in Duisburg-Hamborn uns mit dieser Orientierung recht gegeben. Diese Arbeiter hatten nämlich den Werkschutz beiseite gedrängt, der nur den Zutritt von Thyssen-Arbeitern zulassen wollte. Dennoch blieben solche Vorstöße auf dem halben Weg stecken, wie bei Thyssen, wo die Rüttger-Arbeiter sich letztlich der Versammlungsleitung des Betriebsrates beugten und einfach ruhig im Saal Platz nahmen, nachdem der BR selbst zu Beginn der Versammlung "betriebsfremde" Arbeiter zum Verlassen des Saales aufgefordert hatte.Dieser Tag hat sowohl die ganze Kraft und das ganze Ausmaß der Bewegung ans Licht gebracht, als auch ihre Grenzen aufgezeigt, die in den nachfolgenden Aktionen überwunden werden mußten, sollte die positive Dynamik des Kampfes nicht endgültig gebrochen werden. Die IKS brachte sofort ein weiteres Flugblatt heraus, mit dem die Lehren des 10.12. gezogen werden sollten, um so auf die weitere Entwicklung Einfluß zu nehmen. "Die Verstärkung des Kampfes liegt aber jetzt darin, die Arbeitsniederlegungen auszunutzen, um möglichst massive Straßendemonstrationen aller Arbeiter durchzuführen, sowie öffentliche Massenkundgebungen, wo die Arbeiter selber ans Mikrophon gehen, Kampferfahrungen austauschen und gemeinsame Forderungen ausarbeiten. Aus Solidarität die Arbeit niederzulegen und bei Demos mitzumarschieren, ist ein erster Schritt, der aber als solcher nicht ausreicht. Ihm muß ein zweiter folgen: die anderen Arbeiter müssen ihre eigenen Forderungen aufstellen und selbst in den Kampf treten (Flugblatt der IKS 12.12.1988).Die Waffen des Proletariats sind sein Klassenbewußtsein und seine Organisationsfähigkeit. Das eine kann sich ohne das andere nicht entwickeln, und der Kampf selbst ist die Schule, in denen beides gelernt wird. Die Aufgabe der Revolutionäre kann also nicht nur im Aufzeigen des allgemeinen Ziels der Arbeiterkämpfe bestehen. Sie müssen darüber hinaus in der Lage sein, in den Kämpfen der Arbeiter konkret und realistisch die nächsten Schritte aufzuzeigen. Die Klarheit der Prinzipien in allen grundsätzlichen Fragen ist dabei ebenso wichtig wie die Anwendung der marxistischen Methode zur Analyse der Lage im Allgemeinen, wie von Tag zu Tag und die Entschlossenheit nicht abseits zu stehen, sondern einzugreifen und teilzunehmen am Kampf der Arbeiter. EMT (Jan. 1988). Das unten abgedruckte Flugblatt, von Arbeitern aus Kölner Krankenhäusern herausgegeben , und vertrieben, und unter anderem bei Krupp-Rheinhausen im Dezember verteilt, zeigt konkret auf, daß es möglich ist, völlig unabhängig von gewerkschaftlichen oder anderen staatlichen Organen, direkt die Initiative zu ergreifen und auf einen Zusammenschluß aller Arbeiter hinzuarbeiten. Leider geben die Herausgeber des Flugblatts keine Kontaktadresse an. Auf jeden Fall ist diese wie ähnliche Initiativen in anderen Ländern ein Beispiel, das Schule machen sollte.
Arbeiter- ergreifen selbst die Initiative
Gemeinsam können wir mehr erreichen Wir sind eine kleine Gruppe, die sich aus dem Personal der Kölner Krankenhäuser zusammengesetzt hat. Wir sind keiner Gewerkschaft und keiner Partei untergeordnet, sondern wir vertreten hier unsere eigene Meinung. Weshalb wir uns zu Wort melden ist, daß die Bedingungen in den Krankenhäusern für das Personal sowie für die Patienten immer unerträglicher werden. Den Anstoß für diese Stellungnahme haben uns die Beispiele aus dem Ruhrgebiet gegeben, wo Hundertausende sich gemeinsam und solidarisch gegenüber den Massenentlassungen im Bereich der Stahlindustrie und dem Bergbau gezeigt haben.Auch der öffentliche Dienst einschließlich der Krankenhäuser haben sich durch Arbeitsniederlegungen und Teilnahme an Demos daran beteiligt, wobei aber noch keine eigenen Forderungen gestellt wurden. Denn es geht nicht darum, aus Mitleid mit den Kruppianern auf die Straße zu gehen, sondern es gilt zu verstehen, daß wir alle den gleichen Angriffen ausgesetzt werden und uns auch nur gemeinsam dagegen wehren können. Das Gegenstück der Massenentlassungen in der Industrie ist im öffentlichen Dienst der Stellenabbau bzw. Einstellungsstop.Die Auswirkungen sind jeweils die gleichen: auf der einen Seite die Arbeitslosigkeit; auf der anderen die Mehrbelastung der noch Übriggebliebenen. Durch die Streichung der Steuerfreibeträge für Wochenend-, Feiertags- und Nachtarbeit werden gleichermaßen der öffentliche Dienst sowie die Industrie betroffen. Durch Blüms "Reform" des Gesundheitswesens wird nicht nur das Personal der Krankenhäuser sondern die ganze Bevölkerung getroffen.Es hat sich gezeigt, daß "Vater Staat" genauso rücksichtslos und brutal mit seinen Beschäftigten umspringt wie jeder private Unternehmer. Angesichts dieser Tatsache befürworten wir, daß möglichst massive Protestaktionen und Demos zustande kommen, bei denen die Rücknahme der Massenentlassungen, der "Gesundheitsreform" usw. . verlangt wird.Wir sollten dem Beispiel des Ruhrgebiets folgen und uns ebenfalls in Köln solidarisch erklären mit der KHD (2000 Entlassungen).Dieses Schriftstück soll ein Beispiel dafür sein, daß wir auch als kleine Gruppe, ohne die Parteien, Gewerkschaften usw. selbst aktiv werden können. Wir sind keine passive Manövriermasse. Jeder kann und muss sich zu Wort melden.
"Neue Töne der Linken zur Verteidigung des Kapitals"
Seit Jahren hat man sich daran gewöhnt, bei gewerkschaftlich orientierten Veranstaltungen zum Thema Klassenkampf mit Schlachtrufen wie "bedingungslose Verteidigung der Gewerkschaften" (die das Kapital angeblich 'zerschlagen' will) regelrecht bombardiert zu werden. Zwar vergaßen die Linken und die Basisgewerkschafter meistens nicht, die Gewerkschaftsführung zu kritisieren. Aber wenn jemand behauptete, die Arbeiter können und müssen ihren eigenen Kampf gegen die gewerkschaftliche Sabotage selber führen, bekamen diese regelrechte Wutanfälle und blockierten jede Diskussion darüber sofort ab.Bei einer öffentlichen Großveranstaltung des basisgewerkschaftlichen Solidaritätskomitees Krupp am 12. Februar 1988 in Berlin konnte man jetzt ganz andere Töne hören. Bereits das Einführungsreferat des Sprechers des Komitees erzählte etwas über eine "neue Arbeiterbewegung", und über die Suche der Arbeiter im Ruhrgebiet im Dezember nach "neuen, wirkungsvolleren Kampfformen", die "mehr Spaß machen" als die "traditionellen, langweiligen, gewerkschaftlichen Methoden". Auch der Hauptredebeitrag des Abends, vom Krupp - Rheinhausener Betriebsratsvertreter T. Steegmann gehalten, der als direktes Ausführungsinstrument der IGM Klassenkampf-Sabotage vor Ort sogar den "Kollegen Steinkühler" in Schutz nehmen wollte, betonte vor allem die Eigeninitiative der Arbeiter während der Dezemberkämpfe.Was steckt hinter dieser neuen Tonart der "kritischen" aber unerbittlichen Verteidiger der Gewerkschaften? Sie haben ihre Rolle nicht aufgegeben; sie haben sich nicht geändert. Sie passen sich lediglich einer veränderten Situation an, damit sie ihre alte Bremserrolle des Klassenkampfes weiterspielen können. Vor Jahren haben sie voller Schadenfreude zu uns gesagt: "wartet ab, bis die Kämpfe richtig ernst werden. Dann werden die Arbeiter euch die Fresse polieren, wenn ihr immer noch vom Klassenkampf außerhalb und gegen die Gewerkschaften sprecht". Aber es ist anders gekommen. Die 'Linken' in Deutschland wissen ganz genau, dass während des Eisenbahnerstreiks in Frankreich im Dezember 1986 oder in den Kämpfen im öffentlichen Dienst in Italien im Frühjahr letzten Jahres eine enorme gewerkschaftsfeindliche Stimmung unter den Arbeitern herrschte, und dass die französischen und italienischen "Linken" vielfach ihre gewerkschaftlichen Mitgliedsbücher und Anstecknadeln wegstecken müssen, um überhaupt in die Arbeiterversammlungen reinkommen zu können. Sie wissen inzwischen auch, dass der IG-Metall Chef Steinkühler, der am 12. Dez. am Rheinhausener Bahnhof noch kritisiert wurde, erst so spät nach Rheinhausen gekommen zu sein, am 17. Februar von den versammelten Belegschaften von Krupp, Thyssen und Mannesmann in Duisburg einfach ausgepfiffen worden ist, als er die Entlassungen dort zu rechtfertigen versuchte. Kurzum, sie wissen, dass der gleiche Reifungsprozess des Arbeiterbewusstseins so wie in Frankreich oder Italien auch in der BRD Fortschritte macht und die gewerkschaftliche Kontrolle über die Kämpfe wackliger macht. GEWERKSCHAFTLICHE "SOLIDARITÄT" = GELDSAMMLUNGEN UND GRUSSBOTSCHAFTEN
Auch wenn die Basisgewerkschafter zu den "traditionellen, bürokratischen, legalistischen Methoden" der Gewerkschaften auf Distanz gehen, auch wenn linkskapitalistische Gruppen wie die stalinistische MLPD von der Initiative "der Basis" schwärmen oder der trotzkistische BSA gegen den "Verrat der IGM - Führung" Sturm läuft, sie vertreten immer noch konsequent die gleiche gewerkschaftliche Ausrichtung, die den Arbeiterkampf unweigerlich in Niederlagen führen will. Denn die Botschaft dieser Veranstaltung, von sämtlichen Podiumssprechern sowie von vielen Vertrauensleuten aus verschiedenen Berliner Betrieben lautete: Solidarität mit Krupp heißt Geld auf das Rheinhausener "Solidaritätskonto" zu überweisen, Sympathiebekundungen und -botschaften zu organisieren usw.WIRKLICHE SOLIDARITÄT HEISST SELBER DEN KAMPF AUFNEHMEN UND IHN ZUSAMMENSCHLIESSENAuch die IKS hat auf dieser Veranstaltung das Wort ergriffen, um eine ganz andere Orientierung vorzuschlagen! Solidarität heißt, selber den Kampf aufnehmen, für die eigenen Forderungen eintreten und diesen Kampf mit dem Kampf der Kruppianer sofort Branchen und Regionen übergreifend verschmelzen. Auch wenn diese Perspektive - die einzige, die genügend Kraft schöpfen kann, um das Kapital zurückzudrängen - nicht sofort im vollen Umfang realisierbar ist, riefen wir alle Anwesenden auf, selber die Initiative zu ergreifen, um diese Perspektive vorzubereiten. Anstatt Geld zu überweisen, sollte man das Geld selber nehmen, um z.B. ein Flugblatt herauszubringen, das sich für die Notwendigkeit des gemeinsamen Kampfes aller Arbeiter stark macht. Zu diesem Zweck ist es notwendig, die kämpferischen Arbeiter zusammenzuschließen, Kampfkomitees zu bilden, wo die am meisten fortgeschrittenen Arbeiter außerhalb jeder gewerkschaftlichen Bevormundung zusammenkommen.Während das Präsidium und die linken Gewerkschafter mit keinem Wort auf diesen Beitrag eingegangen sind, beweist die lebhafte Zustimmung, die es unter den mehreren Hundert Anwesenden gab, dass immer mehr Arbeiter dabei sind, sich mit den wirklichen Lehren aus den Dezemberkämpfen auseinanderzusetzen.Es geht hier um die politische Vorbereitung der kommenden Kämpfe, damit sie weiter gehen können als die bisherigen. Gerade die Kämpfe im Ruhrgebiet im Dezember haben diesem Prozess schon Auftrieb verliehen. Aber die Berliner Großveranstaltung zeigt auf, dass die Basisgewerkschafter die Gefahren dieser Entwicklung für das kapitalistische System - die zu einer offenen Infragestellung der Gewerkschaften führen kann - voll erkannt haben. Sie machen mobil, um zu verhindern, dass die wirklichen Lehren gezogen werden.Sie stellen als die Stärken der Dezemberbewegung gerade ihre Schwächen heraus - ihr Unvermögen, über noch zu beschränkte Solidaritätsgesten hinauszugehen oder die gewerkschaftliche Kontrolle abzuschütteln, Die Geschichte und die Erfahrung aus anderen Ländern zeigen, dass der linke Flügel des Kapitals zu vielerlei "Gesichtsveränderungen" in der Lage ist, um jeweils neue Sackgassen für die Arbeiter aufzubauen. Sie können alle erdenklichen Vorschläge machen, auch z.B. "neue, von den Arbeitern selbst verwaltete Gewerkschaften" zu gründen oder zu befürworten, die Gewerkschaftsführer vor die Tür zu setzen. Ähnlich wie man bei einem Gefängnis den Direktor verjagen kann, das Gebäude bleibt aber ein Knast, auch wenn er jetzt von den Wärtern, den kleinen Basisfunktionären, selbst verwaltet wird! Kr. (Weltrevolution Nr. 31, April 1988)
Aktuelles und Laufendes:
- Arbeiterkampf [40]
Leserbrief an die Redaktion
- 3403 reads
Nachfolgend veröffentlichen wir einen Leserbrief, der sich mit wichtigen Fragen beschäftigt, und unsere Antwort. Hallo,
ich bin durch Zufall auf eure Seite gestoßen und hätte ein paar Fragen:
1. Seid ihr als Rätekommunisten grundlegende Gegner des
Parlamentarismus? Oder glaubt ihr nicht auch, dass, solange man die
ArbeiterInnenklasse noch nicht zur Revolution geeint hat, man innerhalb
dieses Systems das Beste für die ArbeiterInnenklasse rausholen sollte?
2. Wie steht ihr zu sozialistischen Nationalstaaten? Glaubt ihr, dass ihr
eure Ziele nur erreichen könnt in einer großen weltweiten Revolution
oder das es wahrscheinlicher ist, dass die Revolution erst in einem Land
siegt und ein Staat nach dem anderen durch die Räte ersetzt wird?
3. Wie viele Mitglieder habt ihr weltweit/ in Deutschland und in welchen
Städten habt ihr Gruppen?
Vielen Dank in Voraus,
mit roten Grüßen
Unsere Antwort
Hallo, vielen Dank für Deinen Brief. Bitte entschuldige, dass wir erst jetzt antworten. Wir freuen uns, dass Du auf unsere Homepage gestoßen bist. Hoffentlich hast Du dort Interessantes gefunden. Nun zu Deinen Fragen. Zunächst einmal sind wir mit Dir einverstanden, dass die Arbeiterklasse innerhalb des Kapitalismus so lange das Beste für sich herausholen sollte, bis sie so weit ist, um das System selbst überwinden zu können. Denn die Arbeiterklasse kann die Revolution nur machen, wenn sie vereint ist, wie Du völlig zu Recht festgestellt hast. Wir meinen, dass die Arbeiterklasse lernen muss, sich selbst zu vereinigen – niemanden außerhalb der Arbeiterklasse kann dies stellvertretend für sie bewerkstelligen – und dass die Verteidigungskämpfe innerhalb des Systems eine der wichtigsten Gelegenheiten sind, wo die Arbeiter lernen, sich zu vereinigen, und wo die Vereinigung praktisch vonstatten geht. Wir sind auch einverstanden mit Deiner Formulierung, dass die Klasse für sich das Beste herauszuholen versuchen muss. Allerdings: wenn man die Lage gerade heute anschaut, wird man unweigerlich feststellen, dass „das Beste“ sozusagen nicht mehr genug ist. Selbst wenn in solchen Kämpfen beispielsweise Lohnerhöhungen durchgesetzt werden, so werden diese binnen kurzer Zeit wieder zunichte gemacht durch die Verteuerung, durch Steuer- und Abgabenerhöhungen, durch Entlassungen und Ausgliederungen usw. Dies ist selbstverständlich kein Argument gegen die Notwendigkeit des Kampfes. Denn wenn das Proletariat sich nicht wehrt, wird ihm rasch noch mehr weggenommen. Außerdem wird, wie Marx es formuliert hat, eine Klasse, die es nicht gelernt hat, sich im Alltag zur Wehr zu setzen, niemals imstande sein, eine neue Gesellschaft zu gründen. Aber die Tatsache, dass selbst die selten gewordenen Verbesserungen, die im Kampf errungen werden, rasch zunichte gemacht werden, weist darauf hin, dass im modernen Kapitalismus schon lange keine dauerhaften Verbesserungen mehr möglich sind. Und das ist auch der Grund, warum wir die Ausnutzung des Parlamentarismus im Interesse der Arbeiterklasse in der heutigen Zeit nicht – mehr – für sinnvoll halten. Denn die Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts hat vor allem deshalb das Parlament ausnutzen können, weil es damals noch möglich war, über die parlamentarische Schiene echte und langanhaltende Verbesserungen für die Arbeiterklasse herauszuholen, wie etwa die Einschränkung der Arbeitszeit oder die Begrenzung der Ausbeutung der Frauen und Kinder.
Was Deine zweite Frage betrifft, nämlich ob die Revolution nur weltweit siegen kann oder ob sie eher zunächst in einem Land siegen wird, um dann sozusagen um sich zu greifen, so meinen wir zunächst einmal, dass dies kein Frage des „Entweder - oder“ sein muss. Die Revolution kann in einem Land anfangen, aber sie kann nicht in einem einzelnen Land lange überleben, ohne entweder von außen mit Gewalt niedergeworfen zu werden oder von innen durch einen Prozess der Entartung zu verkommen, wie es in Russland geschehen ist. Warum ist das so? Weil der Kapitalismus ein Weltsystem ist, dessen ökonomische Gesetzmäßigkeiten und politische Herrschaft nur auf Weltebene überwunden werden kann. Und die Arbeiterklasse ist nicht zuletzt deshalb die revolutionäre Klasse heute, weil sie die einzige weltweit durch die Produktion und durch die eigene radikale Eigentumslosigkeit verbundene Klasse mit gemeinsamen Interessen ist. Was die Frage der sozialistischen Nationalstaaten betrifft, so sind wir der Meinung, dass es im Sozialismus weder Klassen noch Staaten noch Nationen geben wird. Was den Prozess der revolutionären Umwälzung selbst betrifft, so ist klar, dass die Arbeiterklasse die Herrschaft der Bourgeoisie zunächst auf nationaler Ebene stürzen muss, da der Kapitalismus ja in Nationalstaaten aufgeteilt ist. Aber die Machtergreifung des Proletariats nur in einem Land setzt bereits das Vorhandensein eines internationalen revolutionären Ansturm des Proletariats voraus. Denn wenn dieser Ansturm nur in einem Land stattfinden würde, so könnten die vereinten Kräfte der Weltbourgeoisie seinen Erfolg sicher verhindern. Außerdem gehen wir davon aus, dass das Proletariat, sobald es die Macht in mehrere Länder ergriffen hat, sich nicht in der Form einer revolutionären Föderation dieser Länder vereinigen wird, sondern eine internationale Klasse, schließlich einen Weltrat der Arbeiterklasse bilden wird. Das Wesen der proletarische Revolution wird nicht bestimmt durch die Natur der in rivalisierende Nationalstaaten gespaltenen Bourgeoisie, sondern wird durch den internationalen Charakter ihrer proletarischen Träger bestimmt.
Aus unserer Sicht gibt es eine Verbindung zwischen den beiden von Dir gestellten Fragen. Dies liegt an der Verbindung zwischen dem Ziel, den Kommunismus, und dem Weg dorthin, sprich: die Arbeiterbewegung bzw. die Bewegung der Klasse. Wie Rosa Luxemburg in ihrer Schrift gegen Bernstein am Ende des 19. Jahrhunderts festgestellt hat (Sozialreform oder Revolution?), liegt die besondere Herausforderung für die Arbeiterklasse darin, dass ihr Ziel in der Zukunft, außerhalb des Kapitalismus liegt, während die Bewegung dorthin sich innerhalb des Systems abspielt. Deswegen dient nicht jedes x-beliebige Mittel dem Ziel des Kommunismus; die Mittel müssen im Einklang mit diesem Endziel stehen. Auch können die anzuwendenden Mittel sich mit den Bedingungen des Kampfes wandeln, wie dies hinsichtlich der Möglichkeit von Reformen oder der Teilnahme am Parlamentarismus der Fall war, die einst probate Mittel der Arbeiterbewegung waren, aber mittlerweile hinfällig geworden sind.
Zum Schluss noch ein kurzer Hinweis. Du bezeichnest uns als rätekommunistisch. Wenn darunter zu verstehen ist, dass die Macht der siegreichen Arbeiterklasse durch die Arbeiterräte, und nicht durch eine stellvertretend für sie handelnde Klassenpartei ausgeübt werden soll, so trifft dies auf uns zu. Jedoch hat sich die Gewohnheit durchgesetzt, nur diejenigen als „Rätekommunisten“ zu bezeichnen, die die Notwendigkeit von politischen Parteien des Proletariats grundsätzlich ablehnen. Nach dieser Definition ist die IKS nicht als rätekommunistisch zu bezeichnen (und wir bezeichnen uns auch nicht als solche), da wir die Notwendigkeit von politische Organisationen der Arbeiterklasse befürworten.
Die Anzahl der Sektionen der IKS in den verschiedenen Länder und auf den verschiedenen Kontinenten sowie die Orte, an denen wir öffentliche Veranstaltungen abhalten (im deutschsprachigen Raum v.a. Köln und Zürich) sind unserer Website zu entnehmen (www.internationalism.org [75]). Wir hoffen, zumindest erste Antworten auf Deine Fragen gegeben zu haben, und würden uns auf einen weiteren Meinungsaustausch mit Dir freuen.
Mit freundlichen Grüßen
IKS
Politische Strömungen und Verweise:
- Rätekommunismus [89]
Theoretische Fragen:
- Arbeiterklasse [58]
Erbe der kommunistischen Linke:
Vor 20 Jahren - 1987 - Krupp-Rheinhausen
- 2987 reads
Wir veröffentlichen nachfolgend einige Artikel, die wir in unserer Zeitung Weltrevolution vor 20 Jahren zum Kampf der Beschäftigten von Krupp-Rheinhausen (Duisburg) veröffentlichten. Lehren aus den Dezember-Kämpfen Wir veröffentlichen nachfolgend einige Artikel, die wir in unserer Zeitung Weltrevolution vor 20 Jahren zum Kampf der Beschäftigten von Krupp-Rheinhausen (Duisburg) veröffentlichten. Lehren aus den Dezember-Kämpfen Solidarität muß zum Zusammenschluß der Kämpfe führen Am 27. Nov. letzten Jahres brach der Kampf um Krupp-Rheinhausen aus. Zu einer Zeit, in der die Bourgeoisie massive Angriffe gegen die gesamte Arbeiterklasse vornimmt, wurden die Schließung des Duisburger Werkes von Krupp-Rheinhausen und die Entlassung von über 5.000 Arbeitern angekündigt. Diese Nachricht löste den massivsten Kampf aus, der seit den 1920er Jahren in Deutschland stattgefunden hat.. Die Arbeiter dehnen den Kampf aus Als die Entlassungen bekannt wurden, reagierten die Arbeiter sofort: sie legten die Arbeit nieder und riefen alle Arbeiter der Stadt zu einer Vollversammlung auf. Die Belegschaften von Thyssen und Mannesmann in Duisburg traten sofort in Solidaritätsstreiks. Somit wurde klar, daß die Entlassungen bei Krupp alle Arbeiter angehen, und daß vor allem im Ruhrgebiet die aktive Solidarität nicht ausbleiben durfte. Am 30.11. fand eine Vollversammlung mit 9.000 Arbeitern von Krupp und massiven Delegationen der anderen großen Fabriken in Duisburg statt. Die Versammlung rief zum gemeinsamen Kampf im Ruhrgebiet auf. Am 1.12. fanden in 14 Krupp-Werken im Bundesgebiet Demos und Vollversammlungen statt, an denen sich starke Delegationen aus Rheinhausen beteiligten. Am 3.12. demonstrierten 12.000 Schüler in Rheinhausen gegen die geplanten Entlassungen. Eine Delegation von Bergarbeitern forderte einen gemeinsamen Kampf von Berg- und Stahlarbeitern. Das gesamte Ruhrgebiet war mobilisiert und kampfbereit! Am 8.12. demonstriertem Bedienstete der Stadt Duisburg (über 10.000) in Rheinhausen, um ihre Solidarität zu bekunden. Die Gewerkschaften, die zunächst Schwierigkeiten hatten, diese Flut der Solidarität der Arbeiter einzudämmen. traten auf den Plan. Sie kündigten am 5.12. einen Aktionstag für den 10.12. an, an dem sich das ganze Ruhrgebiet beteiligen sollte. Ihr Ziel war es, die Kampfbewegung unter ihre Kontrolle zu bringen und sie somit scheitern zu lassen. Da der Solidaritätswille der Arbeiter nicht leicht zu brechen und die Notwendigkeit eines gemeinsamen Kampfes für alle Arbeiter klar war, mußten die Gewerkschaften diesen Drängen der Arbeiter zum Schein nachgeben, um der Bewegung so die Spitze zu brechen. Der Aktionstag sollte angeblich den Verkehr im Ruhrgebiet lahmlegen. Was geschah aber tatsächlich? Denn in Wirklichkeit bedeutete dies, daß die Arbeiter nicht gemeinsam und vereinigt demonstrierten, nicht in Massenversammlungen den weiteren Verlauf des Kampfes diskutieren konnten, sondern daß sie isoliert voneinander, über das ganze Ruhrgebiet zerstreut, in Gruppen zersplittert Straßen blockierten. Nach einigen Stunden dieser Aktion waren nur noch wenige Arbeiter an den Straßenkreuzungen von Duisburg anzutreffen. Die meisten waren mit einem miesen Gefühl nach Hause gegangen. Und dennoch hätte es ganz anders kommen können. An diesem Tag fand eine Vollversammlung um 7.30 Uhr bei Krupp statt, an der 3.000 Arbeiter teilnahmen. Um 10.00 Uhr fand eine weitere Vollversammlung der Thyssen-Arbeiter statt. Postbeschäftigte und Arbeiter aus Süddeutschland kamen nach Rheinhausen. 90.000 Stahlarbeiter standen im Kampf, gleichzeitig legten 100.000 Bergleute aus Solidarität für einige Stunden die Arbeit nieder. An verschiedenen Orten verließen die Arbeiter die Fabriken und demonstrierten wie z.B. bei Opel-Bochum. Das Ausmaß der Mobilisierung und der Kampfbereitschaft an diesem Tag hätte zu einer riesigen Machtdemonstration der Kraft der Arbeiterklasse werden können. Wenn all die mobilisierten Arbeiter nicht durch unendlich viele Straßenblockaden zerstreut voneinander gewesen, sondern geschlossen, zusammen auf die Straße gegangen wären, hätte die Kampfbewegung einen starken Impuls bekommen. Der 10.12. war der Höhepunkt des Kampfes um Rheinhausen, gleichzeitig aber zeigte er all die Schwächen des Kampfes auf, die die Gewerkschaften ausnutzen konnten, um den Kampf zu entschärfen. Am 11.12 kündigte Bonn die Entlassung von 30.000 Bergleuten an. Es kam aber nicht zu einem gemeinsamen Kampf von Berg- und Stahlarbeitern. Dafür hatte die IG-Bergbau gesorgt, die vor Solidaritätsaktionen gewarnt hatte mit den Vorwand, daß die Forderungen der Bergarbeiter dann untergehen würden, wenn sich die Bergleute mit den Stahlarbeitern solidarisierten.Die Gewerkschaften ließen dann eine Woche verstreichen, bevor eine erneute Massenaktion stattfand (18.12.)... ein Fackelzug mit anschließendem Gottesdienst. Sicherlich das beste Mittel, um die kämpferischsten Arbeiter fernzuhalten. In den nachfolgenden Wochen wurde klar, daß die Kampfbereitschaft der Kruppianer weiterhin sehr stark war, wie die spontane Reaktion in der Nacht des. 6. Januar aufzeigt, als die Arbeiter die Nachtschicht verließen und auf die Straße gingen, nachdem die Schließung von Rheinhausen als unvermeidlich angekündigt worden war. Dennoch ist die „aufsteigende Dynamik“ die der Kampf bis zum 10.12. aufwies, durch die Sabotagearbeit der Gewerkschaften gebrochen worden. Im neuen Jahr veranstalteten- die Gewerkschaften Aktionswochen in Form von sog. "Spaziergängen" mit Bus und Autos zu anderen Fabriken. Das ist eine Karikatur von dem, was die Arbeiter Anfang Dezember als eine Notwendigkeit spürten: die Ausdehnung und Vereinigung des Kampfes.Lehren aus dem Kampf – Nur die Vereinigung der Kämpfe kann die Angriffe zurückdrängenAls Anfang Dezember die Arbeiter in Rheinhausen den Kampf aufnahmen, dehnte er sich innerhalb von ein paar Tagen auf das ganze Ruhrgebiet aus. Heute hingegen "spazieren" die Krupp-Arbeiter von einem Betrieb zum anderen und erhalten schön klingende Solidaritätserklärungen der Betriebsräte dieser Betriebe. Es ist keine Rede mehr vom gemeinsamen Kampf. Das weiß auch die Bourgeoisie, die ihre Position verhärtet und die Schließung von Rheinhausen als unausweichlich erklärt. Die Frage muß also gestellt werden, was diese Wende herbeigeführt hat, wieso nach dem anfänglich so breiten Kampf letztendlich die Krupp-Arbeiter alleine zurückbleiben? Und die Lehre, die man ziehen muß, ist, daß Sympathiestreiks und Solidaritätsbekundungen zwar ein wichtiger Schritt sind, daß sie aber nicht ausreichen, um die Entlassungen und die Angriffe der Bourgeoisie zurückzudrängen. Die Solidarität muß zur Vereinigung der Kämpfe selber führen. Aber was heißt Vereinigung?Wenn die Arbeiter in Rheinhausen den Kampf gegen Entlassungen aufnehmen, dann sind ihr Kampf und ihre Forderungen grundsätzlich die gleichen wie in anderen Betrieben und Branchen. Die Bergleute werden wie die Stahlarbeiter von Massenentlassungen betroffen. Aber auch im öffentlichen Dienst werden die Angriffe stärker Haushaltskürzungen, Streichung von Krankenhausbetten, Privatisierungspläne bei der Post, Stellenstreichungen bei der Bahn...Die Solidarität mit Rheinhausen bedeutet den Kampf für die eigenen Forderungen aufnehmen. Grund genug dazu gibt es.Gerade für die Bergleute bestand kein Anlaß, sich zu verkriechen und sich zurückzuhalten, als die Stahlkocher zum gemeinsamen Kampf, zur Solidarität aufriefen. Denn wenn sich so wichtige Teile wie die Bergleute und die Stahlkocher zusammen in Bewegung setzen und gemeinsam ihr Gewicht in die Waagschale werfen, wenn sich bei; dieser Bewegung andere Beschäftigte anschließen, wie das Beschäftigte des öffentlichen Dienstes und Opel-Arbeiter ansatzweise taten, entsteht eine Sogwirkung, in der immer mehr Teile der Arbeiterklasse in Fluß geraten. Dann geraten die Kapitalisten und ihr Staat erst richtig unter Druck, und kein Teil der Arbeiterklasse steht dann mehr allein mit seinen Forderungen dem Kapital gegenüber. So haben die Bergleute im Dezember eine große Gelegenheit verpaßt, und es ist kein Zufall, daß just einen Tag nach dem 10.12., als der Zusammenschluß zwischen Bergbau und Stahl nicht hergestellt wurde, der Staat den Abbau von ca. 30.000 Arbeitsplätzen im Bergbau beschloß. Es liegt auf der Hand. Die besten Kampfmöglichkeiten bestehen dann, wenn andere Arbeiter schon in den Kampf getreten sind. Dann sind gemeinsames Auftreten, gemeinsame Demos, gemeinsame Vollversammlungen und Massendelegationen, gemeinsame Aktionen überhaupt einfacher durchzuführen. Aber um das zu erreichen, müssen sich die Arbeiter darüber bewußt werden, daß wenn heute die Arbeiter in einer Fabrik von Angriffen getroffen werden, sie selbst wenig später in die Schußlinie geraten werden. Deshalb: der Kampf der einen Arbeiter muß der Kampf der anderen Arbeiter werden!Und wenn es die Arbeiter irgendwo schaffen, die Angriffe des Kapitals zurückzudrängen, dann nur weil andere Arbeiter ebenfalls in den Kampf getreten sind. So können die Rheinhausener Arbeiter die Entlassungen nur abwehren, wenn das ganze Ruhrgebiet dahintersteht und mitkämpft.Die Krupp-Arbeiter haben durch ihren Kampf eine große Solidaritätswelle hervorgerufen Diese explosiven Reaktionen lassen darauf schließen, daß die aufsteigende Kampfbereitschaft immer größere Teile der Klasse zu neuen, heftigen Klassenauseinandersetzungen führen wird, In diesen werden die Arbeiter wieder den gleichen Schwierigkeiten und Spaltungstaktiken der Gewerkschaften gegenübertreten. Deshalb müssen sich bereits heute alle Arbeiter die Lehre zu Eigen machen, daß aktive Solidarität mehr als Sympathiebekundungen verlangt. Ja, nun muß selbst in den Kampf treten und versuchen, den Widerstand aller Arbeiter wirkungsvoll zusammenzuschließen, ihn zu "vernetzen", wie es von den Rheinhausener Arbeitern formuliert wurde. Dies heißt aber. daß sich die Arbeiter nicht mehr in den Fangnetzen der Gewerkschaften fangen lassen dürfen. Die Bestrebungen zum Zusammenschluß der Kämpfe können nur gegen den Widerstand, gegen die Sabotagetaktik der Gewerkschaften erfolgen. Und dies erfordert nichts anderes, als daß die Arbeiter selbst die Initiative in die Hand nehmen. Daß diese Perspektive keine Utopie, sondern eine reale Möglichkeit ist, beweist die Initiative von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, wie wir in dieser Zeitung zeigen.17.1.1988 Nat. (Weltrevolution Nr. 30, Jan-März 1988)
Die Intervention der IKS in den Kämpfen
In Weltrevolution Nr. 29 schrieben wir einen Artikel zum Klassenkampf in der BRD mit dem Titel: "Massive Kämpfe rücken näher". Wir zeigten anhand vieler Beispiele des Widerstands gegen die Flut der Angriffe auf allen Ebenen auf, wie in der BRD zunehmend das Potential für einen breiten Abwehrkampf der Arbeiter heranreift. Diese Einschätzung war Anlaß für die IKS, ein Flugblatt mit dem Titel: "Für bundesweite Aktionen aller Arbeiter gegen alle Angriffe" herauszugeben. Die Gleichzeitigkeit des Widerstands bei Stahl, Kohle und im öffentlichen Dienst bietet die Möglichkeit der massiven Ausdehnung und Vereinigung des Arbeiterkampfes. Demonstrationen und Versammlungen sind dazu besonders geeignete Mittel. "Entschlossene Arbeiter müssen jetzt schon dafür eintreten, bei Diskussionen, Versammlungen, Demonstrationen das Wort ergreifen, um sich für diese Perspektive des gemeinsamen Kampfes stark zu machen. Arbeiter verschiedener Betriebe und Branchen müssen direkten Kontakt zueinander aufnehmen, um den Zusammenschluß der Kämpfe in die Wege zu leiten" (17. Nov.'87). Im Rahmen ihrer Analyse der Lage in der BRD wurde die IKS vom Ausbruch des Kampfes der Krupp-Beschäftigten dessen Ausbreitung nicht überrascht. Das oben erwähnte Flugblatt wurde vor und während des 10. Dezembers an Fabriken im Ruhrgebiet und in Köln, die unterschiedlichen Branchen von Chemie und Automobil über öffentlichen Dienst, Maschinenbau bis zur Stahlindustrie angehören, verteilt. Der 10. Dezember 1987 konnte schon im voraus zumindest als der erste Höhepunkt dieser Kampfbewegung eingeschätzt werden - der Tag, an dem sich das Schicksal der weiteren Bewegung entscheiden sollte. Auf dem Spiel stand, ob es den Arbeitern gelingen würde, der Ausdehnung des Kampfes auf andere Betriebe Schritte näher zu kommen, oder ob die Gewerkschaften trotz der massenhaften Mobilisierung dcr Arbeiter die einzelnen Bereiche voneinander isolieren könnten. In dieser Lage konzentrierte sich unsere Intervention entsprechend unserer bescheidenen Kräfte auf Punkte, wo möglichst viele Arbeiter in Versammlungen zusammenkamen - die Kundgebung um 7 Uhr vor den Tor I von Krupp-Rheinhausen und die Belegschaftsversammlung bei Thyssen. Ziel war es, für massive Versammlungen bzw. Demonstrationen zu werben, auf denen die Arbeiter aus verschiedenen Branchen über die Fortführung des Kampfes debattieren und entscheiden könnten, und die Isolierungsstrategie der Gewerkschaften mit ihren Straßenblockaden als Falle zu entblößen. Tatsächlich hat das gewaltsame Eindringen der Rüttger-Arbeiter bei der Thyssen-Versammlung in Duisburg-Hamborn uns mit dieser Orientierung recht gegeben. Diese Arbeiter hatten nämlich den Werkschutz beiseite gedrängt, der nur den Zutritt von Thyssen-Arbeitern zulassen wollte. Dennoch blieben solche Vorstöße auf dem halben Weg stecken, wie bei Thyssen, wo die Rüttger-Arbeiter sich letztlich der Versammlungsleitung des Betriebsrates beugten und einfach ruhig im Saal Platz nahmen, nachdem der BR selbst zu Beginn der Versammlung "betriebsfremde" Arbeiter zum Verlassen des Saales aufgefordert hatte.Dieser Tag hat sowohl die ganze Kraft und das ganze Ausmaß der Bewegung ans Licht gebracht, als auch ihre Grenzen aufgezeigt, die in den nachfolgenden Aktionen überwunden werden mußten, sollte die positive Dynamik des Kampfes nicht endgültig gebrochen werden. Die IKS brachte sofort ein weiteres Flugblatt heraus, mit dem die Lehren des 10.12. gezogen werden sollten, um so auf die weitere Entwicklung Einfluß zu nehmen. "Die Verstärkung des Kampfes liegt aber jetzt darin, die Arbeitsniederlegungen auszunutzen, um möglichst massive Straßendemonstrationen aller Arbeiter durchzuführen, sowie öffentliche Massenkundgebungen, wo die Arbeiter selber ans Mikrophon gehen, Kampferfahrungen austauschen und gemeinsame Forderungen ausarbeiten. Aus Solidarität die Arbeit niederzulegen und bei Demos mitzumarschieren, ist ein erster Schritt, der aber als solcher nicht ausreicht. Ihm muß ein zweiter folgen: die anderen Arbeiter müssen ihre eigenen Forderungen aufstellen und selbst in den Kampf treten (Flugblatt der IKS 12.12.1988).Die Waffen des Proletariats sind sein Klassenbewußtsein und seine Organisationsfähigkeit. Das eine kann sich ohne das andere nicht entwickeln, und der Kampf selbst ist die Schule, in denen beides gelernt wird. Die Aufgabe der Revolutionäre kann also nicht nur im Aufzeigen des allgemeinen Ziels der Arbeiterkämpfe bestehen. Sie müssen darüber hinaus in der Lage sein, in den Kämpfen der Arbeiter konkret und realistisch die nächsten Schritte aufzuzeigen. Die Klarheit der Prinzipien in allen grundsätzlichen Fragen ist dabei ebenso wichtig wie die Anwendung der marxistischen Methode zur Analyse der Lage im Allgemeinen, wie von Tag zu Tag und die Entschlossenheit nicht abseits zu stehen, sondern einzugreifen und teilzunehmen am Kampf der Arbeiter. EMT (Jan. 1988).
Das unten abgedruckte Flugblatt, von Arbeitern aus Kölner Krankenhäusern herausgegeben , und vertrieben, und unter anderem bei Krupp-Rheinhausen im Dezember verteilt, zeigt konkret auf, daß es möglich ist, völlig unabhängig von gewerkschaftlichen oder anderen staatlichen Organen, direkt die Initiative zu ergreifen und auf einen Zusammenschluß aller Arbeiter hinzuarbeiten. Leider geben die Herausgeber des Flugblatts keine Kontaktadresse an. Auf jeden Fall ist diese wie ähnliche Initiativen in anderen Ländern ein Beispiel, das Schule machen sollte.
Arbeiter- ergreifen selbst die Initiative
Gemeinsam können wir mehr erreichen Wir sind eine kleine Gruppe, die sich aus dem Personal der Kölner Krankenhäuser zusammengesetzt hat. Wir sind keiner Gewerkschaft und keiner Partei untergeordnet, sondern wir vertreten hier unsere eigene Meinung. Weshalb wir uns zu Wort melden ist, daß die Bedingungen in den Krankenhäusern für das Personal sowie für die Patienten immer unerträglicher werden. Den Anstoß für diese Stellungnahme haben uns die Beispiele aus dem Ruhrgebiet gegeben, wo Hundertausende sich gemeinsam und solidarisch gegenüber den Massenentlassungen im Bereich der Stahlindustrie und dem Bergbau gezeigt haben.Auch der öffentliche Dienst einschließlich der Krankenhäuser haben sich durch Arbeitsniederlegungen und Teilnahme an Demos daran beteiligt, wobei aber noch keine eigenen Forderungen gestellt wurden. Denn es geht nicht darum, aus Mitleid mit den Kruppianern auf die Straße zu gehen, sondern es gilt zu verstehen, daß wir alle den gleichen Angriffen ausgesetzt werden und uns auch nur gemeinsam dagegen wehren können. Das Gegenstück der Massenentlassungen in der Industrie ist im öffentlichen Dienst der Stellenabbau bzw. Einstellungsstop.Die Auswirkungen sind jeweils die gleichen: auf der einen Seite die Arbeitslosigkeit; auf der anderen die Mehrbelastung der noch Übriggebliebenen. Durch die Streichung der Steuerfreibeträge für Wochenend-, Feiertags- und Nachtarbeit werden gleichermaßen der öffentliche Dienst sowie die Industrie betroffen. Durch Blüms "Reform" des Gesundheitswesens wird nicht nur das Personal der Krankenhäuser sondern die ganze Bevölkerung getroffen.Es hat sich gezeigt, daß "Vater Staat" genauso rücksichtslos und brutal mit seinen Beschäftigten umspringt wie jeder private Unternehmer. Angesichts dieser Tatsache befürworten wir, daß möglichst massive Protestaktionen und Demos zustande kommen, bei denen die Rücknahme der Massenentlassungen, der "Gesundheitsreform" usw. . verlangt wird.Wir sollten dem Beispiel des Ruhrgebiets folgen und uns ebenfalls in Köln solidarisch erklären mit der KHD (2000 Entlassungen).Dieses Schriftstück soll ein Beispiel dafür sein, daß wir auch als kleine Gruppe, ohne die Parteien, Gewerkschaften usw. selbst aktiv werden können. Wir sind keine passive Manövriermasse. Jeder kann und muss sich zu Wort melden.
"Neue Töne der Linken zur Verteidigung des Kapitals"
Seit Jahren hat man sich daran gewöhnt, bei gewerkschaftlich orientierten Veranstaltungen zum Thema Klassenkampf mit Schlachtrufen wie "bedingungslose Verteidigung der Gewerkschaften" (die das Kapital angeblich 'zerschlagen' will) regelrecht bombardiert zu werden. Zwar vergaßen die Linken und die Basisgewerkschafter meistens nicht, die Gewerkschaftsführung zu kritisieren. Aber wenn jemand behauptete, die Arbeiter können und müssen ihren eigenen Kampf gegen die gewerkschaftliche Sabotage selber führen, bekamen diese regelrechte Wutanfälle und blockierten jede Diskussion darüber sofort ab.Bei einer öffentlichen Großveranstaltung des basisgewerkschaftlichen Solidaritätskomitees Krupp am 12. Februar 1988 in Berlin konnte man jetzt ganz andere Töne hören. Bereits das Einführungsreferat des Sprechers des Komitees erzählte etwas über eine "neue Arbeiterbewegung", und über die Suche der Arbeiter im Ruhrgebiet im Dezember nach "neuen, wirkungsvolleren Kampfformen", die "mehr Spaß machen" als die "traditionellen, langweiligen, gewerkschaftlichen Methoden". Auch der Hauptredebeitrag des Abends, vom Krupp - Rheinhausener Betriebsratsvertreter T. Steegmann gehalten, der als direktes Ausführungsinstrument der IGM Klassenkampf-Sabotage vor Ort sogar den "Kollegen Steinkühler" in Schutz nehmen wollte, betonte vor allem die Eigeninitiative der Arbeiter während der Dezemberkämpfe.Was steckt hinter dieser neuen Tonart der "kritischen" aber unerbittlichen Verteidiger der Gewerkschaften? Sie haben ihre Rolle nicht aufgegeben; sie haben sich nicht geändert. Sie passen sich lediglich einer veränderten Situation an, damit sie ihre alte Bremserrolle des Klassenkampfes weiterspielen können. Vor Jahren haben sie voller Schadenfreude zu uns gesagt: "wartet ab, bis die Kämpfe richtig ernst werden. Dann werden die Arbeiter euch die Fresse polieren, wenn ihr immer noch vom Klassenkampf außerhalb und gegen die Gewerkschaften sprecht". Aber es ist anders gekommen. Die 'Linken' in Deutschland wissen ganz genau, dass während des Eisenbahnerstreiks in Frankreich im Dezember 1986 oder in den Kämpfen im öffentlichen Dienst in Italien im Frühjahr letzten Jahres eine enorme gewerkschaftsfeindliche Stimmung unter den Arbeitern herrschte, und dass die französischen und italienischen "Linken" vielfach ihre gewerkschaftlichen Mitgliedsbücher und Anstecknadeln wegstecken müssen, um überhaupt in die Arbeiterversammlungen reinkommen zu können. Sie wissen inzwischen auch, dass der IG-Metall Chef Steinkühler, der am 12. Dez. am Rheinhausener Bahnhof noch kritisiert wurde, erst so spät nach Rheinhausen gekommen zu sein, am 17. Februar von den versammelten Belegschaften von Krupp, Thyssen und Mannesmann in Duisburg einfach ausgepfiffen worden ist, als er die Entlassungen dort zu rechtfertigen versuchte. Kurzum, sie wissen, dass der gleiche Reifungsprozess des Arbeiterbewusstseins so wie in Frankreich oder Italien auch in der BRD Fortschritte macht und die gewerkschaftliche Kontrolle über die Kämpfe wackliger macht. GEWERKSCHAFTLICHE "SOLIDARITÄT" = GELDSAMMLUNGEN UND GRUSSBOTSCHAFTEN
Auch wenn die Basisgewerkschafter zu den "traditionellen, bürokratischen, legalistischen Methoden" der Gewerkschaften auf Distanz gehen, auch wenn linkskapitalistische Gruppen wie die stalinistische MLPD von der Initiative "der Basis" schwärmen oder der trotzkistische BSA gegen den "Verrat der IGM - Führung" Sturm läuft, sie vertreten immer noch konsequent die gleiche gewerkschaftliche Ausrichtung, die den Arbeiterkampf unweigerlich in Niederlagen führen will. Denn die Botschaft dieser Veranstaltung, von sämtlichen Podiumssprechern sowie von vielen Vertrauensleuten aus verschiedenen Berliner Betrieben lautete: Solidarität mit Krupp heißt Geld auf das Rheinhausener "Solidaritätskonto" zu überweisen, Sympathiebekundungen und -botschaften zu organisieren usw.WIRKLICHE SOLIDARITÄT HEISST SELBER DEN KAMPF AUFNEHMEN UND IHN ZUSAMMENSCHLIESSENAuch die IKS hat auf dieser Veranstaltung das Wort ergriffen, um eine ganz andere Orientierung vorzuschlagen! Solidarität heißt, selber den Kampf aufnehmen, für die eigenen Forderungen eintreten und diesen Kampf mit dem Kampf der Kruppianer sofort Branchen und Regionen übergreifend verschmelzen. Auch wenn diese Perspektive - die einzige, die genügend Kraft schöpfen kann, um das Kapital zurückzudrängen - nicht sofort im vollen Umfang realisierbar ist, riefen wir alle Anwesenden auf, selber die Initiative zu ergreifen, um diese Perspektive vorzubereiten. Anstatt Geld zu überweisen, sollte man das Geld selber nehmen, um z.B. ein Flugblatt herauszubringen, das sich für die Notwendigkeit des gemeinsamen Kampfes aller Arbeiter stark macht. Zu diesem Zweck ist es notwendig, die kämpferischen Arbeiter zusammenzuschließen, Kampfkomitees zu bilden, wo die am meisten fortgeschrittenen Arbeiter außerhalb jeder gewerkschaftlichen Bevormundung zusammenkommen.Während das Präsidium und die linken Gewerkschafter mit keinem Wort auf diesen Beitrag eingegangen sind, beweist die lebhafte Zustimmung, die es unter den mehreren Hundert Anwesenden gab, dass immer mehr Arbeiter dabei sind, sich mit den wirklichen Lehren aus den Dezemberkämpfen auseinanderzusetzen.Es geht hier um die politische Vorbereitung der kommenden Kämpfe, damit sie weiter gehen können als die bisherigen. Gerade die Kämpfe im Ruhrgebiet im Dezember haben diesem Prozess schon Auftrieb verliehen. Aber die Berliner Großveranstaltung zeigt auf, dass die Basisgewerkschafter die Gefahren dieser Entwicklung für das kapitalistische System - die zu einer offenen Infragestellung der Gewerkschaften führen kann - voll erkannt haben. Sie machen mobil, um zu verhindern, dass die wirklichen Lehren gezogen werden.Sie stellen als die Stärken der Dezemberbewegung gerade ihre Schwächen heraus - ihr Unvermögen, über noch zu beschränkte Solidaritätsgesten hinauszugehen oder die gewerkschaftliche Kontrolle abzuschütteln, Die Geschichte und die Erfahrung aus anderen Ländern zeigen, dass der linke Flügel des Kapitals zu vielerlei "Gesichtsveränderungen" in der Lage ist, um jeweils neue Sackgassen für die Arbeiter aufzubauen. Sie können alle erdenklichen Vorschläge machen, auch z.B. "neue, von den Arbeitern selbst verwaltete Gewerkschaften" zu gründen oder zu befürworten, die Gewerkschaftsführer vor die Tür zu setzen. Ähnlich wie man bei einem Gefängnis den Direktor verjagen kann, das Gebäude bleibt aber ein Knast, auch wenn er jetzt von den Wärtern, den kleinen Basisfunktionären, selbst verwaltet wird! Kr. (Weltrevolution Nr. 31, April 1988)
Aktuelles und Laufendes:
- Arbeiterkampf [40]
Vor 20 Jahren - Krupp Rheinhausen Winter 1987/88
- 4485 reads
Wir veröffentlichen nachfolgend einige Artikel, die wir in unserer Zeitung Weltrevolution vor 20 Jahren im Jan. 1988 zum Kampf der Beschäftigten von Krupp-Rheinhausen (Duisburg) veröffentlichten.
Lehren aus den Dezember-Kämpfen Solidarität muß zum Zusammenschluß der Kämpfe führen
Am 27. Nov. letzten Jahres brach der Kampf um Krupp-Rheinhausen aus. Zu einer Zeit, in der die Bourgeoisie massive Angriffe gegen die gesamte Arbeiterklasse vornimmt, wurden die Schließung des Duisburger Werkes von Krupp-Rheinhausen und die Entlassung von über 5.000 Arbeitern angekündigt. Diese Nachricht löste den massivsten Kampf aus, der seit den 1920er Jahren in Deutschland stattgefunden hat.. Die Arbeiter dehnen den Kampf aus Als die Entlassungen bekannt wurden, reagierten die Arbeiter sofort: sie legten die Arbeit nieder und riefen alle Arbeiter der Stadt zu einer Vollversammlung auf. Die Belegschaften von Thyssen und Mannesmann in Duisburg traten sofort in Solidaritätsstreiks. Somit wurde klar, daß die Entlassungen bei Krupp alle Arbeiter angehen, und daß vor allem im Ruhrgebiet die aktive Solidarität nicht ausbleiben durfte. Am 30.11. fand eine Vollversammlung mit 9.000 Arbeitern von Krupp und massiven Delegationen der anderen großen Fabriken in Duisburg statt. Die Versammlung rief zum gemeinsamen Kampf im Ruhrgebiet auf. Am 1.12. fanden in 14 Krupp-Werken im Bundesgebiet Demos und Vollversammlungen statt, an denen sich starke Delegationen aus Rheinhausen beteiligten. Am 3.12. demonstrierten 12.000 Schüler in Rheinhausen gegen die geplanten Entlassungen. Eine Delegation von Bergarbeitern forderte einen gemeinsamen Kampf von Berg- und Stahlarbeitern. Das gesamte Ruhrgebiet war mobilisiert und kampfbereit! Am 8.12. demonstriertem Bedienstete der Stadt Duisburg (über 10.000) in Rheinhausen, um ihre Solidarität zu bekunden. Die Gewerkschaften, die zunächst Schwierigkeiten hatten, diese Flut der Solidarität der Arbeiter einzudämmen. traten auf den Plan. Sie kündigten am 5.12. einen Aktionstag für den 10.12. an, an dem sich das ganze Ruhrgebiet beteiligen sollte. Ihr Ziel war es, die Kampfbewegung unter ihre Kontrolle zu bringen und sie somit scheitern zu lassen. Da der Solidaritätswille der Arbeiter nicht leicht zu brechen und die Notwendigkeit eines gemeinsamen Kampfes für alle Arbeiter klar war, mußten die Gewerkschaften diesen Drängen der Arbeiter zum Schein nachgeben, um der Bewegung so die Spitze zu brechen. Der Aktionstag sollte angeblich den Verkehr im Ruhrgebiet lahmlegen. Was geschah aber tatsächlich? Denn in Wirklichkeit bedeutete dies, daß die Arbeiter nicht gemeinsam und vereinigt demonstrierten, nicht in Massenversammlungen den weiteren Verlauf des Kampfes diskutieren konnten, sondern daß sie isoliert voneinander, über das ganze Ruhrgebiet zerstreut, in Gruppen zersplittert Straßen blockierten. Nach einigen Stunden dieser Aktion waren nur noch wenige Arbeiter an den Straßenkreuzungen von Duisburg anzutreffen. Die meisten waren mit einem miesen Gefühl nach Hause gegangen. Und dennoch hätte es ganz anders kommen können. An diesem Tag fand eine Vollversammlung um 7.30 Uhr bei Krupp statt, an der 3.000 Arbeiter teilnahmen. Um 10.00 Uhr fand eine weitere Vollversammlung der Thyssen-Arbeiter statt. Postbeschäftigte und Arbeiter aus Süddeutschland kamen nach Rheinhausen. 90.000 Stahlarbeiter standen im Kampf, gleichzeitig legten 100.000 Bergleute aus Solidarität für einige Stunden die Arbeit nieder. An verschiedenen Orten verließen die Arbeiter die Fabriken und demonstrierten wie z.B. bei Opel-Bochum. Das Ausmaß der Mobilisierung und der Kampfbereitschaft an diesem Tag hätte zu einer riesigen Machtdemonstration der Kraft der Arbeiterklasse werden können. Wenn all die mobilisierten Arbeiter nicht durch unendlich viele Straßenblockaden zerstreut voneinander gewesen, sondern geschlossen, zusammen auf die Straße gegangen wären, hätte die Kampfbewegung einen starken Impuls bekommen. Der 10.12. war der Höhepunkt des Kampfes um Rheinhausen, gleichzeitig aber zeigte er all die Schwächen des Kampfes auf, die die Gewerkschaften ausnutzen konnten, um den Kampf zu entschärfen. Am 11.12 kündigte Bonn die Entlassung von 30.000 Bergleuten an. Es kam aber nicht zu einem gemeinsamen Kampf von Berg- und Stahlarbeitern. Dafür hatte die IG-Bergbau gesorgt, die vor Solidaritätsaktionen gewarnt hatte mit den Vorwand, daß die Forderungen der Bergarbeiter dann untergehen würden, wenn sich die Bergleute mit den Stahlarbeitern solidarisierten.Die Gewerkschaften ließen dann eine Woche verstreichen, bevor eine erneute Massenaktion stattfand (18.12.)... ein Fackelzug mit anschließendem Gottesdienst. Sicherlich das beste Mittel, um die kämpferischsten Arbeiter fernzuhalten. In den nachfolgenden Wochen wurde klar, daß die Kampfbereitschaft der Kruppianer weiterhin sehr stark war, wie die spontane Reaktion in der Nacht des. 6. Januar aufzeigt, als die Arbeiter die Nachtschicht verließen und auf die Straße gingen, nachdem die Schließung von Rheinhausen als unvermeidlich angekündigt worden war. Dennoch ist die „aufsteigende Dynamik“ die der Kampf bis zum 10.12. aufwies, durch die Sabotagearbeit der Gewerkschaften gebrochen worden. Im neuen Jahr veranstalteten- die Gewerkschaften Aktionswochen in Form von sog. "Spaziergängen" mit Bus und Autos zu anderen Fabriken. Das ist eine Karikatur von dem, was die Arbeiter Anfang Dezember als eine Notwendigkeit spürten: die Ausdehnung und Vereinigung des Kampfes.Lehren aus dem Kampf – Nur die Vereinigung der Kämpfe kann die Angriffe zurückdrängenAls Anfang Dezember die Arbeiter in Rheinhausen den Kampf aufnahmen, dehnte er sich innerhalb von ein paar Tagen auf das ganze Ruhrgebiet aus. Heute hingegen "spazieren" die Krupp-Arbeiter von einem Betrieb zum anderen und erhalten schön klingende Solidaritätserklärungen der Betriebsräte dieser Betriebe. Es ist keine Rede mehr vom gemeinsamen Kampf. Das weiß auch die Bourgeoisie, die ihre Position verhärtet und die Schließung von Rheinhausen als unausweichlich erklärt. Die Frage muß also gestellt werden, was diese Wende herbeigeführt hat, wieso nach dem anfänglich so breiten Kampf letztendlich die Krupp-Arbeiter alleine zurückbleiben? Und die Lehre, die man ziehen muß, ist, daß Sympathiestreiks und Solidaritätsbekundungen zwar ein wichtiger Schritt sind, daß sie aber nicht ausreichen, um die Entlassungen und die Angriffe der Bourgeoisie zurückzudrängen. Die Solidarität muß zur Vereinigung der Kämpfe selber führen. Aber was heißt Vereinigung?Wenn die Arbeiter in Rheinhausen den Kampf gegen Entlassungen aufnehmen, dann sind ihr Kampf und ihre Forderungen grundsätzlich die gleichen wie in anderen Betrieben und Branchen. Die Bergleute werden wie die Stahlarbeiter von Massenentlassungen betroffen. Aber auch im öffentlichen Dienst werden die Angriffe stärker Haushaltskürzungen, Streichung von Krankenhausbetten, Privatisierungspläne bei der Post, Stellenstreichungen bei der Bahn...Die Solidarität mit Rheinhausen bedeutet den Kampf für die eigenen Forderungen aufnehmen. Grund genug dazu gibt es.Gerade für die Bergleute bestand kein Anlaß, sich zu verkriechen und sich zurückzuhalten, als die Stahlkocher zum gemeinsamen Kampf, zur Solidarität aufriefen. Denn wenn sich so wichtige Teile wie die Bergleute und die Stahlkocher zusammen in Bewegung setzen und gemeinsam ihr Gewicht in die Waagschale werfen, wenn sich bei; dieser Bewegung andere Beschäftigte anschließen, wie das Beschäftigte des öffentlichen Dienstes und Opel-Arbeiter ansatzweise taten, entsteht eine Sogwirkung, in der immer mehr Teile der Arbeiterklasse in Fluß geraten. Dann geraten die Kapitalisten und ihr Staat erst richtig unter Druck, und kein Teil der Arbeiterklasse steht dann mehr allein mit seinen Forderungen dem Kapital gegenüber. So haben die Bergleute im Dezember eine große Gelegenheit verpaßt, und es ist kein Zufall, daß just einen Tag nach dem 10.12., als der Zusammenschluß zwischen Bergbau und Stahl nicht hergestellt wurde, der Staat den Abbau von ca. 30.000 Arbeitsplätzen im Bergbau beschloß. Es liegt auf der Hand. Die besten Kampfmöglichkeiten bestehen dann, wenn andere Arbeiter schon in den Kampf getreten sind. Dann sind gemeinsames Auftreten, gemeinsame Demos, gemeinsame Vollversammlungen und Massendelegationen, gemeinsame Aktionen überhaupt einfacher durchzuführen. Aber um das zu erreichen, müssen sich die Arbeiter darüber bewußt werden, daß wenn heute die Arbeiter in einer Fabrik von Angriffen getroffen werden, sie selbst wenig später in die Schußlinie geraten werden. Deshalb: der Kampf der einen Arbeiter muß der Kampf der anderen Arbeiter werden!Und wenn es die Arbeiter irgendwo schaffen, die Angriffe des Kapitals zurückzudrängen, dann nur weil andere Arbeiter ebenfalls in den Kampf getreten sind. So können die Rheinhausener Arbeiter die Entlassungen nur abwehren, wenn das ganze Ruhrgebiet dahintersteht und mitkämpft.Die Krupp-Arbeiter haben durch ihren Kampf eine große Solidaritätswelle hervorgerufen Diese explosiven Reaktionen lassen darauf schließen, daß die aufsteigende Kampfbereitschaft immer größere Teile der Klasse zu neuen, heftigen Klassenauseinandersetzungen führen wird, In diesen werden die Arbeiter wieder den gleichen Schwierigkeiten und Spaltungstaktiken der Gewerkschaften gegenübertreten. Deshalb müssen sich bereits heute alle Arbeiter die Lehre zu Eigen machen, daß aktive Solidarität mehr als Sympathiebekundungen verlangt. Ja, nun muß selbst in den Kampf treten und versuchen, den Widerstand aller Arbeiter wirkungsvoll zusammenzuschließen, ihn zu "vernetzen", wie es von den Rheinhausener Arbeitern formuliert wurde. Dies heißt aber. daß sich die Arbeiter nicht mehr in den Fangnetzen der Gewerkschaften fangen lassen dürfen. Die Bestrebungen zum Zusammenschluß der Kämpfe können nur gegen den Widerstand, gegen die Sabotagetaktik der Gewerkschaften erfolgen. Und dies erfordert nichts anderes, als daß die Arbeiter selbst die Initiative in die Hand nehmen. Daß diese Perspektive keine Utopie, sondern eine reale Möglichkeit ist, beweist die Initiative von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, wie wir in dieser Zeitung zeigen.17.1.1988 Nat. (Weltrevolution Nr. 30, Jan-März 1988)
Die Intervention der IKS in den Kämpfen
In Weltrevolution Nr. 29 schrieben wir einen Artikel zum Klassenkampf in der BRD mit dem Titel: "Massive Kämpfe rücken näher". Wir zeigten anhand vieler Beispiele des Widerstands gegen die Flut der Angriffe auf allen Ebenen auf, wie in der BRD zunehmend das Potential für einen breiten Abwehrkampf der Arbeiter heranreift. Diese Einschätzung war Anlaß für die IKS, ein Flugblatt mit dem Titel: "Für bundesweite Aktionen aller Arbeiter gegen alle Angriffe" herauszugeben. Die Gleichzeitigkeit des Widerstands bei Stahl, Kohle und im öffentlichen Dienst bietet die Möglichkeit der massiven Ausdehnung und Vereinigung des Arbeiterkampfes. Demonstrationen und Versammlungen sind dazu besonders geeignete Mittel. "Entschlossene Arbeiter müssen jetzt schon dafür eintreten, bei Diskussionen, Versammlungen, Demonstrationen das Wort ergreifen, um sich für diese Perspektive des gemeinsamen Kampfes stark zu machen. Arbeiter verschiedener Betriebe und Branchen müssen direkten Kontakt zueinander aufnehmen, um den Zusammenschluß der Kämpfe in die Wege zu leiten" (17. Nov.'87). Im Rahmen ihrer Analyse der Lage in der BRD wurde die IKS vom Ausbruch des Kampfes der Krupp-Beschäftigten dessen Ausbreitung nicht überrascht. Das oben erwähnte Flugblatt wurde vor und während des 10. Dezembers an Fabriken im Ruhrgebiet und in Köln, die unterschiedlichen Branchen von Chemie und Automobil über öffentlichen Dienst, Maschinenbau bis zur Stahlindustrie angehören, verteilt. Der 10. Dezember 1987 konnte schon im voraus zumindest als der erste Höhepunkt dieser Kampfbewegung eingeschätzt werden - der Tag, an dem sich das Schicksal der weiteren Bewegung entscheiden sollte. Auf dem Spiel stand, ob es den Arbeitern gelingen würde, der Ausdehnung des Kampfes auf andere Betriebe Schritte näher zu kommen, oder ob die Gewerkschaften trotz der massenhaften Mobilisierung dcr Arbeiter die einzelnen Bereiche voneinander isolieren könnten. In dieser Lage konzentrierte sich unsere Intervention entsprechend unserer bescheidenen Kräfte auf Punkte, wo möglichst viele Arbeiter in Versammlungen zusammenkamen - die Kundgebung um 7 Uhr vor den Tor I von Krupp-Rheinhausen und die Belegschaftsversammlung bei Thyssen. Ziel war es, für massive Versammlungen bzw. Demonstrationen zu werben, auf denen die Arbeiter aus verschiedenen Branchen über die Fortführung des Kampfes debattieren und entscheiden könnten, und die Isolierungsstrategie der Gewerkschaften mit ihren Straßenblockaden als Falle zu entblößen. Tatsächlich hat das gewaltsame Eindringen der Rüttger-Arbeiter bei der Thyssen-Versammlung in Duisburg-Hamborn uns mit dieser Orientierung recht gegeben. Diese Arbeiter hatten nämlich den Werkschutz beiseite gedrängt, der nur den Zutritt von Thyssen-Arbeitern zulassen wollte. Dennoch blieben solche Vorstöße auf dem halben Weg stecken, wie bei Thyssen, wo die Rüttger-Arbeiter sich letztlich der Versammlungsleitung des Betriebsrates beugten und einfach ruhig im Saal Platz nahmen, nachdem der BR selbst zu Beginn der Versammlung "betriebsfremde" Arbeiter zum Verlassen des Saales aufgefordert hatte.Dieser Tag hat sowohl die ganze Kraft und das ganze Ausmaß der Bewegung ans Licht gebracht, als auch ihre Grenzen aufgezeigt, die in den nachfolgenden Aktionen überwunden werden mußten, sollte die positive Dynamik des Kampfes nicht endgültig gebrochen werden. Die IKS brachte sofort ein weiteres Flugblatt heraus, mit dem die Lehren des 10.12. gezogen werden sollten, um so auf die weitere Entwicklung Einfluß zu nehmen. "Die Verstärkung des Kampfes liegt aber jetzt darin, die Arbeitsniederlegungen auszunutzen, um möglichst massive Straßendemonstrationen aller Arbeiter durchzuführen, sowie öffentliche Massenkundgebungen, wo die Arbeiter selber ans Mikrophon gehen, Kampferfahrungen austauschen und gemeinsame Forderungen ausarbeiten. Aus Solidarität die Arbeit niederzulegen und bei Demos mitzumarschieren, ist ein erster Schritt, der aber als solcher nicht ausreicht. Ihm muß ein zweiter folgen: die anderen Arbeiter müssen ihre eigenen Forderungen aufstellen und selbst in den Kampf treten (Flugblatt der IKS 12.12.1988).Die Waffen des Proletariats sind sein Klassenbewußtsein und seine Organisationsfähigkeit. Das eine kann sich ohne das andere nicht entwickeln, und der Kampf selbst ist die Schule, in denen beides gelernt wird. Die Aufgabe der Revolutionäre kann also nicht nur im Aufzeigen des allgemeinen Ziels der Arbeiterkämpfe bestehen. Sie müssen darüber hinaus in der Lage sein, in den Kämpfen der Arbeiter konkret und realistisch die nächsten Schritte aufzuzeigen. Die Klarheit der Prinzipien in allen grundsätzlichen Fragen ist dabei ebenso wichtig wie die Anwendung der marxistischen Methode zur Analyse der Lage im Allgemeinen, wie von Tag zu Tag und die Entschlossenheit nicht abseits zu stehen, sondern einzugreifen und teilzunehmen am Kampf der Arbeiter. EMT (Jan. 1988). Das unten abgedruckte Flugblatt, von Arbeitern aus Kölner Krankenhäusern herausgegeben , und vertrieben, und unter anderem bei Krupp-Rheinhausen im Dezember verteilt, zeigt konkret auf, daß es möglich ist, völlig unabhängig von gewerkschaftlichen oder anderen staatlichen Organen, direkt die Initiative zu ergreifen und auf einen Zusammenschluß aller Arbeiter hinzuarbeiten. Leider geben die Herausgeber des Flugblatts keine Kontaktadresse an. Auf jeden Fall ist diese wie ähnliche Initiativen in anderen Ländern ein Beispiel, das Schule machen sollte.
Arbeiter- ergreifen selbst die Initiative
Gemeinsam können wir mehr erreichen Wir sind eine kleine Gruppe, die sich aus dem Personal der Kölner Krankenhäuser zusammengesetzt hat. Wir sind keiner Gewerkschaft und keiner Partei untergeordnet, sondern wir vertreten hier unsere eigene Meinung. Weshalb wir uns zu Wort melden ist, daß die Bedingungen in den Krankenhäusern für das Personal sowie für die Patienten immer unerträglicher werden. Den Anstoß für diese Stellungnahme haben uns die Beispiele aus dem Ruhrgebiet gegeben, wo Hundertausende sich gemeinsam und solidarisch gegenüber den Massenentlassungen im Bereich der Stahlindustrie und dem Bergbau gezeigt haben.Auch der öffentliche Dienst einschließlich der Krankenhäuser haben sich durch Arbeitsniederlegungen und Teilnahme an Demos daran beteiligt, wobei aber noch keine eigenen Forderungen gestellt wurden. Denn es geht nicht darum, aus Mitleid mit den Kruppianern auf die Straße zu gehen, sondern es gilt zu verstehen, daß wir alle den gleichen Angriffen ausgesetzt werden und uns auch nur gemeinsam dagegen wehren können. Das Gegenstück der Massenentlassungen in der Industrie ist im öffentlichen Dienst der Stellenabbau bzw. Einstellungsstop.Die Auswirkungen sind jeweils die gleichen: auf der einen Seite die Arbeitslosigkeit; auf der anderen die Mehrbelastung der noch Übriggebliebenen. Durch die Streichung der Steuerfreibeträge für Wochenend-, Feiertags- und Nachtarbeit werden gleichermaßen der öffentliche Dienst sowie die Industrie betroffen. Durch Blüms "Reform" des Gesundheitswesens wird nicht nur das Personal der Krankenhäuser sondern die ganze Bevölkerung getroffen.Es hat sich gezeigt, daß "Vater Staat" genauso rücksichtslos und brutal mit seinen Beschäftigten umspringt wie jeder private Unternehmer. Angesichts dieser Tatsache befürworten wir, daß möglichst massive Protestaktionen und Demos zustande kommen, bei denen die Rücknahme der Massenentlassungen, der "Gesundheitsreform" usw. . verlangt wird.Wir sollten dem Beispiel des Ruhrgebiets folgen und uns ebenfalls in Köln solidarisch erklären mit der KHD (2000 Entlassungen).Dieses Schriftstück soll ein Beispiel dafür sein, daß wir auch als kleine Gruppe, ohne die Parteien, Gewerkschaften usw. selbst aktiv werden können. Wir sind keine passive Manövriermasse. Jeder kann und muss sich zu Wort melden.
"Neue Töne der Linken zur Verteidigung des Kapitals"
Seit Jahren hat man sich daran gewöhnt, bei gewerkschaftlich orientierten Veranstaltungen zum Thema Klassenkampf mit Schlachtrufen wie "bedingungslose Verteidigung der Gewerkschaften" (die das Kapital angeblich 'zerschlagen' will) regelrecht bombardiert zu werden. Zwar vergaßen die Linken und die Basisgewerkschafter meistens nicht, die Gewerkschaftsführung zu kritisieren. Aber wenn jemand behauptete, die Arbeiter können und müssen ihren eigenen Kampf gegen die gewerkschaftliche Sabotage selber führen, bekamen diese regelrechte Wutanfälle und blockierten jede Diskussion darüber sofort ab.Bei einer öffentlichen Großveranstaltung des basisgewerkschaftlichen Solidaritätskomitees Krupp am 12. Februar 1988 in Berlin konnte man jetzt ganz andere Töne hören. Bereits das Einführungsreferat des Sprechers des Komitees erzählte etwas über eine "neue Arbeiterbewegung", und über die Suche der Arbeiter im Ruhrgebiet im Dezember nach "neuen, wirkungsvolleren Kampfformen", die "mehr Spaß machen" als die "traditionellen, langweiligen, gewerkschaftlichen Methoden". Auch der Hauptredebeitrag des Abends, vom Krupp - Rheinhausener Betriebsratsvertreter T. Steegmann gehalten, der als direktes Ausführungsinstrument der IGM Klassenkampf-Sabotage vor Ort sogar den "Kollegen Steinkühler" in Schutz nehmen wollte, betonte vor allem die Eigeninitiative der Arbeiter während der Dezemberkämpfe.Was steckt hinter dieser neuen Tonart der "kritischen" aber unerbittlichen Verteidiger der Gewerkschaften? Sie haben ihre Rolle nicht aufgegeben; sie haben sich nicht geändert. Sie passen sich lediglich einer veränderten Situation an, damit sie ihre alte Bremserrolle des Klassenkampfes weiterspielen können. Vor Jahren haben sie voller Schadenfreude zu uns gesagt: "wartet ab, bis die Kämpfe richtig ernst werden. Dann werden die Arbeiter euch die Fresse polieren, wenn ihr immer noch vom Klassenkampf außerhalb und gegen die Gewerkschaften sprecht". Aber es ist anders gekommen. Die 'Linken' in Deutschland wissen ganz genau, dass während des Eisenbahnerstreiks in Frankreich im Dezember 1986 oder in den Kämpfen im öffentlichen Dienst in Italien im Frühjahr letzten Jahres eine enorme gewerkschaftsfeindliche Stimmung unter den Arbeitern herrschte, und dass die französischen und italienischen "Linken" vielfach ihre gewerkschaftlichen Mitgliedsbücher und Anstecknadeln wegstecken müssen, um überhaupt in die Arbeiterversammlungen reinkommen zu können. Sie wissen inzwischen auch, dass der IG-Metall Chef Steinkühler, der am 12. Dez. am Rheinhausener Bahnhof noch kritisiert wurde, erst so spät nach Rheinhausen gekommen zu sein, am 17. Februar von den versammelten Belegschaften von Krupp, Thyssen und Mannesmann in Duisburg einfach ausgepfiffen worden ist, als er die Entlassungen dort zu rechtfertigen versuchte. Kurzum, sie wissen, dass der gleiche Reifungsprozess des Arbeiterbewusstseins so wie in Frankreich oder Italien auch in der BRD Fortschritte macht und die gewerkschaftliche Kontrolle über die Kämpfe wackliger macht. GEWERKSCHAFTLICHE "SOLIDARITÄT" = GELDSAMMLUNGEN UND GRUSSBOTSCHAFTEN
Auch wenn die Basisgewerkschafter zu den "traditionellen, bürokratischen, legalistischen Methoden" der Gewerkschaften auf Distanz gehen, auch wenn linkskapitalistische Gruppen wie die stalinistische MLPD von der Initiative "der Basis" schwärmen oder der trotzkistische BSA gegen den "Verrat der IGM - Führung" Sturm läuft, sie vertreten immer noch konsequent die gleiche gewerkschaftliche Ausrichtung, die den Arbeiterkampf unweigerlich in Niederlagen führen will. Denn die Botschaft dieser Veranstaltung, von sämtlichen Podiumssprechern sowie von vielen Vertrauensleuten aus verschiedenen Berliner Betrieben lautete: Solidarität mit Krupp heißt Geld auf das Rheinhausener "Solidaritätskonto" zu überweisen, Sympathiebekundungen und -botschaften zu organisieren usw.WIRKLICHE SOLIDARITÄT HEISST SELBER DEN KAMPF AUFNEHMEN UND IHN ZUSAMMENSCHLIESSENAuch die IKS hat auf dieser Veranstaltung das Wort ergriffen, um eine ganz andere Orientierung vorzuschlagen! Solidarität heißt, selber den Kampf aufnehmen, für die eigenen Forderungen eintreten und diesen Kampf mit dem Kampf der Kruppianer sofort Branchen und Regionen übergreifend verschmelzen. Auch wenn diese Perspektive - die einzige, die genügend Kraft schöpfen kann, um das Kapital zurückzudrängen - nicht sofort im vollen Umfang realisierbar ist, riefen wir alle Anwesenden auf, selber die Initiative zu ergreifen, um diese Perspektive vorzubereiten. Anstatt Geld zu überweisen, sollte man das Geld selber nehmen, um z.B. ein Flugblatt herauszubringen, das sich für die Notwendigkeit des gemeinsamen Kampfes aller Arbeiter stark macht. Zu diesem Zweck ist es notwendig, die kämpferischen Arbeiter zusammenzuschließen, Kampfkomitees zu bilden, wo die am meisten fortgeschrittenen Arbeiter außerhalb jeder gewerkschaftlichen Bevormundung zusammenkommen.Während das Präsidium und die linken Gewerkschafter mit keinem Wort auf diesen Beitrag eingegangen sind, beweist die lebhafte Zustimmung, die es unter den mehreren Hundert Anwesenden gab, dass immer mehr Arbeiter dabei sind, sich mit den wirklichen Lehren aus den Dezemberkämpfen auseinanderzusetzen.Es geht hier um die politische Vorbereitung der kommenden Kämpfe, damit sie weiter gehen können als die bisherigen. Gerade die Kämpfe im Ruhrgebiet im Dezember haben diesem Prozess schon Auftrieb verliehen. Aber die Berliner Großveranstaltung zeigt auf, dass die Basisgewerkschafter die Gefahren dieser Entwicklung für das kapitalistische System - die zu einer offenen Infragestellung der Gewerkschaften führen kann - voll erkannt haben. Sie machen mobil, um zu verhindern, dass die wirklichen Lehren gezogen werden.Sie stellen als die Stärken der Dezemberbewegung gerade ihre Schwächen heraus - ihr Unvermögen, über noch zu beschränkte Solidaritätsgesten hinauszugehen oder die gewerkschaftliche Kontrolle abzuschütteln, Die Geschichte und die Erfahrung aus anderen Ländern zeigen, dass der linke Flügel des Kapitals zu vielerlei "Gesichtsveränderungen" in der Lage ist, um jeweils neue Sackgassen für die Arbeiter aufzubauen. Sie können alle erdenklichen Vorschläge machen, auch z.B. "neue, von den Arbeitern selbst verwaltete Gewerkschaften" zu gründen oder zu befürworten, die Gewerkschaftsführer vor die Tür zu setzen. Ähnlich wie man bei einem Gefängnis den Direktor verjagen kann, das Gebäude bleibt aber ein Knast, auch wenn er jetzt von den Wärtern, den kleinen Basisfunktionären, selbst verwaltet wird! Kr. (Weltrevolution Nr. 31, April 1988)
IKSonline - 2008
- 3566 reads
Januar 2008
- 769 reads
Ein Bericht über Buchvorstellungen und Diskussionen auf der Nürnberger Buchmesse 2007
- 3795 reads
Vom 14. – 16. Dezember 2007 fand die 12. Linke Literaturmesse in Nürnberg statt. Veranstaltet wird dieses Ereignis von dem Archiv und der Bibliothek Metroproletan sowie dem Gostenhofer Literatur- und Kulturverein Libresso in Nürnberg (www.linke-literaturmesse.org [90]). Dort finden jährlich Veranstaltungen, Buchvorstellungen, Lesungen sowie natürlich eine Verkaufsmesse statt. Die IKS hat sich in diesem Jahr vor allem deshalb daran beteiligt, um ihr soeben auf Deutsch erschienenes Buch über die Italienische Kommunistische Linke bekannt zu machen. Wir nutzten unsere Anwesenheit, um uns an den vor Ort stattfindenden Diskussionen zu beteiligen. Es wurden teilweise sehr interessante neue Bücher vorgestellt, und es fand ein anregender Meinungsaustausch nicht nur auf den Veranstaltungen und Buchvorstellungen statt, sondern auch an den Büchertischen und anderswo. Wir wollen an dieser Stelle ein Echo der Diskussionen wiedergeben, wobei wir über unsere eigene Veranstaltung – auf der wir unser neues Buch vorgestellt haben – gesondert berichten werden.
Demokratie und Reformismus
Da wir erst am Samstagmorgen anwesend sein konnten, bekamen wir die Vorstellung der Ulrike Meinhof-Biografie von Jutta Ditfurth am Freitag Abend nicht mit. Da wir außerdem unseren Büchertisch betreuen mussten, war die Buchvorstellung Kapitalismus versus Barbarei mit dem Autor Michael Klundt (Hrg.) am frühen Nachmittag die erste Veranstaltung, die wir besuchen konnten. Der Autor, ein Vertreter der Linkspartei, wies auf die faktische Entwicklung der Barbarei in der modernen Welt hin. So z.B. auf die geschätzten 6.000 Menschen, die im vergangenen Jahr bei dem verzweifelten Versuch, von Afrika aus die Kanarischen Inseln und somit das Territorium der Europäischen Union zu erreichen, ertrunken waren. Er schien einseitig die „neoliberalen“ Vertreter der Bourgeoisie dafür verantwortlich zu machen. Bezug nehmend auf eine Formulierung Hitlers, derzufolge die wirtschaftliche Form, welche am besten der politischen Institution der Demokratie entspreche, der Kommunismus sei, deutete er an, dass das Großbürgertum seit 1989 der parlamentarischen Demokratie überdrüssig geworden sei und nach Wegen suche, sich dieser zu entledigen. Vor diesem Hintergrund behauptete er, dass selbst die banalsten Reformprojekte der „Linke“ gegenwärtig eine neue Brisanz gewännen. Wir erwiderten darauf, dass es keine Anzeichen einer solchen Entwicklung gibt. Vielmehr haben die Jahrzehnte nach der Niederlage Hitlerdeutschlands dem „Westen“ zu Genüge bewiesen, dass die Demokratie die ideale Herrschaftsform des modernen Kapitalismus liefert und dass die herrschende Klasse gerade heute, in Zeiten steigender Kampfbereitschaft der Arbeiterklasse, dieses Mittel der sozialen Kontrolle nicht aus der Hand geben wird. Was den angeblich fortschrittlichen Reformismus der „Linke“ betrifft, so wollten wir wissen, ob der Autor auch die SPD-PDS-Koalition in Berlin dazu zähle. Darauf antwortete er, wie die Anderen auch, mit der Behauptung, dass die Vorläuferregierung an allem Schuld sei. Die Diskussion endete mit der Erörterung der Frage, ob Reformen im heutigen Kapitalismus überhaupt möglich sind.
Islamismus und westlicher Imperialismus
Der deutsche Journalist Marc Thörner hat seine Erfahrungen als Reporter an der Kriegsfront im Irak oder auch als Beobachter einer Reihe „islamischer“ Länder in Buchform verarbeitet (Der falsche Bart). In seinem Vortrag thematisierte er die Rolle des Westens gegenüber islamistischen Gruppen wie die GIA in Algerien. Er legte dar, wie die Regierung in Algier, mit Unterstützung Frankreichs, die terroristische GIA - eine Abspaltung der ebenfalls islamistischen FIS – instrumentalisierte, um an der Regierung zu bleiben. Auch wies er darauf hin, wie führende islamistische Theoretiker aus bürgerlichen Ideologien des Westens geschöpft haben, vornehmlich aus den antimodernen und antimaterialistischen Strömungen Europas. Am Beispiel Tunesiens zeigte er auf, wie auch Deutschland im Namen des „Kampfes gegen den Terrorismus“ Folterregimes unter die Arme greift und die dortigen Polizeikräfte auch noch ausbildet. Was die Lage im Irak betrifft, so erläuterte er den Strategiewechsel der USA im Irak, die im „sunnitischen Dreieck“ inzwischen auf die alten Baathisten aus dem Umfeld des inzwischen hingerichteten, ehemaligen Diktators Saddam Hussein setzen. In der Diskussion wies die IKS auf die wachsenden sozialen Spannungen in diesem Teil der Welt hin, welche in den offiziellen Medien verschwiegen werden. Wir erwähnten die Streikbewegungen in Ägypten oder Dubai, die Wut der Bevölkerung im Irak auf die angeblich „eigenen“ Terrorgruppen, aber auch die Unzufriedenheit vieler amerikanischer Soldaten im Irak. Letzteres bestätigte Thörner. Dabei sagte er, dass der schlimmste Kriegstreiber in der US-Armee vor Ort nicht einmal das Offizierskorps sei, sondern die Militärgeistlichkeit.
RAF und Antisemitismus
Joachim Bruhn und Jan Gerber vom Verlag ça ira (Freiburg im Breisgau) stellten ihr Buch vor: Rote Armee Fiktion. Sie begannen mit einer Einschätzung des Buches von Ditfurth über Ulrike Meinhof, das das „Niveau der Bunte“ (eine deutsche Klatschzeitschrift) habe und das Wesentliche an Meinhof übersehen habe: dass sie politisch ungebildet gewesen und mehr oder weniger zufällig in die Illegalität abgerutscht sei. Ebenso entschieden wandten sich Bruhn und Gerber gegen die von den Medien und der politischen Klasse betriebenen Glorifizierung der Opfer des Terrors. Obwohl Attentate zum Berufsrisiko der Manager und Politiker gehören wie die Staublunge zum Bergarbeiter, habe man noch nie von einer öffentlichen Würdigung des Leidens Letzterer gemerkt. Zu Recht verwiesen die Autoren auf die Sinnlosigkeit terroristischer Anschläge sowie auf ihre Verwurzelung im Unverständnis, dass nicht die Führer, die lediglich „Charaktermasken“ des Kapitals sind, sondern die Funktionsweise des Systems das Grundproblem darstellt. Der geplante Brandanschlag der RAF auf ein Kaufhaus in Frankfurt wurde als Beispiel für den kleinbürgerlichen, vom protestantischen Moralismus beeinflussten Moralismus Meinhofs und ihrer Umgebung genannt: Sie predigten Askese, Reinheit und Lustfeindlichkeit, anstatt zu begreifen, dass es darum geht, Luxus und das schöne Leben allen Menschen zu ermöglichen. Auch die autoritäre Staatsgläubigkeit der RAF wurde anhand des Hangs dieser Gruppe thematisiert, sich gegenüber der Bundesregierung als „Gegenstaat“ aufzuspielen. Unter Hinweis auf die Tradition des Rätekommunismus Anton Pannekoeks und Cajo Brendels wurde auch der „Leninismus“ der RAF kritisiert. Gemeint ist damit die Vorstellung, dass dem Proletariat revolutionäres Bewusstsein von Außen, durch linke Intellektuelle, „vermittelt“ werden müsse. Vor allem wurden die antisemitischen Tendenzen der RAF (Anschläge auf jüdische Einrichtungen, Parteinahme für „die Palästinenser“ im Nahostkonflikt, Begrüßung des Anschlags gegen israelische Sportler bei den Olympischen Spielen von 1972 in München u.a. durch Ulrike Meinhof) thematisiert und ebenso verurteilt wie ihr positiver Bezug auf die deutsche Nation als ein angeblich vom amerikanischen Imperialismus zu befreiendes Subjekt. Es wurde aufgezeigt, wie diese reaktionären Vorstellungen mehr oder weniger zum Allgemeingut der damaligen linken, „antiimperialistischen“ Szene gehörten und zum Teil noch gehören. In unserer Wortmeldung unterstützten wir viele Aussagen in beiden Referaten. Was die Rolle des Antisemitismus betrifft, so hat bereits Trotzki darauf hingewiesen, wie dieser wesentlich zum System des Stalinismus gehörte und zur Stabilisierung des eigenen Regimes zielstrebig eingesetzt wurde. Aber auch wenn August Bebel mit seiner Bezeichnung des Antisemitismus als „Sozialismus des dummen Kerls“ die davon ausgehende Gefahr unterschätzte, so war die marxistische Arbeiterbewegung in Deutschland zurzeit der Antisozialistengesetze nicht antisemitisch, sondern der Vorkämpfer dagegen. Erst die Niederlage der Weltrevolution ermöglichte den Vormarsch des Nationalismus und des Rassismus vor allem mit dem Sieg der stalinistischen Konterrevolution. Was die Bezugnahme auf den Rätekommunismus betrifft, so haben wir darauf hingewiesen, dass für den damaligen „Rätekommunismus“ wie für die Kommunistische Linke insgesamt das wirklich bedeutende und zukunftsweisende Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre weder die RAF noch die Studentenbewegung war, sondern das Wiederauftauchen wilder, illegaler, außergewerkschaftlicher und oft antigewerkschaftlicher Kämpfe der Arbeiterklasse. Wir betonten die Wichtigkeit der Wiederaneignung der Lehren dieser Kämpfe gerade heute, im Vorfeld erneuter größerer Arbeiterkämpfe. Diese Wortmeldung löste eine heftige Reaktion Joachim Bruhns aus. Die positive Bezugnahme der Kommunistischen Linken auf die Arbeiterklasse und ihre Kämpfe teile er keineswegs. Die Nazizeit habe in Deutschland eine Volksgemeinschaft zustande gebracht, einen die Kapitalisten und die Arbeiterklasse einschließenden Mob erzeugt, welcher bis heute Bestand habe. So sei für ihn jede positive Bezugnahme auf Arbeiterkämpfe und Arbeiterforderungen ausgeschlossen. An dieser Stelle mussten wir die Veranstaltung verlassen, um unsere eigene abzuhalten. Wir waren aber dankbar für diese Klarstellung. Sie macht deutlich, dass das Milieu der sog. Antideutschen (zu dem ça ira und Bahamas gehören), sofern es die Unterstützung eines imperialistischen Lagers gegen ein anderes (jenes Israels und der USA im Nahostkonflikt) zur Leitlinie seiner Politik macht, nichts zu tun haben kann mit der Tradition eines Anton Pannekoek oder Cajo Brendel, welche sich internationalistisch auf die Seite des Proletariats gegen alle imperialistischen Lagern gestellt haben.
In der Scheiße leben
Ingrid Scherf stellte das lesenswerte Buch von Mike Davis über die Explosion der Megacities vor: Planet der Slums. Davis zieht Parallelen zwischen der Schilderung der Lage der arbeitenden Bevölkerung im Frühkapitalismus durch Friedrich Engels (Die Lage der Arbeiterklasse in England) und das Leben eines Großteils der Menschheit heute. Die Exkremente von fünf Milliarden Menschen werden entweder unbehandelt entsorgt oder nicht einmal das – so dass die Menschen mitten drin leben müssen. Eine Stadt wie Kinshasa in Zentralafrika, welche bald zehn Millionen Einwohner haben wird, verfügt über gar kein Abwassersystem. Davis spricht ein Thema an, welches aus Sicht des Marxismus zu den Grundproblemen der Klassengesellschaft gehört, die eine künftige kommunistische Gesellschaft lösen muss: der wachsende Widerspruch zwischen Stadt und Land. So war es wichtig, dass ein Teilnehmer der Diskussion auf die Notwendigkeit verwies, den Zustrom vom Lande in die Stadt umzukehren. Ingrid Scherf wiederum antwortete darauf, dass dies unmöglich sei, ohne die Ursachen der Landflucht wie die Verarmung der Kleinproduzenten, ihre Vertreibung zugunsten von Weltmarktplantagen, Bürgerkriege usw. zu beseitigen. So entwickelte sich eine Diskussion über die Frage, inwiefern die Slums von heute eine Barriere für die Entwicklung künftiger Kämpfe darstellen aufgrund von Zerfallserscheinungen wie Bürgerkriege, Kriminalität und Bandenwesen, und inwiefern andererseits ein multinationales erwerbstätiges wie auch erwerbsloses Proletariat auch dort entsteht, ohne Vaterland und ohne dass es etwas zu verlieren hat, das sich an einem weltweiten revolutionären Ansturm der Zukunft beteiligen könnte. Es wurde auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Slumgesellschaften weder als homogene noch als passiv-hilflos auf Almosen angewiesene Gemeinschaften zu betrachten. Beispiele wurden gegeben von Kämpfen der Bewohner für den Anschluss an den öffentlichen Verkehr und an andere Infrastrukturen – nicht zuletzt um zur Arbeit gelangen zu können. Dies weist auf die Rolle der lohnarbeitenden, proletarisierten Schichten in diesen Teilen der Welt und der Gesellschaft hin. Auch wurde thematisiert, dass aufgrund der Erwerbslosigkeit der Männer zunehmend Arbeiterfrauen aktiviert werden. Schließlich regte eine junge Teilnehmerin ein Nachdenken über die Slumentwicklung in den kapitalistischen Metropolen an. Dies veranlasste Ingrid Scherf zu der Bemerkung, dass beispielsweise in New York die schlimmsten Elendsviertel inzwischen abgetragen worden sind, ohne dass Klarheit darüber herrsche, was aus ihren einstigen Bewohnern geworden sei.
Die Macht des Geldes
Theo Wentzke vom GegenStandpunkt Verlag stellte sein Buch Das Geld vor. Wir werden seine langen und aus unserer Sicht korrekten und interessanten Ausführungen dazu nicht wiedergeben. Sein Buch ist lehrreich und lesenswert. Man kann das alles natürlich auch bei Marx im Kapital nachlesen. Nachteilig an dieser Buchvorstellung wie auch an der von ça ca ira oder von Robert Kurz (worauf wir gleich zu sprechen werden) war, dass die Einleitungen fast die gesamte vorgesehene Zeit ausfüllten (eine Stunde). Bei der Veranstaltung zur RAF wurde eine Diskussion nur dadurch ermöglicht, dass der Raum am Abend nicht mehr gebraucht, somit die Zeit überzogen werden konnte. Diese Unart erinnert an die Uni, wo der Professor lehrt und die Schüler zuhören, um zu lernen (oder auch nicht). Es entspricht keineswegs dem kollektiven Charakter der Arbeiterklasse, deren Bewusstseinsentwicklung grundsätzlich nur kollektiv vonstatten geht.Somit konnten auch hier am Ende nur wenige kurze Fragen gestellt werden. Ein Genosse vom rätekommunistischen Kreis Revolution Times widersprach zu Recht unter Hinweis auf die Lohnarbeit, Warenproduktion und Geldwirtschaft, Ausbeutung und Entfremdung der Produzenten von ihrem Produkt und ihr Ausschluss von der Bestimmung über die Produktion der Behauptung Wentzkes, derzufolge in den stalinistischen Ländern kein Kapitalismus geherrscht habe. Die IKS wiederum wies darauf hin, dass der Vortrag wesentliche Folgen der kapitalistischen Geldwirtschaft außer Acht gelassen hatte, welche für Marx zentral waren, insbesondere die Überproduktionskrise und die Verarmung des Proletariats aufgrund der Entwicklung der Massenarbeitslosigkeit (industrielle Reservearmee resp. „Surplusbevölkerung“). Wentzke erklärte, diese Aspekte seien nur wegen Zeitmangels nicht angesprochen wurden. Eine Aussage, die wir bemerkenswert finden. Wir haben ganz andere Veranstaltungen von GegenStandpunkt erlebt, wo die Idee der Überproduktionskrise als Blödsinn abgekanzelt wurde. Denn die Frage der Krise stellt die Frage des Klassenkampfes und die Notwendigkeit der Revolution – Fragen, mit denen GSP bislang nichts zu tun haben wollte.
Die Frage der „nachholenden Modernisierung“
Unter dem Titel „Kapitalismuskritik light“ stellte Robert Kurz kein neues Buch vor, sondern einen neuen Arbeitskreis: Exit, der sich von Krisis abgespalten hat. Diese Gruppe treibt u.a. die Frage an: Was war das 1989 zusammengebrochene System im Osten? Was war die damit verbundene „alte“ Arbeiterbewegung? Seine Antwort: ein Prozess der „nachholenden Modernisierung“. Soll heißen: anstatt antikapitalistisch zu sein, hat die alte Arbeiterbewegung, haben Gewerkschaften, Sozialdemokratie sowie der „Kommunismus“ des Ostblocks dem Kapitalismus den Weg gebahnt. Einige Altstalinisten empörten sich über die Idee, dass die Ostblockstaaten nicht sozialistisch gewesen seien, und meinten, mit dieser Behauptung verabschiede man sich überhaupt von der Idee des Sozialismus. Die Kritik der IKS setzte an einer ganz anderen Stelle an. Wir begrüßten die Feststellung, dass die Ostblockländer nicht sozialistisch, sondern kapitalistisch waren. Zugleich äußerten wir die Befürchtung, dass der Begriff der nachholenden Modernisierung zu einer Beschönigung des Stalinismus führen könnte. Denn aus unserer Sicht ist der Stalinismus nicht nur kein Sozialismus gewesen, sondern nicht einmal eine fortschrittliche Entwicklung des Kapitalismus oder eine Tendenz zum Kapitalismus, sondern die Konterrevolution gegen die proletarische Weltrevolution. Das Wesen des Stalinismus war die Vorstellung des „Sozialismus in einem Land“, d.h. der Glaube an die Möglichkeit einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung durch eine Abkoppelung vom Weltmarkt (Autarkie). Damals führten die Marxisten zwei Hauptargumente gegen diese Auffassung an. Zum einen zeigten sie auf, dass der Sozialismus in einem Land unmöglich ist, da der Kapitalismus ein Weltsystem ist und nur als solches überwunden werden kann. Zum anderen wiesen sie darauf hin, dass nicht nur der Sozialismus, sondern selbst eine fortschrittliche Entwicklung des Kapitalismus in einem Land – also abgetrennt vom Weltmarkt – unmöglich, ja eine reaktionäre Utopie darstellt. Das Scheitern des Stalinismus wie auch anderer Autarkiemodelle - wie des Kemalismus in der Türkei - hat in den letzten Jahren diese Aussagen bestätigt.In seiner Erwiderung behauptete Robert Kurz, diese von uns vertretene Argumentationslinie führe geschichtsphilosophische Begriffe wie „fortschrittlich“ oder „reaktionär“ in die Diskussion ein, welche aus der Zeit der Aufklärung und von Hegel stammen und heute fragwürdig geworden sind. Darauf entgegneten wir, dass die Vorstellung, wonach der Kapitalismus, wie jede andere Produktionsweise, nach einer Phase der Förderung der Entwicklung der Gesellschaft zu einer Fessel dieser Entwicklung wird, nicht von Hegel stammt, sondern zu den Grundlagen des zuerst von Marx entwickelten historischen Materialismus gehört. Aufgrund von Zeitmangel konnte jedoch diese Diskussion leider nicht fortgeführt werden.Abgesehen von dieser Frage konzentrierte sich der Vortrag von Kurz im Wesentlichen auf eine Kritik an anderen gängigen „linken“ Auffassungen, die er als „Kapitalismuskritik light“ bezeichnete. Dabei ging er wesentlich behutsamer vor als ein Vertreter der „Antideutschen“, der die „Globalisierungsgegner“ von Heiligendamm undifferenziert als „antisemitischen Mob“ bezeichnete. Was allerdings Kurz wie viele andere „Marxologen“ aus unserer Sicht kennzeichnet, ist, dass sie nichts als Kritik und keine Perspektiven anzubieten haben. Dabei rührt der Reichtum beispielsweise der von Marx entwickelten Kritik an der „politischen Ökonomie“ gerade daher, dass er den Kapitalismus vom Standpunkt seiner Überwindung aus betrachtete – vom Standpunkt des Kommunismus. Dez 2007,
Gegen die Angriffe der Regierung müssen wir alle gemeinsam kämpfen
- 2904 reads
Im Namen einer „gerechteren Gesellschaft“ haben Sarkozy und seine Milliardärskumpels die Unverfrorenheit, uns aufzufordern, die Abschaffung bzw. Änderung der „Sonderrentenrechte“ zu akzeptieren und 40 Jahre lang für die Rente zu arbeiten. Was die Eisenbahnarbeiter, die Beschäftigten der RATP, der Gas- und Elektrizitätswerke fordern, wurde deutlich in ihren Hauptversammlungen zum Ausdruck gebracht: Sie wollen keine „Privilegien“, sie wollen die siebenundreißigeinhalb Jahre für alle! Wenn dieser Angriff auf die „Sonderrentenrechte“ hingenommen wird, dann wird, wie die ArbeiterInnen sehr gut wissen, der Staat demnächst von uns fordern, erst 41, dann 42 Jahre lang Beiträge zu leisten, um eine vollständige Rente zu erhalten – möglicherweise sogar noch länger, wie in Italien (das demnächst zu einem Renteneintrittsalter von 65 übergehen wird) oder in Deutschland und Dänemark, wo das Renteneintrittsalter auf 67 Jahre ausgedehnt wurde.
In den Universitäten hat diese Regierung (in Komplizenschaft mit der UNEF – der französischen Studentengewerkschaft – und der Sozialistischen Partei) klammheimlich ein Gesetz verabschiedet, das Tür und Tor öffnet für ein Universitätssystem der zwei Geschwindigkeiten: auf der einen Seiten ein paar „Eliteuniversitäten“, die für die Studenten mit dem besten Abschluss reserviert sind, und auf der anderen Seite eine Masse von niederen Universitäten, die die meisten jungen Studenten, die aus ärmeren Verhältnissen kommen, auf ihre künftige Rolle als arbeitslose oder prekäre ArbeiterInnen vorbereiten.
Im Öffentlichen Dienst stellt sich die Regierung darauf ein, bis 2012 300.000 Arbeitsplätze zu vernichten, und dies just zu einer Zeit, in der LehrerInnen sich überfüllten Klassenzimmern gegenübersehen und in der eine wachsende Zahl von Staatsangestellten dazu gezwungen wird, immer mehr Aufgaben zu erfüllen und immer mehr Stunden zu arbeiten. Im privaten Sektor finden alle Nase lang Stellenabbau und Entlassungen statt, und dies zu einer Zeit, in der die Sarkozy-Regierung eine Reform des Arbeitsrechts ausheckt, deren Schlüsselwort „Flexi-Sicherheit“ lautet, die es den Arbeitgebern noch leichter machen wird, uns auf die Straße zu werfen. Ab dem 1. Januar 2008 werden wir neue Gesundheitsbeiträge zahlen dürfen, die von gestiegenen Rezeptgebühren, von wachsenden Krankenhausgebühren (eingebracht vom früheren Minister Ralite, einem Mitglied der Kommunistischen Partei Frankreichs), von einer Gebühr in Höhe von 90 Euros für medizinische Operationen, etc. begleitet werden.
Sarkozy fordert uns auf, „mehr zu arbeiten, um mehr zu verdienen“. Doch tatsächlich werden wir dazu aufgefordert, mehr zu arbeiten und weniger zu verdienen. Der Schwindel erregende Fall in der Kaufkraft wird nun auch noch von einem exorbitanten Preisanstieg aller Grundnahrungsmittel flankiert: Milchprodukte, Brot, Kartoffeln, Obst und Gemüse, Fisch, Fleisch... Gleichzeitig schnellen die Mietpreise in die Höhe: Immer mehr ProletarierInnen leben in unsicheren oder ungesunden Wohnverhältnissen. Immer mehr ProletarierInnen, selbst jene mit einem Job, sinken in die Armut, sind nicht in der Lage, sich eine anständige Ernährung, Wohnung und Gesundheitsfürsorge zu leisten. Und doch erzählen sie uns: „Es ist noch nicht vorbei“. Die Zukunft, die sie für uns parat halten, die Angriffe, die sie uns versprechen, werden noch schlimmer sein. Und dies, weil die französische Bourgeoisie nun versucht, zu ihren Rivalen in den anderen Ländern aufzuschließen. Angesichts der Verschlimmerung der Krise des Kapitalismus, der Verschärfung der Konkurrenz auf dem Weltmarkt müsse man „konkurrenzfähig“ sein. Dies bedeutet die Steigerung der Angriffe auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeiterklasse.
Der einzige Weg, sich diesen Angriffen zu widersetzen, ist die Aufnahme des Kampfes
Der Zorn und die Unzufriedenheit, die sich heute auf den Straßen und den Arbeitsplätzen artikuliert, konnte sich nur verbreiten, weil überall die ArbeiterInnen mit der Notwendigkeit konfrontiert sind, auf die gleichen Angriffe zu reagieren. Seit 2003 hat die Arbeiterklasse (die laut der Bourgeoisie eine „überholte Idee“ ist) ihren Willen demonstriert, Widerstand zu leisten gegen die Angriffe auf die Renten 2003 in Frankreich und Österreich, gegen die Reform des Gesundheitswesens, gegen Entlassungen in den Schiffswerften im spanischen Galizien 2006 oder im Automobilsektor in Andalusien im letzten Frühjahr. Heute kämpfen ihre Klassenbrüder bei den deutschen Eisenbahnen für Lohnerhöhungen. In all diesen Kämpfen, von Chile bis Peru, von den Textilarbeiterinnen in Ägypten bis zu den Bauarbeitern in Dubai, wird das Entstehen eines tiefen Gefühls der Klassensolidarität sichtbar, welches die Ausweitung der Kämpfe gegen die gemeinsam erlittene Ausbeutung vorantreibt. Dieselbe Klassensolidarität erhob ihr Haupt in der Studentenbewegung gegen die CPE im Frühjahr 2006 und befindet sich im Zentrum der heutigen Bewegung. Vor nichts fürchtet sich die Bourgeoisie mehr als davor.
Die Gewerkschaften spalten und sabotieren die Antwort der ArbeiterInnen
Zuerst dem Sonderrentenrecht besonders in Bereichen wie den öffentlichen Transport (SNCF, RATP) und der Energie (EDF, GDF) an den Kragen zu gehen erbringt dem Staat nur lächerliche Ersparnisse. Es handelt sich um eine rein strategische Wahl, die darauf ausgerichtet ist, die Arbeiterklasse zu spalten. Die Linke und die Gewerkschaften sind im Grunde völlig in Übereinstimmung mit der Regierung. Sie haben stets die Notwendigkeit von „Reformen“ hervorgehoben, besonders auf dem Gebiet der Renten. Mehr noch, es war der frühere sozialistische Premierminister Ricard gewesen, der Anfang der 1980er Jahre das „Weißbuch“ über die Renten produziert hatte, das als Blaupause für all die Angriffe diente, welche von den folgenden Regierungen, linken wie rechten, in die Praxis umgesetzt wurden. Die Kritik, die heute von den Linken und den Gewerkschaften geübt wird, gilt lediglich der Form: Die Angriffe seien nicht „demokratisch“ beschlossen worden, es habe nicht genügend „Konsultationen“ gegeben. Da die Linken zeitweilig raus aus dem Spiel sind, fällt die entscheidende Rolle bei der Kontrolle der Arbeiterklasse den Gewerkschaften zu. Letztere teilen sich die Arbeit mit der Regierung und unter sich auf, mit dem Ziel, die Antwort der ArbeiterInnen zu spalten und zu sabotieren. Die Bourgeoisie muss vor allem die ArbeiterInnen vom öffentlichen Transportsektor isolieren, sie von der restlichen Arbeiterklasse abschneiden.
Dies im Hinterkopf, hat die Bourgeoisie die gesamten Medien aufgeboten, um den Streik zu diskreditieren und die Idee zu streuen, dass andere ArbeiterInnen von einer egoistischen Minderheit privilegierter Arbeiter zur Geisel genommen werden, indem sie ausgiebigen Gebrauch von der Tatsache machte, dass der vom „Sonderrentenrecht“ am meisten betroffene Sektor der öffentliche Transport ist. Sie zählte dabei auf die Unbeliebtheit eines langen Transportstreiks, besonders in der SNCF (traditionell der kämpferischste Bereich, wie in den Streiks vom Winter 1986/87 und 1995), um die „Passagiere“ gegen die Streikenden aufzubringen.
Jede Gewerkschaft spielte ihre Rolle bei der Spaltung und Isolierung der Kämpfe:
-
Die FGAAC (die kleine Zugführergewerkschaft, welche lediglich drei Prozent der SNCF-ArbeiterInnen respräsentiert, aber immerhin 30 Prozent aller Zugführer) rief, nachdem sie zu einer „Neuauflage“ des Streiks am 18. Oktober zusammen mit den Gewerkschaften SUD und der FO aufgerufen hatte, noch am Abend der Demonstration zu Verhandlungen mit der Regierung, um einen „Kompromiss“ und einen speziellen Status für die Zugführer auszuarbeiten, und schließlich zur Wiederaufnahme der Arbeit am nächsten Morgen auf, übernahm also die Rolle des durchtriebenen „Verräters“.
-
Die CFDT (eine Gewerkschaft, die mit der Sozialistischen Partei verlinkt ist) rief nur die Eisenbahnarbeiter zum Streik und zur Demonstration an diesem Tag auf, um „nicht alle Probleme und Forderungen zu vermischen“, um ihren Generalsekretär Chereque zu zitieren; anschließend beeilte sie sich, ausgerüstet mit derselben Taktik, zur Suspendierung des Streiks in der SNCF und zur Rückkehr zur Arbeit in anderen Bereichen aufzurufen, sobald die Regierung ihre Absicht ankündigte, Verhandlungen von Unternehmen zu Unternehmen zu eröffnen.
-
Die CGT, die Hauptgewerkschaft (die mit der Kommunistischen Partei verbunden ist), spielte eine ausschlaggebende Rolle bei dem Manöver, die ArbeiterInnen zurückzudrängen. Sie beschränkte sich selbst auf einen 24-stündigen Streik am 18. Oktober (und überließ es den regionalen Gewerkschaften, die „Initiative“ bei der Verlängerung des Streiks zu übernehmen). Dann übernahm sie die Initiative bei der Ausrufung eines neuen Eisenbahnerstreiks, diesmal für den 13. November, und scharte andere Sektoren und Gewerkschaften hinter diesem Vorschlag. Am 10. November bat der Generalsekretär der CGT, Thibault, die Regierung, multilaterale Verhandlungen (Regierung, Management und Gewerkschaften) über die Sonderrechte zu eröffnen (was nichts als ein Bluff war, weil es die Regierung ist, die den Direktoren öffentlicher Unternehmen direkt ihre Politik diktiert); zwei Tage später, am 12., dem Vorabend des Streiks, rief sie zu einer neuen Initiative auf: Sie schlug erneute multilaterale Verhandlungen vor, diesmal von Unternehmen zu Unternehmen. Dies hieß, die ArbeiterInnen für Idioten zu halten, weil es exakt dieser Rahmen war, den die Regierung ursprünglich anstrebte, um ihre Reformen voranzutreiben, nämlich die Verhandlung zu stückeln, Unternehmen für Unternehmen, Fall für Fall. Diese Kehrtwendung provozierte wütende Reaktionen in den Hauptversammlungen, was die Gewerkschafts“basis“ dazu zwang, die Fortsetzung des Streiks zu befürworten.
-
FO und SUD (eine Gewerkschaft, die von der trotzkistischen Ligue Communiste Revolutionaire unter der Führung von Olivier Besancourt gelenkt wird) versuchten, den Streik noch einige Tage nach dem 18. Oktober mittels einer Minderheit weiterlaufen zu lassen, und fuhren fort, sich gegenseitig dabei zu überbieten, die radikalste Gewerkschaft zu sein. Sie drängten die ArbeiterInnen dazu, den neuaufgelegten Streik bis zum All-Gewerkschafts-Streik am 20. November im Öffentlichen Dienst fortzuführen, und riefen dazu auf, Kommandoaktionen wie die Blockierung der Schienen durchzuführen, statt danach zu streben, den Kampf auf andere Sektoren auszuweiten.
-
Ein Führer der UNSA, ebenfalls Anhänger einer Streik-Neuauflage, erklärte, dass die Demonstrationen getrennt stattfinden sollten und dass die Eisenbahnarbeiter nicht mit öffentlichen Angestellten marschieren sollten, weil „sie nicht dieselben Forderungen haben“.
In dieser Phase gelang es all diesen Gewerkschaften, bei der EDF und der GDF eine ruhige Rückkehr zur Arbeit zu bewerkstelligen. Am Mittwoch, den 21., unmittelbar nach der Demonstration, traten die sechs Gewerkschaftsverbände mit einer Plattform von spezifischen Forderungen in die Verhandlungen über die Zukunft der Eisenbahner.
Um wirksam zu kämpfen, können wir uns nur auf uns selbst verlassen!
Trotz des Bestrebens der Regierung, den Arbeiterwiderstand zu brechen, trotz aller gesetzlicher Verbote, die samt und sonders darauf abzielten, die Rückkehr zur Arbeit zu erzwingen, trotz der Komplizenschaft der Gewerkschaften und ihrer Sabotagearbeit blieb nicht nur der Zorn und die Militanz der ArbeiterInnen erhalten; zunehmend machte sich auch die Erkenntnis von der Notwendigkeit breit, die verschiedenen Kämpfe zu vereinen. Zum Beispiel in Rouen am 17. November, wo Studenten von der Fakultät von Mont-Saint-Aignan loszogen, um streikende Eisenbahnarbeiter aufzusuchen, gemeinsam mit ihnen aßen und an ihren Hauptversammlungen wie auch an der Operation „Freie Passage“ auf der Autobahn teilnahmen. Allmählich kommen Keime der Idee von der Notwendigkeit eines massiven und vereinten Kampfes der gesamten Arbeiterklasse gegen die unvermeidliche Häufung von Angriffen seitens der Regierung zum Vorschein. Damit dieser Kampf Realität wird, müssen die ArbeiterInnen die Lehren aus der Gewerkschaftssabotage ziehen. Um wirksam zu kämpfen, um den Kampf auszuweiten, können sie sich nur auf sich selbst verlassen. Sie haben keine andere Wahl, als durch ihre eigenen Kämpfe die Sache selbst in die Hand zu nehmen und die Fallen sowie spalterischen Manöver der Gewerkschaften zu demaskieren. Mehr als jemals zuvor liegt die Zukunft in der Weiterentwicklung des Klassenkampfes.
Wm 18.11.07
Geographisch:
- Frankreich [32]
Aktuelles und Laufendes:
- Arbeiterkampf [40]
Intervention von IKS-Mitgliedern auf zwei Eisenbahnerversammlungen
- 3049 reads
Am Montag, den 19. November, nahm in einer großen Provinzstadt eine kleine Gruppe von Studenten, die auf unserer letzten öffentlichen Veranstaltung gewesen war, eine Delegation von älteren politisierten Arbeitern, Mitglieder der IKS, zu zwei Hauptversammlungen von Eisenbahnern mit. Da die Gewerkschaften darauf geachtet hatten, dass diese Versammlungen in verschiedene Sektoren aufgespalten wurden, teilten sich unsere Genossen auf, um auf beiden Versammlungen zu reden: auf einer Versammlung des Bahnhofspersonals und auf einer Versammlung der Lokführer.
In beiden Versammlungen gab es einen herzlichen Empfang durch die Eisenbahner. Auf dem Treffen des Bahnhofspersonals stellte sich unser Genossen mit den Worten vor, dass er kein Eisenbahner sei, sondern ein pensionierter Arbeiter, dass er dennoch gekommen sei, um seine Solidarität zum Ausdruck zu bringen. Er fügte hinzu, dass er, wenn möglich, gern sprechen würde, um seine Gedanken darzulegen über das, was Solidarität bedeutet. Die EisenbahnerInnen, die ihn willkommen geheißen hatten, dankten ihn für sein Kommen und sagten: „Natürlich kannst du sprechen.“
Die Versammlung begann gegen halb zwölf und endete gegen halb eins. In der Leitung der Versammlung saß ein Haufen Gewerkschaftsrepräsentanten: FO, CFDT, CFTC, CGT, SUD... Jeder von ihnen hielt eine Rede, in der er uns an die Forderungen der Bewegung erinnerte und sagte, dass es notwendig sei, ein Kräfteverhältnis „auf höherer Stufe“ zu etablieren; in der er die Verhandlungen, die erst kürzlich angekündigt worden waren, als eine Perspektive für den Kampf darstellte und darauf bestand, dass die Versammlungen entscheiden müssen – dies alles jedoch mit einem stark regionalistischen Unterton. Nicht nur, dass es eine Versammlung für einen einzigen Bereich war; darüber hinaus mangelte es ihren Interventionen an jeglichem Interesse für die Lage der Studenten und der Angestellten des Öffentlichen Dienstes. Ein Gewerkschaftsdelegierter behauptete gar, dass die Perspektive darin bestünde, zu kämpfen, um „Reformen zu erlangen“, und nicht darin, gemeinsam zu kämpfen, da es nicht die Orientierung der Gewerkschaften sei, alles zu „revolutionisieren“. Der CFDT-Repräsentant äußerte, dass die regionale Föderation nicht mit der nationalen Führung übereinstimme, die zur Beendigung des Streiks aufgerufen hatte.
Im Anschluss an diese Reden ging ein junger Eisenbahner auf unseren Genossen zu und sagte: „Du kannst sprechen, wenn du möchtest.“ Die Gewerkschaftsredner, die begriffen, was vor sich ging, sagten, dass es notwendig sei, noch ein bisschen zu warten, ehe man ihm das Wort erteilt. Zunächst müsse man zur Abstimmung über den erneuerbaren Streik schreiten, erst dann könne man den seinen Vorschlägen zum weiteren Vorgehen zuhören. Dies beweist nur, dass am Vorabend der Demonstration vom 20. November die Gewerkschaftsrepräsentanten sich veranlasst sahen, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Dagegen unterließ sie es im öffentlichen Sektor, aus Solidarität mit den Eisenbahnern zum Kampf aufzurufen (1). Es lag auf der Hand, dass die Gewerkschaften nicht begierig auf diese „Minderheit“ von Studenten waren, die nur Ärger bereiten konnten und ihre „Kiste der Ideen“ (nach dem Modell der Bewegung gegen den CPE im Frühjahr 2006) zur Eisenbahnerversammlung mitbrachten, die die Gewerkschaftsfunktionäre als ihr Privateigentum betrachteten. Diese Art von Versammlung, organisiert, gemanagt und sabotiert von den Gewerkschaften, sah keine wirkliche Diskussion, keinen Gedankenaustausch vor, ja erlaubte sie nicht. Und doch gab es eine ganz reale Wut und Kampfbereitschaft. Von den 117 Stimmen stimmten 108 EisenbahnerInnen für die Wiederaufnahme des Streiks. Erst nach der Abstimmung wurde unser Genosse ans Mikrophon gelassen. Für die Gewerkschaften waren Vorschläge von „auswärtigen Elementen“ nicht dazu da, von den EisenbahnerInnen diskutiert zu werden. Hier ist der Inhalt seiner Intervention:
„Ich bin kein Eisenbahner. Ich bin Rentner. Doch ich bin gekommen, um meine Solidarität mit eurem Kampf auszudrücken. Von ‚außen‘ besehen, gibt es heute etliche Kämpfe gegen die Angriffe, die das Leben der ArbeiterInnen und die Arbeitsbedingungen betreffen. Ihr, die ihr für eure Renten kämpft, die Studenten, die in Zukunft Arbeiter sein werden und die gegen eine Reform kämpfen, die bestimmte Hochschulen in niedere Universitäten verwandelt, die Angestellten des Öffentlichen Dienstes (wie jene von der Nationalen Bildung) werden morgen demonstrieren, da ihre Arbeitsbedingungen immer unerträglicher werden und ein Haufen Jobs flöten gegangen sind. All diese Kämpfe sind derselbe Kampf für die Verteidigung unserer Lebensbedingungen. Ich habe gerade gehört, dass wir ein Kräfteverhältnis auf einer ‚höheren Stufe‘ durchsetzen sollten. Ich stimme dem zu. Doch wie bewerkstelligen wir dies? Ich denke, dass wir alle zusammen kämpfen müssen. Dies deshalb, weil es eine Menge Solidarität seitens der Lohnabhängigen gegenüber den Studenten gab, so dass angesichts massiver Demonstrationen gegen den CPE die Regierung am Ende zurückweichen musste. Morgen müssen wir in großer Zahl zur Demonstration gehen, aber ich denke auch, dass es gut wäre, wenn es einen Banner gäbe, wo so etwas wie ‚Eisenbahner, Studenten, öffentliche Angestellte: alle vereint im Kampf‘ draufsteht. Und schließlich ist es am Ende der Demo nötig, dass die Eisenbahner, statt nach Hause oder in ein Café zu gehen, mit den Studenten, die öffentlichen Angestellten mit den Eisenbahnern und Studenten diskutieren. Wir müssen miteinander diskutieren, weil wir nur so beginnen können, die benötigte Einheit zu schmieden. Der einzige Weg, um uns selbst gegen die Attacken zu verteidigen, ist, diese Einheit zu bilden.“ Die Intervention erhielt einen freundlichen Beifall.
Bevor die Versammlung begonnen hatte, hatte unser Genosse ein wenig mit den Eisenbahnern über die Lügen in den Medien diskutiert. Diese Lügen sind jedem klar, außer den Blinden und den Tauben (und den Gegendemonstranten von Liberté Cherie). Am Ende der Versammlung kam er noch einmal mit einer kleinen Gruppe von jungen Eisenbahnern ins Gespräch. Er fragte sie: „Wie denkt ihr über ein gemeinsames Banner?“ Einer von ihnen antwortete: „Eigentlich sind die meisten dafür, aber die Gewerkschaften sind dagegen.“ Deutlicher kann man sich kaum über die spalterische Rolle der Gewerkschaften äußern. Dennoch entwickelt sich, trotz des Widerstandes der Gewerkschaften, allmählich die Idee der Einheit und Solidarität unter allen ArbeiterInnen.
In der anderen Hauptversammlung, der der Lokführer, wurden unsere Genossen, welche die Studenten begleiteten, gleichfalls sehr herzlich willkommen geheißen. Sie waren in der Lage, zu intervenieren, um dieselbe Orientierung wie unsere anderen Genossen zu vertreten. Die Studenten waren begeistert über die Idee eines gemeinsamen Banners. Die Interventionen der Studenten und unserer Genossen stießen auf offene Ohren, trotz der Tatsache, dass die Lokführer noch immer die Illusion hatten, dass sie sich allein erfolgreich verteidigen könnten, da sie den Verkehr lahmlegen könnten. Es ist aber die Einheit der ArbeiterInnen und nicht das simple „Blockieren“, was die Stärke der Arbeiterklasse ausmacht. Dieser Fetisch des „Blockierens“ ist heute das neue Ass im Ärmel der Gewerkschaften und bezweckt die Verhinderung jeglicher wirklichen Ausweitung und Vereinigung der Kämpfe.
Seit dem 18. Oktober ging es darum, eine Klasseneinheit gegen die spalterische Arbeit der Gewerkschaften zu bilden. Doch wie diese kleine Gruppe von Studenten in einer Diskussion mit uns nach der Versammlung sagte: „Die Attacken der Bourgeoisie gegen alle Bereiche der Arbeiterklasse sind so breit gefächert, dass dies nur die Tendenz zur Einheit der Kämpfe erleichtern kann.“ Diese kleine Studentengruppe hat sehr gut verstanden, was ein Student von der Universität von Cenesier in Paris 2006 gesagt hatte: „Wenn wir alle allein kämpfen, werden sie uns zum Frühstück verspeisen.“ Und weil sie nicht ihre Eisenbahner-Genossen der Isolation überlassen wollten, die ansonsten von den Milizen des Kapitals aufgemischt worden wären, hielten sie Ausschau nach der Solidarität von authentischen Kommunisten (einige von ihnen waren in den 70er und 80er Jahren von der CGT-Gewerkschaft physisch angegriffen worden). Es trifft allerdings zu, dass seit dem Fall der Berliner Mauer die CGT und die so genannte Kommunistische Partei sehr viel „demokratischer“ geworden sind. Die Studenten, die in der Lage gewesen waren, die Tür zu den Eisenbahnerversammlungen (die im Gefängnis der örtlichen Gewerkschaftsfunktionäre gehalten wurden) aufzustoßen, sagten unseren Genossen: „Es ist großartig, solche ‚Eltern‘ wie euch zu haben.“ Sie sind völlig anders als die „aufbegehrenden“ Studenten Ende der 60er Jahre, die so sehr von der „Generationenlücke“ gezeichnet waren und die in ihrer Rebellion gegen ihre Eltern, die den Terror des Nazismus und Stalinismus erlebt hatten, zu Slogans griffen wie: „Bringt die ältere Generation in die Konzentrationslager!“ (2).
Die Intervention unserer Genossen bezweckte nicht, Mitgliedskarten zu verkaufen und zu jedem Preis zu rekrutieren, da die IKS anders als die Trotzkisten und andere Organisationen der „Linken“ keine Organisation ist, die am bürgerlichen Wahlzirkus teilnimmt. Auch ist es nicht ihr Ziel, „der Bewegung unter die Arme zu greifen, wie einige Anti-Partei-Ideologen denken. Was jene anbelangt, die weiterhin blinden Alarm schlagen und vor den zähnefletschenden Bolschewiki warnen, so können wir nur dazu raten, endlich einmal die tatsächliche Geschichte kennenzulernen und nicht die Lügen der bürgerlichen Propaganda zu wiederholen. Die neue Generation der Arbeiterklasse, ob Eisenbahner oder Studenten, entdeckt die Wahrheit über die reale „Demokratie“ und über die wahre Solidarität, selbst wenn sie noch Illusionen hat und nicht auf die Schule der Erfahrung verzichten kann. Der Mut, den sie schon jetzt besitzt, wo sie gerade beginnt, den Direktiven der Gewerkschaftsbosse nicht zu folgen und die wahre Kultur der Arbeiterklasse zum Leben wiederzuerwecken, zeigt, dass die Zukunft der Menschheit immer noch in ihren Händen liegt.
GM, November 2007
Geographisch:
- Frankreich [32]
Aktuelles und Laufendes:
- Arbeiterkampf [40]
Lohnkampf der Krankenschwestern in Finnland im Herbst 2007
- 3597 reads
In Finnland gab es neulich eine ungewöhnliche Arbeitskampfmethode der Krankenschwestern. Die Gewerkschaft für das Krankenpflegepersonal, Tehy, hatte ihre Mitglieder dazu aufgerufen, zum 19. 11. 2007 ihre Arbeitsstelle zu kündigen, sollte der kommende Tarifvertrag ihre Forderungen nicht erfüllen. Die Gewerkschaft fordert 430 bis 650 Euro pro Monat, zu realisieren innerhalb der kommenden zweieinhalb Jahre. Die Unzufriedenheit unter dem Krankenhauspersonal war groß, der durchschnittliche Lohn bei Krankenschwestern mit mehrjähriger Berufserfahrung liegt so um die 1400,00 Euro netto. Knapp 13 000 KrankenpflegerInnen hatten sich verpflichtet, gemeinsam zu kündigen. Das ist ungefähr die Hälfte der Pflegepersonals in finnischen Krankenhäusern. Sie hatten die Nase voll, ließen sich auch nicht durch der Hetzkampagnen seitens der Regierung und der Medien von ihrem Vorhaben abbringen. Die schlecht bezahlten Krankenschwestern und Pfleger hatten große Sympathie bei den Arbeitern, die wussten, dass es notwendig ist, sich gegen die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen zu wehren. Die Protestierenden hatten auch die Gewissheit, wiedereingestellt zu werden, da es in Finnland an Pflegepersonal mangelt.
Die jetzige Mitte-Rechts-Regierung unter dem ‚liberalen’ Ministerpräsident Matti Vanhanen ist erst im März dieses Jahres gewählt worden. Die Lohnforderung des Krankenhauspersonals entspricht dem Wahlversprechen des rechten Koalitionspartners. Sie hatten versprochen, im Falle ihres Wahlsieges die Gehälter um 540 Euro zu erhöhen, um so, wie es hieß, den europäischen Standard zu erreichen. Das hatten die Betroffenen ernst genommen.
Die Krankenhausverwaltungen warnten vor chaotischen Zuständen. Die Arbeitgeber drohten zudem, dass es keine automatische Wiedereinstellung nach Beendigung des Konfliktes geben werde. Sie warfen den kämpfenden Krankenschwestern vor, dass diese Arbeitskampfmaßnahme Menschenleben aufs Spiel setze. Wer Menschenleben wirklich aufs Spiel setzt, dazu nur ein Beispiel aus dem ganz normalen üblichen Alltag: Wie überall werden auch in Finnland viele Kliniken geschlossen, so dass Geburten im Krankenwagen keine Seltenheit mehr sind. In Lappland kann der Weg zur Klinik 500 km betragen, aber das Problem ist kein typisches für Lappland, in Süd - Finnland werden sogar noch mehr Kinder im Krankenwagen geboren.
Die Arbeitgeber riefen nach Gesetzesänderungen, um Arbeitskämpfe in „kritischen“ Bereichen einschränken zu können. Die Arbeitgeber klagten vor dem Arbeitsgericht, dass 800 Kündigungen rechtswidrig wären. Sie bekamen recht. Die 800 Krankenschwestern mussten ihre Kündigungen zurückziehen, da sie als Beamte laut Gerichtsbeschluss gar nicht an Arbeitskämpfen teilnehmen dürften und die Kündigungen ja eine Arbeitskampfmaßnahme wären. Die Gewerkschaften versuchten, wie so oft, den Kampf der Arbeiterklasse auf den Boden der Gerichte zu ziehen, indem sie vor dem Arbeitsgericht die Klage einreichten, dass die Arbeitgeber den Krankenschwestern ungesetzlicherweise Drohbriefe geschickt hätten, worin stand, dass ihre Stellen Arbeitsuchenden angeboten würden. Das Gericht gab der Klage nicht statt.
Die Krankenhäuser mussten Notpläne machen, worin der Transport von Kranken mit dem Flugzeug nach Upsala in Schweden und nach Bonn in Deutschland vorgesehen war. Die Verhandlungen kamen nicht wie gewünscht voran. Die Kampfbereitschaft beim Pflegepersonal war enorm. Die Regierung beschloss am Vorabend des Kündigungstermins am 17. 11. ein Gesetz zum Schutz der Patienten. Dieses Gesetzt erlaubt die Zwangsverpflichtung des Krankenhauspersonals. Man hatte vor über 2600 Krankenschwestern per brieflicher Ladung zur Arbeit zu zwingen. In Interviews sagten die Krankenschwestern und Pfleger, dass sie dafür Sorge getroffen hätten, dass man sie nicht zuhause anträfe, sollten Zwangsverpflichtungen vorgenommen werden, und viele würden endgültig ihrem Pflegejob den Rücken kehren. Die Krankenschwestern, die nicht an diesen Kampfmaßnahmen teilnahmen, sagten, sie würden auch überlegen, was man anderes beruflich machen könnte, weil die Zustände untragbar wären.
Buchstäblich in letzter Minute am 19. November einigen sich die Arbeitgeberseite und die Gewerkschaft Tehy auf einen Tarifvertrag, der eine Laufzeit von vier Jahren hat, und eine Gehaltssteigerung von 22% – 28% monatlich vorsieht. Außerdem gibt es eine Einmalzahlung von 270 Euro im Dezember. Die Freude ist bei den Krankenschwestern groß. Sie sind aber auch empört, dass man sie beschuldigt hat, die Kranken im Stich zu lassen und dass man so weit gehen muss, selbst zu kündigen, um eine Lohnerhöhung zu bekommen. Ein Kommentar einer Krankenschwester: „Lange hat man uns erzählt, es gäbe genug Arbeitslose, die unsere Arbeit mit Kusshand übernehmen würden, jetzt stellt man fest, dass es doch nicht so einfach ist.“ Im Gegenteil, man war drauf und dran, das Krankenhauspersonal zwangszuverpflichten. Es gibt aber sofort zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern Uneinigkeit darüber, wie dieser Vertrag ausgelegt wird. Die Kommunen wollen den Vertrag als Arbeitgeber so auslegen, dass die Gehaltserhöhung zwischen 16% und 18% liegt. Die Frage, für wen dieser Vertrag gilt, ist offen. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass der Vertrag nur für ihre Mitglieder gilt, leider denken auch Teile der Krankenschwestern so. So versucht man den Kampf im Gesundheitswesen, welcher von den Betroffenen selbst ausging, dazu auszunutzen, um das Personal zu zwingen, der Gewerkschaft beizutreten, um die Lohnerhöhung überhaupt zu erhalten. Bedenklich scheint den Betroffenen Klausel im Vertrag, dass ein Teil der Erhöhung an die Entwicklung der Produktivität gekoppelt ist. Also, je weniger Krankenschwestern es im Jahre 2010 sind, desto höher werden die Löhne der verbleibenden Krankenschwestern und –pfleger ausfallen. Diese Klausel im Vertrag zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberseite ist eine Schweinerei. Die Krankenschwestern sollen im ‚eigenen’ Interesse dafür sorgen, dass Personal abgeschafft wird, damit sie mit ihren Löhnen über die Runden kommen. Überall wird jetzt gewiss, dass die Gewerkschaften, nachdem sie sich in der Öffentlichkeit profiliert haben, im Stillen den Vertrag möglichst zu Ungunsten der Arbeiter auslegen werden.
Der Premierminister Vanhanen hat zwei Tage nach dem Zustandekommen des Tarifvertrages eine Rede gehalten, wobei die Gewerkschaft wie die Sozialdemokratie ihr Fett abbekamen. Er warf der Gewerkschaft Tehy vor, ihre Mitglieder nicht darüber informiert zu haben, dass falls Patienten zu Schaden oder gar zu Tode kämen, die Krankenschwestern persönlich dafür hätten haften müssen. Er beschuldigte das Personal, sie hätten mit ihren Kündigungen, durch die sie höhere Löhne erzwingen wollten, also nur für mehr Geld die Gesundheit und das Leben der Patienten aufs Spiel gesetzt zu haben. Besonders scharf griff er die Sozialdemokratische Partei an, sich ganz offen an die Seite der Kämpfenden gestellt zu haben, und damit unverantwortlicherweise ein solches Verhalten der Krankenschwestern gutgeheißen hätte. Der Bourgeoisie kommt es zugute, wenn die Sozialdemokratie in der Opposition wieder an Glaubwürdigkeit gewinnen kann. Dazu trägt bei, es so hinzustellen, dass die Sozialdemokratie sich von der Rechten absetzt und von diesen bekämpft wird, dass sie für die Belange der Arbeiter einträte.
Diesen Lohnkampf der Krankenschwestern in Finnland muss man in Zusammenhang mit der weltweiten Situation der Arbeiterklasse sehen. Es ist bezeichnend, dass sich selbst in den Kernbereichen wie Lokführern oder Krankenschwestern immer mehr das Phänomen „working poor“ durchsetzt. Solche Streiks erfahren bei der Bevölkerung große Popularität und Unterstützung, so in Deutschland der Lokführerstreik oder in Frankreich der Streik der Eisenbahner. Die jeweiligen Bourgeoisien haben diese Streiks für etwas Spezifisches für diese Länder oder für bestimmte Berufsgruppen hingestellt. In all diesen Streiks haben die Betroffenen anhören müssen, dass sie egoistisch Vorteile für sich allein ergattern wollen, und keine Rücksicht auf die anderen nehmen würden. Trotz der Hetze in den Medien, hat die Bevölkerung ihre Sympathien im Großen und Ganzen den Streikenden entgegengebracht. Das ist gerade deshalb möglich, weil diese Bewegungen für bessere Lebensbedingungen keine Einzelerscheinungen sind. Die Leute spüren, dass die Kämpfenden ein Teil von uns Arbeitern sind, bewundern deren Mut und sehen in ihnen so etwas wie Vorkämpfer. Dieses Gespür innerhalb der Klasse kennt keine Landesgrenzen, sie ist international, so wie die Klasse selbst. (Anfang Jan.2008)
Aktuelles und Laufendes:
- Arbeiterkampf [40]
Nieder mit dem Polizeistaat. Solidarität aller Arbeiter mit den von der Polizei niedergeknüppelten Studenten!
- 3106 reads
Letzte Woche hat die Regierung Sarkozy/Fillon/Hortefeux/Pécresse und Konsorten (in stillschweigender Komplizenschaft mit der Sozialistischen Partei und der ganzen „pluralistischen Linken“) den Gipfel der Schande und des Sadismus überschritten. Nachdem bislang Illegale in Namen der Politik der „Auswahl der Einwanderer“ gewaltsam aus dem Land vertrieben wurden, sind nun die streikenden Studenten dran und man knüppelt wild auf sie ein. Die Studenten, die sich gegen das Gesetz zur Privatisierung der Universitäten (LRU) wehren, sehen sich nun schlimmster Repression ausgesetzt. Im Namen von „Demokratie“ und „Freiheit“ trafen einige Universitätspräsidenten, die sich an das Kapital verkauft haben, die Entscheidung, die Bürgerkriegspolizei CRS und die mobilen Eingreiftruppen herbeizurufen, um die besetzten Universitäten in Nanterre, Tolbiac, Rennes, Aix-Marseille, Nantes, Grenoble frei zu knüppeln.
Die Ordnung des kapitalistischen Terrors
Die Repression war besonders heftig in Rennes und vor allem in Nanterre. Nach anfänglichem Einsatz von Polizeihunden haben die Universitätspräsidenten Hundertschaften vom CRS angefordert, um die Unis zu räumen. Die besetzenden Studenten wurden mit Knüppeln und Tränengas vertrieben. Mehrere Studenten wurden verletzt und verhaftet. Die CRS haben ihren Sadismus auf die Spitze getrieben, als sie einem Studenten die Brille (ein Symbol derjenigen, die studieren und Bücher lesen!) wegrissen und zerstörten. Die Sarkozy und dem Kapital treuen Medien haben über die Repression berichtet und sie gerechtfertigt, als sie die Stellungnahmen der Universitätspräsidenten veröffentlichten. In den 20-Uhr-Nachrichten des Fernsehkanals France 2 rechtfertigte der Präsident der Universität Nanterre die Repression mit den Worten: „Dies ist kein Kampf, dies sind jugendliche Delinquenten“. Ein anderer hysterischer Diener des Kapitals, der Präsident der Universität Rennes, behauptete ohne Skrupel, dass die Revoltierenden „Terroristen und Rote Khmer“ seien.
Es ist klar, dass der ehemalige erste Polizist Frankreichs, Nicolas der Kleine (Sarkozy war zuvor Innenminister), entschlossen ist, die französischen Universitäten mit dem Kärcher zu reinigen und die Kinder der Arbeiterklasse als „Strolche“ „Straftäter“, „Kriminelle“ abzustempeln (so der Präsident der Uni Nanterre). Und aus der Sicht der Politiker (wie sagte Madame Pécresse am 7. November in LCI? „Die Besetzungen sind vor allem ein politischer Akt“) handelt es sich nur um „Terroristen“. Als die Innenministerin Alliot-Marie ihren Polizisten den Einsatzbefehl zur Räumung der besetzten Universitäten erteilte, ging ihre „Freundin“, Madame Pécresse, in ihrem Zynismus sogar so weit, zu behaupten, dass sie den „Studenten ein Gefühl der Sicherheit vermitteln“ wolle.
Die Beschäftigten aus allen Bereichen sollen wissen: Wer auch immer in den Kampf tritt, wild und „unpopulär“ streikt (man kann sich darauf verlassen, dass die Medien und Tele-Sarkozy jeden Tag ihre Propaganda verschärfen werden), der wird, wie die Eisenbahner oder die U-Bahn-Beschäftigten, welche angeblich die „Reisenden in Geiselhaft“ nehmen, als „Terrorist“ und Störer der öffentlichen Ordnung bezichtigt werden.
Die wahre „gelbe Gefahr“ sind nicht die angeblichen „Roten Khmer“ der Universität Rennes. Es sind vielmehr die Vertreter der herrschenden Ordnung, die die Streiks der jungen Generation der Arbeiterklasse mit Hilfe der Spitzel und Kriecher niederknüppeln und mit Tränengas zerstreuen wollen: die Universitätspräsidenten. Die wahren „Terroristen“, die wahren Kriminellen sind diejenigen, die uns regieren und die schmutzigen Manöver dieser Gangsterklasse, der dekadenten Bourgeoisie, ausführen. Ihre Ordnung ist die des erbarmungslosen Terrors des Kapitals.
Diese Gangsterklasse gab sich jedoch nicht damit zufrieden, ihre Hundemeute und die Knüppelgarde der CRS auf die streikenden Studenten zu hetzen. In einigen Universitäten, die von der Polizei geräumt wurden, wurden auch die Streikkassen der Studenten „beschlagnahmt“. So hatten zum Beispiel in Lyon am 16. November besetzende Studenten einige Hundert Euro für ihre Streikkasse sammeln können. Während bis an die Zähne bewaffnete CRS die Uni räumten, beschlagnahmte die Universitätsverwaltung die Lebensmittel, die den Studenten gespendet worden waren, sowie deren Streikkasse. Das ist empörend und widerwärtig! Das Vorgehen der Kleinkriminellen der Bourgeoisie unterscheidet sich in nichts von der Vorgehensweise der „Schläger“ in den Vororten, die im November 2006 vom bürgerlichen Staat gegen die Anti-CPE-Bewegung mobilisiert worden waren, um die demonstrierenden Studenten anzugreifen und ihnen ihre Handys zu rauben!
Dies ist das wahre Gesicht der parlamentarischen Demokratie: Die öffentliche „Ordnung“ ist die Ordnung des Kapitals. Es ist die Ordnung des Terrors und des Kapitals, der Bullen und Medien. Eine Ordnung, die die Lügen und Manipulationen der Tele-Sarkozys verbreitet. Es ist die Ordnung der Machiavellis, die uns spalten wollen, um besser zu herrschen. Es ist die Ordnung derjenigen, die uns gegeneinander aufhetzen wollen und die gleiche Strategie benutzen wie die Vorgänger-Regierung Villepin/Sarkozy im Frühjahr 2006: Diese wollte die Bewegung durch die Anzettelung von Gewalt in die Sackgasse führen.
Die Solidarität zwischen Studenten und Eisenbahnern weist uns den Weg
Die wilde Repression gegen die Studenten ist ein dreister Angriff gegen die ganze Arbeiterklasse. Die große Mehrzahl der gegen die Privatisierung der Unis und die Einführung von Studiengebühren als Zugangskriterium zur Uni kämpfenden Studenten sind Arbeiterkinder und nicht, wie bestimmte Medien und die Sozio-Ideologen des Kapitals verbreiten, Kleinbürger. Viele von ihnen sind Kinder von Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes oder Einwandererkinder (insbesondere in Vorort-Unis wie in Nanterre oder Saint-Denis). Der proletarische Charakter des Kampfes der Studenten gegen das Précesse-Gesetz wurde durch die Tatsache ersichtlich, dass die Streikenden ihre Forderungen erweiterten: Die meisten besetzten Unis nahmen in ihrem Forderungskatalog nicht nur die Rücknahme der LRU, sondern auch die Verteidigung der Sonderbedingungen des Renteneintrittsalters (welche die Regierung beispielsweise im Öffentlichen Dienst, bei den Eisenbahnern, abschaffen will) auf wie auch die Ablehnung des Horefeux-Gesetzes und der Sarkozy-Politik der „Auswahl der Einwanderer“, die Abehnung der Zusatzzahlungen beim Medikamentenkauf und der Angriffe der Regierung gegen die gesamte Arbeiterklasse. Sie betonten die für die Vereinigung der Arbeiter notwendige SOLIDARITÄT, welche für den Zusammenschluss im Kampf gegen das Branchendenken und der „Verhandlungen“ von Betrieb zu Betrieb, von Branche zu Branche (was die Gewerkschaften befürworten) unerlässlich ist. Die Studenten setzten diese Solidarität auch konkret in die Tat um. So haben sich in den französischen Provinzstädten und in Paris Hunderte von Studenten den Demonstrationen der Eisenbahner angeschlossen (insbesondere am 13. und 14. November), die sich gegen die Abschaffung gesonderter Renteneintrittsbedingungen zur Wehr setzten. In einigen Städten (Rennes, Caen, Rouen, Saint-Denis, Grenoble) wurde diese Solidarität der jungen Generation von den Eisenbahnern sehr begrüßt; sie wurden zu deren Vollversammlungen eingeladen und führten gemeinsame Aktionen durch (z.B. traten sie gemeinsam an Autobahnabfahrten auf, wo Studenten und Eisenbahner die Autofahrer an den Zahlstellen kostenlos vorbeiließen und ihnen die Gründe für ihre Aktionen erklärten). Heute überlegen, diskutieren, handeln (und essen) Eisenbahner und Studenten gemeinsam. In einigen Universitäten wie in Paris-8 Saint-Denis (deren Präsidenten Menschen und nicht hysterische Hyänen sind, die mit den Wölfen heulen) schlossen sich ihnen die Dozenten und das Verwaltungspersonal an.
Der proletarische Charakter des Kampfes der Studenten wurde auch darin deutlich, dass die Studenten bei der Besetzung der Unis nicht nur aus dem Grunde die Räume besetzen wollten, um ihre Vollversammlungen abzuhalten und politische Debatten zu führen, die allen offen stehen (ja, Frau Pécresse, der Mensch ist eine Gattung, die im Gegensatz zum Affen über eine Sprache verfügt und ein politisches Wesen ist, wie einige Beschäftigte von Sonderförderungsausbildungsstätten bewiesen haben). In einigen Universitäten haben die streikenden Studenten beschlossen, in den besetzten Räumen auch Illegalen, also Menschen ohne Personalpapiere (die sans-papiers), Schutz zu bieten.
Aufgrund dieser aktiven Solidarität, die auf andere Bereiche überzugreifen droht, hat die Regierung Sarkozy/Fillon (und ihre „Eisernen Ladies“ Pécresse, Alliot-Marie, Dati sowie andere käufliche, unterwürfige Elemente) beschlossen, ihre Bullen zu schicken, um der Arbeiterklasse das Rückgrat zu brechen. Die französische Bourgeoisie will die gleiche Politik anwenden wie damals Thatcher in Großbritannien. Sie will wie in Großbritannien jegliche Solidaritätsstreiks untersagen, um 2008, sobald die Gemeinderatswahlen vorüber sind, freie Hand bei ihren noch brutaleren Angriffen zu haben. Heute versucht die herrschende Klasse mit der Gewalt und Repression ihres Handlangers Sarkozy, ihre „demokratische“ Ordnung durchzusetzen.
Die von den Studenten und einigen Eisenbahnern initiierte Solidaritätsbewegung zeigt, dass der Kampf gegen den CPE nicht in Vergessenheit geraten ist – trotz der ohrenbetäubenden Kampagne rund um die Präsidentschaftswahlen. Die Solidarität zwischen kämpfenden Studenten und einem Teil der Beschäftigten der SNCF und der RATP (die Pariser Metro) weist uns den Weg. Alle arbeitslosen und noch beschäftigten Arbeiter, ob französischer Abstammung oder Einwanderer, ob im Öffentlichen Dienst oder in der Privatindustrie, müssen diesen Weg einschlagen. Es ist der einzige Weg, um gegen die Angriffe der Bourgeoisie und gegen ihr dekadentes System, das der jungen Generation keine andere Zukunft anzubieten hat als die der Arbeitslosigkeit, prekären Arbeitsbedingungen, Armut und Repression (heute Knüppel und Tränengas, morgen Maschinengewehre!), ausreichend Gegendruck aufzubauen.
Dass der Oberbulle Frankreichs, Sarkozy, seine Bullen nicht schon 2006 auf die besetzenden Studenten gehetzt hatte, lag weniger daran, dass er moralische Bedenken gehabt hatte, sondern vielmehr daran, dass er damals Präsidentschaftskandidat war und nicht einen Teil der Wählerschaft verprellen wollte, deren Kinder in den Universitäten eingeschrieben sind. Jetzt, als Präsident, will er seine Muskeln spielen lassen, eine Rechnung begleichen und seine Wut darüber freien Lauf zu lassen, dass die französische Bourgeoisie 2006 den CPE zurücknehmen musste (hatte nicht Sarkozy nach seiner Wahl sofort darüber schwadroniert, dass „der Staat nicht zurückweichen darf“?). Sarkozy will der Clique um Villepin beweisen, dass er nicht nachgeben wird (denn wie Raffarin sagte: „Bei uns darf nicht die Straße herrschen“). Der Zynismus, mit dem er im Namen der „Transparenz“ die Erhöhung seines Gehalts um 140 Prozent ankündigte, während er sich gleichzeitig bei all den Angriffen gegen den Lebensstandard der Arbeiter unnachgiebig zeigte, ist eine wahre Provokation. Die Arbeiterklasse übers Ohr hauen, sie verspotten – das will Sarkozy. „Wir lassen es nicht zu, die Privilegien der Bourgeoisie anzufassen. Ich bin von den Franzosen gewählt worden; jetzt habe ich einen Blankoscheck, um das zu machen, was ich will.“ Aber abgesehen von den persönlichen Ambitionen dieser sinistren Gestalt vertritt Sarkozy auch die gesamte Kapitalistenklasse. Die Auseinandersetzung mit den Eisenbahnern verfolgt nur ein Ziel: Der gesamten Arbeiterklasse soll eine Niederlage beigefügt werden; das seinerzeit in der Bewegung gegen den CPE vorherrschende Gefühl, dass nur ein vereinter Kampf zählt, soll verdrängt werden. Deshalb möchte Sarkozy gegenüber den Eisenbahnern nicht nachgeben und die Universitäten in wahre Polizeifestungen umwandeln.
Aber egal wie dieser Konflikt zwischen der Regierung Sarkozy/Fillon/Pécresse und der Arbeiterklasse ausgehen wird, der Kampf zahlt sich schon jetzt aus: Die Solidaritätsbewegung zwischen Eisenbahnern und Studenten, der sich schon andere Teile der Arbeiterklasse angeschlossen haben (insbesondere unter den Universitäts-Beschäftigten), wird eine unauslöschliche Spur im Bewusstsein hinterlassen, genau wie der Kampf gegen den CPE selbst. Wie alle Arbeiterkämpfe, die zur Zeit weltweit stattfinden, ist er ein wichtiger Bestandteil auf dem Weg zur zukünftigen Überwindung des Kapitalismus. Der Hauptgewinn des Kampfes ist der Kampf selbst, die Erfahrung lebendiger und aktiver Solidarität der Arbeiterklasse auf dem Weg zu ihrer Befreiung und zur Befreiung der gesamten Menschheit.
„Arbeiter, ob aus Frankreich oder Einwanderer, ob im staatlichen Bereich oder in der Privatindustrie beschäftigt, Studenten, Schüler, Arbeitslose: Wir führen den gleichen Kampf gegen die Angriffe der Regierung. Nieder mit dem Polizeistaat. Dem Terror des Kapitals müssen wir die Solidarität der ganzen Arbeiterklasse entgegenstellen!“ Sofiane, 17. November 2007.
Geographisch:
- Frankreich [32]
Nokia - Allgemeiner Lohnraub: Gegen den Terror des Kapitals - Arbeitersolidarität
- 3014 reads
Beiläufig, zufällig nur erfuhren gut 2000 Mitarbeiter des Handyherstellers Nokia Mitte letzter Woche, dass das Werk Bochum, von dem ihre Existenzen leider abhängen, geschlossen werden soll. Keine drei Tage später wurde schon Hunderten von mit Zeitverträgen ausgestatteten MitarbeiterInnen gekündigt. Ihnen wurde mitgeteilt, dass sie ab sofort auf dem Firmengelände nichts mehr zu suchen haben. Die Restlichen „dürfen“ eine kurze Zeit noch die Arbeit der bereits Entlassenen mitverrichten, bis auch sie auf die Straße gesetzt werden. So werden die Lebensplanungen von über 4000 Menschen im Werk Bochum und in der Zulieferindustrie über Nacht zunichte gemacht.
Das wahre Gesicht des Kapitalismus
Die deutsche politische Obrigkeit hat diese Umgangsweise des finnischen Weltkonzerns mit markigen Worten quittiert. Der NRW Ministerpräsident Rüttgers sprach von „Subventionsheuschrecken“, Bundesfinanzminister Steinbrück von „Karawanenkapitalismus“. Sie wollen uns damit sagen, Nokia habe einen sonst überall vorherrschenden “rücksichtsvollen“ und „sozial verantwortlichen“ Umgang der Kapitalisten mit der arbeitenden Bevölkerung verletzt. Da können wir den hohen Herren von der Politik nicht folgen. Es ist vielmehr so, dass die Brutalität und Unverfrorenheit von Nokia absolut typisch ist für das heutige Verhalten der Besitzerklasse gegenüber der Arbeiterklasse. Keine Firmenzentrale im fernen Helsinki, sondern ein deutsches Arbeitsgericht war es, welches monatelang den bundesweiten Streik der Eisenbahner schlichtweg verbot, den Arbeitskampf der Ausgebeuteten unter Strafe stellte. Die deutsche Telekom war es, welche 10.000 MitarbeiterInnen auf einen Schlag ausgliederte, um sie für deutlich weniger Geld länger arbeiten zu lassen. Und als im vergangenen Sommer viele Jugendliche, die für sich keine Perspektive mehr innerhalb dieses Gesellschaftssystems sehen, sich aufmachten, um gegen den G-8 Gipfel in Heiligendamm zu protestieren, erblickte die Bundesanwaltschaft darin die Bildung von terroristischen Vereinigungen. Die Antwort der Staatsgewalt auf die neue Generation ließ nicht lange auf sich warten: Vorbeugehaft sowie das Einsperren von Demonstranten in Käfige wie auf Guantanamo. Und dieselben Politiker, die sich nun mit den „Nokianern“ solidarisch erklären, haben monatelang in aller Öffentlichkeit gegen die Eisenbahner gehetzt, als diese sich aus guten Gründen zur Wehr gesetzt haben. Dieselben Vertreter des Bundes und des Landes NRW, welche Nokia vor zehn Jahren 88 Millionen Euro in den Rachen warfen, um den Kapitalisten ihr Bochumer Werk mitzufinanzieren, hetzen jetzt angesichts der bevorstehenden Tarifauseinandersetzungen gegen Lohnerhöhungen im öffentlichen Dienst! Ja die Zeiten, als Belegschaften regelmäßig „stufenweise“ und „sozialverträglich“ abgetragen wurden, gehören der Vergangenheit an. Die ungeheuere Verschärfung des Konkurrenzkampfes auf Weltebene, die hinter der Immobilienkrise sich abzeichnende Zuspitzung der Überproduktionskrise des Kapitalismus zwingen die alten Industriestaaten, die Maske der „Sozialpartnerschaft“ fallen zu lassen, welche in den meisten Weltteilen ohnehin nie groß aufgesetzt wurde. Was hat beispielsweise NRW-Chef Rüttgers getan, nachdem er auf dem Nokiagelände in Bochum die Betroffenen mit leeren Worthülsen abzuspeisen versucht hatte? Er eilte nach Düsseldorf zurück, um ein weiteres „Rettungspaket“ von voraussichtlich 2 Milliarden Euro für seine Landesbank WestLB zu schnüren, welche sich bei der US Immobilienkrise ein wenig verspekuliert hatte. Die vom deutschen Staat an Nokia verschenkten 88 Millionen Euro, worüber die politische Klasse sich nun öffentlich ereifert, sind eine lächerliche Summe im Vergleich zu den Milliarden, welche in den letzten Monaten locker gemacht wurden, um einen Zusammenbruch des maroden kapitalistischen Finanz- und Bankensektors zu vermeiden. Da hat die Besitzerklasse nicht mal mehr das Bisschen für die Lohnabhängigen übrig, das sie in früheren Zeiten eingesetzt hatte, um den „sozialen Frieden“ abzusichern. Hier liegt der Grund, warum das Kapital mit immer unverblümterer Brutalität gegenüber der Arbeiterklasse vorgeht. Nicht an der „Taktlosigkeit“ eines einzelnen Konzerns liegt es, sondern an der Notwendigkeit eines ganzen Systems, wenn heute immer systematischer versucht wird, die Lohnabhängigen einzuschüchtern. Die Brutalitäten gegenüber den Nokianern oder gegenüber den Lokführern sind kein Ausrutscher Einzelner, sondern pure Absicht. Sie zielen darauf ab, uns zu terrorisieren, um uns gefügig zu machen. Da arbeiten die „bösen“ Kapitalisten“ und der uns angeblich umsorgende Staat Hand in Hand. Nicht nur die Kündigung droht den Betroffenen bei Nokia und anderswo, sondern das, was danach kommt: Hartz IV!
Die Bochumer Werksschließung: Ein Angriff gegen die gesamte Arbeiterklasse
Die Nachricht von der beabsichtigten Werksschließung bei Nokia in Bochum wurde genau drei Tage bekannt, nachdem die Lokführer bei der Deutschen Bahn 8% mehr Lohn und eine Reduzierung ihrer Arbeitszeit um eine Stunde durchgesetzt hatten. Das muss nicht Zufall sein. Dieser Teilerfolg bei der Bahn nach Jahren der Reallohnsenkung ist nicht nur ein Schlag ins Gesicht für die Pläne der herrschenden Klasse, auf Kosten der Beschäftigten die DB in ein international tätiges Logistikunternehmen zu verwandeln. Es ist eine Ermutigung für die ganze Arbeiterklasse, dem Beispiel der Eisenbahner zu folgen und sich einen Ausgleich für die rapide steigenden Preise und Steuerlast zu erkämpfen. Ob beabsichtigt oder nicht, ob mit der Staatsmacht abgesprochen oder nicht (welche in Deutschland bei Entlassungen von über 50 Beschäftigten auf einmal vorab informiert wird): Die Nachricht von der Bochumer Werksschließung kam für das Kapital genau zum richtigen Zeitpunkt. Sie dient als Warnung an die gesamte arbeitende Bevölkerung, angesichts des Teilerfolgs bei der Bahn nicht „übermütig“ zu werden. Die Botschaft lautet: „erkämpfte Lohnerhöhungen der Beschäftigten werden durch Massenentlassungen von Seiten des Kapitals quittiert! Vergesst nicht, wer in dieser Gesellschaft am längeren Hebel sitzt, nämlich die Besitzer der Produktionsmittel!“Nachdem es ein Jahrzehnt lang die Reallöhne – auch im internationalen Vergleich – besonders stark abgesenkt, und sich dadurch Wettbewerbsvorteile erzwungen hatte, weiß das deutsche Kapital heute sehr genau, dass eine allgemeine Unzufriedenheit der arbeitenden Klasse sich angestaut hat. So ist die Kapitalseite heute emsig bemüht, durch v.a. kosmetische „Korrekturen“ beim Arbeitslosengeld, dem Gerede von „Mindestlöhnen“, „Reichenbesteuerung“ und „sozialer Gerechtigkeit“ die Wogen zu glätten. Denn eine allgemeine Streikwelle würde uns Lohnabhängigen einen Teil unserer Klassenidentität und unser Selbstvertrauen wieder geben. Der „Standort Deutschland“ will außerdem verhindern, dass durch eine solche allgemeine Kampfeswelle ein Teil der angesammelten Konkurrenzvorteile wieder verloren gehen könnten. Zwar hat in dieser Hinsicht die Regierung vorgesorgt: Maßnahmen wie die seit Anfang 2007 in Kraft getretene Mehrwertsteuererhöhung oder die geplante massive Besteuerung von Sparkonten ab 2009 sollen den größten Teil eventueller Reallohnerhöhungen wieder in die Taschen des Staates und der Unternehmen umleiten. Dennoch setzt das Kapital auch auf offene Einschüchterung, damit weder die bevorstehenden Lohnkämpfe noch die daraus hervorgehenden Abschlüsse zu umfangreich werden. Auch in dieser Hinsicht richtet sich der Angriff gegen die Nokiabeschäftigten in Wahrheit gegen die gesamte Arbeiterklasse!
Arbeitersolidarität gegen die Gewalt des Kapitals
Gegenüber der Wucht der kapitalistischen Angriffe kann es nur eine Antwort geben: Die Arbeitersolidarität. Dass die Betroffenen die Notwendigkeit dieser Klassensolidarität immer deutlicher spüren, zeigt die erste Reaktion der Bevölkerung des Ruhrgebiets auf die Nachricht von der Werksschließung bei Nokia. Die Beschäftigten spürten sofort das Bedürfnis, sich auf dem Werksgelände zu versammeln. Da standen die ZeitarbeiterInnen und die (nur scheinbar) „Festangestellten“ Schulter an Schulter, um ihrer Empörung Ausdruck zu verleihen. Wichtiger noch: Nicht allein die üblichen rituellen Gewerkschaftsdelegationen waren vertreten, sondern es strömten Lohnabhängige aus den unterschiedlichsten Betrieben der Region herbei, um ihre Solidarität kundzutun. Die Leute von Opel erklärten: Ihr habt uns 2004 in unserem Kampf gegen die Werksschließung unterstützt, jetzt unterstützen wir euch! Bei den Gesprächen bezog man sich wie selbstverständlich auf die gemeinsamen Kampferfahrungen unserer Klasse, um gegenüber der jetzigen Lage eine Perspektive zu gewinnen. So war von der beispielhaften Kampfkraft der Eisenbahner die Rede. Auch wurde darauf hingewiesen, dass die Werksschließung bei Opel in Bochum vor vier Jahren nicht durch Unterordnung und „Opferbereitschaft“ der Beschäftigten, sondern allein durch die große Kampfkraft der Betroffenen und die Solidarität der gesamten arbeitenden Bevölkerung verhindert wurde. Die Lehren von vor 20 Jahren bei Krupp wurden ebenfalls aufgegriffen: Die Kraft der Solidarität, aber auch die Verelendung, welche auf der doch noch durchgesetzten Werksschließung damals in Duisburg-Rheinhausen folgte. Dort auf dem Nokiagelände und in den darauffolgenden Tagen tauchte ein Ausdruck der Arbeitersolidarität wieder auf, welcher zukunftsweisend ist. In den letzten Jahren wurde der Kampf gegen Massenentlassungen und Werksschließungen hauptsächlich von den unmittelbar Betroffenen getragen, während andere Beschäftigte oder Erwerbslose sich mehr unterstützend, sozusagen von außen helfend beteiligten. Das war 2006 bei der AEG in Nürnberg so, 2004 bei Opel Bochum und auch 1987 bei Krupp. Jetzt war aus dem Opelwerk in Bochum zu vernehmen, dass die Beschäftigten dort sich an einem eventuellen Streik der Nokianer beteiligen wollen. Das hat es im Ansatz bereits 2004 bei Mercedes gegeben, als die Beschäftigten im Werk Bremen mitgestreikt haben aus Solidarität mit ihren KollegInnen in Stuttgart. Damals handelte es sich noch um eine Solidarität unter Beschäftigten ein und desselben Konzerns, die sich nicht gegeneinander ausspielen lassen wollten. Nun keimt ein Bewusstsein wieder auf, dass auch die Lohnsklaven aus verschiedenen Firmen, Branchen usw. gemeinsame Interessen haben, die nur gemeinsam verteidigt werden können. Diese Einsicht gewinnt nicht nur in Deutschland, sondern weltweit an Boden. So haben gegen Jahresende 2006 in Frankreich kämpfende Eisenbahner und Studenten gemeinsame Kampfversammlungen abgehalten.Auch die große Popularität, welche der Eisenbahnerstreik in Deutschland innerhalb der arbeitenden Bevölkerung genossen hat, muss in diesem Lichte gesehen werden. Der herrschenden Klasse ist es zwar gelungen, die massive Unzufriedenheit eines Teils der Eisenbahner mit den bestehenden, v.a. dem DGB angegliederten Gewerkschaften wieder in kapitalistisch geordnete – sprich gewerkschaftliche – Bahnen zu lenken mittels einer Scheinradikalisierung der fossilen GDL. Dadurch ist ein Bild in der Öffentlichkeit gestiftet worden, welches der herrschenden Klasse nur recht sein kann. Dies ist das Bild von einer Berufsgruppe – in diesem Fall die Lokführer –, welche sich von einem gemeinsamen Kampf mit anderen Berufsgruppen oder Sektoren der Klasse verabschiedet, um zu versuchen, auf eigene Faust das Beste für sich herauszuholen. Aller Erfolge der GDL bei der Isolierung des Lokführerstreiks zum trotz entspricht dieses Bild heute nicht der Stimmung der Arbeiterklasse. Die Lokführer werden vielmehr als Vorkämpfer eines notwendig gewordenen allgemeinen Kampfes angesehen. Mit ihrer Bekundung der Bereitschaft zur aktiven Solidarität mit den Nokianern ist es den Opelaner in Bochum gelungen, dieser Gemeinsamkeit, welche nur indirekt durch die allgemeine Beliebtheit des Lokführerstreiks zum Ausdruck kam, eine direkte Konkretisierung zu geben. Wir können und müssen dem Terrorsystem der kapitalistischen Konkurrenz die Stirn bieten! Wir können und wir müssen den Versuch der herrschenden Klasse durchkreuzen, mittels Angriffe wie bei Nokia nicht nur die Betroffenen, sondern uns alle einzuschüchtern. Begreifen wir die Gleichzeitigkeit der Angriffe mittels Arbeitslosigkeit und Inflation als Herausforderung, unsere eigenen Kräfte zu bündeln. Während bei Nokia, bei Motorola in Flensburg oder bei BMW Jobs vernichtet werden, stehen in vielen Branchen Tarifverhandlungen an, es wächst der Unmut gegenüber Reallohnverlusten. Es gilt, direkte Verbindungen zwischen den kämpferischsten Arbeiterinnen und Arbeitern der verschiedenen Bereiche zu knüpfen, ohne gewerkschaftliche „Vermittlung“. Es gilt, sich den Versammlungen und Demonstrationen anderer Bereiche zielstrebig anzuschließen bzw. die eigenen Aktionen für andere zu öffnen. Es gilt, dort die Gemeinsamkeit der Interessen aller Lohnabhängigen hervorzuheben und gemeinsame Forderungen zur Sprache zu bringen. Es gilt, den Kampf gegen Massenentlassungen und die Lohnkämpfe bewusst zu verbinden, sie immer mehr zusammenzuführen. Gegenüber der gewerkschaftlichen Absonderung, wie von der GDL vorexerziert, und dem gewerkschaftlichen Streikbrechertum, wie zuletzt von Transnet gegenüber dem Lokführerstreik praktiziert, müssen die Kämpferischsten sich für die Eigenständigkeit der Aktionen der Betroffenen selbst stark machen. Nur eine breite, allgemeine Aktion, welche die Logik des Kapitals in Frage stellt, welche gegen das Prinzip der kapitalistischen Konkurrenz das sozialistische Prinzip der Solidarität geltend macht, kann Angriffe wie bei Nokia aufhalten.
Gegen den Terror des Kapitalismus hilft nur die Solidarität der Arbeiterklasse! 20.01.08
Dieser Artikel wird von der IKS als Flugblatt auf der Demonstration am 22.01.08 in Bochum verteilt.
Nationale Situationen:
Aktuelles und Laufendes:
- Arbeiterkampf [40]
Russland 1917, Deutschland 1918 : Die Ausdehnung der Russischen Revolution beendete den Weltkrieg
- 8615 reads
Im Gegensatz zu den Behauptungen der offiziellen Geschichtsschreibung der herrschenden Klasse ging der 1. Weltkrieg am 11. November 1918 nicht zu Ende, weil die Verbündeten Deutschland-Österreich eine entscheidende militärische Niederlage erlitten hatten oder nicht mehr über die Kräfte zur Fortsetzung des Krieges verfügten. Nein, der Waffenstillstand wurde einzig unterzeichnet, weil die herrschende Klasse auf beiden kriegführenden Seiten der Gefahr der weltweiten Ausdehnung der proletarischen Oktoberrevolution von 1917 in Russland gegenüberstand. Tatsächlich war es die unmittelbare Gefahr der Erhebung des Proletariats in Europa, die die Kapitalisten dazu zwang, das Gemetzel einzustellen. Wenn es der Arbeiterklasse gelungen war, so weit voranzukommen, so nur, weil dem ein langer Prozess vorausgegangen war, in dem sie ihre Kräfte gesammelt hatte. Schon im Sommer 1916 entfalteten sich große Massenbewegungen, insbesondere in Deutschland, in denen die Wut der ArbeiterInnen gegen das Leid, die Entbehrungen und die Armut, die auf den Krieg zurückzuführen waren, zum Ausdruck gebracht wurden. Aber man kann erst vom wahren Beginn der revolutionären Welle im Februar 1917 in Russland reden. Der 23. Februar hätte eigentlich ein einfacher Gedenktag an die Arbeiterfrauen im Rahmen der üblichen Demonstrationen der sozialistischen Parteien sein sollen, aber dieser Tag löste eine Explosion der großen Verbitterung aus, die sich in den Reihen der ArbeiterInnen wie auch anderer armer Schichten der Bevölkerung gegen die Tag für Tag schlechter werdende Lebensmittelversorgung der damaligen Hauptstadt Russlands und der durch die Kriegswirtschaft bewirkten Überausbeutung gesteigert hatte. Während die Bewegung am 23. Februar noch die Forderung nach Brot erhob, entwickelte sie sich in den nächsten Tagen schnell zu einem Aufstand, der wegen der blutigen Repression durch das Zarenregime noch ungewollt begünstigt wurde. Am 26. Februar schlossen sich aufgrund der Ausstrahlung der Arbeiterkämpfe Soldaten der Bewegung an. Am 27. Februar wurde das Zarenregime gestürzt, eine bürgerlich demokratische Regierung (eine so genannte „provisorische Regierung“) ernannt, während sich die Arbeiterklasse in den Fabriken und den anderen Arbeitsstätten in selbständigen Arbeiterräten organisierte und Delegierte in den zentralen Sowjet der Stadt schickte. Da die neue Regierung in den darauf folgenden Monaten den Krieg jedoch fortsetzen wollte und gegenüber dem Hunger und den durch den Krieg und die Kriegswirtschaft auferlegten Entbehrungen nichts anzubieten hatte, da stattdessen die Arbeiter viel länger als acht Stunden arbeiten mussten, wurden diese immer kämpferischer und ihr Bewusstsein immer weiter vorangetrieben. Im April 1917 trat die bolschewistische Partei für die Losung „Brot und Frieden“ und „Alle Macht den Räten“ ein. Die Arbeiterklasse radikalisierte sich immer mehr, da die provisorische Regierung noch entschlossener als der Zar für den Krieg mobilisierte. Nach neuen Aufständen im Juli, in denen das Proletariat zum Rückzug gezwungen wurde (denn die Bedingungen zum Sturz der Kerenski-Regierung waren noch nicht herangereift), versuchte der dem Zar ergebene General Kornilow einen Putsch gegen die provisorische Regierung. Dieser Versuch wurde vor allem durch die massive Mobilisierung der Arbeiter in Petrograd vereitelt, was der Arbeiterklasse einen neuen Aufschwung verlieh und wodurch die Bolschewiki und ihre Losungen noch mehr Zulauf erhielten. Nach dem 22. Oktober 1917 fanden Versammlungen statt, in denen gewaltige Arbeitermassen zusammenkamen, und in denen die Losungen „Nieder mit der provisorischen Regierung! Nieder mit dem Krieg“, „Alle Macht den Räten“ aufkamen. Am 25. Oktober stürmten die Arbeitermassen mit den Matrosen der „Roten Flotte“ der Kronstädter Garnison den Winterpalast und verjagten die Kerenski-Regierung. Das war die Oktoberrevolution. Der Gesamtrussische Sowjetkongress, der zum gleichen Zeitpunkt stattfand und in dem die bolschewistische Partei über die Mehrheit verfügte, kündigte in einer Resolution die Übernahme der Macht an: „Gestützt auf den Willen der gewaltigen Mehrheit der Arbeiter, Bauern und Soldaten, gestützt auf den in Petrograd vollzogenen siegreichen Aufstand der Arbeiter und der Garnison, nimmt der Kongress die Macht in seine Hände“. (Lenin, „An die Arbeiter, Soldaten und Bauern“, Lenin, Bd. 26, S. 237). Am 26. Oktober verabschiedete der Kongress in seiner zweiten Sitzung ein „Dekret über den Frieden“ und schaffte gleichzeitig die Notmaßnahmen ab, damit die Bevölkerung in Russland nicht mehr unter den Kriegsfolgen litt. Die revolutionären Ereignisse in Russland hatten natürlich unter den ArbeiterInnen Europas und der ganzen Welt eine enorme Ausstrahlung. Dies war zunächst am stärksten spürbar unter den Arbeitern jener Länder, die direkt am imperialistischen Gemetzel beteiligt waren. Dadurch wurden sie überall zu Demonstrationen gegen den Krieg und zu Kundgebungen zur Unterstützung des Roten Oktober ermuntert. Eine Folge war, dass es an der Front zu Verbrüderungen unter kämpfenden Soldaten der verfeindeten Länder kam. In Deutschland, wo es das zahlenmäßig größte und am stärksten konzentrierte Proletariat mit der umfassendsten politischen Erfahrung gab, ging die Ausstrahlung am weitesten. Nach einem Zeitraum der Reifung im Jahre 1917 entwickelte sich 1918 hier eine revolutionäre Dynamik, die Anfang November, d.h. am 4. November, ihren Höhepunkt erreichte. An jenem Tag meuterten die Matrosen von Kiel. Dabei gelang es ihnen, einen Großteil der Soldaten (Arbeiter in Uniform) sowie auch Arbeiter aus den Betrieben auf ihre Seite zu ziehen. Insbesondere in Berlin und Bayern kam es zu Zusammenschlüssen. Damit reagierten die Arbeiter in Deutschland auf die Aufrufe, die ihre Klassenbrüder und -schwestern in Russland an sie seit Oktober 1917 gerichtet hatten, damit sie sich in den Kampf um die Weltrevolution einreihen und dabei die Führung übernehmen. Ihr Aufstand ermöglichte auch den Aufstand jener Truppenteile, die bis dahin der Regierung des Kaisers Wilhelm II. ergeben gewesen waren. Innerhalb weniger Tage entstanden überall im Land - dem russischen Beispiel folgend - Arbeiterräte. Die herrschende Klasse verstand die Notwendigkeit, sich des Kaisers zu entledigen, der schließlich am 9. November zurücktrat; die Republik wurde ausgerufen. Die Regierungsgeschäfte wurden geleitet von den SPD-Leuten Ebert und Scheidemann (die 1914 die Kriegskredite bewilligt und den Burgfrieden unterstützt hatten). Diese schlossen unmittelbar danach mit der französischen Regierung einen Waffenstillstand. Wie wir in einem früheren Artikel in unserer Zeitung Révolution Internationale Nr. 173 (November 1988) anlässlich dieser Ereignisse geschrieben hatten: „Mit ihrer Aufstandsbewegung hatten die Arbeiter in Deutschland den größten Massenkampf der Arbeiterklasse in ihrer Geschichte ins Rollen gebracht. Die ganze Burgfriedenspolitik, welche die Gewerkschaften während des Krieges praktiziert hatten, und die Politik des Klassenfriedens zwischen den Klassen brach unter den Schlägen des Klassenkampfes auseinander. Mit diesen Aufständen schüttelten die Arbeiter die Niederlage vom August 1914 ab und erhoben nun wieder die Stirn. Der Mythos einer deutschen (oder anderen) Arbeiterklasse, die vom Reformismus gelähmt wäre, brach zusammen (…) In die Fußstapfen des Proletariats in Russland tretend, stellten sich die Arbeiter in Deutschland nach den Arbeiteraufständen und dem Anfang der Bildung von Arbeiterräten in Österreich und Ungarn 1919 an die Spitze der ersten großen internationalen Welle von revolutionären Kämpfen, die aus dem Krieg hervorgegangen waren“. Und um nicht der Gefahr ausgesetzt zu sein, wie in Russland durch die revolutionäre Welle von Kämpfen weggespült zu werden, beeilte sich die deutsche Bourgeoisie sicherlich mit Unterstützung der herrschenden Klasse der anderen Länder und früheren Kriegsgegner, den imperialistischen Krieg, der vier Jahre zuvor vom Zaun gebrochen worden war, zu beenden. Um der Ausbreitung der proletarischen Revolution entgegenzutreten, haben sich die Bourgeoisien der Welt verständigt, um nur wenige Tage nach dem Aufstand der Matrosen in Kiel gegen das deutsche Militär sehr schnell einen Waffenstillstand zu schließen. Später wurde die revolutionäre Bewegung in Deutschland blutig niedergeschlagen (insbesondere während der „blutigen Woche“ im Januar 1919, als ihre berühmtesten Führer, revolutionäre Spartakisten wie Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, von Freikorps ermordet wurden, die im Sold der SPD standen) (2). Diese Niederlage des Proletariats in Deutschland sollte später zum Tod der Revolution in Russland führen. Nichtsdestotrotz hatte die Weltarbeiterklasse in diesen beiden Ländern gezeigt, dass sie die einzige Kraft in der Gesellschaft ist, die – wenn sie auf ihrem Klassenterrain kämpft, den Krieg beenden kann. RI 1) Trotz des Fortbestehens eines politischen Regimes mit feudalem Charakter hatte sich der Kapitalismus in Russland stark entwickelt und große Industriezentren geschaffen: Zum Beispiel waren die Metallfabriken von Putilow mit ihren 40.000 Beschäftigten die größte Fabrik der Welt. 2) Siehe insbesondere die Artikelreihe über die Deutsche Revolution in Nr. 16 und 17, in der die Entwicklung im Detail, vom Waffenstillstand bis zur Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, nachgezeichnet wird und die besser ermöglicht zu begreifen, was damals in Deutschland passiert ist. 3) Siehe auch unseren Artikel in der Internationalen Revue Nr. 23 – „1918-1919 – Die proletarische Revolution bringt den imperialistischen Krieg zu Ende“.
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Februar 2008
- 850 reads
Die Italienische Kommunistische Linke - Ein Beitrag zur Geschichte der revolutionären Bewegung 1926-1945
- 3059 reads
Jüngste Buchveröffentlichung der IKS
Bestellungen an: [email protected] [30] 291 S. Preis: 10 Euro,
Inhaltsverzeichnis:
Einleitung
KAPITEL 1Die Ursprünge (1912 – 1926) Die Geburt der Sozialistischen Partei Italiens Die Linke innerhalb der Partei (1913-1918)Auf dem Weg zur Eroberung der Partei (1918-1921) Bordiga und der “Partito Comunista d’Italia”„Bolschewisierung” und die Reaktion der Linken Die Beziehungen zu Karl Korsch Bordigas Entwicklung nach 1926
KAPITEL 2Italienische Linke oder Deutsche Linke? (1927-1933) Von “Réveil Communiste” zu “L’Ouvrier Communiste” Pappalardi und die italienischen „Bordigisten” Réveil Communiste (1927-29) Der Einfluss der KAPD: „L’Ouvrier Communiste” (1929-31)
KAPITEL 3Die Geburt der linken Fraktion der PCI (1927- 1933)
Die Mitglieder: Arbeiterimmigranten Ottorino Perrone
Die Organisation der Fraktion: Frankreich, die USA,
Belgien Die Gründungskonferenz in Pantin
Erste Kontakte mit der Linksopposition „Prometeo” und Trotzki
Beziehungen mit der Neuen Italienischen Opposition, der deutschen und der französischen Opposition
Gründe und Konsequenzen des Ausschlusses der Fraktion aus der trotzkistischen Opposition
KAPITEL 4„Bilan”: Mit Riesenschritten in die Niederlage (1933-1939) Das Gewicht der Konterrevolution „Die Mitternacht des Jahrhunderts” „Bilans” Auseinandersetzung mit dem Antifaschismus und derVolksfrontDer Kongress der Fraktion 1935 Die isolierte Fraktion Die Diskussionen mit Union CommunisteDie Communist League of Struggle Die Revolutionary Workers‘ League und Oehler Der endgültige Bruch mit dem Trotzkismus Erste Arbeitsgemeinschaft mit der belgischen Ligue des Communistes Internationalistes
KAPITEL 5Der Krieg in Spanien: Kein Verrat! Die Mehrheit der Fraktion und die dramatischen Ereignissen in Spanien Auf dem Weg in die Spaltung: Argumente und Aktivitäten der Minderheit in Spanien Die Geburt der Belgischen Fraktion Kontakte mit Mexiko: Paul Kirchhoff und der „Grupo de Trabajadores” Das Internationale Büro der Fraktionen: Die Schwächen der Kommunistischen Linken
KAPITEL 6Hin zum Krieg oder zur Revolution? (1937 – 1939) Krieg oder Revolution? Die Wurzeln des imperialistischen Krieges:Die Dekadenz des Kapitalismus Die reaktionäre Funktion der Nationalbewegungen in den Kolonien Die Diskussion über die Kriegswirtschaft
KAPITEL 7Bilanz der Russischen Revolution Die Methode von „Bilan” Der Ausgangspunkt: die Partei Die objektiven Bedingungen: die kapitalistische Dekadenz Die subjektiven Bedingungen: die Partei Gewerkschaften und Klassenkampf Die Niederlage der Russischen Revolution Das Wesen des russischen Arbeiterstaates Der Staat in der Übergangsperiode
KAPITEL 81939-45 Prüfung durch den Krieg Die Herausforderung des Krieges: Von der Fraktion zur Partei Der Schock des Krieges Der „Kern der Kommunistischen Linken” Die Revolutionären Kommunisten Deutschlands undder holländische Spartacusbond Der Einfluss der Ereignisse vom März 1943 in Italien auf die FraktionPolitische Meinungsverschiedenheiten mit VercesiItalia di Domani: Vercesis Aktivitäten in der Brüsseler Antifaschistischen Koalition Die Bildung der französischen Fraktion: die Spaltung von der Italienischen Fraktion
KAPITEL 9„Partito Comunista Internazionalista” (1943-45) Die Gründung des PCInt: Damen und Prometeo Bordiga und Pistone: Die „Frazione di sinistra dei comunisti e socialisti” Die Föderation Pugliens und der„Partito Operaio Comunista” Der Kongress des PCInt in Turin (Dezember 1945) Die Entwicklung der Partei nach 1946: Spaltungen Die französischen Linkskommunisten(Internationalisme) Schlussfolgerungen
ANHANG ICommunisme Nr. IPrinzipienerklärung der Belgischen Fraktion der Internationalen Kommunistischen Linken ANHANG IIManifest der kommunistischen Linken an die ProletarierEuropas (Juni 1944) Einleitung der IKS (1984) Manifest der kommunistischen Linken an die Proletarier Europas (Juni 1944)
Politische Strömungen und Verweise:
- Kommunistische Linke [70]
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
- Italienische Linke [86]
Eine Debatte über die Gewerkschaftsfrage im NLO –Köln
- 2795 reads
Am 12.2. fand in Köln eine Diskussionsveranstaltung des Netzwerk Linke Opposition mit Themenschwerpunkt Gewerkschaften statt. Es war vereinbart worden, dass Vertreter der „Internationalen Sozialisten“ und der IKS jeweils ihre Standpunkte zur Eröffnung der Diskussion vorstellen sollten. Zudem hatten die IKS und IS jeweils zwei Texte zur Vorbereitung zirkuliert (weiter unten haben wir diesen Text angehängt). In der Einleitung der IS wurde hervorgehoben, dass die großen revolutionären Bewegungen immer aus den Gewerkschaften hervorgegangen seien. Gewerkschaften seien nötig, um die bewussten Arbeiter zu sammeln. Auch wenn die Gewerkschaftsführung von Anfang an, d.h. schon von ihrer Gründung im 19. Jahrhundert an, dem Kapital treu ergeben gewesen seien, könnte man eigentlich nicht von den Gewerkschaften reden, denn letztendlich sei doch die Basis die eigentliche Gewerkschaft. Die Gewerkschaften seien Kampforganisationen, mit deren Hilfe die Arbeiter ihre Einheit schweißen könnten. Dann räumte der Redner der IS ein, dass die Gewerkschaften von Anfang an „eingebaute“ Schwächen mit sich trügen. So seien sie, wie der Name sagte, Organisationen, die nur Gewerke repräsentieren. Damit förderten sie die Spaltungen der Arbeiterklasse in verschiedene Bereiche; auch hätten sie immer nur für Verbesserungen innerhalb des Systems und nie gegen das System gekämpft; schließlich seien die Gewerkschaften immer für eine Trennung zwischen Politik und Wirtschaft eingetreten. Während das Kapital versuche, Organisationen für sich einzuverleiben und das Verhalten der Gewerkschaftsbürokratie ein Beispiel dafür sei, sei die Gewerkschaftsbürokratie dennoch ein (wenn auch widerwilliger) Partner bei antifaschistischen Bündnissen. Aufgabe der Revolutionäre sei es, bei den Gewerkschaften mitzuarbeiten, Mandate als Vertrauensleute anzustreben, denn schließlich habe die Arbeiterklasse noch kein anderes Instrument zum Kampf entwickelt als Gewerkschaften. Die IKS hatte zur Vorbereitung der Diskussion einen kurzen Text erstellt (siehe weiter unten), den wir jedoch aus Zeitgründen auf dem Treffen nicht separat vorstellten. Stattdessen haben wir, um leichter in die Diskussion einzusteigen, auf die Position der IS geantwortet. Hier ein Teil unserer Antwort. * Die Bejahung einer Gewerkschaftsarbeit - mit der Begründung, das Bewusstsein einer Reihe von Arbeitern unzureichend entwickelt ist -, geht von der Annahme aus, dass die Gewerkschaften Ort und Instrument der Bewusstseinsentwicklung sind. Die Gewerkschaften waren zwar im 19. Jahrhundert zeitweise und in einem begrenztem Maße ein Ort, wo nicht nur Solidarität praktiziert wurde, wo es ein wirkliches Arbeiterleben gab und wo das Bewusstsein in einem beschränktem Maße vorangetrieben werden konnte, aber seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts ist in ihnen immer mehr jegliches proletarisches Leben erloschen. Stattdessen binden sie die Arbeiter an das kapitalistische System und seine Ideologie. * Indem man behauptet, die Gewerkschaftsführung habe schon immer im Interesse des Kapitals gehandelt, oder sie sei zumindest stark von Reformismus befallen, wird der Kern der ganzen reformistischen Versumpfung zurückgeführt auf die Frage der Führung und man behauptet weiterhin, grundsätzlich seien die Gewerkschaften weiterhin eine Waffe, die nur von der Last der Bürokratie befreit werden müsste. Aus der Sicht der IKS ist das Gewicht des Reformismus eher auf eine Epoche zurückzuführen, als die materiellen Grundlagen für diese Illusionen noch vorhanden waren. Dies war eine bestimmte Phase Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts; dieser Phase wurde aber der Boden entzogen mit dem Anbruch der neuen Epoche des 1. Weltkrieg, als die materiellen Bedingungen für die Art und Weise, wie die Gewerkschaften zuvor kämpften, nicht mehr vorhanden waren. Die marxistische Bewegung hat gegen die aufkommenden reformistischen Illusionen gekämpft, aber der Kern ihrer Kritik war nie, dass dieses Problem auf das Verhalten der Führer allein zurückzuführen sei, sondern stattdessen sahen sie die tieferliegenden Wurzeln in der Trennung zwischen politischem und ökonomischen Kampf, zwischen Minimal- und Maximalprogramm, in der branchenmäßigen Zersplitterung usw. Nicht nur hat die Führung verraten, sondern die Gewerkschaften sind seit dem 1. Weltkrieg zu einer entscheidenden Stütze für das Kapital geworden – ihre konterrevolutionäre Rolle während der revolutionären Kämpfe in Deutschland belegt dies.* Die Einheit der Arbeiter lässt sich heute nicht durch irgendwelche Gewerkschaften herstellen, sondern nur durch den gemeinsamen, sich vereinigenden Kampf aller Teile der Klasse, der anfängt mit Demonstrationen, Vollversammlungen usw. und in der Bildung von Arbeiterräten gipfelt. Seit der Bildung der ersten Arbeiterräte 1905 und vor allem in der Welle von revolutionären Kämpfen 1917-23 haben sich die Arbeiter immer wieder selbständig organisiert (Beispiel 1956 in Budapest, 1968 in Frankreich, 1969 in Deutschland, 1980 in Polen, die Kämpfe gegen den CPE in Frankreich 2006). Das Grundproblem besteht aber darin, dass man keine Einheitsorgane aufrechterhalten kann, weil der Kampf nicht permanent stattfindet, sondern explosiv ausbricht.
Gewerkschaften – ein Instrument des Staates oder von ‚schlechten’ Führern geleitet?
In den nachfolgenden Wortmeldungen, die wir aus Platzgründen nicht vollständig und chronologisch sondern nur auszugsweise wiedergeben können, pflichtete ein Genosse, der seit Jahren bei „Wildcat“ aktiv mitarbeitet, dem Standpunkt der IKS bei, dass es eine qualitative Veränderung der Gewerkschaften an der Wende vom 19./20. Jahrhundert gegeben habe. Er erläuterte, im 19. Jahrhundert seien Gewerkschaften „instabile“ Gebilde gewesen, mit schnell wachsender Mitgliedschaft in bestimmten Bereichen der Arbeiterklasse. Im 20. Jahrhundert dagegen seien die Gewerkschaften sozusagen „stabile“ Organe geworden, weil sie eine staatliche „Befestigung“ erhalten hätten, um eine Rolle als Ordnungsfaktor auszuüben. Die Gewerkschaften seien seitdem nicht so sehr von Arbeitern geschaffen worden, sondern eher staatliche Geschöpfe mit staatlich gestifteter Lizenz zum Organisieren der Arbeiter. In einer ersten Antwort reagierte ein Vertreter der IS mit dem Einwand, dass zwar die Gewerkschaftsbürokratie eigene Interessen hätte, eigentlich nur ihre Privilegien verteidigte und ohnehin nur unter dem Druck der Arbeiter handelte, aber die Hauptmotivation beim Eintritt in die Gewerkschaften sollte sein, dort Leute zu suchen. Man müsse Verbindungen als Vertrauensleute aufbauen. Die IS betonte, die erste Anlaufadresse müssten die Gewerkschaften sein, außerdem könnte nur mit deren Hilfe ein Netzwerk der Solidarität hergestellt werden. Diese Ausrichtung wurde von einem Anhänger der „Internationale Bolschewistische Tendenz“ (Bolschewik) unterstützt, der dafür plädierte, kommunistische Fraktionen in den Gewerkschaften zu errichten. Gegenüber dieser Rechtfertigung der Gewerkschaftsarbeit durch IS, man treffe dort die kämpferischsten Leute, forderte der Wildcat-Genosse die Mitglieder von IS auf, eine Bilanz ihrer Erfahrung mit der Basisarbeit in den Gewerkschaften vorzulegen, die diese Position auch wirklich bestätigen könnte. Er hob hervor, dass er seinerseits nach jahrelanger Erfahrung mit Streiks und anderen Kampf- und Protestformen, immer wieder feststellen musste, dass er bei den Gewerkschaftsversammlungen nie irgendeine Basis getroffen habe. Es habe einfach nie oder nur ganz selten und wenn ganz wenige Arbeiter auf diesen Gewerkschaftstreffen gegeben, stattdessen meist nur Funktionäre. Er meinte, es sei viel besser anstatt immer wieder für Gewerkschaftsarbeit zu plädieren, einfach zu den Kämpfen hinzugehen und vor Ort direkt Kontakt zu knüpfen. Mit der Unterscheidung zwischen Führung und Basis werde das Kernproblem vertuscht, dass es ein strukturelles Problem gebe. Die Gewerkschaften seien verfestigte Strukturen, eng mit dem Staat verbunden. Auch die IKS entgegnete in mehreren Wortmeldungen, dass die Gewerkschaften längst kein Ort proletarischen Lebens mehr seien. Seit fast 100 Jahren haben sich die Bedingungen geändert, und die Arbeitermüssen sich branchenübergreifend zusammenschließen, um die Kapitalisten zum Nachgeben zu zwingen. Dies kann mit der „Struktur“ der Gewerkschaften nicht gelingen. Der Kampf kann heute nicht mehr in die Hände der Gewerkschaften gelegt werden, sondern die Arbeiter müssen sich selbst organisieren. Die Gewerkschaften handeln als Wachhunde des Kapitals in den Betrieben, welche die Arbeiter daran hindern, die Initiative zu ergreifen und ihr Bewusstsein trüben. Die Aussage der IS, dass die wichtigsten Kämpfe immer mit den Gewerkschaften geführt wurden, sagten wir, entspricht nicht der Erfahrung der Geschichte denn mit der Bildung der Arbeiterräte 1905 hätten die Arbeiter die „praktische ‚Form gefunden, die das Proletariat in Stand setzt, seine Herrschaft zu verwirklichen“ (Lenin). Die Geschichte der wichtigsten Kämpfe des 20. Jahrhundertsund bis heute sei eine Geschichte des eigenständigen, außerhalb und gegen die Gewerkschaften geführten Kampfes. Die tieferliegende Ursache dafür sei die weitreichende Umwälzung der Bedingungen des Kapitalismus seit dem 1. Weltkrieg. Auch wenn in der Diskussion keine Zeit blieb, näher auf diese veränderten Bedingungen des Kapitalismus einzugehen, zeigte sich, dass hier zwei unterschiedliche Ansätze aufeinprallten – die von den IS vertretene Sicht, vom 19. Jahrhundert habe sich bis heute nichts am Charakter der Gewerkschaften geändert; die andere Auffassung, eine eher den historischen Umwälzungen Rechnung tragende Sichtweise (von dem Wildcat-Genossen und von der IKS vertreten), dass sich der Charakter der Gewerkschaften gewandelt habe, die von eher ehemaligen Arbeiterorganisation zu einem staatlichen Ordnungsfaktor mutiert sei. Ein weiterer Grund für das Mitwirken in den Gewerkschaften war aus der Sicht der IS, dass man nicht einfach warten könne, bis sich Arbeiterräte gebildet hätten. Überhaupt könne man nicht einfach die Arbeiter außerhalb der Gewerkschaften allein auf sich gestellt lassen. Wie die Gewerkschaften aussähen, was sie täten – läge an uns. Auch wenn die Gewerkschaften ans System angekettet worden seien, müssten wir die Gewerkschaften für uns instrumentalisieren.
Selbständiges Handeln der Arbeiterklasse erforderlich?
Dem gegenüber erhob eine Teilnehmerin den Einwand, man dürfe nicht die Sicht haben, die Arbeiter solle man nicht alleine stehenlassen, sondern sie könnten sehr wohl eigenständig entscheiden, wüssten, wo sie sich Hilfe holen können. Allerdings hätten sie meist schlechte Erfahrung mit den Gewerkschaften gemacht. Die IKS meinte, es geht immer zunächst darum, die Eigeninitiative der Betroffenen zu fördern, jegliches Bestreben zusammenzukommen zu unterstützen, um die Lage gemeinsam zu beraten, gemeinsam zu überlegen, an wen man sich wenden könne. Je mehr sich zusammenschlössen, je mehr sich ein Kampf radikalisiere, desto mehr Ausstrahlung könne eine Bewegung haben. Ausgangspunkt eines langen Prozesses, der erst in einer revolutionären Situation zur Bildung von Arbeiterräten führt, müsse jeweils das selbständige Handeln der Betroffenen sein. Diese Dynamik verlangt aber den Zusammenschluss aller Arbeiter über alle sie spaltenden Gräben hinweg. Bei diesem Prozess können die Gewerkschaften nicht zu Instrumenten zugunsten der Arbeiter „verwandelt“ werden, sondern sie wirken immer als Hindernis, das überwunden werden müsse. Erfolge der Arbeiter werden nicht erzwungen dank einer unmöglich gewordenen Umwandlung der Gewerkschaften zu Kampforganen sondern nur dank des Handelns der Betroffenen. Einer Frau, die auf eine gar nicht bescheidene Weise von sich behauptete, keine Intellektuelle zu sein um unter Berufung auf das angeblich niedrige Bildungs- und Bewussteinsniveau der Arbeiter die Gewerkschaften für notwendig hielt, damit die Arbeiter ihre Macht erkennen und ausüben, wurde entgegengehalten, die Arbeiter können ihr Selbstvertrauen nur entwickeln, ihre eigene Macht nur dann verspüren, wenn sie selbst handeln. Zudem hatte Rosa Luxemburg in ihrer Schrift „Sozialreform oder Revolution“ betont: „Es kann keine gröbere Beleidigung, keine ärgere Schmähung gegen die Arbeiterschaft ausgesprochen werden als die Behauptung: theoretische Auseinandersetzungen seien lediglich Sache der ‚Akademiker’“.Während in der Diskussion die Mitglieder der IS immer wieder die Behauptung aufstellten, in den Gewerkschaften knüpfe man die großen Kontakte, nur so könne man in Verbindung mit den Arbeitern stehen, letztendlich den Beweis für ihre „erfolgreiche Kontaktarbeit“ aber schuldig blieben, und gleichzeitig der Vorwurf durchdrang, die IKS stehe eher abseits von den Kämpfen, schilderte die IKS anhand von einigen Beispielen (Polen 1980, Krupp-Rheinhausen 1987, Frankreich 2006, 2007) dass man als Revolutionäre nur außerhalb und unabhängig von den Gewerkschaften tätig sein kann. Im Verlaufe dieses Abends waren bei diesem Streitgespräch in der Tat zwei unterschiedliche, sich gegenseitig ausschließende Herangehensweisen aufeinandergestoßen. 15.02.08
Schriftlicher Beitrag der IKS
zur Debatte der Gewerkschaftsfrage auf dem NLO-Treffen im Februar 2008
Es gibt die Auffassung, dass die Revolution jeder Zeit möglich wäre, dass sie nur vom Willen abhinge. Die Marxisten betonen dagegen, dass die Revolution nur unter bestimmten Bedingungen möglich ist.
Es gibt die Auffassung, dass der alltägliche Abwehrkampf der Arbeiter und die Revolution nichts miteinander zu tun hätten. Manche politische Organisationen lehnen den Abwehrkampf ab, weil er der Revolution entgegengesetzt sei. Sie wollen die Revolution sofort. Es gibt die Auffassung, dass die Organisationen, die heute ungeeignet für den Arbeiterkampf sind und ihm feindlich gegenüberstehen, das schon immer gewesen seien. Der Marxismus sieht die Dinge historisch. Es gibt nichts, was für alle Zeiten gut oder schlecht ist; alles wandelt sich. Nach der Lehre des Marxismus war selbst der Kapitalismus nicht schon immer etwas Schlechtes, ist der Kapitalismus nichts an sich ‚Teuflisches’. Er war gegenüber dem Feudalismus etwas Fortschrittliches. Er ermöglichte die Entwicklung der Produktivkräfte, was eine Vorbedingung für den Kommunismus ist, der nur als eine Gesellschaft der Fülle möglich ist, und er brachte seinen eigenen Totengräber, das Weltproletariat, hervor. Eine Gesellschaftsform macht eine Entwicklung durch. In ihrem Entstehen, ihrer aufsteigenden Phase stellt sie einen geschichtlichen Fortschritt dar, beseitigt manche Übel der vorhergehenden Gesellschaft. In dieser Zeit steht die Revolution noch nicht auf der Tagesordnung, sondern erst ab dem Zeitpunkt, an dem eine Gesellschaftsform ihre historische Aufgabe erfüllt hat, und nun zu einem Hindernis für die weitere Entwicklung wird.
Der Arbeiterkampf im 19. Jahrhundert
In der aufsteigenden Phase entwickelte sich der Weltmarkt. Die Arbeiterklasse konnte durch den Zusammenschluss in Gewerkschaften Verbesserungen erreichen. Im 19. Jahrhundert gab es eine Trennung zwischen politischem und wirtschaftlichem Kampf. Der wirtschaftliche Kampf wurde von den Gewerkschaften geführt und der politische von der sozialdemokratischen Partei. Der wirtschaftliche Kampf richtete sich gegen einzelne Kapitalisten und die streikenden Arbeiter wurden von den anderen Arbeitern unterstützt, die das nur konnten, wenn sie nicht selber streikten. Damals konnten sich noch die verschiedensten Arbeitervereine bilden, Kultur- und Sportvereine, die noch wirklich ein Gegenpol zur bürgerlichen Welt waren. Dort wurde die Solidarität gepflegt, der Zusammenhalt, eine Unterstützungskasse angelegt.
Die Wende des 1. Weltkriegs
Der 1. Weltkrieg war Ausdruck dafür, dass der Kapitalismus nun zu einem Hindernis für die weitere Entwicklung der Menschheit geworden war. Der 1. Weltkrieg war Ausdruck eines verschärften, mörderischen Konkurrenzkampfes, der jede nationale Bourgeoisie zwang, die Arbeiterklasse bluten zu lassen. Der Weltmarkt war geschaffen und damit in gewisser Hinsicht ein Schritt hin zur Einheit der Menschheit getan. Der 1. Weltkrieg als Krieg um die Neuaufteilung des Weltmarkts unter die einzelnen Staaten. Die Gewerkschaften waren zu Staatsorganen, zu Instrumenten des Kapitals geworden, die zusammen mit ihrer jeweiligen Bourgeoisie, die ganze Wirtschaft auf den Krieg ausrichteten, den Arbeitern den Burgfrieden aufzwangen und ‚ihre’ jeweiligen Arbeiter zum massenhaften Mord an ihren Klassenschwestern und –brüdern aufriefen.
Die Gewerkschaften – Waffe der Arbeiter oder des Kapitals?
Nun stand die Weltrevolution auf der Tagesordnung, die Abschaffung der Lohnarbeit, der Staaten, der Konkurrenz- und Warengesellschaft. Die Gewerkschaften haben ihre ursprüngliche Funktion verloren als Vertreter der Ware Arbeitskraft. Und sie haben eine neue Funktion, nun an der Seite der Bourgeoisie, die Kämpfe in Sackgassen laufen zu lassen, Wut verpuffen zu lassen usw. usw. Ohne die Überwindung des Kapitalismus kann die Arbeiterklasse auf die Dauer nicht mehr überleben. Sie muss die Revolution machen, um überleben zu können. Um dahin zu kommen, die Revolution machen zu können, muss sie gegen die Verschlechterung ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen kämpfen, muss sie sich ihres revolutionären Wesens bewusst werden, muss sie ihre Einheit schmieden - auch letzteres ein Grund, die Gewerkschaften abzulehnen, selbst wenn sie Vertreter der Ware Arbeitskraft wären, weil sie der Einheit entgegenarbeiten, indem sie die Arbeiter in Branchen spalten. Es kann keine Trennung mehr zwischen politischem und wirtschaftlichem Kampf geben. Bei jedem größerem Kampf steht die Arbeiterklasse gegen alle tragenden Kräfte der Gesellschaft, gegen die Unternehmer, die Gewerkschaften, die Medien, die Parteien. Die Lohnkämpfe werden zu einer Schule für die Revolution.Hinter jedem Streik lauert, wie Lenin sagt, das Gespenst der Revolution. Der Kampf der Arbeiter ist ein Kampf gegen die Ausbeutung und stellt damit die Machtfrage über die Verfügung des Mehrprodukts. In den Kämpfen muss das Proletariat die Perspektive des Kommunismus entwickeln.
Der Massenstreik- Fusion von politischem und ökonomischem Kampf
1905 hat die Arbeiterklasse in Russland und schon vorher in Belgien ein neues Mittel für ihren Kampf gefunden: den Massenstreik, und eine neue Organisationsform: die Arbeiterräte. Beide sind eine Einheit von politischem und wirtschaftlichen Kampf. Da die Revolution, die Befreiung der Arbeiter ansteht, und die nur das Werk der Arbeiter selbst sein kann, ist jede Stellvertreterpolitik ausgeschlossen, also auch der Parlamentarismus. Der Massenstreik kann nicht wie ein Generalstreik geplant oder der Tag X vorbereitet werden, sondern er kommt aus den Tiefen der gesellschaftlichen Entwicklung und der unterirdischen Reifung der Bewusstseinsentwicklung der Arbeiter.Der staatliche Totalitarismus ist so stark geworden, dass es nur noch im Kampf Arbeiterorgane wie Streikkomitees geben kann. Wenn man versucht, sie nach dem Kampf aufrechterhalten, werden sie unweigerlich aufgesaugt und degenerieren zu gewerkschaftsähnlichen Gruppen. Nur wenn möglichst große Teile der Klasse mobilisiert sind, wenn es ständig Vollversammlungen und Debatten gibt, wenn die Klasse wachsam ist, wenn die Klasse agiert, können Masseneinheitsorgane bestehen.
In allen größeren Kämpfen der Arbeiterklasse kommt es zu Vollversammlungen und zu auf den Vollversammlungen gewählten Streikkomitees und Delegierten. Das sind Keimformen der Arbeiterräte. Beide die Räte und deren Keimformen sind die politisch und wirtschaftlichen Masseneinheitsorgane der Klasse. Sie sind für alle offen, ob Christ oder Moslem, ob arbeitslos oder nicht, ob Gewerkschaftsmitglied oder nicht, ob CDU-, SPD- oder Nichtwähler. Sie sind Orte der Debatte, der Zurückdrängung der bürgerlichen Ideologie. Es ist möglichst die ganze Klasse in die jeweiligen Kämpfe einbezogen werden.
Aktuelles und Laufendes:
- Arbeiterkampf [40]
Gegen die weltweiten Angriffe des krisengeschüttelten Kapitalismus: eine Arbeiterklasse – ein Klassenkampf
- 2835 reads
Seit fünf Jahren hat sich der Klassenkampf weltweit kontinuierlich weiterentwickelt. Gegen die simultanen und immer schlimmeren Attacken, mit denen sie konfrontiert wird, reagiert die Arbeiterklasse, indem sie ihre Kampfbereitschaft demonstriert und sowohl in den sog. entwickelten als auch in den unterentwickelten Ländern den Kampf aufnimmt.
Bekräftigung der weltweiten Entwicklung des Klassenkampfes
Im Laufe des Jahres 2007 sind in vielen Ländern Arbeiterkämpfe ausgebrochen.
Ägypten: Bereits im Dezember 2006 und Frühjahr 2007 standen die 27.000 ArbeiterInnen der Fabrik Ghazl Al Mahallah, etwa hundert Kilometer von Kairo entfernt, im Mittelpunkt einer großen Welle von Kämpfen. Am 23. September, inmitten einer mächtigen Welle von Kämpfen, nahmen sie den Kampf erneut auf. Der Regierung versäumte es, ihr Versprechen zu halten und 150 Tageslöhne an alle ArbeiterInnen auszuzahlen, ein Versprechen, mit dem sie dem vorausgegangenen Streik ein Ende bereitet hatte. Ein Streikender, der von der Polizei festgenommen worden war, erklärte: „Uns wurden 150 Tageslöhne versprochen; wir wollen lediglich, dass man unsere Rechte respektiert: Wir sind entschlossen, bis ans Ende zu gehen.“ Die ArbeiterInnen listeten ihre Forderungen auf: einen Bonus von 150 ägyptischen Pfund (umgerechnet weniger als 20 Euros, während die Monatslöhne zwischen 200 und 250 ägyptischen Pfund schwanken); kein Vertrauen in den Gewerkschaftsausschuss und den Vorstand der Gesellschaft; einen Bonus, der auf den Grundlohn angerechnet wird und nicht am Produktionsergebnis gebunden ist; eine Erhöhung der Lebensmittelzuschüsse; einen an die Preise geknüpften Mindestlohn; Fahrkostenzuschüsse für ArbeiterInnen, die gezwungenermaßen weit entfernt von der Fabrik wohnen, und eine Verbesserung des Gesundheitsdienstes. Die ArbeiterInnen anderer Textilbetriebe, wie jene von Kafr Al Dawar, die bereits im Dezember 2006 erklärten: „Wir sitzen alle im gleichen Boot und unternehmen dieselbe Reise“, demonstrierten einmal mehr ihre Solidarität und traten Ende September in den Streik. In den Kairoer Getreidemühlen gingen die Beschäftigten zu einem Sitzstreik über und übermittelten eine Solidaritätsbotschaft, in der sie die Forderungen der Textilarbeiterinnen unterstüzten. In den Betrieben von Tanta Linseed and Oil folgten die Beschäftigten dem Beispiel von Mahallah, indem sie eine ähnliche Liste von Forderungen veröffentlichten. In diesen Kämpfen wurde auch eine vehemente Ablehnung der offiziellen Gewerkschaften zum Ausdruck gebracht, die als die treuen Bluthunde der Regierung und der Bosse betrachtet werden: „Der Repräsentant der offiziellen, staatlich kontrollierten Gewerkschaften, der daher gekommen war, um seine Kollegen aufzufordern, den Streik zu beenden, befindet sich im Krankenhaus, nachdem er von wütenden Arbeitern zusammengeschlagen worden war. ‚Die Gewerkschaften gehorchen lediglich den Anweisungen von oben, wir wollen unsere eigenen Repräsentanten wählen‘, erklärten die ArbeiterInnen“ (zitiert in Libération, 1.10.2007). Die Regierung sah sich veranlasst, den ArbeiterInnen einen Zuschlag von 120 Tageslöhnen anzubieten und zu versprechen, das Management zu belangen. Doch die ArbeiterInnen haben gezeigt, daß sie bloßen Versprechungen nicht mehr trauen; Stück für Stück vertrauten sie ihrer kollektiven Stärke und ihrer Entschlossenheit, zu kämpfen, bis ihre Forderungen erfüllt wurden.
Dubai: In diesem Emirat am Persischen Golf bauen Hunderttausende von Bauarbeitern, zumeist aus Indien, Pakistan, Bangladesh und China, Luxushotels und Paläste für 100 Euro im Monat und werden in der Nacht wie Vieh in schmutzige Baracken gepfercht. Bereits im Frühjahr 2006 waren Streiks ausgebrochen, und auch im Oktober 2007 trotzten 4.000 von ihnen der Androhung von Repressalien, des Job- und Lohnverlustes sowie der lebenslangen Abschiebung aus Dubai und gingen auf die Straße, womit sie weitere 400.00 Bauarbeiter dazu brachten, zwei Tage lang mit ihnen in den Ausstand zu treten.
Algerien: Angesichts des wachsenden Unmuts riefen die autonomen Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes für den 12. und 15. Januar 2008 gegen den Kollaps der Kaufkraft und die neuen Gehaltstarife für Lehrer zu einem landesweiten Streik der Staatsangestellten, insbesondere der Lehrer, auf. Doch der Streik weitete sich auch auf andere Sektoren aus, einschließlich der Beschäftigten im Gesundheitsbereich. Die Stadt Tisi Ouzou wurde völlig lahmgelegt, der Streik der Lehrkräfte war in den Städten Oran, Constantine, Annaba, Bechar, Adrar und Saïda besonders massiv.
Venezuela: Schon im Mai 2007 hatten sich die Ölarbeiter gegen Entlassungen in einem Staatsunternehmen gewehrt. Im September mobilisierten sie sich während der Arbeitsvertragsverhandlungen erneut, um höhere Löhne zu fordern. Auch der Mai erlebte eine Mobilisierung von Studenten gegen das Regime, die die Verbesserung der Lebensbedingungen für die Ärmsten der Bevölkerung und der ArbeiterInnen forderten. Die Studenten organisierten allgemeine Versammlungen, die für alle offen waren, mit gewählten Streikkomitees. Jedesmal hinterließ die von der Chavez-Regierung, dem „Apostel der bolivarischen Revolution“, veranlasste Repression einige Tote und Hunderte von Verletzten.
Peru: Im April begann ein unbefristeter Streik in einem chinesischen Unternehmen, der sich - zum ersten Mal seit 20 Jahren - schnell auf den Kohlebergbau im ganzen Land ausweitete. Das Unternehmen Sider Peru in Chimbote wurde trotz der Versuche der Gewerkschaften, den Streik zu isolieren und zu sabotieren, vollständig lahmgelegt. Die Ehefrauen der Bergarbeiter demonstrierten zusammen mit ihnen; auch schlossen sich ihnen große Teile der örtlichen Bevölkerung, einschließlich Bauern und Arbeitslose, an. In Casapalca in der Nähe von Lima stellten die Bergarbeiter die Minenmanager, die ihnen mit Entlassungen gedroht hatten, falls sie ihre Arbeit verlassen, unter ihre Obhut. Studenten aus Lima, denen sich ein Teil der Bevölkerung anschloss, machten sich auf, um ihnen Lebensmittel zu bringen und zu unterstützen. Im Juni wurde ein großer Teil der landesweit etwa 325.000 Lehrer mobilisiert, ebenfalls von weiten Teilen der Bevölkerung unterstützt, trotz aller gegenteiligen Bemühungen der Gewerkschaften. Jedesmal reagierte die Regierung mit Verhaftungen, Kündigungsdrohungen, mit dem Einsatz von Vertragsarbeitern, um die streikenden Bergarbeiter zu ersetzen, und mit der Organisierung massiver Medienkampagnen, um die streikenden Lehrer zu verleumden.
Türkei: Angesichts von Lohneinbußen und Arbeitsplatzunsicherheit infolge der Privatisierung und des Transfers von 10.000 Jobs zu Subunternehmen streikten Ende des vergangenen Jahres 26.000 ArbeiterInnen von Türk Telecom 44 Tage lang – der größte Streik in der Türkei seit dem Bergarbeiterstreik von 1991. Vor dem Hintergrund einer Militärkampagne gegen die Kurden im irakischen Grenzgebiet wurden einige „Rädelsführer“ verhaftet, der Sabotage, ja des Hochverrats gegen die nationalen Interessen beschuldigt und mit Sanktionen und Kündigungen bedroht. Am Ende behielten sie ihre Jobs, und obendrein wurde eine Lohnerhöhung von zehn Prozent ausgehandelt.
Finnland: Die Bourgeoisie war bereits weit gekommen beim Abbau der sozialen Sicherheit in Finnland, als 70.000 Pflegekräfte (vornehmlich Krankenschwestern) im Oktober einen Monat lang in den Ausstand traten, um eine Lohnerhöhung von mindestens 24 Prozent zu fordern. Die Gehälter sind so niedrig (zwischen 400 und 600 Euro im Monat), dass viele von ihnen dazu gezwungen sind, Arbeit im benachbarten Schweden zu suchen. 12.800 Krankenschwestern drohten, kollektiv zu kündigen, falls die Regierung und die Gewerkschaft Tehy es in ihren Verhandlungen versäumt, ihren Forderungen nachzukommen – die Regierung hatte lediglich eine 12-prozentige Erhöhung angeboten. In einigen Krankenhäusern drohten ganze Stationen geschlossen zu werden.
Bulgarien: Nach einem eintägigen symbolischen Streik traten die Lehrer Ende September in einen unbefristeten Streik, um Gehaltserhöhungen zu fordern: 100 Prozent für Realschullehrer (die im Durchschnitt 174 Euro im Monat verdienen) und eine 5-prozentige Erhöhung des nationalen Bildungsetats. Der Streik war in dem Moment zu Ende, als die Regierung versprach, die Lehrergehälter 2008 zu überprüfen.
Ungarn: Aus Protest gegen die Stilllegung unprofitabler Linien und gegen die Regierungsreform der Renten und der Gesundheitsfürsorge traten die Eisenbahnarbeiter in den Streik. Am 17. Dezember zogen sie weitere 32.000 ArbeiterInnen aus anderen Branchen (Lehrer, Pflegekräfte, Busfahrer, Angestellte des Budapester Flughafens) in den Streik. Am Ende waren die Gewerkschaften trotz der Tatsache, dass das Parlament die Reform durchgewunken hat, in der Lage, die Mobilisierung in den Industrien zu benutzen, um den Kampf der Eisenbahnarbeiter zu ersticken; sie riefen zur Rückkehr zur Arbeit am nächsten Tag auf.
Russland: Trotz des Gesetzes, das alle Streiks, die länger als 24 Stunden dauern, für illegal erklärt, trotz der gerichtlichen Verurteilungen von Streikenden, trotz ständiger Polizeiübergriffe und des Einsatzes von Kriminellen gegen die kämpferischsten ArbeiterInnen, ist im vergangenen Frühjahr zum ersten Mal seit zehn Jahren eine Streikwelle durchs Land geschwappt, von Westsibirien bis zum Kaukasus. Zahllose Industriebranchen wurden dabei in Mitleidenschaft gezogen: Baustellen in Tschetschenien, ein Sägewerk in Nowgorod, ein Krankenhaus in dem Gebiet von Tchita, Hausinstandhaltungsarbeiter in Saratow, Angestellte von Fast-Food-Restaurants in Irkutsk, die Fabrik von General Motors in Togliattigrad und eine wichtige Maschinenfabrik in Karelien. Die Bewegung kulminierte im November mit einem dreitägigen Streik der Hafenarbeiter in Tuapse am Schwarzen Meer, dem zwischen dem 13. und 17. November die Hafenarbeiter von drei Petersburger Betrieben folgten. Am 26. Oktober traten Postangestellte in den Streik, so wie auch im gleichen Monat die Angestellten von Elektrizitätswerken. Zugführer bei den Eisenbahnen drohten, zum ersten Mal seit 1988 wieder zu streiken. Das völlige mediale Ausblenden dieser Streikwelle, die durch die massive Inflation und Preissteigerungen von 50 – 70 Prozent bei Grundnahrungsmitteln ausgelöst worden war, wurde vor allem durch den Streik der Fordarbeiter in Vsevolojsk in der Region von St. Petersburg am 20. November durchbrochen. Die Föderation Unabhängiger Gewerkschaften, die die Regierung ganz offenkundig mit Samthandschuhen anfasst und Streiks jeglicher Art feindlich gegenübersteht, erwies sich als unfähig, auch nur die geringste Rolle bei der Kontrolle der Arbeiterbewegung zu spielen. Dafür beutete das Management der Großbetriebe mit der Hilfe der herrschenden Klasse des Westens ausgiebig die Illusionen der ArbeiterInnen über „freie“ oder „klassenkämpferische“ Gewerkschaften aus und ermutigte die Entstehung neuer gewerkschaftlicher Strukturen, wie die Überregionale Gewerkschaft der Automobilarbeiter, die auf Initiative des Gewerkschaftskomitees von Ford geschaffen wurde und unabhängige Gewerkschaften aus etlichen Großbetrieben, wie Avto-VAZ-General Motors in Togliattigrad und Renault-Autoframos in Moskau, um sich scharte. Es sind diese neuen „unabhängigen“ Gewerkschaften, die – durch die Isolierung der ArbeiterInnen in ihren Fabriken und die Einschränkung der Solidaritätsbekundungen anderer ArbeiterInnen auf reine Sympathiebekundungen und finanzielle Hilfe – die ArbeiterInnen in die bittersten Niederlagen treiben. Erschöpft und mittellos nach einem Monat Streik, waren Letztere gezwungen, zur Arbeit zurückzukehren, nachdem sie nichts oder – in den Worten des Managements – ein vages Versprechen erhalten hatten, nach der Rückkehr zur Arbeit in Verhandlungen zu treten.
Italien: Am 23. November organisierten die Basisgewerkschaften (Confederazione Unitaria di Base – CUB, die Cobas - und etliche branchenübergreifende „Kampf“-Gewerkschaften) einen eintägigen Generalstreik gegen ein am 23. Juli von der Regierung und den drei Hauptgewerkschaften (CGIL, CISL, UIL) unterschriebenes Abkommen - das Angriffe gegen die Arbeitsplatzsicherheit und eine drastische Reduzierung der Renten- und Gesundheitsausgaben vorsieht -, dem sich zwei Millionen ArbeiterInnen anschlossen. Mehr als 400.000 Menschen nahmen an 25 Demonstrationen überall im Land teil, die größten in Rom und Mailand. Alle Branchen waren betroffen, besonders aber das Transportwesen (Eisenbahnen, Flughäfen), der Maschinenbau (in der Fiat-Fabrik von Pomigliano wurde der Streikaufruf zu 90 Prozent befolgt) und die Krankenhäuser. Ein großer Teil der Streikenden bestand aus jungen Leuten mit Zeitverträgen (von denen es mehr als sechs Millionen gibt) und nicht-gewerkschaftlichen ArbeiterInnen. Der Zorn über die abnehmende Kaufkraft spielte eine wichtige Rolle bei dem Umfang dieser Mobilisierung.
Großbritannien: Zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt traten Postangestellte, besonders in Liverpool und Südlondon, spontan in eine Reihe von Streiks gegen Lohnkürzungen und drohenden Arbeitsplatzverlust. Die Kommunikationsarbeiter-Gewerkschaft (CWU) antwortete darauf mit der Isolierung der ArbeiterInnen, indem sie deren Aktivitäten auf das Aufstellen von Streikposten an den bestreikten Sortierämtern beschränkte. Gleichzeitig unterschrieb die CWU ein Abkommen mit dem Management, um die Flexibilität bei den Jobs und den Löhnen zu erhöhen.
Deutschland: Der „rollende Streik“ der Eisenbahner für höhere Löhne dauerte zehn Monate und wurde von der GDL (Gewerkschaft Deutscher Lokführer) kontrolliert. Die Gewerkschaften spielten eine Hauptrolle bei der Spaltung der ArbeiterInnen; einige Gewerkschaften hielten am legalen Rahmen fest, während andere radikaler in der Bereitschaft schienen, das Gesetz zu brechen. Die Medien organisierten eine riesige Kampagne, um die „selbstsüchtigen“ Streikenden zu verleumden, die jedoch eine Menge Sympathie von den Fahrgästen erhielten, die größtenteils selbst ArbeiterInnen sind und in wachsendem Maße bereit sind, sich mit jenen zu identifizieren, die sich im Kampf gegen dieselbe „soziale Ungerechtigkeit“ befinden, die sie selbst fühlen. Die Zahl der Eisenbahner hat sich in den letzten zwanzig Jahren halbiert, während sich gleichzeitig die Arbeitsbedingungen verschlechterten und die Löhne in den letzten fünfzehn Jahren eingefroren waren, so dass die Eisenbahner heute zu den am schlechtesten bezahlten Arbeitern in Deutschland gehören (Monatsgehälter von nur 1500 Euro im Durchschnitt). Unter dem Druck der Eisenbahner wurde ein neuer dreitägiger Streik im November vom Gericht stattgegeben, parallel zum Eisenbahnerstreik in Frankreich, der auf große Unterstützung in der deutschen Öffentlichkeit stieß. Dies führte im Januar zu einer Lohnerhöhung von 11 Prozent (weitaus weniger als die geforderten 31 Prozent und teilweise bereits überholt); um Dampf abzulassen, wurde die Wochenarbeitszeit der 20.000 Lokführer von 41 auf 40 Stunden reduziert – beginnend mit dem Februar 2009.
Für das Ende 2008 kündigte der finnische Handyhersteller Nokia die Schließung seines Bochumer Werkes an, d.h. die Kündigung von 2.300 ArbeiterInnen und die Gefährdung weiterer 1.700 Jobs unter den ZeitvertragsarbeiterInnen in der Stadt. Am Tag nach der Ankündigung, am 16. Januar, verweigerten die ArbeiterInnen die Arbeit, und Automobilarbeiter aus der nahe gelegenen Opel-Fabrik sowie von Mercedes, Stahlarbeiter vom Dortmunder Hoechst-Betrieb, Maschinenbauer von Herne und Bergarbeiter der Region versammelten sich vor den Fabriktoren von Nokia, um ihren KollegInnen ihre Unterstützung und Solidarität auszudrücken. Das deutsche Proletariat im Zentrum Europas wird durch seine systematische Erfahrung in Sachen Solidarität und militanter Kampf einmal mehr zum Leuchtturm für den internationalen Klassenkampf. Es sei daran erinnert, dass schon im Jahr 2004 die Arbeiter von Daimler-Benz in Bremen spontan gegen die Versuche des Managements in den Ausstand getreten waren, sie gegen ihre Kollegen in der Stuttgarter Daimler-Fabrik auszuspielen, denen die Entlassung drohte. Einige Monate später waren die bereits genannten Opel-Arbeiter an der Reihe, spontan gegen dieselbe Art von Pressionen durch das Management zu streiken. Daher versuchte die herrschende Klasse in Deutschland, dieselben Ausdrücke der Solidarität und die Mobilisierung über Industriebranchen hinweg zu vermeiden, indem sie die Aufmerksamkeit auf den altbekannten Fall einer Verlagerung (die Nokiafabrik zieht nach Cluj in Rumänien) zu lenken und eine riesige Medienkampagne (mit den vereinten Kräften der Regierung, Landespolitikern, der Kirche und der Gewerkschaften) zu entfachen, um den finnischen Konzern anzuklagen, die Regierung hintergangen zu haben, nachdem er all die Subventionen für den Erhalt seiner Bochumer Fabrik erhalte hatte.
Während die gesamte Arbeiterklasse Ziel unablässiger Angriffe der herrschenden Klasse (Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67, Entlassungspläne, Kürzungen der Sozialhilfe durch die Agenda 2010...) ist, wird der Kampf gegen Entlassungen und Arbeitsplatzvernichtung in wachsendem Maße von Forderungen nach Lohnerhöhungen und gegen die zerfallende Kaufkraft ergänzt. 2007 war die Zahl der Streiktage die höchste seit 1993 nach der Wiedervereinigung (70 Prozent von ihnen gingen aufs Konto der Streiks im Frühjahr gegen die Auslagerung von 50.000 Jobs in der Telekommunikationsindustrie).
Frankreich: Das künftige Potenzial war vor allem durch die Streiks der Lokführer und der Straßenbahnfahrer in Frankreich im Oktober und November demonstriert worden, ein Jahr nach den Kämpfen im Jahr 2006, die die Regierung damals dazu gezwungen hatten, das neue Gesetz (CPE) zurückzunehmen, das auf die Verringerung der Arbeitsplatzsicherheit für junge Leute abzielte, und in denen die studentische Jugend eine Hauptrolle gespielt hatte. Der Streik im Transportwesen folgte einem fünftägigen Streik der Flugzeugcrews bei Air France gegen die Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen, Spiegelbild des allgemeinen Anstiegs der Militanz und des sozialen Unmuts.
Weit entfernt davon, sich an einem „privilegierten“ Rentensystem zu klammern, forderten die Eisenbahner die Rückkehr zur Rente nach 371/2 Beitragsjahren für alle. Besonders die jungen Arbeiter der SNCF demonstrierten eine große Entschlossenheit, um den Streik auszudehnen und mit dem Korporatismus zu brechen, der die Eisenbahner in verschiedene Kategorien (Lokführer, Mechaniker, Zugbesatzung) spaltete, was so schwer auf den Kämpfen von 1986/87 und 1995 gelastet hatte. Dabei offenbarten sie ein starkes Gefühl der Solidarität innerhalb der Arbeiterklasse insgesamt.
Gleichzeitig war die Studentenbewegung gegen die Universitätsreform (bekannt als „Loi Pécresse“) - die darauf abzielte, die Universitäten aufzuteilen in einige wenige Eliteinstitutionen für die Bourgeois und in Massenuniversitäten, von denen der Rest mit Zeitarbeitsverträgen abgeht - eine Verlängerung der Bewegung von 2006 in dem Sinne, als ihr Forderungskatalog nicht nur die Rücknahme des Loi Pécresse vorsah, sondern auch die Ablehnung aller Angriffe der Regierung mit einschloss. Es wurden ganz reale Solidaritätsbande zwischen Studenten und Eisenbahnern sowie Straßenbahnfahrern geknüpft, die sich im gegenwärtigen Kampf - wenn auch begrenzt – in solchen Momenten ausdrücken wie in ihren allgemeinen Versammlungen, vereinten Aktionen und gemeinsamen Mahlzeiten.
Diese Kämpfe konfrontieren überall die Sabotage und Spaltung, zu denen die Gewerkschaften ermutigen, die immer mehr ihre wahre Funktion als Diener des bürgerlichen Staates enthüllen, da sie die Kärrnerarbeit bei den Angriffen gegen die Arbeiterklasse leisten müssen. In den Kämpfen der Eisenbahner und Straßenbahnfahrer im Oktober und November 2007 in Frankreich war das geheime Einverständnis der Gewerkschaften mit der Regierung augenscheinlich. Und jede Gewerkschaft spielten ihren Part bei der Spaltung und Isolierung der Kämpfe. (1)
Vereinigte Staaten: Die Vereinte Automobilarbeiter-Gewerkschaft sabotierte den Streik bei General Motors im September, daraufhin bei Chrysler im Oktober und verhandelte mit dem Management über den Transfer medizinischer und sozialer Belange an die Gewerkschaften im Austausch für den „Schutz“ der Jobs und einem vierjährigen Einfrieren der Löhne. Dies ist nichts als Schwindel, da das Management hinter der Aufrechterhaltung der Zahl der Arbeitsplätze die Ersetzung von permanenten Vollzeit-ArbeiterInnen durch ZeitarbeiterInnen mit niedrigeren Löhnen plant, die dennoch gezwungen werden, der Gewerkschaft beizutreten.
Dieses Verhalten der Gewerkschaft – schlechtere Bedingungen für künftige Jobs zu akzeptieren – ist weit entfernt von der Entschlossenheit, die die New Yorker U-Bahn-Beschäftigten im Jahr 2005 an den Tag gelegt hatten, welche unter großen Opfer gegen eine vorgeschlagene Abmachung streikten, die die künftige Generationen bestrafen würde, während die heutigen ArbeiterInnen relativ verschont geblieben wären; ausdrücklich hatten sie ihre Solidarität nicht nur mit ihren KollegInnen erklärt, sondern auch mit den noch ungeborenen Arbeitergenerationen.
Die Hauptcharakteristiken des heutigen Kampfes
Die Bourgeoisie ist in wachsendem Maße gezwungen, angesichts der Diskreditierung des Gewerkschaftsapparates Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Daher erleben wir, je nach Land, das Auftreten von Basisgewerkschaften oder „radikalerer“ Gewerkschaften bzw. Gewerkschaften, die „frei und unabhängig“ zu sein behaupten, um die Kämpfe zu kontrollieren, um die Fähigkeit der ArbeiterInnen, die Kontrolle über den Kampf selbst zu übernehmen, in Schach zu halten und vor allem um jeglichen Denkprozess, jegliche Diskussion und jeglichen Anstieg im Bewusstsein unter den ArbeiterInnen zu unterbinden.
Die sich entwickelnden Kämpfe stehen auch einer breiten Hasskampagne, die von der herrschenden Klasse dirigiert wird, und einer Steigerung der Repressionsmaßnahmen gegenüber. In Frankreich wurde nicht nur eine große Kampagne organisiert, um die „Kunden“ gegen streikende TransportarbeiterInnen auszuspielen, die ArbeiterInnen unter sich zu spalten und den Impuls zur Solidarität zu brechen – es wird auch immer öfter versucht, die Streikenden zu kriminalisieren. Am 21. November, am Ende des Streiks, wurde eine ganze Kampagne um Sabotageakte an Eisenbahngleisen und Oberleitungen entfesselt, um die ArbeiterInnen als „uverantwortlich“ und gar als „Terroristen“ hinzustellen. Dieselbe Kriminalisierung richtete sich gegen die Studenten, deren Streikposten vor den Universitäten als „Rote Khmer“ oder „Delinquenten“ dargestellt wurden. Dieselben Studenten wurden Opfer gewaltsamer Repression durch die Polizei, als diese die Streikposten beiseite drängte und die besetzten Universitäten räumte. Dutzende von Studenten wurden verletzt oder festgenommen und summarisch zu langen Gefängnisstrafen verurteilt.
Diese aktuellen Kämpfe bekräftigen voll und ganz die Charakteristiken, die wir in der Resolution über die internationale Lage, welche vom 17. Kongress der IKS im Mai 2007 verabschiedet worden war, in den Blickpunkt gerückt hatten. (2)
·„... sie schließen immer mehr die Frage der Solidarität mit ein. Dies ist äußerst wichtig, weil sie par excellence das Gegenstück zum Verhalten des ‚Jeder-für-sich-selbst‘ bildet, das so typisch für den gesellschaftlichen Zerfall ist, und vor allen Dingen weil sie im Mittelpunkt der Fähigkeit des Weltproletariats steht, nicht nur seine gegenwärtigen Kämpfe weiterzuentwickeln, sondern auch den Kapitalismus zu stürzen“. Trotz aller Bemühungen der Bourgeoisie, die Kämpfe davon fernzuhalten, lag in den Kämpfen in Frankreich im Oktober und November der Duft der Solidarität in der Luft.· Die Kämpfe drücken eine Desillusionierung über die Zukunft aus, die der Kapitalismus uns anbietet: „... nahezu vier Jahrzehnte der offenen Krise und der Angriffe gegen die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse, besonders der Anstieg der Arbeitslosigkeit und der prekären Arbeit hat die Illusionen weggefegt, dass ‚morgen alles besser sein wird‘: die älteren Arbeitergenerationen sind sich genauso wie die neuen weitaus bewusster über die Tatsache, dass ‚morgen alles noch schlimmer sein wird‘.“· „Heute ist es nicht die Möglichkeit der Revolution, die die Hauptquelle des Denkprozesses ausmacht, sondern - angesichts der katastrophalen Perspektiven, die der Kapitalismus für uns parat hält – ihre Notwendigkeit.“ Das Nachdenken über die Sackgasse des Kapitalismus ist mehr und mehr ein bestimmendes Element bei der Reifung des Klassenbewusstseins.
·„1968 drückten die Studentenbewegung und die Bewegung der ArbeiterInnen, auch wenn die eine der anderen auf dem Fuße folgte, zwei verschiedene Realitäten bezüglich des Eintrittts des Kapitalismus in seine offene Krise aus: für die Studenten eine Revolte des intellektuellen Kleinbürgertums angesichts der Perspektive einer Auszehrung ihres gesellschaftlichen Status‘; für die ArbeiterInnen ein ökonomischer Kampf gegen die Anfänge der Herabsetzung ihres Lebenstandards. 2006 war die Bewegung der StudentInnen eine Bewegung der Arbeiterklasse.“ Heute ist die Mehrheit der Studenten in der Arbeiterklasse integriert: Die meisten von ihnen müssen arbeiten, um ihr Studium oder ihre Wohnung zu finanzieren; sie sind beständig prekären Arbeitsbedingungen, Arbeitslosigkeit oder perspektivlosen Jobs ausgesetzt. Das Zwei-Geschwindigkeitssystem der Universitäten nach Vorbereitung durch die Regierung wird sie noch näher ans Proletariat rücken. In diesem Sinn bestätigt die französische Studentenmobilisierung 2007 das Jahr 2006, das deutlich auf dem Terrain der Arbeiterklasse stand und Methoden der Arbeiterklasse benutzte: souveräne Massenversammlungen, die allen ArbeiterInnen offen standen.
Heute zeichnet sich der Entwicklungsprozess des Klassenkampfes auch durch die Entwicklung der Diskussion innerhalb der Arbeiterklasse aus, durch das Bedürfnis nach kollektivem Nachdenken, durch die Politisierung suchender Elemente, was am Auftauchen oder an der Reaktivierung proletarischer Gruppen und Diskussionszirkel im Kielwasser bedeutsamer Ereignisse (Ausbruch imperialistischer Konflikte) oder von Streiks deutlich wird. In der ganzen Welt gibt es eine Tendenz, sich auf internationalistische Positionen hinzu zu bewegen. Wir finden ein charakteristisches Beispiel in der Türkei, wo die Genossen der Gruppe EKS eine internationalistische Stellung gegen den Krieg im Irak und gegen die Intervention der Türkei dort verteidigen, indem sie Klassenpositionen der Kommunistischen Linken vertreten. (3)
Auch in weniger entwickelten Ländern wie die Philippinen und Peru oder in hochindustrialisierten Ländern, wo die Tradition der Arbeiterbewegung weniger ausgeprägt ist, wie Korea und Japan, sind revolutionäre Bewegungen aufgekommen. In diesem Zusammenhang hat die IKS ihre Verantwortung angenommen, wie angesichts unserer jüngsten Interventionen ersichtlich wird, als wir an so verschiedenen Orten wie Peru, Brasilien, Dominikanische Republik, Japan und Südkorea an öffentlichen Veranstaltungen teilgenommen hatten, zu ihnen ermutigt oder sie selbst organisiert hatten.
„Es liegt in der Verantwortung revolutionärer Organisationen und besonders der IKS, ein aktiver Faktor im Denkprozess zu sein, der sich bereits innerhalb der Klasse abspielt, nicht nur indem sie aktiv in den Kämpfen zu intervenieren, wenn diese sich zu entwickeln beginnen, sondern auch indem sie die Entwicklung von Gruppen und Einzelnen stimulieren, die danach streben, sich dem Kampf anzuschließen.“ Mit diesen Minderheiten wird das wachsende Echo der Propaganda und Positionen der Kommunistischen Linken ein wesentlicher Faktor bei der Politisierung der Arbeiterklasse bis zur Überwindung des Kapitalismus sein.
W. (19. Januar 2008)
(1) Für weitere Informationen über die Sabotage der Gewerkschaften siehe die in unserer französischen Presse im November und Dezember 2007 veröffentlichten Artikel, von denen einige auch auf Englisch in World Revolution, Nr. 310 [92] verfügbar sind.
(2) Siehe International Review, Nr. 130, 3. Quartal 2007.
(3) Siehe ihr Flugblatt, das wir auf unserer Website veröffentlicht hatten.
Aktuelles und Laufendes:
- Arbeiterkampf [40]
Erbe der kommunistischen Linke:
April 2008
- 751 reads
Diskussionsveranstaltung: Mai 68 und die revolutionären Perspektiven
- 2889 reads
Diskussionsveranstaltung: Mai 68 und die revolutionären Perspektiven
Mai 68: ... die Studentenproteste. Die idealistischen 1960er Jahre, all das Gerede von Klassenkampf, Revolution, gehört dies nicht alles auf den Misthaufen der Geschichte? Nein: Mai 68 in Frankreich war nicht einfach ein Studentenaufstand. Die brutale Repression gegen die Studenten im Quartier Latin war nur der Funke, der eine größere Bewegung anfachte; eine Bewegung der Arbeiterklasse, des größten spontanen Streiks in der Geschichte der Arbeiterklasse. Es waren Ereignisse von historischer Bedeutung. Mehr als vier Jahrzehnte lang war die Arbeiterklasse mit Niederlagen und einer Konterrevolution konfrontiert gewesen, bei der die Bourgeoisie versuchte, alle Überreste und Erinnerungen an die internationale Welle von revolutionären Kämpfen auszulöschen, die die Welt nach der Oktoberrevolution 1917 in Russland erschüttert hatten. Stalinismus, Faschismus, der „Kampf der Demokratien" im 2. Weltkrieg gegen den Faschismus, der kalte Krieg zwischen Ost und West, die Propaganda der angeblichen Integration der Arbeiterklasse in die Konsumgesellschaft -all dies waren unterschiedliche Gesichter dieser Konterrevolution. Die Ereignisse des Mai 1968 ermöglichten einen dramatischen Bruch mit dieser dunklen Zeit der Konterrevolution und ebneten den Weg zu einer internationalen Welle von Arbeiterkämpfen (Heißer Herbst in Italien und Deutschland 1969, der Aufstand in Córdoba, Argentinien, die großen Streiks in Polen 1970, Anfang der 1970er Jahre in Großbritannien und anderswo).Weit entfernt davon, in die kapitalistische Gesellschaft integriert zu sein, zeigte die Arbeiterklasse Ende der 1960er und in den 1970er Jahren ihre Fähigkeit, auf die ersten Zeichen der neu hereingebrochenen Wirtschaftskrise des Systems zu reagieren. Die Krise ist seitdem nicht verschwunden, sondern sie hat sich während der letzten 40 Jahre nur noch mehr zugespitzt. Und ungeachtet vieler Rückschläge, Schwierigkeiten und unterschiedlichster Erfahrungen ist die Arbeiterklasse nicht besiegt worden. Die jüngsten Kämpfe in verschiedenen Ländern wie auch das Auftauchen einer neuen Generation von Jugendlichen, die sich grundlegende Fragen über die Zukunft stellen, welche der Kapitalismus der Menschheit anzubieten hat, belegen dies. Das ist das wahre Erbe von 1968: Das Wiedererstarken des Klassenkampfes als der einzige Hebel, um diese Gesellschaft zu überwinden. Diese Gesellschaft wird weiterhin von den Kräften geschützt, die dazu beitrugen, die Bewegung vor 40 Jahren zu sabotieren: Parlament und Wahlzirkus, Gewerkschaften und die Linksparteien. Das Erbe von 1968 ist vor allem die ganze Erfahrung der Selbstorganisierung mittels Aktionskomitees, leidenschaftlicher Debatten in Vollversammlungen, der Wiedergeburt der Idee von Arbeiterräten und die Wiederentdeckung einer begrabenen revolutionären politischen Tradition. Kurzum die Perspektive der proletarischen Revolution als die einzig realistische Alternative gegenüber einer im Zerfall begriffenen kapitalistischen Gesellschaft.
Es werden Zeitzeugen aus Frankreich berichten, die vor 40 Jahren an den Ereignissen des Mai 68 in Frankreich beteiligt waren, entsprechend inspiriert wurden und seitdem für die Überwindung des Kapitalismus kämpfen. Sie werden den Bogen spannen zum Kampf der Studenten in Frankreich gegen den CPE 2006 und zu den Perspektiven heute
Veranstaltungen über diese wichtigen Ereignisse in:
- Berlin, 8. Mai, um 18.30 Uhr, Rotes Antiquariat, Rungestr. 20, U-/S-Bahn Jannowitzer Brücke
- Hannover, 9. Mai, um 19.00 h, Kornstr. 28,
- Köln: 17. Mai um 14.00 Uhr, an der Neusser Str. 340, U-Bahnhaltestelle Florastr.
- Zürich: 16. Mai um 20.00 Uhr im Volkshaus (Helvetiaplatz), Grüner Saal
Diese Veranstaltung ist zusammen mit der Gruppe Eiszeit organisiert. Beide Organisationen werden ihre jeweiligen (kurzen) Einleitungen zur Diskussion vortragen.
Weitere Veranstaltungen der IKS in anderen Ländern siehe: www.internationalism.org [29]
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Historische Ereignisse:
- Mai 1968 [94]
Mai 68 : Die Studentenbewegung in Frankreich und auf der Welt (2. Teil)
- 6466 reads
Im ersten Teil dieses Artikels, der sich mit der Bewegung des Mai 1968 befasste, haben wir ihre erste Phase nachgezeichnet, die der Mobilisierung der Studenten. Wir haben aufgezeigt, dass die studentische Agitation in Frankreich vom 22. März 1968 bis Mitte Mai nur der Ausdruck einer internationalen Bewegung war, die fast alle westlichen Staaten erfasste. Ausgelöst wurde die Bewegung 1964 in den USA an der Universität Berkeley, Kalifornien. Am Schluss des ersten Teils des Artikels schrieben wir: „Ein Merkmal dieser ganzen Bewegung war natürlich vor allem die Ablehnung des Vietnamkrieges. Aber während man eigentlich hätte erwarten können, dass die stalinistischen Parteien, die mit dem Regime in Hanoi und Moskau verbunden waren, wie zuvor bei den Antikriegsbewegungen während des Koreakrieges zu Beginn der 1950er Jahre, die Führung dieser Bewegung übernehmen würden, geschah dieses nicht. Im Gegenteil; diese Parteien verfügten praktisch über keinen Einfluss, und sehr oft standen sie im völligen Gegensatz zu den Bewegungen. Dies war eines der Merkmale der Studentenbewegung Ende der 1960er Jahre; es zeigte die tiefgreifende Bedeutung auf, die ihnen zukommen sollte.“Diese Bedeutung werden wir jetzt aufzuzeigen versuchen. Dazu müssen wir natürlich unbedingt die damaligen Themen der studentischen Mobilisierung in Erinnerung zu rufen.
Die Themen der Studentenrevolte in den 1960er Jahren in den USA...
Wie schon erwähnt war der Widerstand gegen den Vietnamkrieg der USA der wichtigste und weitest verbreitete Mobilisierungsfaktor in allen Ländern der westlichen Welt. Es ist sicherlich kein Zufall, dass die Studentenrevolten im wichtigsten Land der Erde einsetzten. Die Jugend in den USA wurde direkt und unmittelbar mit der Frage des Krieges konfrontiert, da in ihren Reihen junge Männer rekrutiert wurden, die zur Verteidigung „der freien Welt“ in den Krieg geschickt wurden. Zehntausende amerikanische Jugendliche haben für die Politik ihrer Regierung ihr Leben gelassen; Hunderttausende sind verletzt und verstümmelt aus Vietnam zurückgekehrt, Millionen bleiben ihr Leben lang geprägt durch das, was sie in diesem Land erlebt haben. Abgesehen von dem Horror, den sie vor Ort durchgemacht haben, wurden viele mit der Frage konfrontiert: Was machen wir eigentlich in Vietnam? Den offiziellen Erklärungen zufolge waren sie dorthin geschickt worden, um die ‚Demokratie’, ‚die freie Welt’ und die ‚Zivilisation’ zu verteidigen. Aber was sie vor Ort erlebten, widersprach völlig den offiziellen Rechtfertigungen: Das Regime, das sie angeblich verteidigen sollten, die Regierung in Saigon, war weder ‚demokratisch’ noch ‚zivilisiert’. Sie war eine Militärdiktatur und extrem korrupt. Vor Ort fiel es den Soldaten sehr schwer nachzuvollziehen, dass sie die ‚Zivilisation’ verteidigten, wenn von ihnen verlangt wurde, dass sie sich selbst wie Barbaren verhalten sollten, die unbewaffnete arme Bauern, Frauen, Kinder und Alte terrorisieren und umbringen sollten. Aber nicht nur die Soldaten vor Ort waren von den Schrecken des Krieges angeekelt, sondern dies traf auch auf wachsende Teile der US-Jugend insgesamt zu. Junge Männer fürchteten nicht nur in den Krieg geschickt zu werden, und junge Frauen fürchteten nicht nur den Verlust ihrer Freunde, sondern man erfuhr auch immer mehr von den rückkehrenden ‚Veteranen’, oder ganz einfach durch das Fernsehen (1) von der Barbarei, die dort herrschte. Der schreiende Widerspruch zwischen den offiziellen Reden der US-Regierung von der ‚Verteidigung der Zivilisation und der Demokratie’, auf die sich die US-Regierung berief und ihr tatsächliches Handeln in Vietnam war einer der wichtigsten Faktoren, der zur Revolte gegen die Autoritäten und die traditionellen Werte der US-Bourgeoisie führte (2). Diese Revolte hatte in einer ersten Phase die Hippie-Bewegung mit empor gebracht, eine gewaltlose und pazifistische Bewegung, die sich auf ‚Flower power“ (Macht der Blumen) berief, und von der ein Slogan lautete: „Make Love, not War“ (Macht Liebe, nicht Krieg). Es war wahrscheinlich kein Zufall, dass die erste größere Studentenmobilisierung an der Universität Berkeley entstand, d.h. in einem Vorort von San Francisco, das damals das Mekka der Hippies war. Die Themen und vor allem die Mittel dieser Mobilisierungen ähnelten noch dieser Hippie-Bewegung: „Sit-in“; eine gewaltlose Methode, um die „Free Speech“ (Redefreiheit) für politische Propaganda an den Universitäten zu fordern, insbesondere auch um die ‚Bürgerrechte’ der Schwarzen zu unterstützen und die Rekrutierungskampagnen der Armee, die in den Universitäten stattfanden, anzuprangern. Jedoch stellte wie in anderen Ländern später auch, insbesondere 1968 in Frankreich, die Repression in Berkeley (ca. 800 Protestierende wurden verhaftet) einen wichtigen Faktor der ‚Radikalisierung’ der Bewegung dar. Von 1967 an, nach der Gründung der Youth International Party (Internationalen Partei der Jugend) durch Abbie Hoffman und Jerry Rubin, der eine kurze Zeit bei der Bewegung der Gewaltlosen mitgewirkt hatte, gab sich die Bewegung der Revolte eine ‚revolutionäre’ Perspektive gegen den Kapitalismus. Die neuen ‚Helden’ der Bewegung waren nicht mehr Bob Dylan oder Joan Baez, sondern Leute wie Che Guevara (den Rubin 1964 in La Havanna getroffen hatte). Die Ideologie dieser Bewegung war unglaublich konfus. Es gab anarchistische Bestandteile (wie den Freiheitskult, insbesondere die sexuelle Freiheit oder Freiheit des Drogenkonsums), aber auch stalinistische Bestandteile (Kuba und Albanien wurden als Beispiele gepriesen). Die Aktionen ähnelten sehr denen der Anarchisten – wie Lächerlichmachen und Provokationen. So bestand eine der ersten spektakulären Aktionen des Tandems Hoffman-Rubin darin, Bündel Falschgeld in der New Yorker Börse zu verteilen, woraufhin sich die dort Anwesenden wie wild auf sie stürzten, um welche zu ergattern. Und während des Kongresses der Demokratischen Partei im Sommer 1968 schlugen sie als Präsidentenkandidaten das Schwein Pegasus vor (3), während sie gleichzeitig bewaffnete Auseinandersetzungen mit der Polizei vorbereiteten. Zusammenfassend kann man zu den Hauptmerkmalen der Proteste, welche sich in den 1960er Jahren in den USA ausbreiteten, sagen, dass sie sich sowohl gegen den Vietnamkrieg als auch gegen die Rassendiskriminierung, gegen die ungleiche Behandlung der Geschlechter und gegen die traditionelle Moral und die Werte Amerikas wandten. Wie die meisten der Beteiligten feststellten (als sie sich wie revoltierende Bürgerkinder verhielten), waren diese Bewegungen keineswegs Regungen der Arbeiterklasse. Es ist sicherlich kein Zufall, dass einer ihrer ‚Theoretiker’, der Philosophieprofessor Herbert Marcuse, meinte, die Arbeiterklasse sei ‚integriert’ worden, und dass die revolutionären Kräfte gegen den Kapitalismus unter anderen Gesellschaftsschichten zu finden seien, so beispielsweise die Schwarzen, die Opfer der Rassendiskriminierung waren, die Bauern der Dritten Welt oder revoltierende Intellektuelle.
… und in den anderen Ländern
In den meisten anderen Ländern des Westens ähnelten die Studentenbewegungen der 1960er Jahre stark denen der USA: Verwerfung der US-Intervention in Vietnam, Revolte gegen die Autoritäten, insbesondere die akademischen Autoritäten, gegen die Autorität im Allgemeinen, gegen die traditionelle Moral, insbesondere gegen die Sexualmoral. Dies ist einer der Gründe, weshalb die stalinistischen Parteien, die ein Symbol des Autoritarismus waren, keinen Widerhall unter den Revoltierenden finden konnten, obgleich sie die US-Intervention in Vietnam heftig an den Pranger stellten. Dabei wurden die von den USA bekämpften militärischen Kräfte in Vietnam, welche als ‚anti-kapitalistisch’ auftraten, total vom sowjetischen Block unterstützt. Es stimmt, dass der Ruf der UdSSR sehr stark unter der Niederschlagung des Aufstands in Ungarn 1956 gelitten hatte und dass das Bild des alten Apparatschiks Breschnew keine großen Träume aufkommen ließ. Die Revoltierenden der 1960 Jahre hingen lieber Poster von Ho Chi Minh (ein alter Apparatschik, der aber eher vorzeigbar war und als ‚heldenhafter’ erschien) und am liebsten noch das romantische Photo von Che Guevara auf (ein anderes Mitglied einer stalinistischen Partei, aber halt ‚exotischer’) oder von Angela Davis auf (sie war auch Mitglied der stalinistischen Partei der USA, aber sie hatte den doppelten Vorteil eine Schwarze und Frau zu sein, und zudem noch genau wie Che Guevara ‚gut’ auszusehen). Diese Komponente, sowohl gegen den Vietnamkrieg gerichtet zu sein und als ‚libertär’ zu erscheinen, tauchte ebenfalls in Deutschland auf. Die berühmteste Figur der Bewegung, Rudi Dutschke, stammte aus der ehemaligen DDR, wo er sich als junger Mann schon gegen die Niederschlagung des Ungarn-Aufstandes gewehrt hatte. Seine ideologischen Bezugspunkte waren der ‚junge Marx’ sowie die Frankfurter Schule (der Marcuse angehörte), und auch die Situationistische Internationale (auf die sich die Gruppe „Subversive Aktion“, deren Berliner Sektion er 1962 gründete, berief). Vor den Ereignissen von Mai 68 in Frankreich war die APO in Deutschland der wichtigste Bezugspunkt der Studentenrevolten in Europa. Die Themen und Forderungen der Studentenbewegung, die sich 1968 in Frankreich entfaltete hat, waren im Wesentlichen die gleichen. Im Laufe der Entwicklung wurde der Widerstand gegen den Vietnamkrieg durch eine Reihe von Slogans in den Hintergrund gedrängt, die situationistisch oder anarchistisch inspiriert waren (oder gar surrealistisch), und die man immer häufiger auf den Mauern lesen konnte („Die Mauern haben das Wort“). Die anarchistische Ausrichtung wurde insbesondere in folgenden Slogans deutlich: „Die Leidenschaft der Zerstörung ist eine schöpferische Freude.“ (Bakunin)„ Es ist verboten zu verbieten.“„Freiheit ist das Verbrechen, das alle Verbrechen beinhaltet.“„Wahlen sind Fallen für Dumme.“„Frech und unverschämt zu sein, ist die neue revolutionäre Waffe.“Diese wurden durch jene Forderungen ergänzt, die zur „sexuellen Revolution“ aufriefen: „Liebt euch aufeinander liegend!“ „Knöpft euer Gehirn so oft auf wie euren Hosenschlitz!“ „Je mehr ich Liebe mache, desto mehr habe ich Lust die Revolution zu machen. Je mehr ich die Revolution mache, desto mehr habe ich Lust Liebe zu machen.“ Der Einfluss des Situationismus spiegelte sich in Folgendem wider:„Nieder mit der Konsumgesellschaft!“ „Nieder mit der Warengesellschaft des Spektakels!“„Schaffen wir die Entfremdung ab!“„Arbeitet nie!“„Seine Wünsche für die Wirklichkeit nehmen, denn ich glaube an die Wirklichkeit meiner Wünsche.“ „Wir wollen keine Welt, in der die Sicherheit nicht zu verhungern eingetauscht wird mit dem Risiko vor Langeweile zu sterben.“ „Langeweile ist konterrevolutionär.“ „Wir wollen leben ohne Stillstand und uns grenzenlos amüsieren.“„Seien wir realistisch, verlangen wir das Unrealistische!“Übrigens tauchte auch die Generationenfrage (die in den USA und in Deutschland sehr präsent war) in verschiedenen Slogans (oft auf sehr schändliche Weise) auf: „Lauf Genosse, die alte Welt liegt hinter dir!“„Die Jungen machen Liebe, die Alten machen obszöne Gesten.“ Im Frankreich des Mai 68, wo Barrikaden errichtet wurden, hörte man auch Slogans wie: „Die Barrikaden versperren die Straßen, aber öffnen den Weg.“„Der Abschluss allen Denkens ist der Pflasterstein in deiner Fresse, CRS [Bürgerkriegspolizei]." „Unter dem Pflasterstein liegt der Strand.“Die größte Verwirrung, die in dieser Zeit vorzufinden war, kommt durch die beiden folgenden Slogans zum Ausdruck:„Es gibt kein revolutionäres Denken. Es gibt nur revolutionäre Handlungen.“ „Ich habe etwas zu sagen, aber ich weiß nicht was.“
Die Bedeutung der Studentenbewegung der 1960er Jahre
Diese Slogans wie die meisten, die in den anderen Ländern zirkulierten, zeigen deutlich, dass die Studentenbewegung der 1960er Jahre keineswegs das Wesen der Arbeiterklasse widerspiegelte, auch wenn es in verschiedenen Ländern (wie in Italien oder Frankreich) den Willen gab, eine Brücke zu den Arbeiterkämpfen zu schlagen. Diese Herangehensweise spiegelte übrigens eine gewisse Überheblichkeit gegenüber der Arbeiterklasse wider, die mit einer gewissen Faszination für den Arbeiter als Blaumann durchmischt war, welcher der Held von schlecht verdauten Texten der Klassiker des Marxismus war. Im Kern war die Studentenbewegung der 1960er Jahre kleinbürgerlicher Natur. Einer der klarsten Aspekte neben seinem anarchisierenden Erscheinungsbild war der Wille „das Leben sofort umzuwälzen“. Der ‚revolutionäre’ Radikalismus der Führung dieser Bewegung, sowie die Gewaltverherrlichung, die von einigen Teilen der Bewegung betrieben wurde, spiegelt ebenfalls ihr kleinbürgerliches Wesen wider. Die ‚revolutionären’ Anliegen der Studenten von 1968 waren zweifelsohne aufrichtig, aber sie waren stark geprägt von einer Sicht der Welt aus einer Dritten-Welt-Perspektive (Guevarismus und Maoismus) sowie vom Antifaschismus. Die Bewegung hatte eine romantische Sichtweise der Revolution, ohne auch nur die geringste Vorstellung von der wirklichen Entwicklung der Bewegung der Arbeiterklasse zu haben, die zur Revolution führt. Die Studenten in Frankreich, die sich für „revolutionär“ hielten, glaubten, dass die Bewegung des Mai 68 schon die Revolution war, und die Barrikaden, die Tag für Tag errichtete wurden, wurden als die Erben der Barrikaden von 1848 und der Kommune von 1871 dargestellt. Eines der Merkmale der Studentenbewegung Ende der 1960er Jahre war der „Generationenkonflikt“, der sehr große Graben zwischen der neuen Generation und der ihrer Eltern, denen verschiedene Vorwürfe gemacht wurden. Insbesondere die Tatsache, dass diese hart hatte schuften müssen, um Armut und auch Hunger zu überwinden, die durch den 2. Weltkrieg entstanden waren. Man warf ihr vor, dass sie sich nur um ihr materielles Wohlergehen kümmerte. Deshalb feierten die Fantastereien über die „Konsumgesellschaft“ und Slogans wie „Arbeitet nie!“ solche Erfolge. Als Nachfolger einer Generation, die von der Konterrevolution voll getroffen worden war, warf die Jugend der 1960er Jahre der älteren Generation vor, sich den Ansprüchen des Kapitalismus unterworfen und angepasst zu haben. Im Gegenzug verstanden viele Eltern nicht und hatten Schwierigkeiten zu akzeptieren, dass ihre Kinder Verachtung zeigten für die Opfer, die sie hatten erbringen müssen, um ihren Kindern bessere wirtschaftliche Verhältnisse zu ermöglichen, als sie sie selbst erlebt hatten. Aber dennoch gab es einen wirklichen ökonomischen Bestimmungsgrund für die Studentenrevolte der 1960er Jahre. Damals gab es keine größere Bedrohung durch Arbeitslosigkeit oder durch prekäre Arbeitsbedingungen nach dem Studium, wenn man die Lage mit der heute vergleicht. Die Hauptsorge der studentischen Jugend war damals, dass sie nicht mehr den gleichen sozialen Aufstieg würde machen können wie die vorhergehende Akademikergeneration. Die Generation von 1968 war die erste Generation, die mit einer gewissen Brutalität mit dem Phänomen der „Proletarisierung der Führungskräfte“ konfrontiert wurde, welches von den Soziologen der damaligen Zeit eingehend untersucht wurde. Dieses Phänomen hatte sich seit einigen Jahren ausgebreitet, noch bevor die Krise offen in Erscheinung trat, sobald die Studentenzahl beträchtlich zugenommen hatte. Diese Zunahme entsprach den Bedürfnissen der Wirtschaft aber auch dem Willen und der Möglichkeit der Generation ihrer Eltern, ihren Kindern eine bessere wirtschaftliche und soziale Lage angedeihen zu lassen, als es ihre eigene war. Unter anderem hatte diese massenhafte Zunahme der Studenten die wachsende Malaise hervorgerufen, die auf den Fortbestand von Strukturen und Praktiken an den Universitäten zurückzuführen war, welche aus einer Zeit stammten, in der nur eine Elite die Uni besuchen konnte, und in der stark autoritäre Strukturen vorherrschten. Während die Studentenbewegung, welche 1964 einsetzte, sich in einer Zeit des „Wohlstandes“ des Kapitalismus entfaltete, sah die Lage 1967 schon anders aus, als die wirtschaftliche Situation sich schon sehr stark verschlechtert hatte – wodurch die studentische Malaise vergrößert wurde. Dies war einer der Gründe, weshalb die Bewegung 1968 ihren Höhepunkt erlebte. Und dies erklärt auch, warum im Mai 1968 die Arbeiterklasse auf den Plan trat und die Bewegung anführte. Darauf werden wir im nächsten Artikel eingehen. Fabienne, 29.3.2008. (1) Während des Vietnamkrieges waren die US-Medien den Militärbehörden nicht unterworfen. Diesen „Fehler“ beging die US-Regierung während der Auslösung des Irakkrieges 1991 und 2003 nicht mehr. (2) Solch ein Phänomen wiederholte sich nicht mehr nach dem 2. Weltkrieg. Die US-Soldaten hatten ebenfalls eine Hölle erlebt, insbesondere jene, die 1944 in der Normandie gelandet waren, aber fast alle Soldaten und die Bevölkerung insgesamt waren angesichts der Barbarei des Nazi-Regimes bereit, diese Opfer zu bringen(3) Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten die französischen Anarchisten einen Esel für die Parlamentswahlen nominiert.
Geographisch:
- Deutschland [36]
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Rubric:
Mai 2008
- 757 reads
Die Hungerrevolten zeigen die Notwendigkeit der Überwindung des Kapitalismus
- 3329 reads
In den letzten Wochen ist in etlichen Ländern der kapitalistischen Peripherie eine Reihe von Revolten, Proteste und Streiks gegen die steigenden Nahrungsmittel- und Energiekosten ausgebrochen. Auf ihrem jüngsten Treffen haben die Wachhunde der kapitalistischen Institutionen – IWF, Weltbank und G8 – vor einer gigantischen Destabilisierung und vor Konflikten in fast 40 Ländern rund um den Globus gewarnt. Es ist kein Zufall, dass die Hungerrevolten jetzt ausbrechen, da der starke Anstieg in den Nahrungsmittelpreisen keine natürliche In den letzten Wochen ist in etlichen Ländern der kapitalistischen Peripherie eine Reihe von Revolten, Proteste und Streiks gegen die steigenden Nahrungsmittel- und Energiekosten ausgebrochen. Auf ihrem jüngsten Treffen haben die Wachhunde der kapitalistischen Institutionen - IWF, Weltbank und G8 - vor einer gigantischen Destabilisierung und vor Konflikten in fast 40 Ländern rund um den Globus gewarnt. Es ist kein Zufall, dass die Hungerrevolten jetzt ausbrechen, da der starke Anstieg in den Nahrungsmittelpreisen keine natürliche Katastrophe ist, sondern das Resultat aus der Verschärfung der kapitalistischen Krise. Die Bedingungen verschlechtern sich für die ArbeiterInnen in allen Ländern Seitdem die weltweite Finanzkrise begonnen hatte, haben sich die Lebensbedingungen für die Arbeiterklasse überall auf der Welt drastisch verschlechtert. Während in den vorherigen Phasen der sich verschärfenden Krise die ArbeiterInnen in den peripheren Ländern weitaus härter und schneller betroffen waren als die ArbeiterInnen der Industrieländer, erleben wir nun, dass die ArbeiterInnen der Industriezentren und der Peripherie gleichzeitig - auch wenn in unterschiedlichem Umfang - unter den Folgen der Krise leiden. Ob in den USA, wo jeden Monat um die 200.000 Menschen infolge der Hypothekenkrise ihr Heim verlieren, wo Tausende ihren Job verlieren und sich steigenden Nahrungsmittel- und Energiepreisen ausgesetzt sehen, ob in Europa, wo die Preise vieler Grundnahrungsmittel um 30 bis 50 Prozent gestiegen sind, ob in den „aufstrebenden Ländern" wie Indien und China, wo die Lebensmittelpreise ebenfalls stark angestiegen sind, oder in den peripheren Ländern, niemals zuvor seit 1929 wurden so viele Menschen in solch einer kurzen Zeitspanne von den Auswirkungen der Krise bedroht. Doch selbst 1929 verbreitete sich die Hungersnot nicht so schnell unter den armen Massen in der kapitalistischen Peripherie. Und wir stehen erst am Anfang dieses Abstiegs. Die steigenden Ölpreise haben die Produktions- und Transportkosten aufgebläht, was sich in den Nahrungsmittelpreisen für die Konsumenten niederschlägt. Der Preis für Reis, Weizen und andere Feldfrüchte ist in den meisten Ländern um 50 bis 100 Prozent gestiegen, in manchen Fällen hat er sich verdoppelt und verdreifacht, mit einer dramatischen Beschleunigung insbesondere in den letzten paar Wochen. Die Konsequenzen für Arbeiter, Bauern und die Massen der Arbeitslosen in den peripheren Ländern sind besonders brutal.
Die Inflation der Nahrungsmittelpreise und die Unruhen
Zwischen dem Frühjahr 2007 und Februar 2008 hat sich der Preis für Weizen und Soja verdoppelt. In den letzten zehn Monaten ging der Preis für Körnerfrüchte (Mais) um 66, für Reis um 75 Prozent in die Höhe. Der von der FAO etablierte Nahrungsmittelindex stieg zwischen März 2007 und März 2008 um 57 Prozent. Dennoch hält die FAO daran fest, dass die Preisexplosion nicht die Folge schrumpfender Ernteerträge ist, sei doch die weltweite Getreideproduktion 2007 um fünf Prozent gestiegen. Und doch sterben täglich 100.000 Menschen an Hunger oder an Krankheiten, die unmittelbare Konsequenzen des Hungers sind. Alle fünf Sekunden stirbt ein Kind unter zehn Jahren an Hunger. 900 Millionen Menschen sind ständig unterernährt. Als Reaktion darauf sind Unruhen ausgebrochen in Ägypten, Burkina Faso, Südafrika, Kamerun, Marokko, Mosambique, im Senegal, in Elfenbeinküste, Mauretanien, im Jemen, in Indonesien, Indien, Bangladesh, Thailand, auf den Philippinen, in Mexiko und Peru, in Argentinien, Honduras, Haiti...
Eine „herzzerreißende Auswahl" der herrschenden Klasse
"Die UN werden eine ‚herzzerreißende' Auswahl bei der Adressierung ihrer Nothilfe treffen müssen, es sei denn, dass die Regierungen mehr Geld ausgeben und helfen, immer teurer werdende Nahrungsmittel zu kaufen, warnte ein Sprecher des Welternährungsprogramms (WEP), um 73 Millionen Menschen in 80 Ländern in diesem Jahr zu ernähren.... Wenn wir in diesem Sommer nicht mehr erhalten, werden wir eine ganz herzzerreißende Auswahl vornehmen müssen - entweder reduzieren wir die Begünstigten oder wir reduzieren die Rationen... Das WEP hat an die Regierungen appelliert, weitere 500 Millionen Dollar zu spenden, um mit den höheren Nahrungsmittelpreisen zu Rande zu kommen. Die USA haben 200 Millionen für die Nothilfe freigemacht, Deutschland zehn Millionen." (The Guardian, 16.4.08)
Während der IWF voraussagt, dass die Kosten der jüngsten Finanzkrise bis zu 1.000.000.000.000 (1 Billion) betragen werden und verschiedene Länder bereits Hunderte von Milliarden Dollar für Rettungsoperationen für notleidende Banken ausgegeben haben, geht den Lebensmittelhilfe-Organisationen das Geld aus, da die großen Länder nur Krümel geben... Sicherlich ziehen es die kapitalistischen Institutionen vor, Banken zu retten, statt mehr als eine Milliarde Menschen zu ernähren, doch die jüngste Ernährungskrise wird wenigstens weitere 500 Millionen Hungernde innerhalb einiger Monate hinzufügen...
Während in den Industrieländern sich viele ArbeiterInnen 30-50prozentigen Preiserhöhungen bei Nahrungsmitteln und Energie ausgesetzt sehen und insbesondere die Arbeitslosen und prekär Beschäftigten mit Schwierigkeiten haben, mit ihren Einkünften auszukommen, bedeutet die Verdoppelung der Preise für Grundnahrungsmittel in den peripheren Ländern der Welt die Gefahr des Verhungerns. Da mehr als eine Milliarde Menschen von weniger als einem Dollar am Tag leben und da viele von ihnen bis zu 90 Prozent ihres Einkommens für Nahrungsmittel ausgeben müssen, bedroht ein solch krasser Anstieg der Lebensmittelpreise sie unmittelbar.
Diese katastrophale, lebensbedrohliche Situation führte zu einer Reihe von Hungerrevolten und Streiks für höhere Löhne etc. Aus Furcht vor einer Explosion der Proteste haben die Regierungen Vietnams und Indiens - beide Länder sind Reisexporteure - die Ausfuhr von Reis ausgesetzt. Kasachstan - achtgrößter Getreideexporteur - hat angedroht, ebenfalls den Getreideexport auszusetzen. Auf den Philippinen drohte die Regierung lebenslängliche Strafen für diejenigen an, die Reis horten! Infolgedessen werden Nahrungsmittel immer knapper, da wichtige Getreidearten entweder zunehmend gehortet werden oder weil ihr Export zusammenbricht. Selbst in den USA schränken die Großhändler den Einkauf von Mehl, Reis und Speiseöl ein, da die Nachfrage das Angebot weit übertrifft. Es gibt auch Anekdoten über einige Verbraucher, die Getreidelager horten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis noch größere Preiserhöhungen die USA, Europa und Ostasien erreichen.
Die Angst vor dem Hunger ist ein Albtraum, der den Aufstieg der Menschheit von Anbeginn begleitet - und angespornt - hat. Die Hauptursache dieser Gefahr war stets die verhältnismäßige Primitivität der Produktivkräfte der Gesellschaft gewesen. Die Hungersnöte, die periodisch die vor-kapitalistischen Gesellschaften heimgesucht hatten, waren die Folge eines unzureichenden Verständnisses und einer mangelhaften Beherrschung der Naturgesetze. Seitdem die Gesellschaft sich in Klassen aufgeteilt hat, waren die Ausgebeuteten und Armen stets die Hauptopfer dieser Rückständigkeit und Fragilität der menschlichen Existenz gewesen. Nun jedoch, wo zusätzliche 100 Millionen menschliche Wesen praktisch über Nacht vom Hunger bedroht werden, wird es immer deutlicher, dass heute die Hauptursache des Hungers nicht in der Rückständigkeit der Wissenschaft und Technologie, sondern in der Rückständigkeit unserer gesellschaftlichen Organisation liegt. Selbst die Repräsentanten der offiziellen Institutionen der herschenden Ordnung sehen sich gezwungen zuzugeben, dass die gegenwärtige Krise „menschengemacht" ist. Während seiner aufsteigenden Epoche fühlte sich der Kapitalismus trotz allen Elends, das er verursachte, in der Lage, langfristig die Menschheit von der Geißel des Hungers zu befreien. Dieser Glaube gründete sich auf die Fähigkeit des Kapitalismus - tatsächlich auf seine dringenden Bedürfnisse als ein Konkurrenzsystem -, permanent die Produktivkräfte zu revolutionieren. In den Jahren, die dem II. Weltkrieg folgten, wies man auf die Erfolge der modernen Landwirtschaft, die Entwicklung des Wohlfahrtsstaates, die Industrialisierung neuer Regionen des Planeten, die Steigerung der Lebenserwartung als Beweis hin, dass man die „Schlacht gegen den Hunger", die von der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft ausgerufen worden war, letztendlich gewinnen werde. Erst kürzlich behauptete das kapitalistische Regime, dass es durch die wirtschaftliche Entwicklung von Ländern wie China oder Indien etliche Hunderte von Millionen vor den Klauen des Hungers bewahrt habe. Und selbst jetzt möchte es uns glauben machen, dass in die Höhe schnellende Preise weltweit das Produkt des wirtschaftlichen Fortschritts seien, des neuen Wohlstandes, der in den aufstrebenden Ländern geschaffen werde, des neuen heftigen Verlangens der Massen nach Hamburger und Joghurt. Doch selbst wenn dies stimmen würde, müssten wir uns über den Sinn eines Wirtschaftssystems Gedanken machen, das nur in der Lage ist, die einen Menschen zum Preis des Lebens anderer Menschen, den Verlierern im Konkurrenzkampf ums Überleben, zu ernähren.
In Wirklichkeit ist der explodierende Hunger in der Welt von heute nicht einmal das Ergebnis solch eines verabscheuungswürdigen „Fortschritts". Was wir erblicken, ist die Verbreitung des Hungers in den rückständigsten Regionen der Welt und in den „aufstrebenden" Ländern. Überall auf der Welt ist der Mythos, dass der Kapitalismus das Gespenst des Hungers bannen kann, als erbärmliche Lüge entlarvt worden. Wahr ist, dass der Kapitalismus die materiellen und gesellschaftlichen Vorbedingungen für solch einen Sieg geschaffen hat. Nachdem er dies getan hat, ist der Kapitalismus selbst zum größten Hindernis für einen solchen Fortschritt geworden. Die Massenproteste gegen den Hunger in Asien, Afrika und Lateinamerika in den vergangenen Wochen enthüllen der Welt, dass die Ursachen des Hungers nicht natürlich, sondern gesellschaftlich sind.
Die Ursachen der gegenwärtigen Krise
Die Politiker und Experten der herrschenden Klasse haben eine Reihe von Erklärungen für die gegenwärtige dramatische Situation. Diese beinhalten den Wirtschafts"boom" in Teilen Asiens, die Verbreitung des „Biosprits", die ökologischen Katastrophen und der Klimawechsel, die Ruinierung der landwirtschaftlichen Subsistenzwirtschaft in den „unterentwickelten" Ländern, einen spekulativen Run auf Nahrungsmittel, die Einschränkungen der Agrarproduktion, die durchgesetzt werden, um die Nahrungsmittelpreise hochzutreiben, etc. All diese Erklärungen enthalten ein Körnchen Wahrheit. Keine von ihnen erklärt jedoch für sich genommen irgendetwas. Sie sind die besten Symptome - mörderische Symptome -, die zusammengenommen die Hauptursachen des Problems anzeigen. Die Bourgeoisie wird stets Lügen über ihre Krise verbreiten, ja sich selbst belügen. Doch was derzeit auffällt, ist das Ausmaß der Unfähigkeit der Regierungen und Experten, zu verstehen, was vor sich geht, oder gar ihren Reaktionen den Anschein von Kohärenz zu verleihen. Die Hilflosigkeit der angeblich allmächtigen herrschenden Klasse wird immer augenscheinlicher. Was bei den verschiedenen Erklärungen auffällt, ist - abgesehen von ihren zynischen und heuchlerischen Charakter - die Tatsache, dass jede Fraktion der herrschenden Klasse danach trachtet, die Aufmerksamkeit auf jenen Aspekt zu lenken, der ihre eigenen unmittelbaren Interessen am meisten betrifft. Ein Beispiel: Ein Gipfeltreffen von G8-Politikern ruft die „Dritte Welt" dazu auf, durch eine unmittelbare Senkung ihrer Zölle gegen Agrarimporte auf die Hungerrevolten zu reagieren. Mit anderen Worten: der erste Gedanke dieser feinen Repräsentanten der kapitalistischen Demokratie war, von der Krise zu profitieren, um ihre eigenen Exportchancen zu erhöhen! Ein weiteres Beispiel: die jüngste „Debatte" in Europa. Die Industrielobby zetert über den landwirtschaftlichen Protektionismus der Europäischen Union, den Ruin der Subsistenzwirtschaft in der „Dritten Welt" etc. Und warum? Weil sie sich von der industriellen Konkurrenz Asiens bedroht fühlt, will sie die landwirtschaftlichen Subventionen zusammenstreichen, die von der Europäischen Union bezahlt werden und die man sich nicht länger leisten könne, wie diese Lobby meint. Die Bauernlobby ihrerseits sieht in den Hungerrevolten einen Beweis für die Notwendigkeit, die Subventionen zu erhöhen. Die Europäische Union hat die Gelegenheit genutzt und die Ausweitung der landwirtschaftlichen Produktion zu Diensten der „erneuerbaren" Energie - wie in Brasilien, einem ihrer Hauptrivalen auf diesem Gebiet - verurteilt.
Die „Teilerklärungen" der Bourgeoisie sind, abgesehen davon, dass sie der zynische Ausdruck ihrer rivalisierenden Partikularinteressen sind, nur dazu da, um die Verantwortung des kapitalistischen Systems für die gegenwärtige Katastrophe zu verbergen. Insbesondere kann keines dieser Argumente und nicht einmal alle Argumente zusammengenommen die beiden Hauptkennzeichen der aktuellen Krise erklären: ihr Ausmaß und ihre plötzliche, brutale Beschleunigung zurzeit.
Das Ausmaß der kapitalistischen Krise
Während in der Vergangenheit Hunderte von Millionen Chinesen nur wenig zu essen hatten (die berühmte "eiserne Reisschüssel"), gebe es nun einen stärkeren Verzehr von Fleisch, Milchprodukten und Weizen. Eine wachsende Nachfrage nach mehr Fleisch und Milch bedeute, Futtergetreide für Vieh und Geflügel übernimmt die Landwirtschaft, was wiederum bedeutet, dass immer weniger Münder von demselben Nutzland ernährt werden können. Dies ist die Haupterklärung, die von vielen Fraktionen der Bourgeoisie vorgebracht wird. Die Proletarisierung eines Teils der Bauernmassen, die radikal deren Lebensstil gewandelt und sie in den Weltmarkt integriert hat, wird von der herrschenden Klasse als eine große Verbesserung ihrer Bedingungen betrachtet. Doch was zu erklären bleibt, ist, wie diese Verbesserung, diese Befreiung von Millionen aus den Klauen des Hungers sich in ihr... Gegenteil verkehren konnte. Der Präsident der Weltbank, Robert Zoellick, erklärte jüngst, dass die steigenden Preise den ganzen Fortschritt, der im "Kampf gegen die Armut" zuletzt erzielt worden war, zunichte machten.
Biokraftstoffe: Die Ersetzung des Benzins durch Weizen, Körnerfrüchte, Palmöl etc. hat in der Tat zu dramatischen Kürzungen der Nahrungsmittelerzeugnisse geführt. Nicht nur dass die "Verschmutzungs"bilanz von Biokraftstoffen negativ ist (jüngste Untersuchungen zeigen, dass Biokraftstoffe die Luftverschmutzung steigern, da sie noch gefährlichere Partikel als normales Benzin ausstoßen, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass einige Biokraftstoffe fast soviel Öl als Energie benötigen, wie sie selbst an Energie produzieren), auch ihre ökologischen und ökonomischen Konsequenzen sind für die gesamte Menschheit katastrophal. Solch ein Wechsel zur Kultivierung von Weizen, Körnerfrüchten/Mais, Palmöl etc. für die Herstellung von Energie statt für die Ernährung ist ein typischer Ausdruck für die kapitalistische Blindheit und Destruktivität. Er wird zu einem Teil von dem zwecklosen Versuch angetrieben, den steigenden Erdölpreisen Herr zu werden, und zu einem anderen Teil - besonders in den Vereinigten Staaten - von der Hoffnung, ihre Abhängigkeit von importiertem Öl zu reduzieren, um ihre Sicherheitsinteressen als imperialistische Macht zu schützen. Weit davon entfernt, die Krise zu erklären, ist der Biosprit-Skandal ein Symptom - und ein aktiver Faktor - ihrer Ausmaße.
Exportsubventionen und Protektionismus: Einerseits gibt es landwirtschaftliche Überproduktion in einigen Ländern und eine permanente "Exportoffensive"; gleichzeitig können sich andere Länder nicht mehr selbst ernähren. Konkurrenz und Protektionismus in der Landwirtschaft bedeuten, dass - ganz so wie bei anderen Waren in der Wirtschaft - die produktiveren Bauern in den Industrieländern große Teile ihrer Feldfrüchte (oft mit staatlicher Suvention) in die "Drittwelt"-Länder exportieren und so die einheimische Bauernschaft ruinieren - was den Exodus vom Land in die Stadt steigert, die weltweiten Flüchtlingsströme anschwellen lässt und zur Abwanderung von einst landwirtschaftlich genutztem Land führt. In Afrika sind beispielsweise die einheimischen Bauern von europäischen Geflügel- und Rindfleischexporten ruiniert worden. Mexiko stellt nicht mehr genügend Nahrungsmittel her, um seine Bevölkerung zu ernähren. Das Land muss jährlich mehr als 10 Milliarden Dollar für den Import von Nahrungsmittel ausgeben. "Linke" Propagandisten der herrschenden Klasse, aber auch viele wohlmeinende, jedoch in die Irre geleitete oder schlecht informierte Menschen rufen zu einer Rückkehr zur Subsistenzwirtschaft in den "peripheren" Ländern und zur Abschaffung der landwirtschaftlichen Subventionen sowie des Schutzes ihrer eigenen Märkte durch die alten kapitalistischen Ländern auf. Was diese Argumente nicht in Betracht zu ziehen vermögen, ist, dass der Kapitalismus von Anbeginn von der Eingliederung der Subsistenzwirtschaft in den Weltmarkt gelebt hat und auf diese Weise expandierte, was den Ruin und die oft gewaltsame Trennung der einheimischen Bauern von ihrem Land, von ihren Produktionsmitteln bedeutete. Die Wiedererlangung des Landes durch die Produzenten ist nur im Rahmen der Überwindung des Kapitalismus selbst denkbar. Dies heißt nichts anderes als die Überwindung des Privateigentums an Produktionsmitteln und der Produktion für den Markt sowie des Antagonismus zwischen Stadt und Land, die fortschreitende Auflösung der Mega-Citys durch eine weltweite und planvolle Rückkehr Hunderter von Millionen von Menschen aufs Land: nicht zum althergebrachten Land der bäuerlichen Isolation und Rückständigkeit, sondern zu einem Land, das durch seine Vernetzung mit den Citys und mit einer weltweiten menschlichen Kultur neu belebt wird.
Indem die bürgerlichen Medien diese o.g. Faktoren auflisten, versuchen sie die Demaskierung der tieferen Hauptursachen zu verhindern. In Wirklichkeit erleben wir nicht zuletzt die kombinierten, akkumulierten Konsequenzen der langfristigen Auswirkungen der Umweltvergiftung und der zutiefst zerstörerischen Tendenzen des Kapitalismus in der Landwirtschaft.
Die Destruktivität des Kapitalismus in Landwirtschaft und Umwelt
Etliche zerstörerische Tendenzen sind offen zutage getreten. Entsprechend des Konkurrenzdrucks ist die traditionelle Bauernwirtschaft verschwunden; die Bauern sind zu Abhängigen von Kunstdünger, Pestiziden und künstlicher Bewässerung geworden. Das International Rice Research-Institut warnt, dass der Erhalt des Reisanbaus durch den übermäßigen Gebrauch von Dünger und die Beeinträchtigung der Bodenqualität gefährdet sei.
"Zum Verkauf bestimmte Feldfrüchte in Monokultur wurden zur Regel; der Ertrag wurde verdoppelt, doch auf Kosten eines dreimal höheren Wasserverbrauchs durch den Zugriff auf das Grundwasser mit elektrischen Pumpen. Dies und die Überdüngung hat weitverbreiteten Schaden an Boden und Wasser angerichtet" (1) Zurzeit sind etwa 40 Prozent der landwirtschaftlichen Produkte das Ergebnis von künstlicher Bewässerung; 75 Prozent des weltweit verfügbaren Trinkwassers wird zu diesem Zweck von der Landwirtschaft Zweck verbraucht. Das Anpflanzen von Luzernen in Kalifornien, von Zitrusfrüchten in Israel, von Baumwolle rund um den Aralsee in der früheren Sowjetunion, von Weizen in Saudiarabien oder im Jemen, d.h. das Anpflanzen von Feldfrüchten in Gebieten, die nicht die natürlichen Bedingungen für ihr Wachstum bieten, bedeutet eine enorme Verschwendung von Wasser in der Landwirtschaft. Der massive Einsatz von "gekreuztem Saatgut" (hybrid seeds) stellt eine direkte Gefahr für die natürliche Vielfalt dar. (2)
In vielen Gebieten der Welt wird der Boden immer mehr vergiftet. In China sind 10 Prozent des Anbaugebiets kontaminiert; jährlich sterben 120.000 Bauern durch die Bodenverschmutzung an Krebs. Ein Resultat dieser Bodenauszehrung durch das rastlose Streben nach Produktivität ist die Tatsache, dass die Nahrungsmittel in den Niederlanden, das "landwirtschaftliche Kraftwerk" Europas, äußerst nährstoffarm sind.
Und mit jedem Grad Celsius, mit dem die globale Erwärmung zunimmt, gehen die Reis-, Weizen- und andere Getreideerträge um 10 Prozent zurück. Die jüngsten Hitzewellen in Australien haben zu beträchtlichen Schäden an den Feldfrüchten und zur Austrocknung des Bodens geführt. Jüngste Erkenntnisse haben aufgezeigt, dass der Anstieg der Temperaturen die Überlebensfähigkeit vieler Pflanzen bedroht oder ihren Nährwert reduziert. Trotz neuer Anbaugebiete, die für die Bewirtschaftung gewonnen wurden, schrumpft die nutzbare landwirtschaftliche Fläche weltweit infolge der Auslaugung, der Erosion, der Vergiftung und der Auszehrung des Bodens.
So taucht eine Gefahr auf, die die Menschheit lange als Albtraum der Vergangenheit abgetan hat. Die kombinierten Auswirkungen der klimatisch bedingten Austrocknung und der Fluten sowie ihre Konsequenzen für die Landwirtschaft, die kontinuierliche Zerstörung und Reduzierung von fruchtbarem Boden, die Vergiftung und Überfischung der Meere führt zu einem Mangel an Nahrungsmitteln. Seit 1984 kann die weltweite Getreideproduktion nicht mehr mit dem Wachstum der Erdbevölkerung Schritt halten. Innerhalb von zwanzig Jahren ist sie von 343 Kilo pro Person auf 303 Kilo gefallen (Carnegie Department of Global Ecology in Stanford). Die Verrücktheit des Sytems bedeutet, dass der Kapitalismus gezwungen ist, ein Über-Produzent fast aller Güter zu sein, während er andererseits einen Mangel an Lebensmitteln schafft, indem er die eigentliche, natürliche Grundlage für sein Wachstum zerstört. Die wirklichen Ursachen für diese Absurdität liegen in der kapitalistischen Produktion begründet: "Auf der anderen Seite reduziert das große Grundeigentum die agrikole Bevölkerung auf ein beständig sinkendes Minimum und setzt ihr eine beständig wachsende, in großen Städten zusammengedrängte Industriebevölkerung entgegen; es erzeugt dadurch Bedingungen, die einen unheilbaren Riß hervorrufen in dem Zusammenhang des gesellschaftlichen und durch die Naturgesetze des Lebens vorgeschriebnen Stoffwechsels, infolge wovon die Bodenkraft verschleudert und diese Verschleuderung durch den Handel weit über die Grenzen des eignen Landes hinausgetragen wird. (Liebig.) (...) Große Industrie und industriell betriebene große Agrikultur wirken zusammen. Wenn sie sich ursprünglich dadurch scheiden, daß die erste mehr die Arbeitskraft und daher die Naturkraft des Menschen, die letztere mehr direkt die Naturkraft des Bodens verwüstet und ruiniert, so reichen sich später im Fortgang beide die Hand, indem das industrielle System auf dem Land auch die Arbeiter entkräftet und Industrie und Handel ihrerseits der Agrikultur die Mittel zur Erschöpfung des Bodens verschaffen" (Karl Marx - Friedrich Engels - Werke, Band 25, "Das Kapital", Bd. III, Sechster Abschnitt, S. 815, 47. Kapitel, Metäriewirtschaft und das bäuerliche Parzelleneigentu, Dietz Verlag, Berlin/DDR 1983)
Eine brutale Beschleunigung des Krisentempos
Seit dem Zusammenbruch der Immobilienspekulation in den USA und anderen Ländern (Großbritannien, Spanien, etc.) suchen viele Hedgefonds und andere Investoren nach alternativen Möglichkeiten, um ihr Geld anzulegen. Derzeit stehen die landwirtschaftlichen Feldfrüchte im Visier der Spekulation. Die zynische Rechnung der Spekulation in Zeiten einer ernsten Krise: Landwirtschaftliche Feldfrüchte sind eine "todsichere Wette", da sie zu den letzten Dingen gehören, auf die die Menschen "verzichten" können! Milliarden von spekulativen Dollars sind bereits in Agrarkonzernen angelegt worden. Diese kolossalen spekulativen Summen haben mit Sicherheit die drastischen Preiserhöhungen mit beschleunigt, doch sie sind nicht die tatsächliche Hauptursache. Wir können davon ausgehen, dass sich der Preisanstieg landwirtschaftlicher Produkte fortsetzen würde, selbst wenn die Spekulation beendet werden würde.
Dennoch verschafft uns dieser Einblick in die Rolle der Spekulation (die isoliert betrachtet ein red herring ist) eine Ahnung über die Verknüpfungen in der zeitgenössischen Weltwirtschaft. In Wirklichkeit gibt es eine Verbindung zwischen der "Eigentumskrise" und dem Erdbeben im weltweiten Finanzkapital einerseits und der Preisexplosion bei den Nahrungsmitteln andererseits. Die Weltrezession von 1929, die brutalste in der Geschichte des Kapitalismus bis dahin, wurde von einem dramatischen Verfall der Preise begleitet. Die Verarmung der Arbeitermassen zu jener Zeit war mit der Tatsache verknüpft, dass die Löhne im Zusammenhang mit der Massenarbeitslosigkeit noch dramatischer fielen als andere Preise. Heute dagegen werden die Tendenzen einer weltweiten Rezession, die manifest werden, von einer allgemeinen Woge der Inflation begleitet. Die in die Höhe schnellenden Preise der Nahrungsmittel sind die Speerspitze dieser Entwicklung, auf jederlei Art verknüpft mit den steigenden Kosten für Energie, Transport und so weiter. Das jüngste Hineinpumpen von Milliarden von Dollar in die Wirtschaft durch die Regierungen, um die vor der Pleite stehenden Banken und das Finanzsystem zu stützen, hat wahrscheinlich mehr als jeder andere Faktor zur derzeitigen weltweiten Inflationsspirale beigetragen. Dies auch, weil er den Schuldenberg enthüllt, auf dem das "Krisenmanagement" der letzten Jahrzehnte zu einem großen Teil basierte, und somit das "Vertrauen" unter den Geschäftsleuten untergräbt.
Die Arbeitermassen der Welt sind in einem eisernen Schraubstock eingezwängt. Während einerseits die weltweite Arbeitslosigkeit einen unbarmherzigen Druck auf die Löhne ausübt, fressen andererseits die in die Höhe schnellenden Preise den Wert des Wenigen weg, was die ProletarierInnen noch verdienen.
Die derzeitige Verschärfung der weltweiten und historischen Krise des Weltkapitalismus zeigt sich als eine vielköpfige Hydra. Zusammen mit der monströsen Eigentums- und Finanzkrise, die weiterhin im Zentrum des Kapitalismus schwelt, ist bereits ein zweites Monster in Gestalt von in die Höhe schnellender Preise und des Hungers erschienen. Und wer kann uns sagen, was noch alles folgen wird? Im Augenblick scheint die herrschende Klasse noch überwältigt und irgendwie hilflos zu sein. Ihre hektischen Reaktionen enthüllen den Versuch, die staatliche Kontrolle über die Wirtschaft zu verstärken und ihre Politik international zu koordinieren, aber sie illustrieren auch die Verschärfung der Konkurrenz zwischen den kapitalistischen Nationen. Die besänftigenden Worte der Politikmacher bezwecken, der Welt, ja sich selbst das Gefühl auszureden, immer mehr die Kontrolle darüber zu verlieren, was mit ihrem System geschieht. Eine Entwicklung, die die herrschende Klasse mit einer zweifachen Gefahr konfrontiert: der Gefahr der Destabilisierung ganzer Länder oder ganzer Kontinente und ihres Versinkens in eine Spirale des Chaos sowie der langfristigen Gefahr einer revolutionären Erhebung, die den Kapitalismus selbst in Frage stellt.
Die Verantwortung des Proletariats
Wegen der zerstörerischen Auswirkungen der kapitalistischen Produktionsweise auf die Landwirtschaft und auf die Umwelt ist die Menschheit tatsächlich mit einem Rennen gegen die Zeit konfrontiert. Je mehr der zerstörerische Kapitalismus die Welt verwüstet, desto mehr ist die Grundlage für das Überleben der Menschheit bedroht. Jedoch zwingen die drastische Verschlechterung der Wirtschaftskrise und die spekulativen Effekte auf die Nahrungsmittelpreise die Arbeitermassen, Arbeitslosen und Bauern, umgehend zu reagieren. Ihr Kampf ist einerseits ein defensiver Kampf ums Überleben, andererseits jedoch wirft er die Notwendigkeit auf, die Ursachen ihrer lebensbedrohlichen Lage auszumerzen.
Fußnoten:
(1) Dies ist einem interessanten Artikel bei Libcom von Ret Marut entnommen. ("A world food crisis: empty rice bowls and fat rats [95]").
(2) "Dies ist ein modifiziertes Saatgut - so kontruiert, dass es sich selbst nicht reproduzieren und nur mit Hilfe von Kunstdünger wachsen kann. So werden die Farmer in die Abhängigkeit von multinationalen Konzernen gesperrt, die ihnen dieses Saatgut verkaufen. In der einheimischen Landwirtschaft schließt das Bebauungssystem ein symbiotisches Verhältnis zwischen Boden, Wasser, Nutzvieh und Pflanzen mit ein. Die hybride Landwirtschaft ersetzt diese Integration auf bäuerlicher Ebene durch die Integration von Inputs wie Saatgut und Chemikalien. Das einheimische Anbausystem beruht nur auf innere organische Inputs. Das Saatgut kommt von der Farm, die Düngung des Bodens kommt von der Farm, und die Schädlingsbekämpfung ist in den Kreuzungen der Feldfrüchte eingebaut. Im hybriden Komplex sind die Erträge an den erworbenen Inputs von Saatgut, Kunstdünger, Pestiziden, Erdöl und intensiver Bewässerung gebunden (...) Wenn die Bauern vom Mischsaatgut abhängig werden, wird diese natürliche Vielfalt und die lokale Anpassungsfähigkeit verloren gehen. Solch eine Kommerzialisierung tradioneller bäuerlicher Techniken erzeugt häufig einen fürchterlichen Druck auf die Bauern - in Indien haben im vergangenen Jahr 10.000 Bauern Selbstmord begangen, hauptsächlich wegen Zahlungsschwierigkeiten (...) Den Einsatz von Kunstdünger anstelle organischer Methoden, um den Boden wieder fruchtbar zu machen, wie die Kompostierung, Fruchtfolgen und der natürliche Dünger erzeugt leblose, ausgedörrte Böden, die anfällig gegenüber der Bodenerosion sind. Geschätzte 24 Milliarden Tonnen Erdboden des weltweiten Ackerlandes erodieren jährlich. Der Anteil von Staubpartikel in der unteren Atmosphäre hat sich in den vergangenen 60 Jahren verdreifacht." (Ret Marut, oben zitiert)
Theoretische Fragen:
- Umwelt [24]
Erbe der kommunistischen Linke:
Mai 68: Das Erwachen der Arbeiterklasse - 3. Teil
- 3079 reads
Gegenüber all den Lügen, die heute zum Mai 68 verbreitet werden, müssen die Revolutionäre die Wahrheit wiederherstellen. Sie müssen auch die Mittel anbieten, um die Bedeutung und die Lehren dieser Ereignisse zu begreifen. Sie müssen insbesondere verhindern, dass ihre Lehren unter einem Haufen Blumen und Kränzen begraben werden. Gegenüber all den Lügen, die heute zum Mai 68 verbreitet werden, müssen die Revolutionäre die Wahrheit wiederherstellen. Sie müssen auch die Mittel anbieten, um die Bedeutung und die Lehren dieser Ereignisse zu begreifen. Sie müssen insbesondere verhindern, dass ihre Lehren unter einem Haufen Blumen und Kränzen begraben werden. Wir haben schon damit angefangen, indem wir bislang zwei Artikel zum Mai 68 veröffentlicht haben, die auf die ersten Bestandteile der Ereignisse des Mai 68 zurückkommen – die Studentenproteste. In diesem Artikel wollen wir auf den wesentlichsten Bestandteil der Ereignisse eingehen – die Bewegung der Arbeiterklasse. In dem ersten Artikel dieser Reihe schrieben wir am Schluss zu den Ereignissen in Frankreich: „Am 14. Mai gingen die Diskussionen in vielen Betrieben weiter. Nach den gewaltigen Demonstrationen am Vorabend, die den ganzen Enthusiasmus und ein Gefühl der Stärke zum Vorschein gebracht hatten, war es schwierig die Arbeit wieder aufzunehmen, so als ob nichts passiert wäre. In Nantes traten die Beschäftigen von Sud-Aviation in einen spontanen Streik und beschlossen die Besetzung des Werkes. Vor allem die jüngeren Beschäftigten trieben die Bewegung voran. Die Arbeiterklasse war auf den Plan getreten.“ Diese Schilderung werden wir hier fortsetzen.
Die Ausdehnung der Streiks
In Nantes stießen die jungen Arbeiter, die im gleichen Alter waren wie die Studenten, die Bewegung an. Ihre Argumentation war einfach aber einleuchtend: „Wenn die Studenten, die ja mit einem Streik keinen Druck ausüben können, die Kraft besaßen, die Regierung zum Nachgeben zu zwingen, können die Arbeiter die Regierung auch zum Nachgeben zwingen.“ Die Studenten der Stadt wiederum erklärten sich mit den Arbeitern solidarisch; sie reihten sich in deren Streikposten ein: Verbrüderung. Die Kampagnen der CGT und der KPF warnten vor den „linken Provokateuren, die im Dienste der Arbeitgeber und des Innenministers stehen“ und die Studenten unterwandert hätten; aber diese Kampagnen zeigten keine große Wirkung. Insgesamt standen am Abend des 14. Mai 3100 Arbeiter im Streik. Am 15. Mai breitete sich die Bewegung auf die Renault-Werke in Cléon in der Normandie, und auf zwei weitere Fabriken in der Region aus: totaler Streik, unbegrenzte Werksbesetzungen, rote Fahnen an den Fabriktoren. Am Ende des Tages streikten 11.000 Beschäftigte. Am 16. Mai schlossen sich die Beschäftigten der anderen Renault-Werke an: rote Fahnen über Flins, Sandouville, Le Mans und Billancourt. An jenem Abend befanden sich 75.000 Arbeiter im Streik; aber als die Arbeiter von Renault-Billancourt in den Kampf traten, wurde ein deutliches Signal gesetzt. Es handelte sich um die größte Fabrik in Frankreich (35.000 Beschäftigte) und seit langem galt ein Sprichwort: „Wenn Renault niest, hat Frankreich Schnupfen.“ Am 17. Mai gab es 215.000 Streikende. Die Streiks erreichten nunmehr ganz Frankreich, vor allem die Provinz. Es handelte sich um eine vollkommen spontane Bewegung; die Gewerkschaften liefen ihr nur nach. Überall standen die jungen Arbeiter an ihrer Spitze. Häufig verbrüderten sich Studenten und junge Arbeiter. Junge Arbeiter zogen in die besetzten Universitäten und forderten die Studenten auf, zu ihnen in die Kantinen zum Essen zu kommen. Es gab keine genauen Forderungen. Stattdessen äußerte sich eher Unmut. Auf einer Fabrikmauer in der Normandie stand: „Wir brauchen Zeit zum Leben und mehr Würde!“ An jenem Tag rief die CGT zur „Ausdehnung des Streiks“ auf. Sie hatte Angst, von der „Basis überrollt“ und von der CFDT, welche von den ersten Tagen an viel präsenter war, verdrängt zu werden. Wie man damals sagte, war sie auf den „fahrenden Zug aufgesprungen“. Ihr Aufruf wurde erst am nächsten Tag bekannt. Am 18. Mai standen mittags eine Million Arbeiter im Streik, noch bevor der Streikaufruf der CGT bekannt wurde. Am Abend streikten zwei Millionen Beschäftigte. Am 20. Mai streikten sechs Millionen, und am 21. Mai hatten schon 6.5 Millionen die Arbeit niedergelegt. Am 22. Mai befanden sich acht Millionen im unbefristeten Streik. Es handelte sich um den größten Streik in der Geschichte der internationalen Arbeiterbewegung. Er war sehr viel massiver als die vorher berühmt gewordenen Streiks – der ‚Generalstreik’ des Mai 1926 in Großbritannien (der eine Woche dauerte) und die Streiks im Mai-Juni 1936 in Frankreich. Alle Bereiche waren betroffen: Industrie, Transport und Verkehr, Energie, Post und Telekommunikation, Erziehungswesen, Verwaltungen (mehrere Ministerien waren vollkommen lahm gelegt), Medien (das staatliche Fernsehen streikte, die Beschäftigten prangerten vor allem die aufgezwungene Zensur an), Forschungslabore usw. Selbst die Bestattungsunternehmer streikten (Mai 68 war ein schlechter Zeitpunkt zum Sterben). Gar Berufssportler schlossen sich der Bewegung an. Die rote Fahne wehte über den Gebäuden des französischen Fußballverbandes. Die Künstler standen nicht abseits, das Filmfestival in Cannes wurde auf Veranlassung der Regisseure unterbrochen.In dieser Zeit wurden die besetzten Universitäten (wie auch andere öffentliche Gebäude wie das Odéon-Theater in Paris) zu Orten ständiger politischer Debatte. Viele Arbeiter, insbesondere die Jungen, aber nicht nur diese, beteiligten sich an diesen Diskussionen. Arbeiter baten diejenigen, die die Notwendigkeit einer Revolution vertraten, zu den Versammlungen in den besetzten Betrieben zu kommen und dort ihren Standpunkt zu vertreten. So wurde der kleine Kern von Leuten, die später die Sektion der IKS in Frankreich gründen sollte, dazu aufgefordert, in der besetzten Fabrik JOB ihre Auffassungen von den Arbeiterräten zu erklären. Und am bedeutendsten war, dass diese Einladung von Mitgliedern der …CGT und der KPF ausgesprochen wurde. Diese mussten eine Stunde lang mit den Hauptamtlichen der CGT des großen Werkes Sud-Aviation verhandeln, die gekommen waren, um die Streikposten der JOB zu ‚verstärken’, bevor sie die Zustimmung erhielten, ‚Linksradikale’ in das Werk zu lassen. Mehr als sechs Stunden lang diskutierten Arbeiter und Revolutionäre, auf Papierrollen sitzend, über die Revolution, die Geschichte der Arbeiterbewegung, die Sowjets und gar über den Verrat ... der KPF und der CGT. Viele Diskussionen fanden ebenfalls auf den Straßen und Bürgersteigen statt (im Mai 68 herrschte überall schönes Wetter). Sie entstanden spontan, jeder hatte etwas zu sagen („Man hört dem anderen zu und redet miteinander“ war einer der Slogans). Überall herrschte so etwas wie Feststimmung, außer in den ‚Reichenvierteln’, wo sich Angst und Hass ansammelten. Überall in Frankreich, in den Stadtvierteln, in einigen großen Betrieben oder in den benachbarten Bezirken tauchten „Aktionskomitees“ auf. Dort wurde darüber diskutiert, wie man kämpfen sollte, wie eine revolutionäre Perspektive aussehen könnte. Im Allgemeinen wurden diese Diskussionen von linken oder anarchistischen Gruppen angestoßen, aber dort versammelten sich viel mehr Leute als Mitglieder dieser Organisationen. Selbst bei der ORTF, den staatlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten, entstand ein Aktionskomitee, das insbesondere von Michel Drucker mit angetrieben wurde, und an dem sich der unbeschreibliche Thierry Rolland beteiligte.
Die Reaktionen der Bourgeoisie
In Anbetracht dieser Lage befand sich die herrschende Klasse in einer Phase des Umherirrens, was sich durch verwirrte und unwirksame Initiativen äußerte. So diskutierte und verwarf das Parlament, welches von der Rechten beherrscht wurde, einen Zensurantrag, der von der Linken zwei Wochen zuvor eingebracht worden war: Die offiziellen Institutionen der Republik Frankreichs schienen in einer anderen Welt zu leben. Das Gleiche traf auf die Regierung zu, die an jenem Tag beschloss, Daniel Cohn-Bendit, der nach Deutschland gereist war, die Wiedereinreise zu verbieten. Diese Entscheidung ließ die Unzufriedenheit nur noch weiter hochkochen. Am 24. Mai kam es zu mehreren Demonstrationen, insbesondere um gegen das Aufenthaltsverbot Cohn-Bendits zu protestieren: „Nieder mit den Landesgrenzen!“ „Wir sind alle deutsche Juden!“ Trotz des von der CGT gelegten Sperrrings gegen die „Abenteurer“ und „Provokateure“ (d.h. die „radikalen“ Studenten) schlossen sich viele junge Arbeiter diesen Demonstrationen an. Am Abend hielt der Präsident der Republik, General de Gaulle, eine Rede. Er schlug ein Referendum vor, damit die Franzosen sich zur „Beteiligung“ äußern (eine Art Assoziation Kapital-Arbeit). Weltfremder konnte man nicht sein. Diese Rede stieß auf taube Ohren. Sie zeigte die totale Verwirrung der Regierung und der Bourgeoisie im Allgemeinen (1). In den Straßen hatten die Demonstrationen die Rede in Transistorradios verfolgt. Die Wut stieg sofort weiter an: „Wir pfeifen auf seine Rede.“ In ganz Paris und in mehreren Provinzstädten kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen; Barrikaden wurden errichtet. Zahlreiche Schaufenster wurden zerschlagen, Autos in Brand gesetzt. Dadurch richtete sich ein Teil der öffentlichen Meinung gegen die Studenten, die nunmehr als „Krawallmacher“ angesehen wurden. Es ist übrigens wahrscheinlich, dass sich unter die Demonstranten Mitglieder der gaullistischen Milizen oder Zivilpolizisten gemischt hatten, um Öl aufs Feuer zu gießen und der Bevölkerung Angst einzujagen. Es war aber auch klar, dass viele Studenten glaubten, sie würden die ‚Revolution machen’, indem sie Barrikaden errichteten oder Autos anzündeten, die als Symbol der ‚Konsumgesellschaft’ galten. Aber diese Handlungen brachten vor allem die Wut der Demonstranten, Studenten und jungen Arbeiter über die lächerlichen und provozierenden Reaktionen der Behörden gegenüber der größten Streikwelle der Geschichte zum Vorschein. Ein Ausdruck dieser Wut gegen das System: das Symbol des Kapitalismus, die Pariser Börse, wurde in Brand gesetzt. Schließlich konnte die Bourgeoisie erst am darauf folgenden Tag wirksamere Maßnahmen ergreifen. Am Samstag, den 25. Mai, wurden Verhandlungen im Arbeitsministerium (rue de Grenelle) zwischen Gewerkschaften, Arbeitgebern und der Regierung aufgenommen. Von Anfang an waren die Arbeitgeber bereit, mehr zuzugestehen, als was die Gewerkschaften erwartet hatten. Es war offensichtlich, dass die Bourgeoisie Angst hatte. Der Premierminister Pompidou leitete die Verhandlungen. Am Sonntagmorgen traf er den Chef der CGT, Séguy, eine Stunde lang unter vier Augen. Die beiden Hauptverantwortlichen für die Aufrechterhaltung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung in Frankreich brauchten Zeit, um ohne Zeugen die Bedingungen für die Wiederherstellung der Ordnung zu besprechen (2). In der Nacht vom 26. zum 27. Mai wurde das „Abkommen von Grenelle“ unterzeichnet: - Lohnerhöhung von 7% für alle ab dem 1. Juni, plus 3% zusätzlich ab dem 1. Oktober;- Erhöhung der Mindestlöhne um 25%;- Kürzung der „Eigenleistungen“ im Gesundheitswesen von 30% auf 25% (insbesondere die Gesundheitsausgaben, die die Sozialversicherung nicht übernahm); - Anerkennung der Gewerkschaften in den Betrieben;- Sowie eine Reihe von sehr vagen Versprechungen des Beginns von Verhandlungen, insbesondere über die Frage der Arbeitszeit (die damals durchschnittlich 47 Stunden pro Woche betrug). In Anbetracht der Stärke der Bewegung handelte es sich um eine wahre Provokation: - Die 10% Lohnerhöhung sollte schnell durch die Inflation aufgefressen werden (damals gab es eine hohe Inflationsrate); - nichts zur Frage des Lohnausgleichs für die Inflation; - nichts Konkretes zur Verkürzung der Arbeitszeit. Man gab sich damit zufrieden, als Ziel die „schrittweise“ Rückkehr zur 40 Stundenwoche (welche schon 1936 offiziell erreicht worden war) zu proklamieren. Wäre man dem von der Regierung vorgeschlagenen Rhythmus gefolgt, hätte man das Ziel 2008 erreicht!- Die einzigen, die etwas Wesentliches erreichten, waren die am geringsten bezahlten Arbeiter (man wollte die Arbeiterklasse spalten und sie zur Wiederaufnahme der Arbeit drängen) sowie die Gewerkschaften (welche für ihre Saboteursrolle belohnt wurden). - Am 27. Mai verwarfen die Vollversammlungen das „Abkommen von Grenelle“ einstimmig. Bei Renault Billancourt haben die Gewerkschaften eine ‚Showveranstaltung’ organisiert, über die von den Medien groß berichtet wird. Als er von den Verhandlungen zurückkam, sagte Séguy zu den Journalisten, „die Wiederaufnahme der Arbeit steht unmittelbar bevor“, und er hoffte sehr wohl, dass die Arbeiter von Billancourt ein Beispiel dafür liefern würden. Aber 10.000 Beschäftigte, die sich seit dem Morgen versammelt hatten, hatten die Fortsetzung der Streiks beschlossen, noch bevor die Gewerkschaftsführer angekommen waren. Benoît Frachon, ‘historischer’ Führer der CGT (der sich schon an den Verhandlungen von 1936 beteiligt hatte) erklärte: „Das Abkommen von Grenelle wird Millionen von Arbeitern einen Wohlstand bieten, den sie nicht erhofft hatten.“ Todesstille im Saal. André Jeanson von der CFDT freute sich über das anfängliche Votum zur Fortsetzung des Streiks und sprach von der Solidarität zwischen Arbeitern, Studenten und kämpfenden Oberschülern: stürmischer Beifall. Schließlich trug Séguy einen „objektiven Bericht“ der „Errungenschaften von Grenelle“ vor: minutenlanges Pfeifkonzert. Danach machte Séguy eine Kehrtwendung: „Wenn man nach dem hier gehörten urteilen muss, werdet ihr euch nicht über den Tisch ziehen lassen!“ Applaus, aber aus der Menge rief eine Stimme: „Er führt uns hinters Licht.“ Der beste Beweis der Verwerfung des „Abkommens von Grenelle“: die Zahl der Streikenden stieg noch am 27. Mai auf neun Millionen. Am 9. Mai fand im Sportstadion Charléty in Paris eine große Versammlung statt. Sie wurde von der Studentengewerkschaft UNEF, der CFDT (welche sich radikaler als die CGT gab) und linken Gruppen einberufen. In den Reden wurden revolutionäre Töne geschwungen. Man wollte für die wachsende Unzufriedenheit mit der CGT und der KPF ein Ventil finden. Neben den Vertretern der Extremen Linken waren auch Politiker der Sozialdemokratie wie Mendès-France anwesend (ehemaliger Regierungschef in den 1950er Jahren). Cohn-Bendit, der mit schwarz gefärbten Haaren aus Deutschland zurückgekehrt war, trat auch auf (am Vorabend war er in der Sorbonne erschienen). Der 28. Mai war der Tag der Manöver und Schachzüge der linken Parteien. Am Morgen hielt François Mitterrand, Vorsitzender der « Fédération de la gauche démocrate et socialiste“ (in der die Sozialistische Partei, die Radikale Partei und verschiedene kleine linke Gruppe vertreten waren) eine Pressekonferenz ab. Er meinte, es gebe ein Machtvakuum – deshalb kündigte er seine Kandidatur als Präsident der Republik an. Am Nachmittag schlug Waldeck-Rochet, der Führer der KPF, eine Regierung mit „kommunistischer Beteiligung“ vor. Es ging darum zu vermeiden, dass die Sozialdemokraten die Lage allein zu ihren Gunsten ausnutzten. Am 29. Mai folgte eine große Demonstration, zu welcher die CGT aufrief und in der sie eine „Volksregierung“ forderte. Die Rechten warnten sofort vor einem „kommunistischen Komplott“. An diesem Tag „tauchte“ General de Gaulle ab. Einige brachten das Gerücht in Umlauf, er trete ab; tatsächlich flog er nach Deutschland, um dort die Unterstützung des General Massus, welcher in Deutschland die französischen Besatzungstruppen befehligte, und die Loyalität der Armee sicher zu stellen. Der 30. Mai stellte eine Art entscheidenden Tag dar bei dem Versuch der Bourgeoisie, die Lage wieder in den Griff zu kriegen. De Gaulle hielt erneut eine Rede. „Unter den gegenwärtigen Bedingungen trete ich nicht zurück (…). Ich löse heute die Nationalversammlung auf ...“ Gleichzeitig fand in Paris auf den Champs-Élysées eine gewaltige Demonstration zur Unterstützung de Gaulles statt. Aus den Reichenvierteln, den wohlhabenden Vororten und auch vom Land wurde mit Armeelastern das „Volk“ herangekarrt. Es kamen zusammen die Verängstigten und Besitzenden, die Bürgerlichen, die Vertreter der Religionsschulen für die Kinder der Reichen, die Führungsschichten, die sich ihrer ‚Überlegenheit’ bewusst waren, die kleinen Geschäftsinhaber, die um ihre Schaufenster fürchteten; Kriegsveteranen, die wegen der Angriffe auf die Nationalfahne erbost waren, die Geheimpolizei, die mit der Unterwelt unter einer Decke steckte, aber auch alte Algeriensiedler und die OAS, junge Mitglieder der faschistoiden Gruppe Occident, die alten Nostalgiker Vichys (obwohl diese alle de Gaulle verachteten). All diese feinen Leute strömten zusammen, um ihren Hass auf die Arbeiterklasse und ihre ‚Ordnungsliebe’ zu bekunden. Aus der Menge, zu der auch alte Kämpfer des „freien Frankreich“ gehörten, drangen Rufe wie „Cohn-Bendit nach Dachau!“. Aber die „Partei der Ordnung“ beschränkte sich nicht auf die Demonstranten auf den Champs-Elysées. Am gleichen Tag rief die CGT zu branchenmäßigen Verhandlungen zur „Verbesserung der Errungenschaften von Grenelle“ auf. Es handelte sich um ein Mittel zur Spaltung der Bewegung, um sie so vernichten zu können.
Die Wiederaufnahme der Arbeit
Von jenem Donnerstag an wurde die Arbeit wieder aufgenommen, allerdings nur langsam, denn am 6. Juni streikten immer noch ca. 6 Millionen Beschäftigte. Die Arbeit wurde in großer Zerstreuung wieder aufgenommen. 31. Mai: Stahlindustrie Lothringens, Textilindustrie Nordfrankreichs,4. Juni: Arsenale, Versicherungen5. Juni : Elektrizitätswerke, Kohlebergwerke6. Juni : Post, Telekommunikation, Transportwesen (In Paris setzte die CGT Druckmittel zur Wiederaufnahme der Arbeit ein. In jedem Betriebswerk kündigten die Gewerkschaftsführer an, dass in den anderen Depots die Arbeit schon wieder aufgenommen worden sei, was eine Täuschung war.);7. Juni: Grundschulen10. Juni: das Renault-Werk in Flins wurde von der Polizei besetzt. Ein von den Polizisten verprügelter Gymnasiast fiel in die Seine und ertrank;11. Juni: Intervention der CRS (Bürgerkriegspolizei) in den Peugeot-Werken in Sochaux (zweitgrößtes Werk in Frankreich). Zwei Arbeiter wurden getötet. In ganz Frankreich kam es erneut zu gewalttätigen Demonstrationen. „Sie haben unsere Genossen getötet.“ Trotz des entschlossenen Widerstands der Arbeiter räumten die CRS das Sochaux-Werk. Aber die Arbeit wurde erst 10 Tage später wieder aufgenommen. Aus Furcht, dass die Empörung erneut zu einem Wiederaufleben der Streiks führte (immerhin standen noch drei Millionen Beschäftigte im Streik), riefen die Gewerkschaften (mit der CGT an der Spitze) und die Linksparteien (mit der KPF an der Spitze) nachdrücklich zur Wiederaufnahme der Arbeit auf, „damit die Wahlen stattfinden können und der Sieg der Arbeiterklasse vervollständigt werden kann.“ Die Tageszeitung der KPF, l’Humanité, trug die Schlagzeile: „Gestärkt durch ihren Sieg nehmen Millionen Beschäftigte die Arbeit wieder auf.“ Der systematische Streikaufruf durch die Gewerkschaften vom 20. Mai an konnte nun erklärt werden: Sie wollten die Bewegung kontrollieren, damit sie so leichter zur Wiederaufnahme der Arbeit in den weniger kämpferischen Teilen und zur Demoralisierung der anderen Bereiche drängen konnten. Waldeck-Rochet erklärte in seinen Reden während des Wahlkampfes, dass die « Kommunistische Partei eine Partei der Ordnung ist ». In der Tat konnte die bürgerliche „Ordnung“ schrittweise wiederhergestellt werden. 12. Juni: Wiederaufnahme der Arbeit in den Schulen der Sekundarstufe14. Juni: Air France und Seeschiffahrt16. Juni : Besetzung der Sorbonne durch die Polizei17. Juni: chaotische Wiederaufnahme der Arbeit bei Renault Billancourt18. Juni: De Gaulle ließ die Führer der OAS freisetzen, die noch im Gefängnis saßen;23. Juni: Erster Wahltag der Parlamentswahlen mit großen Stimmengewinnen für die Rechten;24. Juni: Wiederaufnahme der Arbeit bei Citroën Javel, mitten in Paris (Krasucki, Nummer 2 der CGT, trat vor der Vollversammlung auf und rief zum Streikabbruch auf.)26. Juni: Usinor Dünkirchen30. Juni : Stichwahl mit einem historischen Sieg der Rechten. Einer der Betriebe, die als letzte die Arbeit wieder aufnahmen, waren die Radio- und Fernsehanstalten am 12. Juli. Viele Journalisten wollten nicht wieder bevormundet und zensiert werden, wie das vorher so sehr durch die Regierung geschehen ist. Nach der Wiederaufnahme der Arbeit wurden viele von ihnen entlassen. Überall wurde die Ordnung wiederhergestellt, gerade auch bei den Medien, die wichtig waren für die gezielte „Bearbeitung“ der Bevölkerung. So endete der größte Streik der Geschichte im Gegensatz zu den Behauptungen der CGT und der KPF in einer Niederlage. Eine schwere Schlappe, die durch die Rückkehr der Parteien und „Autoritäten“ bekräftigt wurde, welche während der Bewegung die ganze Wut und Verachtung auf sich gezogen hatten. Aber die Arbeiterbewegung weiß schon seit langem: „Das eigentliche Resultat ihrer Kämpfe ist nicht der unmittelbare Erfolg, sondern die immer weiter um sich greifende Vereinigung der Arbeiter“ (Kommunistisches Manifest). Aber ungeachtet ihrer unmittelbaren Niederlage haben die Arbeiter in Frankreich 1968 einen großen Sieg nicht nur für sich selbst, sondern für das ganze Weltproletariat errungen. Dies werden wir in unserem nächsten Artikel aufzeigen, in dem wir versuchen werden, die tiefer liegenden Ursachen wie auch die historische und internationale Dimension dieses „schönen Mai“ in Frankreich herauszustellen. Fabienne (27/04/2008) 1) Am Tag nach dieser Rede kündigten die Beschäftigten der Kommunen in vielen Städten an, dass sie sich weigerten, das Referendum zu organisieren. Auch wussten die Behörden nicht, wie sie Wahlzettel drucken sollten – die Staatsdruckerei wurde bestreikt und die nicht streikenden privaten Druckereien verweigerten den Druckauftrag. Die Arbeitgeber wollten keine zusätzlichen Scherereien mit ihren Beschäftigten haben. 2) Man erfuhr später, dass Chirac, Staatssekretär im Ministerium für soziale Angelegenheiten, ebenfalls Krasucki, die Nummer 2 der CGT, (auf einem Dachboden!) getroffen hat.
Geographisch:
- Frankreich [32]
Aktuelles und Laufendes:
- Mai 68 [96]
Leute:
- Cohn-Bendit [97]
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Historische Ereignisse:
- Mai 68 [98]
Theoretische Fragen:
- Arbeiterklasse [58]
Juli 2008
- 766 reads
40 Jahre seit Mai 1968: Das Ende der Konterrevolution - Das historische Wiedererstarken der Arbeiterklasse - 2. Teil
- 3735 reads
Gegenüber all den Lügen, die heute zum Mai 68 verbreitet werden, müssen die Revolutionäre die Wahrheit wiederherstellen. Sie müssen auch die Mittel anbieten, um die Bedeutung und die Lehren dieser Ereignisse zu begreifen. Sie müssen insbesondere verhindern, dass ihre Lehren unter einem Haufen Blumen und Kränzen begraben werden.
Wir haben schon damit angefangen, indem wir bislang einen Artikel in unserer Internationalen Revue veröffentlicht haben, der auf die ersten Bestandteile der Ereignisse des Mai 68 zurückkommt – die Studentenproteste in Frankreich und auf der Welt. In diesem Artikel wollen wir auf den wesentlichsten Bestandteil der Ereignisse eingehen – die Bewegung der Arbeiterklasse. In dem ersten Artikel dieser Reihe schrieben wir am Schluss zu den Ereignissen in Frankreich: „Am 14. Mai gingen die Diskussionen in vielen Betrieben weiter. Nach den gewaltigen Demonstrationen am Vorabend, die den ganzen Enthusiasmus und ein Gefühl der Stärke zum Vorschein gebracht hatten, war es schwierig die Arbeit wieder aufzunehmen, so als ob nichts passiert wäre. In Nantes traten die Beschäftigen von Sud-Aviation in einen spontanen Streik und beschlossen die Besetzung des Werkes. Vor allem die jüngeren Beschäftigten trieben die Bewegung voran. Die Arbeiterklasse war auf den Plan getreten.“ Diese Schilderung werden wir hier fortsetzen.
Die Ausdehnung der Streiks
In Nantes stießen die jungen Arbeiter, die im gleichen Alter waren wie die Studenten, die Bewegung an. Ihre Argumentation war einfach aber einleuchtend: „Wenn die Studenten, die ja mit einem Streik keinen Druck ausüben können, die Kraft besaßen, die Regierung zum Nachgeben zu zwingen, können die Arbeiter die Regierung auch zum Nachgeben zwingen.“ Die Studenten der Stadt wiederum erklärten sich mit den Arbeitern solidarisch; sie reihten sich in deren Streikposten ein: Verbrüderung. Die Kampagnen der KPF (1) und der CGT (2) warnten vor den „linken Provokateuren, die im Dienste der Arbeitgeber und des Innenministers stehen“ und die Studenten unterwandert hätten; aber diese Kampagnen zeigten keine große Wirkung. Insgesamt standen am Abend des 14. Mai 3100 Arbeiter im Streik. Am 15. Mai breitete sich die Bewegung auf die Renault-Werke in Cléon in der Normandie, und auf zwei weitere Fabriken in der Region aus: totaler Streik, unbegrenzte Werksbesetzungen, rote Fahnen an den Fabriktoren. Am Ende des Tages streikten 11.000 Beschäftigte.
Am 16. Mai schlossen sich die Beschäftigten der anderen Renault-Werke an: rote Fahnen über Flins, Sandouville, Le Mans und Billancourt. An jenem Abend befanden sich 75.000 Arbeiter im Streik; aber als die Arbeiter von Renault-Billancourt in den Kampf traten, wurde ein deutliches Signal gesetzt. Es handelte sich um die größte Fabrik in Frankreich (35.000 Beschäftigte) und seit langem galt ein Sprichwort: „Wenn Renault niest, hat Frankreich Schnupfen.“
Am 17. Mai gab es 215.000 Streikende. Die Streiks erreichten nunmehr ganz Frankreich, vor allem die Provinz. Es handelte sich um eine vollkommen spontane Bewegung; die Gewerkschaften liefen ihr nur nach. Überall standen die jungen Arbeiter an ihrer Spitze. Häufig verbrüderten sich Studenten und junge Arbeiter. Junge Arbeiter zogen in die besetzten Universitäten und forderten die Studenten auf, zu ihnen in die Kantinen zum Essen zu kommen. Es gab keine genauen Forderungen. Stattdessen äußerte sich eher Unmut. Auf einer Fabrikmauer in der Normandie stand: „Wir brauchen Zeit zum Leben und mehr Würde!“ An jenem Tag rief die CGT zur „Ausdehnung des Streiks“ auf. Sie hatte Angst, von der „Basis überrollt“ und von der CFDT (3) , welche von den ersten Tagen an viel präsenter war, verdrängt zu werden. Wie man damals sagte, war sie auf den „fahrenden Zug aufgesprungen“. Ihr Aufruf wurde erst am nächsten Tag bekannt. Am 18. Mai standen mittags eine Million Arbeiter im Streik, noch bevor der Streikaufruf der CGT bekannt wurde. Am Abend streikten zwei Millionen Beschäftigte.
Am 20. Mai streikten sechs Millionen, und am 21. Mai hatten schon 6.5 Millionen die Arbeit niedergelegt.
Am 22. Mai befanden sich acht Millionen im unbefristeten Streik. Es handelte sich um den größten Streik in der Geschichte der internationalen Arbeiterbewegung. Er war sehr viel massiver als die vorher berühmt gewordenen Streiks – der ‚Generalstreik’ des Mai 1926 in Großbritannien (der eine Woche dauerte) und die Streiks im Mai-Juni 1936 in Frankreich. Alle Bereiche waren betroffen: Industrie, Transport und Verkehr, Energie, Post und Telekommunikation, Erziehungswesen, Verwaltungen (mehrere Ministerien waren vollkommen lahm gelegt), Medien (das staatliche Fernsehen streikte, die Beschäftigten prangerten vor allem die aufgezwungene Zensur an), Forschungslabore usw. Selbst die Bestattungsunternehmer streikten (Mai 68 war ein schlechter Zeitpunkt zum Sterben). Gar Berufssportler schlossen sich der Bewegung an. Die rote Fahne wehte über den Gebäuden des französischen Fußballverbandes. Die Künstler standen nicht abseits, das Filmfestival in Cannes wurde auf Veranlassung der Regisseure unterbrochen. In dieser Zeit wurden die besetzten Universitäten (wie auch andere öffentliche Gebäude wie das Odéon-Theater in Paris) zu Orten ständiger politischer Debatte. Viele Arbeiter, insbesondere die Jungen, aber nicht nur diese, beteiligten sich an diesen Diskussionen. Arbeiter baten diejenigen, die die Notwendigkeit einer Revolution vertraten, zu den Versammlungen in den besetzten Betrieben zu kommen und dort ihren Standpunkt zu vertreten. So wurde der kleine Kern von Leuten, die später die Sektion der IKS in Frankreich gründen sollte, dazu aufgefordert, in der besetzten Fabrik JOB ihre Auffassungen von den Arbeiterräten zu erklären. Und am bedeutendsten war, dass diese Einladung von Mitgliedern der …CGT und der KPF ausgesprochen wurde. Diese mussten eine Stunde lang mit den Hauptamtlichen der CGT des großen Werkes Sud-Aviation verhandeln, die gekommen waren, um die Streikposten der JOB zu ‚verstärken’, bevor sie die Zustimmung erhielten, ‚Linksradikale’ in das Werk zu lassen. Mehr als sechs Stunden lang diskutierten Arbeiter und Revolutionäre, auf Papierrollen sitzend, über die Revolution, die Geschichte der Arbeiterbewegung, die Sowjets und gar über den Verrat ... der KPF und der CGT. Viele Diskussionen fanden ebenfalls auf den Straßen und Bürgersteigen statt (im Mai 68 herrschte überall schönes Wetter). Sie entstanden spontan, jeder hatte etwas zu sagen („Man hört dem anderen zu und redet miteinander“ war einer der Slogans). Überall herrschte so etwas wie Feststimmung, außer in den ‚Reichenvierteln’, wo sich Angst und Hass ansammelten. Überall in Frankreich, in den Stadtvierteln, in einigen großen Betrieben oder in den benachbarten Bezirken tauchten „Aktionskomitees“ auf. Dort wurde darüber diskutiert, wie man kämpfen sollte, wie eine revolutionäre Perspektive aussehen könnte. Im Allgemeinen wurden diese Diskussionen von linken oder anarchistischen Gruppen angestoßen, aber dort versammelten sich viel mehr Leute als Mitglieder dieser Organisationen. Selbst bei der ORTF, den staatlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten, entstand ein Aktionskomitee, das insbesondere von Michel Drucker (4) mit angetrieben wurde, und an dem sich der unbeschreibliche Thierry Rolland (5) beteiligte.
Die Reaktionen der Bourgeoisie
In Anbetracht dieser Lage befand sich die herrschende Klasse in einer Phase des Umherirrens, was sich durch verwirrte und unwirksame Initiativen äußerte. So diskutierte und verwarf das Parlament, welches von der Rechten beherrscht wurde, einen Zensurantrag, der von der Linken zwei Wochen zuvor eingebracht worden war: Die offiziellen Institutionen der Republik Frankreichs schienen in einer anderen Welt zu leben. Das Gleiche traf auf die Regierung zu, die an jenem Tag beschloss, Daniel Cohn-Bendit, der nach Deutschland gereist war, die Wiedereinreise zu verbieten. Diese Entscheidung ließ die Unzufriedenheit nur noch weiter hochkochen. Am 24. Mai kam es zu mehreren Demonstrationen, insbesondere um gegen das Aufenthaltsverbot Cohn-Bendits zu protestieren: „Nieder mit den Landesgrenzen!“ „Wir sind alle deutsche Juden!“ Trotz des von der CGT gelegten Sperrrings gegen die „Abenteurer“ und „Provokateure“ (d.h. die „radikalen“ Studenten) schlossen sich viele junge Arbeiter diesen Demonstrationen an. Am Abend hielt der Präsident der Republik, General de Gaulle, eine Rede. Er schlug ein Referendum vor, damit die Franzosen sich zur „Beteiligung“ äußern (eine Art Assoziation Kapital-Arbeit). Weltfremder konnte man nicht sein. Diese Rede stieß auf taube Ohren. Sie zeigte die totale Verwirrung der Regierung und der Bourgeoisie im Allgemeinen (6). Auf den Straßen hatten die Demonstrationen die Rede in Transistorradios verfolgt. Die Wut stieg sofort weiter an: „Wir pfeifen auf seine Rede.“ In ganz Paris und in mehreren Provinzstädten kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen; Barrikaden wurden errichtet. Zahlreiche Schaufenster wurden zerschlagen, Autos in Brand gesetzt. Dadurch richtete sich ein Teil der öffentlichen Meinung gegen die Studenten, die nunmehr als „Krawallmacher“ angesehen wurden. Es ist übrigens wahrscheinlich, dass sich unter die Demonstranten Mitglieder der gaullistischen Milizen oder Zivilpolizisten gemischt hatten, um Öl aufs Feuer zu gießen und der Bevölkerung Angst einzujagen. Es war aber auch klar, dass viele Studenten glaubten, sie würden die ‚Revolution machen’, indem sie Barrikaden errichteten oder Autos anzündeten, die als Symbol der ‚Konsumgesellschaft’ galten. Aber diese Handlungen brachten vor allem die Wut der Demonstranten, Studenten und jungen Arbeiter über die lächerlichen und provozierenden Reaktionen der Behörden gegenüber der größten Streikwelle der Geschichte zum Vorschein. Ein Ausdruck dieser Wut gegen das System: das Symbol des Kapitalismus, die Pariser Börse, wurde in Brand gesetzt. Schließlich konnte die Bourgeoisie erst am darauf folgenden Tag wirksamere Maßnahmen ergreifen. Am Samstag, den 25. Mai, wurden Verhandlungen im Arbeitsministerium (rue de Grenelle) zwischen Gewerkschaften, Arbeitgebern und der Regierung aufgenommen. Von Anfang an waren die Arbeitgeber bereit, mehr zuzugestehen, als was die Gewerkschaften erwartet hatten. Es war offensichtlich, dass die Bourgeoisie Angst hatte. Der Premierminister Pompidou leitete die Verhandlungen. Am Sonntagmorgen traf er den Chef der CGT, Séguy (7) , eine Stunde lang unter vier Augen. Die beiden Hauptverantwortlichen für die Aufrechterhaltung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung in Frankreich brauchten Zeit, um ohne Zeugen die Bedingungen für die Wiederherstellung der Ordnung zu besprechen (8). In der Nacht vom 26. zum 27. Mai wurde das „Abkommen von Grenelle“ unterzeichnet:
- Lohnerhöhung von 7% für alle ab dem 1. Juni, plus 3% zusätzlich ab dem 1. Oktober;
- Erhöhung der Mindestlöhne um 25%;
- Kürzung der „Eigenleistungen“ im Gesundheitswesen von 30% auf 25% (insbesondere die Gesundheitsausgaben, die die Sozialversicherung nicht übernahm);
- Anerkennung der Gewerkschaften in den Betrieben;
- Sowie eine Reihe von sehr vagen Versprechungen des Beginns von Verhandlungen, insbesondere über die Frage der Arbeitszeit (die damals durchschnittlich 47 Stunden pro Woche betrug). In Anbetracht der Stärke der Bewegung handelte es sich um eine wahre Provokation:
- Die 10% Lohnerhöhung sollte schnell durch die Inflation aufgefressen werden (damals gab es eine hohe Inflationsrate);
- nichts zur Frage des Lohnausgleichs für die Inflation;
- nichts Konkretes zur Verkürzung der Arbeitszeit. Man gab sich damit zufrieden, als Ziel die „schrittweise“ Rückkehr zur 40 Stundenwoche (welche schon 1936 offiziell erreicht worden war) zu proklamieren. Wäre man dem von der Regierung vorgeschlagenen Rhythmus gefolgt, hätte man das Ziel 2008 erreicht!
- Die einzigen, die etwas Wesentliches erreichten, waren die am geringsten bezahlten Arbeiter (man wollte die Arbeiterklasse spalten und sie zur Wiederaufnahme der Arbeit drängen) sowie die Gewerkschaften (welche für ihre Saboteursrolle belohnt wurden).
- Am 27. Mai verwarfen die Vollversammlungen das „Abkommen von Grenelle“ einstimmig. Bei Renault Billancourt haben die Gewerkschaften eine ‚Showveranstaltung’ organisiert, über die von den Medien groß berichtet wird. Als er von den Verhandlungen zurückkam, sagte Séguy zu den Journalisten, „die Wiederaufnahme der Arbeit steht unmittelbar bevor“, und er hoffte sehr wohl, dass die Arbeiter von Billancourt ein Beispiel dafür liefern würden. Aber 10.000 Beschäftigte, die sich seit dem Morgen versammelt hatten, hatten die Fortsetzung der Streiks beschlossen, noch bevor die Gewerkschaftsführer angekommen waren. Benoît Frachon, ‘historischer’ Führer der CGT (der sich schon an den Verhandlungen von 1936 beteiligt hatte) erklärte: „Das Abkommen von Grenelle wird Millionen von Arbeitern einen Wohlstand bieten, den sie nicht erhofft hatten.“ Todesstille im Saal. André Jeanson von der CFDT freute sich über das anfängliche Votum zur Fortsetzung des Streiks und sprach von der Solidarität zwischen Arbeitern, Studenten und kämpfenden Oberschülern: stürmischer Beifall. Schließlich trug Séguy einen „objektiven Bericht“ der „Errungenschaften von Grenelle“ vor: minutenlanges Pfeifkonzert. Danach machte Séguy eine Kehrtwendung: „Wenn man nach dem hier gehörten urteilen muss, werdet ihr euch nicht über den Tisch ziehen lassen!“ Applaus, aber aus der Menge rief eine Stimme: „Er führt uns hinters Licht.“ Der beste Beweis der Verwerfung des „Abkommens von Grenelle“: die Zahl der Streikenden stieg noch am 27. Mai auf neun Millionen. Am 9. Mai fand im Sportstadion Charléty in Paris eine große Versammlung statt. Sie wurde von der Studentengewerkschaft UNEF, der CFDT (welche sich radikaler als die CGT gab) und linken Gruppen einberufen. In den Reden wurden revolutionäre Töne geschwungen. Man wollte für die wachsende Unzufriedenheit mit der CGT und der KPF ein Ventil finden. Neben den Vertretern der Extremen Linken waren auch Politiker der Sozialdemokratie wie Mendès-France anwesend (ehemaliger Regierungschef in den 1950er Jahren). Cohn-Bendit, der mit schwarz gefärbten Haaren aus Deutschland zurückgekehrt war, trat auch auf (am Vorabend war er in der Sorbonne erschienen). Der 28. Mai war der Tag der Manöver und Schachzüge der linken Parteien. Am Morgen hielt François Mitterrand, Vorsitzender der « Fédération de la gauche démocrate et socialiste“ (in der die Sozialistische Partei, die Radikale Partei und verschiedene kleine linke Gruppe vertreten waren) eine Pressekonferenz ab. Er meinte, es gebe ein Machtvakuum – deshalb kündigte er seine Kandidatur als Präsident der Republik an. Am Nachmittag schlug Waldeck-Rochet, der Führer der KPF, eine Regierung mit „kommunistischer Beteiligung“ vor. Es ging darum zu vermeiden, dass die Sozialdemokraten die Lage allein zu ihren Gunsten ausnutzten. Am 29. Mai folgte eine große Demonstration, zu welcher die CGT aufrief und in der sie eine „Volksregierung“ forderte. Die Rechten warnten sofort vor einem „kommunistischen Komplott“. An diesem Tag „tauchte“ General de Gaulle ab. Einige brachten das Gerücht in Umlauf, er trete ab; tatsächlich flog er nach Deutschland, um dort die Unterstützung des General Massus, welcher in Deutschland die französischen Besatzungstruppen befehligte, und die Loyalität der Armee sicher zu stellen. Der 30. Mai stellte eine Art entscheidenden Tag dar bei dem Versuch der Bourgeoisie, die Lage wieder in den Griff zu kriegen. De Gaulle hielt erneut eine Rede. „Unter den gegenwärtigen Bedingungen trete ich nicht zurück (…). Ich löse heute die Nationalversammlung auf ...“ Gleichzeitig fand in Paris auf den Champs-Élysées eine gewaltige Demonstration zur Unterstützung de Gaulles statt. Aus den Reichenvierteln, den wohlhabenden Vororten und auch vom Land wurde mit Armeelastern das „Volk“ herangekarrt. Es kamen zusammen die Verängstigten und Besitzenden, die Bürgerlichen, die Vertreter der Religionsschulen für die Kinder der Reichen, die Führungsschichten, die sich ihrer ‚Überlegenheit’ bewusst waren, die kleinen Geschäftsinhaber, die um ihre Schaufenster fürchteten; Kriegsveteranen, die wegen der Angriffe auf die Nationalfahne erbost waren, die Geheimpolizei, die mit der Unterwelt unter einer Decke steckte, aber auch alte Algeriensiedler und die OAS (9), junge Mitglieder der faschistoiden Gruppe Occident, die alten Nostalgiker Vichys (obwohl diese alle de Gaulle verachteten). All diese feinen Leute strömten zusammen, um ihren Hass auf die Arbeiterklasse und ihre ‚Ordnungsliebe’ zu bekunden. Aus der Menge, zu der auch alte Kämpfer des „freien Frankreich“ gehörten, drangen Rufe wie „Cohn-Bendit nach Dachau!“. Aber die „Partei der Ordnung“ beschränkte sich nicht auf die Demonstranten auf den Champs-Elysées. Am gleichen Tag rief die CGT zu branchenmäßigen Verhandlungen zur „Verbesserung der Errungenschaften von Grenelle“ auf. Es handelte sich um ein Mittel zur Spaltung der Bewegung, um sie so vernichten zu können.
Die Wiederaufnahme der Arbeit
on jenem Donnerstag an wurde die Arbeit wieder aufgenommen, allerdings nur langsam, denn am 6. Juni streikten immer noch ca. 6 Millionen Beschäftigte. Die Arbeit wurde in großer Zerstreuung wieder aufgenommen.
31. Mai: Stahlindustrie Lothringens, Textilindustrie Nordfrankreichs,
4. Juni: Arsenale, Versicherungen
5. Juni : Elektrizitätswerke (10), Kohlebergwerke6. Juni : Post, Telekommunikation, Transportwesen (In Paris setzte die CGT Druckmittel zur Wiederaufnahme der Arbeit ein. In jedem Betriebswerk kündigten die Gewerkschaftsführer an, dass in den anderen Depots die Arbeit schon wieder aufgenommen worden sei, was eine Täuschung war.);
7. Juni: Grundschulen
10. Juni: das Renault-Werk in Flins wurde von der Polizei besetzt. Ein von den Polizisten verprügelter Gymnasiast fiel in die Seine und ertrank;
11. Juni: Intervention der CRS (Bürgerkriegspolizei) (11) in den Peugeot-Werken in Sochaux (zweitgrößtes Werk in Frankreich). Zwei Arbeiter wurden getötet. In ganz Frankreich kam es erneut zu gewalttätigen Demonstrationen. „Sie haben unsere Genossen getötet.“ Trotz des entschlossenen Widerstands der Arbeiter räumten die CRS das Sochaux-Werk. Aber die Arbeit wurde erst 10 Tage später wieder aufgenommen. Aus Furcht, dass die Empörung erneut zu einem Wiederaufleben der Streiks führte (immerhin standen noch drei Millionen Beschäftigte im Streik), riefen die Gewerkschaften (mit der CGT an der Spitze) und die Linksparteien (mit der KPF an der Spitze) nachdrücklich zur Wiederaufnahme der Arbeit auf, „damit die Wahlen stattfinden können und der Sieg der Arbeiterklasse vervollständigt werden kann.“ Die Tageszeitung der KPF, l’Humanité, trug die Schlagzeile: „Gestärkt durch ihren Sieg nehmen Millionen Beschäftigte die Arbeit wieder auf.“ Der systematische Streikaufruf durch die Gewerkschaften vom 20. Mai an konnte nun erklärt werden: Sie wollten die Bewegung kontrollieren, damit sie so leichter zur Wiederaufnahme der Arbeit in den weniger kämpferischen Teilen und zur Demoralisierung der anderen Bereiche drängen konnten. Waldeck-Rochet erklärte in seinen Reden während des Wahlkampfes, dass die « Kommunistische Partei eine Partei der Ordnung ist ». In der Tat konnte die bürgerliche „Ordnung“ schrittweise wiederhergestellt werden.
12. Juni: Wiederaufnahme der Arbeit in den Schulen der Sekundarstufe
14. Juni: Air France und Seeschiffahrt16. Juni : Besetzung der Sorbonne durch die Polizei
17. Juni: chaotische Wiederaufnahme der Arbeit bei Renault Billancourt
18. Juni: De Gaulle ließ die Führer der OAS freisetzen, die noch im Gefängnis saßen;
23. Juni: Erster Wahltag der Parlamentswahlen mit großen Stimmengewinnen für die Rechten;
24. Juni: Wiederaufnahme der Arbeit bei Citroën Javel, mitten in Paris (Krasucki, Nummer 2 der CGT, trat vor der Vollversammlung auf und rief zum Streikabbruch auf.)
26. Juni: Usinor Dünkirchen
30. Juni : Stichwahl mit einem historischen Sieg der Rechten. Einer der Betriebe, die als letzte die Arbeit wieder aufnahmen, waren die Radio- und Fernsehanstalten am 12. Juli. Viele Journalisten wollten nicht wieder bevormundet und zensiert werden, wie das vorher so sehr durch die Regierung geschehen ist. Nach der Wiederaufnahme der Arbeit wurden viele von ihnen entlassen. Überall wurde die Ordnung wiederhergestellt, gerade auch bei den Medien, die wichtig waren für die gezielte „Bearbeitung“ der Bevölkerung. So endete der größte Streik der Geschichte im Gegensatz zu den Behauptungen der CGT und der KPF in einer Niederlage. Eine schwere Schlappe, die durch die Rückkehr der Parteien und „Autoritäten“ bekräftigt wurde, welche während der Bewegung die ganze Wut und Verachtung auf sich gezogen hatten. Aber die Arbeiterbewegung weiß schon seit langem: „Das eigentliche Resultat ihrer Kämpfe ist nicht der unmittelbare Erfolg, sondern die immer weiter um sich greifende Vereinigung der Arbeiter“ (Kommunistisches Manifest). Aber ungeachtet ihrer unmittelbaren Niederlage haben die Arbeiter in Frankreich 1968 einen großen Sieg nicht nur für sich selbst, sondern für das ganze Weltproletariat errungen. Dies werden wir in unserem nächsten Artikel aufzeigen, in dem wir versuchen werden, die tiefer liegenden Ursachen wie auch die historische und internationale Dimension dieses „schönen Mai“ in Frankreich herauszustellen.
Die internationale Bedeutung des Streiks im Mai 1968
In den meisten Büchern und Fernsehsendungen, die sich in der letzten Zeit mit dem Thema Mai 1968 befassten, wird der internationale Charakter der Studentenbewegung, welche in Frankreich zu jener Zeit im Gange war, unterstrichen. Es herrscht, wie wir auch in früheren Artikeln festgestellt haben, Einverständnis darüber, dass die Studenten in Frankreich nicht die ersten waren, die massiv auf den Plan traten. Sie waren sozusagen auf den fahrenden Zug aufgesprungen, welcher in den US-amerikanischen Universitäten im Herbst 1964 in Gang gesetzt wurde. Von den USA ausgehend, hatte diese Bewegung die meisten westlichen Ländern erfasst und dabei in Deutschland 1967 seinen spektakulärsten Höhepunkt erlebt, was die Studenten in Deutschland zu einem "Bezugspunkt" für die Studenten Europas machte. Aber die gleichen Journalisten oder „Historiker“, die vorbehaltlos das internationale Ausmaß der Studentenproteste Ende der 1960er Jahre unterstreichen, hüllen sich in allgemeines Schweigen über die Arbeiterkämpfe, die damals weltweit stattfanden. Natürlich können sie den gewaltigen Streik, der den wichtigsten Moment der Ereignisse des Jahres 1968 in Frankreich darstellt, nicht einfach ausblenden und schweigend darüber hinweggehen. Aber wenn sie sich dazu äußern, dann nur, um zu sagen, die Bewegung der Arbeiter sei eine auf Frankreich beschränkte Ausnahmeerscheinung, gewesen.
In Wirklichkeit war die Bewegung der Arbeiterklasse in Frankreich ebenso wie die der Studenten, Teil einer internationalen Bewegung, und sie kann auch nur im internationalen Kontext verstanden werden. Dies wollen wir unter anderem im folgenden Artikel aufzeigen.
Die französische "Besonderheit"
Es stimmt, dass die Lage in Frankreich im Mai 1968 eine besondere war, die in keinem anderen Land in dem Ausmaß vorzufinden war, allenfalls marginal: eine massive Bewegung der Arbeiterklasse, die sich von der Studentenbewegung ausgehend entwickelt hatte. Es ist offensichtlich, dass die Mobilisierung der Studenten, die danach einsetzende Repression – welche Erstere wiederum anfachte – sowie das Zurückweichen der Regierung nach der "Nacht der Barrikaden" vom 10. auf den 11. Mai eine Rolle nicht nur bei der Auslösung der Arbeiterstreiks, sondern auch beim Ausmaß derselben gespielt haben. Aber wenn die Arbeiterklasse in Frankreich solch eine Bewegung ausgelöst hat, dann geschah dies nicht, weil sie "dem Beispiel der Studenten folgen" wollte, sondern weil in ihren eigenen Reihen eine tiefe und weit verbreitete Unzufriedenheit, aber auch die politische Kraft herrschte, um solch einen Kampf aufzunehmen.
Dieser Tatbestand wird in der Regel durch die Bücher und Fernsehprogramme, welche sich mit Mai 68 befassten, nicht verheimlicht. Es wird oft in Erinnerung gerufen, dass die Arbeiter von 1967 an wichtige Kämpfe geführt haben, die sich in vielem von der Zeit davor unterschieden. Während die kleinen, harmlosen Streiks und die gewerkschaftlichen Aktionstage keine große Begeisterung hervorriefen, flammten nunmehr sehr heftige Konflikte auf, mit einer großen Entschlossenheit der Beschäftigten, die mit einer gewaltsamen Repression durch die Arbeitgeber und die Polizei konfrontiert wurden und unter denen die Gewerkschaften mehrfach die Kontrolle verloren hatten. So kam es schon Anfang 1967 zu größeren Zusammenstößen in Bordeaux (im Flugzeugwerk Dassault), in Besançon und in der Gegend von Lyon (Streik und Besetzung in Rhodia, Streik bei Berliet mit anschließender Aussperrung der Arbeiter durch die Arbeitgeber und Besetzung des Werkes durch die Bürgerkriegspolizei CRS), in den Bergwerken Lothringens, in den Schiffswerften von Saint-Nazaire (die am 11. April durch einen Generalstreik lahmgelegt wurden).
In Caen in der Normandie fanden die wichtigsten Kämpfe der Arbeiterklasse vor dem Mai 1968 statt. Am 20. Januar 1968 hatten die Gewerkschaften von Saviem (LKW-Hersteller) zu einem anderthalbstündigen Streik aufgerufen, aber die Gewerkschaftsbasis, die diese Maßnahme als unzureichend betrachtete, trat am 23. Januar spontan in den Streik. Am übernächsten Tag, um 4.00h morgens, griff die CRS die Streikposten an und vertrieb sie, um den Managern und den Streikbrechern den Zugang zur Fabrik zu ermöglichen. Die Streikenden beschlossen, in das Stadtzentrum zu ziehen, wo sich ihnen Arbeiter anderer Betriebe anschlossen, die ebenfalls in den Streik getreten waren. Um acht Uhr morgens bewegten sich ca. 5.000 Menschen friedlich auf das Stadtzentrum zu, bis sie von der Bürgerkriegspolizei (12) brutal angegriffen wurden. So schlugen diese mit ihren Gewehrkolben auf die Demonstranten ein. Am 26. Januar bekundeten Beschäftigte aus allen Bereichen (unter ihnen Lehrer) wie auch viele Studenten ihre Solidarität. An einer Solidaritätsveranstaltung um 18 Uhr auf dem Marktplatz beteiligten sich ca. 7.000 Menschen. Am Ende der Veranstaltung griff die CRS erneut an, um den Platz zu räumen – aber sie wurde vom heftigen Widerstand der Arbeiter überrascht. Die Zusammenstöße dauerten die ganze Nacht. Über 200 Menschen wurden verletzt, Dutzende verhaftet. Sechs junge Demonstranten, alles junge Arbeiter, wurden zu Haftstrafen von 15 Tagen bis zu drei Monaten verurteilt. Aber anstatt die Kampfbereitschaft der Arbeiter zu schwächen und diese zurückzudrängen, bewirkte diese Repression nur die weitere Ausdehnung der Bewegung. Am 30. Januar zählte man ca. 15.000 Streikende in Caen. Am 2. Februar wurden die staatlichen Behörden und die Arbeitgeber zum Rückzug gezwungen. Die Strafverfolgungen gegen die Demonstranten wurden fallengelassen; die Löhne wurden um drei bis vier Prozent angehoben. Am nächsten Tag nahmen die Beschäftigten die Arbeit wieder auf, aber unter dem Druck der jungen Beschäftigten kam es mindestens noch einen Monat lang zu weiteren Arbeitsniederlegungen bei Saviem.
Doch Saint-Nazaire im April 67 und Caen im Januar 68 waren nicht die einzigen von Generalstreiks betroffenen Städte. Auch in anderen, weniger großen Städten wie Redon im März, Honfleur im April kam es zu größeren Streiks. Diese massiven Streiks aller Beschäftigten einer Stadt sollten einen Vorgeschmack von dem liefern, was im Mai im ganzen Land passieren sollte.
Deshalb kann man nicht behaupten, dass das Gewitter des Mai 68 wie ein Blitz aus heiterem Himmel erfolgt war. Die Studentenbewegung hatte etwas angezündet, das längst bereit war zu brennen.
Natürlich haben die "Spezialisten", insbesondere die Soziologen, versucht, die Ursachen dieser "Ausnahme" Frankreich aufzuzeigen. Sie haben vor allem auf die hohen Wachstumszahlen der Industrie in Frankreich während der 1960er Jahre verwiesen, wodurch das alte, landwirtschaftlich geprägte Land zu einem modernen und mächtigen Industriestaat wurde. Diese Tatsache erkläre das Auftreten und die Rolle einer großen Zahl von jungen Arbeitern, die in Fabriken angestellt waren, die oft erst kurz zuvor errichtet worden waren. Diese jungen Arbeiter, die häufig vom Land kamen, seien meistens nicht gewerkschaftlich organisiert gewesen; auch seien sie schlecht mit der Kasernendisziplin in den Betrieben zurechtgekommen, zudem sie trotz ihrer Berufsausbildung meist lächerlich geringe Löhne erhielten.
So lässt sich erklären, warum die jüngsten Mitglieder der Arbeiterklasse als erste den Kampf aufgenommen haben, und auch, warum die meisten wichtigen Bewegungen, die dem Mai 1968 vorhergingen, in Westfrankreich ausgelöst wurden: Diese Region wurde erst relativ spät industrialisiert. Aber die Erklärungen der Soziologen vermögen nicht zu erklären, warum nicht nur die jungen Arbeiter 1968 in Streik getreten sind, sondern die große Mehrheit der ganzen Arbeiterklasse, d.h. quer durch alle Generationen, gestreikt hat.
… und international
Hinter einer solch tiefgreifenden und weitreichenden Bewegung wie die des Mai 68 steckten notwendigerweise tiefergehende Ursachen, die weit über Frankreich hinausreichten. Die gesamte Arbeiterklasse Frankreichs ist damals faktisch in einen Generalstreik getreten, da alle Teile der Arbeiterklasse mittlerweile von der Wirtschaftskrise erfasst worden waren, die 1968 erst in ihrer Anfangsphase steckte. Diese Krise war aber keineswegs auf Frankreich beschränkt, sondern erfasste den Weltkapitalismus insgesamt. Die Auswirkungen dieser weltweiten Wirtschaftkrise in Frankreich (Anstieg der Arbeitslosigkeit, Lohnstopps, Produktivitätserhöhungen, Angriffe auf die Sozialleistungen) liefern die Haupterklärung für den Anstieg der Kampfbereitschaft in Frankreich 1967: „In allen Industriestaaten Europas und in den USA stieg die Arbeitslosigkeit an und die wirtschaftlichen Aussichten verschlechterten sich. England, das trotz einer Vielzahl von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung eines Gleichgewichts Ende 1967 dazu gezwungen war, das Pfund abzuwerten, löste eine Reihe von Abwertungen vieler anderer Währungen aus. Die Regierung Wilson kündigte ein außergewöhnliches Sparprogramm an: massive Kürzung der Staatsausgaben (...), Lohnstopps, Einschränkung der Binnennachfrage und der Importe, besondere Anstrengungen zur Ankurbelung der Exporte. Am 1. Januar 1968 schrie Johnson [der damalige US-Präsident] Alarm und kündigte unumgängliche harte Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des wirtschaftlichen Gleichgewichts an. Im März brach die Dollarkrise aus. Die Tag für Tag pessimistischere Wirtschaftspresse erwähnte immer öfter das Gespenst der Wirtschaftskrise von 1929 […] Die ganze Bedeutung des Mai 1968 lag darin, eine der ersten und größten Reaktionen der Arbeiter gegen eine sich weltweit verschlechternde wirtschaftliche Lage gewesen zu sein“ (Révolution Internationale - alte Reihe, Nr. 2, Frühjahr 1969).
Tatsächlich haben besondere Umstände dazu geführt, dass der erste große Kampf der Arbeiterklasse gegen die Angriffe der Kapitalisten, die später an Schärfe noch zunehmen sollten, in Frankreich ausgefochten wurde. Doch sehr schnell traten auch Arbeiter anderer Länder in den Kampf. Den gleichen Ursachen folgten die gleichen Wirkungen.
Am anderen Ende der Welt, in Cordoba (Argentinien), kam es im Mai 1969 zu dem, was später als „Cordobazo“ in die Geschichte eingehen sollte. Nach einer ganzen Reihe von Arbeitermobilisierungen in vielen Städten gegen die brutalen wirtschaftlichen Sparmaßnahmen und die Repression durch das Militärregime hatten Polizei und Armee am 29. Mai die Kontrolle verloren, obwohl Letztere sogar Panzer aufgeboten hatte. Die Arbeiter hatten die zweitgrößte Stadt des Landes übernommen. Die Regierung konnte die „Ordnung“ am folgenden Tag nur dank des massiven Einsatzes des Militärs wiederherstellen.
In Italien begannen zum gleichen Zeitpunkt die größten Arbeiterkämpfe seit dem II. Weltkrieg. Bei Fiat in Turin legten mehr und mehr Arbeiter die Arbeit nieder, zunächst im größten Werk der Stadt, bei Fiat-Mirafiori, ehe die Bewegung dann die anderen Werke in Turin und Umgebung erreichte. Während eines gewerkschaftlichen Aktionstages am 3. Juli 1969 gegen die Mietpreiserhöhungen zogen demonstrierende Arbeiter, denen sich Studenten anschlossen, zum Mirafiori-Werk. Die Polizei griff daraufhin die Demonstrierenden gewalttätig an. Die gewaltsamen Auseinandersetzungen hielten die ganze Nacht an und dehnten sich auf andere Stadtviertel aus.
Ab Ende August, als die Arbeiter aus ihrem Sommerurlaub zurückkehrten, kam es erneut zu Arbeitsniederlegungen – dieses Mal jedoch auch bei Pirelli (Reifenhersteller) in Mailand und in vielen anderen Betrieben.
Doch die italienische Bourgeoisie, die aus der Erfahrung des Mai 68 gelernt hatte, ließ sich im Gegensatz zu der französischen Bourgeoisie nicht überraschen. Sie versuchte mit aller Macht zu verhindern, dass die spürbare, starke gesellschaftliche Unzufriedenheit zu einem gesellschaftlichen Flächenbrand ausuferte. Deshalb versuchte der zu ihren Diensten stehende Gewerkschaftsapparat, die anstehenden Tarifverhandlungen, insbesondere in der Metallindustrie, in der Chemiebranche und im Baugewerbe, auszunutzen, um Spaltungsmanöver durchzuführen, mit denen die Arbeiter dazu veranlasst werden sollten, für „gute Abschlüsse“ in ihrer jeweiligen Branche zu kämpfen. Die Gewerkschaften verfeinerten die Taktik der „Schwerpunktstreiks“: An einem Tag streikten die Metaller, an einem anderen die Beschäftigten der chemischen Industrie, an einem dritten die des Baugewerbes. Man rief auch zu „Generalstreiks“ auf, aber diese sollten jeweils auf eine Provinz oder eine Stadt beschränkt bleiben. Sie richteten sich gegen die Preiserhöhungen oder Mietpreissteigerungen. In den Betrieben selbst plädierten die Gewerkschaften für rotierende Streiks; eine Abteilung nach der anderen sollte die Arbeit niederlegen. Dies geschah unter dem Vorwand, so dem Arbeitgeber den größtmöglichen Schaden zuzufügen und für die Streikenden den Schaden so gering wie möglich zu halten. Gleichzeitig unternahmen die Gewerkschaften alles, um die Kontrolle über eine Basis wiederherzustellen, die ihnen immer mehr entglitt. Nachdem die Arbeiter in vielen Betrieben aus Unzufriedenheit mit den traditionellen Gewerkschaftsstrukturen Vertrauensleute wählten, wurden diese postwendend als „Fabrikräte“ institutionalisiert, die die „Basisorgane“ der Einheitsgewerkschaft sein sollten, welche die drei Gewerkschaftsverbände CGIL, CISL und UIL gemeinsam gründen wollten.
Nach mehreren Monaten, während derer die Kampfbereitschaft durch eine Reihe von „Aktionstagen“ erschöpft wurde, die jeweils voneinander abgeschottet in verschiedenen Branchen und Städten stattfanden, wurden zwischen Anfang November und Ende Dezember die Tarifverträge Zug um Zug unterzeichnet. Und schließlich explodierte am 12. Dezember - wenige Tage vor dem Abschluss des Tarifvertrages in der bedeutendsten Branche, der privaten Metallindustrie, wo die Arbeiter am radikalsten gekämpft hatten - eine Bombe in einer Mailänder Bank. Dabei kamen 16 Menschen ums Leben. Das Attentat wurde Anarchisten in die Schuhe geschoben (einer von ihnen, Giuseppe Pinelli, starb in den Händen der Mailänder Polizei), aber viel später stellte sich heraus, dass das Attentat von gewissen Kreisen des Staatsapparates angezettelt worden war. Die geheimen Strukturen des bürgerlichen Staates leisteten so den Gewerkschaften Hilfestellung, um für Verwirrung in den Reihen der Arbeiter zu sorgen, während gleichzeitig ein Vorwand für die Verstärkung des Repressionsapparates gefunden worden war.
Das Proletariat Italiens war jedoch nicht das einzige, das sich im Herbst 1969 regte. In geringerem Maße traten auch die Arbeiter in Deutschland auf den Plan; im September 1969 kam es zu wilden Streiks gegen die von den Gewerkschaften unterzeichneten Tarifabschlüsse der Lohndämpfung. Diese Tarifabschlüsse wurden von den Gewerkschaften in Anbetracht der Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in Deutschland als „realistisch“ gelobt. Die Wirtschaft in Deutschland war trotz des Wirtschaftswunders von den zunehmenden Schwierigkeiten der Weltwirtschaft seit 1967 nicht verschont geblieben – 1967 rutschte Deutschland zum ersten Mal seit dem II. Weltkrieg in die Rezession ab.
Auch wenn dieses Wiedererwachen der Arbeiterklasse in Deutschland noch sehr verhalten war, kam diesem eine besondere Bedeutung zu. Auf der einen Seite handelt es sich um den zahlenmäßig größten und konzentriertesten Teil der Arbeiterklasse in Europa. Aber vor allem hat die Arbeiterklasse in Deutschland in der Geschichte eine herausragende Stellung innerhalb der Weltarbeiterklasse eingenommen – und diesen Platz wird sie auch in Zukunft einnehmen. In Deutschland war der Ausgang der internationalen revolutionären Welle von Kämpfen, die von Oktober 1917 in Russland an die kapitalistische Herrschaft auf der ganzen Welt bedroht hatte, infragestellt worden. Die von den Arbeitern in Deutschland erlittene Niederlage nach ihrem revolutionären Ansturm zwischen 1918-1923 hatte der schrecklichsten Konterrevolution, die die Weltarbeiterklasse jemals erlebt hatte, den Weg bereitet. Dort, wo die Revolution am weitesten gediehen war, in Deutschland und Russland, hatte die Konterrevolution die schlimmsten und barbarischsten Formen angenommen: Stalinismus und Naziherrschaft. Diese Konterrevolution hatte fast ein halbes Jahrhundert gedauert und erlebte ihren Gipfelpunkt im II. Weltkrieg, der es im Gegensatz zum I. Weltkrieg dem Proletariat nicht ermöglicht hatte, sein Haupt zu erheben, sondern seine Niederlage nur verschärft hatte, insbesondere durch die durch den Sieg der „Demokratie“ und des „Sozialismus“ entstandenen Illusionen.
Die gewaltigen Streiks des Mai 1968 in Frankreich, schließlich der „Heiße Herbst“ in Italien hatten den Beweis erbracht, dass die Weltarbeiterklasse die Zeit der Konterrevolution überwunden hatte, und dass im Gegensatz zur Krise von 1929 die nun mehr neu einsetzende Krise nicht zu einem neuen Weltkrieg führen sollte, sondern zu einer Intensivierung der Klassenkämpfe, welche die herrschende Klasse daran hinderten, ihre barbarische Lösung für die Erschütterungen ihrer Wirtschaft durchzusetzen. Die Kämpfe der Arbeiter in Deutschland im September 1969 bestätigten dies später, und in einem noch größeren Maße taten dies auch die Kämpfe der polnischen Arbeiter aus den Ostseestädten im Winter 1970-71.
Im Dezember 1970 reagierte die Arbeiterklasse in Polen spontan und massiv auf eine Erhöhung der Preise von mehr als 30%. Die Arbeiter zerstörten den Sitz der stalinistischen Partei in Gdansk, Gdynia und Elblag. Die Streikbewegung dehnte sich von der Ostseeküste auf Poznan, Katowice, Wroclaw und Krakov aus. Am 17. Dezember schickte Gomulka, der Generalsekretär der an der Macht befindlichen stalinistischen Partei, seine Panzer an die Ostküste. Mehrere Hundert Arbeiter wurden getötet. Straßenkämpfe fanden in Szczecin und Gdansk statt. Die Bewegung konnte aber nicht durch Repression unterdrückt werden. Am 21. Dezember brach eine Streikwelle in Warschau aus. Gomulka musste abtreten. Sein Nachfolger, Gierek, verhandelte sofort persönlich mit den Werftarbeitern von Szczecin. Gierek machte einige Konzessionen, aber weigerte sich die Preiserhöhungen zurückzunehmen. Am 11. Februar brach ein Massenstreik in Lodz aus. Gierek musste schließlich nachgeben: die Preiserhöhungen wurden gestrichen. Die stalinistischen Regimes waren die schlimmste Verkörperung der Konterrevolution gewesen. Im Namen des „Sozialismus“ und im „Interesses der Arbeiterklasse“ wurde die schrecklichste Terrorherrschaft gegen die Arbeiter ausgeübt. Der „heiße“ Winter der polnischen Arbeiter 1970-71 sowie auch die Streiks, die nach Bekanntwerden der Kämpfe in Polen auf der anderen Seite der Grenze ausbrachen, insbesondere in Lwow (Ukraine) und Kaliningrad bewiesen , dass selbst dort, wo die Konterrevolution in Gestalt der „sozialistischen“ Regimes immer noch das Zepter in der Hand hielt, ein Durchbruch erzielt worden war.
Wir können an dieser Stelle nicht alle Arbeiterkämpfe aufzählen, die nach 1968 stattgefunden haben und diese grundlegende Umwälzung des Kräfteverhältnisses zwischen den beiden Klassen Bourgeoisie und Proletariat auf Weltebene bewirkt haben. Wir wollen stellvertretend nur zwei Beispiele erwähnen: Spanien und England.
Trotz einer wütenden Repression, die vom Franco-Regime ausgeübt wurde, hielt die Kampfbereitschaft der Arbeiter noch bis 1974 massiv an. In Pamplona, Navarra, überstieg die Zahl der Streiktage pro Arbeiter noch die der französischen Arbeiter 1968. Alle Industriegebiete (Madrid, Asturien, Baskenland) wurden erfasst. In den großen Arbeiterzusammenballungen der Vororte von Barcelona dehnten sich die Streiks am weitesten aus. Fast alle Betriebe der Region wurden bestreikt. Es kam zu exemplarischen Solidaritätsstreiks (oft begannen Streiks in einem Werk ausschließlich aus Solidarität mit den Beschäftigten anderer Betriebe).
Das Beispiel des englischen Proletariats ist ebenfalls sehr aufschlussreich, denn hier handelte es sich um das älteste Proletariat der Welt. Während der 1970er Jahre fanden dort massive Kämpfe gegen die Ausbeutung statt (1979 wurden mehr als 29 Millionen Streiktage registriert, die englischen Arbeiter standen in der Streikstatistik an zweiter Stelle hinter den französischen Arbeitern mit ihren Streiks 1968). Diese Kampfbereitschaft zwang die englische Bourgeoisie zweimal dazu, sogar ihren Premierminister auszutauschen: Im April 1976 wurde Callaghan durch Wilson ersetzt, und Anfang 1979 wurde Callaghan durch das Parlament abgesetzt.
So liegt die grundlegende historische Bedeutung des Mai 68 weder in den „französischen Besonderheiten“ noch in der Studentenrevolte, ebensowenig in der heute so viel gepriesenen ‚Revolution der Sitten?’, sondern darin, dass die Weltarbeiterklasse die Konterrevolution überwunden hatte und in einen neuen historischen Zeitraum von Zusammenstößen mit der kapitalistischen Ordnung eingetreten war. Diese neue Periode zeichnet sich ebenso dadurch aus, dass sich politisch-proletarische Strömungen, welche von der Konterrevolution praktisch eliminiert oder zum Schweigen gebracht worden waren, neu entwickelt haben, darunter die IKS. Darauf werden wir in einem weiteren Artikel eingehen.
Das internationale Wiederauftauchen revolutionärer Kräfte
Die Schäden der Konterrevolution in den Reihen der Kommunisten
Anfang des 20. Jahrhunderts führte das Proletariat während und nach dem 1. Weltkrieg gigantische Kämpfe, in denen der Kapitalismus beinahe überwunden worden wäre. 1917 wurde die bürgerliche Macht in Russland gestürzt. Zwischen 1918-1923 gab es in dem wichtigsten Land Europas, in Deutschland, mehrere Anläufe zur Überwindung des Kapitalismus. Diese revolutionäre Welle fand in allen Winkeln der Erde ihren Widerhall, d.h. überall wo es eine entwickelte Arbeiterklasse gab, von Italien bis Kanada, von Ungarn bis China.
Aber der Weltbourgeoisie gelang es, diese gigantische Bewegung der Arbeiterklasse einzudämmen, und sie blieb nicht dabei stehen. Sie brach die schrecklichste Konterrevolution in der Geschichte der Arbeiterbewegung vom Zaun. Diese Konterrevolution entwickelte sich in Gestalt einer unvorstellbaren Barbarei, deren bedeutendsten Ausdrücke der Stalinismus und Nationalsozialismus waren. Diese wüteten besonders stark dort, wo die Revolution am weitesten gegangen war, nämlich in Russland und in Deutschland.
In diesem Zusammenhang verwandelten sich die kommunistischen Parteien, welche in der revolutionären Welle von Kämpfen an der Spitze gestanden hatten, zu Parteien der Konterrevolution.
Der Verrat der kommunistischen Parteien löste in ihren Reihen die Entstehung von linkskommunistischen Fraktionen aus, welche wirklich revolutionäre Positionen weiter verteidigen wollten Ein ähnlicher Prozesses hatte schon innerhalb der sozialistischen Parteien stattgefunden, als diese 1914 aufgrund ihrer Unterstützung des imperialistischen Krieges ins bürgerliche Lager übergewechselt waren. Aber während diejenigen, welche innerhalb der sozialistischen Parteien gegen deren opportunistisches Abgleiten und deren Verrat ankämpften, an Stärke und Einfluss in der Arbeiterklasse gewannen, so dass sie nach der Russischen Revolution sogar eine neue Internationale gründen konnten, verlief die Entwicklung der linken Strömungen, die aus den kommunistischen Parteien hervorgingen, aufgrund des zunehmenden Gewichtes der Konterrevolution anders. Während sie anfänglich eine Mehrheit der Mitglieder in den Parteien in Deutschland und Italien umfassten, verloren diese Strömungen schrittweise ihren Einfluss in der Arbeiterklasse und den größten Teil ihrer Mitglieder. Oder sie gingen unter durch eine Zersplitterung in eine Reihe von kleinen Gruppen, wie in Deutschland, noch bevor das Hitler-Regime die letzten Militanten auslöschte oder sie ins Exil zwang.
Während der 1930er Jahre zählten neben der Strömung um Trotzki, welche immer mehr vom Opportunismus zerfressen wurde, die Gruppen, welche die revolutionären Positionen weiterhin entschlossen verteidigten wie die Gruppe Internationaler Kommunisten (GIK) in Holland (die sich auf den "Rätekommunismus" berief und die Notwendigkeit einer proletarischen Partei verwarf) und die Linksfraktion der Kommunistischen Partei Italiens (welche die Zeitschrift Bilan veröffentlichte) nur einige wenige Dutzend Mitglieder. Diese konnten keinen Einfluss auf die Arbeiterkämpfe ausüben.
Im Gegensatz zum 1. Weltkrieg hat der 2. Weltkrieg keine Umkehrung des Kräfteverhältnisses zwischen Proletariat und Bourgeoisie ermöglicht. Ganz im Gegenteil. Durch die historische Erfahrung klüger geworden und dank der wertvollen Unterstützung der stalinistischen Parteien setzte die Bourgeoisie alles daran, jegliche neue Regungen der Arbeiterklasse im Keim zu ersticken. In der demokratischen Euphorie der "Befreiung" standen die Gruppen der Kommunistischen Linken noch isolierter da als in den 1930er Jahren. In Holland löste der Communistenbond Spartacus den GIC bei der Verteidigung rätistischer Positionen ab. Diese wurden ebenfalls ab 1965 von der Gruppe Daad en Gedachte, einer Abspaltung vom Bond, vertreten. Diese beiden Gruppen veröffentlichten viele Texte, obwohl sie durch ihre rätekommunistische Position behindert waren, welche die Rolle einer Avantgardeorganisation für die Arbeiterklasse verwarf. Aber das größte Hindernis war das ideologische Gewicht der Konterrevolution. Dies traf auch auf Italien zu, wo die Bildung der Partito Comunista Internazionalista (die Battaglia Comunista und Prometeo veröffentlichte) im Jahre 1945 um Damen und Bordiga die Versprechen nicht hielt, welche ihre Mitglieder sich erhofft hatten. Während diese Organisation bei ihrer Gründung über ca. 3.000 Mitglieder verfügte, wurde sie infolge von Demoralisierung und Spaltungen – insbesondere nach der von Bordiga betriebenen Spaltung 1952, die zur Bildung der Parti Communiste International führte (sie veröffentlichte Programma Comunista), immer mehr geschwächt. Einer der Gründe für die Spaltungen und Schwächung liegt in der Aufgabe einer ganzen Reihe von Errungenschaften, die von Bilan in den 1930er Jahren erzielt worden waren.
In Frankreich verschwand 1952 die Gruppe Gauche Communiste de France (GCF), die 1945 gebildet worden war, und welche die Kontinuität mit den Positionen Bilan's (bei gleichzeitiger Integration programmatischer Positionen der Deutsch-Holländischen Linken) darstellte und 42 Ausgaben ihrer Zeitschrift Internationalisme herausbrachte. Abgesehen von den Leuten, die der Parti Communiste International verbunden waren und Le Prolétaire veröffentlichten, vertrat eine andere Gruppe bis Anfang der 1960er Jahre Klassenpositionen in der Zeitschrift Socialisme ou Barbarie (SouB). Aber diese aus dem Trotzkismus hervorgegangene Abspaltung nach dem 2. Weltkrieg gab schrittweise und ausdrücklich den Marxismus auf. Infolgedessen verschwand die Gruppe 1966.
Ende der 1950er und Anfang der 1960er Jahre hatten mehrere Spaltungen von Socialisme ou Barbarie insbesondere gegenüber der Frage des Marxismus zur Bildung von kleinen Gruppen geführt, welche sich der rätistischen Bewegung anschlossen, insbesondere gehörte dazu ICO (Informations et Correspondances Ouvrières).
Man könnte nach andere Gruppen in anderen Ländern erwähnen, aber kennzeichnend für die Lage der damaligen Strömungen, die in den 1950er und Anfang der 1960er Jahren kommunistische Positionen vertreten haben, war ihre große zahlenmäßige Schwäche. Ihre Publikationen zirkulierten eher in eingeweihten Kreisen, sie waren international isoliert. Darüber hinaus gab es theoretisch-programmatische Rückschritte, die entweder einfach zu ihrem Verschwinden oder zu einer sektenhaften Entwicklung geführt haben, wie das insbesondere bei der Parti Communiste International der Fall war, die sich als die einzige kommunistische Organisation auf der Welt betrachtete.
Das Wiedererstarken der revolutionären Positionen
Der Generalstreik 1968 in Frankreich, schließlich die verschiedenen massiven Bewegungen der Arbeiterklasse, über die wir im vorherigen Artikel berichtet haben, haben erneut die Idee der kommunistischen Revolution in zahlreichen Ländern auf die Tagesordnung gestellt. Die Lügen des Stalinismus, der sich als "kommunistisch" und "revolutionär" darstellte, zerbrachen überall. Daraus schlugen natürlich die Strömungen Kapital, die die UdSSR als "Mutterland des Sozialismus" bezeichneten, wie die maoistischen oder trotzkistischen Organisationen. 1968 erlebte die trotzkistische Bewegung, die sich auf ihren Kampf gegen Stalinismus berief, eine Art Neugeburt. Sie konnte damals aus dem Schatten der stalinistischen Parteien treten, der lange auf ihnen gelegen hatte. Ihr Wachstum war teilweise spektakulär, insbesondere in Frankreich, Belgien oder Großbritannien. Aber seit dem 2. Weltkrieg gehörte diese Strömung dem proletarischen Lager nicht mehr an, insbesondere weil sie "die Arbeitererrungenschaften der UdSSR" verteidigt hatte, d.h. sie hatte das von der UdSSR beherrschte imperialistische Lager verteidigt. Nachdem die Arbeiterstreiks, die sich seit Ende der 1960er Jahre entfalteten, die arbeiterfeindliche Rolle der stalinistischen Parteien und Gewerkschaften, der wahren Rolle der Wahlen und der Demokratie als Herrschaftsinstrument der Bourgeoisie offenbart hatten, wurden viele Leute dazu bewogen, sich mit politischen Strömungen zu befassen, die in der Vergangenheit die Rolle der Gewerkschaften und des Parlamentarismus am deutlichsten entblößt hatten und den Kampf gegen den Stalinismus am klarsten verkörperten – die Kommunistische Linke.
Nach Mai 1968 wurden die Schriften Trotzkis sehr weit verbreitet, aber auch die Pannekoek's, Gorter's (13) , Rosa Luxemburgs, die als eine der Ersten kurz vor ihrer Ermordung im Januar 1919 die bolschewistischen Genossen vor gewissen Gefahren gewarnt hatten, die die Revolution in Russland bedrohten.
Neue Gruppen sind in Erscheinung getreten, die sich mit der Erfahrung der Kommunistischen Linken befassten. Diejenigen, die verstanden, dass der Trotzkismus eine Art linker Flügel des Stalinismus geworden war, wandten sich eher dem Rätismus zu als der Italienischen Linken. Dafür gab es mehrere Gründe. Die Verwerfung der stalinistischen Parteien ist oft mit der Verwerfung des Begriffs der kommunistischen Partei selbst verbunden. Dies war gewissermaßen der Preis, den die Neuen, welche sich der proletarischen Revolution zuwandten, der stalinistischen Lüge von der Kontinuität zwischen Bolschewismus und Stalinismus, zwischen Lenin und Stalin, zu zahlen hatten Diese falsche Idee wurde im Übrigen zum Teil durch die Positionen der bordigistischen Strömung mit verbreitet. Sie war die einzige Strömung, die aus der Italienischen Linken hervorgegangen war, welche sich international ein wenig ausbreiten konnte, und sich auf den "Monolithismus" in ihren Reihen berief. Andererseits war dies eine Folge der Tatsache, dass die Strömungen, welche sich weiterhin auf diese Gruppierung beriefen, im Wesentlichen die Ereignisse des Mai 1968 nicht verstanden und sie verpasst haben, weil sie hinter ihnen nur einen Studentenprotest sahen und nicht die tiefer dahinter liegende historische Bedeutung.
Während gleichzeitig neue, vom Rätismus inspirierte Gruppen auftauchten, verbuchten die schon früher bestehenden Gruppen große Erfolge. Ihre Mitgliederzahlen nahmen spektakulär zu, während sie gleichzeitig zu einem politischen Bezugspunkt wurden. Dies traf insbesondere auf die Gruppe Informations et Correspondance Ouvrières (ICO= Arbeiterkorrespondenz und –informationen) zu, die aus einer Abspaltung von SouB 1958 hervorgegangen war, und die 1969 ein internationales Treffen in Brüssel organisierte, an der sich insbesondere Cohn-Bendit, Mattick (ein ehemaliges Mitglied der Deutschen Linken beteiligte, welcher in die USA ausgewandert war und dort verschiedene rätistische Zeitschriften veröffentlichte) und Cajo Brendel, Haupttriebkraft von Daad en Gedachte. Aber die Erfolge des "organisierten" Rätismus waren nur von kurzer Dauer. Die Gruppe ICO löste sich 1974 auf. Die holländischen Gruppen fielen zusammen, nachdem ihre Haupttriebkräfte ihre Aktivitäten einstellten
In Großbritannien fiel die Gruppe Solidarity, die von den Positionen von Socialisme ou Barbarie inspiriert wurde, und einen ähnlichen Erfolg wie ICO hatte, nach einer Reihe von Spaltungen 1981 auseinander (obwohl ihre Londoner Sektion die Zeitschrift noch bis 1992 veröffentlichte). In Skandinavien haben die rätistischen Gruppen, die sich nach 1968 entwickelt haben, eine Konferenz im September 1977 in Oslo organisiert – aber dieser folgten keine weiteren Schritte.
Letztendlich hat sich die Strömung in den 1970er Jahren am weitesten entwickelt, die mit den Positionen von Bordiga (der im Juli 1970 starb) verbunden ist. Ihre Mitgliedschaft stieg damals insbesondere nach dem Ausbruch von Krisen bei linksextremen Gruppen (insbesondere bei maoistischen Gruppen). 1980 war die Internationale Kommunistische Partei die Organisation, welche sich auf die Kommunistische Linke berief, mit dem größten Einfluss auf internationaler Ebene. Aber diese "Öffnung" der bordigistischen Strömung für Leute, die sehr stark von der extremen Linken geprägt waren, führte 1982 zu ihrem Zusammenbruch. Seitdem besteht sie weiter als eine Reihe von kleinen, auf sich beschränkten Sekten.
Der Anfang der IKS
Der bedeutendste langfristige Ausdruck dieses wieder erwachten Interesses an den Positionen der Kommunistischen Linken war unsere eigene Organisation (14). Diese wurde im Wesentlichen vor gerade 40 Jahren gegründet, im Juli 1968 in Toulouse, als ein kleiner Kern von Leuten, der ein Jahr zuvor einen Diskussionskreis um einen Genossen R.V. gegründet hatte, eine erste Prinzipienerklärung verabschiedete. Dieser Genosse R.V. hatte seine ersten politischen Erfahrungen in der Gruppe Internacionalismo in Venezuela gesammelt. Diese Gruppe war 1964 von dem Genossen MC gegründet worden, der die Haupttriebkraft bei der Gauche Communiste de France (Kommunistische Linke Frankreichs – GCF – 1944 52) gewesen war, nachdem er zuvor von 1938 an der Italienischen Fraktion der Kommunistischen Linken angehört hatte, und der schon seit 1919 Militant gewesen war (im Alter von 12 Jahren). Zunächst war er in der Kommunistischen Partei Palästinas, dann in der Französischen Kommunistischen Partei aktiv gewesen. Während des Generalstreiks im Mai 1968 hatten Mitglieder des Diskussionszirkels mehrere Flugblätter mit dem Namen "Bewegung für den Aufbau von Arbeiterräten" (MICO) verteilt. Sie hatten mit anderen Leuten diskutiert, bevor sie dann im Dezember 1968 die Gruppe Révolution Internationale gründeten. Diese Gruppe hatte Kontakt aufgenommen mit zwei anderen Gruppen, die der rätekommunistischen Bewegung angehörten – Rätekommunistische Organisation Clermont-Ferrand und "Rätekommunistische Hefte", die in Marseille ansässig war. Mit diesen beiden Gruppen wurden dann weitere Diskussionen geführt.
Schließlich schlossen sich diese drei Gruppen 1972 zusammen, um die spätere Sektion der IKS in Frankreich, Révolution Internationale, zu gründen, welche dann mit der Veröffentlichung der Zeitschrift mit dem gleichen Namen (neue Serie) begann. In Fortsetzung der Politik von Internacionalismo, der GCF und Bilan's, nahm Révolution Internationale Diskussionen mit verschiedenen Gruppen auf, die ebenfalls nach 1968 aufgetaucht waren, insbesondere in den USA (Internationalism). 1972 schickte Internationalism ein Schreiben an ca. 20 Gruppen, die sich auf die Kommunistische Linke beriefen, und rief zur Schaffung eines Netzes zum Austausch und der internationalen Debatte auf. Révolution Internationale reagierte darauf sehr positiv, und schlug dabei als Arbeitsperspektive die Organisierung einer internationalen Konferenz vor. Die anderen Gruppen, welche positiv reagierten, gehörten alle der rätekommunistischen Bewegung an. Die Gruppen, welche sich an die Italienische Linke anlehnten, stellten sich entweder taub oder hielten diese Initiative für verfrüht. Auf der Grundlage dieser Initiative fanden zwischen 1973 und 1974 mehrere Treffen in England und Frankreich statt, an denen sich insbesondere aus Großbritannien (World Revolution, Revolutionary Perspectives und Workers' Voice) beteiligten, die ersten beiden Gruppen waren aus einer Abspaltung von Solidarity hervorgegangen und die letzte aus einer Abspaltung von den Trotzkisten).
Schließlich führte dieser Zyklus von Treffen im Januar 1975 zu einer Konferenz, bei der die Gruppen, welche die gleiche politische Orientierung teilten - Internacionalismo, Révolution Internationale, Internationalism, World Revolution, Rivoluzione Internazionale (Italien) und Accion Proletaria (Spanien) beschlossen, sich zur Internationalen Kommunistischen Strömung zusammenzuschließen.
Die IKS beschloss dann die Fortsetzung der Politik der Kontaktaufnahme und Diskussionen mit anderen Gruppen der Kommunistischen Linken. So nahm die IKS an den Konferenzen in Oslo 1977 (mit Revolutionary Perspectives) teil und antwortete positiv auf die 1976 von Battaglia Comunista vorgeschlagene Initiative zur Abhaltung einer internationalen Konferenz von Gruppen der Kommunistischen Linken.
Die drei danach stattgefundenen Konferenzen – 1977 in Mailand, 1978 in Paris, 1980 in Paris – stießen auf ein wachsendes Interesse unter den Leuten, die sich auf die Kommunistische Linke beriefen, aber die Entscheidung Battaglia Comunista's und der Communist Workers' Organisation (die aus einem Zusammenschluss von Revolutionary Perspectives und Workers' Voice in Großbritannien hervorgegangen war), die IKS aus dem Diskussionsprozess auszuschließen, bedeutete dann auch das Ende der Konferenzen (15) . Der sektiererische Rückzug (zumindest die Abgrenzung gegenüber der IKS) von Battaglia Comunista und der Communist Workers’ Organisation (die sich 1984 im Internationalen Büro für die Revolutionäre Partei – IBRP zusammenschlossen) zeigte, dass die Initialzündung durch das historische Wiederauftauchen der Arbeiterklasse im Mai 1968, die zur Bildung der Kommunistischen Linken geführt hatte, nun zu Ende gekommen war.
Aber trotz der Schwierigkeiten, auf die die Arbeiterklasse während der letzten Jahrzehnte gestoßen ist, insbesondere aufgrund der ideologischen Kampagnen über den "Tod des Kommunismus" nach dem Zusammenbruch der stalinistischen Regime, hat es die Weltbourgeoisie nicht geschafft, der Arbeiterklasse eine entscheidende Niederlage beizufügen. Dies kommt durch die Tatsache zum Ausdruck, dass die Kommunistische Linke (die hauptsächlich durch das IBRP (16) und vor allem die IKS verkörpert wird) ihre Positionen aufrechterhalten hat und heute auf ein wachsendes Interesse bei den Leuten stößt, die infolge des langsamen Wiedererstarkens des Klassenkampfes seit 2003 nach einer revolutionären Perspektive suchen.
Fabienne, 6. Juli 2008
(1) Kommunistische Partei Frankreichs
(2) CGT=Confédération générale du Travail: Sie ist die stärkste Gewerkschaftszentrale, insbesondere im Industriebereich, im Transportwesen und unter den Beamten. Sie wird von der KPF kontrolliert.
(3) Confédération francaise démocratique du Travail. Dieser Gewerkschaftsverband ist christlichen Ursprungs aber Anfang der 1960er Jahre verwarf sie ihren Bezug auf das Christentum und sie wurde seitdem stark von der Sozialistischen Partei beeinflusst sowie von einer kleinen sozialistischen Partei (PSU) , die seitdem eingegangen ist.
(4) Fernsehberichterstatter, der sehr auf „Ausgleich“ bedacht war
(5) Sportkommentator mit zügellosem Chauvinismus
(6) Am Morgen nach der Rede weigerten sich die Beschäftigten der Kommunalbetriebe an vielen Orten, das Referendum zu organisieren. Auch wussten die Behörden nicht, wo sie die Stimmzettel drucken sollten. Die staatliche Druckerei wurde bestreikt und die nicht streikenden privaten Druckereien verweigerten die Annahme des Auftrags. Ihre Arbeitgeber wollte keine zusätzlichen Scherereien mit ihren Arbeitern haben
(7) Georges Séguy war ebenso Mitglied des Politbüros der KPF.
(8) Man erfuhr später, dass Chirac, Staatssekretär im Sozialministerium ebenso Krasucki (auf einem Speicher) getroffen hat. Dieser war damals die Nummer 2 der CGT.
(9) Eine geheime bewaffnete Organisation: eine geheime Militär- und Partisanenorganisation, die für den Verbleib Frankreichs in Algerien kämpfen wollte. Anfang der 1960er Jahre verübte sie terroristische Attentate und sie versuchte gar de Gaulle umzubringen.
(10) Electricité de France
(11) CRS=Compagnies républicaines de Sécurité: nationale Polizeikräfte, spezialisiert auf die Niederschlagung von Straßendemonstrationen.
(12) Kräfte der Nationalgendarmerie (d.h. der Armee), die die gleiche Rolle wie die CRS haben
(13) Die beiden Haupttheoretiker der Holländischen Linken
(14) Eine umfassendere Darstellung der Geschichte der IKS findet man in "Aufbau der revolutionären Organisation: 20 Jahre IKS – Internationale Revue Nr. 16 – und "30 Jahre IKS: Von Vergangenheit für die Zukunft lernen" -Internationale Revue Nr. 37
(15) Zu den Konferenzen siehe unseren Artikel: „Die internationalen Konferenzen der Kommunistischen Linken (1976-1980) – Lehren einer Erfahrung für das proletarische Milieu“ – Internationale Revue Nr.38
(16) Jegliche Entwicklung des IBRPs im Vergleich zur IKS ist hauptsächlich auf ihr Sektierertum sowie seine opportunistische Umgruppierungspolitik zurückzuführen (wodurch sie oft schon auf Sand gebaut hat). Siehe dazu unseren Artikel „Eine opportunistische Politik der Umgruppierung führt lediglich zu „Fehlgeburtern“, Internationale Revue Nr. 36))
Aktuelles und Laufendes:
- Mai 68 [96]
- Arbeiterkämpfe 1968 [99]
- Studentenrevolte Mai 68 [100]
Politische Strömungen und Verweise:
- Trotzkismus [101]
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Historische Ereignisse:
- Mai 68 [98]
- Arbeiterkämpfe 1968 [102]
- Studentenrevolte Mai 68 [103]
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Mai 68: Das internationale Wiederauftauchen der revolutionären Kräfte /5. Teil
- 3373 reads
Unser letzter Artikel zu Mai 68 endete mit den folgenden Sätzen…
«So liegt die grundlegende historische Bedeutung des Mai 68 weder in den „französischen Besonderheiten“ noch in der Studentenrevolte, ebenso wenig in der heute so viel gepriesenen ‚Revolution der Sitten’, sondern darin, dass die Weltarbeiterklasse die Konterrevolution überwunden hatte und in einen neuen historischen Zeitraum von Zusammenstößen mit der kapitalistischen Ordnung eingetreten war. Diese neue Periode zeichnet sich ebenso dadurch aus, dass sich politisch-proletarische Strömungen, welche von der Konterrevolution praktisch eliminiert oder zum Schweigen gebracht worden waren, neu entwickelt haben, darunter die IKS.»
Darauf werden wir in einem weiteren Artikel eingehen.
Die Schäden der Konterrevolution in den Reihen der Kommunisten
Anfang des 20. Jahrhunderts führte das Proletariat während und nach dem 1. Weltkrieg gigantische Kämpfe, in denen der Kapitalismus beinahe überwunden worden wäre. 1917 wurde die bürgerliche Macht in Russland gestürzt. Zwischen 1918-1923 gab es in dem wichtigsten Land Europas, in Deutschland, mehrere Anläufe zur Überwindung des Kapitalismus. Diese revolutionäre Welle fand in allen Winkeln der Erde ihren Widerhall, d.h. überall wo es eine entwickelte Arbeiterklasse gab, von Italien bis Kanada, von Ungarn bis China.
Aber der Weltbourgeoisie gelang es, diese gigantische Bewegung der Arbeiterklasse einzudämmen, und sie blieb nicht dabei stehen. Sie brach die schrecklichste Konterrevolution in der Geschichte der Arbeiterbewegung vom Zaun. Diese Konterrevolution entwickelte sich in Gestalt einer unvorstellbaren Barbarei, deren bedeutendsten Ausdrücke der Stalinismus und Nationalsozialismus waren. Diese wüteten besonders stark dort, wo die Revolution am weitesten gegangen war, nämlich in Russland und in Deutschland.
In diesem Zusammenhang verwandelten sich die kommunistischen Parteien, welche in der revolutionären Welle von Kämpfen an der Spitze gestanden hatten, zu Parteien der Konterrevolution.
Genau so wie der Verrat der sozialistischen Parteien 1914 in Anbetracht des imperialistischen Kriegs die Bildung von Strömungen hervorgerufen hatte, die in den Reihen der sozialistischen Parteien die proletarischen Prinzipien weiter verteidigen wollten, und welche dann auch bei der Gründung der kommunistischen Parteien mitwirkten, hatte der Verrat derselben zur Entstehung von linkskommunistischen Fraktionen geführt, welche wirklich kommunistische Positionen weiter verteidigen wollten. Aber während diejenigen, welche innerhalb der sozialistischen Parteien gegen deren opportunistisches Abgleiten und deren Verrat ankämpften, an Stärke und Einfluss in der Arbeiterklasse gewannen, so dass sie nach der Russischen Revolution sogar eine neue Internationale gründen konnten, verlief die Entwicklung der linken Strömungen, die aus den kommunistischen Parteien hervorgingen, aufgrund des zunehmenden Gewichtes der Konterrevolution anders. Während anfänglich eine Mehrheit der Mitglieder in den Parteien in Deutschland und Italien tätig war, verloren diese Strömungen schrittweise ihren Einfluss in der Arbeiterklasse und den größten Teil ihrer Mitglieder. Oder sie gingen unter durch eine Zersplitterung in eine Reihe von kleinen Gruppen, wie in Deutschland, noch bevor das Hitler-Regime die letzten Militanten auslöschte oder sie ins Exil zwang.
Während der 1930er Jahre zählten neben der Strömung um Trotzki, welche immer mehr vom Opportunismus zerfressen wurde, die Gruppen, welche die revolutionären Positionen weiterhin entschlossen verteidigten wie die Gruppe Internationaler Kommunisten (GIK) in Holland (die sich auf den "Rätekommunismus" berief und die Notwendigkeit einer proletarischen Partei verwarf) und die Linksfraktion der Kommunistischen Partei Italiens (welche die Zeitschrift Bilan veröffentlichte) nur einige wenige Dutzend Mitglieder. Diese konnten keinen Einfluss auf die Arbeiterkämpfe ausüben.
Im Gegensatz zum 1. Weltkrieg hat der 2. Weltkrieg keine Umkehrung des Kräfteverhältnisses zwischen Proletariat und Bourgeoisie ermöglicht. Ganz im Gegenteil. Durch die historische Erfahrung klüger geworden und dank der wertvollen Unterstützung der stalinistischen Parteien setzte die Bourgeoisie alles daran, jegliche neue Regungen der Arbeiterklasse im Keim zu ersticken. In der demokratischen Euphorie der "Befreiung" standen die Gruppen der Kommunistischen Linken noch isolierter da als in den 1930er Jahren. In Holland löste der Communistenbond Spartacus den GIC bei der Verteidigung kommunistischer Positionen ab. Diese wurden ebenfalls ab 1965 von der Gruppe Daad en Gedachte, einer Abspaltung vom Bond, vertreten. Diese beiden Gruppen veröffentlichten viele Texte, obwohl sie durch ihre rätekommunistische Position behindert waren, welche die Rolle einer Avantgardeorganisation für die Arbeiterklasse verwarf. Aber das größte Hindernis war das ideologische Gewicht der Konterrevolution. Dies traf auch auf Italien zu, wo die Bildung der Partito Comunista Internazionalista (die Battaglia Comunista und Prometeo veröffentlichte) im Jahre 1945 um Damen und Bordiga die Versprechen nicht hielt, welche ihre Mitglieder sich erhofft hatten. Während diese Organisation bei ihrer Gründung über ca. 3.000 Mitglieder verfügte, wurde sie infolge von Demoralisierung und Spaltungen – insbesondere nach der von Bordiga betriebenen Spaltung 1952, die zur Bildung der Parti Communiste International führte (sie veröffentlichte Programma Comunista), immer mehr geschwächt. Einer der Gründe für die Spaltungen und Schwächung liegt in der Aufgabe einer ganzen Reihe von Errungenschaften, die von Bilan in den 1930er Jahren erzielt worden waren.
In Frankreich verschwand 1952 die Gruppe Gauche Communiste de France (GCF), die 1945 gebildet worden war, und welche die Kontinuität mit den Positionen Bilan's (bei gleichzeitiger Integration programmatischer Positionen der Deutsch-Holländischen Linken) darstellte und 42 Ausgaben ihrer Zeitschrift Internationalisme herausbrachte. Abgesehen von den Leuten, die der Parti Communiste International verbunden waren und Le Prolétaire veröffentlichten, vertrat eine andere Gruppe bis Anfang der 1960er Jahre Klassenpositionen in der Zeitschrift Socialisme ou Barbarie (SouB). Aber diese aus dem Trotzkismus hervorgegangene Abspaltung nach dem 2. Weltkrieg gab schrittweise und ausdrücklich den Marxismus auf. Infolgedessen verschwand die Gruppe 1966.
Man könnte nach andere Gruppen in anderen Ländern erwähnen, aber kennzeichnend für die Lage der damaligen Strömungen, die in den 1950er und Anfang der 1960er Jahren kommunistische Positionen vertreten haben, war ihre große zahlenmäßige Schwäche. Ihre Publikationen zirkulierten eher in eingeweihten Kreisen, sie waren international isoliert. Darüber hinaus gab es theoretisch-programmatische Rückschritte, die entweder einfach zu ihrem Verschwinden oder zu einer sektenhaften Entwicklung geführt haben, wie das insbesondere bei der Parti Communiste International der Fall war, die sich als die einzige kommunistische Organisation auf der Welt betrachtete.
Das Wiedererstarken der revolutionären Positionen
Der Generalstreik 1968 in Frankreich, schließlich die verschiedenen massiven Bewegungen der Arbeiterklasse, über die wir im vorherigen Artikel berichtet haben, haben erneut die Idee der kommunistischen Revolution in zahlreichen Ländern auf die Tagesordnung gestellt. Die Lügen des Stalinismus, der sich als "kommunistisch" und "revolutionär" darstellte, zerbrachen überall. Daraus schlugen natürlich die Strömungen Kapital, die die UdSSR als "Mutterland des Sozialismus" bezeichneten, wie die maoistischen oder trotzkistischen Organisationen. 1968 erlebte die trotzkistische Bewegung, die sich auf ihren Kampf gegen Stalinismus berief, eine Art Neugeburt. Sie konnte damals aus dem Schatten der stalinistischen Parteien treten, der lange auf ihnen gelegen hatte. Ihr Wachstum war teilweise spektakulär, insbesondere in Frankreich, Belgien oder Großbritannien. Aber seit dem 2. Weltkrieg gehörte diese Strömung dem proletarischen Lager nicht mehr an, insbesondere weil sie "die Arbeitererrungenschaften der UdSSR" verteidigt hatte, d.h. sie hatte das von der UdSSR beherrschte imperialistische Lager verteidigt. Nachdem die Arbeiterstreiks, die sich seit Ende der 1960er Jahre entfalteten, die arbeiterfeindliche Rolle der stalinistischen Parteien und Gewerkschaften, der wahren Rolle der Wahlen und der Demokratie als Herrschaftsinstrument der Bourgeoisie offenbart hatten, wurden viele Leute dazu bewogen, sich mit politischen Strömungen zu befassen, die in der Vergangenheit die Rolle der Gewerkschaften und des Parlamentarismus am deutlichsten entblößt hatten und den Kampf gegen den Stalinismus am klarsten verkörperten – die Kommunistische Linke.
Nach Mai 1968 wurden die Schriften Trotzkis sehr weit verbreitet, aber auch die Pannekoek's, Gorter's, Rosa Luxemburgs, die als eine der Ersten kurz vor ihrer Ermordung im Januar 1919 die bolschewistischen Genossen vor gewissen Gefahren gewarnt hatten, die die Revolution in Russland bedrohten.
Neue Gruppen sind in Erscheinung getreten, die sich mit der Erfahrung der Kommunistischen Linken befassten. Diejenigen, die verstanden, dass der Trotzkismus eine Art linker Flügel des Stalinismus geworden war, wandten sich eher dem Rätismus zu als der Italienischen Linken. Dafür gab es mehrere Gründe. Die Verwerfung der stalinistischen Parteien ist oft mit der Verwerfung des Begriffs der kommunistischen Partei selbst verbunden. Auch trug die Tatsache, dass die bordigistische Strömung (sie war die einzige Strömung, die aus der Italienischen Linken hervorgegangen war, welche sich international ein wenig ausbreiten konnte) die Idee der Machtergreifung durch die kommunistische Partei vertrat und sich auf den "Monolithismus" in ihren Reihen berief, dazu bei, dass das Misstrauen gegenüber der historischen Strömung der Italienischen Linken zunahm. Andererseits war dies eine Folge der Tatsache, dass die Strömungen, welche sich weiterhin auf diese Gruppierung beriefen, im Wesentlichen die Ereignisse des Mai 1968 nicht verstanden und sie verpasst haben, weil sie hinter ihnen nur einen Studentenprotest sahen und nicht die tiefer dahinter liegende historische Bedeutung.
Während gleichzeitig neue, vom Rätismus inspirierte Gruppen auftauchten, verbuchten die schon früher bestehenden Gruppen große Erfolge. Ihre Mitgliederzahlen nahmen spektakulär zu, während sie gleichzeitig zu einem politischen Bezugspunkt wurden. Dies traf insbesondere auf die Gruppe Informations et Correspondance Ouvrières (ICO= Arbeiterkorrespondenz und –informationen) zu, die aus einer Abspaltung von SouB 1958 hervorgegangen war, und die 1969 ein internationales Treffen in Brüssel organisierte, an der sich insbesondere Cohn-Bendit, Mattick (ein ehemaliges Mitglied der Deutschen Linken beteiligte, welcher in die USA ausgewandert war und dort verschiedene rätistische Zeitschriften veröffentlichte) und Cajo Brendel, Haupttriebkraft von Daad en Gedachte. Aber die Erfolge des "organisierten" Rätismus waren nur von kurzer Dauer. Die Gruppe ICO löste sich 1974 auf. Die holländischen Gruppen fielen zusammen, nachdem ihre Haupttriebkräfte ihre Aktivitäten einstellten
In Großbritannien fiel die Gruppe Solidarity, die von den Positionen von Socialisme ou Barbarie inspiriert wurde, und einen ähnlichen Erfolg wie ICO hatte, nach einer Reihe von Spaltungen 1981 auseinander (obwohl ihre Londoner Sektion die Zeitschrift noch bis 1992 veröffentlichte). In Skandinavien haben die rätistischen Gruppen, die sich nach 1968 entwickelt haben, eine Konferenz im September 1977 in Oslo organisiert – aber dieser folgten keine weiteren Schritte.
Letztendlich hat sich die Strömung in den 1970er Jahren am weitesten entwickelt, die mit den Positionen von Bordiga (der im Juli 1970 starb) verbunden ist. Ihre Mitgliedschaft stieg damals insbesondere nach dem Ausbruch von Krisen bei linksextremen Gruppen (insbesondere bei maoistischen Gruppen). 1980 war die Internationale Kommunistische Partei die Organisation, welche sich auf die Kommunistische Linke berief, mit dem größten Einfluss auf internationaler Ebene. Aber diese "Öffnung" der bordigistischen Strömung für Leute, die sehr stark von der extremen Linken geprägt waren, führte 1982 zu ihrem Zusammenbruch. Seitdem besteht sie weiter als eine Reihe von kleinen, auf sich beschränkten Sekten.
Der Anfang der IKS
Der bedeutendste langfristige Ausdruck dieses wieder erwachten Interesses an den Positionen der Kommunistischen Linken war unsere eigene Organisation (3). Diese wurde im Wesentlichen vor gerade 40 Jahren gegründet, im Juli 1968 in Toulouse, als ein kleiner Kern von Leuten, der ein Jahr zuvor einen Diskussionskreis um einen Genossen R.V. gegründet hatte, eine erste Prinzipienerklärung verabschiedete. Dieser Genosse R.V. hatte seine ersten politischen Erfahrungen in der Gruppe Internacionalismo in Venezuela gesammelt. Diese Gruppe war 1964 von dem Genossen MC gegründet worden, der die Haupttriebkraft bei der Gauche Communiste de France (Kommunistische Linke Frankreichs – GCF – 1944 52) gewesen war, nachdem er zuvor von 1938 an der Italienischen Fraktion der Kommunistischen Linken angehört hatte, und der schon seit 1919 Militant gewesen war (im Alter von 12 Jahren). Zunächst war er in der Kommunistischen Partei Palästinas, dann in der Französischen Kommunistischen Partei aktiv gewesen. Während des Generalstreiks im Mai 1968 hatten Mitglieder des Diskussionszirkels mehrere Flugblätter mit dem Namen "Bewegung für den Aufbau von Arbeiterräten" (MICO) verteilt. Sie hatten mit anderen Leuten diskutiert, bevor sie dann im Dezember 1968 die Gruppe Révolution Internationale gründeten. Diese Gruppe hatte Kontakt aufgenommen mit zwei anderen Gruppen, die der rätekommunistischen Bewegung angehörten – Rätekommunistische Organisation Clermont-Ferrand und "Rätekommunistische Hefte", die in Marseille ansässig war. Mit diesen beiden Gruppen wurden dann weitere Diskussionen geführt.
Schließlich schlossen sich diese drei Gruppen 1972 zusammen, um die spätere Sektion der IKS in Frankreich, Révolution Internationale, zu gründen, welche dann mit der Veröffentlichung der Zeitschrift mit dem gleichen Namen (neue Serie) begann. In Fortsetzung der Politik von Internacionalismo, der GCF und Bilan's, nahm Révolution Internationale Diskussionen mit verschiedenen Gruppen auf, die ebenfalls nach 1968 aufgetaucht waren, insbesondere in den USA (Internationalism). 1972 schickte Internationalism ein Schreiben an ca. 20 Gruppen, die sich auf die Kommunistische Linke beriefen, und rief zur Schaffung eines Netzes zum Austausch und der internationalen Debatte auf. Révolution Internationale reagierte darauf sehr positiv, und schlug dabei als Arbeitsperspektive die Organisierung einer internationalen Konferenz vor. Die anderen Gruppen, welche positiv reagierten, gehörten alle der rätekommunistischen Bewegung an. Die Gruppen, welche sich an die Italienische Linke anlehnten, stellten sich entweder taub oder hielten diese Initiative für verfrüht. Auf der Grundlage dieser Initiative fanden zwischen 1973 und 1974 mehrere Treffen in England und Frankreich statt, an denen sich insbesondere aus Großbritannien (World Revolution, Revolutionary Perspectives und Workers' Voice) beteiligten, die ersten beiden Gruppen waren aus einer Abspaltung von Solidarity hervorgegangen und die letzte aus einer Abspaltung von den Trotzkisten).
Schließlich führte dieser Zyklus von Treffen im Januar 1975 zu einer Konferenz, bei der die Gruppen, welche die gleiche politische Orientierung teilten - Internacionalismo, Révolution Internationale, Internationalism, World Revolution, Rivoluzione Internazionale (Italien) und Accion Proletaria (Spanien) beschlossen, sich zur Internationalen Kommunistischen Strömung zusammenzuschließen.
Die IKS beschloss dann die Fortsetzung der Politik der Kontaktaufnahme und Diskussionen mit anderen Gruppen der Kommunistischen Linken. So nahm die IKS an den Konferenzen in Oslo 1977 (mit Revolutionary Perspectives) teil und antwortete positiv auf die 1976 von Battaglia Comunista vorgeschlagene Initiative zur Abhaltung einer internationalen Konferenz von Gruppen der Kommunistischen Linken.
Die drei danach stattgefundenen Konferenzen – 1977 in Mailand, 1978 in Paris, 1980 in Paris – stießen auf ein wachsendes Interesse unter den Leuten, die sich auf die Kommunistische Linke beriefen, aber die Entscheidung Battaglia Comunista's und der Communist Workers' Organisation (die aus einem Zusammenschluss von Revolutionary Perspectives und Workers' Voice in Großbritannien hervorgegangen war), die IKS aus dem Diskussionsprozess auszuschließen, bedeutete dann auch das Ende der Konferenzen. Der sektiererische Rückzug (zumindest die Abgrenzung gegenüber der IKS) von Battaglia Comunista und der Communist Workers’ Organisation (die sich 1984 im Internationalen Büro für die Revolutionäre Partei – IBRP zusammenschlossen) zeigte, dass die Initialzündung durch das historische Wiederauftauchen der Arbeiterklasse im Mai 1968, die zur Bildung der Kommunistischen Linken geführt hatte, nun zu Ende gekommen war.
Aber trotz der Schwierigkeiten, auf die die Arbeiterklasse während der letzten Jahrzehnte gestoßen ist, insbesondere aufgrund der ideologischen Kampagnen über den "Tod des Kommunismus" nach dem Zusammenbruch der stalinistischen Regime, hat es die Weltbourgeoisie nicht geschafft, der Arbeiterklasse eine entscheidende Niederlage beizufügen. Dies kommt durch die Tatsache zum Ausdruck, dass die Kommunistische Linke (die hauptsächlich durch das IBRP und vor allem die IKS verkörpert wird) ihre Positionen aufrechterhalten hat und heute auf ein wachsendes Interesse bei den Leuten stößt, die infolge des langsamen Wiedererstarkens des Klassenkampfes seit 2003 nach einer revolutionären Perspektive suchen.
Fabienne, 6. Juli 2008
(1) Mai 68 – 4. Teil. « Die internationale Bedeutung des Generalstreiks in Frankreich“. Weltrevolution Nr. 149
(2) Die beiden Haupttheoretiker der Holländischen Linken
(3) Eine umfassendere Darstellung der Geschichte der IKS findet man in "Aufbau der revolutionären Organisation: 20 Jahre IKS – Internationale Revue Nr. 16 – und "30 Jahre IKS: Von Vergangenheit für die Zukunft lernen" -Internationale Revue Nr. 37
Politische Strömungen und Verweise:
- Kommunistische Linke [70]
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Historische Ereignisse:
- Mai 1968 [94]
Nahrungskrise, Hungerrevolten: Nur der Klassenkampf des Proletariats kann dem Hunger ein Ende bereiten
- 3140 reads
In der Nr. 132 der International Review (engl. Ausgabe, Nr. 41 deutsche Ausgabe) haben wir ausführlich über die Entwicklung der Arbeiterkämpfe berichtet, die gleichzeitig auf der Welt ausgebrochen sind als Reaktion auf die Zuspitzung der Krise und der Angriffe gegen die Lebensbedingungen der Arbeiter. Die neuen Erschütterungen der Weltwirtschaft, die Geißel der Inflation und der Nahrungskrise werden das Elend der verarmtesten Teile der Bevölkerung in den peripheren Ländern nur noch verschärfen. Diese Entwicklung, welche die Sackgasse offenbart, in welcher das kapitalistische System steckt, hat in zahlreichen Ländern Hungerrevolten ausgelöst, während sich gleichzeitig Arbeiterkämpfe entfalteten, in denen für Lohnerhöhungen als Reaktion auf die Preisschübe bei Grundnahrungsmitteln gekämpft wurde. Aufgrund der Zuspitzung der Krise werden die Hungerrevolten und die Arbeiterkämpfe immer mehr zunehmen und gleichzeitig stattfinden. Diese Revolten gegen die Misere sind auf die gleiche Ursache zurückzuführen: Die Krise der kapitalistischen Gesellschaft, ihre Unfähigkeit, der Menschheit eine Zukunft anzubieten oder sogar nur ein einfaches Überleben eines Teils der Gesellschaft zu ermöglichen. Aber sie verfügen nicht über das gleiche Potenzial. Nur der Kampf der Arbeiterklasse auf ihrem eigenen Boden kann dem Elend, dem sich ausbreitenden Hunger ein Ende setzen – dazu ist aber die Überwindung des Kapitalismus und die Errichtung einer neuen Gesellschaft erforderlich, in der es keine Not, keinen Hunger und keine Kriege geben wird.
Die Nahrungskrise offenbart den Bankrott des Kapitalismus
Der gemeinsame Nenner der Hungerrevolten, die seit Anfang des Jahres an mehreren Orten auf der Welt ausgebrochen sind, sind die Preisschübe der Nahrungsmittel oder ihr Mangel. Darunter haben vor allem die armen Bevölkerungsteile und die Arbeiter in zahlreichen Ländern brutal zu leiden. Einige Zahlen belegen dies aufschlussreich: Der Maispreis hat sich seit 2007 vervierfacht, der Weizenpreis hat sich seit Anfang 2008 verdoppelt und die Nahrungsmittelpreise sind allgemein um 6o% während der letzten beiden Jahre in den ärmeren Ländern gestiegen. Ein Zeichen der Zeit - die zerstörerischen Wirkungen der weltweiten Preissteigerungen von 30-50% der Lebensmittel haben nicht nur die ärmsten Bevölkerungsteile sondern auch die 'reichsten' Länder getroffen. So können zum Beispiel in den USA, der weltgrößten Wirtschaftsmacht der Erde, 28 Millionen Amerikaner nicht mehr ohne die Lebensmittelverteilung durch die Kommunen und Bundesstaaten auskommen.
Jetzt schon sterben jeden Tag auf der Welt 100.000 Menschen an Hunger, ein Kind unter 10 Jahren stirbt alle 5 Sekunden, 842 Millionen Menschen leiden unter schwerer chronischer Unterernährung; viele von ihnen sind dadurch erwerbsunfähig. Und jetzt schon kämpfen zwei von sechs Milliarden Menschen (d.h. ein Drittel der Bevölkerung) um ihr tägliches Überleben aufgrund der ansteigenden Nahrungsmittelpreise.
Die Experten der herrschenden Klasse selbst – IWF, FAO, UNO, G 8 usw. – haben angekündigt, dass dies kein vorübergehender Misstand sei, und dass er nicht nur chronisch wird, sondern sich weiter zuspitzen wird infolge der schwindelerregenden Preissteigerungen der Grundnahrungsmittel und deren Verknappung im Verhältnis zu den Bedürfnissen der Menschen auf der Erde. Während die Erde eigentlich 12 Milliarden Menschen ernähren könnte, sterben in Wirklichkeit Millionen von Menschen an Hunger aufgrund der Gesetze des Kapitalismus, der überall auf der Welt das herrschende System geworden ist. Die Produktion in diesem System dient nicht der Bedürfnisbefriedigung der Menschen, sondern der Profitmaximierung. Dieses System ist völlig unfähig, die Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen. Übrigens bewegen sich alle Erklärungsansätze der gegenwärtigen Nahrungskrise in die gleiche Richtung - es handelt sich um eine Produktion, die den blinden und irrationalen Gesetzen des Systems unterworfen ist:
1. Der schwindelerregende Anstieg der Ölpreise, der zu erhöhten Transportkosten führt, sowie die erhöhte Nahrungsmittelproduktion usw. Dieses Phänomen ist eine für das System typische Absurdität. Sie wohnt dem System inne und kommt nicht irgendwie von Außen.
2. Der große Anstieg der Lebensmittelnachfrage, die auf eine gewisse Erhöhung der Kaufkraft der Mittelklasse und neuer Nahrungsgewohnheiten in den so genannten 'Schwellenländern' wie Indien oder China zurückzuführen sei. Selbst wenn es ein Fünkchen Wahrheit in dieser Erklärung gibt, offenbart sie dennoch den wahren "wirtschaftlichen Fortschritt", der durch die Erhöhung der Kaufkraft einiger Menschen dazu führt, dass Millionen andere Menschen zum Hunger verdammt sind aufgrund des daraus entstehenden gegenwärtigen Nahrungsmittelmangels auf dem Weltmarkt.
3. Die frenetische Spekulation mit Agrarprodukten. Auch dies ist eine reine kapitalistische Ausgeburt; ihr ökonomisches Gewicht ist um so schwerwiegender, da die reale Wirtschaft in immer größeren Schwierigkeiten steckt. Einige Beispiele: Die Weizenvorräte haben ihren niedrigsten Stand seit 30 Jahren erreicht. Der Spekulationswahnsinn der Anleger hat nunmehr Agrarprodukte im Visier mit der Hoffnung, dass man in diesem Bereich mehr abzocken kann, da dies seit der Immobilienkrise in jener Branche nicht mehr möglich ist. An der Chicagoer Börse "ist der Handel mit Soja, Weizen, Mais, Schweinefleisch und gar mit Lebendvieh" um 20% im ersten Quartal dieses Jahres gestiegen (Le Figaro, 15.4.08).
4. Der aufblühende Markt der Biotreibstoffe, der zudem noch angetrieben wird von den explodierenden Ölpreisen, ist ebenso zur Zielscheibe frenetischer Spekulation geworden. Diese neue Gewinnquelle ist für das Wachstum des Biotreibstoffs auf Kosten der Pflanzen, die der Ernährung dienen, verantwortlich. Viele Länder, in denen bislang Grundnahrungsmittel angebaut wurden, haben ihre Anbauflächen umgestellt, um nunmehr Pflanzen für Biotreibstoff zu züchten. Unter dem Vorwand gegen die Klimaerwärmung anzukämpfen, schrumpft so die Menge konsumierbarer Grundnahrungsmittel und ihre Preise ziehen dramatisch an. Dies trifft zum Beispiel auf Congo-Brazzaville zu, wo ganz extensiv Zuckerrohr mit diesem Ziel angebaut wird, während gleichzeitig die Bevölkerung hungert. Während in Brasilien 30% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze lebt und kaum überleben kann, wird die Wahl der anzubauenden Agrarprodukte immer mehr durch den run auf die Biotreibstoffe bestimmt.
5. Der Handelskrieg und der Protektionismus, die ebenfalls typische Merkmale des Kapitalismus sind und im Agrarbereich wüten, haben dazu geführt, dass die produktivsten Bauern der Industriestaaten exportieren (oft mit Hilfe von Regierungssubventionen) und damit einen Teil ihrer Produktion in den Dritte-Welt-Ländern verkaufen, wodurch die Bauern vor Ort ruiniert werden. Diese sind seit langem unfähig, die örtliche Bevölkerung ausreichend zu ernähren oder auch nur Hilfsgüter anbieten zu können. In Afrika zum Beispiel sind viele örtliche Bauern durch die europäischen Exporte von Hühnern und Rindfleisch ruiniert worden. Mexiko kann nicht mehr genügend Grundnahrungsmittel herstellen, um seine Bevölkerung zu ernähren. Als Folge muss das Land jetzt Lebensmittel im Wert von 10 Milliarden Dollar einführen.
6. Der unverantwortliche Einsatz von Ressourcen dieses Planeten, der durch die Jagd nach unmittelbaren Profiten bestimmt wird, führt letzten Endes zur Erschöpfung derselben. Die Überdüngung zerstört das Gleichgewicht des Bodens. Das International Rice Research-Institut warnt, dass der Erhalt des Reisanbaus durch den übermäßigen Gebrauch von Dünger und die Beeinträchtigung der Bodenqualität mittelfristig gefährdet sei. Die Überfischung der Meere hat ebenso schon zu einer Verknappung zahlreicher Fischsorten geführt.
7. Die Folgen der Erwärmung des Planeten, insbesondere Überschwemmungen und Dürren werden zu Recht als Grund für die gesunkenen nutzbaren landwirtschaftlichen Anbauflächen angeführt. Aber letzten Endes sind diese Umweltschäden die Folgen einer frenetischen Industrialisierung durch den Kapitalismus auf Kosten der unmittelbaren und langfristigen Bedürfnisse der Menschen. So haben die jüngsten Hitzewellen in Australien zu schwerwiegenden Schäden und einem großen Rückgang der Nahrungsmittelproduktion geführt. Und das Schlimmste steht erst noch vor uns, denn Berechnungen zufolge wird ein Anstieg der Temperatur um ein Grad Celsius einen Rückgang der Reis, Weizen- und Maisernte um 10% bewirken. Forschungsergebnisse zeigen, dass der Temperaturanstieg die Überlebenschancen vieler Tiere und Pflanzen bedroht und den Nährwert vieler Pflanzen reduziert.
Aber Hunger ist nicht die einzige Folge der Absurditäten der Ausbeutung der Reichtümer der Erde. So kommt es infolge der Biotreibstoffproduktion zu einer Erschöpfung der anbaufähigen Flächen. Darüber hinaus führt dieser "saftige" Markt zu einem wahnsinnigen und gegen die Natur gerichteten Verhalten: In den USA, wo schon mehr als 30% des Maisanbaus für die Herstellung von Ethanol verwendet wird, werden gigantische Anbauflächen für den Anbau von "energiereichem" Mais benutzt. Dazu werden aber Anbauflächen verwendet, die dafür überhaupt nicht geeignet sind. Dadurch wird eine enorme Verschwendung von Dünger und Wasser verursacht, und das Endergebnis ist zudem noch sehr magert. Jean Ziegler erklärte dazu: "Um 50 Liter Bioethanol zu tanken, muss man 232 Kilo Mais verwenden" – aber um ein Kilo Mais zu züchten, muss man 1000 Liter Wasser verwenden! Jüngste Untersuchungen zeigen, dass nicht nur die "Umweltbilanz" der Biotreibstoffe negativ ist (jüngste Erhebungen deuten darauf hin, dass sie die Luft mehr verschmutzen als normale Treibstoffe), aber ihre globalen Konsequenzen auf ökologischer und ökonomischer Ebene sind für die gesamte Menschheit verheerend. Zudem ist in vielen Teilen der Erde der Boden immer stärker verseucht oder gar völlig vergiftet. Der Boden in China ist zum Beispiel zu 10% vergiftet, 120.000 Bauern sterben jedes Jahr an Krebs, der durch Bodenverseuchung hervorgerufen wurde.
All die Erklärungen, welche uns zur Ernährungskrise gegeben werden, enthalten ein Körnchen Wahrheit. Aber keine von ihnen kann als solche eine wirkliche Erklärung liefern. Da es sich um die Grenzen des Systems handelt, insbesondere wenn diese in Form der Krise in Erscheinung treten, hat die herrschende Klasse keine andere Wahl als die Ausgebeuteten anzulügen. Sie leiden unter den Folgen dieser Entwicklung. Ihnen gegenüber versuchen die Herrschenden zu verbergen, dass diese Gesellschaft nicht von ewigem Bestand ist, genauso wenig wie frühere Ausbeutungsgesellschaften ewig existierten. Aber auf einer gewissen Art muss die herrschende Klasse auch sich selbst als gesellschaftliche Klasse belügen, um zu vertuschen, dass ihre Herrschaft historisch zum Verschwinden verurteilt ist. Aber was heute ins Auge sticht, ist der Gegensatz zwischen den von der herrschenden Klasse gemachten Versicherungen und ihrer Unfähigkeit, gegenüber der Nahrungskrise mit einem Mindestmaß an Glaubwürdigkeit und Effizienz zu reagieren.
Die verschiedenen angebotenen Erklärung und Lösungen entsprechen – abgesehen von ihrer zynischen und heuchlerischen Art – alle den eigenen und unmittelbaren Interessen der einen oder anderen Fraktion der herrschenden Klasse. Einige Beispiele zur Verdeutlichung. Auf dem letzten G 8 Gipfel haben die Führer dieser Staaten die Repräsentanten der armen Länder aufgefordert, gegenüber den Hungerrevolten zu reagieren. Sie schlugen die sofortige Senkung der Handelszölle auf Agrarprodukte vor. Mit anderen Worten: der erste Gedanke dieser feinen Repräsentanten der kapitalistischen Demokratie war, von der Krise zu profitieren, um ihre eigenen Exportchancen zu erhöhen! Die europäische Industrielobby erhob gegenüber dem Agrarprotektionismus der Europäischen Union ein Zetergeschrei, die unter anderem beschuldigt wird, für den Ruin der Subsistenzwirtschaft in der Dritten-Welt verantwortlich zu sein (1). Und warum? Aus Angst vor der industriellen Konkurrenz aus Asien wollen diese die Agrarsubventionen, die von der EU bezahlt werden, reduzieren, weil diese nicht mehr finanzierbar seien. Die Agrarlobby wiederum sieht in den Hungerrevolten den Beweis der Notwendigkeit der Erhöhung derselben Agrarsubventionen. Die Europäische Union hat die Gelegenheit benutzt, um den Einsatz der Agrarproduktion zugunsten "erneuerbarer Energien" in Brasilien zu verurteilen, das eines der EU-Hauptrivalen in dieser Branche ist. Der Kapitalismus hat wie kein anderes System vor ihm die Produktivkräfte bis zu solch einem Punkt entwickelt, dass sie die Errichtung einer Gesellschaft ermöglichen würden, in der die menschlichen Bedürfnisse befriedigt werden könnten. Aber die so in Bewegung gesetzten Kräfte können nicht in den Dienst der großen Mehrheit der Menschen gestellt werden, solange sie durch die Gesetze des Kapitalismus gefesselt werden. Stattdessen wenden sie sich gegen die Menschen. „Wir haben in den fortgeschrittensten Industrieländern die Naturkräfte gebändigt und in den Dienst der Menschen gepresst; wir haben damit die Produktion ins unendliche vervielfacht, dass ein Kind jetzt mehr erzeugt als früher hundert Erwachsene. Und was ist die Folge? Steigende Überarbeit und steigendes Elend der Massen (…) Erst eine bewusste Organisation der gesellschaftlichen Produktion, in der planmäßig produziert und verteilt wird, kann die Menschen ebenso in gesellschaftlicher Beziehung aus der übrigen Tierwelt herausheben, wie dies die Produktion überhaupt für die Menschen in spezifischer Beziehung getan hat“ (Friedrich Engels, Einleitung zur Dialektik der Natur, MEW 20, S. 323).
Seitdem der Kapitalismus in seine Niedergangsphase eingetreten ist, tragen die von den Menschen produzierten Reichtümer nicht dazu bei, die Menschen aus der Herrschaft der Notwendigkeit zu befreien, sondern sie bedrohen die Menschheit in ihrer Existenz selbst. Somit wird die Menschheit heute durch eine neue Gefahr bedroht: weit verbreiteter Hunger – während man noch vor einiger Zeit behauptete, die Gefahr des Verhungerns höre der Vergangenheit an. Aber wie die Klimaerwärmung zeigt, die ganze Produktion – auch die der Agrarprodukte – ist den blinden Gesetzen des Kapitalismus unterworfen. Die Grundlagen des Lebens auf der Erde werden durch die Plünderung der Ressourcen des Planeten bedroht.
Der Unterschied zwischen den Hungerrevolten und den Aufständen in den Vororten
Heute sind die ärmsten Menschen der Dritten Welt vom Hunger betroffen. Die Plünderungen von Geschäften sind eine vollkommen legitime Reaktion gegen eine untragbare Lage in ihrem Überlebenskampf. Auch wenn diese Hungerrevolten zu Zerstörungen und Gewalt führen, dürfen sie nicht auf die gleiche Ebene gestellt werden wie die Revolten in den Städten (wie in Brixton, Großbritannien 1981 oder in den französischen Vororten 2005) oder wie die Rassenunruhen (wie die von Los Angeles 1992), weil sie eine andere Bedeutung haben als diese (2).
Obwohl sie die „öffentliche Ordnung“ stören und materielle Schäden anrichten, dienen letztere letzten Endes nur den Interessen der herrschenden Klasse, welche sehr wohl dazu in der Lage ist, diese Aufstände nicht nur gegen die Aufständischen selbst auszuschlachten, sondern sie gegen die gesamte Arbeiterklasse auszunutzen. Insbesondere bieten diese Ausdrücke verzweifelter Gewalt (an denen sich meist Lumpenproletarier beteiligten) der herrschenden Klasse oft einen Vorwand zur Verstärkung ihres Repressionsapparates mit einer verstärkten polizeilichen Überwachung der Elends- und Arbeiterviertel..
Diese Art Aufstände sind ein reines Zerfallsprodukt des Kapitalismus. Sie spiegeln die Verzweiflung und das Gefühl des „no future“ wider, das sich durch ihren völlig absurden Charakter äußert. Dies traf zum Beispiel auf die Unruhen in den französischen Vorstädten im November 2005 zu, als die Jugendlichen ihre gewalttätigen Aktionen keinesfalls gegen die Stadtviertel der Reichen, wo die Ausbeuter wohnen, richteten, sondern gegen ihre eigenen Wohnviertel, die seitdem noch mehr heruntergekommen und noch unerträglicher geworden sind. Und die Tatsache, dass ihre eigene Familien, ihre eigenen Nachbarn und die ihnen Nahestehenden die Hauptopfer der Verwüstungen wurden, belegt den völlig blinden, verzweifelten und selbstmörderischen Charakter dieser Aufstände. Angesteckt wurden nämlich die Autos der Arbeiter, die in diesen Wohnvierteln leben, und zerstört wurden die Schulen und Turnhallen, die von ihren Brüdern und Schwestern oder den Nachbarkindern benutzt werden. Und gerade weil diese Aufstände völlig absurd waren, konnte die herrschende Klasse sie gegen die Arbeiterklasse selbst einsetzen. In den Medien wurden sie von der herrschenden Klasse dazu ausgeschlachtet, um viele Arbeiter aus den ärmeren Vierteln glauben zu lassen, dass die jungen Aufständischen keine Opfer des krisengeschüttelten Kapitalismus sind, sondern kleine "Diebe“. Abgesehen von der Tatsache, dass diese Aufstände nur zu einer verstärkten „Ausländerjagd“ geführt haben, konnten sie nur dazu dienen, jegliche Solidarität der Arbeiterklasse mit diesen aus der Produktion ausgeschlossenen Jugendlichen zu untergraben. Diese Jugendlichen sehen keine Perspektive und werden ständig durch die Polizei belästigt.
Im Gegensatz zu den Aufständen in den Städten und den Rassenunruhen, welche die Bourgeoisie völlig kontrollieren und gegen die Arbeiterklasse wenden kann, um die Arbeiterklasse zu spalten und ihre Solidarität zu vereiteln, sind die Hungersrevolten vor allem und hauptsächlich ein Ausdruck des Bankrotts der Weltwirtschaft und der Irrationalität seiner Produktionsweise. Diese äußert sich heute durch eine Ernährungskrise, von der nicht nur die Ärmsten der „armen“ Länder betroffen sind, sondern immer mehr Lohnabhängige in den „entwickelten“ Ländern. Es ist kein Zufall, dass die meisten Arbeiterkämpfe, die sich heute überall auf der Welt entfalten, oft um Lohnerhöhungen drehen. Die galoppierende Inflation, der Preisanstieg der Waren, die zur Deckung der Grundbedürfnisse benötigt werden, zusammen mit den Reallohnsenkungen und der Renten, die durch die Inflation angenagt werden, über die prekären Arbeitsbedingungen und den Entlassungswellen sind Ausdrücke der Krise, die alle Bestandteile enthält, damit die Frage des Hungers, des Überlebenskampfes in der Arbeiterklasse nunmehr aufkommen.
Jetzt schon haben Untersuchungen aufgezeigt, dass in Frankreich die Supermärkte und die großen Einkaufszentren, in denen die Arbeiter kaufen gehen, große Absatzschwierigkeiten haben und ihr Warensortiment und Liefermengen reduzieren. Wenn die Ernährungskrise schon die Arbeiter der ‚armen’ Länder (und zunehmend auch die Arbeiter der Zentren des Kapitalismus) erfasst, wird es der herrschenden Klasse viel schwerer fallen, die Hungerrevolten gegen den Klassenkampf des Proletariats auszunutzen. Hunger und Not – das sind die Perspektiven des Kapitalismus für die Menschheit. Das wird jetzt schon durch die Hungerrevolten, die jüngst in mehreren Ländern ausgebrochen sind, deutlich.
Natürlich sind diese Aufstände auch Verzweiflungstaten der ärmsten Massen in den 'armen' Ländern. Sie bieten keine Perspektive für die Überwindung des Kapitalismus. Aber im Gegensatz zu den Aufständen in den Städten oder den Rassenunruhen stellen die Hungerrevolten eine Bündelung der absoluten Misere dar, in welche der Kapitalismus immer größere Teile der Bevölkerung treibt. Sie zeigen das auf, was auf die Arbeiterklasse zukommt, wenn diese Produktionsform nicht überwunden wird. Deshalb tragen sie zur Bewusstwerdung des Proletariats über den unvermeidbaren Bankrott der kapitalistischen Wirtschaft bei. Und sie zeigen auch, mit welchem Zynismus und welcher Brutalität die herrschende Klasse auf die Wutausbrüche derjenigen reagiert, die Geschäfte plündern, um nicht zu verhungern: Repression, Tränengas, Schlagstöcke und Maschinengewehre. Aber im Gegensatz zu den Revolten in den Vorstädten, sind diese Hungerrevolten kein die Arbeiterklasse spaltender Faktor. Im Gegenteil, trotz der Gewalt und der Zerstörungen, die sie vielleicht hervorrufen, neigen die Hungerrevolten eher dazu, ein spontanes Gefühl der Solidarität unter den Arbeitern zu bewirken, da diese auch die Hauptleidtragenden der Nahrungskrise sind und immer mehr Schwierigkeiten haben, ihre Familien durchzubringen. Deshalb können die Hungerrevolten nur schwerer von der herrschenden Klasse ausgeschlachtet und zur Spaltung der Arbeiter eingesetzt werden.
Gegenüber den Hungerrevolten bietet nur der Kampf der Arbeiter eine Perspektive.
Obwohl sich heute in den 'armen' Ländern gleichzeitig Arbeiterkämpfe gegen die kapitalistische Misere und Hungerrevolten entfalten, handelt es sich um zwei parallele Bewegungen aber mit jeweils unterschiedlichem Wesen.
Selbst wenn sich Arbeiter an Hungerrevolten und an Plünderungen beteiligen, ist dies kein Boden für den Klassenkampf. Denn es handelt sich dabei um einen Boden, auf dem das Proletariat in all den anderen verarmten und marginalisierten "Volksschichten" aufgelöst wird. Bei dieser Art Bewegung kann die Arbeiterklasse nur ihre Klassenautonomie verlieren und ihre eigenen Kampfmethoden aufgeben: Streiks, Demonstrationen, Vollversammlungen.
Die Hungerrevolten sind nur ein Strohfeuer, Revolten ohne Fortsetzung, die keinesfalls das Problem des Hungers lösen können. Sie sind lediglich eine unmittelbare und verzweifelte Reaktion gegenüber der absoluten Misere. Sobald die Geschäfte geplündert sind, bleibt nichts mehr übrig, während Lohnerhöhungen, die Arbeiter erkämpft haben, länger Bestand haben (auch wenn sie später wieder verloren gehen). Selbstverständlich darf die Arbeiterklasse gegenüber der Hungersnot, vor der heute die Bevölkerung in den Ländern der Peripherie des Kapitalismus steht, nicht gleichgültig bleiben. Dies trifft um so mehr zu, da die Arbeiter in diesen Ländern ebenso von der Nahrungskrise betroffen sind und immer mehr Schwierigkeiten haben, ihre Familien mit ihren miserablen Löhnen zu ernähren.
Die gegenwärtigen Ausdrucksformen der kapitalistischen Krise, insbesondere die Preisschübe und die Zuspitzung der Ernährungskrise werden dazu neigen, die Lebensbedingungen der Arbeiter und der verarmten Massen immer mehr zu verschlechtern. Deshalb werden die Arbeiterkämpfe in den ‚armen’ Ländern und die Hungerrevolten immer mehr zunehmen. Aber während die Hungerrevolten keine Perspektiven aufzeigen können, stellen die Arbeiterkämpfe die Grundlage dar, auf der die Arbeiter ihre eigene Stärke und eigene Perspektiven entfalten können. Das einzige Mittel des Proletariats, um den immer gewalttätiger werdenden Angriffen des Kapitalismus entgegenzutreten, ist seine Fähigkeit, seine Klassenautonomie zu bewahren, indem es seine Kämpfe und seine Perspektiven auf seinem eigenen Boden entfaltet. Insbesondere müssen die Arbeiter in den Vollversammlungen und Massendemonstrationen gemeinsame Forderungen erheben, welche die Solidarität mit den hungernden Massen zum Ausdruck bringen. Bei diesen Forderungen müssen die kämpfenden Arbeiter nicht nur Lohnerhöhungen und Senkungen der Grundnahrungsmittel verlangen, sondern sie müssen in ihre Forderungen auch die kostenlose Verteilung der lebensnotwendigsten Nahrungsmittel für die Ärmsten, die Arbeitslosen und die Bedürftigen aufnehmen. Nur indem sie ihre eigene Kampfmittel und ihre Klassensolidarität mit den Hungernden und Unterdrückten entfaltet, kann die Arbeiterklasse die anderen nicht-ausbeutenden Schichten der Gesellschaft auf ihre Seite ziehen.
Der Kapitalismus kann der Menschheit keine Perspektive mehr anbieten außer immer barbarischere Kriege, tragischere Katastrophen, eine zunehmende Misere für den Großteil der Weltbevölkerung. Die einzige Möglichkeit, damit die Gesellschaft diese Barbarei überwindet, besteht in der Abschaffung des kapitalistischen Systems. Und die einzige Kraft, die den Kapitalismus überwinden kann, ist die Weltarbeiterklasse. Weil diese aber bislang noch nicht die Kraft entfaltet hat, diese Perspektive durch die Entwicklung und massive Ausdehnung ihrer Kämpfe umzusetzen, sind immer größere Bevölkerungsmassen in den Ländern der "3.Welt" dazu getrieben, sich an verzweifelten Hungerrevolten zu beteiligen, um zu überleben. Die einzig wirkliche Lösung für die Nahrungskrise ist die Entfaltung der Arbeiterkämpfe mit dem Ziel der kommunistischen Weltrevolution, wodurch die Hungerrevolten eine Perspektive und eine Stoßrichtung erhalten. Das Proletariat kann die anderen nicht-ausbeutenden Schichten aber nur für sich gewinnen und um sich scharen, wenn es sich als eine revolutionäre Klasse behauptet. Nur durch die Entfaltung und Vereinigung ihrer Kämpfe kann die Arbeiterklasse zeigen, dass sie die einzige gesellschaftliche Kraft ist, die diese Welt umwälzen und eine radikale Lösung für die Geißel des Hungers anbieten kann, aber auch eine Lösung für all die Kriege und alle anderen Ausdrucksformen der Verzweiflung, die zum Fäulnisprozess dieser Gesellschaft beitragen.
Der Kapitalismus hat die Bedingungen des Überflusses geschaffen, aber solange diese Gesellschaft nicht überwunden ist, können diese nur zu einer absurden Situation führen, wo die Überproduktion von Waren gleichzeitig besteht mit dem Mangel an den grundlegendsten Waren.
Die Tatsache, dass der Kapitalismus nicht mehr dazu in der Lage ist, die Bevölkerung zu ernähren und ganze Bevölkerungsteile dem Hunger aussetzen muss, ist eine dringende Aufforderung an die Arbeiterklasse, ihre historische Aufgabe zu erfüllen. Nur mit Hilfe der kommunistischen Weltrevolution können die Grundlagen für eine wahre Überflussgesellschaft gelegt werden, in der das Problem des Hungers ein für allemal aus dieser Welt geschafft sein wird. – Juli 2008
(1) Der Begriff "3.Welt" war 1952 mitten im Kalten Krieg durch den französischen Ökonomen und Demographen Alfred Sauvy erfunden worden, um anfänglich jene Länder zu beschreiben, die weder dem westlichen noch dem russischen Block direkt zugeordnet werden konnten. Aber diese Bedeutung ist schließlich praktisch fallen gelassen worden, insbesondere seit dem Fall der Berliner Mauer. Aber er wurde ebenso verwendet, um die Länder zu kennzeichnen, in denen es ein nur sehr schwaches Wirtschaftswachstum gibt, mit anderen Worten die ärmsten Länder des Planeten, insbesondere in Afrika, Asien oder Südamerika. In diesem Sinne haben wir diesen Begriff weiter benutzt, der an Aktualität nichts verloren hat.
(2) Hinsichtlich der Rassenunruhen von Los Angeles siehe unseren Artikel "Gegenüber dem Chaos und den Massakern – nur die Arbeiterklasse kann eine Antwort bieten" – in International Review Nr. 70. Zu den Aufständen in den französischen Vororten im Herbst 2005 siehe "Soziale Unruhen – Argentinien 2001, Frankreich 2005 …. Nur der Kampf der Arbeiterklasse bietet eine Zukunft" (International Review 124) und "Thesen zur Studentenbewegung des Frühjahrs 2006" – Sonderausgabe von Weltrevolution.
Aktuelles und Laufendes:
- Nahrungskrise [105]
- Lebensmittelpreisexplosion [106]
- Hungerrevolten [107]
- Hunger Arbeiterklasse [108]
Theoretische Fragen:
- Umwelt [24]
August 2008
- 692 reads
Krieg in Georgien – alle Mächte sind für den Krieg verantwortlich!
- 3104 reads
Krieg in Georgien – alle Mächte sind für den Krieg verantwortlich!
Wieder einmal herrscht Krieg im Kaukasus. Zu einem Zeitpunkt, als Bush und Putin Süßigkeiten in Beijing kosteten und praktisch Schulter an Schulter der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele beiwohnten, die angeblich ein Symbol des Friedens und der Versöhnung unter den Völkern darstellen, haben der georgische Präsident Saakaschwili, ein Schützling des Weißen Hauses, und die russische Bourgeoisie ihre Soldaten in den Krieg geschickt und ein schreckliches Massaker an der Bevölkerung verübt. Dieser Krieg hat zu einer neuen quasi ‚ethnischen’ Säuberung auf beiden Seiten geführt, deren genaue Opferzahl gegenwärtig nicht eingeschätzt werden kann (man geht von mehreren Tausend Toten aus), von denen wiederum ein Großteil Zivilisten sind. Jedes Lager beschuldigt die andere für den Krieg verantwortlich zu sein oder rechtfertigt sich, so gehandelt zu haben, weil man mit dem Rücken zur Wand stand. Die Bevölkerung vor Ort – ob die russischen, ossetischen, abchasischen oder georgischen Ursprungs, deren Städte, Dörfer und Wohnungen bombardiert, angesteckt, geplündert und zerstört werden, wird von allen nationalistischen bürgerlichen Fraktionen zur Geisel genommen. Sie wird überall den gleichen Massakern, den gleichen Grausamkeiten ausgesetzt. Die Arbeiter dürfen dabei keine Seite verteidigen. Sie dürfen nicht zwischen ihren Ausbeutern wählen. Sie müssen sich weiterhin gegen sie auf ihrem Klassenterrain mobilisieren und die nationalistischen und kriegerischen Forderungen verwerfen wie: « Verteidigen wir unsere russischen Brüder und Schwestern im Kaukasus“ oder „Verteidigen wir das Volk, welches Vertrauen in russische Hilfe hat“ oder „Gott rette die territoriale Integrität Georgiens“ – all diese Slogans dienen nur der einen oder anderen kapitalistischen Bande, die alle nur die Bevölkerung als Kanonenfutter einsetzen wollen.
Eine neuer Beleg für die kriegerische Barbarei des Kapitalismus
Als Reaktion auf eine Reihe von Provokationen der russischen Bourgeoisie und ihrer separatistischen Fraktionen in Ossetien meinte der georgische Präsident Schaakaschwili ungestraft eine brutale Invasion der Miniprovinz Südossetien in der Nacht vom 7. auf den 8. August anleiern zu können. Die georgischen Truppen wurden dabei von der Luftwaffe unterstützt. Zchinwali, die ‚Hauptstadt’ der abtrünnigen, pro-russischen Provinz, wurde dabei in Schutt und Asche gelegt. Während Moskau ihm treue Milizen in den anderen Kriegsherd in Georgien, das ebenso abtrünnige Abchasien, schickte, und diese dabei das Kodori-Tal besetzten, haben die russischen Truppen ebenso brutal und barbarisch reagiert, indem sie massiv mehrere georgische Städte bombardierten (darunter den Hafen Poti an der Schwarzmeerküste, welcher völlig zerstört und geplündert wurde, und vor allem Gori, aus der die meisten Einwohner nach intensivem Beschuss flüchteten). Blitzschnell haben die russischen Panzer ein Drittel des georgischen Territoriums besetzt, dabei gar die Hauptstadt bedroht. Die Panzer rückten bis auf wenige Kilometer an die Hauptstadt Tiflis heran, ohne Schritte für einen Rückzug nach der Unterzeichnung des Waffenstillstandes eingeleitet zu haben. Auf beiden Seiten die gleichen schrecklichen Szenen und das gleiche Abschlachten. Fast die ganze Bevölkerung von Zchinwali und Umgebung (es handelte sich um ca. 30.000 Flüchtlinge) musste aus dem Kampfgebiet flüchten. Innerhalb einer Woche stieg, den Angaben des Sprechers des Flüchtlingsrats zufolge, die Zahl der Flüchtlinge im ganzen Land (die terrorisiert und ohne Hab und Gut das Weite suchten) auf über 115.000 an. Der Großteil der Einwohner von Gori ist geflüchtet. Der Konflikt hatte seit langem geschwelt. Südossetien und Abchasien, beides Gebiete, in denen Schmuggler und andere Banden den Alltag prägen, sind selbsternannte pro-russische Minirepubliken, die unter ständiger russischer Kontrolle stehen. Seit fast 20 Jahren, als Georgien seine Unabhängigkeit erklärte und im Verlaufe der nachfolgenden Kriege, sind diese Republiken zum Schauplatz ständiger Konflikte und Schießereien zwischen den beiden Nachbarstaaten geworden. Die Instrumentalisierung der russischen Minderheiten in Georgien zum Zwecke der Rechtfertigung der aggressiven imperialistischen Politik Russlands erinnert an die Politik Deutschlands nicht nur zur Zeit der Naziherrschaft (die Episode der Sudetendeutschen in der Tschechoslowakei) sondern während des ganzen 20. Jahrhunderts. Wie ein Experte in der Zeitung Le Monde vom 10.08.08 erklärte: „Südossetien ist weder ein Land noch ein Regime. Es ist eine durcheinander gewürfelte Gesellschaft, zusammengesetzt aus russischen Generälen und ossetischen Banditen, die sich auf dem Hintergrund des Konfliktes mit Georgien bereichern wollen.“ Die Rückkehr zum entfesseltsten Nationalismus und zu militärischem Abenteurertum ist für die herrschende Klasse immer das bevorzugte Mittel um zu versuchen, Probleme der Innenpolitik zu regeln. Nachdem der georgische Präsident mit 95% Stimmenanteil nach der gegen den ehemaligen ‚sowjetischen’ Minister Schewardnadse gerichteten „Rosenrevolution“ im Herbst 2003 gewählt worden war, hatte er Anfang 2008 große Schwierigkeiten wiedergewählt zu werden, obgleich er Unterstützung durch die USA erhielt. Aber Korruption und sein autokratischer Regierungsstil hatten seine Glaubwürdigkeit stark angekratzt. Dieser bedingungslose Anhänger Washingtons übernahm übrigens die Staatsgeschäfte in einem Staat, welcher seit seiner Gründung 1991 am Tropf der USA, dem Führer der von Bush Sen. Verheißenen ‚neuen Weltordnung’ hängt. Russland und Putin haben nun Saakashwili eine Falle gestellt, in welche dieser auch gelaufen ist. Sie haben damit die Gelegenheit genutzt, ihre Muskeln spielen zu lassen und ihre Autorität im Kaukasus wiederherzustellen (welcher einen wahren Splitter in der russischen Achillesverse darstellt), und um so auf die seit 1991 erfolgte Einkreisung Russlands durch die Nato zu reagieren. Aus russischer Sicht hat diese Einkreisung ein unerträgliches Niveau erreicht, nachdem nun die USA den Beitrittswunsch Georgiens und der Ukraine zur Nato unterstützen. Auch und vor allem kann Russland nicht hinnehmen, dass in Polen und der Tschechischen Republik Raketenabwehrbasen errichtet werden, die aus russischer Sicht nicht gegen den Iran gerichtet sind, sondern gegen Russland selbst. Russland hat die Tatsache ausgenützt, dass die Hände des Weißen Hauses gebunden sind, dessen Truppen im Irak und in Afghanistan in der Klemme stecken. So konnte Russland eine militärische Gegenoffensive im Kaukasus starten, nachdem es erst kurz zuvor durch den äußerst mörderischen Krieg in Tschetschenien seine Autorität ein wenig wiederherstellen konnte. Aber die Verantwortung für diesen Krieg und das Abschlachten beschränkt sich nicht auf die direkten Teilnehmer. Allen imperialistischen Mächten, die heute heuchlerisch Krokodilstränen über das Schicksal Georgiens vergießen, klebt Blut an den Fingern – so zum Beispiel den USA mit ihren beiden Golfkriegen, Frankreich und seiner Beteiligung am Völkermord in Ruanda 1994, oder auch Deutschland, das 1992 den Balkan mit in den Krieg trieb.
Die Masken fallen!
Das Ende des kalten Krieges und der Blockpolitik hat nicht zu einem „Zeitraum des Friedens und der Stabilität“ auf der Welt geführt. Von Afrika bis zum Mittleren Osten, über den Balkan und nun im Kaukasus ist davon nichts zu spüren. Das Auseinanderbrechen des ehemaligen stalinistisch beherrschten Blocks hat in Wirklichkeit nur neue imperialistische Appetite gestärkt und ein wachsendes kriegerisches Chaos hervorgebracht.
Georgien liegt übrigens in einer wesentlichen strategischen Schlüsselstellung– deshalb wurde es während der letzten Jahre immer wieder umworben. Während der stalinistischen Zeit war es nur ein Transitland für russische Öllieferungen zwischen Wolga und Ural. Seit 1989 ist es ein Schlüsselgebiet für die Ausbeutung der Reichtümer des Kaspischen Meeres. Im Mittelpunkt dieses Gebietes gelegen, ist Georgien zu einem Hauptdreh- und Angelpunkt für die Öl- und Gaslieferungen aus dem Kaspischen Meer, Aserbaidschan, Kasachstan, Turkmenistan geworden, und seit 2005 verbindet die 1800 km lange Ölpipeline BTC, die direkt unter US-Führung gebaut wurde, den aserbaidschanischen Hafen Baku über Tiflis direkt mit dem türkischen Ölhafen Ceyhan. Damit wurde Russland bei dem Transport des Öls aus dem Kaukasus verdrängt. Aus Moskaus Sicht gibt es eine unmittelbare Bedrohung, dass Zentralasien, wo sich 5% der Weltreserven an Öl und Gas befinden, zu einer Alternative für die dominierende Rolle Russlands bei der Versorgung Europas mit Gas wird. Dies um so mehr, da die Europäische Union seit einiger Zeit von dem Projekt einer Gasleitung von 330 km Länge namens Nabucco träumt, die parallel zur BTC verläuft, und direkt die Gasfelder des Irans und Aserbaidschans mit Europa durch die Türkei verbindet, während der neue Präsident Russlands, Medwedew - ein ehemaliger Chef von Gazprom - , darauf reagiert hat, indem er ein gewaltiges Konkurrenzprojekt vorgeschlagen hat, welches unter dem Schwarzen Meer verläuft und somit Europa direkt verbindet. Die erwarteten Kosten werden auf ca. 20 Milliarden Dollar geschätzt.
Hin zu einem neuen ‘kalten Krieg’ ?
Die beiden ehemaligen Blockführer, Russland und USA, stehen sich nun erneut gefährlich gegenüber; aber der heutige imperialistische Rahmen unterscheidet sich stark von dem des kalten Krieges, als es eine lückenlose Blockdisziplin gab. Seinerzeit wollte man uns lange glauben machen, der Konflikt zwischen den beiden Blöcken sei vor allem der Ausdruck eines ideologischen Kampfes: Der Kampf zwischen den Kräften der Freiheit und Demokratie gegen den Totalitarismus, welcher mit dem Kommunismus gleichgesetzt wurde. Heute kann man genau sehen, wie sehr uns diejenigen, welche einen ‚neuen Zeitraum des Friedens und der Stabilität“ versprochen hatten, getäuscht hatten. Ihr Aufeinanderprallen ist nur ein bestialischer und mörderischer Ausdruck des unverblümten Kampfes um schmutzige und niederträchtige imperialistische Interessen. Heute werden die Beziehungen der Staaten untereinander durch die Tendenz des Jeder-für-sich beherrscht. Der Waffenstillstand spiegelt nur den Triumph der Kremlherren und der russischen Überlegenheit auf militärischer Ebene in Georgien wider, der eine erniedrigende quasi-Kapitulation Georgiens (dessen territoriale Integrität nicht sichergestellt ist) vor den von Moskau diktierten Bedingungen bedeutete. So stellt diese Parodie von „Friedenskräften“, die in Südossetien und Abchasien stationiert wurden und sich ausschließlich aus Soldaten der russischen Armee zusammensetzen, eine offizielle Anerkennung des ständigen Verbleibs von russischen Besatzungstruppen inmitten georgischen Territoriums dar. Russland hat seinen militärischen Vorteil ausgenutzt, um sich in Georgien mit seinen Truppen niederzulassen, die in fast ganz Georgien ungeachtet der Verurteilung der ‚internationalen Gemeinschaft’ ihren Einzug gehalten haben. Der ‘Schutzherr’ Georgiens, die USA, hat ebenso erneut einen herben Rückschlag einstecken müssen. Während Georgien einen hohen Tribut für seine Anbindung an die USA zahlen musste (ein zweitausend Mann starkes Kontingent von georgischen Soldaten wurde in den Irak und Afghanistan geschickt), konnte dagegen Uncle Sam seinem Verbündeten lediglich ‚moralische Unterstützung’ anbieten und Russland mit leeren Verurteilungen überhäufen ohne auch nur eine Hand heben zu können, um Georgien effektiv verteidigen zu können. Der wichtigste Aspekt dieser Schwächung ist, dass das Weiße Haus nicht einmal einen Alternativplan für diesen brüchigen Waffenstillstand anbieten konnte, der sich auf einen Kuhhandel stützt. Die USA sind sogar gezwungen, den „europäischen Plan“ zu schlucken; schlimmer noch, es handelt sich um ein Abkommen, dessen Bedingungen von Moskau diktiert wurden. Noch erniedrigender war, dass die US-Außenministerin Condoleeza Rice eigens anreisen musste, um den georgischen Präsidenten zu zwingen, das Abkommen zu unterzeichnen. Dies offenbart die amerikanische Hilflosigkeit und den Niedergang der ersten Weltmacht. Diese neue Etappe der US-Schwächung wird die Glaubwürdigkeit der USA noch weiter untergraben und Sorgen unter den Staaten verstärken, die - wie Polen und die Ukraine - auf deren Unterstützung angewiesen sind. Während die USA ihre Unfähigkeit offenbaren, wird auch gleichzeitig durch diesen Konflikt die Haltung des jeder-für-sich unter den Europäern deutlich. Gegenüber der Lähmung der USA ist die ‚europäische Diplomatie’ in Aktion getreten. Es ist ganz aufschlussreich, dass der französische Präsident Sarkozy als Sprecher Europas in seiner Eigenschaft als Ratspräsident aufgetreten ist, obwohl er in Wirklichkeit oft nur seine eigenen Interessen mit einem marktschreierischen und Aufsehen erregenden Stil vertritt. Seine ‚Dienste' entbehren jeder Kohärenz; stattdessen entpuppt er sich immer als Meister kurzfristiger, überstürzter Schritte auf internationaler Ebene. Erneut wollte Sarkozy seinen Senf zur Beilegung des Konfliktes beitragen, vor allem um damit zu prahlen. Aber der berühmte „französische Friedensplan“ (er konnte nicht lange die Illusion aufrechterhalten, es handele sich um einen nationalen oder europäischen Erfolg) ist nur ein lächerlicher Schein, welcher kaum die Tatsache verdecken kann, dass seine Bedingungen ganz einfach von Russland aufgezwungen wurden. Und wie könnte Europa daraus Nutzen ziehen, wenn es in seinen Reihen die unterschiedlichsten und gegensätzlichsten Positionen gibt? Wie könnte es auch nur ein Mindestmaß an Einheit mit Polen und den Baltischen Staaten in seinen Reihen geben, welche aufgrund ihrer tief verwurzelten anti-russischen und anti-deutschen Haltung inbrünstige Verteidiger Georgiens sind. So hatte sich Deutschland gegen das Streben der USA nach verstärktem Einfluss in der Region mit am entschlossensten gegen die Aufnahme Georgiens und der Ukraine in die Nato ausgesprochen. Wenn jüngst Angela Merkel eine spektakuläre Kehrtwende vollzog und dem georgischen Präsidenten ihre Unterstützung für die Bewerbung um die Aufnahme versicherte, geschah dies, weil sie durch die wachsende Unpopularität Russlands dazu gezwungen wurde, das sich im von ihm besetzten Teil Georgiens hochmütig verhält, aber von der ‚internationalen Gemeinschaft’ stark verurteilt wird. Europa gleicht eher einem Haifischbecken, wo Frankreich seine eigene Politik verfolgt und durch seinen Versuch, Wolf und Schaf zu versöhnen, Putin einen tollen Dienst erwiesen hat, oder wo Großbritannien sehr schnell Stellung für Georgien bezog, um sich besser seinem großen Rivalen, Deutschland, entgegenzustellen. Und der Nutzen, den Russland aus dieser Entwicklung zieht, ist selbst sehr begrenzt. Sicher hat Russland seine imperialistische Position nicht nur im Kaukasus kurzfristig verstärken können – und dies allein lässt schon Schlimmes befürchten. Die Armada der russischen Flotte hat die Kontrolle über die See gewonnen und drohte damit, jedes Schiff zu versenken, das sich ihr in dieser Region näherte. Obwohl Russland seine Position unmittelbar im Kaukasus ausbauen kann, reicht dieser militärische Sieg nicht aus, um die USA von ihrem Projekt der Errichtung von Raketenabschussanlagen auf europäischem Boden abzubringen. Im Gegenteil: Washington ist dadurch angetrieben worden, die Installierung noch schneller voranzutreiben, wie das soeben mit Polen unterzeichnete Abkommen zur Errichtung des Raketenschilds zeigt. Als Vergeltungsmaßnahme hat der stellvertretende russische Generalstabschef Russlands schon damit gedroht, Polen zu einem bevorzugten Ziel seines nuklearen Arsenals zu machen. In Wirklichkeit ist der russische Imperialismus weniger an der Unabhängigkeit oder der Annektierung Südossetiens und Abchasiens interessiert; er will viel mehr eine Position der Stärke erlangen, um bei den Verhandlungen über die Zukunft Georgiens die Fäden zu ziehen. Aber seine kriegerische Aggressivität und das Ausmaß der eingesetzten militärischen Mittel in Georgien wecken bei seinen imperialistischen Rivalen alte Ängste, und bei seinem Versuch der Durchbrechung seiner Isolierung ist es diplomatisch isolierter als je zuvor. Keine Macht kann beanspruchen, die Lage im Griff zu haben oder sie gar zu kontrollieren; und die Schwankungen und Umkehrungen von Bündnissen, die wir sehen, spiegeln eine gefährliche Zuspitzung der imperialistischen Rivalitäten wider.
Im Kapitalismus ist kein Frieden möglich
Aber es gibt keinen Zweifel daran, dass alle imperialistischen Mächte, ob groß oder klein, das gleiche Interesse und das gleiche Bestreben an den Tag legen, um eine Rolle zu spielen und einen Platz auf diplomatischer Ebene in einer Region einzunehmen, in der es eine Bündelung großer geo-strategischer Interessen gibt. Dies zeigt, wie stark alle imperialistischen Mächte für diese Situation verantwortlich sind. Mit dem Öl und dem Gas aus der Region des Kaspischen Meeres oder der zentralasiatischen, oft türkisch-sprachigen Länder, stehen die vitalen Interessen der Türkei und des Irans auf dem Spiel. In Wirklichkeit mischt aber die ganze Welt bei diesem Konflikt mit. Im Kaukasus kann man viel leichter menschliches Kanonenfutter auftreiben, da diese Region ein bunt gemischtes ethnisches Mosaik ist. Die Osseten sind zum Beispiel iranischen Ursprungs. Man kann sich leicht vorstellen, dass eine interessierte Macht solch eine ethnische Zerstückelung ausnutzt und die nationalistischen Flammen mit anfacht Die vorherrschende Rolle Russlands stellt ebenso eine schwere Bürde dar. Sie weist auf andere, schwerer wiegende zukünftige imperialistische Spannungen hin: Man konnte die Ängste und Mobilisierung der Baltischen Staaten und vor allem der Ukraine beobachten; die Ukraine verfügt immer noch über viele Waffen und vor allem ein Atomwaffenarsenal, also eine ganz andere Nummer als Georgien. Dieser Krieg erhöht das Risiko einer destabilisierenden Feuersbrunst nicht nur auf regionaler Ebene, sondern er wird auch unvermeidbare weltweite Auswirkungen haben hinsichtlich des Gleichgewichtes der zukünftigen imperialistischen Beziehungen. Der „Friedensplan“ ist nur ein Scheinfriedensplan, nichts als Sand in den Augen. Alle Elemente für eine neue zukünftige kriegerische Eskalation sind vorhanden, wodurch sich eine ganze Kette von Feuersbrünsten in der Region vom Kaukasus bis zum Mittleren Osten entfalten würde. Nicht durch die Forderung nach mehr Demokratie, den Respekt der Menschenrechte, oder der Glaube an die Abkommen unter imperialistischen Gangstern oder ihre internationalen Übereinkommen werden die gegenwärtigen Verhältnisse überwunden. Der einzige Weg, um dem Krieg ein Ende zu setzen, ist die Überwindung des Kapitalismus. Und dies kann nur durch den Kampf der Arbeiterklasse geschehen. Die einzigen Verbündeten der Arbeiterklasse sind die anderen Arbeiter, über alle Grenzen, Völker und nationalistische Fronten hinweg. Die einzige Art, wie die Arbeiter der ganzen Welt ihre Solidarität gegenüber ihren Klassenbrüdern und –schwestern in Russland, Georgien, Ossetien, Abchasien oder gegenüber den Opfern der Kriege und der Massaker zum Ausdruck bringen können, besteht darin, dass sie ihren Kampf für die Überwindung des Systems verstärken. Dem kriegerischen Nationalismus der herrschenden Klasse können wir nur den Aufruf des Kommunistischen Manifestes entgegenstellen: Die Arbeiter haben kein Vaterland. Arbeiter aller Länder, vereinigt Euch! W.17.08.08
Geographisch:
Aktuelles und Laufendes:
- Georgien [110]
- Krieg im Kaukasus [111]
Leute:
- Shaakaswili [112]
Theoretische Fragen:
- Internationalismus [69]
Nahrungsmittelkrise: Der Preis der kapitalistischen Gier wird uns in den Hungertod treiben - Bericht von den Philippinen
- 3169 reads
Der Artikel, den wir unten veröffentlichen, ist uns von den Genossen der Gruppe Internationalysmo von den Philippinen zugeschickt worden. Er zeigt uns den wirklichen Wert der Krokodilstränen, die von der herrschenden Klasse der Philippinen, ob in der Regierung oder in der Opposition, über das Leid der Bevölkerung infolge der Ernährungskrise vergossen werden, eine Krise, die nicht das Ergebnis schlechter Ernten ist, sondern die Folge des unstillbaren Durstes der kapitalistischen Wirtschaft nach Profit, ganz gleich,
Der Artikel, den wir unten veröffentlichen, ist uns von den Genossen der Gruppe Internationalysmo von den Philippinen zugeschickt worden. Er zeigt uns den wirklichen Wert der Krokodilstränen, die von der herrschenden Klasse der Philippinen, ob in der Regierung oder in der Opposition, über das Leid der Bevölkerung infolge der Ernährungskrise vergossen werden, eine Krise, die nicht das Ergebnis schlechter Ernten ist, sondern die Folge des unstillbaren Durstes der kapitalistischen Wirtschaft nach Profit, ganz gleich, was es kostet. Und die Zeche wird von den in Armut lebenden Massen, die von der massiven Steigerung der Lebensmittelpreise betroffen sind, sowohl unmittelbar als auch langfristig bezahlt, da die zynische Unverantwortlichkeit der kapitalistischen Klasse in zunehmendem Maße das ökologische System ruiniert, von dem die Nahrungsmittelproduktion der Menschheit abhängt.
Die Analyse des Artikels konzentriert sich auf die Biospritherstellung und auf die Erosion der Reisanbaugebiete durch ein Über-Bewirtschaften des Bodens. Ein Punkt sollte aus unserer Sicht noch hinzugefügt werden: die Rolle, die die Umleitung von Spekulationskapital aus den US-amerikanischen und europäischen Immobilienmärkten in die Warenmärkte – und insbesondere in die Zukunftsmärkte für Nahrungsmittel – spielt. Laut Jean Ziegler, UN-Sonderberichterstatter über das Recht auf Ernährung, können - neben der Verwendung von Getreide für Biosprit als Hauptschuldigen beim Anstieg der Nahrungsmittelpreise – immerhin 30 Prozent des Anstiegs direkt der Spekulation auf den Warenterminmärkten zugeschrieben werden.
Die Welternährungskrise trat erst kürzlich in den Blickpunkt des medialen Interesses, aber sie ist ein Phänomen, das sich über Jahrzehnte beständig weiterentwickelt hat. Die Hungerrevolten von Haiti bis Bangladesh, von Pakistan bis Ägypten mögen das Thema der in die Höhe schnellenden Kosten für Grundnahrungsmittel in den Mittelpunkt der weltweiten Aufmerksamkeit gerückt haben, doch bleibt die Tatsache gültig, dass sie alle das Resultat von Jahren einer sich anhäufenden kapitalistischen Verheerung sind. Eine Zeitlang versuchten nationale Regierungen wie das Arroyo-Regime, die Zeichen der immer näher rückenden Krise zu ignorieren, selbst als die Preise für Reis auf den staatlichen Märkten in den Philippinen auf ein 34-Jahres-Hoch schnellten. Der philippinische Präsident spöttelte gar, dass es so etwas wie Reiskürzungen nicht geben könne, denn diese seien „physische Phänomene, bei denen sich Leute auf den Straßen anstellen, um Reis zu kaufen. Sieht man heute derartige Schlangen?“ (2)
Die Welt befindet sich inmitten einer unerhörten Inflation, die die Nahrungsmittelpreise auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten getrieben hat. Diese Teuerung betrifft zuvorderst alle Arten von Nahrungsmittel, vor allem aber die wichtigsten Erzeugnisse wie Korn, Reis und Weizen. Laut der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft stiegen zwischen März 2007 und März 2008 die Getreidepreise um 88 Prozent, die Preise für Speiseöl und Fett um 106 Prozent und die Preise für Molkerei-Produkte um 48 Prozent. Ein Weltbank-Bericht wies ferner darauf hin, dass in den 36 Monaten vor dem Februar 2008 überall auf der Welt die Nahrungsmittelpreise um 83 Prozent gestiegen sind; er erwartete, dass die meisten Nahrungsmittelpreise bis 2015 weit über dem Stand von 2004 verbleiben. (3)
In Thailand schnellte der Preis für die beliebteste Reissorte, für die man in den letzten fünf Jahren 138 Dollar die Tonne bezahlt hatte, am 24. April 2008 auf ein Rekordhoch von über 1.000 Dollar pro Tonne, und Händler sowie Exporteure erwarten, dass sich dies angesichts der angespannten Versorgungslage noch fortsetzen wird. (4) Dasselbe Phänomen wiederholt sich überall auf der Welt. Allein auf den Philippinen stieg der Preis für Reis im Einzelhandel von 60 Cent pro Kilogramm vor einem Jahr auf 75 Cent pro Kilo heute. Und in einem Land, wo 68 seiner 90 Millionen Einwohner von weniger als zwei US-Dollar pro Tag leben (5), ist dies ein Albtraum von horrenden Ausmaßen.
Die Welternährungskrise ist das unvermeidliche Ergebnis der permanenten Krise des Kapitalismus seit Ende der 1960er Jahre. Viele Volkswirtschaften kämpfen darum, flott zu bleiben in einer Welt der intensiven Konkurrenz und des kapitalistischen Profitstrebens auf einem bereits gesättigten Weltmarkt. Infolgedessen praktizieren die Regierungen eine Wirtschaftspolitik, die darauf ausgerichtet ist, das Wachstum von Industrien anzuregen; eine Politik, die immer mehr Geld in die eigene Wirtschaft steckt, statt für die Befriedigung der Bedürfnisse des Volkes zu sorgen. Kombiniert mit dem unhaltbaren Gebrauch der natürlichen Ressourcen und dem ungestümen Drang der Industrieproduktion nach Profit, der die Umweltverschmutzung und die Emission von Treibhausgasen weltweit verschlimmert, sieht sich die Menschheit nun einem zerstörerischen Gebräu nach kapitalistischer Rezeptur gegenüber.
Auf dem Gebiet der landwirtschaftlichen Produktion haben die Verwendung von Stickstoff und die Übersäuerung der Böden zur Ankurbelung der kapitalistischen Agrarproduktion die Gesamtproduktivität der einst fruchtbaren Zonen der Agrarproduktion ruiniert. Und auch wenn es zutrifft, dass die Anwendung moderner Bewirtschaftungsmethoden zu Beginn der grünen Revolutionen weltweit anfangs eine Steigerung der Produktivität erbracht hatte, so ist es auch wahr, dass es in vielen Teilen der Welt seither eine allmähliche Abnahme der landwirtschaftlichen Produktion gab. Laut eines Berichts des in London ansässigen Instituts für Gesellschaftswissenschaften:
„In Indien sank der Ertrag von Getreide pro Einheit des verwendeten Düngers während der Jahre der grünen Revolution um zwei Drittel.
Zwischen 1970 und 2000 wuchs die Steigerungsrate des jährlichen Verbrauchs von Düngemitteln für asiatischen Reis vom Dreifachen auf das Vierzigfache der Reiserträge an (8). In Zentral-Luzon, der Hauptinsel der Philippinen, stieg der Reisertrag während der 1980er Jahre um 13 Prozent, dies jedoch nur um den Preis einer 21prozentigen Steigerung des Verbrauchs von Düngemitteln. In den Central Plains ging der Ertrag lediglich um 6,5 Prozent hoch, während der Düngemittelverbrauch um 24 Prozent zunahm und der Verbrauch von Pestiziden um 53 Prozent hochschnellte. Auf West-Java stand einer 23prozentigen Ertragssteigerung eine 65 bzw. 69prozentige Zunahme von Pestiziden und Düngemitteln gegenüber. Jedoch war es das absolute Sinken der Erträge trotz eines hohen Inputs von Düngemitteln, das letztendlich die Blase der Grünen Revolution zum Platzen brachte. Nach dramatischen Steigerungen zu Beginn der Grünen Revolution begannen die Erträge ab den 1990er Jahren zurückzugehen. Auf Zentral-Luzon, Philippinen, stiegen die Reiserträge während der 70er Jahre stetig an, erreichten zu Beginn der 80er Jahre ihren Höhepunkt und sind seither allmählich gefallen. Ähnlich ging es im Reis-Weizen-System in Nepal und Indien zu. Wo die Erträge noch nicht fallen, hat sich die Wachstumsrate rapide verlangsamt oder auf einem Niveau eingependelt, wie in China, Nordkorea, auf den Philippinen, in Birma, Indonesien, Thailand, Pakistan und Sri Lanka geschehen.
Seit 2000 sind die Erträge weiter zurückgegangen, bis zu dem Umfang, dass in sechs der letzten sieben Jahre die Weltgetreideproduktion hinter dem Konsum zurückgefallen ist.“ (6)
Das Streben eines dekadenten, in seinen eigenen Widersprüchen verstrickten Systems nach Profit ist in die Zerstörung der natürlichen Fruchtbarkeit der ausgelaugten Böden gemündet. Auch wenn es zutrifft, dass die Weltwirtschaft immer noch mehr Nahrungsmittel produziert, als die Welt benötigt, ist vieles von dem, was produziert und auf dem globalen kapitalistischen Markt gehandelt wird, verdorben, ehe es den Markt erreicht, und wenn es ankommt, können Millionen von Menschen sich seinen Erwerb nicht mehr leisten. Letztendlich ist der Schlusspunkt die Pauperisierung der Arbeiterklasse und die Unterjochung eines immer größeren Teils der Menschheit unter äußerste Armut und Not. Denn der Kapitalismus ist an erster Stelle an der Akkumulation von Mehrwert interessiert und niemals an der Befriedigung der Bedürfnisse der Gesellschaft.
Die „Reiskrise“ auf den Philippinen
Laut Arturo Yap, dem Landwirtschaftsminister der Philippinen, „haben (wir) keine Ernährungskrise, sondern vielmehr eine Krise der Reispreise. Alle von uns suchen nach neuen Lösungen – wie man sich nicht nur der Versorgungsfrage, sondern auch der Preisfrage zuwendet, wie man (sicherstellen kann), dass die armen Familien etwas zum Essen haben.“ Er sagte, dass es fünf ernste Gründe für die „Reis“-Lage auf den Philippinen gebe, denen sich die Regierung widmen müsse: Die Versorgungslage sei erstens größtenteils durch die wachsende Nachfrage einer wachsenden Bevölkerung betroffen; zweitens durch die Auswirkungen des Klimawechsels; drittens durch die boomende Nachfrage nach Biosprit; viertens durch die fortgesetzte Umwandlung von Ackerland zugunsten einer nicht-landwirtschaftlichen Nutzung; und schließlich gebe es eine Vernachlässigung der Bewässerungsanlagen.
Auf dem ersten Blick mag man die so genannten Ursachen der philippinischen „Reis“-Krise für sich genommen als gültig betrachten. Doch die Tatsache hinter alldem ist die unbestrittene Wahrheit, dass der Rahmen, innerhalb dessen jene aufgezählten Ursachen wirken, die eigentliche Ursache ist, die alle anderen auslöst – der kapitalistische Rahmen der Produktion weltweit. Erstens ist die Behauptung, dass das Angebot angeblich von der wachsenden Nachfrage einer wachsenden Bevölkerung betroffen ist, nichts anderes als eine Ausrede angesichts der Tatsache, dass das, was von der kapitalistischen Weltwirtschaft produziert wird, eher an der Produktion von Mehrhwert als an der Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse orientiert ist. Zweitens sind auch die Auswirkungen des Klimawechsels auf die landwirtschaftliche Produktion an sich eine direkte Folge des kapitalistischen Rahmens der Produktion. Beispielsweise ist es nicht die Industrialisierung an sich, die verantwortlich ist für die Veränderung der klimatischen Bedingungen, sondern „das überwiegende Bestreben des Kapitalismus, die Profite zu maximieren, und seine konsequente Missachtung der menschlichen und ökologischen Bedürfnisse, es sei denn, sie fallen mit dem Ziel der Reichtumsvermehrung zusammen“ (7). Es gibt keinen Zweifel, dass es durch die Hände des kapitalistischen Weltsystems, das von einem unablässigen Streben nach Profit und wirtschaftlicher Expansion getrieben wird, zu einer entsetzlichen Verschlechterung der Umwelt gekommen ist. Aber Fakt ist, alle bürgerlichen Staaten, einschließlich des philippinischen Staates, der die astronomischen Kosten der ökologischen Verschlechterung am eigenen Leib erlebt, beschützen den Profithunger ihres jeweiligen nationalen Kapitals und ihre politischen Marionetten, um Forschung und Entwicklung einer umweltfreundlicheren Energiequelle für die Industrieproduktion zu sabotieren. Drittens ist der so genannte Umkehreffekt der boomenden Nachfrage nach Biosprit an die Landwirtschaft selbst das Resultat der von allen Regierungen (einschließlich der Arroyo-Regierungen) praktizierten Politik, nach alternativen Energiequellen zu suchen, um die Last der Abhängigkeit ihrer Industrie von ausländischem Erdöl etwas zu mindern. Hinzu kommt, dass die Senkung der Ausgaben fürs Öl zugunsten „sozialer“ Zwecke die Kapazität der Staaten zu Rüstungsproduktion und Krieg steigert. Es sind keineswegs ökologische Anliegen, die die Politik zur Entwicklung von Biokraftstoffen antreiben, sondern die Notwendigkeit für jedes nationale Kapital, sich selbst vor den steigenden Rohölpreisen auf dem Weltmarkt abzuschirmen, was so weit geht, die Kriegsanstrengungen aller bürgerlichen Staaten zu „unterstützen“. Es ist höchst aufschlussreich, dass schon im Zweiten Weltkrieg sowohl die Alliierten wie die Vereinigten Staaten als auch die Achsenmächte wie Deutschland bei ihren Kriegsbemühungen Biokraftstoffe verwendeten. Im Falle der Philippinen steht die Logik, Agrarerzeugnisse von den Tellern wegzulenken und auf die Bedürfnisse der Biosprit-Industrie auszurichten, in Übereinstimmung mit den Anstrengungen der philippinischen Regierung, mehr hochbezahlte, lukrativere Feldfrüchte zu produzieren, um das Streben nach zusätzlichen Dollareinnahme-Quellen zu forcieren. Viertens ist die fortgesetzte Umwandlung von Agrarland in Parzellen, Golfplätze, Einkaufszentren und Industriekomplexe ebenfalls eine direkte Folge der Landwirtschaftspolitik der Regierungen, besonders auf den Philippinen. Das jahrzehntealte Allgemeine Agrarreformprogramm (CARP – Comprehensive Agrarian Reform Program) scheiterte katastrophal. CARP ist nicht nur ein mystifizierendes und reaktionäres Programm der philippinischen Bourgeoisie; darüber hinaus ist es auch ökonomisch nicht lebensfähig. In einem Zeitalter, in dem die intensive kapitalistische Konkurrenz auf dem Weltmarkt die kleinen landwirtschaftlichen Produzenten wegen der hohen Bewirtschaftungskosten und den wachsenden Schulden zur Strecke bringt, sind die Bauern gezwungen, entweder ihrem Land den Rücken zuzukehren oder sich selbst prekären Arrangements zu unterwerfen, wie die Subunternehmer größerer Unternehmen, eine Praxis, die in der Region von Mindanao auf den Philippinen weitverbreitet ist. (8) Was das ewige Problem der schlimmen Vernachlässigung der Bewässerungssysteme auf den Philippinen angeht, so ist dies eher eine Frage des Mismanagements und der Korruption in der Regierung, ein Ausdruck des Zerfalls der ideologischen Formen in der kapitalistischen Dekadenz, in der Selbstgefälligkeit und die Mentalität des „Jeder-für-sich“ über alles andere herrscht.
Wie von einem Staat zu erwarten, der mit einer Krise von so großer Tragweite inmitten der kapitalistischen Dekadenz konfrontiert ist, antwortete der philippinische Staat durch die Arroyo-Regierung in Form aktiver Staatsinterventionen – eine Reaktion, die von allen linkskapitalistischen Formationen auf den Philippinen zusammen mit ihren Bemühungen, zu staatlich verordneten Lohnerhöhungen aufzurufen, unterstützt und grimmig entschlossen weiterentwickelt wird. So wie sich die Krisenschübe intensivieren, so häufen sich auch die verschleiernden Bemühungen des Staates, sie einzudämmen. Linke wie Rechte des Kapitals sind eins, wenn es darum geht, das Hirngespinst zu verbreiten, dass „nur der Staat“ die ArbeiterInnen und die Ärmsten der Armen vor den Hungerschüben und dem äußersten Elend bewahren könne. Sie ignorieren völlig die Tatsache, dass der Staat, den sie zu mehr Interventionen ermutigen wollen, jenes Organ ist, das die bürgerliche Diktatur durchsetzt, das die Quelle der Versklavung und des Leids – den Kapitalismus – beschützt. In ihrem Versuch, in Form und Inhalt „radikaler“ zu sein, drängten einige linkskapitalistische Strömungen auf eine aggressive und absolute Kontrolle der Gesellschaft durch den Staat.
Die linkskapitalistische Kritik, dass das, was der Staat tut – „Steigerung“ des Etats des Landwirtschaftsministeriums, Vergeben von „Reissubventionen“ für die „Ärmsten der Armen“ und die staatliche Konkurrenz zu den Privathändlern beim Kauf und Einkauf von Reis -, nicht genug sei und dass es an „politischem Willen“ mangele, zeigt deutlich, dass die Linksextremisten die absolute staatliche Kontrolle wollen. Sie gehen dabei sogar so weit, dass sie ihr uraltes Dogma der Parteiherrschaft und des Totalitarismus schwingen – die komplette und allumfassende Kontrolle durch den Staat, wie in den so genannten sozialistischen Ländern, die sie als „Überbleibsel“ der Oktoberrevolution verteidigen.
Es gibt keine Lösung der Krise innerhalb des kapitalistischen Systems
Rechte wie Linke des Kapitals sind sich einig darin, verschleiernde Programme in die Welt zu setzen, die die Tatsache verbergen sollen, dass es innerhalb des Systems keine Lösung der Krise gibt. Der Widerspruch zwischen Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse ist bereits auf die Spitze getrieben. Keine reformistischen oder vorübergehendenen Interventionen des Staates können etwas an der Tatsache ändern, dass – gleich, welche Lösungen innerhalb des Bollwerks des Kapitalismus formuliert werden – dies zu einer noch intensiveren Krise und Umweltzerstörung führen wird. Jede wirksame Lösung, die das Kapital anbieten kann, wird lediglich eine noch größere Bürde für die Arbeiterklasse und die sich abplackenden Massen bedeuten. Selbst wenn der Staat absolute Kontrolle über das Wirtschaftsleben der Gesellschaft ausübt, so wird sich die Krise dennoch weiter verschärfen, und dies infolge der Sättigung der Märkte und der Unfähigkeit der Bevölkerung, die überbordende Produktion von Waren innerhalb eines Systems aufzunehmen, das sein Leben der Konkurrenz und dem Profit verdankt. Die Geschichte hat bereits bewiesen, dass der Staatskapitalismus und der Totalitarismus eine zwecklose Reaktion des Kapitals im Angesicht einer permanenten und sich verschärfenden Krise ist. Der Zusammenbruch der Sowjetunion und Osteuropas Anfang der 1990er Jahre liefert Zeugnis ab für diese Tatsache.
Die Lösung der Krise liegt nicht innerhalb des sterbenden Systems, sondern außerhalb von ihm. Es liegt in den Händen der einzigen revolutionären Klasse – der Arbeiterklasse -, die Saat für die künftige kommunistische Revolution zu legen. Die Lösung ist nicht innerhalb des kapitalistischen Bollwerks noch ist sie auf den Spuren der Reformen oder im friedlichen Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus zu finden. Die Lösung liegt nicht in der absoluten Kontrolle des Wirtschaftslebens der Gesellschaft durch den Staat, sondern in der Zerstörung des Kapitalismus an sich wie auch des bürgerlichen Staates, der als Herrschaftsmaschinerie dient.
Mit anderen Worten: die Lösung der Ernährungskrise ist die Zerstörung eines Produktionssystems, das auf dem Markt und Profit basiert, und die Etablierung eines Systems, das auf der absoluten Produktion für die menschlichen Bedürfnisse basiert. Und der erste Schritt in diese Richtung und in Richtung einer revolutionären Umwandlung der Gesellschaft ist nicht die legalistische und reformistische Herangehensweise etlicher linksextremistischer Organisationen, noch liegt es in den Händen einer absolutistischen Staatsintervention, ihn zu tun. Er geschieht nicht auf dem friedlichen und „legalistischen“ Weg der lakbayan (Protestkarawanen und lange Märsche), die von den linksbürgerlichen Formationen popularisiert werden. Er geschieht auch nicht mittels Gewerkschaftstum. Die Lösung liegt in den Händen der Arbeiterklasse (9), die die Attacken des Kapitals auf ihrem eigenen Terrain mit ihren eigenen einheitlichen Kampforganen konfrontiert – die Arbeiterversammlungen, die Vorläufer der Arbeiterräte.
Arbeiter aller Länder, vereinigt euch! Nur auf dem Weg der Klasseneinheit wird nach der unvermeidlichen Zuspitzung der proletarischen Bewegung die proletarische Weltrevolution eingeleitet.
Internationalysmo, 7. Mai 2008
Fußnoten:
(1) Siehe in Environment News Service den englischsprachigen Bericht und auf der United Nations Site den französischen Bericht.
(2) Gil C. Cabacungan Jr., Arroyo warnte vor Reiskrise, Philippine Daily Inquire, 24. März 2008.
(3) „Die steigende Tendenz der internationalen Nahrungsmittelpreise setzte sich 2008 fort, ja beschleunigte sich. Die US-Weizenexportpreise stiegen von $375/Tonne im Januar auf $440/Tonne im März, und die thailändischen Reisexportpreise stiegen von $365/Tonne auf $562/Tonne. Dies war nur die Spitze einer 181prozentigen Verteuerung der globalen Weizenpreise in den 36 Monaten vor dem Februar 2008 und einer 83prozentigen Steigerung aller globalen Nahrungsmittelpreise in derselben Periode (...) Die beobachtete Verteuerung der Nahrungsmittelpreise ist kein vorübergehendes Phänomen, sondern wird sich noch weiter hinziehen. Es wird erwartet, dass die Preise für Getreide 2008 und 2009 hoch bleiben werden und dann zu fallen beginnen, da Angebot und Nachfrage auf die hohen Preise reagieren; jedoch werden sie aller Voraussicht nach bis 2015 für alle Getreidearten weit über dem Niveau von 2004 bleiben.“ (Rising Food Prices: Policy Options and World Bank Response, S. 2, unsere Hervorhebung, unsere Übersetzung)
(4) „Bangkok, 24. April – Die Benchmark thailändischer Reispreise sprang am Dienstag um mehr als fünf Prozent auf ein Rekordhoch von $1.000 die Tonne, und Händler unter den weltweit größten Exporteuren warnten vor weiteren Preissteigerungen, wenn der Iran und Indonesien in den Markt treten.“ (Reuters, Die Preise klettern auf ein neues Rekordhoch von über $1.000 pro Tonne, 24.4.2008 – gemeldet auf Flex News, unsere Übersetzung)
(5) Nationales Büro für Statistiken, Erhebung über Familieneinnahmen und –ausgaben 2006, Tag der Veröffentlichung: 11. Januar 2008.
(6) „Beware the New ‚Doubly Green Revolution‘“, ISIS-Presseveröffentlichung, 14.1.2008, unsere Übersetzung.
(7) Como, „Imperialist chaos, ecological disaster: Twin-track to capitalist oblivion“, Internationale Revue Nr. 129 (engl., franz. und span. Ausgabe), 2. Quartal, September 2007, S. 2.
(8) „Die Soyapa Erzeuger-Genossenschaft beschäftigt 360 VertragsarbeiterInnen, sowohl Erwachsene als auch Kinder. Die Genossenschaft wurde sechs Jahre zuvor auf Initiative von Stanfilco gegründet, als sie ihre Mitglieder davon überzeugte, Bananen zu pflanzen. Sie ist keine Kooperative – jeder Pflanzer behält seine eigene Parzelle als Eigentum, und jeder hat einen eigenen Vertrag abgeschlossen, um Bananen an Dole zu verkaufen.“ (Bananenkrieg auf den Philippinen – gemeldet am 8. Juli 1998 von Melissa Moore auf www.foodfirst.com [113])
(9) „Dass die Emanzipation der Arbeiterklasse von der Arbeiterklasse selbst erkämpft werden muss, dass der Kampf für die Emanzipation der Arbeiterklasse nicht einen Kampf um Klassenprivilegien und Monopole bedeutet, sondern für gleiche Rechte und Pflichten sowie für die Abschaffung der Klassenherrschaft“ (Die Internationale Arbeiterassoziation, Allgemeine Regeln, Oktober 1864, unsere Hervorhebung, unsere Übersetzung)
Aktuelles und Laufendes:
- Hungerrevolten [107]
- Nahrungsmittelkrise [114]
Theoretische Fragen:
- Umwelt [24]
Stellungnahme der KRASS (Russland) zum Krieg in Georgien
- 3116 reads
Stellungnahme der KRASS (Russland) zum Krieg in Georgien
Wir veröffentlichen nachfolgend eine Stellungnahme, die schon zu Beginn der Zusammenstöße in Georgien im Sommer 2008 von den Genoss/Innen der KRASS, einer kleinen Gruppe aus der anarcho-syndikalistischen Bewegung, von denen die meisten Genoss/Innen hauptsächlich in Russland wohnen, verbreitet wurde. Obgleich unsere beiden Organisationen bei bestimmten Fragen nicht übereinstimmen, stehen wir in brüderlichen politischen Beziehungen mit der KRASS; diese Beziehungen werden durch die internationalistischen Positionen untermauert, welche wir teilen. Diese Stellungnahme verdeutlicht nach den früheren Stellungnahmen der KRASS, insbesondere gegenüber dem Konflikt in Tschetschenien, erneut die sehr internationalistische Haltung der KRASS: · sie entblößen die ausschließlich kapitalistischen und imperialistischen Ziele der nationalen Regierungen und prangern deren Habsucht an, insbesondere die der Großmächte; · sie unterstützen keine der beiden kriegführenden Seiten im kapitalistischen und imperialistischen Konflikt ; · sie rufen die Arbeiter der am Krieg beteiligten Länder dazu auf, ihre Klassensolidarität über alle Landesgrenzen zu zeigen und den Kampf gegen ihre jeweiligen Ausbeuter zu führen. Deshalb unterstützen wir voll und ganz die wesentlichen Aussagen dieser Stellungnahme. Wir möchten jedoch präzisieren, dass die am Ende des Dokumentes an die Soldaten gerichteten Aufrufe (Weigerung, den Befehlen der Vorgesetzten zu folgen, die Waffen gegen sie zu richten usw.) zwar aus historischer Perspektive richtig sind (und sie wurden auch während der russischen Revolution 1917 und der deutschen Revolution 191 angewandt), aber sie können nicht unmittelbar umgesetzt werden, solange weder in der Region noch international die Arbeiterkämpfe ausreichend stark und gereift sind. In der gegenwärtigen Lage würde eine solche Haltung der Soldaten sie der schlimmsten Repression ausliefern, ohne dabei auf die Unterstützung ihrer Klassenbrüder/schwestern rechnen zu können. Aber wir möchten hier die unnachgiebige Verteidigung des Internationalismus der KRASS begrüßen sowie ihren politischen Mut, den sie seit Jahren unter besonders schweren Bedingungen in Anbetracht der Polizeirepression und des Gewichtes der Mystifikationen, insbesondere der nationalistischen, gezeigt haben. Diese Mystifikationen lasten auf dem Bewusstsein der Arbeiterklasse aufgrund des Gewichtes der stalinistischen Konterrevolution, die in Russland jahrzehntelang herrschte. Die IKS (25.08.08)
Nein zum neuen Krieg im Kaukasus !
Der Ausbruch neuer militärischer Aktionen zwischen Georgien und Südossetien droht zu einem viel größeren Krieg zwischen dem von der Nato unterstützten Georgien und dem russischen Staat zu werden. Tausende von Menschen wurden schon getötet oder verletzt, meist friedliche Zivilisten. Ganze Städte und zahlreiche Infrastrukturanlagen wurden zerstört. Die Gesellschaft ist von dem schmutzigen Strom des Nationalismus und der chauvinistischen Hysterie mitgerissen worden.
Wie immer und überall bei Konflikten zwischen den Staaten gibt es und kann es nichts Gerechtes bei diesem neuen Krieg im Kaukasus zu verteidigen geben. Alle Krieg führenden Parteien sind mitschuldig. Nachdem man jahrelang den Krieg mit angefacht hat, ist es schließlich zum militärischen Konflikt gekommen. Das Regime Saakashwili hat zwei Drittel der georgischen Bevölkerung in eine tiefgreifende Misere gestürzt. Je mehr die Wut in Georgien gegen diese Lage zunahm, desto mehr suchte das Regime nach einem Ausweg mittels eines „kleinen siegreichen Krieges“ in der Hoffnung, dass dies dem Regime helfen würde. Die russische Regierung ist wild entschlossen, ihre Vorherrschaft im Kaukasus aufrechtzuerhalten. Heute behauptet sie, die Schwachen zu schützen, aber ihre Heuchelei ist unverkennbar: Tatsächlich wiederholen die Truppen Saakaswilis nur das, was die Truppen Putins seit neun Jahren in Tschetschenien betreiben. Die führenden Kreise Ossetiens und Abchasiens wollen ihre Rolle als exklusive Verbündete Russlands in der Region verstärken, und dabei gleichzeitig die verarmten Massen um die Flamme der ‚nationalen Idee’ und der ‚Hilfe für das Volk’ versammeln. Die Führer der USA, der europäischen Staaten und der Nato wollen im Gegenzug so stark wie möglich den Einfluss der russischen Rivalen im Kaukasus schwächen, um damit die Kontrolle über die Ölquellen und die Transportwege zu sichern. So werden wir zu Zeugen und Opfern des neuen Brennpunktes der weltweiten Zusammenstöße um Energie, Öl und Gas.
Diese Kämpfe werden den Arbeitern in Georgien, Ossetien, Abchasien und Russland, nichts anderes bringen als Blut und Tränen, unberechenbare Desaster und Entbehrungen. Wir möchten unsere tiefgreifende Sympathie all den Freunden und Eltern der Opfer zum Ausdruck bringen, denjenigen, die obdachlos geworden und denen die Subsistenzmittel im Krieg geraubt wurden. Wir dürfen nicht dem Einfluss der nationalistischen Demagogie verfallen, die von uns Einheit mit „unserer“ Regierung verlangt und dabei die Fahnen der „Verteidigung des Vaterlandes“ ausrollt. Der Hauptfeind der einfachen Leute ist nicht der Bruder oder die Schwester auf der anderen Seite der Grenze oder einer anderen Nationalität. Die Feinde - das sind die Führer, die Arbeitgeber, die Präsidenten und Minister, die Geschäftsleute und die Generäle; all diejenigen, welche Kriege verursachen um ihre Macht und ihren Reichtum zu bewahren. Wir rufen die Arbeiter Russlands, Ossetiens, Abchasiens und Georgiens dazu auf, die Geißel des Nationalismus und des Patriotismus zu verwerfen, um ihre Wut gegen die Führer und Reichen zu richten, egal hinter welcher Landesgrenze sie leben.
Russische, georgische, ossetische und abchasische Soldaten! Gehorcht nicht den Befehlen Eurer Vorgesetzten! Dreht die Waffen um gegen all diejenigen, die Euch in den Krieg schicken wollen. Schießt nicht auf die „Feindessoldaten“, verbrüdert Euch mit ihnen! Steckt die Bajonette in den Boden!
Arbeiter hinter der Front! Sabotiert die Militärmaschinerie, legt die Arbeit nieder und beteiligt euch an den Versammlungen und Demonstrationen gegen den Krieg, organisiert Euch und streikt!
Nein zum Krieg und dessen Organisatoren – die Reichen und die Führer! Ja zur Solidarität der Arbeiter über alle Landesgrenzen und Fronten hinweg!
Föderation Erziehungswesen, Bildung und Techniker – KRAS-IWA.
Aktuelles und Laufendes:
- Georgien [110]
- Kaukasuskrieg [115]
- Internationalismus Kaukasus [116]
- Arbeiterklasse und Kaukasus [117]
Theoretische Fragen:
- Internationalismus [69]
September 2008
- 758 reads
Interne Debatte der IKS: Die Gründe für das „Wirtschaftswunder" nach dem Zweiten Weltkrieg
- 3557 reads
Im Frühling 2005 eröffnete die IKS eine interne Debatte über die ökonomische Analyse der starken Aufschwungsperiode nach dem Zweiten Weltkrieg (oft auch als „Die 30 glorreichen Jahre" bezeichnet). Diese Periode stellte mit ihren spektakulären und einzigartigen Wachstumsraten der Weltwirtschaft eine Ausnahme in der Geschichte der Dekadenz des Kapitalismus dar1. Diese Debatte war schon in früheren Texten der IKS aufgetaucht, welche sich unterschiedlich zur Rolle des Krieges innerhalb der kapitalistischen Wirtschaft und angesichts der fehlenden zahlungskräftigen Märkte äusserten. Eine erste Frage, die sich unsere Organisation stellte, war folgende: Ermöglichen Kriegszerstörungen den Aufbau neuer Absatzmärkte? Wenn dies jedoch nicht so ist, dann taucht automatisch einen andere Frage auf: Durch welche anderen Faktoren als die Kriegszerstörungen lassen sich die „30 glorreichen Jahre" schlüssig erklären? Die Debatte in der IKS über diese Fragen ist im Gange und die verschiedenen hier vorgestellten Positionen sind nicht vollständig entwickelt. Dennoch sind sie aber eine ausreichende Grundlage zur Veröffentlichung dieser Debatte gegen aussen. Dies vor allem, um die Debatte im Milieu der Leute, die sich auf die Positionen der Kommunistischen Linken hinbewegen, zu bereichern.
Auch wenn die Realität und die Entwicklung der Krise seit dem Ende des „Wirtschaftswunders" deutlich gezeigt haben, dass diese Periode eine Ausnahmesituation im dekadenten Kapitalismus war, so ist die Wichtigkeit der aufgetauchten Fragen keinesfalls zu unterschätzen. Diese Fragen führen uns zurück zum Kern der marxistischen Analyse und lassen uns auch den historisch begrenzten Charakter der kapitalistischen Produktionsweise verstehen. Der Eintritt des Kapitalismus in seine Dekadenz und die Unüberwindbarkeit der heutigen Krise sind eine der objektiven Grundlagen für die revolutionäre Perspektive der Arbeiterklasse.
Der Hintergrund der Debatte: gewisse Widersprüche in unseren Analysen
Die erneute kritische Lektüre unserer Broschüre Die Dekadenz des Kapitalismus2, hat innerhalb unserer Organisation ein Nachdenken und eine Debatte mit verschiedenen Positionen ausgelöst. Fragen bezüglich der Auswirkungen des Krieges in der Dekadenz des Kapitalismus hat sich die Arbeiterbewegung - vor allem die Kommunistische Linke - in der Vergangenheit schon gestellt. Die Broschüre Die Dekadenz des Kapitalismus entwickelt die Idee, dass die Kriegszerstörungen im dekadenten Kapitalismus, vornehmlich die Weltkriege, einen Absatzmarkt für die kapitalistische Produktion erzeugen - den Wiederaufbau: „Aber gleichzeitig sind mit der erhöhten Nachfrage nach neuen Märkten die äusseren Märkte stark zurückgegangen. Deshalb musste der Kapitalismus auf Hilfsmittel wie Zerstörungen und die Produktion von Zerstörungsmitteln zurückgreifen, um die größten Verluste oder die Abnahme an „Lebensraum" auszugleichen zu versuchen." (Kapitel: „Das Wachstum seit dem Zweiten Weltkrieg", Seite 21, deutsche Ausgabe).
„In der massiven Zerstörung im Hinblick auf den Wiederaufbau entdeckte der Kapitalismus einen gefährlichen und vorübergehenden, aber wirkungsvollen Ausweg für seine neuen Absatzprobleme.
Die Zerstörungen des Ersten Weltkrieges haben nicht ausgereicht (...) Von 1929 an befand sich der Kapitalismus erneut in einer Krise.
Es sieht so aus, als ob diese Lehre gut verstanden worden sei: die Zerstörungen, welche durch den Zweiten Weltkrieg angerichtet wurden, waren grösser sowohl in ihrer Intensität, als auch in ihrer Ausdehnung (...) Russland, Deutschland, Japan, Grossbritannien, Frankreich und Belgien litten gewaltig unter den Auswirkungen des Krieges, der zum ersten Mal das Ziel verfolgte, das bestehende industrielle Potential systematisch zu zerstören. Der „Wohlstand" Europas und Japans nach dem Kriege schien schon kurz nach dem Kriege systematisch mit eingeplant gewesen zu sein (Marshallplan-Hilfe, usw.) (Kapitel: „Der Zyklus Krieg-Wiederaufbau", Seite 22)
Eine solche Idee findet sich auch in verschiedenen Texten der Organisation (vor allem in der Internationalen Revue), sowie bei unseren Vorgängern von Bilan, die in einem Artikel mit dem Titel „Krisen und Zyklen in der Wirtschaft des niedergehenden Kapitalismus" schrieben: „Das folgende Massaker bildete ein beträchtliches Ventil für die kapitalistische Produktion und eröffnete „großartige" Perspektiven. (...) Während der Krieg das große Ventil für die kapitalistische Produktion ist, ist es in „Friedenszeiten" der Militarismus (d.h. alle Aktivitäten die mit der Vorbereitung auf den Krieg zu tun haben), der den Mehrwert fundamentaler Bereiche der vom Finanzkapital kontrollierten Produktion realisiert." (Bilan, Nr. 11, 1934 - wiederveröffentlicht in der Internationalen Revue Nr. 28, deutsch, Seiten 19 und 21).
In anderen Texten der IKS jedoch, die sowohl vor als auch nach der Broschüre Die Dekadenz des Kapitalismus erschienen, wird eine andere Analyse über die Rolle des Krieges in der Dekadenz entwickelt. Sie stützt sich auf den „Rapport der Konferenz der Französischen Kommunistischen Linken vom Juli 1945", für die der Krieg: „Ein unabdingbares Mittel des Kapitalismus war, welches ihm Entwicklungsmöglichkeiten eröffnete, in einer Epoche als diese Möglichkeiten auch vorhanden waren, aber nur mit gewalttätigen Methoden eröffnet werden konnten. Der Niedergang der kapitalistischen Welt aber, der historisch alle Möglichkeiten zu einer Entwicklung beendet hat, findet im modernen Krieg, im imperialistischen Krieg, den Ausdruck dieses Niedergangs. Es besteht keine weitere Möglichkeit zur Entwicklung der Produktion. Die Produktivkräfte werden auf dem Scheiterhaufen landen und es werden in einem immer schnelleren Rhythmus Ruinen über Ruinen hinterlassen." (Hervorhebung durch uns).
Der Bericht über den Historischen Kurs vom 3. Kongress der IKS3 bezieht sich ausdrücklich auf diese Passage im Text der Französischen Kommunistischen Linken, sowie auch der Artikel „Krieg, Militarismus und imperialistische Blöcke in der Dekadenz des Kapitalismus", den wir 1988 veröffentlichten4. Dort steht: „Was all diese Kriege auszeichnet, wie die zwei Weltkriege, ist, dass sie anders als diejenigen im vorangegangenen Jahrhundert keinen Fortschritt in der Entwicklung der Produktivkräfte ermöglichten. Sie hatten lediglich massive Zerstörungen und die Ausblutung der Länder in denen sie stattfanden zur Folge (ganz abgesehen von den schrecklichen Massakern)."
Der Rahmen der Debatte
All diese Fragen sind wichtig, weil die darauf gegebenen Antworten die theoretische Grundlage für die generelle politische Orientierung einer revolutionären Organisation ausmachen. Sie unterscheiden sich in ihrer Natur aber deutlich von Fragen, die eine Klassengrenze zwischen der Arbeiterklasse und der Bourgeoisie darstellen, wie der Internationalismus, die arbeiterfeindliche Rolle der Gewerkschaften, die Beteiligung am parlamentarischen Zirkus, usw. Oder anders ausgedrückt: die verschiedenen Positionen sind vollumfänglich in Einklang mit der Plattform der IKS.
Wenn gewisse Ideen aus der Broschüre Die Dekadenz des Kapitalismus kritisiert oder gar in Frage gestellt werden, so geschieht dies mit derselben Methode und im gleichen allgemeinen Rahmen der schon zur Zeit der Niederschrift dieser Broschüre vorhanden war und sich seither vertiefte5. Wir wollen das Wichtigste in Erinnerung rufen:
1. Die Anerkennung des Eintritts des Kapitalismus in seine dekadente Phase durch das Ausbrechen des Ersten Weltkrieges und die Anerkennung des unüberwindbaren Charakters der Widersprüche dieses Systems. Es handelt sich hier um ein Verständnis über die Ausdrücke und politischen Konsequenzen eines Wechsels in der historischen Periode, welche die Arbeiterbewegung damals mit den Worten „Das Zeitalter der Kriege und Revolutionen" bezeichnete.
2. Wenn wir die Dynamik der kapitalistischen Produktionsweise über eine gewisse Periode betrachten, so müssen wir nicht mit einer Studie der einzelnen Sektoren (Nationen, Unternehmen, usw.) des Kapitalismus beginnen, sondern den Kapitalismus als ein weltweites Ganzes betrachten. Denn nur dies erlaubt ein Verständnis der verschiedenen Teile. Dies war auch die Methode von Marx als er die Reproduktion des Kapitals untersuchte und er festhielt: „Um den Gegenstand der Untersuchung in seiner Reinheit, frei von störenden Nebenumständen aufzufassen, müssen wir hier die gesamte Handelswelt als eine Nation ansehen und voraussetzen, dass die kapitalistische Produktion sich überall festgesetzt und sich aller Industriezweige bemächtigt hat." (Das Kapital, Band 1, Kapitel 22: „Verwandlung von Mehrwert in Kapital", Ges. Werke, S. 607).
3. „Im Gegenteil zu dem, was die Verehrer des Kapitals suggerieren, schafft die kapitalistische Produktion jedoch nicht automatisch und wunschgemäß die für ihr Wachstum notwendigen Märkte. Der Kapitalismus entwickelte sich zunächst in einer nichtkapitalistischen Welt, worin er die für seine Entfaltung notwendigen Märkte fand. Nachdem er aber seine Produktionsverhältnisse auf die ganze Erde ausgedehnt und in einem einzigen Weltmarkt vereinigt hatte, erreichte der Kapitalismus Anfang des 20. Jahrhunderts die Schwelle zur Sättigung derselben Märkte, die im 19. Jahrhundert noch seine ungeheure Ausdehnung ermöglicht hatten. Darüber hinaus wurde durch die wachsende Schwierigkeit des Kapitals, Märkte zu finden, wo sein Mehrwert realisiert werden kann, der Druck auf die Profitrate verstärkt und ihr tendenzieller Fall bewirkt. Dieser Druck wird durch den ständigen Anstieg des konstanten, "toten" Kapitals (Produktionsmittel) zu Lasten des variablen, lebendigen Kapitals, die menschliche Arbeitskraft, ausgedrückt. Anfangs nur als Tendenz wirkend, wird der Fall der Profitrate schließlich immer spürbarer und zu einer zusätzlichen Bremse für den Akkumulationsprozess des Kapitals, also für die Funktionsweise des gesamten Systems." (Plattform der IKS Punkt 3: „Die Dekadenz des Kapitalismus", Seite 3 der deutschen Ausgabe)
4. Es war die Aufgabe von Rosa Luxemburg, auf der Grundlage der Arbeiten von Marx und der Kritik einer gewissen Unvollständigkeit dieser Arbeiten die These aufzustellen, dass zentral für die Bereicherung des Kapitalismus als Ganzes der Verkauf von eigens produzierten Waren auf außerkapitalistischen Märkten ist; das heißt, in Ökonomien, welche zwar Warenhandel betrieben, aber noch nicht in die kapitalistische Produktionsweise integriert waren: „In Wirklichkeit sind die realen Bedingungen bei der Akkumulation des Gesamtkapitals ganz andere als bei dem Einzelkapital und als bei der einfachen Reproduktion. Das Problem beruht auf folgendem: Wie gestaltet sich die gesellschaftliche Reproduktion unter der Bedingung, dass ein wachsender Teil des Mehrwerts nicht von den Kapitalisten konsumiert, sondern zur Erweiterung der Produktion verwendet wird? Das Draufgehen des gesellschaftlichen Produkts, abgesehen von dem Ersatz des konstanten Kapitals, in der Konsumtion der Arbeiter und Kapitalisten ist hier von vornherein ausgeschlossen, und dieser Umstand ist das wesentlichste Moment des Problems. Damit ist aber auch ausgeschlossen, dass die Arbeiter und die Kapitalisten selbst das Gesamtprodukt realisieren können. Sie können stets nur das variable Kapital, den verbrauchten Teil des konstanten Kapitals und den konsumierten Teil des Mehrwerts selbst realisieren, auf diese Weise aber nur die Bedingungen für die Erneuerung der Produktion in früherem Umfang sichern. Der zu kapitalisierende Teil des Mehrwerts hingegen kann unmöglich von den Arbeitern und Kapitalisten selbst realisiert werden. Die Realisierung des Mehrwerts zu Zwecken der Akkumulation ist also in einer Gesellschaft, die nur aus Arbeitern und Kapitalisten besteht, eine unlösbare Aufgabe." (Rosa Luxemburg, Die Akkumulation des Kapitals, Kapitel 26: „Die Reproduktion des Kapitals und ihr Milieu", Ges. Werke, Bd. 5, S. 299).
Die IKS hat diese Analyse im Allgemeinen übernommen, was aber nicht heißt, dass innerhalb unserer Organisation nicht Positionen existieren können, welche die ökonomische Auffassung von Luxemburg kritisieren. Das werden wir im Speziellen noch bei einer der hier präsentierten Positionen sehen. Luxemburgs Analyse wurde zu ihrer Zeit nicht nur von den Reformisten bekämpft, welche nicht wahrhaben wollten, dass der Kapitalismus einer Katastrophe entgegen ging, sondern auch aus dem revolutionären Lager und dabei von nicht geringeren als Lenin und Pannekoek. Sie gingen zwar ebenfalls davon aus, dass der Kapitalismus eine historisch überlebte Produktionsweise geworden war, doch waren ihre Begründungen anders als die von Rosa Luxemburg.
5. Das Phänomen des Imperialismus rührt exakt von der Notwendigkeit der entwickelten Länder her, außerkapitalistische Märkte zu erobern: „Der Imperialismus ist der politische Ausdruck des Prozesses der Kapitalakkumulation in ihrem Konkurrenzkampf um die Reste des noch nicht mit Beschlag belegten nichtkapitalistischen Weltmilieus." (Rosa Luxemburg, Die Akkumulation des Kapitals, Kapitel 31: „Schutzzoll und Akkumulation", Ges. Werke Bd. 5 S. 391)
6. Der historisch begrenzte Charakter der außerkapitalistischen Märkte bildet die ökonomische Grundlage für die Dekadenz des Kapitalismus. Der Erste Weltkrieg war Ausdruck eines solchen Widerspruchs. Die Aufteilung der Welt unter den Großmächten war abgeschlossen und diejenigen, welche mit ihrem Besitz an Kolonien am schlechtesten dastanden, hatten keine andere Wahl, als eine Neuaufteilung mit militärischen Mitteln zu suchen. Der Eintritt des Kapitalismus in seine niedergehende Phase war Beweis für die Unlösbarkeit der Widersprüche dieses Systems.
7. Die Einführung von staatskapitalistischen Maßnahmen in der Dekadenz des Kapitalismus ist für die Bourgeoisie Hilfsmittel, um die Krise zu bremsen und ihre schlimmsten Auswirkungen abzuschwächen. Sie versuchen damit zu verhindern, dass sich die Krise erneut in einer dermaßen brutalen Form zeigt wie dies 1929 der Fall gewesen war.
8. In der Periode der Dekadenz ist der Kredit ein wesentliches Mittel, mit dem die herrschende Klasse versucht, dem Mangel an außerkapitalistischen Märkten entgegen zu wirken. Die Anhäufung von je länger je weniger kontrollierbaren Schulden, die wachsende Zahlungsunfähigkeit der verschiedenen kapitalistischen Sektoren und die sich steigernde Instabilität der Weltwirtschaft zeigen aber klar die Grenzen des Kredits.
9. Ein typischer Ausdruck der Dekadenz des Kapitalismus auf ökonomischer Ebene sind die wachsenden unproduktiven Ausgaben. Sie zeigen, wie die unüberwindbaren Widersprüche dieses Systems die Entwicklung der Produktivkräfte hemmt: die Militärausgaben (Waffen und Militäreinsätze) angesichts der weltweit sich verschärfenden imperialistischen Spannungen; die Ausgaben zur Aufrechterhaltung und Ausrüstung der Repressionsapparate, um letzten Endes gegen den Kampf der Arbeiterklasse vorzugehen; die Werbung, als Waffe des ökonomischen Wettkampfes auf dem übersättigten Markt; usw. Vom ökonomischen Standpunkt aus gesehen bilden solche Ausgaben einen totalen Verlust für das Kapital.
Die Positionen in der gegenwärtigen Debatte
Innerhalb der IKS existiert eine Position, die zwar mit unserer Plattform einverstanden ist, aber verschiedene Aspekte des Beitrags von Rosa Luxemburg zu den Gründen der ökonomischen Krise zurückweist6. Für diese Position liegen die Gründe der Krise in einem anderen Widerspruch, der von Marx hervorgehoben wurde: dem tendenziellen Fall der Profitrate. Während sie Konzepte zurückweist (die vor allem von den Bordigisten und Rätisten vertreten werden) die davon ausgehen, dass der Kapitalismus automatisch und für alle Ewigkeit die Ausdehnung seiner eigenen Märkte aufrechterhalten kann, solange nur die Profitrate genug hoch ist, hebt sie hervor, dass der Grundwiderspruch des Kapitalismus nicht in den Grenzen der Märkte liegt (also der Form in der sich die Krise manifestiert), sondern in der Barriere zur Ausdehnung der Produktion.
Das Wesentliche zur Debatte über diese Position haben wir schon in Polemiken mit anderen Organisationen beschrieben (auch wenn es Unterschiede dabei gibt), in denen die Sättigung der Märkte und der Fall der Profitrate beleuchtet werden7. Dennoch, und das werden wir später noch sehen, existiert eine gewisse Übereinstimmung dieser Auffassung mit einer Position in der gegenwärtigen Debatte, die sich „Keynesianisch-Fordistischer Staatskapitalismus" nennt und ebenfalls in diesem Text vorgestellt wird. Diese zwei Positionen gehen davon aus, dass es einen internen Markt innerhalb der kapitalistischen Produktionsverhältnisse gab, welcher ein Faktor der Prosperität des so genannten „Wirtschaftswunders" war. Sie analysieren das Ende dieser Periode als Produkt des „tendenziellen Falls der Profitrate".
Die anderen Positionen in der Debatte beziehen sich auf den Rahmen der Analyse Rosa Luxemburgs über die zentrale Rolle des Mangels an außerkapitalistischen Märkten für die Krisen und die Dekadenz des Kapitalismus.
Aufgrund dieser Analyse hat ein Teil der Organisation erkannt, dass in unserer Broschüre Die Dekadenz des Kapitalismus Widersprüche vorhanden sind. Die Broschüre bezieht sich auf denselben Rahmen, insofern sie die Akkumulation während des „Wirtschaftswunders" in der Entstehung eines Wiederaufbau-Marktes sieht, der nicht außerkapitalistisch ist.
Aufgrund dieser Kritik entstand innerhalb der IKS eine Position - sie ist hier unter dem Titel „Kriegswirtschaft und Staatskapitalismus" aufgeführt -, welche Kritiken an unserer Broschüre formuliert. Vor allem kritisiert sie eine fehlende Genauigkeit und die mangelnde Beachtung des Marshall-Plans in der Erklärung des Wiederaufbaus. Zudem bezieht sie sich grundsätzlich „auf die Idee, dass die Prosperität der 50er und 60er Jahre durch die globale Situation der imperialistischen Machtverhältnisse und die Installierung einer permanenten Kriegswirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg bestimmt ist".
Der Teil unserer Organisation, welcher die Analyse der Broschüre Die Dekadenz des Kapitalismus über das „Wirtschaftswunder" kritisiert, hat zwei verschiedene Interpretationen über die Prosperität dieser Periode formuliert. Die erste - hier unter dem Titel „Außerkapitalistische Märkte und Verschuldung" präsentiert - misst den beiden Faktoren, welche die IKS in ihrer Vergangenheit schon analysiert hat, eine grössere Bedeutung zu8. Laut dieser Position „sind diese zwei Faktoren ausreichend, um sich die Prosperität des Wirtschaftswunders zu erklären".
Die zweite Position - unter dem Titel „Keynesianisch-Fordistischer Staatskapitalismus" präsentiert - „geht vom selben Punkt aus, der in der Broschüre über die Dekadenz entwickelt ist: die relative Sättigung der Märkte 1914, verglichen mit dem Bedürfnis nach Akkumulation auf Weltebene. Sie entwickelt die Idee, dass nach 1945 das System mit der Einführung einer Variante des Staatskapitalismus antwortete, basierend auf einer Dreiteilung (Keynesianismus) der enorm gesteigerten Produktivität (Fordismus) in Profit, Staatsabgaben und Reallöhne".
Das Ziel dieses ersten Artikels zur Debatte über die „30 glorreichen Jahre" ist die nun erfolgte kurze Vorstellung dieser Positionen und im nachfolgenden Rest des Textes je eine zusammengefasste Präsentation der drei Positionen. Dies um die Debatte anzuregen9. Wir werden später ausführlichere Beiträge zu den verschiedenen Positionen publizieren oder auch andere, die im Laufe der Debatte auftauchen.
1. Kriegswirtschaft und Staatskapitalismus
Der Ausgangspunkt dieser Position ist schon 1945 von der Französischen Kommunistischen Linken entwickelt worden. Sie hielt fest, dass seit 1914 die außerkapitalistischen Märkte, welche das notwendige Ausdehnungsgebiet des Kapitalismus während seiner aufsteigenden Periode dargestellt hatten, nicht mehr ausreichten: „Die jetzige Periode ist die der Dekadenz des Kapitalismus. Was bedeutet dies? Die herrschende Klasse lebte vor dem ersten imperialistischen Krieg mit einer ständigen Ausdehnung der Produktion, und sie konnte auch nicht anders. Nun ist sie am Punkt ihrer Geschichte angekommen, an dem sie diese Ausdehnung nicht mehr in derselben Weise fortführen kann. (...) Heute ist die Bourgeoisie in allen Teilen - abgesehen von unbrauchbaren entfernten Gebieten, von zu vernachlässigenden Übrigbleibseln der nichtkapitalistischen Welt, die ungenügend sind, um die weltweite Produktion aufzunehmen - Herrin dieser Welt, doch hat sie keine außerkapitalistische Länder mehr vor sich, die für ihr System neue Märkte darstellen könnten: Und damit beginnt auch ihre Dekadenz."10
Die Geschichte der Weltwirtschaft seit 1914 ist der Versuch der herrschenden Klasse in den verschiedenen Ländern, dieses grundsätzliche Problem zu überwinden: wie den durch die kapitalistische Ökonomie produzierten Mehrwert akkumulieren, in einer Welt, die schon unter den großen imperialistischen Mächten aufgeteilt ist und in welcher der Markt die Gesamtheit des Mehrwertes nicht mehr aufnehmen kann? Und seit die imperialistischen Mächte nur noch auf Kosten ihrer Rivalen expandieren können, müssen sie sich nach der Beendigung eines Krieges schon wieder auf den nächsten vorbereiten. Die Kriegswirtschaft wird zum Überlebensprinzip der kapitalistischen Gesellschaft. „Die Kriegsproduktion hat nicht das Ziel, ein ökonomisches Problem zu lösen. Sie ist im Wesentlichen Ergebnis der Notwendigkeit des kapitalistischen Staates, sich einerseits gegen die enteigneten Klassen zu verteidigen und durch Gewalt deren Ausbeutung aufrecht zu erhalten und andererseits mit Gewalt ihre wirtschaftliche Position zu stärken und sie auf Kosten der anderen imperialistischen Staaten zu erweitern (...) Die Kriegsproduktion wird auch bestimmend für die industrielle Produktion und hauptsächliches ökonomisches Betätigungsfeld der Gesellschaft" (Internationalisme: „Bericht über die internationale Lage", Juli 1945).
Die Wiederaufbauperiode - das so genannte „Wirtschaftswunder" - ist ein Teil dieser Geschichte.
Drei ökonomische Charakteristiken der Welt nach 1945 sollen hier hervorgehoben werden:
- Erstens: Es gab eine gewaltige wirtschaftliche und militärische Vorherrschaft der USA, wie sie in der Geschichte des Kapitalismus noch nie vorgekommen war. Die USA stellten selbst die Hälfte der weltweiten Produktion und besaßen fast 80% der globalen Goldreserven. Sie waren der einzige kriegführende Staat, dessen Produktionsapparat unbeschädigt aus dem Krieg hervorkam. Ihr Bruttosozialprodukt verdoppelte sich zwischen 1940 und 1945. Sie absorbierten das gesamte, vom britischen Empire während all der Jahre der Kolonialherrschaft akkumulierte Kapital und dazu noch einen Teil desjenigen des französischen Kolonialreichs.
- Zweitens: In den Reihen der herrschenden Klasse der westlichen Länder existierte ein klares Bewusstsein darüber, dass der Lebensstandard der Arbeiterklasse notwendigerweise zu heben ist, um soziale Unruhen zu vermeiden, welche von den Stalinisten und dem gegnerischen russischen Block ausgenützt werden könnten. Die Kriegswirtschaft beinhaltete einen neuen Aspekt, dessen sich unsere Vorgänger der Französischen Kommunistischen Linken damals nicht vollständig bewusst waren: die verschiedenen sozialen Einrichtungen (Gesundheitswesen, Arbeitslosenversicherungen, Pensionen, usw.), welche die herrschende Klasse - vor allem die des westlichen Blocks - zu Beginn des Wiederaufbaus in den 1940er Jahren eingerichtet hatten.
- Drittens: Der Staatskapitalismus, der vor dem Zweiten Weltkrieg eine Tendenz hin zur Autarkie der verschiedenen nationalen Ökonomien eingenommen hatte, war jetzt in die Struktur von imperialistischen Blöcken integriert, welche die wirtschaftlichen Beziehungen unter den Staaten bestimmte (Bretton Woods für den amerikanischen Block, COMECON für den russischen Block).
Während des Wiederaufbaus erfuhr der Staatskapitalismus eine qualitative Entwicklung: Der Anteil des Staates in der nationalen Ökonomie wurde dominierend11. Selbst heute, nach 30 Jahren des so genannten „Liberalismus" bilden die Staatsausgaben einen Anteil zwischen 30-60% des Bruttoinlandproduktes der Industrieländer.
Dieses neue Gewicht des Staates war ein Übergang von Quantität in Qualität. Der Staat war nicht mehr nur „ausführendes Organ" der herrschende Klasse, er war auch der größte Arbeitgeber und stellte den größten Markt. In den USA zum Beispiel wurde das Pentagon der größte Arbeitgeber des Landes (mit 3 bis 4 Millionen zivilen und militärischen Beschäftigten). Dadurch spielte er eine gewichtige Rolle in der Wirtschaft und ermöglichte es, die bestehenden Märkte noch besser auszuschöpfen.
Die Inkraftsetzung des Bretton-Woods-Abkommens ermöglichte auch die Einführung eines verfeinerten und weniger anfälligen Kreditsystems im Vergleich zur Vergangenheit: Das Konsumkreditwesen wurde ausgebaut, und die ökonomischen Institutionen, die vom amerikanischen Block gegründet wurden (IWF, Weltbank, GATT) ermöglichten die Verhinderung von Finanz- und Bankenkrisen.
Die enorme wirtschaftliche Überlegenheit der USA erlaubte es der amerikanischen Bourgeoisie, schrankenlos Geld auszugeben, um ihre militärische Überlegenheit gegenüber dem russischen Block zu sichern: Sie unterstützten zwei blutige und kostspielige Kriege (Korea und Vietnam), Projekte à la Marshall-Plan und fremde Investitionen für den Wiederaufbau der ruinierten europäischen Wirtschaft Europas und Asiens (vor allem in Korea und Japan). Doch diese enorme Anstrengung - nicht durch die „klassische" Funktionsweise des Kapitalismus bestimmt, sondern durch die imperialistische Konfrontation, welche die Dekadenz dieses Systems kennzeichnet - endete im Ruin der amerikanischen Wirtschaft. 1958 befand sich der amerikanische Staatshaushalt bereits in einem Defizit, und 1970 besaßen die USA nur noch 16% der weltweiten Goldreserven. Das Bretton-Woods-System erlitt Schiffbruch, und die Welt stürzte in eine Krise, von der sie sich bis heute nicht erholt hat.
2. Außerkapitalistische Märkte und Verschuldung
Weit davon entfernt, die Produktivkräfte in einer vergleichbaren Art und Weise zu steigern, wie dies in der aufsteigenden Phase des Kapitalismus der Fall gewesen war, charakterisierte sich das „Wirtschaftswunder" durch eine enorme Verschwendung von Mehrwert. Dies war ein Zeichen für die Fesselung der Entwicklung der Produktivkräfte, welche die Dekadenz des Kapitalismus kennzeichnet.
Der Wiederaufbau nach dem Ersten Weltkrieg eröffnete eine Phase der Prosperität, die aber nur einige Jahre anhielt. Während dieser Zeit bildeten Verkäufe auf außerkapitalistischen Märkten die notwendige Grundlage für die Akkumulation, so wie es schon vor Ausbruch des Konfliktes der Fall gewesen war. Auch wenn die Welt damals schon unter den größten Industriestaaten aufgeteilt war, so war sie noch weit davon entfernt, von der kapitalistischen Produktionsweise gänzlich beherrscht zu werden. Trotzdem war die Aufnahmefähigkeit der außerkapitalistischen Märkte ungenügend, gemessen an der Menge der in den industrialisierten Ländern hergestellten Waren. Der Aufschwung brach deshalb durch der Krise von 1929 schnell an der Überproduktion zusammen.
Ganz anders dagegen war die Periode des auf den Zweiten Weltkrieg folgenden Wiederaufbaus, der die besten wirtschaftlichen Kennzahlen der aufsteigenden Phase des Kapitalismus in den Schatten stellte. Während mehr als zwei Jahrzehnten entwickelte sich ein anhaltendes Wachstum aufgrund der größten Produktivitätssteigerungen in der Geschichte des Kapitalismus. Dies war vor allem der Perfektionierung der Fließbandproduktion (Fordismus), der Automatisierung der Produktion und ihrer größtmöglichen Ausweitung geschuldet.
Doch genügt es nicht, nur Waren zu produzieren, man muss sie auch auf dem Markt verkaufen können. Der Erlös aus dem Verkauf von Waren, die im Kapitalismus produziert werden, dient der notwendigen Erneuerung der Produktionsmittel und dem Kauf der Arbeitskraft (Löhne der Arbeiter). Er dient also der einfachen Reproduktion des Kapitals (ohne Ausweitung der Produktionsmittel oder der Konsumtion), er muss aber auch die unproduktiven Kosten abdecken. Diese reichen von den Rüstungsausgaben bis hin zum Lebensunterhalt der Kapitalisten und beinhalten zahlreiche andere Kosten, auf die wir noch zurückkommen werden. Wenn nach all dem ein positiver Saldo übrig bleibt, kann dieser der Akkumulation des Kapitals zugeführt werden.
Bei den jährlich gemachten Verkäufen im Kapitalismus ist der Anteil, welcher der Akkumulation des Kapitals zufließt und der seine Besitzer somit bereichert, notwendigerweise beschränkt, weil er den Überschuss nach Abzug all der anderen notwendigen Ausgaben darstellt. Historisch gesehen stellt er nur einen kleinen Prozentsatz des jährlich produzierten Reichtums dar[12] und korrespondiert im Wesentlichen mit den Verkäufen auf außerkapitalistischen Märkten (interne und externe)13. Dies ist effektiv das einzige Mittel für den Kapitalismus, sich zu entwickeln (neben der Ausbeutung der außerkapitalistischen Ökonomien, ob legal oder illegal). Oder mit anderen Worten: um nicht in einer Situation zu sein, in der „die Kapitalisten ja selbst nur unter sich ihre Waren auszutauschen und aufzuessen haben" was, wie es Marx ausdrückte, „keineswegs eine Wertsteigerung des Kapitals erlaubt": „Wie könnte es sonst an Nachfrage für dieselben Waren fehlen, deren die Masse des Volks ermangelt, und wie wäre es möglich, diese Nachfrage im Ausland suchen zu müssen, auf fernern Märkten, um den Arbeitern zu Hause das Durchschnittsmaß der notwendigen Lebensmittel zahlen zu können? Weil nur in diesem spezifischen, kapitalistischen Zusammenhang das überschüssige Produkt eine Form erhält, worin sein Inhaber es nur dann der Konsumtion zur Verfügung stellen kann, sobald es sich für ihn in Kapital rückverwandelt. Wird endlich gesagt, dass die Kapitalisten ja selbst nur unter sich ihre Waren auszutauschen und aufzuessen haben, so wird der ganze Charakter der kapitalistischen Produktion vergessen und vergessen, dass es sich um die Verwertung des Kapitals handelt, nicht um seinen Verzehr".14
Mit dem Eintritt des Kapitalismus in seine Dekadenz wurden die außerkapitalistischen Märkte immer unzureichender, doch sie verschwanden nicht einfach und ihre Lebensfähigkeit hing, gleich wie in der aufsteigenden Phase, vom Fortschreiten der Industrialisierung ab. Die außerkapitalistischen Märkte wurden immer unfähiger, die wachsende Produktion an Gütern durch den Kapitalismus aufzunehmen. Das Resultat war eine Überproduktion und mit ihr die Vernichtung eines Teils der Produktion, außer wenn der Kapitalismus den Kredit einsetzte, um dieser Situation entgegen zu wirken. Doch je mehr sich die außerkapitalistischen Märkte verringern, desto weniger können die Kredite zurückbezahlt werden.
Das zahlungskräftige Feld für das Wachstum des fast 30 Jahre andauernden „Wirtschaftswunders" entstand aus einer Kombination von Ausbeutung dieser immer noch existierenden außerkapitalistischen Märkte und einer Verschuldung, weil erstere nicht fähig waren, die die Gesamtheit des Angebots aufzunehmen. Es gibt keinen anderen Weg (außer einmal mehr die Ausbeutung der außerkapitalistischen Reichtümer), der die Expansion des Kapitalismus in dieser Periode ermöglichte, so wie es auch in allen anderen Perioden der Fall ist. Deshalb leistete das „Wirtschafswunder" seinen eigenen kleinen Beitrag am heutigen Schuldenberg, der niemals zurückbezahlt werden kann und wie ein Damoklesschwert über dem Kapitalismus schwebt.
Ein anderes Charakteristikum des „Wirtschaftswunders" ist das Gewicht der unproduktiven Kosten in der Wirtschaft. Sie bilden einen bedeutenden Anteil der Staatsausgaben, die ab Ende der 1940er Jahre in den meisten industrialisierten Staaten beträchtlich anwuchsen. Dies war das geschichtliche Ergebnis der Entwicklung hin zum Staatskapitalismus und dabei vor allem des Gewichts des Militarismus in der Wirtschaft, welches nach dem Zweiten Weltkrieg sehr hoch war, und zugleich auch das Ergebnis einer keynesianischen Politik, die eine künstliche Nachfrage schaffte. Wenn eine Ware oder ein Angebot unproduktiv ist, bedeutet dies, dass deren Gebrauchswert nicht in den Produktionsprozess einfließen kann15, um so an der einfachen oder erweiterten Reproduktion des Kapitals teilzunehmen. Wir müssen also auch diejenigen Kosten als unproduktiv betrachten, welche im Zusammenhang mit einer Nachfrage innerhalb des Kapitalismus stehen, die aber für die einfache und erweiterte Reproduktion nicht notwendig sind. Dies war während des „Wirtschaftswunders" im Speziellen der Fall bei den schrittweisen Lohnerhöhungen in Anpassung an die Produktivitätssteigerung der Arbeit, von der gewisse Teile der Arbeiterklasse in bestimmten Ländern „profitiert" hatten und in denen eine keynesianische Doktrin vollzogen wurde. Die Ausbezahlung von Löhnen, welche höher sind als das strikt Notwendige zur Wiederherstellung der Arbeitskraft ist, genauso wie die miserablen Arbeitslosengelder oder die unproduktiven Ausgaben des Staates, im Grunde eine Verschwendung von Kapital, das nicht mehr an der Wertsteigerung des globalen Kapitals teilnehmen kann. Mit anderen Worten: Das Kapital welches in unproduktive Ausgaben gesteckt wird ist, wie auch immer sie aussehen, sterilisiert.
Die Bildung eines internen Marktes durch den Keynesianismus als eine unmittelbare Lösung zum Absatz der massiven industriellen Produktion hat Illusionen in eine dauerhafte Rückkehr des Wachstums wie zu Zeiten des aufsteigenden Kapitalismus geweckt. Doch seit der Markt komplett abgenabelt wurde von den Bedürfnissen der Wertsteigerung des Kapitals, hatte dies die Sterilisierung eines beträchtlichen Teils des Kapitals zur Folge. So weiterzufahren war nur durch eine Verbindung von verschiedenen und sehr außergewöhnlichen Faktoren möglich, die aber nicht dauerhaft sein konnten:
- ein Produktivitätsanstieg der Arbeit, welcher bei einer gleichzeitigen Finanzierung unproduktiver Ausgaben genügend groß war, um einen Überschuss abzuwerfen für die Weiterführung der Akkumulation;
- die Existenz von zahlungskräftigen Märkten - die entweder außerkapitalistisch oder das Resultat einer Verschuldung waren - und eine Realisierung des Überschusses ermöglichten.
Eine Steigerung der Produktivität wie zu Zeiten des „Wirtschaftswunders" ist seither nicht mehr erreicht worden. Auch wenn dies eintreffen würde, so zeigt das totale Verschwinden der außerkapitalistischen Märkte und die Tatsache, dass praktisch eine Grenze zur Wiederbelebung der Wirtschaft durch eine noch höhere weltweite Verschuldung (welche bereits gigantisch ist) erreicht ist, die Unmöglichkeit der Wiederholung einer solchen Wachstumsperiode.
Im Gegensatz zur Analyse in unserer Broschüre Die Dekadenz des Kapitalismus bildete der Markt des Wiederaufbaus keinen Faktor, der den Aufschwung während des „Wirtschaftswunders" nach dem Zweiten Weltkrieg erklären könnte. Am Ende des Zweiten Weltkrieges bildete der Wiederaufbau des Produktionsapparates an sich keinen außerkapitalistischen Markt und kreierte selbst keinen Wert. Er war großteils das Resultat eines Transfers von Reichtum, der bereits in den USA akkumuliert war, in diejenigen Länder, die den Wiederaufbau brauchten. Die Finanzierung wurde durch den Marshall-Plan übernommen, und somit war es im Wesentlichen ein Geschenk aus der staatlichen Schatztruhe der USA. Ein solcher Markt des Wiederaufbaus genügt auch nicht als Erklärung für die kurze Aufschwungsphase nach dem Ersten Weltkrieg. Dies ist der Grund, weshalb das Schema „Krieg-Wiederaufbau/Prosperität", das zwar empirisch der Realität des dekadenten Kapitalismus entspricht, kein ökonomisches Gesetz darstellt, nach dem es einen Markt des Wiederaufbaus gäbe, der den Kapitalismus bereichern könnte.
3. Keynesianisch-Fordistischer Staatskapitalismus
Unsere Analyse über die Triebkräfte hinter den Nachkriegsboom beruht auf einer Reihe von objektiven Feststellungen. Hier die Wichtigsten:
Die weltweite Pro-Kopf-Produktion verdoppelte sich während der aufsteigenden Periode des Kapitalismus16, und die industriellen Wachstumsraten stiegen kontinuierlich an, bis sie am Vorabend des Ersten Weltkrieges ihren Höhepunkt erreichten17. Zu diesem Zeitpunkt erreichten die Märkte, die dem Kapitalismus als Expansionsfeld gedient hatten, einen Grad relativer Sättigung, gemessen am weltweiten Bedürfnis zur Akkumulation. Dies war der Beginn der dekadenten Phase des Kapitalismus, welche durch zwei Weltkriege, die größte je erlebte Überproduktionskrise (1929-33) und einen massiven Einbruch im Wachstum der Produktivkräfte gekennzeichnet war (sowohl bei der industriellen Produktion als auch beim weltweiten Pro-Kopf-Produkt halbieren sich die Wachstumszahlen zwischen 1913 und 1945 fast auf die Hälfte: 2,8% bzw. 0,9% pro Jahr).
Doch dies hielt den Kapitalismus keineswegs davon ab, nach dem Zweiten Welzkrieg fast 30 Jahre lang eine Zeit des enormen Wachstums zu erleben. Das weltweite Pro-Kopf-Produkt verdreifachte sich, während sich die industrielle Produktion mehr als verdoppelte (2,9% bzw. 5,2% pro Jahr). Diese Zahlen sind nicht nur höher als die während der aufsteigenden Periode des Kapitalismus, auch die Reallöhne steigerten sich vier mal schneller (sie erhöhten sich um das Vierfache, während sie sich in der Zeit zwischen 1850 und 1913, die doppelt so lang war, nur knapp verdoppelt hatten)!
Wie konnte ein solches „Wirtschaftswunder" geschehen?
- nicht durch eine noch übrig gebliebene außerkapitalistische Nachfrage, da diese schon 1914 ungenügend war und sich danach noch verkleinerte18;
- nicht durch staatliche Verschuldung und defizitäre Budgets, da diese in der Zeit des „Wirtschaftswunders" stark zurückgingen19;
- nicht durch Kredite, da diese nach Rückkehr der Krise erst wirklich zum Zuge kamen und anwuchsen20;
- nicht durch die Kriegsproduktion, weil sie unproduktiv ist: die am meisten aufgerüsteten Länder waren am wenigsten leistungsfähig und umgekehrt;
- nicht durch den Marshall-Plan, da er in seiner Wirkung und Dauer begrenzt war21;
- nicht durch die Kriegszerstörungen, da diejenigen des Ersten Weltkrieges keinerlei Prosperität erzeugt hatten22;
- nicht durch ein Anwachsen des Gewichtes des Staates in der Wirtschaft, da es sich in der Zeit zwischen den Weltkriegen verdoppelt hatte, aber keine solche Wirkung erzeugte23, da sein Anteil 1960 geringer war (19%) als 1937 (21%) und es große unproduktive Ausgaben beinhaltete.
Die Erklärungen für das „Wirtschaftswunder" liegen woanders. Vor allem weil: (a) die Wirtschaft nach dem Krieg ausgeblutet war, (b) die Kaufkraft aller wirtschaftlichen Akteure auf einem Tiefststand war, (c) Letztere gewaltig verschuldet waren, (d) die enorme Macht der USA auf einer unproduktiven Kriegswirtschaft basierte, welche große Schwierigkeiten hatte, sich wieder in eine zivile Wirtschaft umzuwandeln, und (e) dieses „Wirtschaftswunder" eintrat, obwohl große Mehrwertmassen in die unproduktiven Ausgaben flossen!
In Wirklichkeit ist dieses Wunder keines mehr, wenn wir die Analysen von Marx über die Produktivitätssteigerungen24 und die Beiträge der Kommunistischen Linken zur Entwicklung des Staatskapitalismus in der Dekadenz des Kapitalismus miteinander verbinden. Diese Periode zeichnete sich im Wesentlichen durch folgendes aus:
a) Eine nie vorher in der Geschichte des Kapitalismus erlebte Produktivitätssteigerung. Eine Steigerung die sich auf die Verallgemeinerung und Entwicklung der Fließbandproduktion stützte (der Fordismus).
b) Ein kontinuierlicher Anstieg der Reallöhne, eine Vollbeschäftigung und die Einführung eines indirekten Lohnes mittels verschiedener Sozialleistungen. Überdies waren die Länder mit den größten Lohnsteigerungen auch die mit den stärksten Wachstumszahlen in der Gesamtwirtschaft, und umgekehrt.
c) Eine Übernahme der gesamten Produktion durch den Staat und starke Interventionen desselben in die Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit25.
d) All diese keynesianischen Maßnahmen wurden in hohem Masse auf internationalem Niveau organisiert durch OECD, GATT, IWF, Weltbank, usw.
e) Schlussendlich war im Gegensatz zu anderen Perioden das „Wirtschaftswunder" auf diejenigen Länder mit einer bereits entwickelten Wirtschaft konzentriert (und dies bei einem relativ geringen Austausch zwischen den Ländern der OECD und dem Rest der Welt), und es erfolgten keine bemerkenswerten Produktionsauslagerungen in Billiglohn-Länder trotz starkem Lohnanstieg und einer Vollbeschäftigung. Die „Globalisierung" und die Produktionsauslagerungen waren Phänomene, die erst in den 1980er und vor allem dann in den 1990er Jahren stattfanden.
Durch die zwangsmäßige und proportionale Dreiteilung der Produktivitätssteigerung zwischen dem Profit, den Steuern und den Löhnen war der keynesianisch-fordistische Staatskapitalismus fähig, die Vollendung des Akkumulationszyklus' mittels eines Angebots von Waren und Dienstleistungen zu gesenkten Kosten (Fordismus) und einer gesteigerten zahlungskräftigen Nachfrage, die ebenfalls auf dieser Produktivitätssteigerung beruhte (Keynesianismus), sicher zu stellen. So waren die Märkte garantiert; die Krise kehrte in der Form eines erneuten Falls der Profitrate zurück, der eine Folge der Erschöpfung der fordistischen Produktivitätssteigerungen war, die sich zwischen dem Ende der 1960er Jahre und 1982 um die Hälfte verringerten26. Dieser drastische Fall der Rentabilität des Kapitals führte zu einer Demontage der Nachkriegspolitik zugunsten eines deregulierten Staatskapitalismus zu Beginn der 1980er Jahre. Auch wenn diese Kehrtwende zu einem spektakulären Anstieg der Profitraten, als Folge der Lohnkürzungen, führte, so bedeutete die daraus resultierende Abnahme einer zahlungskräftigen Nachfrage, dass die Akkumulationsrate und das Wachstum zurückgingen27. Seither ist der Kapitalismus mit einer strukturellen Schwäche bei der Produktivitätssteigerung dazu gezwungen, vor allem Druck auf die Löhne und Arbeitsbedingungen auszuüben. Dies um noch zu einem Anstieg der Profite zu gelangen, was aber wiederum zu einem Rückgang zahlungskräftiger Märkte führt. Die Wurzeln dieser Entwicklung sind:
a) permanente Überkapazitäten und eine permanente Überproduktion;
b) ein zunehmender Rückgriff auf die Verschuldung, um der verringerten Nachfrage entgegenzuwirken;
c) Auslagerungen auf der Suche nach billigen Arbeitskräften;
d) eine Globalisierung um ein Maximum an Exporten zu erzielen;
e) eine sich ständig wiederholende finanzielle Instabilität durch spekulative Geschäfte, da Investitionen in sich ausdehnende Bereiche nicht mehr möglich sind.
Heute ist die Wachstumsrate auf das Niveau der Zeit zwischen den Weltkriegen gesunken, und eine Neuauflage der „30 glorreichen Jahre des Wirtschaftswunders" ist unmöglich. Der Kapitalismus ist dazu verdammt, in einer zunehmenden Barbarei zu versinken.
Die Wurzeln und Auswirkungen dieser Analyse, auf die hier nicht genauer eingegangen werden kann, werden wir später darlegen. Dies erfordert eine Rückkehr zu einigen unserer Analysen, damit wir zu einem breiteren und kohärenteren Verständnis der Funktionsweise und Grenzen der kapitalistischen Produktionsweise gelangen28.
Eine offene Debatte für das internationalistische Milieu
Wie unsere Vorgänger von Bilan und der Französischen Kommunistischen Linken behaupten wir nicht, „die Weisheit mit dem Löffel gegessen zu haben"29. Wir sind uns bewusst, dass die Debatten, die in den Reihen unserer Organisation geführt werden, von kritischen und konstruktiven Anregungen von außen nur profitieren können. Aus diesem Grunde begrüßen wir alle an uns gerichtete Beiträge und werden sie in unsere kollektive Reflexion einbeziehen.
IKS
1 Zwischen 1950 und 1973 hatte sich das weltweite pro Kopf Bruttosozialprodukt jährlich um 3% erhöht, während es zwischen 1870 und 1913 in einem Rhythmus von 1,3% gewachsen war (Angus Madison: „Die Weltwirtschaft", OECD, 2001, S. 284).
2 Sie ist im Wesentlichen eine Sammlung von Artikeln, die wir im Januar 1981 veröffentlicht haben.
3 Dritter Kongress der IKS, International Review Nr. 18, 1979, (engl./franz./span. Ausgabe)
4 International Review Nr. 52, 1988, (engl./franz./span. Ausgabe)
5 Siehe die Serie in der International Review „Die Dekadenz des Kapitalismus verstehen" und dabei vor allem den Artikel in Nr. 56 (engl./franz./span. Ausgabe), sowie auch die Präsentation der Resolution über die internationale Situation vom 8. Kongress der IKS, die sich auf die Frage des Gewichts der Verschuldung auf die Weltwirtschaft konzentriert, Internationale Revue Nr. 11, (deutsch).
6 Diese Minderheitsposition existiert schon seit langem in unserer Organisation - die Genossen, welche sie heute vertreten, taten dies schon zum Zeitpunkt ihres Eintritts in die IKS - und hat diese Genossen auch nicht daran gehindert, an allen unseren Aktivitäten teilzunehmen, an unseren Interventionen sowie der theoretisch-politischen Debatte.
7 Siehe dazu den zweiteiligen Artikel „Antwort an die CWO zum Krieg in der Dekadenz des Kapitalismus", International Review Nr. 127 und 128 (engl./franz./span. Ausgabe).
8 Die Ausbeutung der außerkapitalistischen Märkte ist schon in der Broschüre Die Dekadenz des Kapitalismus beschrieben. Sie wurde im 6. Artikel der Serie „Die Dekadenz des Kapitalismus verstehen" wieder aufgegriffen und unterstrichen (International Review Nr. 56, engl./franz./span. Ausgabe). Dort wird der Faktor der Verschuldung beschrieben, der „Wiederaufbau-Markt" ist jedoch nicht erwähnt.
9 Es gibt innerhalb dieser Positionen auch Nuancen, wie die Debatte bisher zeigte. Wir können aber im Rahmen dieses Artikels nicht darauf eingehen. Sie können in die zukünftigen Diskussionsbeiträge einfliessen.
10 Internationalisme, 1. Januar 1945: „Thesen über die internationale Lage".
11 Alleine in den USA waren die Ausgaben des Staates, welche 1930 noch 3% des Bruttoinlandproduktes ausgemacht hatten, während der 1950-60er Jahre auf fast 20% des BIP gestiegen.
[12] Als Beispiel: Während der Periode zwischen 1817-1913 betrugen die Verkäufe auf außerkapitalistischen Märkten im Jahresdurchschnitt 2,3% der weltweiten Produktion
(errechnet aufgrund der Entwicklung der weltweiten Produktion in derselben Zeit. Quelle: www.theworldeconomy.org/frenchpdf/MaddtabB18.pdf [118]).
Es handelt sich dabei um einen Durchschnitt, und dieser Wert ist somit geringer als in den Jahren des großen Wachstums, welches die Jahre unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg kennzeichnete.
13 Es ist hier nicht von großem Belang, ob die Verkäufe schlussendlich produktiv sind oder nicht, wie dies bei der Rüstungsproduktion der Fall ist.
14 Marx; „Das Kapital" Band 3, Kapitel 15, Überfluss an Kapital bei Überfluss an Bevölkerung, MEW Bd. 25 S.267/68.
15 Um dies zu illustrieren, genügt es, auf den Unterschied im Endgebrauch einer Waffe, eines Inserates oder eines gewerkschaftlichen Schulungskurses einerseits und andererseits eines Werkzeuges, von Lebensmitteln, Schul- und Universitätskursen, medizinischer Versorgung, usw. hinzuweisen.
16 Von 0,53% pro Jahr zwischen 1820-70 auf 1,3% zwischen 1870-1913 (Angus Maddison, L`économie mondiale, OECD S. 284)
17 Jährliche Wachstumsraten der weltweiten industriellen Produktion:
1786-1820: 2,5%
1820-1840: 2,9%
1840-1870: 3,3%
1870-1894: 3,3%
1894-1913: 4,7%
(aus W.W. Rostow, The World Economy, S. 662)
18 Während diese Kaufkraft zu Beginn der kapitalistischen Entwicklung wichtig war, betrug sie 1914 innerhalb der Grenzen der entwickelten Länder nur noch zwischen 5-20% 1914 und wurde 1945 mit 2-12% marginal (Peter Flora, State, Economy and Society in Western Europe 1815-1975, A Data Handbook, Vol. 2, Campus, 1987). Der Handel mit der Dritten Welt wurde um zwei Drittel reduziert durch den Rückzug Chinas, des Ostblocks, Indiens und anderer unterentwickelter Länder vom Weltmarkt. Der Handel mit dem übrig gebliebenen Drittel fiel zwischen 1952 und 1972 auf die Hälfte zurück (P. Bairoch, Le Tiers-Monde dans l`impasse, S. 391-392)!
19 Zahlen siehe in International Review 114, (engl./franz./span. Ausgabe)
20 Zahlen siehe in Internationale Revue 37 (deutsch)
21 Der Marshall-Plan hatte nur eine schwache Auswirkung auf die amerikanische Wirtschaft: „Nach dem Zweiten Weltkrieg (...) belief sich die Ausfuhr 1946 auf nur 4,9% der Produktion und 1947 auf 6,6%, machte also einen viel kleineren Prozentsatz aus als in den ersten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg. Der Marshall-Plan hat hier keine entscheidende Veränderungen gebracht". Fritz Sternberg, Kapitalismus und Sozialismus vor dem Weltgericht, Rohwolt, 1961, S. 398) Der Autor folgert daraus, dass der innere Handel ausschlaggebend war.
22 Die Fakten und Argumente dazu sind in einem Artikel in der International Review 128, (engl./franz./span. Ausgabe) zu finden. Wir werden aber darauf zurück kommen, weil laut Marx die Entwertung und Zerstörung von Kapital tatsächlich eine Regeneration des Akkumulationszykluses und die Eröffnung neuer Märkte erlaubt. Eine detaillierte Studie hat uns allerdings gezeigt, dass dieser Faktor, auch wenn er eine Rolle spielte, relativ gering war, begrenzt in der Zeit und auf Europa und Japan.
23 Der Anteil der totalen öffentlichen Ausgaben in den Ländern der OECD steigerte sich von 1913 bis 1937 von 9% auf 21% (International Review 114 (engl./franz./span. Ausgabe).
24 In der Realität ist die Produktivität nur ein anderer Ausdruck des Wertgesetzes - da sie das Umkehrte der Arbeitszeit bedeutet -, und sie ist die Grundlage der Auspressung des relativen Mehrwertes, die so charakteristisch für diese Periode war.
25 Der Anteil der öffentlichen Ausgaben in den Ländern der OECD verdoppelte sich zwischen 1960 und 1980 von 19% auf 45% (International Review 114, engl./franz./span. Ausgabe).
26 Grafiken dazu in International Review 115, 121 und 128 (engl./franz./span. Ausgabe)
27 Grafiken und Zahlen in der Internationalen Revue 37, sowie auch in unserer Analyse über das Wachstum in Südost-Asien: https://fr.internationalism.org/ICConline/2008/crise_economique_Asie_Sud... [119].
28 Der Leser findet verschieden Zahlenangaben sowie auch theoretische Analysen in unseren Artikeln, die in der International Review 114, 115, 121, 127, 128 erschienen sind, sowie in den Analysen über das Wachstum in Südostasien auf unserer Webseite.
29 „Keine Gruppe besitzt die absolute und ewige Wahrheit", wie es die Französische Kommunistische Linke ausdrückte. Siehe dazu unseren Artikel „Vor 60 Jahren: Eine Konferenz revolutionärer Internationalisten" in Internationale Revue Nr. 41 (deutsch).
Aktuelles und Laufendes:
Historische Ereignisse:
- Wirtschaftswunder [121]
Theoretische Fragen:
- Politische Ökonomie [66]
Erbe der kommunistischen Linke:
Oktober 2008
- 787 reads
1929- 2008: Der Kapitalismus ist ein bankrottes System – aber eine andere Welt ist möglich: der Kommunismus!
| Attachment | Size |
|---|---|
| 0 bytes |
- 4021 reads
Politiker und Ökonomen wissen nicht mehr, wie sie die Tragweite der Lage ausdrücken sollen: „Am Rande des Abgrunds“, „Ein ökonomisches Pearl Harbour“, „Ein Tsunami, der auf uns zurollt“ „Ein 11.September der Finanzen“ … nur die Anspielung auf den Untergang der Titanic fehlt noch! Was passiert wirklich? Jeder steht aufgrund der wirtschaftlichen Erschütterungen vor Angst erregenden Fragen. Stehen wir vor einem neuen Krach wie 1929? Wie ist es dazu gekommen? Was tun, damit wir uns verteidigen können? Und in welcher Welt leben wir heute?
Politiker und Ökonomen wissen nicht mehr, wie sie die Tragweite der Lage ausdrücken sollen: „Am Rande des Abgrunds“, „Ein ökonomisches Pearl Harbour“, „Ein Tsunami, der auf uns zurollt“ „Ein 11.September der Finanzen“ … nur die Anspielung auf den Untergang der Titanic fehlt noch! Was passiert wirklich? Jeder steht aufgrund der wirtschaftlichen Erschütterungen vor Angst erregenden Fragen. Stehen wir vor einem neuen Krach wie 1929? Wie ist es dazu gekommen? Was tun, damit wir uns verteidigen können? Und in welcher Welt leben wir heute?
Hin zu einer brutalen Verschlechterung unserer
Man darf keine Illusionen haben. Weltweit wird die ganze Menschheit in den kommenden Monaten unter der schrecklichen Verschlechterung der Lebensbedingungen zu leiden haben. Der Internationale Währungsfond (IWF) hat in seinem letzten Bericht angekündigt, dass sich „50 Länder bis Anfang 2009“ in die Reihe der Länder einreihen werden, die von Hungersnot betroffen sein werden. Unter ihnen viele Länder Afrikas, Lateinamerikas, der Karibik und selbst Asiens. In Äthiopien zum Beispiel stehen offiziellen Verlautbarungen zufolge schon 12 Millionen Menschen vor dem Hungertod. In Indien und China, diesen neuen kapitalistischen Eldorados, werden Hunderte Millionen Beschäftigte in große Armut gestürzt werden. Auch in den USA und in Europa wird ein Großteil der Bevölkerung in eine unerträgliche Armut absinken.
Alle Bereiche der Wirtschaft sind betroffen. In den Büros, Banken, Fabriken, Krankenhäusern, in der Automobilindustrie, im Bausektor, im Transportwesen – überall wird es millionenfach Entlassungen hageln. Die Arbeitslosigkeit wird explodieren! Seit Anfang 2008 sind allein in den USA schon ca. eine Million Beschäftigte auf die Straße geflogen. Und all das ist erst der Anfang. Diese Entlassungswelle bedeutet eine Wohnung zu bezahlen, medizinische Versorgung zu bekommen und sich zu ernähren, wird für immer mehr Arbeiterfamilien immer schwerer werden. Für die Jugendlichen heißt dies auch, dass diese kapitalistische Welt ihnen keine Zukunft mehr zu bieten hat!
Die uns gestern belogen haben, belügen uns auch heute!
Die Führer der kapitalistischen Welt, die Politiker, die im Dienst der herrschenden Klasse stehenden Journalisten, sie alle versuchen nicht mal diese katastrophale Perspektive zu vertuschen. Wie könnten sie das auch? Die größten Banken der Welt machen pleite. Sie haben nur überlebt dank der Rettungspakete von Hunderten von Milliarden Dollars und Euros, welche die Zentralbanken, sprich der Staat, ihnen zugeschachert haben. An den Börsen Amerikas, Asiens und Europas befinden sich die Kurse weiter im Sturzflug: Seit Januar 2008 haben sie mehr als 25.000 Milliarden Dollar verloren, sprich den Wert von zwei Jahren Gesamtproduktion der USA. All dies spiegelt die wahre Panik wider, die die herrschende Klasse überall auf der Welt ergriffen hat. Wenn heute die Börsen zusammenbrechen, dann geschieht dies nicht nur wegen der katastrophalen Lage der Banken, sondern auch weil sie einen schwindelerregenden Rückgang der Profite erwarten, was zurückzuführen ist auf das massive Schrumpfen der Wirtschaft, die explosive Zunahme von Firmenpleiten, eine zu erwartende Rezession, die noch viel schlimmer sein wird als alles, was wir während der letzten 40 Jahre gesehen haben.
Die Hauptführer der Welt, Bush, Merkel, Brown, Sarkozy, Hu Jintao halten ein Gipfeltreffen nach dem anderen ab (G4, G7, G8, G27, G 40), in der Hoffnung eine Schadensbegrenzung zu versuchen und das schlimmste zu verhindern. Für Mitte November ist ein neuer „Gipfel“ geplant, der einigen zufolge dazu dienen soll, „den Kapitalismus neu zu strukturieren“. Die Erregung der Führer der Welt ähnelt der der Journalisten und „Experten“: Fernsehen, Radio, Zeitungen usw. – überall wird über die Krise berichtet.
Warum solch ein großes Aufheben?
Während die herrschende Klasse nicht mehr den desaströsen Zustand ihrer Wirtschaft vertuschen kann, versucht sie uns dennoch glauben zu machen, dass trotz alledem das kapitalistische System nicht infragestellt werden muss; dass es einfach darum geht, gegen „Exzesse“ und „Fehlverhalten“ anzugehen. Schuld seien die Spekulanten! Schuld sei die Habgier der Spekulanten! Schuld seien die Steuerparadiese! Schuld der „Liberalismus“!
Um dieses Märchen zu schlucken, greift man auf all die professionellen Lügner zurück. Die gleichen „Spezialisten“, welche gestern noch behaupteten, der Wirtschaft ginge es gut, die Banken wären solide, verbreiten heute unaufhörlich in den Medien ihre neuen Lügen. Diejenigen, die uns früher weismachen wollten, der „Liberalismus“ sei DIE Lösung, der Staat dürfe nicht in die Wirtschaft eingreifen, rufen heute umso stärker den Staat zum Eingreifen auf. Mehr Staat und mehr „Moral“, dann könnte der Kapitalismus wieder voll funktionieren. Diese Lüge wollen sie uns nun einbläuen!
Kann der Kapitalismus die Krise überwinden?
Die Krise, die heute den Weltkapitalismus erschüttert, ist nicht erst im Sommer 2007 mit dem Beginn der Subprime-Krise in den USA entstanden. Seit mehr als 40 Jahren hat eine Rezession nach der anderen stattgefunden: 1967, 1974, 1981, 1991, 2001. Seit Jahrzehnten ist die Arbeitslosigkeit zu einem Dauerphänomen der Gesellschaft geworden, seit Jahrzehnten sehen sich die Ausgebeuteten wachsenden Angriffen gegen ihre Lebensbedingungen ausgesetzt. Warum?
Weil der Kapitalismus ein System ist, das nicht für die Bedürfnisse der Menschen produziert, sondern für den Markt und den Profit. Die nicht-befriedigten Bedürfnisse sind gewaltig, aber die Menschen sind nicht zahlungsfähig; d.h. die große Mehrheit der Weltbevölkerung verfügt nicht über die Kaufkraft, die produzierten Waren zu kaufen. Wenn der Kapitalismus in der Krise steckt, wenn Hunderte von Millionen Menschen, bald Milliarden in eine unerträgliche Armut abstürzen und mit Hunger konfrontiert werden, dann nicht weil dieses System nicht genügend produziert, sondern weil es mehr Waren produziert als es verkaufen kann. Jedes Mal gelang es der herrschenden Klasse, durch den massiven Rückgriff auf Kredite und die Schaffung von künstlichen Märkten sich zeitweilig Luft zu verschaffen. Deshalb führen diese „Wiederaufschwünge“ nur zu noch mehr Blut und Tränen, denn irgendwann muss die Rechnung, müssen all die Schulden beglichen werden. Genau das findet heute statt. Das ganze „traumhafte Wachstum“ der letzten Jahre stützte sich ausschließlich auf Verschuldung. Die Weltwirtschaft hat auf Pump gelebt, und nachdem jetzt der Zeitpunkt der Rückzahlung gekommen ist, bricht alles zusammen wie ein Kartenhaus. Die gegenwärtigen Erschütterungen der kapitalistischen Weltwirtschaft sind nicht auf eine „schlechte Verwaltung“ durch die politischen Führer, die Spekulationen der „Händler“ oder ein unverantwortliches Verhalten der Banker zurückzuführen. All diese Gestalten haben nur die Gesetze des Kapitalismus angewandt, und es sind gerade diese Gesetze, die dem System zum Verhängnis werden. Deshalb werden all die Tausenden von Milliarden, die von allen Staaten und den Zentralbanken in die Wirtschaft gepumpt werden, nichts an der Lage ändern. Sie werden den Schuldenberg nur noch vergrößern. Es ist, als ob man ein Feuer mit Öl zu löschen versuchte. Der Einsatz dieser verzweifelten und wirkungslosen Mittel belegt, dass die herrschende Klasse eigentlich hilflos ist. Alle Rettungspläne sind früher oder später zum Scheitern verurteilt. Es wird keine wirkliche Ankurbelung der kapitalistischen Wirtschaft geben. Keine Politik, weder die von links noch von rechts, wird den Kapitalismus retten können, denn dieses System ist von einer tödlichen und unheilbaren Krankheit befallen.
Gegen die Zuspitzung der Armut müssen wir durch unsere Kämpfe und unsere Solidarität reagieren
Überall werden Vergleiche mit dem Krach von 1929 und der großen Depression in den 1930er Jahren angestellt. Die Bilder der damaligen Zeit sind noch in den Köpfen haften geblieben: endlos lange Schlange von Arbeitslosen, Arme vor den Suppenküchen, pleite gegangene und geschlossene Fabriken…
Aber ist die Lage von heute wirklich die gleiche? Die Antwort lautet klar Nein! Sie ist viel schlimmer, selbst wenn der Kapitalismus aus dieser Erfahrung gelernt hat und einen brutalen Zusammenbruch dank des Eingreifens des Staats und einer besseren internationalen Koordinierung hat vermeiden können.
Aber es gibt noch einen anderen Unterschied. Die schreckliche Depression der 1930er Jahre führte zum 2. Weltkrieg. Wird die gegenwärtige Krise in einen 3. Weltkrieg münden? Die Flucht nach vorne in einen Krieg ist die einzig mögliche Antwort seitens der Herrschenden gegenüber der unüberwindbaren Krise des Kapitalismus.
Und die einzige Kraft, die sich dem entgegenstellen kann, ist ihr Erzfeind, die Weltarbeiterklasse. Die Arbeiterklasse hatte in den 1930er Jahren eine schreckliche Niederlage nach der Isolierung der Revolution 1917 in Russland erlitten und sich für das imperialistische Massaker einspannen lassen. Aber die heutige Arbeiterklasse hat seit den großen Kämpfen von 1968 bewiesen, dass sie nicht bereit ist, erneut ihr Leben zu lassen für die Ausbeuterklasse. Seit 40 Jahren hat die Arbeiterklasse oft schmerzhafte Niederlagen hinnehmen müssen, aber sie bleibt weiterhin ungeschlagen und vor allem seit 2003 hat sie sich immer mehr zur Wehr gesetzt. Die Beschleunigung der Wirtschaftskrise wird für Hunderte von Millionen von Arbeitern nicht nur in den unterentwickelten, sondern auch in den entwickelten Ländern ein schreckliches Leiden, Arbeitslosigkeit, Armut, Hunger usw. verursachen – aber sie wird ebenso notwendigerweise Abwehrkämpfe seitens der Ausgebeuteten hervorrufen.
Diese Kämpfe sind unabdingbar zur Begrenzung der wirtschaftlichen Angriffe seitens der Herrschenden, um sie daran zu hindern, die Ausgebeuteten in eine absolute Verarmung zu stürzen. Aber es ist klar, dass sie den Kapitalismus nicht daran hindern können, immer mehr in der Krise zu versinken. Sie ermöglicht es den Ausgebeuteten, ihre kollektive Stärke zu entwickeln, ihre Einheit, ihre Solidarität, ihr Bewusstsein im Hinblick auf die einzige Alternative, die der Menschheit eine Zukunft bieten kann: die Überwindung des kapitalistischen Systems und seine Ersetzung durch eine Gesellschaft, die auf ganz anderen Grundlagen fußt. Eine Gesellschaft, die nicht mehr auf Ausbeutung und Profit sowie der Produktion für einen Markt basiert, sondern die für die Bedürfnisse der Menschen produziert. Diese Gesellschaft wird von den Arbeitern selbst geleitet werden und nicht von einer privilegierten Minderheit: Es handelt sich um die kommunistische Gesellschaft.
Acht Jahrzehnte lang haben alle Teile der kapitalistischen Klasse, vom linken bis zum rechten Flügel, gemeinsam daran gewirkt, die seinerzeit in Osteuropa und China herrschenden Regime als "kommunistisch" darzustellen; in Wirklichkeit waren diese nur eine besonders barbarische Form des Staatskapitalismus. Sie wollten versuchen, die Ausgebeuteten davon zu überzeugen, dass es vergeblich wäre, von einer anderen Welt zu träumen, dass es keine andere Welt als den Kapitalismus geben könnte.
Nachdem heute der Kapitalismus seinen historischen Bankrott offenbart, muss die Perspektive der kommunistischen Gesellschaft immer mehr die Kämpfe der Arbeiter inspirieren.
Gegenüber den Angriffen des sich in äußerster Bedrängnis befindenden Kapitalismus,um die Ausbeutung, Armut, die kriegerische Barbarei zu überwinden brauchen wir die Entwicklung von Arbeiterkämpfen auf der ganzen Welt.
Proletarier, aller Länder vereinigt euch!
Internationale Kommunistische Strömung, 25.10.2008
Aktuelles und Laufendes:
- Wirtschaftskrise 2008 [123]
- Arbeitersolidarität [124]
- Ausweg Wirtschaftskrise [125]
Historische Ereignisse:
Dagonmei: Ein Blick hinter das chinesische Wirtschaftswunder
- 4727 reads
Pun Ngai ist Professorin am sozialwissenschaftlichen Zentrum der Pekinger Universität und der Hongkonger Polytechnischen Universität. Zurzeit befindet sie sich auf einer Tournee durch fünf europäische Länder, um das Buch „DAGONMEI - Arbeiterinnen aus Chinas Weltmarktfabriken erzählen“ vorzustellen, das sie zusammen mit ihrem Kollegen Li Wanwei vom Institut für industrielle Beziehungen in Hongkong herausgegeben hat. (1) Nicht zuletzt das Erscheinen dieses Buches auf Deutsch bot den Anlass zu dieser öffentlichen Gesprächsreihe.
Pun Ngai ist Professorin am sozialwissenschaftlichen Zentrum der Pekinger Universität und der Hongkonger Polytechnischen Universität. Zurzeit befindet sie sich auf einer Tournee durch fünf europäische Länder, um das Buch „DAGONMEI - Arbeiterinnen aus Chinas Weltmarktfabriken erzählen“ vorzustellen, das sie zusammen mit ihrem Kollegen Li Wanwei vom Institut für industrielle Beziehungen in Hongkong herausgegeben hat. (1) Nicht zuletzt das Erscheinen dieses Buches auf Deutsch bot den Anlass zu dieser öffentlichen Gesprächsreihe.
Am 10. Oktober 2008 stellte Pun Ngai dieses Buch in Köln vor. Eingedenk der Bedeutung des wirtschaftlichen und militärischen Aufstiegs Chinas in den letzten Jahrzehnten und der Fragen, die sich bezüglich der Zukunft dieses „Wirtschaftswunders“ im Lichte der gegenwärtigen Agonien des Weltkapitalismus stellen, war es keine Überraschung, dass das Kölner Treffen auf großes Interesse stieß.
Das Subjekt der Untersuchung von Pun Ngai sind die Arbeitsimmigranten innerhalb Chinas – die Proletarisierung von 120 Millionen Bauern im vergangenen Vierteljahrhundert – insbesondere die Bedingungen der „Dagongmei“, wörtlich: „Arbeitsschwestern“. Pun Ngai und Li Wanwei präsentierten eine Reihe von Interviews mit jungen Arbeiterinnen, die aus den ländlichen Gebieten in die Industriestadt Shenzen in Südchina gekommen waren, einer der ersten Sonderwirtschaftszonen, die von der chinesischen Regierung geschaffen worden waren, um ausländisches Kapital anzuziehen. In ihrer Präsentation gab Pun Ngai Beispiele aus den persönlichen Erfahrungen solcher Arbeiterinnen.
Doch vor allem war es ihr Anliegen, diese Erfahrungen in einen globaleren Zusammenhang zu setzen, um Bewegungen einen „Sinn abzugewinnen“, die zweifellos von weltweiter Bedeutung sind. Sie stellte zwei Hauptargumente vor, die im Zentrum ihrer Analyse der Entwicklungen in China stehen.
Produktion und Reproduktion derArbeitskraft
Das erste ist die Trennung zwischen der Produktionssphäre in den Städten und der Reproduktionssphäre auf dem Lande. Ein großer Teil der Arbeitskraft für die Weltmarktfabriken wird vom Lande rekrutiert. Die Reproduktionskosten dieser Arbeitskräfte werden von den Bauernfamilien selbst auf der Grundlage winziger Landparzellen auf Subsistenzbasis übernommen. Dies erklärt größtenteils, warum die Löhne in China so viel niedriger sein können als in den alten weiterentwickelten kapitalistischen Ländern des Westen oder in Japan, wo die Lohnarbeit zum großen Teil im Rahmen des Lohnarbeitssystems reproduziert wird (mit anderen Worten: wo die Löhne nicht nur die Reproduktionskosten der ArbeiterInnen selbst decken müssen, sondern auch die ihrer Kinder, der künftigen Generation von Proletariern).
Doch wie in der sich anschließenden Diskussion betont wurde, ist dieses „Geheimnis“ der kapitalistischen Entwicklung keine chinesische Besonderheit, sondern liefert die Basis für ähnliche Entwicklungen anderswo in Asien oder auf anderen Kontinenten. Viele Besucher dieses Treffens waren auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, warum China erfolgreicher in dieser Entwicklung ist als die meisten seiner Rivalen.
Schlafsaal Kapitalismus
Hier ist der zweite Gedanke, der von Pun Ngai vorgestellt wurde, von eminenter Bedeutung. Es ist, wie sie es nennt, das Schlafsaalsystem. Im maoistischen China (wie im stalinistischen Russland, möchten wir hinzufügen) war die freie Bewegung der Arbeit innerhalb des Landes nicht zugelassen. Insbesondere wurde die gesamte Bevölkerung entweder als Stadt- oder Landbewohner registriert. Ein Bauer benötigte eine Genehmigung, um in die Stadt zu ziehen, und umgekehrt. Trotz aller Wirtschafts“reformen“ von Deng wurde diese Einschränkung der Beweglichkeit der Arbeit beibehalten. Auf dem ersten Blick ist dies überraschend mit Blick auf die Notwendigkeit der Freizügigkeit der Arbeit für das Kapital. Doch die Beibehaltung dieser Regulierungen macht aus den Migranten in den Städten „Illegale“ im eigenen Land, ohne Versicherung, medizinische Versorgung oder Bildungsstätten. Auch haben sie nicht die Möglichkeit, Arbeiter-Communities für sich selbst in den urbanen Zentren zu bilden. Sie sind gezwungen, in Schlafsälen zu übernachten, die den Bossen gehören. Als solche sind sie ständig unter der Kontrolle ihrer Arbeitgeber. Wie Pun Ngai betonte, können sie sich nicht weigern, ihre Körper zu verkaufen, ohne von Räumung bedroht und zurück in ihre Dörfer geschickt zu werden. Sie sind jederzeit für die „Just in time“-Produktion, die der Weltmarkt erfordert, verfügbar. Wie die Opfer dieses Systems selbst sagen, sind sie „sofort verfügbare“ „Wegwerfarbeiter“, die zurück aufs Land geschickt werden können, sobald sie nicht mehr erforderlich sind oder ihre Gesundheit ruiniert ist.
Pun Ngai vergleicht diesen Proletarisierungsprozess mit dem ersten Industrieland in der Geschichte, Großbritannien, wie es von Friedrich Engels in seiner berühmten Untersuchung der Arbeiterklasse in England geschildert wurde. Während sie auf die Existenz einer Reihe von Ähnlichkeiten hinwies, unterstrich sie gleichzeitig zwei Unterschiede. Zunächst einmal war der Ausgangspunkt für den Aufstieg des modernen Kapitalismus die gewaltsame Trennung der Produzenten von den Produktionsmitteln, der Bauern von ihrem Land. In China ließen die Landreformen Maos der Bauernschaft eigene, winzige Landparzellen, zuviel, um zu verhungern, aber nicht genug, um davon zu leben. Aus diesem Grund ist die Migration der ländlichen Armen „freiwillig“, findet offiziell aber nur unter Verletzung staatlicher Gesetze statt. Darüber hinaus sind besonders junge Frauen durch kulturelle Faktoren (wie während der Diskussion betont wurde) motiviert, der rückständigen, patriarchalischen Welt des Dorfes zu entfliehen. Zweitens ist es, wie bereits unterstrichen worden war, die Besonderheit (Pun Ngai nannte sie eine Unvollständigkeit) dieser Proletarisierung, dass die ArbeiterInnen unter der Drohung gehalten werden, zurück aufs Land geschickt zu werden. Sie betonte die Traumata, die durch die Unsicherheit dieses „Zwischenstatus“, der auf die Dauer unerträglich ist.
In ihrer Antwort auf eine entsprechende Frage aus dem Publikum wies sie darauf hin, dass die chinesische Regierung gegenwärtig die Möglichkeiten einer Landreform in Erwägung zieht, die den Erwerb privaten Landes erleichtern soll. Doch der Sinn dieser „Reform“ wäre nicht, der Bauernschaft zu erlauben, ihre Parzellen zu vergrößern, was die Subsistenzwirtschaft überlebensfähiger machen und somit der Migration vom Lande Einhalt gebieten würde. Vorgesehen ist im Wesentlichen eine Ermunterung zum Kauf großer Landgüter, die im Gegenteil die Migration weiter anfachen und den Städten neue Reserven billiger Arbeitskräfte bescheren würden.
Eine neue Generation von Arbeitern
Bezüglich der Auswirkungen dieser historischen Entwicklungen auf die Arbeiterklasse unterschied Pun Ngai zwischen der ersten und der zweiten Generation von Migranten. Die erste Generation hatte noch die Hoffnung, Geld zu sparen und nach Hause zurückzukehren. Die Männer konnten darauf hoffen, ihre Parzellen zu modernisieren, die Frauen darauf, kleine Geschäfte zu eröffnen. Doch für die weit überwiegende Mehrheit realisierten sich solche Träume niemals, und viele, die es versuchten, endeten in finanziellem Ruin. Die erste Generation wurde durch diese Erfahrungen, die sich durch Verzweiflung und Verinnerlichung ihres Zorns auszeichneten, traumatisiert.
Im Gegensatz dazu ist das Motto der neuen Generation: „keine Trauer“ darüber, die Dörfer verlassen zu haben. Sie ist entschlossen, niemals zurückzugehen. Die Energie dieser ArbeiterInnen richtet sich auf die Zukunft und nach außen und drückt sich selbst in kollektiven Klassenaktionen aus. Laut offiziellen Zahlen stieg zwischen 1993 und 2005 die Zahl der jährlich registrierten „kollektiven Vorkommnisse“ von 10.000 auf 87.000. Besonders in den vergangenen drei Jahren haben nahezu alle Teile der Klasse einschlägige Erfahrungen gesammelt. Proteste und Petitionen werden nicht nur gegen bzw. an die Arbeitgeber gerichtet, sondern auch gegen die staatliche Verwaltung und den offiziellen Gewerkschaftsapparat. Pun Ngai berichtete von Diskussionen, wo militante Minderheiten von Arbeitern äußerten: „Wir müssen nach einem großen Ideal suchen! Wir brauchen neue innere Werte!“
Diese Ideen, sagt sie, verbreiten sich heute immer mehr. Sie berichtete ebenfalls, dass insbesondere die Arbeiterinnen in einigen Fällen begonnen haben, die Schlafsäle in Orte des Kontaktes, Dissens‘ und der Organisierung von ArbeiterInnen umzuwandeln.
Einige Besucher stellten auch allgemeinere politische Fragen. Jemand wollte wissen, wann China ihrer Meinung nach eine Demokratie werde. Sie antwortete, dass dies nicht wirklich ihr Anliegen sei und dass Demokratie etwas sei, was einer Definition bedarf. Ihr Anliegen sei die Entwicklung dessen, was sie Graswurzeldemokratie in der Klasse nannte. In ihrer Antwort auf die Frage, ob die ArbeiterInnen sich heute positiv darauf beziehen, was der Fragesteller den „Sozialismus“ von Mao nannte, und ob sie irgendetwas Positives aus dieser „sozialistischen“ Erziehung für ihren jetzigen Kämpfe gelernt haben, sagte sie, dass ArbeiterInnen gelegentlich Zitate von Mao benutzen, um bestimmte Forderungen gegenüber dem Staat legal zu rechtfertigen. Über die Versuche, patriotische Gefühle über die neue „Größe Chinas“ (zum Beispiel anlässlich der Olympischen Spiele) unter den ArbeiterInnen zu entfachen, sagte sie, dass sie sowohl durch den Westen (durch seinen aggressiven Diskurs) als auch von den chinesischen Herrschern selbst gefördert wurden und ein negativer Faktor gegen die Arbeiterklasse seien.
Natürlich wollten alle von Pun Ngai wissen, wie die aktuelle weltweite Finanzkrise China betreffen werde. Sie sagte, dass dies angesichts der Exportabhängigkeit des Landes wahrscheinlich weitverbreitete Arbeitslosigkeit und wachsende Armut verursachen werde. Nach etlichen Jahren steigender Löhne, nicht zuletzt unter dem Druck der Arbeitermilitanz, würde dies wahrscheinlich die „Verhandlungsmacht“ beträchtlicher Teile der Klasse beeinträchtigen.
Es wurden so viele Fragen gestellt, dass am Ende leider keine Zeit mehr war für die vorgesehene allgemeine Diskussion. Doch es wurde darauf hingewiesen, dass das System, Arbeitskräfte illegal, aber geduldet – und somit besonders billig und fügsam – zu machen, keine Besonderheit Chinas ist, sondern überall auf der Welt um sich greift, einschließlich in Europa und den Vereinigten Staaten. Die Besonderheit Chinas ist das Ausmaß, in dem dieses Mittel angewendet wird. Die Schlafsäle beherbergen regulär zwischen 5.000 und 10.000 ArbeiterInnen pro Einheit. Die Agglomerationen dieser Lager umfassen häufig Gebiete, die so groß wie eine durchschnittliche europäische Großstadt sind.
Als Schlussfolgerung können wir durchaus sagen, dass jene, die zu dem Treffen gekommen waren, sehr bewegt waren von der Präsenz, dem Kampfgeist und der Klarheit in den Analysen einer Repräsentantin der Arbeiterklasse aus China. (2)
Kapitalismus heißt Weltwirtschaft. Durch die weltweite Zusammenschaltung und die Entwicklung des Klassenkampfes schafft der Kapitalismus gegen seinen Willen die Bedingungen für die Vereinigung seiner eigenen Totengräber.
Geographisch:
- China [72]
Aktuelles und Laufendes:
- China [127]
- Lage der Arbeiter in China [128]
- Wirtschaftswunder China [129]
- Dagongmei [130]
Leute:
November 2008
- 791 reads
Die Welt am Rande einer Umweltkatastrophe /I
- 3993 reads
Die Frage der Umwelt ist immer schon in der Propaganda der Revolutionäre seit der Entblößung der unerträglichen Lebensbedingungen im London des 19. Jahrhunderts durch Marx und Engels bis zu Bordiga und seinen Schriften über die Umweltzerstörungen infolge des unverantwortlichen Handelns des Kapitalismus aufgegriffen worden. Heute ist diese Frage noch zentraler, und sie verlangt verstärkte Anstrengungen seitens der revolutionären Organisationen um aufzuzeigen, dass die historische Alternative, vor der die Menschheit steht – Sozialismus oder Barbarei –, die Perspektive des Sozialismus gegenüber der Barbarei nicht nur die Frage der lokalen oder generalisierten Kriege umfasst. Sondern diese Barbarei betrifft auch die Frage der Gefahr einer ökologischen und Umweltkatastrophe, die sich immer deutlicher abzeichnet.
Die Welt am Rande einer Umweltkatastrophe /I
„Die Hungersnöte dehnen sich in den Ländern der 3. Welt aus, und sie werden auch bald in den Ländern zu vermelden sein, die angeblich „sozialistisch“ waren. Gleichzeitig vernichtet man in Westeuropa und in Nordamerika die landwirtschaftlichen Güter massenweise, und bezahlt man den Bauern Gelder, damit weniger angebaut und geerntet wird. Sie werden bestraft, wenn sie mehr als die auferlegten Quoten produzieren. In Lateinamerika töten Epidemien wie die Cholera Tausende von Menschen, obgleich diese Geißel schon lange zuvor gebannt worden war. Zehntausende von Menschen fallen weiterhin innerhalb weniger Stunden Überschwemmungen und Erdbeben zum Opfer, obgleich die Gesellschaft eigentlich in der Lage ist, Deiche und erdbebensichere Häuser zu bauen. Man darf eigentlich gar nicht die Tücken oder „Fatalitäten“ der Natur erwähnen, wenn wie in Tschernobyl 1986 die Explosion eines AKW's Hunderte (eigentlich Tausende) Menschen tötet und noch vielmehr in vielen Provinzen radioaktiv verstrahlt. Typisch ist es, dass sich in den höchstentwickelten Ländern tödliche Unfälle häufen: 60 Tote in einem Pariser Bahnhof, 100 Tote bei einem Brand in der Londoner U-Bahn. Dieses System hat sich als unfähig erwiesen, der Zerstörung der Natur entgegenzutreten, den sauren Regen, die Verschmutzungen jeder Art und insbesondere die durch Atomkraftwerke, den Treibhauseffekt, die zunehmende Verwüstung zu bekämpfen; d.h. alles Faktoren, die das Überleben der Menschheit selber bedrohen“ (1991, Kommunistische Revolution oder Zerstörung der Menschheit“ Manifest des. 9. Kongresses der IKS 1991).
Die Frage der Umwelt ist immer schon in der Propaganda der Revolutionäre seit der Entblößung der unerträglichen Lebensbedingungen im London des 19. Jahrhunderts durch Marx und Engels bis zu Bordiga und seinen Schriften über die Umweltzerstörungen infolge des unverantwortlichen Handelns des Kapitalismus aufgegriffen worden. Heute ist diese Frage noch zentraler, und sie verlangt verstärkte Anstrengungen seitens der revolutionären Organisationen um aufzuzeigen, dass die historische Alternative, vor der die Menschheit steht – Sozialismus oder Barbarei –, die Perspektive des Sozialismus gegenüber der Barbarei nicht nur die Frage der lokalen oder generalisierten Kriege umfasst. Sondern diese Barbarei betrifft auch die Frage der Gefahr einer ökologischen und Umweltkatastrophe, die sich immer deutlicher abzeichnet.
Mit dieser Artikelserie möchte die IKS die Umweltfrage aufgreifen. Dabei werden wir auf die folgenden Aspekte eingehen:
Im ersten Artikel versuchen wir eine kurze Bestandsaufnahme der Lage heute zu machen und aufzuzeigen, vor welchem globalen Risiko die Menschheit heute steht, insbesondere die weltweit anzutreffenden zerstörerischsten Phänomene wie:
-
Zunahme des Treibhauseffektes
-
Müllentsorgung
-
Die grenzenlose Ausbreitung von Giftstoffen und die damit verbundenen biologischen Prozesse
-
Die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen und/oder ihre Umwandlung durch Giftstoffe
Im zweiten Artikel werden wir versuchen aufzuzeigen, warum die Umweltprobleme nicht auf die Verantwortlichkeit Einzelner zurückgeführt werden kann, obwohl es auch individuelle Verantwortlichkeiten gibt, weil der Kapitalismus und seine Logik des Strebens nach Höchstprofiten die wirklichen verantwortlichen Kräfte sind. So werden wir sehen, dass die Entwicklung der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Forschung keinem Zufall unterworfen ist, sondern den Zwangsgesetzen des Kapitalismus vom Höchstprofit unterliegt.
Im dritten Artikel werden wir auf die Lösungsansätze der verschiedenen Bewegungen der Grünen, Ökologen usw. eingehen, um aufzuzeigen, dass trotz ihrer guten Absichten und dem guten Willen vieler ihrer Aktivisten diese Lösungsansätze nicht nur völlig wirkungslos sind, sondern direkt die Illusionen hinsichtlich einer möglichen Lösung für diese Fragen innerhalb des Kapitalismus verstärken, während in Wirklichkeit die einzige Lösung die internationale kommunistische Revolution sein kann.
Die Vorboten der Katastrophe
Man spricht immer mehr von Umweltproblemen, allein schon weil in der jüngsten Zeit in verschiedenen Ländern der Welt Parteien entstanden sind, die sich den Umweltschutz auf die Fahnen geschrieben haben. Ist das beruhigend? Überhaupt nicht! Wenn jetzt ein großes Aufheben um diese Frage gemacht wird, geht es nur darum, uns noch mehr in dieser Frage zu verwirren. Deshalb haben wir beschlossen, an erster Stelle besondere Phänomene zu beschreiben, die alle zusammengenommen die Gesellschaft immer mehr an den Rand einer Umweltkatastrophe drängen. Wie wir aufzeigen werden, ist die Lage im Gegensatz zu all den Beteuerungen in den Medien und insbesondere in den auf Hochglanzpapier gedruckten Fachzeitschriften noch viel schwerwiegender und bedrohlicher, als man sagt. Nicht dieser oder jener profitgierige und unverantwortlich handelnde Einzelkapitalist; nicht dieser oder jener Mafioso oder dieses oder jenes Camorra Mitglied ist für die Lage verantwortlich, sondern das kapitalistische System insgesamt.
Die Auswirkungen des wachsenden Treibhauseffektes
Jedermann spricht von den Auswirkungen des Treibhauseffektes, aber meist beruht dies nicht auf einer wirklichen Sachkenntnis. Es ist wichtig hervorzuheben, dass der Treibhauseffekt für das Leben auf der Erde eine durchaus positive Funktion erfüllt - zumindest für die Art Leben, die wir kennen, weil er es ermöglicht, dass auf der Erdoberfläche eine Durchschnittstemperatur von ungefähr 15° herrscht (dieser Durchschnitt berücksichtigt die vier Jahreszeiten und die verschiedenen Breitengrade) statt minus17°C, d.h. der geschätzten Temperatur, wenn es den Treibhauseffekt nicht gäbe. Man muss sich vorstellen, wie die Welt aussehen würde, wenn die Temperaturen ständig unter Null lägen, Seen und Flüsse vereist… Worauf ist dieser 'Überschuss' von mehr als 32°C zurückzuführen? Auf den Treibhauseffekt: Das Sonnenlicht dringt durch die niedrigsten Schichten der Atmosphäre ohne absorbiert zu werden (die Sonne erwärmt nicht die Luft) und liefert die Energie auf der Erde. Die daraus entstehende Strahlung (wie die von jedem Himmelskörper) setzt sich hauptsächlich aus Infrarotstrahlen zusammen; sie wird durch einige Bestandteile der Luft aufgefangen und stark absorbiert wie Kohlenstoffanhydrid, Wasserdampf, Methan und andere zusammengesetzte Teile wie Fluorchlorkohlenwasserstoff (Abkürzung FCKW). Daraus geht hervor, dass die thermische Bilanz der Erde aus dieser Wärme, die in den unteren Schichten der Erdatmosphäre entsteht, Nutzen zieht, weil sie dazu dient, die Temperatur auf der Erdoberfläche um 32°C ansteigen zu lassen. Das Problem ist also nicht der Treibhauseffekt als solcher, sondern die Tatsache, dass mit der Entwicklung der Industriegesellschaft Substanzen in die Atmosphäre abgelassen wurden, die einen Treibhauseffekt bewirken und die bei zunehmender Konzentration eine deutliche Erderwärmung verursachen. Man hat zum Beispiel mit Hilfe von Untersuchungen der Luft durch Bohrungen im 650000 Jahre alten Polareis bewiesen, dass die gegenwärtige Konzentration von CO2 von 380 ppm (Milligramm pro Kubikdezimeter) die höchste je gemessene ist und vielleicht sogar die höchste seit den letzten 20 Millionen Jahren. Die im 20. Jahrhundert ermittelten Temperaturen sind die höchsten seit den vergangenen 20000 Jahren. Die wahnsinnige Verwendung fossiler Brennstoffe als Energiequelle und die wachsende Abholzung der Wälder auf der Erde haben seit dem Industriezeitalter das natürliche Gleichgewicht des Kohlenstoffs in der Erdatmosphäre durcheinander gebracht. Dieses Gleichgewicht ist das Ergebnis der Freisetzung von CO2 in der Atmosphäre einerseits durch die Verbrennung und den Abbau von organischen Stoffen, und andererseits der Fixierung dieses Kohlendioxids in der Atmosphäre durch die Photosynthese. Bei diesem Prozess wird es in Kohlenhydrat und damit in einen komplexen organischen Stoff umgewandelt. Das Gleichgewicht zwischen Freisetzung (Verbrennung) und Fixierung (Photosynthese) von CO2 zugunsten der Freisetzung ist die Grundlage für die gegenwärtige Zuspitzung des Treibhauseffektes.
Wie weiter oben aufgeführt spielt nicht nur das Kohlendioxyd sondern auch Wasserdampf und Methan eine Rolle. Der Wasserdampf ist sowohl Faktor als auch Ergebnis des Treibhauseffektes, denn es gibt umso mehr Wasserdampf je stärker die Temperatur steigt. Die Zunahme des Methans in der Atmosphäre ist wiederum auf eine ganze Reihe von natürlichen Ursachen zurückzuführen, aber sie ist auch Ergebnis der zunehmenden Verwendung dieses Gases als Brennstoff und aufgrund von undichten Stellen in den auf der ganzen Welt verstreuten Gasleitungen. Das Methan, das auch "Moorgas" genannt wird, ist eine Art Gas, das aus der Gärung der organischen Stoffe entsteht, falls kein Sauerstoff vorhanden ist. Die Flutung von bewaldeten Tälern für den Bau von Dämmen für hydroelektrische Kraftwerke ist eine Ursache für die Zunahme der Methankonzentration. Aber das Problem des Methans, das gegenwärtig für ein Drittel der Zunahme des Treibhauseffektes verantwortlich ist, ist sehr viel größer als es anhand der eben erwähnten Fakten erscheint. Zunächst kann das Methan 23-mal mehr Infrarotstrahlung aufnehmen als Kohlendioxyd. Und das ist beträchtlich. Aber schlimmer noch! All die gegenwärtigen, ohnehin schon katastrophalen Prognosen berücksichtigen nicht das mögliche Szenario infolge der Freisetzung von Methan durch die gewaltigen natürlichen Methanreserven der Erde. Dieses befindet sich in verschlossenen Gashüllen, bei ungefähr 0° C und einem geringen Atmosphärendruck in besonderen Eisformationen (hydratisierten Gasen). Ein Liter Eiskristall kann ca. 50 Liter Methangas binden. Solche Vorkommen findet man vor allem im Meer, entlang des Kontinentalabhangs und im Innern der Permafrostzone in verschiedenen Teilen Sibiriens, Alaskas und Nordeuropas. Experten in diesem Bereich meinten dazu folgendes: "Wenn die globale Erwärmung gewisse Grenzen überschreitet (3 - 4°C) und wenn die Temperatur der Küstengewässer und des Permafrostgebietes ansteigen würde, könnte eine gewaltige Emission innerhalb einer kurzen Zeit (innerhalb von einigen Jahrzehnten) von freigesetztem Methan durch instabil gewordene Hydrate stattfinden, und dies würde zu einer katastrophalen Zunahme des Treibhauseffektes führen […] Im letzten Jahr sind die Methanemissionen auf schwedischem Boden im Norden des Polarkreises um 60% gestiegen. Der Anstieg der Temperaturen während der letzten 15 Jahre ist im Durchschnitt relativ begrenzt geblieben, aber in dem nördlichen Teil Eurasiens und Amerikas war er sehr ausgeprägt (im Sommer ist die mythische Nord-Westpassage eisfrei, die eine Durchfahrt mit dem Schiff vom Atlantik zum Pazifik ermöglicht)" (3).
Aber selbst ohne diese besonders ernsthafte Warnung haben international anerkannte Prognosen wie die des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) der UNO und des MIT (Massachusetts Institute of Technology) in Boston schon für das gegenwärtige Jahrhundert eine durchschnittliche Temperaturerhöhung von mindestens 0,5°C bis höchstens 4,5°C prognostiziert, ausgehend von der Annahme, dass sich allem Anschein nach nichts Wesentliches verändern wird. Darüber hinaus berücksichtigen deren Prognosen nicht einmal die Umwälzungen, die sich aus dem Erscheinen der beiden neuen Industriemächte China und Indien ergeben, welche gefräßige Energieverbraucher sind.
Eine zusätzliche Erwärmung von wenigen Grad würde eine größere Verdampfung des Wassers der Weltmeere verursachen, aber die genauesten Untersuchungen deuten darauf hin, dass es immer größere Unterschiede bei der geographischen Verteilung der Niederschlagsmengen geben wird. „Trockene Gebiete werden immer größer und noch trockener. Meeresgebiete mit Oberflächentemperaturen über 27°C, ein kritischer Wert für das Entstehen von Zyklonen, werden weiter wachsen – um 30 - 40%. Dies würde katastrophale meteorologische Folgen haben - und zu Überschwemmungen und immer neuen Zerstörungen führen. Das Schmelzen eines Großteils der antarktischen Gletscher und der Gletscher Grönlands, der Anstieg der Meereswassertemperaturen lässt den Meeresspiegel ansteigen (…) damit dringt Salzwasser in immer mehr fruchtbare Küstengebiete vor und überflutet sie (teilweise Bangladesh, viele Inseln in den Ozeanen)" (4). (ebenda).
Aus Platzgründen können wir nicht näher auf dieses Thema eingehen, aber man muss dennoch die Tatsache unterstreichen, dass der Klimawandel, der durch den Treibhauseffekt hervorgerufen wird, auch wenn er nicht den Rückschlag haben wird, den die Freisetzung von Methan aus der Erde verursacht, katastrophale Folgen haben wird. Dazu gehören zum Beispiel:
-
eine größere Intensität der meteorologischen Ereignisse, das größere Auswaschen der Böden durch noch stärkere Regenfälle, die Böden werden weniger ertragreich und die Verwüstung wird auch in den weniger gemäßigten Klimazonen voranschreiten, wie zum Beispiel in Piemont (Italien).
-
Im Mittelmeer und in anderen einst mäßig warmen Meeren, entstehen Umweltbedingungen, die das Überleben von Lebewesen ermöglichen, welche bislang nur in tropischen Gewässern lebten. Damit wird es zur Wanderung von bislang nicht einheimischen Lebewesen kommen, was zu Störungen des ökologischen Gleichgewichts führt.
-
Das Wiederauftauchen alter, längst ausgerotteter Krankheiten wie Malaria aufgrund der Ausbreitung von Klimabedingungen, die das Wachstum und die Verbreitung der Träger dieser Krankheiten wie Mücken usw. begünstigen.
Das Problem der Produktion und der Umgang mit Abfall
Ein zweites Problem, das typisch ist für diese Phase der kapitalistischen Gesellschaft ist die exzessive Produktion von Abfällen und die daraus resultierende Schwierigkeit der Entsorgung derselben. Während in der letzten Zeit die Meldungen über Müllberge in den Straßen Neapels und in Kampanien international in den Nachrichten auftauchten, ist das mit darauf zurückzuführen, dass dieser Teil der Welt noch immer als ein Teil der Industriestaaten und damit als ein Teil der fortgeschrittenen Länder angesehen wird. Aber die Tatsache, dass die Peripherien vieler Großstädte der Dritten Welt zu offenen Müllhalden geworden sind, ist mittlerweile längst bekannt.
Diese unglaubliche Anhäufung von Müll ist der Logik der Funktionsweise des Kapitalismus selbst geschuldet. Während die Menschheit immer Müll produziert hat, wurde dieser in der Vergangenheit immer verwertet und neu verwendet. Nur mit dem Einzug des Kapitalismus wird der Müll erst zu einem Problem aufgrund der besonderen Funktionsweise dieser Gesellschaft. Deren Mechanismen stützen sich alle auf ein grundlegendes Prinzip: Jedes Produkt menschlicher Aktivität wird als Ware betrachtet, d.h. etwas, das verkauft werden muss, um ein Höchstmaß an Profit zu erzielen auf einem Markt, wo gnadenlose Konkurrenz herrscht. Dies musste eine Reihe von verheerenden Konsequenzen nach sich ziehen:
-
Warenproduktion kann in Raum und Zeit aufgrund der Konkurrenz unter den Kapitalisten nicht geplant werden. Sie unterliegt einer irrationalen Logik, die dazu führt, dass jeder einzelne Kapitalist seine Produktion ausdehnt, um mit möglichst niedrigen Kosten zu verkaufen und um seinen Profit zu realisieren. Dadurch stapeln sich Berge von unverkauften Waren. Gerade diese Notwendigkeit, den Konkurrenten zu besiegen und die Preise zu senken, zwingt die Produzenten dazu, die Qualität der hergestellten Waren zu senken. Dadurch sinkt ihre Haltbarkeit drastisch und die Produkte zerfallen viel schneller und müssen weggeschmissen werden.
-
Eine Wahnsinnsproduktion von Verpackungen und Aufmachung, oft unter Verwendung giftiger Substanzen, die nicht abbaubar sind und die irgendwo in der Natur einfach auf den Müll geschmissen werden. Diese Verpackungen, die oft keinen Nutzen haben außer die Produkte "ansehnlicher", für den Verkauf attraktiver zu machen, stellen häufig ein größeres Gewicht dar und nehmen größeren Raum ein als der Inhalt der verkauften Ware selbst. Man geht davon aus, dass gegenwärtig ein Müllsack, bei dem keine Abfalltrennung vorgenommen wurde, heute bis zur Hälfte mit Verpackungsmaterial voll gestopft ist.
-
Das Abfallaufkommen wird zudem noch durch die neuen "Lebensstilformen" verschärft, die dem "modernen Leben" innewohnen. Auswärts essen, in einem Selbstbedienungsrestaurant, auf Plastiktellern und Mineralwasser aus Plastikflaschen trinken, ist mittlerweile zu einer Alltagstätigkeit für Hunderte Millionen Menschen auf der ganzen Welt geworden. Auch die Verwendung von Plastiktüten zum Einkauf ist eine "praktische Annehmlichkeit", die von vielen benutzt wird. All das ist umweltgefährdend – und nützt nur dem Besitzer des Schnellrestaurants, der das Reinigungspersonal einsparen kann, welches nötig ist, wenn man andere Verpackungsarten verwendet. Der Besitzer des Supermarktes oder gar der Ladenbesitzer um die Ecke kommt dabei auf seine Kosten, denn der Kunde kann zu jedem Zeitpunkt das kaufen, was er will, auch wenn er das ursprünglich gar nicht geplant hatte, weil er immer eine Plastiktüte zum Tragen bekommt. All das bewirkt eine ungeheure Steigerung der Produktion von Abfall und Verpackungsmüll, so dass man pro Kopf fast mit einem Kilo Abfall & Verpackungen rechnen muss, d.h. Millionen Tonnen verschiedenster Abfälle pro Tag.
Man geht davon aus, dass allein in einem Land wie Italien die Abfallmenge sich während der letzten 25 Jahre bei gleich bleibender Bevölkerungszahl mehr als verdoppelt hat.
Die Frage des Mülls ist eine der Fragen, welche die Politiker meinen lösen zu können, aber im Kapitalismus stößt sie in Wirklichkeit auf unüberwindbare Hürden. Aber diese Hürden tauchen nicht aufgrund mangelnder Technologie auf, sondern im Gegenteil sie sind das Ergebnis der Mechanismen, die diese Gesellschaft beherrschen. Denn der Umgang mit Müll, sei es um ihn zu entsorgen oder seinen Umfang zu reduzieren, ist auch den Regeln der Profitwirtschaft unterworfen. Selbst wenn Recycling und die Wiederverwendung von Material durch Mülltrennung usw. möglich sind, erfordert dies Mittel und eine gewisse politische Koordinierungsfähigkeit, welche im Allgemeinen in den schwächeren Wirtschaften ohnehin fehlt. Deshalb stellt in den ärmeren Ländern oder dort, wo die Firmen in Anbetracht der Beschleunigung der Krise während der letzten Jahrzehnte vor größeren Schwierigkeiten stehen, die Abfallentsorgung mehr als einen zusätzlichen Kostenfaktor dar.
Aber manche mögen einwenden: Wenn in den fortgeschrittenen Ländern die Müllentsorgung funktioniert, heißt dies, dass es sich nur um eine Frage des guten Willens, des richtigen Bürgersinns und der Fähigkeit der ordentlichen Leitung einer Firma handelt. Das Problem sei, dass wie in allen Bereichen der Produktion die stärksten Länder einen Teil der Last der Abfallentsorgung auf die schwächeren Länder (oder innerhalb der stärksten Länder auf die schwächeren Regionen) abwälzen.
"Zwei amerikanische Umweltgruppen, Basel Action Network und Silicon Valley Toxics, haben neulich einen Bericht veröffentlicht, in dem behauptet wird, dass 50 - 80% der Elektronikabfälle der westlichen US-Bundesstaaten in Container auf Schiffe verladen werden, die Richtung Asien (vor allem Indien und China) fahren, wo die Kosten für ihre Beseitigung wesentlich niedriger sind und die Umweltschutzauflagen viel lockerer sind. Es handelt sich nicht um Hilfsprojekte, sondern um einen Handel mit giftigen Rückständen, die Verbraucher weggeschmissen haben. Der Bericht der beiden Umweltgruppen erwähnt zum Beispiel die Müllhalde von Guiyu, auf der vor allem Bildschirme und Drucker gelagert werden. Die Arbeiter von Guiyu benutzen nur sehr primitive Werkzeuge, um daraus die Teile auszubauen, welche weiter verkauft werden können. Eine enorme Menge an Elektronikschrott wird nicht recycelt, sondern liegt einfach auf den Feldern, an Flussufern, in Teichen und Sümpfen, Flüssen und Bewässerungskanälen herum. Ohne irgendwelchen Schutz arbeiten dort Frauen, Männer und Kinder" (4).
"In Italien (…) schätzt man, dass die Öko-Mafiosi einen Umsatz von 26 Milliarden Euro pro Jahr haben, davon 15 Mrd. für den illegalen Handel und die illegale Entsorgung von Müll (Bericht über die Ecomafia 2007, Umweltliga). (…) Der Zoll hat im Jahre 2006 ungefähr 286 Container beschlagnahmt mit mehr als 9000 Tonnen Müll. Die legale Entsorgung eines 15 Tonnen Containers mit gefährlichem Sondermüll kostet ungefähr 60000 Euro. Bei einer illegalen Entsorgung in Asien werden dafür nur 5000 Euro verlangt. Die Hauptabnehmer für illegalen Müllhandel sind asiatische Entwicklungsländer. Das dorthin exportierte Material wird zunächst verarbeitet, dann wieder nach Italien und andere Länder eingeführt, dieses Mal aber als ein Produkt, das aus dem Müll gewonnen wurde, und nun insbesondere Plastik verarbeitenden Fabriken zugeführt wird.
Im Juni 1992 hat die FAO (Food and Agricultural Organisation) angekündigt, dass die Entwicklungsländer, vor allem die afrikanischen Staaten, zu einer "Mülltonne" geworden sind, die dem Westen zur Verfügung stehen. Somalia scheint heute einer der am meisten gefährdeten afrikanischen Staaten zu sein, ein wahrer Dreh- und Angelpunkt für den Mülltourismus. In einem jüngsten Bericht der UNEP (United Nations Environment Programme) wird auf die ständig steigende Zahl von verschmutzten Grundwasservorkommen in Somalia hingewiesen, was unheilbare Erkrankungen verursacht. Der Hafen von Lagos, Nigeria, ist der wichtigste Umschlagplatz für den illegalen Handel von Technikschrott, der nach Afrika verschifft wird.
Jedes Jahr sammeln sich auf der Welt ca. 20 - 50 Millionen Tonnen "Elektroschrott" an. In Europa spricht man von 11 Millionen Tonnen, davon landen 80% auf dem Müll. Man geht davon aus, dass es 2008 mindestens eine Milliarde Computer (einen für sechs Erdbewohner) geben wird; gegen 2015 wird es mehr als zwei Milliarden PCs geben. Diese Zahlen bergen neue große Gefahren in sich, wenn es darum gehen wird, den alten Elektroschrott zu entsorgen" (5).
Wie oben erwähnt wird das Müllproblem aber auch auf die weniger entwickelten Regionen innerhalb eines Landes verlagert. Das trifft insbesondere für Kampanien, Italien, zu, was international von sich reden machte aufgrund ihrer Müllberge, die monatelang auf den Straßen herumlagen. Aber wenige wissen, dass Kampanien – so wie international China, Indien oder Nordafrika -, das 'Auffangbecken' für viel Giftmüll aus den Industriegebieten des Nordens ist. Dadurch wurden fruchtbare landwirtschaftliche Böden wie die um Caserta zu solchen der am meisten verschmutzten Böden der Erde. Trotz der eingeleiteten, wiederholten strafrechtlichen Verfolgungsmaßnahmen geht die Vernichtung der Böden weiter. Es sind aber nicht die Camorra, die Mafia, die Unterwelt usw., die diese Schäden verursachen, sondern die Logik des Kapitalismus ist dafür verantwortlich. Während für die vorschriftsmäßige Entsorgung von Giftmüll oft mehr als 60 Cent pro Kilo veranschlagt werden müssen, kostet die illegale Entsorgung nur etwas mehr als 10 Cent. So wird jedes Jahr jede verlassene Höhle zu einer offenen Müllkippe. In einem kleinen Dorf Kampaniens, wo eine Müllverbrennungsanlage gebaut werden soll, wurde giftiges Material zur Vertuschung des Giftbestandes mit Erde vermischt und dann beim Straßenbau verwendet. Dort hat man es als untere Schicht für eine lange Straße mit gestampftem Boden benutzt. Wie Saviano in seinem Buch, das mittlerweile in Italien zu einem Kultbuch geworden ist, schrieb: "wenn die illegalen Müllberge, die die Camorra "entsorgt" hat, auf einem Haufen zusammengetragen würden, würde dieser eine Höhe von 14600 Meter auf einer Fläche von 3 Hektar erreichen, das wäre höher als jeder Berg auf der Erde" (6).
Wie wir im nächsten Artikel näher ausführen werden, ist das Problem des Abfalls vor allem mit der Produktionsform verbunden, die die kapitalistische Gesellschaft auszeichnet. Abgesehen von dem Teil, der "weggeworfen" wird, sind die Probleme oft auf die Zusammensetzung und das Material zurückzuführen, die bei der Produktion verwendet werden. Die Verwendung von synthetischen Stoffen, insbesondere von Plastik, das praktisch unzerstörbar ist, bringt gewaltige Probleme für die zukünftigen Generationen mit sich. Und dieses Mal handelt es sich nicht mal um reiche oder arme Länder, weil Plastik nirgendwo auf der Welt abbaubar ist, wie der Auszug aus folgendem Artikel belegt: "Man nennt sie "Trash Vortex", die Müllinsel im Pazifischen Ozean, die einen Durchmesser von ca. 25000 km umfasst, ca. 30 m tief ist und zu ca. 80% aus Plastik besteht, die restlichen 20% sind anderer Müll, der dort gelandet ist. Es ist, als ob es inmitten des Pazifiks eine gigantische Insel gäbe, die nicht aus Felsen, sondern aus Müll besteht. In den letzten Wochen hat die Dichte dieses Materials solche Werte erreicht, dass das Gesamtgewicht dieser 'Müllinsel' ca. 3,5 Millionen Tonnen umfasst, erklärte Chris Parry von der Kalifornischen Küstenwacht in San Francisco (…) Diese unglaubliche, wenig bekannte Abfallmenge, ist seit den 1950er Jahren entstanden, aufgrund eines subtropischen Wirbels im Nordpazifik. Es handelt sich um eine langsame Strömung im Ozean, die sich im Uhrzeigersinn und spiralenförmig dreht, angetrieben von Hochdruckströmungen. (…). Der größte Teil dieses Plastiks, ca. 80%, wurde von den Kontinenten angeschwemmt. Nur der Rest stammt von Schiffen (private, Handels- oder Fischfangbooten). Jedes Jahr werden auf der Welt ca. 100 Milliarden Kilo Plastik produziert, davon landet ca. 10% im Meer. 70% dieses Plastiks versinkt auf den Meeresboden und schädigt somit die Lebewesen am Meeresgrund. Der Rest schwimmt an der Meeresoberfläche. Der Großteil dieses Plastiks ist wenig biologisch abbaubar und zerfällt letztendlich in winzige Partikel, die wiederum im Magen vieler Meerestiere landen und deren Tod verursachen. Was übrig bleibt, wird erst im Laufe von mehreren Hundert Jahren verfallen; solange wird es aber weiterhin großen Schaden in den Meeren anrichten" (7).
Solch eine Müllmenge auf einer Fläche, die zweimal größer ist als die USA soll wirklich erst jetzt entdeckt worden sein? In Wirklichkeit nein! Sie wurde 1997 von einem Kapitän eines Schiffs, welches der Meeresforschung dient, entdeckt. Der Kapitän befand sich auf der Rückkehr von einem Wettbewerb unter Yachten. Heute wird bekannt, dass die UNO in einem Bericht von 2006 davon ausgeht, „dass eine Million Meeresvögel und mehr als 100000 Fische und Meeressäugetiere jedes Jahr aufgrund des Plastikmülls sterben, und dass jede Meeresseemeile des Ozeans mindestens ungefähr 46000 Stücke schwimmenden Plastiks enthält“ (8).
Aber was wurde während der letzten 10 Jahre von denjenigen unternommen, die in der Gesellschaft am Hebel der Macht sitzen? Absolut gar nichts! Ähnliche Verhältnisse, auch wenn sie nicht so dramatisch sind, hat man auch im Mittelmeer beobachtet, in dessen Gewässer jedes Jahr 6.5 Mio. Abfall geschmissen werden, von denen 80% Plastik sind. Auf dem Boden des Mittelmeeres findet man stellenweise bis zu 2000 Stücke Plastik pro Quadratkilometer (9).
Und dabei gäbe es Lösungen. Wenn beispielsweise der Plastik aus mindestens 85% Maisstärke besteht, ist er vollständig biologisch abbaubar. Heute schon gibt es Tüten, Stifte und andere aus diesem Material bestehende Gegenstände. Aber im Kapitalismus schlägt die Industrie ungern einen Weg ein, der nicht höchste Profite verspricht. Und da Plastik auf der Grundlage von Maisstärke teurer ist, will niemand diese Kosten für die teurere Herstellung des biologisch abbaubaren Materials übernehmen, weil man sonst vom Markt verdrängt wird (10). Das Problem ist, dass die Kapitalisten die Gewohnheit haben, Wirtschaftsbilanzen zu erstellen, die systematisch all das ausschließen, was nicht zahlenmäßig erfasst werden kann, weil man es weder kaufen noch verkaufen kann, auch nicht, wenn es sich um die Gesundheit der Menschen und die Umwelt handelt. Jedes Mal, wenn ein Industrieller einen Stoff herstellen lässt, das am Ende seiner Lebensdauer zu Müll wird, werden die Kosten für die Entsorgung des Mülls praktisch nie einkalkuliert, und vor allem wird nie berücksichtigt, welche Kosten und Schäden daraus entstehen, dass dieses Material irgendwo auf der Erde nicht abgebaut liegen bleibt.
Man muss hinsichtlich des Müllproblems noch hinzufügen: Wenn man Müllhalden oder auch Verbrennungsanlagen verwendet, stellt das eine Verschwendung des ganzen Energiewertes und der nützlichen Bestandteile dieses Mülls dar. Es ist zum Beispiel bewiesen, dass die Herstellung bzw. Verarbeitung von Kupfer und Aluminium mit Hilfe von recyceltem Material Kostenersparnisse bis zu 90% ermöglichen kann. In den Ländern der Peripherie sind die Müllhalden zu einer wahren Quelle der Subsistenzmittel für Tausende von Menschen geworden, die vom Land gekommen sind, aber in der Stadt keine Arbeit finden. Müllsammler suchen auf den Müllhalden nach Wiederverwertbarem.
„Richtige „Müllstädte“ sind entstanden. In Afrika handelt es sich um Korogocha in Nairobi – Pater Zanotelli hat die Verhältnisse dort mehrmals beschrieben; weniger bekannt ist Kigali in Ruanda, aber die in Sambia sind auch berühmt. Dort wird 90% des Mülls nicht eingesammelt. Er verfault auf der Straße, während die Müllhalde von Olososua in Nigeria jeden Tag von mehr als 1000 LKW's angefahren wird. In Asien hat Payatas in Quezon City in der Nähe von Manila traurige Berühmtheit erlangt. Diese Slums, wo mehr als 25000 Menschen leben, sind am Abhang eines Müllbergs entstanden. Man nennt ihn den „stinkenden Berg“, wo sich Kinder und Erwachsene um das Material streiten, das sie weiterverkaufen können. Dann gibt es noch Paradise Village, das kein Touristendorf ist, sondern ein Slum, der auf einem Sumpfgebiet entstanden ist, wo es immer wieder zu Überschwemmungen und starken Monsunregenfällen kommt. Schließlich Dumpsite Catmon, die Müllhalde, auf der die Slums stehen, die Paradise Village überragen. In Beijing, China, leben Tausende von Menschen auf den Müllhalden, die verbotene, weil gefährliche Stoffe recyceln, während es in Indien die meisten „Überlebenden“ gibt, die sich dank der Müllhalden „ernähren“ können" (11).
Die Verbreitung der Giftstoffe
Giftstoffe sind natürliche oder synthetische Substanzen, die für den Menschen und/oder andere Lebewesen giftig sind. Neben Stoffen, die es immer schon auf unseren Planeten gegeben hat, und die von der industriellen Technologie auf verschiedenste Art verwendet werden – wie zum Beispiel Schwermetalle, Asbest, usw., hat die chemische Industrie Zehntausende anderer Stoffe massenweise produziert. Mangelnde Kenntnis der Gefahren einer Reihe von Stoffen, und vor allem der Zynismus des Kapitalismus haben unvorstellbare Schäden angerichtet. Dadurch sind Umweltzerstörungen entstanden, die man nur sehr schwer wieder beheben kann, nachdem die gegenwärtig herrschende Klasse gestürzt sein wird.
Eine der größten Katastrophen der chemischen Industrie ist sicherlich die von Bophal, Indien, die in dem Werk des amerikanischen Chemie-Multis Union Carbide zwischen dem 2. und 3. Dezember 1984 stattfand. Eine Giftwolke von 40 Tonnen Pestiziden hat entweder sofort oder in den darauf folgenden Jahren mindestens 16000 Menschen getötet. Millionen andere Menschen klagen seitdem über unheilbare körperliche Schäden. Später eingeleitete Untersuchungen haben zutage gebracht, dass im Gegensatz zu einem vergleichbaren Werk in Virginia, USA, das Werk in Bophal über keine drucktechnischen Überwachungsanlagen und Kühlsysteme verfügte. Der Kühlturm war vorübergehend außer Betrieb genommen worden; die Sicherheitssysteme entsprachen überhaupt nicht dem Ausmaß der Werksanlage. In Wirklichkeit stellte die indische Fabrik mit ihren billigen Arbeitskräften für die amerikanischen Besitzer eine sehr lukrative Einnahmequelle dar, die nur sehr geringe Investitionen in variables und fixes Kapital erforderte.
Ein anderes historisches Beispiel war dann der Vorfall in dem Atomkraftwerk von Tschernobyl 1986. „Man hat geschätzt, dass die radioaktiven Strahlen des Reaktors 4 von Tschernobyl ungefähr 200 mal höher lagen als die Explosionen der Atombomben von Hiroshima und Nagasaki zusammengenommen. Auf einem Gebiet zwischen Russland, der Ukraine und Weißrussland, in dem ungefähr 9 Millionen Menschen leben, hat man eine große Verseuchung festgestellt. 30% des Gebietes ist durch Cäsium 137 verseucht. In den 3 Ländern mussten ca. 400000 Menschen evakuiert werden, während weitere 270000 Menschen in Gebieten leben, wo der Konsum von örtlichen landwirtschaftlichen Produkten nur eingeschränkt erlaubt ist“ (12).
Es gibt natürlich noch unzählige andere Umweltkatastrophen aufgrund der miserablen Verwaltung von Betrieben oder aufgrund der vielen Meeresverschmutzungen durch Ölteppiche wie die, welcher der Öltanker Exxon Valdez am 24. März 1989 anrichtete, als bei seinem Untergang vor der Küste Alaskas mindestens 30000 Tonnen Öl ins Meer liefen, oder auch durch den ersten Golfkrieg, als viele Ölplattformen in Brand geschossen wurden und eine wahre Ökokatastrophe sich im Persischen Golf in einem bislang noch nie da gewesenen Ausmaß ausbreitete. Schätzungen der US-amerikanischen Nationalen Akademie der Wissenschaften zufolge werden jedes Jahr durchschnittlich zwischen 3 - 4 Millionen Tonnen Kohlenwasserstoff ins Meer eingeleitet. Tendenz steigend – trotz der verschiedenen Schutzmaßnahmen, denn die Nachfrage nach diesen Produkten wächst.
Neben den Auswirkungen dieser Verschmutzungen, die bei hoher Dosierung größere Vergiftungen hervorrufen, gibt es einen anderen Vergiftungsmechanismus, der langsamer, diskreter wirkt, die chronische Vergiftung. Wenn eine giftige Substanz langsam und in geringen Dosen aufgenommen wird und chemisch stabil ist, kann sie sich in den Organen und den Geweben der Lebewesen absetzen und soweit voranschreiten, dass tödliche Konzentrationen erreicht werden. Dies nennt man aus der Sicht der Ökotoxikologie Bioakkumulation. Ein anderer Mechanismus überträgt ebenso eine giftige Substanz, die in die Lebensmittelkette eindringt (das trophische Netz). Sie gelangt von einer niedrigen zu einer höheren Stufe der trophischen Stadien, mit jeweiliger Verdoppelung bzw. Verdreifachung der Konzentration. Um es deutlicher zu machen, nehmen wir ein konkretes Beispiel aus dem Jahre 1953 in Minamata in Japan. In der Minamata Bucht lebten viele arme Fischer, die sich im Wesentlichen aus ihrem Fischfang ernährten. In der Nähe dieser Bucht befand sich ein Industriekomplex, der Azetaldehyd, einen chemischen Stoff, eine Synthese, deren Zubereitung ein Quecksilberderivat erfordert, verwendete. Die ins Meer als Abfall eingeleiteten Stoffe waren leicht mit Quecksilber vergiftet. Die Konzentration betrug jedoch nur 0.1 Mikrogramm pro Liter Meerwasser, d.h. eine Konzentration, die selbst mit den heute verfügbaren genaueren Messgeräten immer noch schwierig aufzuspüren ist. Welche Konsequenzen zog man aus dieser kaum wahrnehmbaren Verschmutzung? 48 Menschen starben innerhalb weniger Tage, 156 litten unter Vergiftungen mit schwerwiegenden Folgen, und selbst die Katzen der Fischer, die sich ständig von Fischresten ernährten, wurden „irrsinnig“, "brachten sich schließlich selbst" im Meer um, ein für ein Raubtier völlig unübliches Verhalten. Was war passiert? Das im Meerwasser vorhandene Quecksilber war durch das Phytoplankton absorbiert und fixiert worden, war dann von diesem zum Zooplankton gewandert, schließlich zu den kleinen Mollusken (Weichtieren), und schlussendlich zu den kleineren und mittelgroßen Fischen. Der Vorgang erfasste die ganze trophische Kette. Dabei wurde der gleiche Schadstoff, der chemisch unzerstörbar ist, auf einen neuen ‚Gastgeber’ mit wachsender Konzentration übertragen und zwar umgekehrt proportional im Verhältnis zur Größe des Jägers und der Masse der während seines Lebens aufgenommenen Nahrung. So hat man festgestellt, dass bei Fischen das Metall eine Konzentration von 50 mg/Kilo erreicht hatte, was einer 500000 fachen Konzentration entspricht. Bei einigen Fischern mit dem „Minamata-Syndrom“ wurden erhöhte Metallwerte in ihren Organen, insbesondere in ihren Haaren, die mehr als ein halbes Gramm pro Kilo Körpergewicht betrugen.
Obgleich sich Anfang der 1960er Jahre die Wissenschaftler dessen bewusst waren, dass es bei giftigen Substanzen nicht ausreicht, Methoden der Auflösung in der Natur zu benutzen, weil erwiesenermaßen biologische Mechanismen dazu in der Lage sind, das zu konzentrieren, was der Mensch zerstreut, hat die chemische Industrie unseren Planeten weiterhin massiv verpestet – ohne dieses Mal den Vorwand auftischen zu können "wir haben nicht gewusst, dass so etwas eintreten kann". So ist es jüngst zu einem zweiten Minamata in Priolo (Sizilien) gekommen, wo auf einer Fläche von wenigen Quadratkilometern mindestens fünf Raffinerien, darunter Enichem, illegal Quecksilber aus einer Chlor- und Schwefelfabrik auf den Feldern entsorgen. Zwischen 1991 und 2001 sind ca. 1000 Kinder mit großen geistigen Behinderungen und ernsthaften Missbildungen sowohl am Herz als auch am Urogenitaltrakt geboren worden. Ganze Familien leiden unter Tumoren und viele verzweifelte Frauen sahen sich zu Abtreibungen gezwungen, weil sie verkrüppelte Kinder erwarteten. Dabei hatte der Vorfall von Minamata schon all die Risiken von Quecksilber für die menschliche Gesundheit aufgezeigt. Priolo ist also kein unvorhersehbares Ereignis, kein tragischer Fehler, sondern eine rein verbrecherische Tat, die von dem italienischen Kapitalismus und dabei noch von dem "Staatskapitalismus" verübt wurde, den viele Leute als "linker" als der "Privatsektor" darstellen wollen. In Wirklichkeit hat man feststellen müssen, dass die Führung von Enichem sich schlimmer als die Ökomafia verhalten hat: Um Kosten bei der "Dekontaminierung" (man spricht von mehreren Millionen eingesparten Euros) zu sparen, wurden die mit Quecksilber verseuchten Abfälle mit anderem Schutzwasser vermischt und im Meer entsorgt. Indem falsche Bescheinigungen ausgestellt wurden, benutzte man Tankwagen mit doppeltem Boden, um den Handel mit giftigen Substanzen zu verheimlichen – all das mit Übereinstimmung der verantwortlichen Stellen. Als die Justiz sich schließlich rührte und die führenden Köpfe der Industrie verhaftete, war die Verantwortung dermaßen unleugbar, dass Enichem ein Schmerzensgeld von 11000 Euro pro Familie beschloss, d.h. ein Betrag, den das Unternehmen bei einer rechtskräftigen Verurteilung durch ein Gericht hätte bezahlen müssen.
Neben den Ursachen für Verschmutzungen, die auf Unfälle zurückzuführen sind, produziert die ganze Gesellschaft aufgrund ihrer Funktionsweise ständig umweltgefährdende Stoffe, die sich in der Luft, im Wasser und am Boden sammeln – und wie schon erwähnt – in der Biosphäre, einschließlich bei den Menschen. Der massive Einsatz von Reinigungsmitteln und anderen Produkten dieser Art hat zum Phänomen der Eutrophierung (Nährstoffanreicherung in einem Gewässer) der Flüsse, Seen und Meere geführt. In den 1990er Jahren wurden in die Nordsee 6000 - 11000t Blei, 22 000 - 28 000t Zink, 4200t Chrom, 4000t Kupfer, 1450t Nickel, 530t Kadmium, 1,5 Millionen Tonnen Stickstoffe und ca. 100000t Phosphate eingeleitet. Dieser Giftmüll ist besonders gefährlich in den Meeren, die flächenmäßig groß (aber nicht sehr tief) sind, wie bei der Nordsee, der Ostsee, der südlichen Adria, dem Schwarzen Meer. Weil in diesen Meeren nicht soviel Tiefenwasser vorhanden ist, und die Vermischung zwischen Süßwasser aus den Flüssen und dichterem Salzwasser schwierig ist, können die Giftstoffe sich nicht zersetzen.
Synthetische Produkte wie das berühmt berüchtigte Pflanzenschutzmittel DDT, das seit 30 Jahren in den Industriestaaten verboten ist, oder auch PCB (chlorierte Biphenyle), welche zuvor in der elektrischen Industrie verwendet, aber mittlerweile ebenso wegen bekannt gewordener Gefahren verboten wurden, besitzen alle eine unbeschreibliche chemische Haltbarkeit. Sie sind in unveränderten Zustand überall vorhanden, im Wasser, in den Böden, in den Zellen der Lebewesen. Aufgrund der Bioakkumulation sind diese Stoffe in gefährlichen Konzentrationen in einigen Lebewesen zu finden, was zu deren Tod oder Störungen bei der Reproduktion führt und einen Rückgang der jeweiligen Populationen bewirkt. So richtet der Müllhandel, bei dem oft Giftmüll noch irgendwo ohne irgendwelche Schutzmaßnahmen zwischengelagert wird, unkalkulierbare Schäden im Ökosystem und für die ganze Bevölkerung an.
Bevor wir diesen Punkt hier abschließen – obwohl noch Hunderte von Beispielen aus der ganzen Welt geliefert werden könnten -, wollen wir noch daran erinnern, dass gerade diese Bodenverseuchung für ein neues und dramatisches Phänomen verantwortlich ist: die Entstehung von „Todeszonen“ – wie zum Beispiel das Dreieck Priolo, Mellili und Augusta in Sizilien – wo der Prozentsatz von Neugeborenen mit Fehlbildungen viermal höher ist als der nationale Durchschnitt, oder auch das andere Todesdreieck in der Nähe von Neapel zwischen Giuliano, Qualiano und Villaricca, wo die Zahl der Tumorerkrankungen weit über dem nationalen Durchschnitt liegt.
Die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen und/oder die Bedrohung durch die Umweltverschmutzung
Das letzte Beispiel des globalen Phänomens, das die Welt in eine Katastrophe führt, ist das der Verknappung und Erschöpfung der natürlichen Ressourcen oder deren Bedrohung durch Umweltverschmutzung. Bevor wir näher auf dieses Phänomen eingehen, wollen wir unterstreichen, dass die Menschengattung schon früher in einem geringeren Maße auf solche Probleme gestoßen ist, die schon damals katastrophale Konsequenzen hatten. Damals waren nur kleinere, beschränkte Teile der Erde davon betroffen. Wir wollen aus dem Buch von Jared Diamond, „Kollaps“, das sich mit der Geschichte Rapa Nui’s auf der Osterinsel befasst, zitieren, die wegen ihrer großen Steinstatuen bekannt ist. Man weiß, dass die Insel von dem holländischen Forscher Jacob Roggeveen Ostern 1772 entdeckt wurde (daher ihr Name), und es ist mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass die Insel „von einem dichten subtropischen Wald bedeckt war, der viele große Bäume aufwies“. Auch gab es dort viele Vögel und wilde Tiere. Aber bei Ankunft der Kolonisatoren hatte die Insel einen anderen Eindruck hinterlassen:
"so war es auch für Rogeveen ein Rätsel, wie die Inselbewohner ihre Statuen aufgerichtet hatten. Um noch einmal aus seinem Tagebuch zu zitieren: „Die steinernen Bildsäulen sorgten zuerst dafür, dass wir starr vor Erstaunen waren, denn wir konnten nicht verstehen, wie es möglich war, dass diese Menschen, die weder über dicke Holzbalken zur Herstellung irgendwelcher Maschinen noch über kräftige Seile verfügten, dennoch solche Bildsäulen aufrichten konnten, welche volle neun Meter hoch und in ihren Abmessungen sehr dick waren (...) Ursprünglich, aus größerer Entfernung, hatten wir besagte Osterinsel für sandig gehalten, und zwar aus dem Grund, dass wir das verwelkte Gras, Heu und andere versengte und verbrannte Vegetation als Sand angesehen hatten, weil ihr verwüstetes Aussehen uns keinen anderen Eindruck vermitteln konnte als den einer einzigartigen Armut und Öde. „Was war aus den vielen Bäumen geworden, die früher dort gestanden haben müssen?“ Um die Bearbeitung, den Transport und die Errichtung der Statuen zu organisieren, bedurfte es einer komplexen, vielköpfigen Gesellschaft, die von ihrer Umwelt leben konnte“. (Diamond, S. 105)
„Insgesamt ergibt sich für die Osterinsel ein Bild, das im gesamten Pazifikraum einen Extremfall der Waldzerstörung darstellt und in dieser Hinsicht auch in der ganzen Welt kaum seinesgleichen hat. Der Wald verschwand vollständig, und seine Baumarten starben ausnahmslos aus.“ (Diamond, S. 138)
"Dies alles lässt darauf schließen, dass die Abholzung der Wälder kurz nach dem Eintreffen der ersten Menschen begann, um 1400 ihren Höhepunkt erreichte und je nach Ort zwischen dem frühen 15. und dem 17. Jahrhundert praktisch abgeschlossen war. Für die Inselbewohner ergab sich daraus die unmittelbare Folge, dass Rohstoffe und wild wachsende Nahrungsmittel fehlten, und auch die Erträge der Nutzpflanzen gingen zurück (…) Da es auch keine seetüchtigen Kanus mehr gab, verschwanden die Knochen der Delphine, die in den ersten Jahrhunderten die wichtigsten Fleischlieferanten der Inselbewohner gewesen waren, um 1500 praktisch völlig aus den Abfallhaufen; und das Gleiche galt für Thunfische und andere Fischarten aus dem offenen Meer. (…) Weiter geschädigt wurde der Boden durch Austrocknung und Auswaschung von Nährstoffen, auch sie eine Folge der Waldzerstörung, die zu einem Rückgang des Pflanzenertrages führte. Darüber hinaus standen die Blätter, Früchte und Zweige wilder Pflanzen, die den Bauern zuvor als Kompost gedient hatten, nicht mehr zur Verfügung. (...) Im weitern Verlauf kam es dann zu einer Hungersnot, einem Zzusammenbruch der Bevölkerung und einem Niedergang bis hin zum Kannibalismus. (…) In der mündlichen Überlieferung der Inselbewohner nimmt der Kannibalismus breiten Raum ein; die schrecklichste Beschimpfung, die man einem Feind entgegenschleudern konnte, lautete: "Das Fleisch deiner Mutter hängt zwischen meinen Zähnen." (S. 138)
"Wegen ihrer isolierten Lage ist die Osterinsel das eindeutigste Beispiel für eine Gesellschaft, die sich durch übermäßige Ausbeutung ihrer eigenen Ressourcen selbst zerstört hat (...) Die Parallelen zwischen der Osterinsel und der ganzen heutigen Welt liegen beängstigend klar auf der Hand. Durch Globalisierung, internationalen Handel, Flugverkehr und Internet teilen sich heute alle Staaten der Erde die Ressourcen, und alle beeinflussen einander genau wie die zwölf Sippen auf der Osterinsel. Die Osterinsel war im Pazifik ebenso isoliert wie die Erde im Weltraum. Wenn ihre Bewohner in Schwierigkeiten gerieten, konnten sie nirgendwohin flüchten, und sie konnten niemanden um Hilfe bitten; ebenso können wir modernen Erdbewohner nirgendwo Unterschlupf finden, wenn unsere Probleme zunehmen. Aus diesen Gründen erkennen viele Menschen im Zusammenbruch der Osterinsel eine Metapher, ein schlimmstmögliches Szenario für das, was uns selbst in Zukunft vielleicht noch bevorsteht“ (S. 152). (15)
Diese Beobachtungen, die alle aus dem Buch von Diamond stammen, warnen uns davor zu glauben, dass das Ökosystem der Erde über keine Grenzen verfüge, und sie zeigen, dass das, was auf den Osterinseln passierte, auch die Menschheit insgesamt treffen kann, falls diese nicht entsprechend behutsam mit den Ressourcen des Planeten umgeht.
Man könnte natürlich sofort eine Parallele ziehen zum Abholzen der Wälder, das seit dem Beginn der Urgemeinschaften bis heute vor sich geht, und heute weiter systematisch betrieben wird, womit die letzten grünen Lungen der Erde wie der Regenwald des Amazonas zerstört werden.
Wie schon bei der Verseuchung durch Blei erwähnt, kennt die herrschende Klasse sehr wohl die bekannten Risiken, wie die edle Intervention eines Wissenschaftlers des 19. Jahrhundert, Rudolf Julius Emmanuel Clausius, belegt, der sich zur Frage der Energie und der Ressourcen schon ein Jahrhundert vor all den Reden zum Naturschutz sehr deutlich äußerte „In der Wirtschaft einer Nation ist ein Gesetz immer gültig: Man darf während eines gewissen Zeitraums nicht mehr konsumieren als das, was in diesem Zeitraum produziert wurde. Deshalb dürfen wir nur soviel Brennstoffe verbrauchen wie es möglich ist, diese dank des Wachstums der Bäume wiederherzustellen“ (16).
Aber wenn man die heutigen Verhältnisse betrachtet, muss man schlussfolgern, dass genau das Gegenteil passiert, was Clausius empfohlen hatte, und man schlägt direkt den gleichen fatalen Weg wie den der Osterinsel ein.
Um dem Problem der Ressourcen adäquat entgegenzutreten, muss man auch eine andere grundlegende Variable berücksichtigen: die Schwankungen der Weltbevölkerung.
„Bis 1600 war das Wachstum der Weltbevölkerung noch sehr langsam; sie nahm lediglich zwischen 2 - 3% pro Jahrhundert zu. 16 Jahrhunderte vergingen, bevor die Einwohnerzahl von ca. 250 Millionen Menschen zur Zeit des Beginns des Zeitalters von Jesus Christus die Zahl von 500 Millionen Menschen erreicht wurde. Von diesem Zeitpunkt an und danach nahm die Zeit zur Verdoppelung der Bevölkerung ständig ab, so dass in einigen Ländern der Welt heute die so genannte „biologische Grenze“ des Bevölkerungswachstums erreicht wird (3 - 4%). UNO-Schätzungen zufolge werden ca. 8 Milliarden Menschen um das Jahr 2025 leben. […] Es gibt große Unterschiede zwischen den entwickelten Ländern, die nahezu ein Nullwachstum erreicht haben, und den Entwicklungsländern, die bis zu 90% zum gegenwärtigen demographischen Wachstum beitragen. […] Im Jahre 2025 wird zum Beispiel Nigeria UN-Schätzungen zufolge eine größere Bevölkerungszahl als die USA haben und in Afrika werden dreimal so viel Menschen leben wie in Europa. Überbevölkerung, verbunden mit Rückständigkeit, Analphabetentum und ein Mangel an Hygiene und Gesundheitseinrichtungen stellen sicher ein großes Problem dar, das nicht nur Afrika bedroht, sondern die ganze Welt beeinflussen wird. Insofern scheint es ein großes Ungleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot an verfügbaren Ressourcen zu geben, das auch auf die Verwendung von ca. 80% der Energieressourcen der Welt durch die Industriestaaten zurückzuführen ist.
Die Überbevölkerung bringt einen starken Rückgang der Qualität der Lebensbedingungen mit sich, weil sie die Produktivität eines Arbeiters sinken und auch die Verfügbarkeit von Lebensmitteln, Trinkwasser, Gesundheitsleistungen und Medikamenten pro Kopf fallen lässt. Der starke, von Menschen gegenwärtig verursachte Druck führt zu einer Schädigung der Umwelt, die sich unvermeidbar auf die Gleichgewichte des Systems Erde auswirken wird.
Die Ungleichgewichte haben sich in den letzten Jahren verstärkt: die Bevölkerung wächst nicht nur in einem Maße, das keineswegs homogen ist, sondern sie nimmt vor allem in den städtischen Ballungsräumen sehr stark zu“ (17).
Das starke Bevölkerungswachstum verschärft das Problem der Erschöpfung der Ressourcen also nur noch mehr, zudem der Mangel an natürlichen Ressourcen vor allem da anzutreffen ist, wo die Bevölkerungsexplosion am stärksten ist, was für die Zukunft nur noch größere Probleme erahnen lässt, wovon immer mehr Menschen betroffen sein werden.
Untersuchen wir die erste Quelle der Natur, Wasser, ein auf der ganzen Welt notwendiges Gut, das heute durch das unverantwortliche Vorgehen des Kapitalismus stark bedroht ist.
Wasser ist ein Gut, das auf der Erdoberfläche in großen Mengen vorhanden ist (um nur von den Ozeanen, dem Grundwasser und den Polkappen zu sprechen), aber nur ein kleiner Teil davon ist als Trinkwasser nutzbar, d.h. der Teil, der in den Polkappen und in den wenigen noch nicht vergifteten Flüssen zur Verfügung steht. Die Entwicklung der industriellen Aktivitäten, die die Bedürfnisse der Umwelt völlig außer Acht lassen, und die völlig willkürliche Ablagerung und Entsorgung des städtischen Mülls haben einen Großteil des Grundwassers verseucht, das die natürliche Trinkwasserreserve des Gemeinwesens ist. Dies hat mit zur Verbreitung von Krebs und anderen Krankheiten der Bevölkerung beigetragen; andererseits ist das Wasser zu einem knappen und kostbaren Gut in vielen Ländern geworden.
„Mitte des 21. Jahrhunderts werden den pessimistischen Prognosen zufolge ca. 7 Milliarden Menschen in 60 Ländern nicht mehr über ausreichend Wasser verfügen. Im besten Fall aber würden „nur“ zwei Milliarden Menschen in 48 Ländern an Wassermangel leiden. (…) Aber die besorgniserregendsten Angaben in dem Dokument der UNO sind wahrscheinlich die aufgrund der Wasserschmutzung und der schlechten Hygienebedingungen zu erwartenden Toten: 2.2 Millionen pro Jahr. Darüber hinaus ist Wasser Träger zahlreicher Krankheiten, unter ihnen Malaria, durch welche jedes Jahr ca. eine Million Menschen sterben“ (18). (Das blaue Gold des dritten Jahrtausends)
Die englische Wissenschaftszeitung New Scientist schrieb in ihrer Schlussfolgerung anlässlich des Wassersymposiums im Sommer 2004 in Stockholm: „In der Vergangenheit wurden mehrere Millionen Brunnen errichtet, meistens ohne irgendwelche Kontrolle, und die Wassermengen, die durch gigantische elektrische Wasserpumpen gefördert werden, übersteigen bei weitem den Umfang der Regenwassermassen, die das Grundwasser wieder mit neuem Wasser versorgen. […] Wasser dem Erdreich zu entnehmen, ermöglicht vielen Ländern reichhaltige Reis- und Zuckerrohrernten (diese Pflanzen benötigen viel Wasser), aber der Boom wird nicht lange dauern. […] Indien ist ein Zentrum der Revolution des Bohrens nach unterirdischem Wasser. Indem beim Bohrvorgang Technologie Ölbohrungen benutzt wird, haben die kleinen Bauern 21 Millionen kleine Brunnen auf ihren Feldern errichtet, und jedes Jahr kommen noch mal eine Million Brunnen hinzu. […] In den nördlichen Ebenen Chinas, wo die meisten landwirtschaftlichen Produkte geerntet werden, entnehmen die Bauern der Erde jedes Jahr 30 Kubikkilometer Wasser mehr als durch den Regen zugeführt wird […]. In Vietnam wurde in den letzten Jahren die Zahl der Brunnen vervierfacht. […] In Punjab, wo 90% der Lebensmittel Pakistans herstammen, fangen die Grundwasserreserven langsam an auszutrocknen“ (19).
Während die Lage allgemein schlimm ist, sogar sehr schlimm, ist die Lage in den Schwellenländern Indien und China geradezu katastrophal und sie läuft Gefahr, in ein Desaster auszuarten.
„Die Dürre in der Provinz Sechuan und in Chongqing hat ca. 9,9 Milliarden Yuan Schäden verursacht. Einschränkungen beim Wasserverbrauch für mehr als 10 Millionen Menschen wurden veranlasst, während im ganzen Land ca. 18 Millionen Menschen an Wasserknappheit leiden“ (20).
„China wurde von den schlimmsten Überschwemmungen in den letzten Jahren heimgesucht, mit mehr als 60 Millionen betroffenen Menschen in Zentral- und Südchina, mindestens 360 Toten und großen ökonomischen Schäden, die schon 7,4 Milliarden Yuan übersteigen. 200000 Häuser sind zerstört oder beschädigt, 528000 Hektar landwirtschaftlich bebaute Fläche sind zerstört und 1,8 Million überflutet. Gleichzeitig schreitet die Verwüstung schnell voran. Bislang wurde ein Fünftel des Territoriums in Mitleidenschaft gezogen. Dies hat Sandstürme hervorgerufen, von denen manche gar bis Japan ziehen. […] Während Zentral- und Südchina unter Überschwemmungen leiden, dehnt sich die Wüste im Norden weiter aus. Mittlerweile ist davon mehr als ein Fünftel des Geländes entlang des Gelben Flusses, der Hochebene Qinghai-Tibets und eines Teils der Inneren Mongolei und Gansus betroffen. Die Bevölkerung Chinas umfasst ca. 20% der Weltbevölkerung, aber sie verfügt nur über 7% der verfügbaren landwirtschaftlichen Anbaufläche.
Wang Tao, dem Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Lanzhu, zufolge hat die Verwüstung in China während des letzten Jahrzehnts jedes Jahr um 950 Quadratkilometer zugenommen. Jedes Jahr im Frühjahr wird Beijing und ganz Nordchina von Sandstürmen heimgesucht, mit Auswirkungen bis nach Südkorea und in Japan“ (21).
All das muss uns zum Nachdenken über die so viel gepriesene starke Leistungskraft des chinesischen Kapitalismus zwingen. Die jüngste Entwicklung der chinesischen Wirtschaft kann dem niedergehenden Weltkapitalismus kein neues Leben einhauchen; stattdessen zeigt sie den ganzen Schrecken der Agonie dieses Systems auf: Städte im Smog (auch die jüngst stattgefundenen Olympischen Sommerspiele können nicht darüber hinwegtäuschen), austrocknende Flüsse und jedes Jahr Zehntausende Arbeiter, die bei Arbeitsunfällen in den Bergwerken oder in den Betrieben aufgrund der furchtbaren Arbeitsbedingungen und der mangelnden Sicherheitsbestimmungen sterben.
Viele andere Ressourcen werden natürlich immer knapper. Aus Platzgründen können wir hier am Ende dieses Artikels nur kurz auf zwei eingehen.
Die erste ist natürlich Öl. Es ist bekannt, dass man seit dem Ende der 1970er Jahre von der Erschöpfung der natürlichen Ölquellen spricht, aber in diesem Jahr, 2008, scheint man tatsächlich einen Höhepunkt der Förderung (er wird Hubbert Gipfel genannt) erreicht zu haben, d.h. der Moment, wo wir verschiedenen geologischen Hochrechnungen zufolge schon die Hälfte der natürlichen Ressourcen benutzt und erschöpft hätten. Öl stellt heute ca. 40% der Basisenergie dar und ungefähr 90% der im Verkehr eingesetzten Energie. Auch in der chemischen Industrie ist er ein wichtiger Grundstoff, insbesondere bei der Herstellung von Düngemitteln in der Landwirtschaft, Plastik, Klebstoffen und Lacken, Schmier- und Reinigungsmitteln. All das ist möglich, weil das Öl bislang ein relativ billiger Stoff und scheinbar grenzenlos verfügbar war. Weil diese Perspektiven sich nun geändert haben, trägt dies jetzt schon zu den Preiserhöhungen mit bei. Die kapitalistische Welt hört jetzt ebenso wenig auf die Empfehlung Clausius, innerhalb einer Generation nicht mehr zu verbrauchen als die Natur in dieser Zeit liefern kann. Stattdessen hat sich die kapitalistische Welt in eine verrückte Jagd des Energiekonsums gestürzt. Dabei sind China und Indien an führende Stellen getreten. Sie verbrennen alles, was man verbrennen kann. Man greift sogar auf giftige fossile Kohlenstoffe zur Energiegewinnung zurück und hat damit bislang nie da gewesene Umweltprobleme geschaffen.
Natürlich hat die „wunderbare“ Zuflucht in die sog. Biokraftstoffe sich als Flop, weil völlig unzureichend, erwiesen. Die Herstellung von Brennstoff auf der Grundlage der alkoholischen Gärung von Maisstärke oder von Pflanzenölen reicht keineswegs aus, um die gegenwärtigen Bedürfnisse des Marktes an Brennstoffen zu befriedigen. Im Gegenteil, dadurch werden die Preise für Nahrungsmittel nur noch mehr in die Höhe getrieben, wodurch der Hunger unter den ärmsten Bevölkerungsteilen nur noch zunimmt. Erneut werden dadurch kapitalistische Unternehmen wie die Nahrungsmittelhersteller begünstigt, die zu Verkäufern von Biokraftstoffen geworden sind. Aber für die einfachen Sterblichen bedeutet dies, dass große Waldgebiete abgeholzt werden, um dort Plantagen zu errichten (Millionen Hektar Wald sind geopfert worden). Die Herstellung von Biodiesel verlangt in der Tat den Einsatz von großen Flächen. Um sich eine konkretere Vorstellung davon zu machen: wenn man auf einem Hektar Raps oder Sonnenblumen anbaut oder andere Pflanzenöl erzeugende Pflanzen, kann man ungefähr 1000 Liter Biodiesel gewinnen, wodurch ein PKW ca. 10000km zurücklegen kann. Wenn man von der Hypothese ausgeht, dass Pkws durchschnittlich im Jahr ca. 10000km zurücklegen, wird jedes Fahrzeug den auf einem Hektar Anbaufläche erzeugten Biodiesel verbrauchen. Für ein Land wie Italien, wo ca. 34 Millionen PKWs angemeldet sind, würde dies bedeuten, dass man eine Anbaufläche von ca. 34 Millionen Hektar benötigen würde. Wenn man den PKWs noch die ca. 4 Millionen LKWs hinzufügt, deren Verbrauch noch höher liegt, würde sich der Verbrauch verdoppeln, und es würde eine Anbaufläche von mindestens 70 Millionen Hektar erforderlich machen. Dies entspricht dem Doppelten der Fläche Italiens, Berge, Städte usw. eingeschlossen.
Obgleich man nicht auf die gleiche Weise davon redet, stellt sich ein ähnliches Problem wie bei den fossilen Brennstoffen natürlich bei anderen Ressourcen mineralischer Art wie beispielsweise bei den Mineralien, aus denen Metall gewonnen wird. Es stimmt, dass in diesem Fall Metall nicht durch seine Verwendung zerstört wird wie im Fall des Öls oder des Methangases, aber die Nachlässigkeit der kapitalistischen Produktion läuft darauf hinaus, dass auf den Böden und auf den Müllhalden große Mengen Metalls gelagert werden, so dass die Versorgung mit Metall früher oder später auch nicht mehr ausreichen wird. Die Verwendung unter anderem bestimmter vielschichtiger Legierungen lässt den eventuellen Versuch der Rückgewinnung eines „reinen“ Materials als schwierig erscheinen.
Das Ausmaß des Problems wurde anhand von Schätzungen deutlich, denen zufolge innerhalb weniger Jahrzehnte die folgenden Ressourcen erschöpft sein werden: Uran, Platin, Gold, Silber, Kobalt, Blei, Mangan, Quecksilber, Molybdän, Nickel, Zinn, Wolfram und Zink. Dies sind natürlich für die moderne Industrie praktisch unabdingbare Stoffe, und ihr Mangel bzw. Erschöpfung wird eine sehr schwere Last in der Zukunft darstellen. Aber auch andere Stoffe sind nicht unerschöpflich. Man hat errechnet, dass noch ca. 30 Milliarden Tonnen Eisen, 220 Millionen Tonnen Kupfer, 85 Millionen Tonnen Zink zur Verfügung stehen werden (in dem Sinne, dass es noch wirtschaftlich möglich sein wird, sie zu fördern). Um sich auszumalen, um welche Mengen es sich handelt, muss man wissen, um die ärmsten Länder auf das Niveau der reichsten Länder zu bringen, bräuchte man 30 Milliarden Tonnen Eisen, 500 Millionen Tonnen Kupfer, 300 Millionen Tonnen Zink, d.h. viel mehr als der ganze Planet Erde anzubieten hat.
In Anbetracht dieser angekündigten Katastrophe muss man sich fragen, ob der Fortschritt und die Entwicklung notwendigerweise mit Umweltverschmutzung und der Zerstörung des Ökosystems verbunden sein müssen. Man muss sich fragen, ob solche Desaster auf unzureichende Bildung der Menschen oder auf etwas Anderes zurückzuführen sind. Das werden wir in dem nächsten Artikel untersuchen.
1 Manifest [133] des 9. Kongresses der IKS, im Juli 1991 verabschiedet.
2 G. Barone et al., Il metano e il futuro del clima, in Biologi Italiani, n° 8 de 2005. (“Methan und die Zukunft des Klimas”)
3 idem
4 G. Pellegri, Terzo mondo, nueva pattumiera creata dal buonismo tecnologico, siehe http:/www.caritas-ticino.ch/rivista/elenco%20rivista/riv_0203/08%20-%20Terzo%m... [134]
5 Vivere di rifiuti, (Von Abfällen leben) http:/www.scuolevi-net:scuolevi/valdagno [135] /marzotto/mediateca.nsf/9bc8ecfl790d17ffc1256f6f0065149d/7f0bceed3ddef3b4c12574620055b62d/Body/M2/Vivere%20di%rifiuti.pdf ?OpenElement
6 Roberto Saviano, Gomorra, Viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della camorra, (Reise in das Reich der Wirtschaft und in die Träume der Herrschaft der Camorra), Arnoldo Montaldi, 2006.
7 La Republica on-line, 29/10/2007
8 La Republica, 6/02/2008. allein in den USA werden mehr als 100 Milliarden Plastiktüten verwendet. 1.9 Milliarden Tonnen Öl sind für deren Herstellung erforderlich, wobei die meisten von ihnen auf dem Müll landen und Jahrzehnte bis zu ihrer Zersetzung brauchen. Für die Herstellung mehrerer Dutzend Milliarden Plastiktüten müssen allein 15 Millionen Bäume gefällt werden.
9 Siehe den Artikel “Das Mittelmeer, ein Plastikmeer” in La Republica du 19 Juli 2007.
10 Man kann natürlich nicht ausschließen, dass der schwindelerregende Preisanstieg des Öls zwischen 2007-2008 die Verwendung dieses Rohstoffs für die Produktion Kunststoffen infragestellt, wodurch es in absehbarer Zukunft zu einer Kehrtwende unter wachsamen Unternehmern kommen könnte, die aber nur auf die Verteidigung ihrer Interessen achten.
11 R. Troisi : la discarica del mondo luogo di miseria e di speranza nel ventunesimo secolo. (Die Müllentsorgung der Erde – Misere und Hoffnung des 21. Jahrhunderts) - villadelchancho.splinder.com/tag/discariche+del+mondo
12 Siehe den Artikel: „Einige Kollateralschäden der Industrie – Chemie, und Atomkraft” Alcuni effetti collaterali dell'industria, La chimica, la diga e il nucleare.
13 Jared Diamond, Collasso, edizione Einaudi – Kollaps
14 Aus den “Historischen Archiven der Neuen Linken” "Marco Pezzi", Nochmals zu Öl und Kapitalismus. diligander.libero.it/alterantiveinfo/petrolio_criticaeconflitto_giugno2006.pdf
15 Jared Diamond, Colasso, edizione Einaudi
16 R. J. E Clausius (1885), geboren 1822 in Koslin (damals Preußen, heute Polen) und 1888 gestorben in Bonn.
17 Vereinigung Geographielehrer Italiens – “Das Bevölkerungswachstum”, La crescita della popolazione.
www.aiig.it/Un%20quaderno%20per%l [136]'ambiente/offline/crescita-pop.htm
18 G. Carchella, Acqua : l'oro blu del terzo millenario, su "Lettera 22, associazione indipendente di giornalisti". www.lettera22.it/showart.php?id=296&rubrica=9 [137] Wasser – Das blaue Gold des 21. Jahrhunderts in Brief 22, Unabhängige Vereinigung der Journalisten
19 Newscientist, "Asian Farmers sucking the continent dry [138]" Asiatische Bauern trocknen den Kontinent aus, 28. August 2004
20 PB, Asianews, China: Noch 10 Millionen Menschen dursten nach Trockenheit "Cina: oltre 10 milioni di persone assetate dalla siccità [139]"
21, Asianews. "La Cina stretta tra le inondazioni e il deserto che avanza [140]" China – eingeklemmt zwischen Überschwemmungen und dem Vormarsch der Wüsten, 18/08/2006
Aktuelles und Laufendes:
- Umweltkatastrophe [141]
- Ökokatastrophe [142]
- Umweltverschmutzung [143]
Theoretische Fragen:
- Umwelt [24]
Dezember 2008
- 782 reads
Bewegung an den Universtäten in Italien: Wir zahlen nicht für die Krise
- 3463 reads
Wie vor genau 40 Jahren, seit die Bewegung des französischen Mai 68 nach Italien und in die ganze Welt getragen wurde, sind die Schüler und die Angestellten der Universitäten wieder auf den Strassen Italiens, um sich dem sogenannten Dekret Gelmini (Gelmini ist die Ministerin für Bildung, Hochschule und Erziehung) entgegenzustellen.
Wir zahlen nicht für die Krise[1]
„Wir zahlen nicht für die Krise.“ (1) Wie vor genau 40 Jahren, als die Bewegung des französischen Mai 68 nach Italien und in die ganze Welt getragen wurde, sind die SchülerInnen und die Angestellten der Universitäten wieder auf den Straßen Italiens, um sich dem so genannten Gelmini-Dekret (Gelmini ist die Ministerin für Bildung, Hochschulen und Erziehung) entgegenzustellen. Die Gründe sind bekannt, wir beschränken uns darauf, sie kurz zu wiederholen.
Auf der Ebene der Schule beinhaltet das Gelmini-Dekret - abgesehen vom Zwang, Schuluniformen zu tragen, was in der endgültigen Version des Dekrets nicht mehr erwähnt wurde, oder z. B. die Wiedereinführung der Kopfnote - vor allem Kürzungen, die den Bildungsbereich und die Qualität der Dienstleistung für die SchülerInnen und StudentInnen betreffen.
Die Einsparungen auf Kosten der SchülerInnen durchzusetzen beinhaltet:
- eine Einschränkung der Schulzeit in der Primärschule und im Kindergarten;
- eine drastische Einschränkung des Personals (DozentInnen, Verwaltung und technisches Personal), indem man den Zugang blockiert, restrukturiert und Arbeitszeiten reduziert: 87.000 DozentInnenen werden in eine prekäre Situation geraten (Zeitarbeitsverträge), und 45.000 Aushilfskräfte (Sekretärinnen und Hausmeister) werden nicht mehr zur Arbeit gerufen;
- Zunahme der SchülerInnen in den Klassen;
- Wegfall des technischen Unterrichts und der zweiten Fremdsprache in der Oberstufe;
- Reduzierung der Schulzeit in den technischen Schulen und Berufsschulen.
Auf der Ebene der Universitäten gibt es, jenseits der Märchen, die uns die Regierung erzählt:
- eine Kürzung der Budgets von über 500 Mio. Euro in den nächsten drei Jahren;
- eine Reduzierung des Personals der Universitäten in den Jahren 2010 und 2011, so dass auf fünf Pensionierungen nur eine Neuanstellung kommt;
- Vorbereitung für die Umwandlung der öffentlichen Universitäten in privatrechtliche Stiftungen.
Dies sind die wesentlichen Elemente des Regierungsmanövers. Wie man sieht, reicht dies, um die öffentliche Bildung in Italien verwahrlosen zu lassen, weil es sich nicht um Gesetze handelt, welche die öffentliche Bildung in Italien reorganisieren. Es geht vielmehr darum, die öffentliche Bildung teilweise stillzulegen sowie die Ressourcen und das Personal auf Null zu setzen. Genau das hat das betroffene Personal, das in diesen Bereichen arbeitet, zum Widerstand angestachelt, ganz besonders die Jungen und die ZeitarbeiterInnen, was personell fast identisch ist. Die Betroffenen im Studentenbereich sehen in der Gelmini-Reform, in den finanziellen Manövern der Berlusconi-Regierung berechtigterweise einen Angriff auf ihre eigene Zukunft. Bei einer weiteren Deklassierung der Bildung in Italien und der Umgestaltung von Universitäten in Stiftungsuniversitäten (ungeachtet der Diskussionen, ob nun das Private oder das Öffentliche besser ist) werden in Zukunft nur noch jene eine Chance haben, die sich den Zugang zu guter Bildung erkaufen können. „Es stellt ein eindeutiges Signal für das abnehmende Interesses des Staates an der Förderung des öffentlichen Bildungssystems dar, das für jeden den Zugang zu den höchsten Ebenen der Bildung garantiert.“ (2)
Dieses Gefühl der Zukunftslosigkeit erfasst die Bewegung der StudentInnen und ZeitarbeiterInnen umso mehr, weil dies vor dem Hintergrund einer noch nie dagewesenen Wirtschaftskrise geschieht, die außergewöhnlich besorgniserregend ist.
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass diese Bewegung nur schwach studentisch geprägt ist. Ihre größte Kraft gewinnt sie daraus, dass der Angriff der Berlusconi-Regierung ausgerechnet inmitten der Wirtschaftskrise stattfindet, die Italien und die ganze Welt betrifft. In diesem Sinn erinnert die Bewegung in Italien stark an die Bewegung der französischen StudentInnen 2006, die sich gegen das „CPE“-Gesetz (Vertrag zur Ersteinstellung) gewandt hatten. Ein Gesetz, das, wenn es angenommen worden wäre, die Arbeitsbedingungen der jungen ArbeiterInnen massiv verschlechtert hätte. Beide Bewegungen gingen bzw. gehen von den materiellen Bedingungen aus, welche die beruflichen und Lebensperspektiven der neuen Arbeitergenerationen betreffen, und stellen sich somit auf proletarisches Terrain. Es ist kein Zufall, dass die Parole der Studenten und ZeitarbeiterInnen heißt: „Wir zahlen nicht für die Krise!“
Dies drückt sich darin aus, dass dem Gerede darüber, „dem Land in Schwierigkeiten zur Hand zu gehen“ oder „in diesen schwierigen Zeiten Opfer auf sich zu nehmen“, kein Glauben geschenkt wird.
Die schwache studentische Ausprägung der Bewegung wird auch in dem Willen ersichtlich, sich für eine gemeinsame Zukunft in allen Lebensbereichen einzusetzen. Man sieht dies auch an anderen Faktoren, z.B. daran, dass es im Gegensatz besonders zu den 68er Bewegungen keinen Gegensatz zwischen den Generationen und auch keine Konfrontation zwischen StudentInnen und DozentInnen gibt. Es gibt hingegen eine Tendenz, zusammen zu kämpfen. Außerdem ist die Bewegung wenig ideologisch, was sich darin ausdrückt, dass sie sich weder als links noch als rechts charakterisiert und auch nicht von linken oder rechten Parteien benutzt werden kann. Jedoch hat die Bewegung ein klares Bewusstsein darüber, dass ihr Kampf den Sieg davontragen muss.
Die Fallen, die der Bewegung gestellt werden
Trotz allem hat die Bewegung, die sich auf den Straßen Italiens zeigt, auch eine Reihe von Schwächen, die die herrschende Klasse bewusst ausnutzt, um die Bewegung zum Scheitern zu bringen. Eine dieser Schwächen ist das Fehlen von klaren Zielen. Anders als in Frankreich, wo die Reife der StudentInnen durch einen frontalen Angriff der Regierung gefördert wurde, hat der indirekte Charakter des Angriffs in Italien weniger für Klarheit gesorgt. Wie gesagt, ist es richtig, dass ein wichtiger Faktor, der die Bewegung antreibt, die Wirtschaftskrise ist, in der sich Italien und der Rest der Welt befinden. Aber was bedeutet diese Krise genau? Eine Finanzkrise, welche von skrupellosen Spekulanten hervorgerufen wurde? Eine Krise, die dem ungezügelten Konsum oder der Überbevölkerung weltweit zuzuschreiben ist? Eine Krise, die von der Invasion des Weltmarktes durch die Chinesen verursacht wurde? Oder ist es nicht doch eine unlösbare Krise des Systems, in dem wir leben?
Es ist klar, dass die eine oder andere dieser Erklärungen dazu verleiten kann, sich den Wechsel zu den Obamas oder Veltronis (dem Oppositionsführer der Linken in Italien) zu wünschen, zur Linken allgemein, die als der gutgesinnte Teil der Gesellschaft hingestellt wird, als jener, der fähig ist, gut und gerecht zu regieren. Andernfalls müsste man die ganze Gesellschaftsordnung in Frage stellen, die Ausbeutung, die sich seit Jahrhunderten, ganz unabhängig von dieser oder jenem Regime, ständig fortgesetzt hat.
In dieser Hinsicht wird in den Medien viel Aufhebens über die Eigenschaften der Gelmini gemacht. Sie sei „eine dem verhassten Berlusconi würdige Ministerin“; sie wird dafür verantwortlich gemacht, „die öffentliche Schule in die Hände von Privaten zu legen“. Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Maßnahmen der Berlusconi-Regierung drakonisch sind und dass Schulen sowie Universitäten stark davon betroffen sind. Aber man muss sich von der Logik befreien, dass dies die rechte Regierung nur gemacht habe, um sich eines politisch gefährlichen Sektors zu entledigen, wie dies aus einer Rede von Calamandrei aus dem Jahre 1950 hervorgeht, in der er ausführt, wie man eine öffentliche Schule in eine parteihörige Schule umwandelt. Diese Rede wird im Moment bewusst lanciert, wobei behauptet wird, dass eine linke Regierung diesen Sektor nie angerührt hätte. (3)
„Wie etabliert man in einem Land parteihörige Schulen? Man kann es auf zwei Arten tun. Einerseits mit einem offenen Totalitarismus. Na ja, wir haben diese Erfahrung schon mit dem Faschismus gemacht. Aber es gibt weitere Formen, Schulen in partei- oder sektenhörige Schulen umzuwandeln. Nehmen wir einmal an, ganz abstrakt, es gäbe eine Partei an der Macht, eine dominierende Partei, die das Grundgesetz respektieren will. Sie will es nicht brechen, sie will nicht auf Rom marschieren und die Aula in eine Schaltzentrale der Macht verwandeln, aber sie will, ohne dass es so aussehen soll, eine Diktatur in versteckter Form durchsetzen. Also, was soll man tun, um sich eine Schule anzueignen und die öffentlichen Schulen in parteihörige Schulen umzuwandeln? Man stellt fest, dass die Schulen den Makel haben, unparteiisch zu sein. Es gibt einen gewissen Widerstand, auch während des Faschismus gab es ihn. Also folgt die dominierende Partei einem anderen Weg (um es klar zu sagen, all dies ist nur eine theoretische Überlegung). Man fängt damit an, die öffentlichen Schulen zu vernachlässigen, sie zu diskreditieren, sie verarmen zu lassen. Man lässt zu, dass sich die öffentlichen Schulen auflösen, und beginnt damit, die privaten Schulen zu bevorzugen. Nicht alle privaten Schulen, sondern nur die Schulen, die dieser Partei hörig sind. Dann fließt alle Fürsorge nur in diese Schulen. Fürsorge in Form von Geld und Privilegien. Dann rät man den Jungen, in diese Schulen zu gehen, weil sie im Grunde genommen besser als die staatlichen Schulen seien. Da die dominierende Partei nicht in der Lage ist, die öffentliche Schule offen in eine parteihörige Schule zu verwandeln, lässt sie einfach die öffentlichen Schulen vor die Hunde gehen, um so dann den privaten Schulen den Vorzug zu geben.“ (4)
Abgesehen von der Illusion, dass es in der kapitalistischen Gesellschaft eine unabhängige Schule geben könnte, eine Kultur, die über den Parteien steht, verhält es sich in der Realität so, dass, wer auch immer an der Regierungsspitze steht, nicht anders kann, als zu versuchen, die kapitalistische Ökonomie aus der Krise zu retten. Was zu nichts anderen führen kann als zu immer aggressiveren Angriffen gegen die Bevölkerung. Es spielt keine große Rolle, wenn die Kultur eines Landes darunter leidet. Es ist richtig, dass die Regierung Berlusconis in ihrer Rohheit einen harten Sparplan durchgesetzt hat. Man sollte aber nicht denken, dass dies bloß ein politisches Manöver ist; es ist notwendig für den Staat, den Gürtel enger zu schnallen. (5)
Aber dies sind noch nicht alle Fallen! Gerade weil sich eine kämpferische Dynamik an den Universitäten und Schulen verbreitet hat, beginnt sich die herrschende Klasse Sorgen zu machen und setzt weitere Hebel in Bewegung, um sich zu verteidigen. Zuerst hat Berlusconi davon gesprochen, dass es nötig sei, die Besetzung der Schulen und Universitäten zu verhindern, indem er Innenminister Maroni entsprechende Instruktionen erteilt hat. Später hat er dies quasi dementiert, um nachher vom Ex-Ministerpräsidenten Cossiga korrigiert zu werden. Dieser hat als „Weiser“ der Bourgeoisie mit großer Unverfrorenheit eine Reihe von Ratschlägen für den „Ehrenmann“ Berlusconi herausgearbeitet, die wir hier wegen ihrer Brisanz wiedergeben wollen, um zu verstehen, was auf den Straßen und Plätzen Italiens geschieht, und möglicherweise auch vorauszusehen, welche Maßnahmen die herrschenden Klasse gegen die Bewegung ergreifen wird:
„Präsident Cossiga, denken Sie dass man mit der Androhung von staatlicher Gewalt gegen die Studenten übertrieben hat?“
„Das hängt davon ab, ob der Ratspräsident (Berlusconi) sich für einen Präsidenten eines starken Staates hält. Nun, dann hat er richtig gehandelt. Aber weil Italien einen schwachen Staat hat und in der Opposition nicht die eiserne PCI (partito comunista italiano, die ehemalige stalinistische Partei Italiens) steht, sondern die in der Auflösung begriffene PD (partito democratico di sinistra; eine der Nachfolgeparteien des PCI), befürchte ich, dass den Worten keine Taten folgen werden und Berlusconi somit dumm dastehen wird.“
„Welche Taten sollten folgen?“
„An diesem Punkt sollte Maroni (Innenminister) das tun, was ich tat, als ich Innenminister war.“
„Das heißt?“
„Sie machen lassen, die Polizei aus den Straßen und den Universitäten abziehen, gleichzeitig die Bewegung mit Agents Provocateurs (Spitzeln) infiltrieren, die zu allem bereit sind, und die Demonstranten etwa zehn Tage lang Läden zerstören lassen, Autos in Brand stecken lassen und zuschauen, wie die Stadt in Schutt und Asche gelegt wird.“
„Danach?“
„Danach werden, unter Beifall der Bevölkerung, die Sirenen der Krankenwagen jene der Polizei übertönen.“
„In welchem Sinn?“
„In dem Sinne, dass die Ordnungskräfte die Demonstranten massakrieren, ohne Gnade alle spitalreif schlagen sollen. Man soll sie nicht verhaften, die Richter würden sie sowieso gleich wieder auf freien Fuß setzen, aber sie blutig schlagen und mit ihnen auch die Dozenten, die sie anstifteten.“
„Auch die Dozenten?“
„Vor allem die Dozenten. Nicht die alten, sicher, aber besonders die jungen Lehrerinnen, die schon. Sind Sie sich bewusst, was da vor sich geht? Es gibt Lehrkräfte, die Kinder indoktrinieren und sie dazu bringen, auf der Straße zu demonstrieren. Das ist ein kriminelles Verhalten.“ (6)
Wenn man dieses Interview liest, kommt man nicht umhin, einen Zusammenhang mit den Geschehnissen am 29. Oktober auf der Piazza Navona (Rom) herzustellen. Eine Gruppe Neofaschisten provozierte einen Zusammenstoß mit den Studenten, die an der Demonstration teilnahmen. Tatsächlich setzt der Staat mit seinen Medien und materiellen Möglichkeiten (Presse, TV, Polizei etc.) bereits den Entwurf von Cossiga um.
Die Provokation geht nicht nur von den infiltrierten Provokateuren aus, die es sicherlich gibt, sondern auch vom Antifaschismus, der durch eine ganze Reihe von Provokationen wiederbelebt wird. Vor und nach der Episode auf der Piazza Navona gab es unzählige Provokationen durch neofaschistische Banden, die die Konfrontation gewaltsam austragen wollen und so das Ganze auf einen Diskurs für die Verteidigung der Demokratie, des Respekts für die Legalität und der Ordnung lenken, wie es Ex-Präsident Cossiga vorhersagte. Doch zum Glück widersteht die Bewegung diesen Fallen sehr gut; bei vielen Gelegenheiten wird deutlich, was auch durch zahlreiche kürzlich erschienene Videos und Blogs belegt wird: dass die Bewegung sich bewusst nicht auf einen falschen Zusammenstoß mit den Faschisten einlässt, sondern weiterhin auf den bisherigen Grundlagen ihres Kampfes besteht.
Die Perspektive der Bewegung
Eine Bewegung, die auch nach der endgültigen Verabschiedung des Gesetzes, dem Ausgangspunkt der Bewegung, durch den Senat aktiv bleibt, demonstriert einen Willen, der nicht oberflächlich ist, sondern aus einem tiefen Leid gespeist wird. Auch wenn wir im Augenblick nicht in der Lage sind zu sagen, wie die nächste Zukunft dieser Bewegung aussehen wird, denken wir, dass Bewegungen dieser Art eine wichtige Rolle in der Zukunft spielen. Die ökonomische wie auch die politische und soziale Situation ist auf einem Tiefpunkt.
Die Bewegung in Italien hat noch nicht die politische Reife erlangt, wie sie die Studentenbewegung in Frankreich hatte, als diese gegen die CPE demonstrierte. Dies, weil die Bewegung keine klare Instanzen hervorgebracht hat, wie z. B. Vollversammlungen, auf denen die Delegationen gewählt und jederzeit wieder abgewählt werden können.
Wenn auch kein klares Bewusstsein über die Notwendigkeit einer Verbindung zu anderen Gesellschaftsschichten während des Kampfes bestand, so hat die Bewegung trotzdem Folgendes ausgedrückt:
- eine klare Unabhängigkeit gegenüber Parteien und Gewerkschaften, ohne dabei der Entpolitisierung anheimzufallen;
- das ausdrückliche Anliegen, der Bevölkerung die Gründe ihres Kampfes mitzuteilen, nicht nur durch Demonstrationen und Transparente, sondern auch durch die „Straßenlektionen“, die von Dozenten vor einer großen Anzahl von Studenten abgehalten wurden, die sogenannten „weißen Nächte“ usw.
Die Auseinandersetzung ist noch nicht vorbei. Die Demonstrationen in ganz Italien am Tag der Verabschiedung des Gelmini-Gesetzes (29.10), der Streik von einer Million Schülern am 30. Oktober und die emsigen Aktivitäten, die sich im Umfeld von Schulen und Universitäten entwickelten, führten am 14. November zu einer nationalen Demonstration. Sie war ein lebendiger Ausdruck des Kampfes und der Aktivitäten, die die Bewegung dazu bringen könnte, wie ein einheitlicher Körper agieren und zu anderen gesellschaftlichen Bereichen, die sich im Kampf befinden, eine Brücke zu schlagen.
4.11.2008 Ezechiele
[1] Parole, die die ganze italienische Studentenbewegung erobert hat.
[2] Aus dem Antrag der wissenschaftlichen Fakultät der Universität Federico II in Neapel 29.10.2008.
[3] Eigentlich wurde der erste Teil der Kürzungen - die Abschaffung von Schulklassen, Dozenten und technischem Personal - von der Prodi-Regierung durchgesetzt.
[4] Aus einer Rede von Piero Calamandrei am 11. Februar 1950 zur Verteidigung einer nationalen Schule.
[5] Es gibt eine weitere politische Mystifizierung, die dazu tendiert, alles auf die Kürzungen in der Grundlagenforschung zu fokussieren. Dabei wird beklagt, dass unsere „klugen Köpfe“ dazu gezwungen werden, auszuwandern, wie es in der TV-Sendung von Michele Santoro dargestellt wurde; es lief darauf hinaus, dass die Angelegenheit einer ganzen Generation so hingestellt wird, als betreffe sie nur eine kleine Minderheit.
[6] Interview von Andrea Cangini mit Cossiga vom 23. Oktober 2008 mit dem Titel: „Man muss sie aufhalten, auch der Terrorismus fing in den Universitäten an.“ (aus der Zeitung Quotidiano nationale, man kann das ganze Interview lesen unter:
Geographisch:
- Italien [145]
Aktuelles und Laufendes:
- Studentenbewegung Italien [146]
- 2008 [147]
- Klassenkampf [148]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Proletarischer Kampf [37]
Das Wachstum in Asien: ein Ausdruck der Krise und der Dekadenz des Kapitalismus
- 22754 reads
Bislang hat sich der Kapitalismus als unfähig erwiesen, zwei Drittel der Menschheit an seiner Entwicklung teilnehmen zu lassen. Nach dem gewaltigen Wirtschaftswachstum in Indien und China - und insgesamt in Ostasien - wird lauthals verkündet, dass er nun dazu in der Lage sei, der Hälfte der Menschheit eine Entwicklung anzubieten. Und er wäre dazu um so mehr in der Lage, wenn man ihn von all seinen Fesseln befreien würde. So verkündet man, dass mit Löhnen und Arbeitsbedingungen auf dem Niveau Chinas im Westen ebenfalls Wachstumsraten von 10% pro Jahr erreicht werden könnten.
Die theoretische und ideologische Herausforderung ist also ziemlich groß: Spiegelt die Entwicklung in Ostasien eine Erneuerung des Kapitalismus wider, oder handelt es sich nur um eine einfache Schwankung in seinem normalen Krisenverlauf? Auf diese wesentliche Frage versuchen wir eine Antwort zu geben. Während wir auf die gesamte Entwicklung im asiatischen Subkontinent eingehen wollen, werden wir jedoch insbesondere den Fall Chinas behandeln, da er am bekanntesten ist und in den Medien am meisten behandelt wird.
Wir werden auf diese Herausforderungen und Fragen in den folgenden Kapiteln eingehen.
Einige Fragen an die revolutionäre Theorie aufgrund der Entwicklung des asiatischen Subkontinentes
1. Während 25 Jahren Wirtschaftswachstum und ‚Globalisierung'[1] (1980-2005), während dessen Europa sein Bruttoinlandprodukt (BIP) auf das 1,7-Fache vergrößerte, die USA ihres auf das 2,2-Fache, die Welt auf das 2,5-Fache, konnte Indien sein BIP auf das Vierfache, das sich entwickelnde Asien auf das Sechsfache, China seins auf das Zehnfache erhöhen. Chinas Entwicklung war also viermal schneller als der Weltdurchschnitt - und das, während die Welt in einer Wirtschaftskrise steckt. Das bedeutet, dass das Wachstum im ostasiatischen Subkontinent den fortgesetzten Fall des weltweiten BIP-pro-Kopf-Wachstums seit Ende der 1960er Jahre abgefedert hat: 1960: 3,7% (1960-69); 2,1% (1970-79); 1,3% (1980-89); 1,1% (1990-1999) und 0,9% (2000-2004)[2]. Die erste Frage, vor der wir stehen, ist folgende: Kann diese Region der Krise entweichen, in welcher der Rest der Weltwirtschaft steckt?
2. Die USA brauchten 50 Jahre zur Verdoppelung ihres Prokopfeinkommens von 1865 und dem 1. Weltkrieg (1914); China gelang dies doppelt so schnell, zudem noch im Zeitraum der Dekadenz und der Krise des Kapitalismus! Während 1952 noch 84% der Bevölkerung Chinas auf dem Land lebte, beträgt heute die Zahl der in der Industrie beschäftigten Arbeiter (170 Millionen) 40%; sie übersteigt damit die Zahl aller Arbeiter in der OECD (123 Millionen Beschäftigte in der Industrie)! Das Land wurde zur Werkstatt der Welt und die Beschäftigung im Dienstleistungsbereich steigt enorm schnell an. Die Umwälzung der Beschäftigungsstrukturen ist eine der schnellsten in der ganzen Geschichte des Kapitalismus gewesen.[3] So ist China mittlerweile zur viertgrößten Wirtschaft der Erde aufgestiegen, wenn man sein BIP in Dollars berechnet und China steht an zweiter Stelle bei Kaufkraftparität.[4] All diese Faktoren verlangen eine Antwort auf die Frage, ob es in diesem Land nicht eine wahre ursprüngliche Akkumulation und eine industrielle Revolution gibt wie die, welche im 18. und 19. Jahrhundert in den entwickelten Ländern stattgefunden hat. Anders ausgedrückt: gibt es einen Raum für das Auftauchen von neuen Kapitaleinheiten und neuen Ländern im Zeitalter der Dekadenz? Wäre gar ein Aufholprozess denkbar, wie in seiner aufsteigenden Phase? Wenn die gegenwärtigen Wachstumszahlen anhalten, würde China zu einer der größten Wirtschaftsmächte innerhalb von weniger als zwei Jahrzehnten werden. Dies war im 19. Jahrhundert auch den USA und Deutschland gelungen, als diese England und Frankreich ein- und überholten, obwohl diese erst später ‚gestartet' waren.
3. Das Wachstum des BIP Chinas ist ebenfalls das höchste, das jemals in der Geschichte des Kapitalismus registriert wurde: Während der letzten 25 Jahre ist es im Jahresdurchschnitt um 8-10% gewachsen, trotz weltweiter Krise. Das Wachstum Chinas übertrifft sogar noch die Wachstumsrekorde Japans in der Blütephase nach dem 2. Weltkrieg. Damals wuchs die Wirtschaft Japans um 8.2% zwischen 1950-1973 und die Koreas um 7.6% zwischen 1962-1990. Darüber hinaus ist der Wachstumsrhythmus Chinas im Augenblick größer und stabiler als der seiner schon industrialisierten Nachbarn (Südkorea, Taiwan, Hongkong). Gibt es also ein Wirtschaftswunder in China?
4. Zudem begnügt sich China nicht mehr damit, Grundstoffe zu produzieren und zu exportieren oder Waren wieder auszuführen, die in Chinas Fabriken mit Billiglöhnen veredelt wurden. Immer mehr produziert und exportiert China hochwertige Güter wie z.B. Elektronikware und Transportmittel. Kommt es somit in China zum Aufbau neuer Industriezentren wie in den NIL (Neu industrialisierten Ländern) (Südkorea, Taiwan, Hongkong, Singapur)? Wird China es wie diese Länder schaffen, seine Exportabhängigkeit zu reduzieren und den Binnenmarkt zu entwickeln? Sind Indien und China nur Sternschnuppen, deren Licht irgendwann verlöschen wird, oder werden sie zu neuen global players auf Weltebene?
5. Die schnelle Herausbildung von großen Arbeiterkonzentrationen in Asien, von denen die meisten Beschäftigten noch sehr jung und unerfahren sind, wirft jedoch eine Reihe von Fragen hinsichtlich der Entwicklung des Klassenkampfes und des Einflusses auf das Kräfteverhältnis zwischen den Klassen auf Weltebene auf. Die Zunahme von Klassenkämpfen und das Auftauchen von politischen Minderheiten sind dafür eindeutige Zeichen.[5] Im Gegenzug werden die sehr niedrigen Löhne und die extrem prekären Beschäftigungsverhältnisse in Ostasien von der herrschenden Klasse der entwickelten Länder dazu benutzt, um die Beschäftigten mit Arbeitsplatzverlust (Verlagerung des Arbeitsplatzes usw.) und Lohnsenkungen und einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen zu erpressen.
Wir können nur auf all diese Fragen Antworten geben und die wahren Hintergründe, Widersprüche und Grenzen des Wachstums in Asien aufzeigen, wenn wir den ganzen Fragenkomplex in den weltweiten Kontext der Entwicklung des Kapitalismus auf historischer und internationaler Ebene einbetten. Nur indem man die gegenwärtige Entwicklung in Ostasien einerseits in den Zeitraum des Beginns der Dekadenzphase seit 1914 einordnet (dies werden wir im 1. Teil tun), und andererseits die internationale Krisenentwicklung seit Ende der 1950er Jahre berücksichtigt (dies geschieht im 2. Teil), kann man umfassend das Wachstum in Asien erklären (3. Teil). Diese Achsen werden wir in diesem Artikel aufgreifen.[6]
Teil 1
Ein für den dekadenten Kapitalismus typischer Verlauf
Der Werdegang Chinas, der geprägt wurde durch das Joch des Kolonialismus und seine nicht abgeschlossene, mehrfach abgewürgte bürgerliche Revolution, ist typisch für jene Länder, die während der aufsteigenden Phase des Kapitalismus keine industrielle Revolution mehr durchführen konnten. Während China mit seinem BIP, das ein Drittel aller produzierten Güter der Welt umfasste, noch bis 1820 die erste Wirtschaftsmacht der Ende war, betrug das chinesische BIP 1950 nur noch 4.5% der Weltproduktion; d.h. ein Siebtel des vorherigen Wertes.
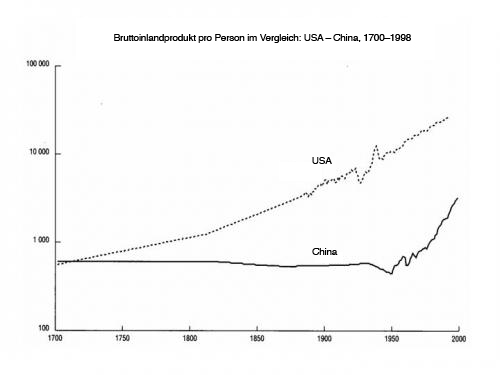
Grafik 1, Quelle Angus Maddison, Die Weltwirtschaft, OECD 2001: 45.
Die obige Statistik zeigt einen Rückgang des BIP Pro-Kopf in China von 8% während der gesamten aufsteigenden Phase des Kapitalismus. Es fiel von 600$ 1820 auf 552$ 1913. Dies verdeutlicht, dass eine richtige bürgerliche Revolution ausgeblieben ist, und dass das Land ständigen Konflikten zwischen Kriegsherren innerhalb einer geschwächten herrschenden Klasse ausgeliefert war, sowie unter dem furchtbaren Gewicht des kolonialen Jochs gelitten hat, der es nach der Niederlage im Opiumkrieg 1840 ausgesetzt wurde. Diese Niederlage stellte den Auftakt zu einer Reihe von demütigenden Verträgen dar, welche zur Aufteilung Chinas unter die Kolonialmächte führte. Derart geschwächt, war China schlecht gerüstet, um für die Bedingungen des einsetzenden Niedergangs des Kapitalismus gewappnet zu sein. Die relative Sättigung der Märkte und ihre Beherrschung durch die Großmächte, die während der gesamten Zeit des Niedergangs des Kapitalismus vorherrschen, haben China eine absolute Unterentwicklung während des größten Teils dieses Zeitraums aufgezwungen, da sein pro Kopf BIP zwischen 1913 (552$) und 1950 (439$) noch schneller zurückging (-20%).
All diese Fakten bestätigen vollauf die von der Kommunistischen Linken entwickelte Analyse, der zufolge es in der Dekadenz des Kapitalismus nicht mehr möglich ist, dass neue Länder und Mächte in einem Umfeld des global gesättigten Weltmarktes aufstreben[7]. Erst in den 1960er Jahren konnte China sein BIP wieder auf das Niveau von 1820 (600$) anheben. Danach stieg es beträchtlich an, aber erst während der letzten 30 Jahre ist das Wachstum förmlich explodiert und hat bislang in der Geschichte des Kapitalismus nie erreichte Werte erreicht[8]. Diese jüngste und außergewöhnliche Phase der Geschichte Chinas bedarf einer Erklärung, denn diese Phase scheint auf den ersten Blick viele Erkenntnisse über die Entwicklung des Kapitalismus zu widerlegen. Aber bevor wir die Wirklichkeit dieses gewaltigen Wachstums in Ostasien ergründen, müssen wir auf zwei andere Merkmale des dekadenten Kapitalismus eingehen, die von den Linkskommunisten aufgedeckt worden sind, und die den asiatischen Subkontinent stark geprägt haben: Die allgemeine Tendenz zum Staatskapitalismus einerseits, und die Eingliederung eines jeden Landes in einen imperialistischen Block mit jeweiligem Führer andererseits. Auch auf dieser Ebene scheint die jüngste Entwicklung Chinas diesen Merkmalen zu widersprechen, da China auf internationaler Ebene eher als "Einzelkämpfer" auftritt. Darüber hinaus werden ständig Reformen verabschiedet und Deregulierungen getroffen, die eher dem Manchesterkapitalismus gleichen, so wie Marx ihn in ‚Das Kapital' oder Engels in "Die Lage der arbeitenden Klasse in England" beschrieben haben. Wir wollen hier vorgreifend sagen, dass all dem nicht so ist. Einerseits werden all diese Reformen aufgrund staatlicher Initiativen und unter der strengen Kontrolle des Staates durchgeführt; andererseits hat die Implosion der beiden imperialistischen Blöcke, d.h. des US- und sowjetisch geführten, es nach 1989 ermöglicht, dass jedes Land eigenmächtig handelt. Wir wollen auf diese beiden Tatsachen näher eingehen, bevor wir den wirtschaftlichen Erfolg Ostasiens während des letzten Vierteljahrhunderts untersuchen.
Die allgemeine Infrastruktur des Staatskapitalismus im Zeitalter der Dekadenz
Wie wir 1974 in einer umfangreichen Untersuchung des Staatskapitalismus schrieben:
„Die Tendenz zur staatlichen Kontrolle ist der Ausdruck der permanenten Krise des Kapitalismus seit 1914. Es handelt sich um eine Art Anpassung des Systems, um in einem Zeitraum zu überleben, in welchem die wirtschaftliche Dynamik des Kapitalismus auf ihre historischen Grenzen stößt. Wenn die Widersprüche des Kapitalismus nur dazu führen können, dass die Welt durch eine Reihe von unvermeidbaren imperialistischen Rivalitäten und Kriegen erschüttert wird, ist der Staatskapitalismus der Ausdruck der Tendenz zur Autarkie, zur permanenten Kriegswirtschaft, der Bündelung der nationalen Kräfte, um das nationale Kapital zu schützen (...) Im Zeitalter des Niedergangs hat die permanente Krise aufgrund der relativen Sättigung der Märkte bestimmte Änderungen der Organisationsstruktur des Kapitalismus aufgezwungen (...) Weil es keine rein wirtschaftliche Lösung für diese Schwierigkeiten gibt, darf man es nicht zulassen, dass die Gesetze des Kapitalismus blind walten. Die Bourgeoisie versucht, deren Konsequenzen mit Hilfe des Staates zu beherrschen: Subventionen, Verstaatlichung von defizitären Bereichen, Kontrolle der Rohstoffe, Planung auf Landesebene, Eingriffe in die Wechselkurse usw." (Révolution Internationale, Alte Serie, Nr. 10, S. 13-14).
Diese Analyse ist nichts anderes als die Position, die die Kommunistische Internationale 1919 bezogen hatte: „Der nationale Staat, der der kapitalistischen Entwicklung einen mächtigen Impuls gegeben hat, ist für die Fortentwicklung der Produktivkräfte zu eng geworden" (Manifest der Komintern). Dieser Widerspruch zwischen den kapitalistischen Produktionsverhältnissen und der Bremswirkung, die sie seitdem auf die Entwicklung der Produktivkräfte ausüben, ist die Ursache für die allgemeine Tendenz zum Staatskapitalismus in der Niedergangsphase des Kapitalismus. Die erbarmungslose Konkurrenz auf einem mittlerweile global gesättigten und von den Großmächten kontrollierten Weltmarkt hat jeden Nationalstaat dazu gezwungen, für seine Interessen zu kämpfen, indem der Staat auf allen Ebenen eingreift: auf sozialer, politischer und ökonomischer. Im Allgemeinen spiegelt die Entwicklung des Staatskapitalismus in der Dekadenz den mittlerweile unüberwindbaren Widerspruch zwischen den immer mehr weltweiten Akkumulationsbedürfnissen des Kapitals und der engen nationalen Grundlage der bürgerlichen Eigentumsverhältnisse: „Die Verstaatlichung des wirtschaftlichen Lebens, gegen welche sich der kapitalistische Liberalismus so sträubte, ist zur Tatsache geworden. Nur zum freien Wettbewerb, sondern auch zur Herrschaft der Trusts, Syndikate und anderer wirtschaftlicher Ungetüme, gibt es keine Rückkehr", hob das Manifest der Kommunistischen Internationale ebenso hervor.
Diese Tendenzen, die nationalen Interessen des Staates in die Hände zu nehmen und sich auf den nationalen Rahmen zurückzuziehen, führten zu einer brutalen Stockung der Expansion und der Internationalisierung des Kapitals, welche die aufsteigende Phase geprägt hatten. So wuchs der Anteil der Exporte der entwickelten Länder in der aufsteigenden Phase ständig, bis er sich mehr als verdoppelte, denn von 5.5% 1830 war er 1914 auf 12.9% gestiegen (Tabelle 2). Dies verdeutlicht die frenetische Eroberung der Welt durch den Kapitalismus während der damaligen Phase.
Der Eintritt des Kapitalismus in seine Niedergangsphase sollte jedoch einen brutalen Stopp des kapitalistischen Vordringens auf der Welt bewirken. Die Stagnation des Welthandels zwischen 1914-1950 (siehe Tabelle 2), der um die Hälfte sinkende Anteil der Exporte der entwickelten Ländern an der weltweiten Produktion (von 12.9% 1913 auf 6.2% 1938 - Tabelle 2), und die Tatsache, dass das Wachstum des Welthandels oft unter dem der Produktion lag, zeigen jeweils den relativ starken Rückgang im Rahmen des Nationalstaates während der Dekadenzphase. Selbst in den ‚fettesten' Jahren des Wirtschaftswunders, in denen es zu einem starken Anstieg des internationalen Handels bis in den 1970er Jahren kam, blieb der Anteil der Exporte der entwickelten Länder (10.2%) immer noch unter dem Niveau von 1914 (12.9%) und selbst unter dem Niveau, das 1860 (10.9% - siehe Tabelle 2[9]) erreicht worden war. Erst mit dem Einzug der "Globalisierung" Mitte der 1980er Jahre überstieg der Exportanteil das ein Jahrhundert zuvor erreichte Niveau. Diese gleiche, entgegen gesetzte Dynamik zwischen aufsteigender und niedergehender Phase des Kapitalismus findet man auch auf der Ebene der Investitionsströme zwischen den Ländern. Der Anteil der direkten Auslandsinvestitionen stieg 1914 auf einen Prozentsatz von 2% des Weltbruttoindustrieproduktes, während sie trotz einer deutlichen Zunahme in der Zeit der Globalisierung 1995 nur die Hälfte des früheren Wertes (1%!) erreichten. Das Gleiche trifft für die Auslandsdirektinvestitionen der entwickelten Länder zu. Während diese von 6.6% 1980 auf 11.5% 1995 anstiegen, lag dieser Prozentsatz immer noch nicht über dem von 1914 (zwischen 12-15%). Diese ökonomische Ausrichtung auf den nationalen Rahmen und der entwickelten Länder im Zeitalter der Dekadenz kann auch noch durch folgende Tatsache verdeutlicht werden. „Am Anfang des Ersten Weltkriegs wurden 55-65% der direkten Auslandsinvestitionen in der Dritten Welt getätigt und nur 25-35% wurden in den entwickelten Ländern vorgenommen. Ende der 1960er Jahre hatte sich dieses Verhältnis umgekehrt, da 1967 nur 31% der direkten Auslandsinvestitionen der entwickelten Länder des Westens in der Dritten Welt getätigt worden waren und 61% in den entwickelten Staaten des Westens. Und seitdem hat sich diese Tendenz nur noch verstärkt (...) Gegen 1980 stieg dieser Anteil auf 78% der direkten Auslandsinvestitionen in den entwickelten Ländern und 22% in der Dritten Welt. (...) Der Umfang gegenüber dem Bruttoinlandsprodukt in den westlichen Industriestaaten betrug Mitte der 1990er Jahre zwischen 8.5% und 9%, gegen 3.5%-4% gegen 1913, d.h. mehr als das Doppelte"[10]
Während der aufsteigende Kapitalismus die Welt nach seinem Bild formte, indem immer mehr Staaten in seinen Bann gezogen wurden, sollte der Niedergang des Systems die Verhältnisse zum Zeitpunkt des Höhepunktes des Systems "einfrieren".
„Dass es unmöglich geworden ist, neue, große kapitalistische Einheiten zur Entstehung zu verhelfen, drückt sich unter anderem in der Tatsache aus, dass die sechs größten Industrieländer bereits am Vorabend des Ersten Weltkriegs die führenden Wirtschaftsmächte, wenn auch in einer anderen Reihenfolge, gestellt hatten". (Der Kampf des Proletariats im aufsteigenden und dekadenten Kapitalismus, in Internationale Revue Nr. 23, S. 25) All dies verdeutlicht den spektakulären Rückzug auf den nationalen Rahmen, welcher die ganze Niedergangsphase des Kapitalismus mittels eines massiven Rückgriffs auf die Politik staatskapitalistischer Maßnahmen prägte.
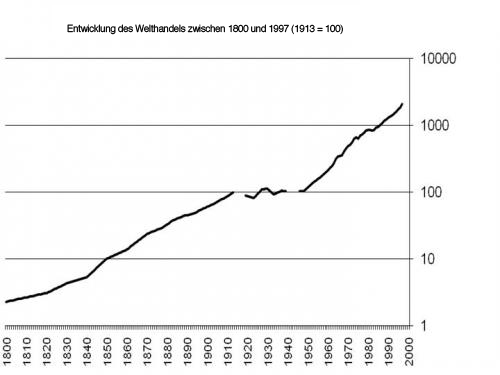
Grafik 2, Quelle: Rostow, The World Economy, History and Prospect, University of Texas Press 1978 : 662
Tabelle 2
|
Exportquote der entwickelten westlichen Staaten (% des BIP) |
|
|
1830 |
5,5 |
|
1860 |
10,9 |
|
1890 |
11,7 |
|
1913 |
12,9 |
|
1929 |
9,8 |
|
1938 |
6,2 |
|
1950 |
8 |
|
1960 |
8,6 |
|
1970 |
10,2 |
|
1980 |
15,3 |
|
1990 |
14,8 |
|
1996 |
15,9 |
|
Philippe Norel, L'invention du marché, Seuil, 2003 : 431. |
Ganz Ostasien sollte von dieser umfangreichen Rückzugsbewegung auf den Rahmen des Nationalstaates erfasst werden. Nach dem 2. Weltkrieg lebte fast die Hälfte der Weltbevölkerung außerhalb des Weltmarktes; sie war durch die Bipolarisierung der Welt zwischen zwei geostrategischen Blöcken "eingepfercht". Dieser Zustand wurde erst im Laufe der 1980er Jahre beendet. Davon betroffen waren die Ostblockstaaten, Indien, mehrere Staaten in der Dritten Welt wie Kuba, Vietnam, Kambodscha, Algerien, Ägypten usw. Diese brutale Abschottung der Hälfte der Welt vom Weltmarkt ist eine klare Verdeutlichung der relativen Sättigung des Weltmarktes. Diese Sättigung zwingt jedes nationale Kapital, direkt die Verteidigung seiner Interessen auf nationaler Ebene zu übernehmen und sich der Politik der beiden Blockführer zu unterwerfen, um in der Hölle der Dekadenz zu überleben. Diese Zwangspolitik musste allerdings scheitern. Dieser ganze Zeitraum bedeutete nur ein sehr mäßiges Wachstum für China und Indien. Vor allem im Falle Indiens lag dieses Wachstum noch unter dem Afrikas.
Tabelle 3:
|
BIP pro Kopf (Indiz 100 = 1950) |
||
|
|
1950 |
1973 |
|
Japan |
100 |
594 |
|
Westeuropa |
100 |
251 |
|
USA |
100 |
243 |
|
Welt |
100 |
194 |
|
China |
100 |
191 |
|
Afrika |
100 |
160 |
|
Indien |
100 |
138 |
|
Quelle : : Angus Maddison, L'économie mondiale, annexe C, OCDE, 2001. |
Es stimmt, dass das Wachstum Chinas das Wachstum der gesamten Dritten Welt zwischen 1950-73 übertroffen hat; aber dennoch blieb das Wachstum in diesem Zeitraum unter dem weltweiten Durchschnitt. Es war geprägt von einer schrecklichen Ausbeutung der Bauern und Arbeiter, und es war erst möglich geworden durch die intensive Unterstützung des Ostblocks bis Anfang der 1960er Jahre sowie durch die Eingliederung in den amerikanischen Einflussbereich. Zudem wurde sie geschwächt durch zwei bedeutende Rückgänge während des genannten Zeitraums - während des "Großen Sprungs nach vorne" (1958-61) und der "Kulturrevolution" (1966-70), die zum Tod von Dutzenden Millionen Bauern und Arbeitern aufgrund schrecklicher Hungersnöte und materiellen Leidens führten. Dieses globale Scheitern der Autarkiepolitik des Staates wurde von uns schon vor einem viertel Jahrhundert festgestellt: "Die protektionistische Politik hat im 20. Jahrhundert völlig ausgedient. Sie bietet der Wirtschaft in den unterentwickelten Ländern keine Gelegenheit mehr zum Luftholen, sondern führt im Gegenteil zu ihrer Strangulierung" Internationale Revue; Nr. 23, S. 27, engl./franz./span. Ausgabe). Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Staatskapitalismus keine Lösung für die Widersprüche des Kapitalismus darstellt, sondern nur ein Mittel, um Zeit zu gewinnen.
China in den jeweiligen Machtbereichen der beiden großen imperialistischen Blöcke
Da China der Konkurrenz des global gesättigten Weltmarktes, welcher von den Großmächten kontrolliert wurde, allein gegenüberstand, konnte China seine nationalen Interessen am besten vertreten, indem es sich zunächst bis Anfang der 1960er Jahre in den sowjetischen Block eingliederte, um dann später in den 1970er Jahren auf die amerikanische Seite zu wechseln. Seine Entwicklung fand auf einem Hintergrund statt, wo der Aufstieg neuer Mächte nicht mehr möglich war und diese ihre Verspätung nicht mehr aufholen konnten, wie das in der aufsteigenden Phase noch möglich gewesen war. Die Verteidigung nationalistischer Projekte der "Entwicklung" in der Dekadenz (das Projekt des Maoismus) war nur unter dieser Bedingung möglich. China bot sich dem meistbietendem in einer Zeit der bipolaren imperialistischen Blockkonfrontation in der Zeit des kalten Krieges (1945-89) an. Die Abschottung vom Weltmarkt, die Eingliederung in den sowjetischen Block und dessen massive Hilfe an China lieferten die Grundlagen für ein sicherlich sehr bescheidenes Wachstum - da es gerade unter dem Weltdurchschnitt lag - aber noch über dem Indiens und dem Rest der Dritten Welt. Tatsächlich hatte sich Indien nur teilweise vom Weltmarkt zurückgezogen. Es war gar eine Zeit lang als Führer der Blockfreien Staaten[11] aufgetreten und es musste dafür den Preis zahlen in Gestalt eines niedrigeren Wirtschaftswachstums als das Afrikas in der Zeit von 1950-73. Der Zusammenbruch der imperialistischen Blöcke nach dem Fall der Berliner Mauer (1989) und der fortgesetzte Verlust der US-Führungsrolle auf der Welt haben diesen Zwang zu einer internationalen Bipolarisierung überwunden, wodurch alle Staaten einen größeren Spielraum bei der Verfolgung ihrer eigenen Interessen erhalten haben.
Teil 2
Stellung und Entwicklung Ostasiens in der Geschichte der kapitalistischen Entwicklung
Die Scherenbewegung in Ostasien historisch betrachtet (1700-2006)
Nachdem wir die Entwicklung Ostasiens in den historischen Kontext der aufsteigenden und dekadenten Phase des Kapitalismus und in den Rahmen der Entwicklung des Staatskapitalismus und der Integration in die beiden imperialistischen Blöcke eingeordnet haben, müssen wir nun versuchen zu begreifen, warum diese Gegend der Erde die historische Tendenz zur Marginalisierung hat umkehren können. Die unten aufgeführte Tabelle zeigt, dass Indien und China 1820 mehr als die Hälfte der auf der Welt produzierten Güter (48.9%) umfassten, während ihr Anteil 1973 auf 7.7% abgefallen war. Das Gewicht der Geißel des Kolonialismus, schließlich der Eintritt des Kapitalismus in seine Niedergangsphase, führten zu einem Rückgang des Anteils Indiens und Chinas am Weltbruttosozialprodukt um das sechsfache. Oder anders ausgedrückt, als Europa und die neuen Länder sich entwickelten, kam es in Indien und China zu einem relativen Rückgang. Heute beobachten wir genau das Gegenteil. Seitdem die entwickelten Länder in die Krise geraten sind, hat sich Ostasien weiter entwickelt, so dass sein Anteil an der Weltproduktion 2006 auf 20% angestiegen ist. Wir beobachten hier also eine deutliche Scherenbewegung über die Jahre betrachtet. Als die Industriestaaten sich mächtig entwickelten, war die Entwicklung in Asien relativ rückläufig, und seitdem sich die Krise dauerhaft in den entwickelten Ländern niedergelassen hat, hat Asien angefangen, einen Boom zu durchlaufen.
Tabelle 4
|
Anteil der verschiedenen Gebiete der Welt in Prozent am weltweiten Bruttoinlandsprodukt |
||||||||
|
|
1700 |
1820 |
1870 |
1913 |
1950 |
1973 |
1998 |
2001 |
|
Europa und die neuen Länder (*) |
22,7 |
25,5 |
43,8 |
55,2 |
56,9 |
51 |
45,7 |
44,9 |
|
Rest der Welt |
19,7 |
18,3 |
20,2 |
22,9 |
27,6 |
32,6 |
24,8 |
(°) |
|
Asien |
57,6 |
56,2 |
36,0 |
21,9 |
15,5 |
16,4 |
29,5 |
|
|
Indien |
24,4 |
16,0 |
12,2 |
7,6 |
4,2 |
3,1 |
5,0 |
5,4 |
|
China |
22,3 |
32,9 |
17,2 |
8,9 |
4,5 |
4,6 |
11,5 |
12,3 |
|
Rest Asiens |
10,9 |
7,3 |
6,6 |
5,4 |
6,8 |
8,7 |
13,0 |
(°) |
|
(*) Neuen Länder = USA, Kanada, Australien, Neuseeland (°) = 37,4 : Rest der Welt und Rest Asiens |
||||||||
|
Quelle : Angus Maddison, L'économie mondiale, OCDE, 2001 : 280 |
Die Entwicklung Asiens nach dem 2. Weltkrieg
Diese Scherenbewegung wird auch anhand der Entwicklung der Wachstumszahlen in China im Vergleich zum Rest der Welt nach dem 2. Weltkrieg deutlich. Die Tabellen 3 (siehe oben) und 5 (siehe unten) zeigen, während in den entwickelten Ländern ein fortgesetztes Wachstums registriert wird, hinkten Indien und China hinterher: zwischen 1950 und 1973 erzielte Europa doppelt so hohe Werte wie Indien, Japans Wachstum war dreimal so hoch wie das Chinas und viermal so hoch wie das Indiens. Das Wachstum Indiens und Chinas lag unter dem Weltdurchschnitt. Aber danach trat genau das Gegenteil ein: zwischen 1978 und 2002 war der Jahresdurchschnitt des BIP Wachstums Chinas (pro Kopf) viermal so hoch (5.9%) wie der Weltdurchschnitt (1.4%) und Indien vervierfachte sein BIP, während dieses sich weltweit zwischen 1980 - 2005 nur um das 2.5-fache erhöhte.
Tabelle 5
|
Durchschnittliche Jahreswachstumsraten des BIP (pro Kopf) in %: |
||
|
|
1952-1978 |
1978-2002 |
|
China (bereinigte Zahlen) |
2,3 |
5,9 |
|
Welt |
2,6 |
1,4 |
|
Quelle : F. Lemoine, L'économie chinoise, La Découverte : 62. |
Erst als die zentralen Länder des Kapitalismus in die Krise gerieten, erlebten China und Indien ihren Aufschwung. Warum? Wie kann man diese Schwerenbewegung erklären? Warum kam es zu einem Wachstumsschub in Ostasien, während der Rest der Welt in die Krise abrutschte? Warum diese Kehrtwende? Wie konnte es in Ostasien zu dem starken Aufstieg kommen, während die Wirtschaftskrise sich international weiter ausdehnte. Wir werden versuchen darauf zu antworten.
Das Wiederauftauchen der Wirtschaftskrise offenbart das Scheitern all der nach dem 2. Weltkrieg eingesetzten Hilfsmittel
Als die Wirtschaftskrise Ende der 1960er Jahre wieder auftauchte, wurden all die Wachstumsmodelle, welche nach dem 2. Weltkrieg aufgeblüht waren, beiseite gefegt: das stalinistische Modell im Osten, das Keynessche Modell im Westen und das nationalistisch-militaristische Modell in der 3. Welt. Dadurch wurden die jeweiligen Ansprüche, sich als eine Lösung gegenüber den unüberwindbaren Widersprüchen des Kapitalismus zu preisen, zunichte gemacht. Die Zuspitzung derselben während der 1970er Jahre offenbarte das Scheitern der neo-keynesianischen Rezepte in allen Ländern der OECD, sie führte zum Zusammenbruch des Ostblocks während des nachfolgenden Jahrzehnts und zeigte die Machtlosigkeit all der "Alternativen" der 3. Welt (Algerien, Vietnam, Kambodscha, Iran, Kuba usw.). All diese Modelle, die während der "fetten" Jahre des Wirtschaftswunders viele Illusionen geschaffen hatten, sind später durch die darauf folgenden Rezessionen zusammengebrochen - dadurch wurde erkennbar, dass sie keineswegs eine Überwindung der inneren Widersprüche des Kapitalismus ermöglichen.
Die Konsequenzen und Reaktionen gegenüber dem Scheitern all dieser Formen waren ganz unterschiedlich. Von 1979-80 an vollzogen die westlichen Staaten eine Umkehr hin zu einem deregulierten Staatskapitalismus (der "neoliberalen" Wende, wie sie von den Medien und der Extremen Linke genannt wird). Aber weil sie durch einen ridigen Staatskapitalismus stalinistischer Art regiert wurden, sollten die Ländern Osteuropas erst nach dem Zusammenbruch des Ostblocks einen ähnlichen Weg antreten. Und es war auch der starke Druck durch die Wirtschaftskrise, welcher verschiedene Länder und Modelle in der 3. Welt dazu trieb, immer mehr in eine endlose Spirale der Barbarei hineinzurutschen (Algerien, Iran, Afghanistan, Sudan usw.), oder einfach in den Bankrott zu geraten (Argentinien, eine Vielzahl afrikanischer Staaten usw.), oder sie standen vor solch großen Schwierigkeiten, dass sie ihre Ansprüche, als Erfolgsmodelle aufzutreten, (die asiatischen Tiger und Drachen) herunterschrauben mussten. Dagegen gelang es einigen Ländern Ostasiens wie China und Vietnam, oder Indien Reformen durchzuführen, welche sie dem Weltmarkt zuführten und während der 1980er Jahre in den internationalen Akkumulationszyklus eingliederten.
Diese verschiedenen Reaktionen führten zu unterschiedlichen Ergebnissen. Wir wollen hier nur auf die westlichen Länder und Ostasien eingehen. Genau wie die Krise zunächst in den Industriezentren auftauchte, um anschließend auf die Länder der Peripherie überzuschwappen, sollte die wirtschaftliche Kehrtwende, die Anfang der 1980er Jahre in den entwickelten Ländern eintrat, die Stellung der Länder des ostasiatischen Subkontinentes im internationalen Akkumulationszyklus bestimmen.
Der Einzug des deregulierten Staatskapitalismus und einer pervertierten Globalisierung
All diesen neokeynesianischen Wiederankurbelungsmaßnahmen, welche während der 1970er Jahre angewandt wurden, gelang es nicht, eine zwischen den 1960er und 1980er Jahren um auf die Hälfte gesunkene Profitrate (siehe Tabelle unten)[12] zu erhöhen. Dieses ununterbrochene Abfallen der Rentabilität des Kapitals trieb eine Reihe von Betrieben an den Rand des Bankrotts. Die Staaten, welche sich zur Stützung ihrer Wirtschaft stark verschuldet hatten, standen praktisch vor der Zahlungsunfähigkeit. Dieser quasi-Bankrott Ende der 1970er Jahre war der Hauptgrund für den Wechsel zum deregulierten Staatskapitalismus - die pervertierte Globalisierung war die dazugehörige Begleiterscheinung. Die Hauptstoßrichtung dieser neuen Politik bestand in einem massiven und frontalen Angriff gegen die Arbeiterklasse mit dem Ziel der Wiederherstellung der Rentabilität des Kapitals. Zu Beginn der 1980er Jahre leitete die herrschende Klasse eine Reihe von massiven Angriffen gegen die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeiterklasse ein. Viele neokeynesianischen Rezepte wurden fallen gelassen. Die Arbeitskraft musste nunmehr international direkt miteinander durch Arbeitsplatzverlagerungen konkurrieren. Überall hielt international die Konkurrenz mit ihrer Deregulierung Einzug. Dieser massive gesellschaftliche Rückschritt ermöglichte eine spektakuläre Wiederherstellung der Profitraten auf einer Höhe, die heute sogar höher liegen als während des Wirtschaftswunders (siehe Tabelle 6 unten).
Die Grafik 3 weiter unten veranschaulicht diese gnadenlose Deregulierungspolitik. Mit ihrer Hilfe konnte die Bourgeoisie schon den Anteil der Lohnmasse am Bruttosozialprodukt international auf +/-10% senken. Diese Senkung ist nichts Anderes als die Umsetzung der spontanen Tendenz zur Erhöhung des Mehrwerts oder des Ausbeutungsgrades der Arbeiterklasse[13]. Diese Grafik zeigt uns auch die Stabilität der Mehrwertrate während der Zeit vor den 1970er Jahren. Diese Stabilität, die mit großen Produktivitätsfortschritten einherging, lieferte die Grundlagen für die Erfolge des Wirtschaftswunders. Diese Rate sank gar während der 1970er Jahre infolge des Drucks durch den Klassenkampf ab, welcher Ende der 1960er Jahre wieder massiv seinen Einzug hielt:
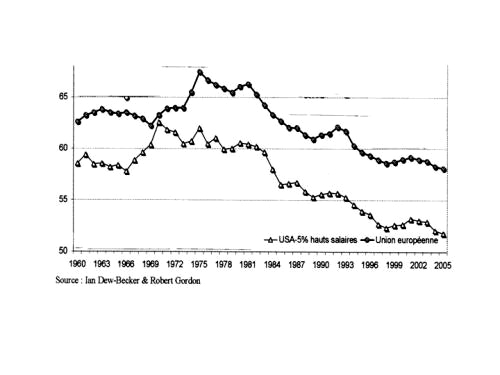
Grafik 3. Anteil der Löhne am Bruttoinlandsprodukt: USA und die Europäische Union 1960-2005.
Diese Senkung des Lohnanteils der Arbeiterklasse am Gesamtprodukt war in Wirklichkeit oft stärker als durch die Grafik deutlich wird, da diese Grafik alle Kategorien von Beschäftigten umfasst, auch beinhaltet die Grafik die Löhne, die sich die Bourgeoisie selber auszahlt[14]. Nachdem er zur Zeit des Wirtschaftswunders gesunken war, vergrößerte sich die Bandbreite der Einkommen. Der Rückgang des Lohnanteils war noch umfangreicher bei den Beschäftigten. Die Statistiken mit Unterscheidung der sozialen Kategorien belegen nämlich, dass für viele Beschäftigte - zumindest für die Qualifizierten - dieser Rückgang noch viel größeren Ausmaß war, da ihre Löhne auf das Niveau der 1960er Jahre sanken, wie dies schon in den USA bei den in der Produktion Beschäftigten der Fall war (Wochenverdienst). Während sich ihre Reallöhne zwischen 1945-1972 nahezu verdoppelt hatten, sind sie danach wieder auf das Niveau von 1960 gesunken.
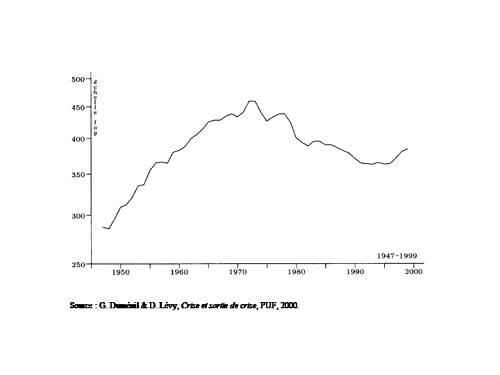
Grafik 4 - Wochenverdienst eines in der Produktion Beschäftigten (Dollarwerte von 1990): USA
Seit einem Vierteljahrhundert hat sich eine massive und breite Bewegung der absoluten Verarmung der Arbeiterklasse auf der ganzen Welt durchgesetzt. Der durchschnittliche Verlust des relativen Anteils am BIP betrug ca. +/-15-20%. Dies ist ein beträchtliches Ausmaß - zu dem auch noch die tiefgreifende Verschlechterung der Lebens- und Arbeitsbedingungen hinzugefügt werden muss. Wie Trotzki auf dem 3. Kongress der Kommunistischen Internationale sagte: SEQ CHAPTER \h \r 1"Die Theorie der Pauperisierung der Massen wurde unter den misstrauischen Pfiffen der Eunuchen, die die Tribünen der bürgerlichen Universitäten bevölkern und den Mandarinen des opportunistischen Sozialismus, begraben geglaubt. Jetzt zeigt sich nicht nur die soziale, sondern auch noch eine physiologische und biologische Pauperisierung, in ihrer ganzen Schrecklichkeit." (Eigene Übersetzung aus dem französischen)
Mit anderen Worten: die Konzessionen des Keynesschen Staatskapitalismus während des Wirtschaftswunders - die Reallöhne verdreifachten sich im Durchschnitt zwischen 1945-1980 - werden vom deregulierten Staatskapitalismus wieder zunichte gemacht. Abgesehen von diesem zeitlich begrenzten Zeitraum nach dem 2. Weltkrieg wird dadurch die Analyse der Kommunistischen Internationale und der Kommunistischen Linken vollauf bestätigt, denen zufolge in der Niedergangsphase des Systems keine wirklichen, vor allem dauerhaften Reformen mehr möglich sind.
Diese massive Senkung der Löhne führte zu zweierlei Konsequenzen. Einerseits konnte dadurch die Mehrwertrate gesteigert, damit wieder eine beträchtliche Profitrate sichergestellt werden. Diese hat nunmehr wieder das Niveau aus der Zeit des Wirtschaftswunders erreicht und dieses sogar übertroffen (siehe Grafik Nr. 6). Indem die Kaufkraft um +/-10 à 20% drastisch gesenkt wurde, sank das Volumen der aufnahmefähigen Märkte weltweit entsprechend. Damit sind direkt verbunden die schwerwiegende Zuspitzung der Überproduktionskrise auf internationaler Ebene und der Rückgang der Akkumulationsrate (das Wachstum des fixen Kapitals) auf ein historisch sehr niedriges Niveau (siehe Grafik 6). Diese doppelte Bewegung mit dem Ziel der Rentabilitätserhöhung zur Wiederherstellung der Profitrate, sowie die Notwendigkeit, neue Märkte für die Aufnahme von Waren zu finden, liegt an der Wurzel des Phänomens der Globalisierung, das in den 1980er Jahren auftauchte. Diese Globalisierung ist nicht zurückzuführen, wie uns die Vertreter der Extremen Linken und die anderen Globalisierungsgegner glauben machenwollen, auf die Dominierung durch das (bösartige) unproduktive Finanzkapital über das (gute) produktive industrielle Kapital. Einige Vertreter der Extremen Linken verlangen, das Finanzkapital müsse abgeschafft werden (oft berufen sie sich dabei unberechtigterweise auf Lenins "Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus"), andere verlangen die Besteuerung (Tobinsteuer) oder die Regulierung, je nach Antiglobalisierungscouleur oder linkssozialdemokratischer Orientierung usw.
Die historische Bedeutung der Globalisierung heute
Die ganze Literatur zur Globalisierung, ob aus linker oder rechter, aus Antiglobalisierungs- oder linksextremer Feder, stellt die Globalisierung als eine Wiederauflage der Eroberung der Welt durch kapitalistische Warenbeziehungen dar. Sehr oft stößt man dabei sogar auf berühmte Stellen aus dem Kommunistischen Manifest, wo Marx die fortschrittliche Rolle der Bourgeoisie und die Ausdehnung des Kapitalismus auf den ganzen Planeten beschrieb. Sie wird als ein umfassender Vorläufer der Herrschaft und der Herstellung der Warenbeziehung über alle Aspekte des Lebens durch kapitalistische Verhältnisse bezeichnet. Man behauptet sogar, dass es sich um die zweite Globalisierung nach der von 1875-1914 handele.
Gemäß dieser Darstellung der gegenwärtigen Globalisierung wäre der ganze Zeitraum seit dem 1. Weltkrieg bis zu den 1980er Jahren nur eine Zwischenphase isolationistischer (1914-45) oder regulierter Art (1945-1980). Während dieser Zeit hätte eine Sozialpolitik zugunsten der Arbeiterklasse (so die Vertreter der Extremen Linken) betrieben werden können, oder in dieser Zeit sei der Kapitalismus daran gehindert worden, sich grenzenlos zu entfalten (die liberale Variante). Kommen wir auf diese "glücklichen Tage" aus der Sicht der Ersten zurück oder derjenigen, die fordern "deregulieren" und "liberalisieren" wir so stark wie möglich, wie es die Letztgenannten wollen. Die Liberalen meinen, wenn man dem Markt seine ganze "Freiheit" und sein "Handlungsvermögen" ließe, würden überall auf der Welt gleich hohe Wachstumszahlen erzielt wie in China. Indem man die Arbeitsbedingungen und Löhne auf dem Niveau der Arbeiter Chinas akzeptiert, würde die Tür zu einem Paradies fulminanten Wachstums aufgestoßen! Nichts ist aber irreführender. Sowohl die linksextreme wie auch die liberale Darstellung täuschen darüber hinweg, dass die gegenwärtigen Wurzeln der Globalisierung nicht vergleichbar sind mit der Dynamik der Internationalisierung des Kapitalismus im 19. Jahrhundert:
1) Die erste Globalisierung (1880-1914) entsprach der Bildung des Weltmarktes und dem tiefen Eindringen der kapitalistischen Warenbeziehungen auf der ganzen Welt. Sie spiegelte die geographische Ausdehnung des Kapitalismus und seiner Herrschaft auf dem ganzen Planeten wider; durch die Lohn-und Nachfragesteigerungen weltweit wurde das Akkumulationsniveau angehoben Während die Dynamik des Kapitalismus im 19. Jahrhundert in eine nach oben gerichtete Spirale mündete, ist die gegenwärtige Globalisierung nur ein Phase der Entwicklung des Kapitalismus, dessen Akkumulations- und Wachstumsraten weltweit absinken. Die Lohnmasse und die kaufkraftfähige Nachfrage gingen zurück. Heute dagegen sind die Globalisierung und die grenzenlose Deregulierung nur Mittel, um den zerstörerischen Auswirkungen der historischen Krise des Kapitalismus entgegenzutreten. Die 'neoliberale' Politik der Globalisierung und Deregulierung sind eine von unzähligen Versuchen, das Scheitern früherer Mittel - Keynesianismus und Neokeynesianismus- auszugleichen. Heute befinden wir uns nicht in der Phase des triumphierenden Kapitalismus des 19. Jahrhunderts, sondern seit den 1970er Jahren stecken wir in der Phase der langsamen Agonie.
Dass das neue Ende des Akkumulationskreislaufs, der seit Ende der 1980er Jahre weltweit Einzug gehalten hat, durch eine örtlich beschränkte Entwicklung des asiatischen Subkontinentes geprägt ist, ändert nichts an dieser Charakterisierung der pervertierten Globalisierung, denn diese Entwicklung umfasst nur einen kleinen Teil der Erde. Sie ist nur möglich für eine kurze Zeit und entspricht in Wirklichkeit einem weit reichenden und massiven sozialen Rückschritt auf internationaler Ebene.
2) Während die erste Globalisierung der weltweiten Eroberung und dem Eindringen kapitalistischer Produktionsverhältnisse entsprach, und dabei immer mehr neue Nationen in diese Warenverhältnisse eingezogen wurden und die Vorherrschaft der alten Kolonialmächte noch verstärkt wurde, beschränkt sich diese heute hauptsächlich auf den südasiatischen Kontinent und lässt die Wirtschaft der entwickelten Länder und des Restes der Dritten Welt immer zerbrechlicher werden und gefährdet diese gar. Während die erste Globalisierung die geographische Ausdehnung und die Vertiefung der kapitalistischen Verhältnisse bedeutete, ist diese heute nur eine Schwankung des allgemeinen Prozesses der weltweiten Zuspitzung der Krise. Die Entwicklung beschränkt sich auf einen Teil der Welt- Ostasien- , während sich die Lage in anderen Teilen verschlechtert. Zudem kann dieser kurze Zeitraum der auf einige Gebiete beschränkten Entwicklung des asiatischen Subkontinentes nur solange dauern, wie die Rahmenbedingungen dafür bestehen. Aber diese Zeit läuft ab (siehe unten und die folgenden Teile dieses Artikels).
3) Während die erste Globalisierung mit einer allgemeinen Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiterklasse einherging, sich dabei die Reallöhne verdoppelten, bewirkt die gegenwärtige Globalisierung eine massive gesellschaftliche Regression: Druck zur Senkung der Löhne, absolute Verarmung von Dutzenden Millionen von Proletariern, massive Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, schwindelerregende Verschärfung des Ausbeutungsgrades usw. Während die erste Globalisierung einen Fortschritt für die Menschheit mit sich brachte, verbreitet die gegenwärtige Globalisierung die Barbarei auf Weltebene.
4) Während die erste Globalisierung eine Integration von immer mehr Arbeitern in die Lohnarbeitsverhältnisse der Produktion bedeutete, zerstört die gegenwärtige Globalisierung - auch wenn durch sie ein junges und unerfahrenes Proletariat in der Peripherie entsteht, die Arbeitsplätze und wälzt die Sozialstruktur der Länder um, in denen die erfahrensten Teile der Weltarbeiterklasse leben. Während die erste Globalisierung dazu neigte, die Bedingungen und das Gefühl der Solidarität zu vereinigen, verschärft die gegenwärtige Globalisierung die Konkurrenz und des "jeder für sich" im Rahmen des allgemeinen Zerfalls der gesellschaftlichen Beziehungen.
Aus all diesen Gründen ist es völlig falsch die gegenwärtige Globalisierung als eine Neuauflage des Zeitraums der aufsteigenden Phase des Kapitalismus zu bezeichnen, und zu diesem Zweck die berühmten Passagen des Kommunistischen Manifestes zu zitieren, in denen Marx die fortschrittliche Rolle der Bourgeoisie zum damaligen Zeitraum beschrieb. Heute gehört der Kapitalismus auf den Misthaufen der Geschichte. Das 20. Jahrhundert war das barbarischste Jahrhundert in der Menschheitsgeschichte. Seine Produktionsverhältnisse ermöglichen heute keinen Fortschritt mehr für die Menschheit, sondern treiben diese in eine immer größere Barbarei und erhöhen die Gefahr einer weltweiten Zerstörung der Umwelt. Die Bourgeoisie war eine fortschrittliche Klasse, welche im 19. Jahrhundert die Produktionsverhältnisse vorantrieb. Sie ist heute eine historisch überholte Klasse, welche den Planeten zerstört und nur noch Misere verbreitet, so dass die ganze Zukunft der Menschheit selbst in Frage gestellt wird. Deshalb darf man eigentlich nicht von Globalisierung reden, sondern von einer pervertieren Globalisierung.
Die politische Bedeutung der Deregulierung und der Globalisierung
Alle Medien und linken Kritiker der Globalisierung bezeichnen die neue Politik der Deregulierung und der Liberalisierung, welche von der Bourgeoisie seit den 1980er Jahren betrieben wird, als "neoliberale" Globalisierung. Diese Bezeichnungen werden ideologisch zu einem völlig verschleiernden Zweck eingesetzt. Einerseits wurde die sogenannte 'neoliberale' Deregulierung aufgrund einer Initiative und unter der Kontrolle des Staates eingeführt. Dies bedeutet bei weitem nicht, dass der 'Staat schwach' ist und die Regulierung nur durch den Markt erfolgte. Andererseits hat die heutige Globalisierung, wie wir weiter oben gesehen haben, nichts mit dem zu tun, was Marx in seinen Werken beschrieben hat. Sie spiegelt eine Etappe der Zuspitzung der Krise auf internationaler Ebene wider - und stellt keinesfalls eine wirkliche schrittweise Ausdehnung des Kapitalismus dar, wie dies in der aufsteigenden Phase des Kapitalismus im 19. Jahrhundert der Fall war; in Wirklichkeit handelt es sich um eine pervertierte Globalisierung. Dies schließt jedoch keineswegs aus, dass die Warenbeziehungen und die Lohnarbeit sich punktuell und örtlich begrenzt entwickeln (wie in Ostasien zum Beispiel), sondern der grundlegende Unterschied besteht darin, dass dieser Prozess in einem völlig unterschiedlichen Rahmen stattfand als jener während der aufsteigenden Phase des Kapitalismus.
Diese beiden Arten Politik (deregulierter Staatskapitalismus und die pervertierte Globalisierung) bringen keineswegs eine Erneuerung des Kapitalismus und auch nicht die Einführung eines neuen "Finanzkapitalismus" zum Ausdruck, wie uns die vulgären Linken und die Antiglobalisierungsbewegung weismachen wollen. Sie spiegeln vor allem die Zuspitzung der Weltwirtschaftskrise wider, da sie das Scheitern all der bislang benutzten klassischen staatskapitalistischen Maßnahmen verdeutlichen. Und die ständigen Aufrufe von gewissen Teilen der Bourgeoisie zur Erweiterung und Generalisierung dieser Politik belegen auch nichts Anderes als ein Scheitern dieser Politik. Zudem hat ein mehr als ein Viertel Jahrhundert deregularisierter und weltweit handelnder Kapitalismus die Wirtschaftskrise international nicht überwinden können. Nachdem diese Politik angewandt wurde, ist das pro-Kopf BIP seit Jahrzehnten gesunken; auch wenn es in bestimmten Regionen vorübergehend angestiegen ist (wie in Ostasien) und ein spektakuläres Wachstum stattgefunden hat.
Der Einzug des deregulierten Staatskapitalismus und die pervertierte Globalisierung sind ein klarer Ausdruck der Dekadenz des Kapitalismus
Die andauernde Krise und der fortdauernde Fall der Profitrate in den 1970er Jahren haben die Rentabilität des Kapitals und der Unternehmen angeschlagen. Ende der 1970er Jahre mussten diese sich sehr stark verschulden. Viele von ihnen standen am Rande des Bankrotts. Zusammen mit dem Scheitern der neo-keynesianischen Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft erzwang dieser Bankrott die Aufgabe der keynesianischen Rezepte zugunsten eines deregulierten Staatskapitalismus und einer pervertierten Globalisierung, deren Hauptziele in der Wiederherstellung der Profitrate, der Rentabilität der Unternehmen und der Öffnung der Märkte für den Weltmarkt liegen. Diese Umorientierung der Wirtschaftspolitik der Bourgeoisie stellte also vor allem eine Stufe der Zuspitzung der Krise auf internationaler Ebene dar. Sie bedeutete keineswegs eine neue Blütephase, die von der sogenannten "neuen Wirtschaft" getragen wurde, wie uns ständig die Medienpropaganda eintrichtern will. Die Krise hatte solche Ausmaße angenommen, dass die herrschende Klasse keine andere Möglichkeit hatte, als auf die "liberaleren" Maßnahmen zurückzugreifen, während diese die Krise und die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in Wirklichkeit nur noch weiter verschärft haben. 27 Jahre deregulierter Staatskapitalismus und die Globalisierung haben gar nichts gelöst, sondern tatsächlich die Wirtschaftskrise noch weiter zugespitzt.
Die beiden Hauptstützen der pervertierten Globalisierung, welche mit der Einführung des deregulierten Staatskapitalismus seit 1980 verbunden sind, stützten sich zum einen auf die frenetische Suche nach Standorten mit geringen Lohnkosten, um entsprechende Profitraten der Betriebe (Lieferanten usw. eingeschlossen) aufzutreiben. Andererseits suchte man unaufhörlich eine Nachfrage aus dem Ausland, um den massiven Einbruch der Binnennachfrage nach den Sparmaßnahmen mit dem Ziel der Wiederherstellung der Profitraten auszugleichen. Von dieser Politik profitierte direkt Ostasien, das sich auf diese Entwicklung entsprechend einstellte. Anstatt zur Erhöhung des internationalen Wirtschaftswachstums beizutragen, hat das sehr spektakuläre Wachstum in Ostasien zum Rückgang der Endnachfrage durch die Senkung der Lohnmasse auf Weltebene beigetragen. Deshalb haben diese beiden Formen der Politik wesentlich zur Zuspitzung der internationalen Krise des Kapitalismus geführt. Dies wird sehr deutlich anhand der unten folgenden Grafik, welche eine logische und konstante Parallele zwischen der Entwicklung der Produktion und dem Welthandel seit dem 2. Weltkrieg aufzeigt, mit Ausnahme des Zeitraums seit den 1990er Jahren, als zum ersten Mal seit 60 Jahren eine Abweichung auftauchte zwischen einem Welthandel, der an Geschwindigkeit gewann, und einer schlapp bleibenden Produktion:
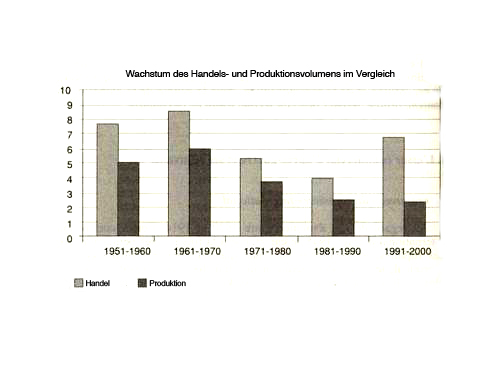
Grafik 5. Quelle: Die Erfindung des Marktes, Philippe Norel, Seuil, 2004, S.430.
Der Handel mit der Dritten Welt, welcher während des Wirtschaftswunders um mehr als die Hälfte gesunken war, stieg ab den 1990er Jahren infolge der Globalisierung wieder an. Aber davon profitierten nur einige Länder der Dritten Welt, d.h. genau diejenigen, welche sich seitdem zu den "Werkstätten" der Welt für Waren entwickelt haben, die mit Billiglöhnen hergestellt wurden[15]. Dass die Zunahme des Welthandels und der Exporte seit den 1980er Jahren nicht mit einem Anstieg des Wirtschaftswachstums einhergingen, belegt das, was wir vorhin aufgezeigt haben. Im Gegensatz zur ersten Globalisierung im 19. Jahrhundert, welche die Produktion und die Lohnmasse erweiterten, wird die heutige Globalisierung in dem Sinne pervertiert, da diese zu einem Schrumpfen der Lohnmasse führt und auch die Grundlagen der Akkumulation auf Weltebene begrenzt. Die gegenwärtige "Globalisierung" bedeutet letzten Endes nichts Anderes als ein gnadenloser Kampf zur Kürzung der Produktionskosten mittels einer massiven Reduzierung der Reallöhne. Sie offenbart, dass der Kapitalismus der Menschheit außer Verarmung und wachsender Barbarei nichts mehr anzubieten hat. Die sogenannte 'neoliberale Globalisierung' hat also nichts zu tun mit einer Rückkehr zur Eroberung der Welt durch einen triumphierenden Kapitalismus wie im 19. Jahrhundert, sondern sie bringt vor allem das Scheitern all der Hilfsmittel zum Ausdruck, um eine Wirtschaftkrise zu bekämpfen, die langsam aber unaufhörlich den Kapitalismus in den Abgrund führt.
Teil 3
Ostasien im weltweiten Akkumulationszyklus
Eine doppelte Bewegung ermöglichte somit Ostasien, sich von Beginn der 1990er Jahre an zu seinen Gunsten in den weltweiten Akkumulationszyklus einzubringen. Einerseits die Wirtschaftskrise, welche Indien und China zwang, ihre jeweiligen Modelle des stalinistischen und nationalistischen Staatskapitalismus fallen zu lassen; andererseits hat die Globalisierung Ostasien die Möglichkeit geboten, sich in den Weltmarkt einzugliedern, indem dort seitens der entwickelten Länder Investitionen getätigt und Arbeitsplätze verlagert wurden, um billige Arbeitskräfte für ihre Produktion aufzutreiben. Diese beiden Tendenzen erklären die Scherenbewegung, eines auf Weltebene rückläufigen, aber im asiatischen Subkontinent stark steigenden Wachstums.
Die Zuspitzung der Wirtschaftskrise ist somit die Ursache für diesen Abschluss des weltweiten Akkumulationszyklus, welcher Ostasien die Eingliederung als Werkstätte der Welt erlaubte. Dies geschah, indem dort Investitionen getätigt, Produktionsstätten und Zuliefererbetriebe aus den entwickelteren Ländern verlagert wurden, welche nur billige Arbeitskräfte suchten, indem die zu Billigstlöhnen produzierten Konsumgüter wieder exportiert wurden, und indem schließlich hochwertige, in Asien veredelte Waren sowie auch Luxusgüter an die neuen Reichen in Asien verkauft wurden, welche in den entwickelten Ländern hergestellt wurden.
Das Wachstum in Ostasien spiegelt keine Erneuerung des Kapitalismus sondern seine Krise wider
Das Scheitern der neokeynesianischen Maßnahmen während der 1970er Jahre in den zentralen Ländern stellte somit eine bedeutende Stufe der Zuspitzung der Wirtschaftskrise auf internationaler Ebene dar. Dieses Scheitern war die Ursache für die Aufgabe des keynesianischen Staatskapitalismus zugunsten einer mehr deregulierten Variante, deren wesentliche Achse in einem massiven und frontalen Angriff gegen die Arbeiterklasse mit dem Ziel bestand, eine seit Ende der 1960 Jahre um die Hälfte gesunkene Profitrate (siehe Grafik 6) wiederherzustellen. Dieser massive gesellschaftliche Rückschritt nahm vor allem die Form einer systematischen Politik der Verstärkung der weltweiten Konkurrenzverhältnisse unter den Lohnabhängigen an. Indem sie in die neue internationale Arbeits- und Lohnteilung eingegliedert wurden, konnten Indien und China daraus einen großen Nutzen ziehen. Während das Kapital die Entwicklungsländer in der Zeit des Wirtschaftswunders fast total vernachlässigte, wird heute massiv (fast ein Drittel) in diesen Ländern investiert. Dabei fließen die Investitionen hauptsächlich in einige asiatische Länder. Dadurch sind Indien und China zu einer Plattform für die Herstellung und den Neuexport von Waren geworden, die in ohnehin relativ produktiven Betrieben hergestellt werden, aber deren Arbeitsbedingungen mit denen der Gründerzeit des Kapitalismus vergleichbar sind. Dies ist im Wesentlichen die Erklärung für den Erfolg dieser Länder.
Ab den 1990er Jahren strömten große Kapitalmengen in diese Länder. Auch wurden viele Betriebe dorthin verlagert, um so zu den Werkstätten der Welt zu werden. Der Weltmarkt wurde mit dort zu Billiglöhnen hergestellten Waren überschwemmt. Im Gegensatz zu früher, als die Lohnunterschiede in den veralteten Betrieben und die protektionistische Politik es den Entwicklungsländern nicht gestatteten, auf den Märkten der zentralen Länder zu konkurrieren, ermöglicht heute die Liberalisierung die Produktion mit geringen Lohnkosten in den ausgelagerten Fabriken. Dadurch können viele Produkte vom Markt verdrängt werden, die in den westlichen Industriestaaten produziert werden. Das spektakuläre Wachstum Ostasiens stellt somit keine Erneuerung des Kapitalismus dar, sondern ein momentanes Aufbäumen bei seinem langsamen internationalen Abstieg. Während diese Schwankung einen beträchtlichen Teil der Welt (Indien und China) dynamisieren und gar zur Aufrechterhaltung des Weltwachstums beitragen konnte, handelt es sich in Wirklichkeit um ein Paradox, wenn man es in den Kontext der langsamen internationalen Entwicklung der Krise und der historischen Phase der Dekadenz einbettete.[16] Nur indem man mit Abstand und Überblick urteilt und all diese besondere Entwicklung in ihrem globaleren Kontext sieht, kann man ihre wirkliche Bedeutung verstehen und daraus etwas ableiten. Wenn man in der Biegung eines Mäanders steckt, kann man daraus nicht die Schlussfolgerung ziehen, dass der Fluss vom Meer in die Berge fließt.[17]
Die offensichtlich werdende Schlussfolgerung, welche mit Nachdruck betont werden muss, lautet, dass das Wachstum in Ostasien keinesfalls eine Erneuerung des Kapitalismus zum Ausdruck bringt. Dadurch kann die Vertiefung der Krise auf internationaler Ebene und vor allem in den zentralen Ländern nicht ausgemerzt werden. Das offensichtliche Paradox kann dadurch erklärt werden, dass Ostasien zu einem günstigen Zeitpunkt handeln konnte, um von einer Stufe der Zuspitzung der internationalen Krise zu profitieren, mit Hilfe derer es zur Werkstatt der Welt mit Niedrigstlöhnen werden konnte.
Das Wachstum Asiens beschleunigt die Depression weltweit
Dieser neue 'Abschluss' der Akkumulation auf Weltebene trägt zur Verschärfung der wirtschaftlichen Depression auf Weltebene bei, da sein Warenausstoß die Überproduktion nur noch weiter erhöht, indem die Endnachfrage aufgrund der relativen Senkung der weltweiten Kaufkraft und der Zerstörung einer Reihe von Gebieten oder Bereichen, die nicht mehr der weltweiten Konkurrenz standhalten können, sinkt.
Marx zeigte auf, dass es im Wesentlichen zwei Wege zur Wiederherstellung der Profitrate gibt: entweder "von oben", indem Produktivitätsgewinne erzielt werden durch die Investitionen in neue Maschinen und Produktionsverfahren, oder "von unten", indem die Löhne gesenkt werden. Da die Rückkehr der Krise Ende der 1960er Jahre sich durch einen quasi ununterbrochenen Rückgang der Produktivitätsgewinne äußerte, bestand der einzige Weg zur Wiederherstellung der Profite in einer massiven Kürzung der Löhne.[18] Die unten aufgeführte Grafik zeigte diese depressive Dynamik deutlich auf: Während des Wirtschaftswunders entwickelten sich Profitraten und die Akkumulation parallel auf einem hohen Niveau. Seit dem Ende der 1960er Jahre sind die Profitraten und die Akkumulation um die Hälfte gesunken. Nach der Einführung der Politik des deregulierten Staatskapitalismus seit den 1980er Jahren ist die Profitrate spektakulär angestiegen und sie hat sogar die Raten der Zeit des Wirtschaftswunders übertroffen. Aber trotz der Wiederherstellung der Profitraten ist die Akkumulationsrate nicht dem gleichen Rhythmus gefolgt und sie befindet sich weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau. Dies ist direkt auf die Schwäche der Endnachfrage zurückzuführen, welche durch die massive Kürzung der Lohnmasse herbeigeführt wurde, welche die Grundlage für die Wiederherstellung der Profitrate ist. Heute befindet sich der Kapitalismus in einer langsam wirkenden Rezessionsspirale: Seine Betriebe sind nunmehr rentabel, aber sie sie funktionieren auf einer immer eingeschränkteren Basis, da das Problem der Überproduktion akuter ist als je zuvor und dadurch die Akkumulationsgrundlagen begrenzt werden.
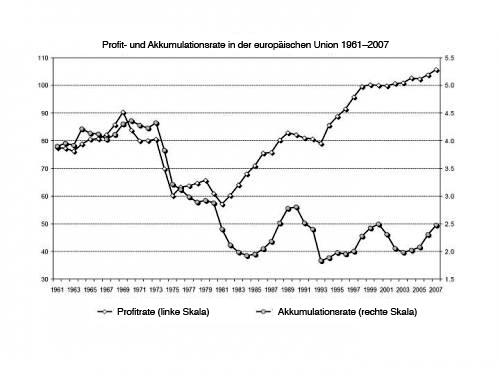
Grafik 6, Quelle: Michel Husson
Deshalb ist das gegenwärtige Wachstum in Ostasien keinesfalls ein asiatisches Wirtschaftswunder; auch handelt es sich nicht um eine Erneuerung des Kapitalismus auf Weltebene, sondern es handelt sich um eine Erscheinungsform des Versinkens in der Krise.
Schlussfolgerung
Der Ursprung, das Zentrum und die Dynamik der Krise rühren aus den zentralen Ländern. Die Verlangsamung des Wachstums, die Arbeitslosigkeit, die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen sind alles Erscheinungen, die vor dem Entwicklungsschub in Ostasien aufgetreten sind. Es waren gerade die Folgen der Krise in den entwickelten Ländern, die einen "Abschluss" der Akkumulation auf Weltebene und damit die Integration Asiens in den Weltmarkt als Werkstatt der Welt bewirkt haben. Dieser neue Abschluss verstärkt im Gegenzug die wirtschaftliche Depression in den zentralen Ländern, da auf internationaler Ebene die Überproduktion weiter zunimmt (das Angebot), während der zahlungskräftige Markt (Nachfrage ) schrumpft, nachdem die Löhne gesenkt wurden (ein für die Wirtschaft ausschlaggebender Faktor) und indem ein Großteil der weniger konkurrenzfähigen Wirtschaft in der Dritten Welt (ein marginaler Faktor auf ökonomischer, aber ein dramatischer Faktor auf menschlicher Ebene) zerstört wurde.
Die Rückkehr der historischen Krise des Kapitalismus Ende der 1960er Jahre, deren Zuspitzung in den 1970er Jahren sowie das Scheitern der seitdem eingesetzten neokeynesianischen Hilfsmittel haben den Weg bereitet für einen deregulierten Staatskapitalismus, welcher später eine pervertierte Globalisierung in den 1990er Jahren eingeleitet hat. Einige Länder konnten so zu Werkstätten mit Niedriglöhnen werden. Dies ist die Grundlage des spektakulären Wachstums in Ostasien, welches zusammen mit der Krise des stalinistischen und nationalistischen Modells der autarken Entwicklung, sich zu einem richtigen Zeitpunkt in den neuen weltweiten Akkumulationszyklus eingliedern konnte.
Frühjahr 2008, C.Mcl
[1] Siehe unseren Artikel: „Hinter der ‚Globalisierung' die Krise des Kapitalismus" in Internationale Revue 18
[2] Quellen: Weltbank: Indikatoren der Entwicklung auf der Welt 2003 (Online-Version) und Weltweite Wirtschaftsperspektiven 2004
[3] Tabelle 1: Strukturelle Verteilung als Prozent des produzierten Werts und Beschäftigung
|
Bereich |
Primärer (Landwirtschaft) |
Sekundärer (Industrie) |
Tertiärer (Dienstleistungen) |
|||
|
|
Wert |
Beschäftigung |
Wert |
Beschäftigung |
Wert |
Beschäftigung |
|
1952 |
51 |
84 |
21 |
7 |
29 |
9 |
|
1978 |
28 |
71 |
48 |
17 |
24 |
12 |
|
2001 |
15 |
50 |
51 |
22 |
34 |
28 |
|
Quelle: Statistisches Jahrbuch China 2002 |
[4] Diese Berechnungsweise ist deutlich zuverlässiger, da sie sich nicht auf die jeweiligen Werte stützt, die nur durch den Warentausch auf dem Weltmarkt entstanden sind, sondern auf den Vergleich der Preise eines Warenkorbs und Standarddienstleistungen in verschiedenen Ländern.
[5] Wir verweisen unsere Leser/Innen auf unseren Bericht zur Konferenz in Korea, auf der eine Reihe von Gruppen und Leuten zusammen kamen, die sich auf den proletarischen Internationalismus und die Kommunistische Linke berufen (siehe International Review - engl./franz./span. Ausgabe Nr. 129) sowie auf die Webseite einer neuen politischen internationalistischen Gruppe, die in den Philippinen entstanden ist und sich ebenfalls an die Kommunistische Linke anlehnt (siehe unsere Webseite).
[6] Auf unserem 17. Internationalen Kongress (siehe Internationale Revue Nr. 130; engl./franz./span. Ausgabe) hatten wir ausführlich über die Wirtschaftskrise im Kapitalismus diskutiert; dabei haben wir uns insbesondere mit dem gegenwärtigen Wachstum bestimmter ‚Schwellenländer' wie Indien oder China befasst, welches scheinbar die Analysen unserer Organisation und des Marxismus im Allgemeinen hinsichtlich des endgültigen Bankrotts der kapitalistischen Produktionsweise widerlegen. Wir haben beschlossen, in unserer Presse, insbesondere in der Internationalen Revue Vertiefungsartikel zu diesem Thema zu veröffentlichen. Dieser Artikel ist eine Konkretisierung dieser Orientierung. Wir meinen, dass er einen richtigen und nützlichen Beitrag zum Begreifen des Phänomens des chinesischen Wachstums im Rahmen der Dekadenz des Kapitalismus liefert. Die gegenwärtig in unserer Organisation stattfindende Debatte hinsichtlich der Analyse der Mechanismen, die dem Kapitalismus sein spektakulärstes Wachstum nach dem 2. Weltkrieg ermöglichten, spiegeln sich wider bei der Art und Weise, wie man die gegenwärtige Dynamik der Wirtschaft bestimmter ‚Schwellenländer', insbesondere Chinas, begreift. Gegenüber dem hier vorgelegten Artikel gibt es Differenzen, weil der Artikel die Auffassung vertritt, dass die Lohnmasse ausreichen würde, um einen aufnahmefähigen Absatzmarkt für die kapitalistische Produktion darzustellen, wenn sie nicht extrem stark "reduziert" wird. Dies spiegelt sich in der Formulierung einer Idee hinsichtlich der gegenwärtigen Globalisierung wider, die "pervertiert wird in dem Sinne, dass sie diese Lohnmasse relativ ‚komprimiert' und die Akkumulationsgrundlagen auf Weltebene um so mehr begrenzt". Die Mehrheit des Zentralorgans der Organisation vertritt diese Auffassung nicht. Sie geht stattdessen davon aus, wenn der Kapitalismus der Arbeiterklasse eine Kaufkraft ermöglicht (deren Gründe wir hier nicht näher erläutern können), die höher ist als das für die Reproduzierung der Arbeitskraft strikt Notwendige, und damit der Konsum der Arbeiter ansteigt, wird damit jedoch nicht dauerhaft die Akkumulation begünstigt.
[7] „Die Periode der kapitalistischen Dekadenz zeichnet sich dadurch aus, dass die Entstehung neuer Industrienationen unmöglich geworden ist. Jene Länder, die ihren industriellen Rückstand vor dem Ersten Weltkrieg nicht wettmachen konnten, waren dazu verdammt, in totaler Unterentwicklung zu stagnieren oder in eine chronische Abhängigkeit gegenüber den hoch industrialisierten Ländern zu geraten. So verhält es sich mit Nationen wie China oder Indien, in denen es trotz angeblicher „nationaler Unabhängigkeit" oder gar „Revolution" (d.h. die Einführung eines drakonischen Staatskapitalismus) nicht gelang, Unterentwicklung und Armut abzustreifen. (...) Die Unfähigkeit der unterentwickelten Länder, das Niveau der hoch entwickelten Mächte zu erreichen, lässt sich durch folgende Tatsachen erklären:
1) Die Märkte, die einst die außerkapitalistischen Sektoren für die Industrieländer verkörperten, sind durch die Kapitalisierung der Landwirtschaft und den fast vollständigen Niedergang des Handwerks gänzlich ausgeschöpft. (...) 3) Die außerkapitalistischen Territorien dieser Welt sind nahezu vollständig vom kapitalistischen Weltmarkt einverleibt worden. Trotz der ungeheuren Armut und der immensen Nachholbedürfnisse, trotz der völligen Unterentwicklung ihrer Wirtschaft stellen die Drittweltländer keinen zahlungsfähigen Markt dar, weil sie schlicht und einfach pleite sind. (4) Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage behindert jegliche Entstehung neuerer kapitalistischer Nationen. In einer Welt der gesättigten Märkte übertrifft das Angebot die Nachfrage bei weitem; die Preise werden durch die niedrigsten Produktionskosten bestimmt. Dadurch sind jene Länder mit den höchsten Produktionskosten gezwungen, ihre Waren für wenig Profit, wenn nicht gar mit Verlust, zu veräußern. Dies drückt ihre Akkumulationsrate auf ein niedriges Niveau. Selbst mit ihren billigen Arbeitskräften gelingt es ihnen nicht, die notwendigen Investitionen zur Anschaffung moderner Technologien zu tätigen. Das Ergebnis ist die ständige Vergrößerung des Abstandes zwischen ihnen und den Industrieländern. (...) 6) Die moderne Produktion von heute erfordert eine im Vergleich zum 19. Jahrhundert weitaus höher entwickelte Technologie und somit enorme Investitionen, die lediglich die Industriemächte zur Verfügung haben. So wirken sich auch rein technische Faktoren negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung aus." (Internationale Revue, Nr. 23, 1980, engl./franz./span. Ausgabe)
[8] Maddison, OCDE, 2001 : 283, 322.
[9] Der Welthandel entwickelte sich nach 1945 sehr schnell, sogar noch stärker als während der aufsteigenden Phase, da der Welthandel sich zwischen 1945-1971 im Laufe von 23 Jahren verfünffachte - während er zwischen 1890 und 1913 (ebenso 23 Jahre) nur um das 2.3 fache stieg. Der Anstieg des Welthandels war also doppelt so stark während des Wirtschaftswunders als während der stärksten Wachstumszeiten in der Aufstiegsphase (Quelle: Rostow, The World Economy, History and Prospect, University of Texas Press, 1978 : 662). Aber trotz dieses enormen Wachstums des Welthandels blieb der Anteil der Exporte an der Weltproduktion unterhalb des Niveaus von 1913 und selbst unterhalb des Niveaus von 1860: Die entwickelten Länder exportierten 1970 nicht mehr als ein Jahrhundert zuvor. Dies ist ein unverkennbares Zeichen eines auf sich selbst zentrierten Wachstums, das sich auf den nationalen Rahmen ausrichtet. Und zudem ist diese Beobachtung eines starken Anstiegs des Welthandels nach 1945 um so mehr zu relativieren, wenn man die Grafik genauer anschaut. Denn ein ständig wachsender Teil des Welthandels entsprach nicht wirklichen Verkäufen, sondern einem Austausch zwischen Filialen aufgrund der zunehmenden internationalen Arbeitsteilung. „Schätzungen der UNCTAD (Welthandelskonferenz) zufolge setzen allein die Multis zwei Drittel des Welthandels untereinander um. Und die Hälfte des Welthandels entspricht einem Transfer zwischen Filialen der gleichen Handelsgruppe" (Bairoch Paul, Victoires et déboires, III: 445). Diese Feststellung bekräftigt somit unsere allgemeine Schlussfolgerung, wonach die Dekadenz sich im Wesentlichen durch einen allgemeinen Rückzug eines jeden Landes auf seinen nationalen Rahmen auszeichnet und im Gegensatz zur aufsteigenden Phase nicht durch eine Ausdehnung und einen Wohlstand, der auf einer weiteren stürmischen Eroberung der Welt fußt.
[10] Alle Angaben der direkten Auslandsinvestitionen entstammen dem Buch von Bairoch Paul, 1997, Victoires et déboires, III : 436-443.
[11] Auf der indonesischen Insel Java fand zwischen dem 18.-24. April 1955 in Bandung die erste afroasiatische Konferenz statt, an der sich 29 Länder beteiligten, von denen die meisten erst kurz zuvor aus der kolonialen Abhängigkeit entlassen worden waren und die alle der Dritten Welt angehörten. Die Initiative für diesen Gipfel war von dem indischen Premierminister Nehru ausgegangen, der auf internationaler Ebene Staaten zusammenführen wollte, welche dem Griff der beiden Großmächte und der Logik des Kalten Kriegs entweichen wollten. Aber diese „blockfreien Staaten" konnten niemals wirklich unabhängig werden und der Dynamik der imperialistischen Zusammenstöße zwischen den beiden großen Blöcken (dem amerikanischen und sowjetischen) entziehen. So gehörten dieser Bewegung damals pro-westliche Staaten wie Pakistan oder die Türkei an, aber auch andere wie China und Nordvietnam, die pro-sowjetisch eingestellt waren.
[12] In der Nr. 128 unserer Internationalen Revue(engl./franz./span. Ausgabe) haben wir zwei Grafiken veröffentlicht, welche die Entwicklung der Profitrate während der letzten 150 Jahre in den USA und Frankreich widerspiegelten. Dort wird das Absinken um die Hälfte der Profitraten zwischen dem Ende der 1960er Jahre und 1980 deutlich. Es handelte sich um einen der spektakulärsten Rückgänge der Profitrate in der Geschichte des Kapitalismus weltweit.
[13] Die Mehrwertrate ist nichts anderes als die Ausbeutungsrate, welche den durch die Kapitalisten angeeigneten Mehrwert (m) ins Verhältnis setzt zur Lohnmasse (v, variables Kapital), den dieser den Beschäftigten zahlt. Ausbeutungsrate = Mehrwert/variables Kapital.
[14] Diese Grafik entstammt aus einer Untersuchung, die von Ian Dew-Becker & Robert Gordon verfasst wurde: Where did the Productivity Growth Go? Inflation Dynamics and the Distribution of Income, Washington DC, September 8-9, 2005, zugänglich im Internet auf folgender Webseite: https://zfacts.com/metaPage/lib/gordon-Dew-Becker.pdf [149].
[15] Diese niedrigen Herstellungskosten erklären die Stabilisierung auf hohem Niveau des Teils der Produktion, welche zwischen 1980 (15,3%) und 1996 15,9%) exportiert wurde. Dieser Anteil wird viel höher, wenn man ihn nicht nach seinem Wert, sondern nach Umfang misst: 19,1% im Jahre 1980 und 28,6% im Jahre 1996.
[16] Während das Weltbruttoinlandsprodukt pro Kopf jedes Jahrzehnt seit den 1960er Jahren gesunken ist: 3,7% (1960-69) ; 2,1% (1970-79), 1,3% (1980-89) ; 1,1% (1990-1999) und 0,9% für 2000-2004 kann man jetzt davon ausgehen - wenn nicht eine tiefe Rezession vor dem Ende des Jahrzehnts ausbricht, was sehr wahrscheinlich ist, dass der Durchschnitt für das Jahrzehnt 2000-2010 zum ersten Mal wesentlich höher liegen könnte als im Vergleich zum Jahrzehnt zuvor. Diese Steigerung ist vor allem auf die wirtschaftliche Dynamik in Ostasien zurückzuführen. Aber dieser Anstieg muss stark relativiert werden, denn wenn man deren Parameter untersucht, kann man feststellen, dass das Weltwachstum seit dem Crash der "New Economy" (2001-2002) sich hauptsächlich auf eine große Verschuldung der Haushalte und amerikanische Rekordhandelsdefizite stützte. Die US-Privathaushalte (wie auch die vieler anderer europäischer Länder) haben das Wachstum aufgrund einer starken Verschuldung nach einer Umschuldung ihrer Hypothekenkredite getragen (welche durch die Politik der Niedrigzinsen zur Ankurbelung des Wachstums betrieben wurde), so dass heute die Gefahren eines Immobiliencrashs erkennbar sind. Gleichzeitig haben die öffentliche Verschuldung, vor allem auch die Handelsdefizite, Rekordniveaus erreicht, welche ebenso stark das Wachstum auf der Welt mit getragen haben. Wenn man die Zahlen näher untersucht, wird diese wahrscheinliche Verbesserung während des ersten Jahrzehnts in diesem Jahrhundert erreicht worden sein, indem man viele Wechsel auf die Zukunft ausgestellt hat.
[17]Diese Art Anstieg ist keineswegs überraschend und sie traten auch im Verlauf der Dekadenz des Kapitalismus relativ häufig auf. Während dieser Phase bestand der Daseinsgrund der Politik der Bourgeoisie und insbesondere der staatskapitalistischen Politik darin, die wirtschaftlichen Gesetze und Regeln auszuhebeln, um ein System zu retten versuchen, welches unvermeidlich zum Bankrott neigt. Insbesondere während der 1930er Jahre wurden solche Maßnahmen schon ergriffen. Damals schon ließen viele staatskapitalistische Maßnahmen sowie massive Aufrüstungsprogramme viele vorübergehend glauben, dass man die Krise im Griff habe und es sogar wieder einen Aufschwung geben könnte: New Deal in den USA, Volksfront in Frankreich, DeMan-Plan in Belgien, Fünfjahrespläne in der UdSSR, Faschismus in Deutschland usw.
[18] Wir verweisen unsere Leser auf einen Artikel in unserer Internationale Revue Nr. 121, (engl./franz./span. Ausgabe) - in welcher wir auf diesen Prozess eingehen und empirische Angaben liefern.
Geographisch:
- Asien [64]
Aktuelles und Laufendes:
- Wirtschaftswunder China [129]
- Wirtschaftsentwicklung Südostasien [150]
- Indien [151]
Theoretische Fragen:
- Politische Ökonomie [66]
Erbe der kommunistischen Linke:
Deutschland 1918 – 19, /1 Der Krieg und die Erneuerung der internationalistischen Prinzipien durch das Proletariat
- 6103 reads
Es ist 90 Jahre her, seitdem dieproletarische Revolution mit den Kämpfen von 1918 und 1919 in Deutschland ihrentragischen Höhepunkt erreicht hatte. Nach der heroischen Machtergreifung durchdas russische Proletariat im Oktober 1917 wechselte das Hauptschlachtfeld derWeltrevolution nach Deutschland. Dort wurde der entscheidende Kampf gefochtenund verloren. Die Weltbourgeoisie strebte stets an, diese Ereignisse historisch
Es ist 90 Jahre her, seitdem die proletarische Revolution mit den Kämpfen von 1918 und 1919 in Deutschland ihren tragischen Höhepunkt erreicht hatte. Nach der heroischen Machtergreifung durch das russische Proletariat im Oktober 1917 wechselte das Hauptschlachtfeld der Weltrevolution nach Deutschland. Dort wurde der entscheidende Kampf gefochten und verloren. Die Weltbourgeoisie strebte stets an, diese Ereignisse historisch in Vergessenheit geraten zu lassen. Das geht soweit, dass sie zwar nicht abstreiten kann, dass diese Kämpfe stattgefunden hatten, dass sie aber vorgibt, dass letztere nur auf „Frieden" und „Demokratie" abgezielt hätten - zu den glückseligen Bedingungen, die gegenwärtig im kapitalistischen Deutschland herrschen. Ziel dieser Artikelreihe, die wir hiermit beginnen, ist es aufzuzeigen, dass die revolutionäre Bewegung in Deutschland die Bourgeoisie in dem zentralen Land des europäischen Kapitalismus nahe an den Abgrund gerückt hatte, den Verlust ihrer Klassenherrschaft. Trotz ihrer Niederlage ist die Revolution in Deutschland wie jene in Russland ein Ansporn für uns heute. Sie erinnert uns daran, dass es nicht nur notwendig, sondern auch möglich ist, die Herrschaft des Weltkapitalismus zu stürzen.
Diese Reihe teilt sich in fünf Teile auf. Der erste Teil wird sich der Frage widmen, wie sich das revolutionäre Proletariat angesichts des I. Weltkrieges um sein Prinzip des proletarischen Internationalismus scharte. Teil 2 wird sich mit den revolutionären Kämpfen von 1918 beschäftigen. Teil 3 wird sich dem Drama der Formierung einer revolutionären Führung widmen, konkretisiert am Beispiel des Gründungskongresses der deutschen Kommunistischen Partei Ende 1918. Teil 4 wird die Niederlage von 1919 untersuchen. Der letzte Teil wird sich mit der historischen Bedeutung der Ermordung Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts sowie mit der Hinterlassenschaft dieser Revolutionäre für uns heute widmen.

I. Niederlage und Auflösung
Die internationale revolutionäre Welle, die gegen den I. Weltkrieg einsetzte, fand nur einige Jahre nach der größten politischen Niederlage statt, die die Arbeiterbewegung bis dahin erlitten hatte: der Zusammenbruch der sozialistischen Internationale im August 1914. Es ist daher wichtig zu begreifen, warum dieser Krieg stattfinden konnte und die Internationale versagte, um den Charakter und Verlauf der Revolutionen in Russland und besonders in Deutschland zu verstehen.
Der Marsch in den Krieg
Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts lag der Weltkrieg in der Luft. Hektisch begannen die imperialistischen Großmächte ihn vorzubereiten. Die Arbeiterbewegung hatte ihn vorausgesagt und vor ihm gewarnt. Doch zunächst wurde sein Ausbruch hinausgezögert - durch zwei Faktoren. Einer von ihnen war die unzureichende militärische Vorbereitung der wichtigsten Protagonisten. Deutschland beispielsweise war erst dabei, den Aufbau einer Kriegsflotte zu vervollständigen, die gegenüber Großbritannien, dem Beherrscher der Weltmeere, bestehen konnte. Es musste erst die Insel Helgoland in eine hochseetüchtige Marinebasis umwandeln und vollendete den Bau eines Kanals zwischen der Nordsee und dem Baltikum. Als das erste Jahrzehnt des Jahrhunderts sich dem Ende näherte, standen diese Vorbereitung kurz vor ihrem Abschluss. Dies rückte den zweiten Verzögerungsfaktor um so mehr in den Vordergrund: die Angst vor der Arbeiterklasse. Die Existenz dieser Furcht war keine bloße spekulative Hypothese der Arbeiterbewegung. Sie wurde offen von den Hauptrepräsentanten der Bourgeoisie ausgedrückt. Von Bülow, eine führende politische Figur im deutschen Staat, erklärte, dass es vornehmlich die Angst vor der Sozialdemokratie war, die die herrschende Klasse dazu veranlasste, den Krieg zu verschieben. Paul Rohrbach, der infame Propagandist der unverhohlen imperialistischen Kreise der Kriegsbefürworter in Berlin, schrieb: „... Zitat ..." General von Bernhard, ein prominenter Militärtheoretiker dieser Tage, warnte in seinem Buch „Über den zeitgenössischen Krieg", dass die moderne Kriegführung wegen der Notwendigkeit, Millionen von Menschen zu disziplinieren und zu mobilisieren, ein enormes Risiko sei. Solche Einsichten basierten nicht allein auf theoretischen Betrachtungen, sondern auch auf der praktischen Erfahrung aus dem ersten imperialistischen Krieg des 20. Jahrhunderts zwischen Großmächten. Dieser Krieg - zwischen Russland und Japan - verhalf der revolutionären Bewegung von 1905 in Russland zum Leben.
Solche Erwägungen nährten die Hoffnung innerhalb der Arbeiterbewegung, dass die herrschende Klasse es nicht wagen würde, in den Krieg zu ziehen. Diese Hoffnungen hatten ihren Anteil daran, dass die Divergenzen innerhalb der Sozialistischen Internationale just zu dem Zeitpunkt übertüncht wurden, als die Notwendigkeit einer proletarischen Klärung die offene Debatte erforderte. Die Tatsache, dass keine der verschiedenen Strömungen innerhalb der sozialistischen Bewegung den Krieg „wollte", schuf die Illusion der eigenen Stärke und Einheit. Doch der Reformismus und Opportunismuswaren prinzipiell nicht unvereinbar mit dem imperialistischen Krieg, sondern befürchteten lediglich den Verlust ihres juristischen und finanziellen Status im Falle seines Ausbruchs. Das „marxistische Zentrum" um Kautsky wiederum fürchtete den Krieg hauptsächlich deswegen, weil er die Illusion einer Einheit in der Arbeiterbewegung, die es um jeden Preis zu verteidigen entschlossen war, zerstören würde.
Was zugunsten der Fähigkeit der Arbeiterklasse sprach, den Ausbruch eines Weltkrieges zu verhindern, war vor allem die Intensität des Klassenkampfes in Russland. Dort hatten die Arbeiter nicht lange gebraucht, um sich von der Niederlage der 1905er Bewegung zu erholen. Am Vorabend des I. Weltkrieges gewann im zaristischen Herrschaftsbereich eine neue Welle von Massenstreiks an Fahrt. In einem gewissen Umfang ähnelte die damalige Lage der Arbeiterklasse in Russland jener im China von heute - eine Minderheit in der Gesamtbevölkerung zwar, aber dafür hochkonzentriert in modernen Fabriken, die vom internationalen Kapital finanziert wurden, brutal ausgebeutet in einem rückständigen Land, dem es an den politischen Kontrollmechanismen des bürgerlichen parlamentarischen Liberalismus mangelte. Mit einem gewichtigen Unterschied: das russische Proletariat wurde in den sozialistischen Traditionen des Internationalismus erzogen, während die chinesischen ArbeiterInnen heute immer noch unter dem Albtraum der nationalistisch-stalinistischen Konterrevolution leiden.
All dies machte Russland zu einer Bedrohung der kapitalistischen Stabilität.
Aber Russland war nicht typisch für das internationale Gleichgewicht der Klassenkräfte. Im Mittelpunkt des Kapitalismus und der imperialistischen Spannungen standen West- und Mitteleuropa. Der Schlüssel zur Weltlage befand sich nicht in Russland, sondern in Deutschland. Dies war das Land, das die Weltherrschaft der Kolonialmächte am meisten herausforderte. Und es war das Land mit der höchstkonzentrierten Arbeiterklasse, eine Klasse, deren sozialistische Erziehung am weitesten gediehen war. Die politische Rolle der deutschen Arbeiterklasse wurde von der Tatsache veranschaulicht, dass in Deutschland die Gewerkschaften von den sozialistischen Parteien gegründet worden waren, während in Großbritannien - der anderen führenden kapitalistischen Nation in Europa - die sozialistische Bewegung ein bloßes Anhängsel der Gewerkschaftsbewegung zu sein schien. In Deutschland standen die Tageskämpfe der ArbeiterInnen traditionell im Lichte des großen sozialistischen Endziels.
Ende des 19. Jahrhunderts begann jedoch ein Prozess der De-Politisierung der sozialdemokratischen Gewerkschaften in Deutschland, ihre „Emanzipation" von der sozialistischen Partei. Die Gewerkschaften zweifelten offen die Existenz einer Einheit zwischen Bewegung und Ziel an. Der Parteitheoretiker Eduard Bernstein verallgemeinerte dieses Bestreben mit seiner berühmten Formulierung: „Das Ziel ist mir nichts, die Bewegung alles". Diese Infragestellung der führenden Rolle der Sozialdemokratie in der Arbeiterbewegung, des Vorrangs des Ziels über die Bewegung brachte die sozialistische Partei in Konflikt mit ihren eigenen Gewerkschaften. Nach dem Massenstreik 1905 in Russland verschärfte sich dieser Konflikt. Er endete in einem Triumph der Gewerkschaften über die Partei. Unter dem Einfluss des„Zentrums" um Kautsky - der um jeden Preis die „Einheit" der Arbeiterbewegung aufrechterhalten wollte - beschloss die Partei, dass die Frage des Massenstreiks eine Angelegenheit der Gewerkschaften sei1.Doch der Massenstreik beinhaltete die ganzen Fragen der kommendenproletarischen Revolution! Auf diese Weise wurde die deutsche und die internationale Arbeiterklasse am Vorabend des I. Weltkrieges politisch entwaffnet.
Die Erklärung ihres nicht-politischen Charakters bereitete die Integration der Gewerkschaften in den kapitalistischen Staat vor. Somit hatte die herrschende Klasse, was sie benötigte, um die ArbeiterInnen für den Krieg zu mobilisieren. Diese Mobilisierung im Herzen des Kapitalismus würde ihrerseits ausreichend sein, um die ArbeiterInnen in Russland - für die Deutschland der Hauptbezugspunkt war - zu demoralisieren und desorientieren und somit die Stoßkraft der dortigen Massenstreiks zu brechen.
Das russische Proletariat, das sich seit 1911 in Massenbewegungen engagierte, hatte einschlägige Erfahrungen mit Wirtschaftskrisen, Kriegen und revolutionären Kämpfen. Nicht so in West- und Mitteleuropa. Dort brach der Weltkrieg am Ende einer langen Phase der wirtschaftlichen Entwicklung aus, der realen Verbesserungen der Lebensbedingungen der ArbeiterInnen, der steigenden Löhne und sinkenden Arbeitslosigkeit, der reformistischen Illusionen. Eine Phase, in der größere Kriege sich auf die Peripherie des Weltkapitalismus beschränkten. Die erste große Weltwirtschaftskrise des dekadenten Kapitalismus sollte erst 15 Jahre später ausbrechen - 1929. Die Epoche der Dekadenz begann nicht mit einer Wirtschaftskrise, wie die Arbeiterbewegung traditionell erwartete, sondern mit der Krise des Weltkrieges. Mit der Niederlage und der Isolierung des linken Flügels der Arbeiterbewegung in der Frage des Massenstreiks gab es keinen Grundmehr für die Bourgeoisie, den Sprung in den imperialistischen Krieg weiter hinauszuzögern. Im Gegenteil: jede weitere Verzögerung hätte sich als fatal für ihre Pläne erwiesen. Ein weiteres Abwarten konnte nur bedeuten: Warten auf die Wirtschaftskrise, auf den Klassenkampf, auf die Entwicklung eines revolutionären Bewusstseins ihrer Totengräber!
Der Zusammenbruch der Internationale
Somit war der Weg zum Weltkrieg frei. Sein Ausbruch führte zum Auseinanderplatzen der Sozialistischen Internationale. Am Vorabend des Krieges organisierte die Sozialdemokratie noch Massenprotestdemonstrationen und Versammlungen in ganz Europa. Die SPD-Führung in Deutschland sandte Friedrich Ebert (einem der künftigen Mörder der Deutschen Revolution) mit dem Parteivermögen nach Zürich in die Schweiz, um dessen Beschlagnahmung zu verhindern, und den stets wankelmütigen Hugo Haase nach Brüssel, um den internationalen Widerstand gegen den Krieg zu organisieren. Doch es war eine Sache, sich dem Krieg entgegenzustellen, bevor er ausgebrochen war. Eine ganz andere war es, Stellung gegen ihn zu beziehen, war er einmal ausgebrochen. Und hier stellten sich die Gelübde der proletarischen Solidarität, auf dem internationalen Kongress in Stuttgart 1907 einmütig geleistet und 1912 in Basel erneuert, als bloße Lippenbekenntnisse heraus. Selbst einige linke Befürworter scheinbar radikaler Sofortaktionen gegen den Krieg - Mussolini in Italien, Hervé in Frankreich - wechselten nun ins Lager des Chauvinismus.
Jeder wurde von dem Ausmaß des Fiaskos der Internationale überrascht. Es ist allgemein bekannt, dass Lenin zunächst annahm, die Pro-Kriegs-Deklarationen der deutschen Parteipresse seien Polizeifälschungen, die darauf abzielten, die ausländische sozialistische Bewegung zu destabilisieren. Auch die Bourgeoisie schien von dem Ausmaß überrascht zu sein, in dem die Sozialdemokratie ihre Prinzipien verraten hatte. Sie hatte hauptsächlich damit gerechnet, dass die Gewerkschaften die ArbeiterInnen mobilisieren, und sie hatte am Vorabend des Kriegs Geheimvereinbarungen mit deren Führung erreicht. In einigen Ländern widersetzten sich jedoch wichtige Teile der Sozialdemokratie dem Krieg. Dies zeigt, dass die politische Öffnung für den Weg zum Krieg nicht automatisch bedeutete, dass die politischen Organisationen der Klasse Verrat begehen mussten. Um so auffälliger war das Versagen der Sozialdemokratie in den führend am Krieg beteiligten Nationen. In Deutschland schafften es in einigen Fällen auch die entschlossensten Kriegsgegner nicht, ihre Stimme zu erheben. In der parlamentarischen Reichtagsfraktion, in der 14 Mitglieder gegen die Kriegskredite stimmten und 78 dafür, unterwarf sich selbst Karl Liebknecht zunächst der traditionellen Parteidisziplin.
Wie war das zu erklären?
Zu diesem Zweck müssen wir natürlich zunächst die Ereignissein ihren historischen Kontext setzen. Hier sind die Veränderungen in den fundamentalen Bedingungen des Klassenkampfes durch den Eintritt in eine neue Epoche der Kriege und Revolutionen, des historischen Niedergangs des Kapitalismus entscheidend. Erst durch diesen historischen Zusammenhang können wir vollständig erfassen, dass das Überwechseln der Gewerkschaften in das Lager der Bourgeoisie historisch unvermeidbar war. Da diese Organe, Ausdrücke eines spezifischen, unreifen Niveaus des Klassenkampfes, naturgemäß niemals revolutionär waren, konnten sie in einer Epoche, in der eine effektive Verteidigung der unmittelbaren Interessen jeglichen Teils des Proletariats notwendigerweise auf die Revolution hinausläuft, nicht mehr ihrer ursprünglichen Klasse dienen und nur überleben, indem sie zum feindlichen Lage überliefen.
Doch was die Rolle der Gewerkschaften so vollständig erklärt, erweist sich bereits bei der Untersuchung des Falles der sozialdemokratischen Parteien als unvollständig. Es trifft zu, dass mit dem I. Weltkrieg diese Parteien ihr Gravitätszentrum, nämlich die Mobilisierungen für die Wahlen, verloren hatten. Es trifft ebenfalls zu, dass die veränderten Bedingungen den politischen Massenparteien des Proletariats allgemeinhin die Basis genommen hatten. Angesichts der Kriege wie auch der Revolutionen musste eine proletarische Partei nun in der Lage sein, auch gegen den Strom zu schwimmen und sich selbst der herrschenden Stimmung in der Klasse insgesamt zu widersetzen. Doch die Hauptaufgabe einer politischen Organisation des Proletariats - die Verteidigung seines Programms und besonders des proletarischen Internationalismus - änderte sich nicht in der neuen Epoche. Im Gegenteil, sie wurde noch wichtiger. Obwohl es also eine historische Notwendigkeit war, dass die sozialistischen Parteien in eine Krise stürzten und dass sogar ganze Strömungen, die vom Reformismus und Opportunismus verseucht waren, Verrat begehen und in der Bourgeoisie aufgehen, erklärt dies nicht vollständig das, was Rosa Luxemburg die „Krise der Sozialdemokratie" nannte.
Es ist auch wahr, dass ein solch fundamentaler historischer Wechsel notwendigerweise eine programmatische Krise auslöst; alte und bewährte Taktiken und sogar Prinzipien werden plötzlich out of date, wie die Teilnahme an den parlamentarischen Wahlen, die Unterstützung nationaler Bewegungen oder der bürgerlichen Revolution. Doch sollten wir hier im Kopf behalten, dass viele damalige Revolutionäre nichtsdestotrotz in der Lage waren, dem proletarischen Internationalismus treu zu bleiben, obwohl sie noch nicht diese politischen und taktischen Implikationen begriffen.
Jeder Erklärungsansatz, der allein von der Grundlage der objektiven Bedingungen ausgeht, wird darin enden, alles, was in der Geschichtepassiert, als von Anfang an unvermeidlich zu betrachten. Diese Betrachtungsweise stellt die Möglichkeit in Frage, von der Geschichte zulernen, da wir wiederum ebenfalls das Produkt unserer eigenen „objektiven Bedingungen" sind. Kein Marxist wird bei vollem Verstand die Wichtigkeit dieser objektiven Bedingungen bestreiten. Doch wenn wir die Erklärung untersuchen, die die damaligen Revolutionäre selbst für die Katastrophe des Sozialismus 1914hatten, entdecken wir, dass sie vor allem die Bedeutung der subjektiven Faktoren betonten.
Einer der Hauptgründe für den Niedergang der sozialistischen Bewegung lag in ihrem illusorischen Gefühl der Unbezwingbarkeit, ihrer irrigen Überzeugung in der Gewissheit ihres eigenen künftigen Triumphes. In der Zweiten Internationale basierte diese Überzeugung auf drei Entwicklungsbedingungen des Kapitalismus, die bereits von Marx ausgemacht worden waren. Diese waren: die Konzentration von Kapital und Produktivkräften einerseits und des besitzlosen Proletariats andererseits; die Eliminierung der gesellschaftlichen Zwischenschichten, die den Hauptwiderspruch zwischen den Klassen verwischen; und die wachsende Anarchie der kapitalistischen Produktionsweise, insbesondere in Gestalt der Wirtschaftskrisen, die die Totengräber des Kapitalismus dazu treiben, das System in Frage zu stellen. Diese Einsichten waren in sich selbstvollkommen schlüssig. Da diese drei Vorbedingungen für den Sozialismus das Produkt objektiver Widersprüche sind, die sich unabhängig vom Willen jeglicher Gesellschaftsklassen entfalten und sich langfristig unvermeidlich durchsetzen, führen sie zu zwei sehr problematischen Schlussfolgerungen. Erstens, dass der Triumph des Sozialismus unvermeidbar sei. Zweitens, dass sein Sieg nur verhindert werden könne, wenn die Revolution zu früh ausbräche, wenn die Arbeiterbewegung auf Provokationen hereinfiele.
Diese Schlussfolgerungen waren um so gefährlicher, als sie durchaus, aber nur teilweise zutrafen. Der Kapitalismus produziert unvermeidlicherweise die materiellen Vorbedingungen für die Revolution und für den Sozialismus. Und die Gefahr, von der herrschenden Klasse zu vorzeitigen Konfrontationen provoziert zu werden, ist eine reale. Wir werden die ganze tragische Bedeutung dieser Frage im dritten und vierten Teil dieser Artikelreihe sehen.
Doch das Problem mit diesem Schema der sozialistischen Zukunft besteht darin, dass es keinen Platz für das neue Phänomen der imperialistischen Kriege zwischen den modernen kapitalistischen Mächten ließ. Die ganze Frage des Weltkrieges passte nicht in dieses Schema. Wir haben bereits gesehen, dass die Arbeiterbewegung das unvermeidliche Heranreifen eines Krieges erkannt hatte, lange bevor er tatsächlich ausbrach. Doch für die Sozialdemokratie in ihrer Gesamtheit führte diese Erkenntnis überhaupt nicht zu der Schlussfolgerung, dass der Triumph des Sozialismus nicht mehr unvermeidbar war. Diese beiden Seiten in der Analyse der Wirklichkeit blieben in einer Weisegetrennt voneinander, die nahezu schizophren anmutet. Solch eine Unkohärenz ist, auch wenn sie fatal sein kann, keinesfalls unüblich. Viele der großen Krisen und Desorientierungen in der Geschichte der Arbeiterbewegung resultierten aus diesem Problem, in den Schemata der Vergangenheit eingesperrt zu sein, aus einem Bewusstsein, das hinter der Realität hinterherhinkte. Wir können das Beispiel der Unterstützung für die provisorische Regierung und die Fortsetzung des Krieges durch die bolschewistische Partei nach der Februarrevolution in Russland 1917 erwähnen. Die Partei ist dem Schema einerbürgerlichen Revolution zum Opfer gefallen, das aus dem Jahre 1905 stammte und seine Unzulänglichkeit im neuen Kontext des Weltkrieges enthüllte. Erst Lenins Aprilthesen und Wochen intensiver Diskussionen öffneten den Weg aus dieser Krise.
Friedrich Engels war kurz vor seinem Tode 1895 der erste, der die notwendigen Schlussfolgerungen aus der Perspektive eines allgemeinen Krieges in Europa zog. Er erklärte, dass sie die historische Alternative zwischen Sozialismus und Barbarei bedingt. Doch nicht einmal Engels konnte sofort alle Schlussfolgerungen aus dieser Einsicht ziehen. So gelang ihm nicht zuerkennen, dass das Erscheinen der oppositionellen Strömung „Die Jungen" in der SPD ein wahrhafter Ausdruck der gerechtfertigten Unzufriedenheit mit einem Handlungsrahmen (der sich vornehmlich auf den Parlamentarismus orientierte)war, der größtenteils unzureichend geworden war. Engels warf angesichts der letzten Krise der deutschen Partei sein ganzes Gewicht für jene in die Waagschale, die im Namen der Geduld und der Notwendigkeit, sich nicht provozieren zu lassen, die Aufrechterhaltung des Status quo der Parteiverteidigten.
Es war Rosa Luxemburg, die in ihrer Polemik gegen Bernstein zur Jahrhundertwende den entscheidenden Schluss aus Engels‘ Vision des„Sozialismus oder Barbarei" zog: Obwohl die Geduld eine der höchsten Tugenden der Arbeiterbewegung bleibt und vorzeitige Konfrontationen vermieden werden müssen, besteht die Hauptgefahr historisch nicht mehr darin, dass die Revolution zu früh kommt, sondern dass sie zu spät kommen könnte. Diese Auffassung legt die ganze Betonung auf die aktive Vorbereitung der Revolution, auf die zentrale Bedeutung des subjektiven Faktors.
Dieser Schlag gegen den Fatalismus, der dabei war, die Zweite Internationale zu beherrschen, diese Restaurierung des revolutionären Marxismus sollte zu einem der Kennzeichen der gesamten revolutionären Linken vor und während des I. Weltkrieges werden.2
Wie Rosa Luxemburg in ihrer „Krise der Sozialdemokratie" schrieb: „Der wissenschaftliche Sozialismus hat uns gelehrt, die objektiven Gesetze der geschichtlichen Entwicklung zu begreifen. Die Menschen machen ihre Geschichte nicht aus freien Stücken, aber sie machen sie selbst. Das Proletariat ist in seiner Aktion von dem jeweiligen Reifegrad der gesellschaftlichen Entwicklung abhängig, aber die geschichtliche Entwicklung geht nicht jenseits des Proletariats vor sich, es ist in gleichem Maße ihre Triebfeder und Ursache, wie es ihr Produkt und ihre Folge ist."
Eben weil sie die objektiven Gesetze der Geschichte entdeckt hatte, kann zum ersten Mal in der Geschichte eine gesellschaftliche Kraft - das klassenbewusste Proletariat - ihren Willen bewusst einsetzen. Das Proletariat kann nicht nur Geschichte machen, sondern auch bewusst ihren Verlaufbeeinflussen.
„Der Sozialismus ist die erste Volksbewegung der Weltgeschichte, die sich zum Ziel setzt, und von der Geschichte berufen ist, in das gesellschaftliche Tun der Menschen einen bewußten Sinn, einen planmäßigen Gedanken und damit den freien Willen hineinzutragen. Darum nennt Friedrich Engels den endgültigen Sieg des sozialistischen Proletariats einen Sprung der Menschheit aus dem Tierreich in das Reich der Freiheit. Auch dieser „Sprung" ist an eherne Gesetze der Geschichte, an Tausend Sprossen einer vorherigenqualvollen und allzu langsamen Entwicklung gebunden. Aber er kann nimmermehr vollbracht werden, wenn aus all dem von der Entwicklung zusammengetragenen Stoff der materiellen Vorbedingungen nicht der zündende Funke des bewussten Willens der großen Volksmasse aufspringt. Der Sieg des Sozialismus wird nicht wie Fatum vom Himmel herabfallen. Er kann nur durch eine lange Kette gewaltiger Kraftproben zwischen den alten und den neuen Mächten erkämpft werden, Kraftproben, in denen das internationale Proletariat unter der Führung der Sozialdemokratie lernt und versucht, seine Geschicke in die eigene Hand zunehmen, sich des Steuers des gesellschaftlichen Lebens zu bemächtigen, au seinem willenlosen Spielball der eigenen Geschichte zu ihrem zielklaren Lenker zu werden."3
Für den Marxismus gehören die Anerkennung der Bedeutung der objektiven historischen Gesetze und ökonomischen Widersprüchen - vom Anarchismus geleugnet oder ignoriert - sowie die subjektiven Elemente zusammen.4
Sie sind unzertrennbar miteinander verknüpft und beeinflussen sich gegenseitig. Wir können dies im Verhältnis zu den wichtigsten Faktoren beider allmählichen Unterminierung des proletarischen Lebens in der Internationalesehen. Einer dieser Faktoren war die Untergrabung der Solidarität innerhalb der Arbeiterbewegung. Dies wurde natürlich erheblich von der wirtschaftlichen Expansion vor 1914 und den reformistischen Illusionen, die dadurch erzeugt wurden, begünstigt. Doch es resultierte auch aus der Fähigkeit des Klassenfeindes, aus seiner Erfahrung zu lernen. Bismarck führte (zusammen mit seinen Sozialistengesetzen) das System der Sozialversicherungen ein, um die Solidarität unter den ArbeiterInnen durch ihre individuelle Abhängigkeit von dem, was später zum „Wohlfahrtsstaat" werden sollte, zu ersetzen. Und als Bismarcks Versuch scheiterte, die Arbeiterbewegung durch ihre Illegalisierung zu besiegen, änderte die imperialistische Bourgeoisie, die Ende des 19.Jahrhunderts seine Regierung ersetzte, ihre Taktik. Nachdem sie realisiert hatte, dass die Arbeitersolidarität unter Bedingungen der Repression oftmals geradezu aufblüht, zog sie die Sozialistengesetze zurück und lud stattdessen wiederholt die Sozialdemokratie dazu ein, „konstruktiv (...) am politischen Leben (d.h. an der Leitung des Staates) teilzunehmen", ja beschuldigte sie der„sektiererischen" Entsagung der „allein praktischen Mittel", um wirkliche Verbesserungen für die ArbeiterInnen zu erreichen.
Lenin wies auf die Verknüpfung zwischen der objektiven und subjektiven Ebene im Verhältnis zu einem anderen entscheidenden Faktor beim Verfall der großen sozialistischen Parteien hin. Dies war die Degradierung des Kampfes für die Befreiung der Menschheit zu einer leeren, tagtäglichen Routine. Er identifizierte drei Strömungen innerhalb der Sozialdemokratie und beleuchtete die zweite unter ihnen - „die zweite Strömung - das sogenannte „Zentrum" -besteht aus Leuten, die zwischen den Sozialchauvinisten und den wirklichen Internationalisten schwanken" (...) „Das „Zentrum" - das sind Leute der Routine, zerfressen von der faulen Legalität, korrumpiert durch die Atmosphäre des Parlamentarismus usw., Beamte, gewöhnt an warme Pöstchen und an „ruhige" Arbeit. Historisch und ökonomisch gesehen vertreten sie keine besondere Schicht, sie sind lediglich eine Erscheinung des Übergangs von der hinter uns liegenden Periode der Arbeiterbewegung, der Periode von 1871 bis1914 - (...) zu einer neuen Periode, die seit dem ersten imperialistischen Weltkrieg, der die Ära der sozialen Revolution eingeleitet hat, objektiv unumgänglich geworden ist"5
Für damalige Marxisten war die „Krise der Sozialdemokratie" nicht etwas, was außerhalb ihres Aktionsradius stand. Sie fühlten sich persönlich verantwortlich für das, was passiert war. Für sie war das Versagen der damaligen Arbeiterbewegung auch ihr eigenes Scheitern. Wie Rosa Luxemburg formulierte: Die Opfer des Krieges liegen auf unserem Gewissen.
Was den Kollaps der sozialistischen Internationale so bemerkenswert macht, ist, dass er nicht in erster Linie das Ergebnis der programmatischen Unzulänglichkeit oder einer falschen Analyse der Weltlage war.
„Nicht an Postulaten, Programmen, Losungen fehlt es dem internationalen Proletariat, sondern an Taten, an wirksamem Widerstand, an der Fähigkeit, den Imperialismus im entscheidenden Moment gerade im Kriege anzugreifen (...)"6
Für Kautsky hatte das Versagen, den Internationalismusaufrechtzuhalten, die Unmöglichkeit bewiesen, ihn tatsächlich zu praktizieren. Seine Schlussfolgerung: die Internationale ist eigentlich ein Instrument des Friedens, die in Kriegszeiten beiseite treten müsse. Für Rosa Luxemburg wie für Lenin war das Fiasko vom August 1914 vor allem das Resultat der Erosion der Ethik einer proletarischen internationalen Solidarität innerhalb ihrer Führung.
„Und dann kam das Unerhörte, das Beispiellose, der 4. August1914. Ob es so kommen mußte? Ein Geschehnis von dieser Tragweite ist gewiß kein Spiel des Zufalls. Es müssen ihm tiefe und weitgreifende objektive Ursachenzugrunde liegen. Aber diese Ursachen können auch in Fehlern der Führerin des Proletariats, der Sozialdemokratie, im Versagen unseres Kampfwillens, unseres Muts, unserer Überzeugungstreue liegen." (ebenda, S. 61)
II. Der Gezeitenwechsel
Der Kollaps der sozialistischen Internationale war ein Ereignis von historischem Rang und eine schreckliche politische Niederlage. Doch es war nicht die entscheidende, d.h. irreversible Niederlage einer ganzen Generation. Ein erstes Anzeichen dafür: die am meisten politisierten Schichtendes Proletariats hielten treu zum proletarischen Internationalismus. Richard Müller, Führer der Gruppe der Revolutionären Obleute, der Fabrikdelegierten in der Metallindustrie, erinnerte sich: „Soweit diese breiten Volkskreise bereits vor dem Krieg unter dem Einfluss der sozialistischen und gewerkschaftlichen Presse zu bestimmten Grundanschauungen über Staat und Gesellschaft erzogen worden waren, zeigte sich, wenn auch zunächst nicht offen, eine direkte Ablehnung der Kriegspropaganda und des Krieges"7 Dies stand in starkem Gegensatz zur Lage in den 1930er Jahren, nach dem Sieg des Stalinismus in Russland und des Faschismus in Deutschland, als die fortgeschrittensten ArbeiterInnen auf das politische Terrain des Nationalismus und der Verteidigung des(imperialistischen) „antifaschistischen" oder „sozialistischen" Vaterlandes gezogen wurden.
Die Vollständigkeit der anfänglichen Kriegsmobilisierung war also kein Beweis für eine schwere Niederlage, sondern eine zeitweilige Überrumpelung der Massen. Diese Mobilisierung wurde von Szenen der Massenhysterie begleitet. Doch diese Ausdrücke dürfen nicht mit einem aktiven Engagement der Bevölkerung verwechselt werden, wie in den Nationalkriegen der revolutionären Bourgeoisien in den Niederlanden und in Frankreich. Die intensive öffentliche Agitation von 1914 wurde zunächst einmal vom Massencharakter der modernen bürgerlichen Gesellschaft und von den beispiellosen Mitteln der Propaganda und Manipulation verursacht, die dem kapitalistischen Staat zur Verfügung stehen. In diesem Sinne war die Hysterie von 1914 nicht ganz neu. In Deutschland wurde dies bereits zurzeit des Deutsch-Französischen Krieges von 1870 beobachtet. Doch durch die Entwicklungen im Charakter der modernen Kriegsführung erhielt sie eine neue Qualität.
Der Irrsinn des imperialistischen Krieges
Es scheint, als habe die Arbeiterbewegung die Kraft des gigantischen politischen, wirtschaftlichen, sozialen und psychologischen Erdbebens unterschätzt, das durch den Weltkrieg ausgelöst wurde. Ereignisse von solch kolossalem Umfang und Gewalt, fern jeder Kontrolle irgendeiner menschlichen Kraft, müssen zwangsläufig extreme Emotionen schüren. Einige Anthropologen glauben, dass der Krieg den Instinkt wecke, das eigene „Reservat" zu verteidigen, etwas, was die Menschheit mit anderen Arten gemeinsam habe. Dies mag der Fall sein oder auch nicht. Sicher ist jedenfalls, dass der moderne Krieg uralte Ängste schürt, die in unserem kollektiven Gedächtnis schlummern, durch Tradition und Kultur über viele Generationen, bewusst oder unbewusst, weitergereicht: die Angst vor dem Tod, dem Verhungern, der Vergewaltigung, Vertreibung, Entbehrung, Versklavung. Die Tatsache, dass die moderne allgemeine imperialistische Kriegführung sich nicht mehr auf Berufssoldaten beschränkt, sondern die gesamte Gesellschaft miteinbezieht und Waffen von beispielloser zerstörerischer Kraft einsetzt, kann die Panik und Instabilität, die sie verursacht, nur steigern. Hinzugefügt werden sollten die tiefen moralischen Folgen. Im Weltkrieg wird nicht nur eine kleine Kaste von Soldaten von der Armee eingezogen, sondern Millionen von Arbeitern, die dazu aufgerufen werden, sich gegenseitig zu töten. Die restliche Gesellschaft, die „Heimatfront", wird dazu angehalten, für denselben Zweck zu arbeiten. In solch einer Situation findet die moralische Grundlage, die jede menschliche Gesellschaft erst möglich macht, keine Anwendung mehr. Wie Rosa Luxemburg sagte: „wie wenn nicht jedes Volk, das zum organisierten Mord auszieht, sich in demselben Augenblick in eine Horde Barbaren verwandelte"8
All dies produzierte in dem Moment, wo der Krieg ausbrach, eine wahrhafte Massenpsychose und eine allgemeine Pogromstimmung. Rosa Luxemburg schilderte, wie sich die Bevölkerungen ganzer Städte in einen verrückt gewordenen Mob verwandelten. Der Keim all der Barbarei des 20.Jahrhunderts, Auschwitz und Hiroshima eingeschlossen, war bereits in diesem Krieg enthalten.
Wie hätte die Arbeiterpartei auf den Kriegsausbruchreagieren sollen? Indem sie den Massenstreik ausrief? Indem sie die Soldaten dazu aufforderte zu desertieren? Unsinn, antwortete Rosa Luxemburg. Die erste Aufgabe von Revolutionären sei es hier, dem zu widerstehen, was Wilhelm Liebknecht einst bezüglich der Erfahrungen aus dem Krieg von 1870 einen Orkan menschlicher Leidenschaften nannte. „...
„Solche Ausbrüche der ‚Volksseele' haben durch ihre ungeheure Elementarkraft etwas Verblüffendes, Betäubendes, Erdrückendes. Man fühlte sich machtlos einer höheren Macht gegenüber - einer richtigen, jeden Zweifel ausschließenden force majeure. Man hat keinen greifbaren Gegner. Es ist wie eine Epidemie - in den Menschen, in der Luft, überall. (...) Aber eine Kleinigkeit war's nicht, damals gegen den Strom zu schwimmen".
1870 schwamm die Sozialdemokratie gegen den Strom. Rosa Luxemburgs Kommentar: „Sie blieben auf dem Posten, und die deutsche Sozialdemokratie zehrte 40 Jahre lang von der moralischen Kraft, die sie damals gegen eine Welt von Feinden aufgeboten hatte." (ebenda, S. 151).9
Und hier kommt sie zum Punkt, zum Herzstück ihrer ganzen Argumentation. „So wäre es auch diesmal gegangen. Im ersten Moment wäre vielleicht nichts anderes erreicht, als dass die Ehre des deutschen Proletariats gerettet war, als dass Tausende und Abertausende Proletarier, die jetzt in den Schützengräben bei Nacht und Nebel umkommen, nicht in dumpfer seelischer Verwirrung, sondern mit dem Lichtfunken im Hirn sterben würden, dass das, was ihnen im Leben das Teuerste war: die Internationale, Völker befreiende Sozialdemokratie kein Trugbild sei. Aber schon als ein mächtiger Dämpfer auf den chauvinistischen Rausch und die Besinnungslosigkeit der Menge hätte die mutige Stimme unserer Partei gewirkt, sie hätte die aufgeklärteren Volkskreise vor dem Delirium bewahrt, hätte den Imperialisten das Geschäft der Volksvergiftung und Volksverdummung erschwert. Gerade der Kreuzzug gegen die Sozialdemokratie hätte die Volksmassen am raschesten ernüchtert. So dann im weiteren Verlaufe des Krieges (...) würde alles Lebendige, Ehrliche, Humane, Fortschrittliche sich um die Fahne der Sozialdemokratie scharen" (ebenda, S.151, 152).
Die Erlangung dieser „enormen moralischen Autorität" ist die erste Aufgabe von Revolutionären im Falle eines Krieges.
Unmöglich für solche wie Kautsky, diese Sorge um die letzten Gedanken der sterbenden Proletarier in Uniform nachzuvollziehen. Für ihn wäre die Provozierung des wütenden Mobs und der staatlichen Repression, sobald der Krieg einmal ausgebrochen war, nichts anderes als eine leere Geste gewesen. Der französische Sozialist Jaurès erklärte einst: Die Internationale verkörperte die ganze moralische Stärke auf der Welt. Nun auf einmal wussten viele ihrer einstigen Führer nicht mehr, dass der Internationalismus keine leere Geste ist, sondern eine Überlebensfrage des Weltsozialismus.
Der Wendepunkt und die Rolle der Revolutionäre
Das Scheitern der sozialistischen Partei führte zu einerwahrhaft dramatischen Situation. Sein erstes Resultat: es ermöglichte eine schier unendliche Fortsetzung des Krieges. Die militärische Strategie der deutschen Bourgeoisie basierte voll und ganz auf der Vermeidung eines Zweifrontenkrieges, auf der Erzielung eines schnellen Sieges über Frankreich, um daraufhin all ihre Kräfte gen Osten zu werfen, um Russland in die Knie zu zwingen. Ihre Strategie gegen die Arbeiterklasse hatte dieselbe Grundlage: sie zu überrumpeln und den Krieg für sich zu entscheiden, bevor Letztere die Zeit hatte, ihre Orientierung wiederzuerlangen.
Ab dem September 1914 (der ersten Schlacht an der Marne) war das Überrennen Frankreichs und damit die ganze Strategie des schnellen Siegesvollständig gescheitert. Nicht nur die deutsche, sondern auch die Weltbourgeoisie war nun in ein Dilemma getappt, dem sie weder ausweichen nochüberwinden konnte. Daraus ergaben sich beispiellose Massaker an Millionen von Soldaten, was selbst vom kapitalistischen Standpunkt aus irrsinnig ist. Das Proletariat selbst war gefangen, ohne jegliche sofortige Perspektive, den Krieg durch eigene Initiative zu beenden. Die Gefahr, die sich somit daraus ergab, war die Zerstörung der bedeutendsten materiellen und kulturellen Vorbedingungen für den Sozialismus: das Proletariat selbst. Revolutionäre verhalten sich zu ihrer Klasse, wie sich ein Teil zum Ganzen verhält. Minderheiten der Klassen können nie die Selbstaktivität und die Kreativität der Massen ersetzen. Doch gibt es Augenblicke in der Geschichte, in denen die Intervention von Revolutionären einen entscheidenden Einfluss haben können. Solche Momente entstehen in einem Prozess hin zur Revolution, wenn die Massen um den Siegkämpfen. Hier ist es entscheidend, der Klasse dabei zu helfen, den richtigen Weg zu finden, die Fallen ihres Feindes zu umgehen, zu vermeiden, zu früh oder zu spät auf ihrem Rendezvous mit der Geschichte zu erscheinen. Doch sie entstehen auch in Momenten der Niederlage, wenn es lebenswichtig ist, die richtigen Lehren zu ziehen. Wir müssen hier jedoch differenzieren. Im Angesichteiner verheerenden Niederlage ist diese Arbeit nur langfristig bedeutsam, indem diese Lehren an künftige Generationen weitergereicht werden. Im Falle der Niederlage von 1914 war der entscheidende Einfluss, den Revolutionäre haben konnten, so unmittelbar wie während der Revolution selbst. Dies nicht nur, weil die erlittene Niederlage keine definitive war, sondern auch aufgrund der Bedingungen eines Weltkrieges, welche, indem sie den Klassenkampf fastbuchstäblich zu einer Überlebensfrage machten, eine außerordentliche Beschleunigung der Politisierung provozierten.
Angesichts des Kriegselends war es unvermeidbar, dass der wirtschaftliche Klassenkampf sich weiterentwickelte und unvermittelt einen offenpolitischen Charakter annahm. Doch die Revolutionäre konnten sich nicht damit zufrieden geben, darauf zu warten, was passiert. Die Orientierung der Klasse war, wie wir gesehen haben, vor allen Dingen das Ergebnis der Unterlassung ihrer politischen Führung. Es lag somit in der Verantwortung aller verbliebenen Revolutionäre innerhalb der Arbeiterbewegung, den Gezeitenwechsel zuinitiieren. Noch vor den Streiks an der „Heimatfront", noch vor den Revolten der Soldaten in den Schützengräben mussten die Revolutionäre hinausgehen und das Prinzip der internationalen Solidarität des Proletariats bekräftigen.
Sie begannen mit dieser Arbeit im Parlament, wo sie den Krieg anprangerten und gegen die Kriegskredite stimmten. Dies war das letzte Mal, dass diese Tribüne für revolutionäre Anliegen benutzt werden konnte. Doch war dies von Anfang an von illegaler revolutionärer Propaganda und Agitation sowie von der Beteiligung an den ersten Brotdemonstrationen begleitet. Doch die alles überragende Aufgabe der Revolutionäre war es noch immer, sich selbst zuorganisieren, um ihren Standpunkt zu klären, und vor allem den Kontakt zu anderen Revolutionären im Ausland wiederherzustellen, um die Gründung einerneuen Internationale vorzubereiten. Am 1. Mai 1916 fühlte sich jedoch der Spartakusbund, der Kern der künftigen Kommunistischen Partei, erstmals stark genug, um auf den Straßen offene und massive Präsenz zu zeigen. Es war der Tag, an dem die Arbeiterbewegung traditionellerweise ihre internationale Solidarität feiert. Der Spartakusbund rief zu Demonstrationen in Dresden, Jena, Hanau, Brunswick und vor allem in Berlin auf. Dort erschienen 10.000 Menschen auf dem Potsdamer Platz, um Liebknecht zu hören, der den imperialistischen Krieg anprangerte. Bei dem vergeblichen Versuch, ihn vor einer Festnahme zu schützen, kam es zu einer Straßenschlacht.
Die Proteste am 1. Mai auf dem Potsdamer Platz raubten der internationalistischen Opposition ihren bekanntesten Führer. Andere Inhaftierungen folgten. Liebknecht wurde beschuldigt, unverantwortlich gehandelt zu haben, ja beabsichtigt zu haben, seine Person ins Rampenlicht zustellen. In Wahrheit wurde seine Aktion am Maitag kollektiv von der Führung des Spartakusbundes beschlossen. Es trifft zu, dass der Marxismus leere Gesten wie den Terrorismus oder das Abenteurertum kritisiert. Worauf es ankommt, ist die kollektive Tat der Massen. Doch die Geste von Liebknecht war mehr als ein Akt des individuellen Heldentums. Sie verkörperte die Hoffnungen und Bestrebungen von Millionen von ProletarierInnen angesichts des Irrsinns der bürgerlichen Gesellschaft. Wie Rosa Luxemburg später schreiben sollte:
„Vergessen wir aber nicht: Weltgeschichte wird nicht gemacht ohne geistige Größe, ohne sittliches Pathos, ohne edle Geste"10
Dieser großartige Geist breitete sich rasch vom Spartakusbund auf die Metallarbeiter aus. 27. Juni 1916, Berlin, Höhepunkt des Prozesses gegen Karl Liebknecht, der wegen öffentlicher Agitation gegen den Krieg festgenommen worden war. Ein Treffen von Fabrikdelegierten wurde verschoben, es sollte nun nach der illegalen Protestdemonstration, zu der der Spartakusbund auf gerufen hatte, stattfinden. Auf der Tagesordnung: Solidarität mit Liebknecht. Gegen den Widerstand von Georg Ledebour, der einzige Repräsentant der Oppositionsgruppe innerhalb der Sozialdemokratischen Partei, wurden für den nächsten Tag weitere Aktionen vorgeschlagen. Es gab keine Diskussion. Jeder stand auf und ging schweigend.
Am nächsten Morgen schalteten um neun Uhr früh die Dreher ihre Maschinen in den großen Waffenfabriken des deutschen Kapitals ab. 55.000 Arbeiter von Löwe, AEG, Borsig, Schwartzkopf legten ihr Werkzeug nieder und versammelten sich außerhalb der Fabriktore. Trotz Militärzensur verbreiteten sich die Neuigkeiten wie ein Lauffeuer überall im Reich: die Rüstungsarbeiter aus Solidarität mit Liebknecht auf der Straße! Wie sich herausstellte, nicht nur in Berlin, sondern auch in Brunswick, auf den Schiffswerften in Bremen, etc. Selbst in Russland gab es Solidaritätsaktionen.
Die Bourgeoisie schickte Tausende von Streikenden an die Front. Die Gewerkschaften starteten auf ihrer Suche nach den „Rädelsführern" eine Hexenjagd in den Fabriken. Doch kaum einer von ihnen wurden eingesperrt, so groß war die Solidarität der ArbeiterInnen. Internationalistische proletarische Solidarität gegen imperialistischen Krieg: dies war der Beginn der Weltrevolution, der erste politische Massenstreik in der Geschichte Deutschlands.
Doch noch schneller griff die Flamme, die auf dem Potsdamer Platz entzündet wurde, auf die revolutionäre Jugend über. Inspiriert vom Beispiel ihrer politischen Führer, löste diese Jugend noch vor den erfahrenen Metallarbeitern den ersten großen Streik gegen den Krieg aus. In Magdeburg und vor allem in Brunswick, das eine Bastion von Spartakus war, eskalierten die illegalen Maiproteste zu einer offenen Streikbewegung gegen die Entscheidung der Regierung, einen Teil der Löhne für die Auszubildenden und JungarbeiterInnen auf ein Zwangskonto zu überweisen, das zur Finanzierung der Kriegsanstrengungen benutzt werden sollte. Die erwachsenen ArbeiterInnen kamen zur Unterstützung heraus. Am 5. Mai bliesen die Militärführer diesen Angriff ab, um eine weitere Ausdehnung der Bewegung zu verhindern.
Nach der Schlacht von Jütland 1916, der ersten und einzigen wichtigen Konfrontation zwischen der britischen und der deutschen Marine im gesamten Krieg, plante eine kleine Gruppe von revolutionären Matrosen, das Schlachtschiff „Hyäne" zu übernehmen und nach Dänemark zu bringen, als eine„Demonstration für die gesamte Welt" gegen den Krieg.11 Obgleich diese Pläne denunziert und durchkreuzt wurden, kündigten sie die ersten offenen Revolten in der Kriegsmarine an, die Anfang August 1917 folgten. Sie entzündeten sich um Fragen, die die Behandlung und die Bedingungen der Mannschaften betrafen. Doch bald schickten die Matrosen ein Ultimatum an die Regierung: Entweder beendet diese den Krieg, oder wir treten in den Streik. Der Staat antwortete mit einer Welle der Repression. Zwei der revolutionären Anführer, Albin Köbis und Max Reichpietsch, wurden hingerichtet.
Doch schon Mitte April 1917 hatte eine Welle von Massenstreiks in Berlin, Leipzig, Magdeburg, Halle, Brunswick, Hannover, Dresden und in anderen Städten stattgefunden. Obwohl die Gewerkschaften und die SPD-Führung, die es nicht mehr wagten, sich der Bewegung offen entgegenzusetzen, versuchten, sie auf wirtschaftliche Fragen zu begrenzen, formulierten die ArbeiterInnen in Leipzig eine Reihe von politischen Forderungen - insbesondere die Forderung nach Beendigung des Krieges -, die in anderen Städten aufgenommen wurden.
Somit waren zu Beginn des Jahres 1918 die Zutaten einerbreiten revolutionären Bewegung gegeben. Die Streikwelle vom April 1917 war die erste Massenintervention von Hunderttausenden von ArbeiterInnen quer durchs ganze Land, die ihre materiellen Interessen auf einem Klassenterrainverteidigten und sich dem imperialistischen Krieg offen widersetzten. Gleichzeitig war diese Bewegung vom Beginn der russischen Februarrevolution1917 inspiriert worden und erklärte offen ihre Solidarität mit ihr. Der proletarische Internationalismus hatte die Herzen der Arbeiterklasse erfasst.
Andererseits hatte das Proletariat mit der Bewegung gegen den Krieg wieder begonnen, seine eigene revolutionäre Führung zu schaffen. Damit meinen wir nicht nur die politischen Gruppen wie den Spartakusbund oder die Bremer Linken, die dazu übergingen, Ende des Jahres 1918 die KPD zugründen. Wir meinen damit auch das Auftreten von hochpolitisierten Schichten und Zentren des Lebens und Kampfes der Klasse, die mit den Revolutionärenverknüpft waren und mit ihren Positionen sympathisierten. Eines dieser Zentren war in den Industriestädten, insbesondere im Metallsektor, anzutreffen, dass ich an dem Phänomen der Obleute, den Fabrikdelegierten, kristallisierte: „Innerhalb der Industriearbeiterschaft befand sich ein kleiner Kern von Proletariern, die den Krieg nicht nur als solchen ablehnten, sondern auch willens waren, seinen Ausbruch mit allen Mitteln zu verhindern; und als der Krieg zur Tatsache geworden, hielten sie es für ihre Pflicht, mit allen Mitteln sein Ende herbeizuführen. Die Zahl war klein, um so entschlossener und rühriger waren die Personen. Hier fand sich das Gegenstück zu jenen, die an die Front zogen, um für ihre Ideale das Leben zu opfern. Der Kampf gegen den Krieg in Fabriken und Büros war zwar nicht so ruhmreich, wie der Kampf an der Front, aber mit gleichen Gefahren verbunden. Die den Kampf aufnahmen und führten, suchten die höchsten Menschheitsideale zu verwirklichen"12
Ein anderes Zentrum fand sich in der neuen Generation von ArbeiterInnen an, den Lehrlingen und JungarbeiterInnen, die keine andere Perspektive vor sich sahen, als zum Sterben in die Schützengräben geschickt zu werden. Der Kern dieses Gärungsprozesses befand sich in den sozialistischen Jugendorganisationen, die sich bereits vor dem Krieg durch die Revolte gegen die „Routine" auszeichneten, welche im Begriff war, die ältere Generation zu kennzeichnen.
Auch innerhalb der bewaffneten Kräfte, wo die Revolte gegen den Krieg viel länger als an der „Heimatfront" benötigte, um sich zu entwickeln, war ein politischer Vorposten etabliert worden. Wie in Russland entstand dieses politische Widerstandszentrum unter den Matrosen, die eine direkte Verbindung zu den ArbeiterInnen und den politischen Organisationen in ihren Heimathäfen hatten und deren Jobs und Bedingungen in jeder Weise jenen der FabrikarbeiterInnen ähnelten, von denen sie im allgemeinen herstammten. Darüber hinaus wurden viele von ihnen aus der „zivilen" Handelsflotte rekrutiert, junge Männer, die die ganze Welt bereist haben und für welche die internationale Brüderlichkeit nicht eine Phrase, sondern eine Lebensweise war.
Ferner war das Aufkommen und die Vervielfältigung dieser Konzentrationen von politischem Leben von einer intensiven theoretischen Tätigkeit geprägt. Alle Augenzeugenberichte aus dieser Periode betonen das außerordentlich hohe Niveau der Debatten auf den verschiedenen illegalen Treffen und Konferenzen. Dieses theoretische Leben fand seinen Ausdruck in Rosa Luxemburgs „Krise der Sozialdemokratie", in Lenins Schriften gegen den Krieg, in den Artikeln der Zeitschrift Arbeiterpolitik in Bremen, aber auch in der großen Anzahl von Flugblättern und Deklarationen, die in strengster Illegalität zirkulierten und zu den scharfsinnigsten und mutigsten Produkten der menschlichen Kultur zählen, die das 20. Jahrhundert emporgebracht hat.
Die Bühne war frei für den revolutionären Ansturm gegen eine der stärksten und wichtigsten Bastionen des Weltkapitalismus.
Steinklopfer
1 Beschluss des Mannheimer Parteikongresses von 1906.
2 In seinen Memoiren über die proletarische Jugendbewegung rief Willi Münzenberg, der sich während des Krieges in Zürich aufhielt, Lenins Standpunkt in Erinnerung: „Durch Lenin lernten wir die Fehler des von Kautsky und seiner theoretischen Schule verfälschten Marxismus kennen, der alles von der historischen Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse und fast nichts von den subjektiven Kräften zur Beschleunigung der Revolution erwartete. Im Gegensatz dazu betonte Lenin die Bedeutung des Individuums und der Masse im historischen Prozess und stellte die marxistische These in den Vordergrund, dass die Menschen im Rahmen der wirtschaftlich gegebenen Verhältnisse ihre Geschichte selbst machen. Diese Betonung des persönlichen Wertes der einzelnen Menschen und Gruppen in den gesellschaftlichen Kämpfen machte auf uns den größten Eindruck und spornte uns zu den denkbar stärksten Leistungen an" (Münzenberg, Die dritte Front, S. 230).
3„Die Krise der Sozialdemokratie", Luxemburg-Werke Bd4, S. 61, 62.
4 Während sie gegen Bernstein richtigerweise die Realität der Tendenzen zum Verschwinden der Mittelschichten und zur Krise und Pauperisierung des Proletariats vertrat, scheiterte die Linke jedoch daran, das Ausmaß zu erkennen, in dem der Kapitalismus in den Jahren vor dem I. Weltkrieg diese Tendenzen zeitweilig abzuschwächen in der Lage gewesen war. Dieser Mangel an Klarheit drückte sich in Lenins Theorie der„Arbeiteraristokratie" aus, der gemäß nur eine privilegierte Minderheit substanzielle Lohnerhöhungen über einen längeren Zeitraum hinweg erlangt hatte, nicht aber die breiten Massen der Klasse. Dies führte zur Unterschätzung der Bedeutung der materiellen Grundlage für die reformistischen Illusionen, die der Bourgeoisie halfen, das Proletariat für den Krieg zu mobilisieren.
5 Lenin, Die Aufgaben des Proletariats in unserer Revolution, Lenin Bd. 24., S. 61,62
6 Luxemburg, Die Krise der Sozialdemokratie(Junius-Broschüre), Januar 1916, ebenda, S. 159.
7 Richard Müller, Vom Kaiserreich zur Republik, S.32, Teil 1 der Trilogie von Müller über die Geschichte der Deutschen Revolution.
8 Ebenda, S. 162.
9 Ebenda, S. 317f.
10 Rosa Luxemburg, Eine Ehrenpflicht, Bd. 4, S. 406,November 1918,
11 Dieter Nelles, Proletarische Demokratie und internationale Bruderschaft - Das abenteuerliche Leben des Hermann Knüfken, S.1, https://www [152]. Anarchismus.at/txt5/nellesknuefken.htm
12 Müller, ebenda, S. 33.
Aktuelles und Laufendes:
Leute:
- Liebknecht [154]
- Luxemburg [155]
- Jogiches [156]
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Historische Ereignisse:
- Deutschland 1918- 1919 [157]
- Deutschland 1. Weltkrieg [158]
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Theoretische Fragen:
- Internationalismus [69]
Erbe der kommunistischen Linke:
Deutschland 1918 – 19, Teil 2 Vom Krieg zur Revolution
- 3743 reads
Im ersten Teil dieser Artikelreihe zum 90. Jahrestag des revolutionären Anlaufs des deutschen Proletariats untersuchten wir den welthistorischen Kontext, in dem sich die Revolution entfaltete. Dieser Kontext war die Katastrophe des I. Weltkrieges und das Scheitern der Arbeiterklasse und ihrer politischen Führung, diesen Ausbruch zu verhindern. Obgleich die frühen Jahre des 20. Jahrhunderts von ersten Manifestationen einer allgemeinen Tendenz
Im ersten Teil dieser Artikelreihe zum 90. Jahrestag des revolutionären Anlaufs des deutschen Proletariats untersuchten wir den welthistorischen Kontext, in dem sich die Revolution entfaltete. Dieser Kontext war die Katastrophe des I. Weltkrieges und das Scheitern der Arbeiterklasse und ihrer politischen Führung, diesen Ausbruch zu verhindern. Obgleich die frühen Jahre des 20. Jahrhunderts von ersten Manifestationen einer allgemeinen Tendenz zur Entwicklung von Massenstreiks gekennzeichnet waren, waren diese Bewegungen, abgesehen von Russland, noch nicht mächtig genug, um das Gewicht der reformistischen Illusionen zu untergraben. Was die organisierte internationalistische Arbeiterbewegung angeht, so stellte sie sich als theoretisch, organisatorisch und moralisch unvorbereitet gegenüber dem Weltkrieg dar, den sie lange zuvor vorausgesagt hatte. Als Gefangene ihrer eigenen Schemata der Vergangenheit, denen zufolge die proletarische Revolution ein mehr oder weniger unvermeidbares Produkt der wirtschaftlichen Entwicklung des Kapitalismus sei, hatten sie sich als eine Art zweite Natur die Behauptung zu Eigen machen, dass es die vorrangige Aufgabe der Sozialisten sei, verfrühte Konfrontationen zu vermeiden und passiv die Reifung der objektiven Bedingungen abzuwarten. Abgesehen von ihrer revolutionären linken Opposition scheiterte – oder weigerte sich – die Sozialistische Internationale, die Konsequenzen aus der Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, dass der erste Akt in der Niedergangsepoche des Kapitalismus ein Weltkrieg statt einer Wirtschaftskrise ist. Vor allem unterschätzte die Internationale, indem sie die Zeichen der Zeit, die Dringlichkeit der sich nähernden Alternative zwischen Sozialismus oder Barbarei, ignorierte, vollkommen den subjektiven Faktor in der Geschichte, insbesondere ihre eigene Rolle und Verantwortung. Das Resultat war der Bankrott der Internationale im Angesicht des Kriegsausbruchs und die chauvinistische Ekstase von Teilen ihrer Führung, insbesondere der Gewerkschaften. Die Bedingungen für den ersten Versuch einer weltweiten proletarischen Revolution wurden also von dem relativ plötzlichen, handstreichartigen Abstieg des Kapitalismus in seine Dekadenzphase, in den imperialistischen Weltkrieg bestimmt, aber auch von einer beispiellosen, katastrophalen Krise der Arbeiterbewegung. Es wurde bald deutlich, dass es keine revolutionäre Antwort auf den Krieg geben konnte ohne die Wiederbelebung der Überzeugung, dass der proletarische Internationalismus keine taktische Frage ist, sondern das „heiligste“ Prinzip des Sozialismus, das einzige „Vaterland“ der Arbeiterklasse (wie Rosa Luxemburg sagte). Wir sahen im vorhergegangenen Artikel, dass Karl Liebknechts öffentliche Erklärung gegen den Krieg am 1. Mai 1916 in Berlin so wie auch die internationalistischen Konferenzen wie jene in Zimmerwald und Kienthal und die weitverbreiteten Gefühle der Solidarität, die sie weckten, unerlässliche Wendepunkte auf dem Weg zur Revolution waren. Angesichts der Schrecken des Krieges in den Schützengräben und der Verarmung und intensivierten Ausbeutung der Arbeitermassen an der „Heimatfront“, die mit einem Schlag all die Errungenschaften von Jahrzehnten des Arbeiterkampfes wegwischten, sahen wir die Entwicklung von Massenstreiks und die Reifung von politisierten Schichten und Zentren der Arbeiterklasse, die in der Lage waren, einen revolutionären Sturm anzuführen. Die Verantwortung des Proletariats, den Krieg zu beendenDie Ursachen für das Scheitern der sozialistischen Bewegung angesichts des Krieges zu verstehen war somit das Hauptanliegen des vorherigen Artikels und auch eine wichtige Beschäftigung der Revolutionäre während der ersten Kriegsphase. Dies wird deutlich in Die Krise der Sozialdemokratie ausgedrückt, der sog. Junius-Broschüre von Rosa Luxemburg. Im Mittelpunkt der Ereignisse, mit denen sich dieser zweite Artikel befasst, finden wir eine zweite entscheidende Frage, eine Konsequenz aus der ersten: Welche gesellschaftliche Kraft bringt den Krieg zu einem Ende und auf welche Weise? Richard Müller, eine der Führer der „revolutionären Obleute“ in Berlin und später ein wichtiger Historiker der Revolution in Deutschland, formulierte die Verantwortung der Revolution damit, was sie verhindern soll: „Es war der Untergang der Kultur, die Vernichtung des Proletariats und der sozialistischen Bewegung überhaupt.“ [1]Wie so oft war es Rosa Luxemburg, die die welthistorische Frage damals am deutlichsten stellte: „Was nach dem Kriege sein wird, welche Zustände und welche Rolle die Arbeiterklasse erwarten, das hängt ganz davon ab, in welcher Weise der Friede zustande kommt. Erfolgt er bloß aus schließlicher allseitiger Erschöpfung der Militärmächte oder gar – was das Schlimmste wäre – durch den militärischen Sieg einer der kämpfenden Parteien, erfolgt er mit einem Worte ohne Zutun des Proletariats, bei völliger Ruhe im Innern des Staates, dann bedeutet ein solcher Frieden nur die Besiegelung der weltgeschichtlichen Niederlage des Sozialismus im Krieg (...) Nach dem Bankrott des 4. August 1914 ist also jetzt die zweite entscheidende Probe für den historischen Beruf der Arbeiterklasse: ob sie verstehen wird, den Krieg, dessen Ausbruch sie nicht verhindert hat, zu beenden, den Frieden nicht aus den Händen der imperialistischen Bourgeoisie als Werk der Kabinettdiplomatie zu empfangen, sondern ihn der Bourgeoisie aufzuzwingen, ihn zu erkämpfen.“[2]Hier beschreibt Rosa Luxemburg drei mögliche Szenarien, wie der Krieg ein Ende findet. Das erste ist der Ruin und die Erschöpfung der kriegführenden imperialistischen Parteien auf beiden Seiten. Hier erkennt sie von Anfang an die potenzielle Sackgasse der kapitalistischen Konkurrenz in der Epoche ihres historischen Niedergangs, die zu einem Prozess der Verrottung und Auflösung führen kann – wenn das Proletariat nicht in der Lage sein sollte, seine eigene Lösung durchzusetzen. Diese Tendenz zum Zerfall der kapitalistischen Gesellschaft sollte sich nur einige Jahrzehnte später völlig manifestieren, mit der „Implosion“ des von Russland angeführten Blocks und der stalinistischen Regimes 1989 sowie dem darauffolgenden Niedergang der Führerschaft der verbleibenden US-amerikanischen Supermacht. Sie realisierte bereits, dass solch eine Dynamik für sich genommen nicht günstig ist für die Entwicklung einer revolutionären Alternative. Das zweite Szenario besteht darin, dass der Krieg bis zum bitteren Ende ausgefochten wird und in einer totalen Niederlage einer der beiden sich gegenüberstehenden Blöcke endet. In diesem Fall wäre das wichtigste Ergebnis die unvermeidliche Spaltung innerhalb des siegreichen Lagers, die eine neue Front für einen zweiten, noch zerstörerischen Weltkrieg eröffnen würde, dem sich die Arbeiterklasse noch weniger entgegenstellen könnte. In beiden Fällen wäre das Resultat nicht eine momentane, sondern eine welthistorische Niederlage des Sozialismus zumindest für eine Generation, die langfristig die eigentliche Möglichkeit einer proletarischen Alternative zur kapitalistischen Barbarei untergraben könnte. Die damaligen Revolutionäre verstanden bereits, dass der „Große Krieg“ einen Prozess eingeleitet hatte, der das Potenzial hat, das Vertrauen der Arbeiterklasse in ihre eigene historische Mission zu unterminieren. Als solches bildet die „Krise der Sozialdemokratie“ eine Krise der menschlichen Gattung an sich, da nur das Proletariat innerhalb des Kapitalismus Geburtshelfer einer alternativen Gesellschaft ist. Die Russische Revolution und der Massenstreik im Januar 1918Was heißt es, den imperialistischen Krieg durch revolutionäre Mittel zu beenden? Die Augen der wahren Sozialisten der ganzen Welt richteten sich auf Deutschland, um diese Frage zu beantworten. Deutschland war die größte Wirtschaftsmacht in Kontinentaleuropa, der Führer – tatsächlich die einzige Großmacht – des einen der beiden konkurrierenden imperialistischen Blöcke. Und es war das Land mit der größten Anzahl von gebildeten, sozialistisch trainierten, klassenbewussten Arbeitern, die sich im Verlaufe des Krieges in wachsendem Maße für die Sache der internationalistischen Solidarität einsetzten. Doch die proletarische Bewegung ist von ihrem Wesen her international. Die erste Antwort auf die o.g. Frage wurde nicht in Deutschland, sondern in Russland gegeben. Die Russische Revolution von 1917 war ein Wendepunkt in der Weltgeschichte. Sie half auch die Situation in Deutschland umzuwandeln. Bis Februar 1917, dem Beginn der Erhebung in Russland, war es das Ziel der klassenbewussten deutschen Arbeiter, den Kampf bis zu einem Umfang auszuweiten, der die Regierungen dazu zwingt, den Frieden herbeizuführen. Selbst innerhalb des Spartakusbundes[3] zum Zeitpunkt seiner Gründung am Neujahrstag 1916 hatte niemand an die Möglichkeit einer direkten Revolution geglaubt. Doch im Lichte der russischen Erfahrungen waren ab April 1917 die klandestinen revolutionären Zirkel in Berlin und Hamburg zur Schlussfolgerung gelangt, dass das Ziel nicht nur darin bestand, den Krieg zu beenden, sondern auch darin, dabei gleich auch das gesamte Regime zu stürzen. Bald klärte der Sieg der Revolution in Petrograd und Moskau im Oktober 1917 für diese Zirkel in Berlin und Hamburg weniger das Ziel als vielmehr die Mittel zu diesem Zweck: bewaffneter Aufstand, von den Arbeiterräten organisiert und angeführt. Paradoxerweise bewirkte der Rote Oktober in den breiten Massen in Deutschland unmittelbar so ziemlich das Gegenteil. Eine Art unschuldige Euphorie über das Nahen des Friedens brach aus, gestützt auf der Annahme, dass die deutsche Regierung nichts anderes machen könne, als in die Hand des „Friedens ohne Annexionen“ einzuschlagen, die vom Osten ausgestreckt wurde. Diese Reaktion zeigt, in welchem Umfang die Propaganda der zur „sozialistischen“ kriegstreiberischen Partei gewordenen SPD – dass der Krieg einem sich sträubenden Deutschland aufgehalst wurde -, immer noch Einfluss ausübte. Was die Volksmassen betraf, so kam der Wendepunkt in der Haltung gegenüber dem Krieg, der von der Russischen Revolution ausgelöst wurde, erst drei Monate später mit den Friedensverhandlungen zwischen Deutschland und Russland in Brest-Litowsk.[4] Diese Verhandlungen wurden von den Arbeitern in ganz Deutschland und im österreichisch-ungarischen Reich intensiv verfolgt. Das Resultat – das imperialistische Diktat Deutschlands und seine Besetzung großer Teile der westlichen Gebiete der späteren Sowjetrepublik, wobei es die dortigen im Gange befindlichen revolutionären Bewegungen grausam unterdrückte – überzeugte Millionen von der Richtigkeit des Schlachtrufs von Spartakus: Der Feind sitzt im „eigenen Land“, es ist das kapitalistische System selbst. Brest verhalf einem gigantischen Massenstreik zum Leben, der in Österreich-Ungarn begann, mit seinem Zentrum in Wien. Er breitete sich sofort auf Deutschland aus und lähmte das Wirtschaftsleben in über zwanzig größeren Städten, mit einer halben Million Streikenden in Berlin. Die Forderungen waren dieselben wie die der Sowjetdelegation in Brest: sofortige Beendigung des Krieges, keine Annexionen. Die Arbeiter organisierten sich selbst mittels eines Systems gewählter Delegationen, die größtenteils den konkreten Vorschlägen eines Flugblatts des Spartakusbundes folgten, welche die Lehren aus Russland zogen. Der Augenzeugenbericht der SPD-Tageszeitung Vorwärts, für die Ausgabe vom 28. Januar 1918 verfasst, schilderte, wie die Straßen an jenem Morgen erst wie ausgestorben wirkten und in Nebel gehüllt waren, so dass die Umrisse der Gebäude, ja der ganzen Welt vage und verzerrt erschienen. Als die Massen in stiller Entschlossenheit auf die Straßen gingen, kam die Sonne hervor und vertrieb den Nebel, schrieb der Reporter.
Spaltungen und Divergenzen innerhalb der Streikführung
This strike gave rise to a debate within the revolutionary leadership about the immediate goals of the movement, but which increasingly touched the very heart of the question of how the proletariat could end the war. The main centre of gravity of this leadership lay at the time within the left wing of the social-democracy which, after being excluded from the SPD[5] because of its opposition to the war, formed a new party, the USPD (the "Independent" SPD). This party, which brought together most of the well known opponents to the betrayal of internationalism by the SPD - including many hesitant and wavering, more petty bourgeois than proletarian elements - also included a radical revolutionary opposition of its own, the Spartakusbund: a fraction with its own structure and platform. Already in the summer and autumn of 1917 the Spartakusbund and other currents within the USPD began to call for protest demonstrations in response to mass discontent and growing enthusiasm for the revolution in Russia. This orientation was opposed by the Obleute, the "revolutionary delegates" in the factories, whose influence was particularly strong in the armaments industry in Berlin. Pointing to the masses' illusions about the "will for peace" of the German government, these circles wanted to wait until discontent became more intense and generalised, and then give it expression in a single, unified mass action. When, during the first days of 1918, calls for a mass strike from factories all over Germany were reaching Berlin, the Obleute decided not to invite the Spartakusbund to the meetings where this central mass action was prepared and decided on. They feared that what they called the "activism" and "precipitation" of Spartakus - which in their eyes had become dominant in this group since its main theoretical mind, Rosa Luxemburg, had been sent to prison - could constitute a danger to the launching of a unified action throughout Germany. When the Spartakists found out about this, they launched a summons to struggle of their own, without waiting for the decision of the Obleute.
This mutual distrust then intensified in relation to the attitude to be adopted towards the SPD. When the trade unions discovered that a secret strike leadership committee had been constituted, which did not contain a single member of the SPD, the latter immediately began to clamour for representation. On the eve of the January 28 strike action, the majority at a clandestine meeting of factory delegates in Berlin voted against this. Nevertheless, the Obleute, who dominated the strike committee, decided to admit delegates of the SPD, arguing that the social-democrats were no longer in a position to prevent the strike, but that their exclusion would create a note of discord and thus undermine the unity of the coming action. Spartakus strongly condemned this decision.
The debate then came to a head in the course of the strike itself. In face of the elementary might of this action, the Spartakusbund began to plead for the intensification of the movement in the direction of civil war. The group believed that the moment might already have come to end the war by revolutionary means. The Obleute strongly opposed this, preferring to take responsibility themselves for an organised ending of the movement, once it had reached what they considered to be its culmination point. Their main arguments were that an insurrectional movement, even were it to succeed, would remain restricted to Berlin, and that the soldiers had not yet been won over to the side of the revolution.
Der Platz Russlands und Deutschlands in der Weltrevolution
Hinter diesem Streit über die Taktik steckten zwei allgemeinere und tiefergehende Fragen. Eine von ihnen betraf die Kriterien, um über die Reife der Bedingungen für einen revolutionären Aufstand zu urteilen. Wir werden im Verlauf dieser Reihe auf die Frage zurückkommen. Die andere bezog sich auf die Rolle des russischen Proletariats in der Weltrevolution. Konnte der Sturz der bürgerlichen Herrschaft in Russland sofort eine revolutionäre Erhebung in Mittel- und Westeuropa anregen oder zumindest die imperialistischen Hauptprotagonisten dazu zwingen, den Krieg zu beenden? Genau dieselbe Diskussion fand auch in der bolschewistischen Partei in Russland statt, sowohl am Vorabend des Oktoberaufstandes als auch anlässlich der Friedensverhandlungen mit der deutschen Reichsregierung in Brest-Litowsk. Innerhalb der bolschewistischen Partei argumentierten die von Bucharin angeführten Gegner jeglicher Vertragsunterzeichnung mit Deutschland, dass das Hauptmotiv des Proletariats, im Oktober 1917 die Macht in Russland zu ergreifen, darin bestand, die Revolution in Deutschland und im Westen loszutreten, und dass die Unterzeichnung eines Vertrages mit Deutschland nun gleichbedeutend mit der Abkehr von dieser Orientierung sei. Trotzki nahm eine Zwischenposition ein, um Zeit zu schinden, was das Problem auch nicht wirklich löste. Die Befürworter der Notwendigkeit der Unterzeichnung eines Vertrages, wie Lenin, stellten keineswegs die internationalistische Motivierung des Oktoberaufstandes in Frage. Was sie bezweifelten, war, dass die Entscheidung, die Macht zu ergreifen, sich auf der Annahme stützte, dass die Revolution sofort auf Deutschland übergreifen werde. Im Gegenteil: die Befürworter des Aufstandes hatten damals darauf hingewiesen, dass die unmittelbare Ausdehnung der Revolution nicht gewiss war und dass das russische Proletariat somit Isolation und beispiellose Leiden riskiert, wenn es die Initiative ergreift und die Weltrevolution beginnt. Solch ein Risiko war jedoch, wie insbesondere Lenin argumentierte, gerechtfertigt, weil das, was auf dem Spiel stand, die Zukunft nicht nur des russischen, sondern auch des Weltproletariats war; die Zukunft nicht nur des Proletariats, sondern der gesamten Menschheit. Diese Entscheidung sollte daher in vollem Bewusstsein und in verantwortlichster Weise getroffen werden. Lenin wiederholte diese Argumente auch in Bezug auf Brest: Das russische Proletariat war moralisch berechtigt, selbst den ungünstigsten Vertrag mit der deutschen Bourgeoisie zu unterzeichnen, um Zeit zu gewinnen, da es nicht sicher war, ob die deutsche Revolution sofort beginnen wird. Isoliert in ihrer Gefängniszelle vom Rest der Welt, intervenierte Rosa Luxemburg in dieser Debatte mit drei Artikeln – „Die historische Verantwortung“, „In die Katastrophe“ und „Die russische Tragödie“; geschrieben im Januar, Juni und September in dieser Reihenfolge -, die drei der wichtigsten berühmten „Spartakusbriefe“ aus dem Untergrund. Hier macht sie klar, dass weder die Bolschewiki noch das russische Proletariat wegen der Tatsache angeklagt werden dürfen, dass sie gezwungen wurden, einen Vertrag mit dem deutschen Imperialismus zu unterzeichnen. Diese Situation war das Resultat der Abwesenheit der Revolution anderswo, besonders aber in Deutschland. Auf dieser Grundlage war sie in der Lage, das folgende tragische Paradoxon zu identifizieren: Obwohl die Russische Revolution der höchste Punkt war, den die Menschheit bis dahin jemals erklommen hatte, und als solcher ein historischer Wendepunkt war, bestanden ihre unmittelbaren Auswirkungen nicht darin, die Schrecken des Weltkrieges zu verkürzen, sondern zu verlängern. Und dies aus dem einfachen Grund, dass sie den deutschen Imperialismus von dem Zwang befreite, einen Zweifrontenkrieg zu führen. Wenn Trotzki an die Möglichkeit eines Sofortfriedens unter dem Druck der Massen im Westen glaubt, so schreibt sie im Januar 1918, „dann muss allerdings in Trotzkis schäumenden Wein viel Wasser gegossen werden.“ Und sie fährt fort: „Die nächste Wirkung des Waffenstillstandes im Osten wird nur die sein, daß deutsche Truppen vom Osten nach dem Westen dirigiert werden. Vielmehr, sie sind es schon.“[6] Im Juni zog sie eine zweite Schlussfolgerung aus dieser Dynamik: Deutschland war zum Gendarm der Konterrevolution in Osteuropa geworden und massakrierte die revolutionären Kräfte von Finnland bis zur Ukraine. Wie gelähmt durch diese Entwicklung, hatte sich das Proletariat „tot gestellt.“. Im September 1918 erläutert sie dann, dass die Welt damit droht, das revolutionäre Russland selbst zu verschlingen. „Der eherne Ring des Weltkrieges, der damit im Osten durchbrochen schien, schließt sich wieder um Rußland und um die Welt lückenlos: Die Entente rückt mit Tschechoslowakei und Japanern vom Norden und Osten her – eine natürliche, unvermeidliche Folge des Vorrückens Deutschland vom Westen und vom Süden aus. Die Flammen des Weltkrieges züngeln auf russischen Boden hinüber und werden im nächsten Augenblick über der russischen Revolution zusammenschlagen. Sich dem Weltkriege – und sei es um den Preis der größten Opfer – zu entziehen erweist sich letzten Endes für Rußland allein unmöglich.“[7]Rosa Luxemburg erkennt deutlich, dass der unmittelbare militärische Vorteil, den Deutschland durch die Russische Revolution erlangt hatte, einige Monate lang dazu beitragen werde, das Kräfteverhältnis zwischen den Klassenkräften in Deutschland zugunsten der Bourgeoisie zu kippen. Obwohl die Revolution in Russland die deutschen Arbeiter inspirierte, obwohl der „Raubfrieden“, der nach Brest vom deutschen Imperialismus durchgesetzt wurde, diesen Arbeitern viele ihrer Illusionen beraubte, dauerte es noch fast ein Jahr, bis dies zu einer offenen Rebellion gegen den Imperialismus reifte. Der Grund hat etwas mit dem spezifischen Charakter einer Revolution im Kontext eines Weltkrieges zu tun. Der „Große Krieg“ 1914 war nicht nur ein Gemetzel in einem Ausmaß, das bis dahin unbekannt war; er war auch die gigantischste organisierte ökonomische, materielle und menschliche Operation in der Geschichte bis dahin. Buchstäblich Millionen von Menschen wie auch alle Ressourcen der Gesellschaften waren Zahnräder in einer infernalischen Maschinerie, eine Größenordnung, die jegliche menschliche Vorstellung übertraf. All dies löste zwei intensive Gefühle innerhalb des Proletariats aus: Hass gegen den Krieg auf der einen Seite und ein Gefühl der Machtlosigkeit auf der anderen. Unter solchen Umständen erfordert es unermessliche Leiden und Opfer, ehe die Arbeiterklasse erkennen kann, dass sie allein die Kraft ist, die den Krieg beenden kann. Darüber hinaus erfordert dieser Prozess Zeit und entfaltet sich auf ungleichmäßige, heterogene Weise. Zwei der wichtigsten Aspekte dieses Prozesses sind die Erkenntnis über die wahren, räuberischen Motive der imperialistischen Kriegsanstrengungen sowie über die Tatsache, dass die Bourgeoisie selbst die Kriegsmaschinerie nicht kontrolliert, die als Produkt des Kapitalismus unabhängig vom menschlichen Willen geworden ist. In Russland 1917 wie auch in Deutschland und Österreich-Ungarn 1918 stellte sich die Erkenntnis, dass die Bourgeoisie nicht imstande war, den Krieg zu beenden, selbst wenn sie sich einer Niederlage gegenübersieht, als entscheidend heraus. Was Brest-Litowsk und die Grenzen des Massenstreiks in Deutschland und Österreich-Ungarn im Januar 1918 enthüllten, war vor allem dies: dass die Weltrevolution von Russland initiiert werden kann, dass jedoch nur eine entscheidende proletarische Aktion in einem der kriegführenden Hauptländer – Deutschland, Großbritannien oder Frankreich – den Krieg anhalten konnte. Der Wettlauf zur Beendigung des KriegesObwohl sich das deutsche Proletariat „tot stellte“, wie Rosa Luxemburg es nannte, setzte sich der Reifungsprozess seines Klassenbewusstseins während der ersten Hälfte des Jahres 1918 fort. Darüber hinaus begannen die Soldaten ab dem Sommer dieses Jahres zum erstenmal ernsthaft vom Bazillus der Revolution infiziert zu werden. Zwei Faktoren trugen besonders dazu bei. In Russland wurden die gefangenen deutschen Soldaten freigelassen und vor die Wahl gestellt, in Russland zu bleiben, um an der Revolution teilzunehmen, oder nach Deutschland zurückzukehren. Jene, die den zweiten Weg wählten, wurden selbstverständlich von der deutschen Armee sofort wieder als Kanonenfutter zurück an die Front geschickt. Doch sie trugen die Neuigkeiten von der Russischen Revolution mit sich. In Deutschland selbst wurden Tausende von Führern des Massenstreiks im Januar bestraft, indem sie an die Front geschickt wurden, wo sie die Nachrichten von der wachsenden Revolte der Arbeiterklasse gegen den Krieg weitergaben. Doch letztendlich war es die wachsende Erkenntnis von der Sinnlosigkeit des Krieges und der Unvermeidlichkeit der Niederlage Deutschlands, die sich als entscheidend für den Stimmungswechsel in der Armee erwies. Im Herbst jenes Jahres begann also etwas, was noch einige Monate zuvor als undenkbar erschien: ein Wettlauf gegen die Zeit zwischen den klassenbewussten Arbeitern einerseits und den Führern der deutschen Bourgeoisie auf der anderen, um zu bestimmen, welche von den beiden großen Klassen der modernen Gesellschaft dem Krieg ein Ende bereiten wird. Auf Seiten der herrschenden Klasse Deutschlands mussten zwei wichtige Probleme in ihren eigenen Reihen gleich zu Anfang gelöst werden. Eines von ihnen war die völlige Unfähigkeit vieler ihrer Repräsentanten, die Möglichkeit einer Niederlage, die ihnen ins Gesicht starrte, auch nur in Erwägung zu ziehen. Das andere war, wie man einen Frieden erwirken kann, ohne das eigentliche Zentrum ihres eigenen Staatsapparates irreparabel zu diskreditieren. Was die letzte Frage anbetrifft, so müssen wir uns vergegenwärtigen, dass in Deutschland die Bourgeoisie an die Macht getragen wurde und das Land nicht durch eine Revolution von unten, sondern durch das Militär, an erster Stell durch die königliche preußische Armee, vereint wurde. Wie konnte man die Niederlage eingestehen, ohne diesen Pfeiler, dieses Symbol der nationalen Stärke und Einheit in Frage zu stellen? 15. September: die westlichen Alliierten durchbrachen die österreichisch-ungarische Front auf dem Balkan. 27. September: Bulgarien, ein wichtiger Verbündeter Berlins, kapitulierte. 29. September: der Chef der deutschen Armee, Erich Ludendorff, informierte das Oberkommando, dass der Krieg verloren sei, dass es nur noch eine Frage von Tagen oder gar Stunden sei, ehe die gesamte militärische Front zusammenbrach. Tatsächlich war die Schilderung der unmittelbaren Frontlage durch Ludendorff etwas übertrieben. Wir wissen nicht, ob er selbst in Panik geriet oder ob er bewusst ein Bild zeichnete, das dunkler war als die Realität, um die deutsche Führung zu veranlassen, seine Vorschläge zu akzeptieren. Jedenfalls wurden seine Vorschläge angenommen: Kapitulation und Installierung einer parlamentarischen Regierung. Mit dieser Vorgehensweise wollte Ludendorff einer totalen deutschen Niederlage zuvorkommen und der Revolution den Wind aus den Segeln nehmen. Doch er hatte noch ein weiteres Ziel in den Augen. Er wollte, dass die Kapitulation von einer zivilen Regierung erklärt wird, so dass das Militär weiterhin seine Niederlage in der Öffentlichkeit leugnen konnte. Er bereitete das Terrain der Dolchstoßlegende vor, dem Mythos vom „Messer in den Rücken“, dem zufolge eine siegreiche deutsche Armee von einem verräterischen Feind hinter den Linien bezwungen wurde. Doch dieser Feind, das Proletariat, konnte natürlich nicht beim Namen genannt werden. Dies würde die wachsende Kluft, die Bourgeoisie und Proletariat trennt, zementieren. Aus diesem Grund musste ein Sündenbock gefunden werden, den man anklagen konnte, die Arbeiter „verleitet“ zu haben. Angesichts der spezifischen Geschichte der westlichen Zivilisation in den vergangenen zweitausend Jahren war das geeignetste Opfer dieser Sündenbock-Suche schnell an der Hand: die Juden. Es war also jener Antisemitismus, der bereits in den Jahren vor dem großen Krieg auf dem Aufstieg war, vor allem im Russischen Reich, und der auf die Hauptbühne der europäischen Politik zurückgekehrt war. Der Weg nach Auschwitz beginnt hier. Oktober 1918: Ludendorff und Hindenburg forderten ein sofortiges Friedensangebot an die Entente[8]. Zur gleichen Zeit rief eine nationale Konferenz der kompromisslosesten revolutionären Gruppierungen, der Spartakusbund und die Bremer Linken, zu einer forcierten Agitation unter den Soldaten und für die Bildung von Arbeiterräten auf. Zu dieser Zeit befanden sich Hunderttausende von desertierenden Soldaten auf der Flucht von der Front. Und, wie der Revolutionär Paul Frölich später schreiben sollte (in seiner Biographie von Rosa Luxemburg), es gab ein neues Verhalten der Massen, das an ihren Augen abgelesen werden konnte. Innerhalb des Lagers der Bourgeoisie wurden die Bemühungen, den Krieg zu beenden, von zwei neuen Faktoren aufrechterhalten. Keiner der unbarmherzigen Führer des deutschen Staates, die nie zögerten, Millionen ihrer eigenen „Subjekte“ in den sicheren wie sinnlosen Tod zu schicken, hatte den Mut, Kaiser Wilhelm II. darüber zu informieren, dass er von seinem Thron zurücktreten muss. Denn eine andere, opponierende Seite im imperialistischen Krieg dachte sich weiterhin neue Ausreden aus, um den Waffenstillstand zu verschieben, da sie noch nicht von der unmittelbaren Wahrscheinlichkeit der Revolution und der Gefahr, die dies für ihre eigene Herrschaft bedeutete, überzeugt war. Die Bourgeoisie verlor Zeit. Doch nichts davon hinderte sie daran, eine blutige Repression gegen die revolutionären Kräfte vorzubereiten. Insbesondere hatte sie bereits jene Teile der Armee auserwählt, die nach ihrer Rückkehr von der Front dazu benutzt werden konnten, die wichtigsten Städte zu besetzen. Innerhalb des Lagers des Proletariats bereiteten die Revolutionäre immer intensiver einen bewaffneten Aufstand vor, um den Krieg zu beenden. Die Obleute in Berlin setzten erst den 4. November, dann den 11. November als Tag des Aufstandes fest. Doch in der Zwischenzeit nahmen die Ereignisse eine Wendung, die weder die Bourgeoisie noch das Proletariat erwartet hatte und die einen großen Einfluss auf den Verlauf der Revolution ausübte. Meuterei in der Marine, Auflösung der ArmeeUm die Bedingungen für einen Waffenstillstand zu erfüllen, die mit ihren Kriegsgegnern vereinbart worden waren, stoppte die Regierung in Berlin am 20. Oktober alle Militäroperationen der Marine, insbesondere die Untersee-Kriegführung. Eine Woche später erklärte sie ihre Bereitschaft, einem Waffenstillstand ohne Bedingungen zuzustimmen. Angesichts dieses Beginns vom Ende drehten Offiziere der Kriegsflotte an der norddeutschen Küste durch. Oder vielmehr trat die Verrücktheit ihrer uralten Kaste – die Verteidigung der Ehre, der Tradition des Duells, der Forderung bzw. Gewährung von „Satisfaktion“ – durch den Irrsinn des modernen imperialistischen Krieges an die Oberfläche. Hinter dem Rücken ihrer eigenen Regierung beschlossen sie, mit der Kriegsflotte zu einer großen Seeschlacht gegen die britische Navy auszulaufen, auf die sie vergeblich während des Krieges gewartet hatte. Sie zogen es vor, in Ehre zu sterben, statt sich ohne Schlacht zu ergeben. Sie nahmen an, dass die Matrosen und die Mannschaften – 80.000 Leben zusammen – unter ihrem Kommando bereit wären, ihnen zu folge[9].Dies war jedoch nicht der Fall. Die Mannschaften meuterten gegen ihre Kommandierenden. Mindest einige von ihnen starben dabei. In einem dramatischen Moment richteten Schiffe, die von ihren Mannschaften übernommen worden waren, und Schiffe, auf denen dies (noch) nicht der Fall war, ihre Geschütze aufeinander. Schließlich ergaben sich die Meuterer, wahrscheinlich, um zu vermeiden, auf ihre eigenen Gefährten zu schießen. Doch dies war es noch nicht, was die Revolution in Deutschland ins Rollen brachte. Was entscheidend war, war, dass ein Teil der inhaftierten Matrosen als Häftlinge nach Kiel gebracht wurde, wo sie wahrscheinlich als Verräter zum Tode verurteilt werden sollten. Die anderen Matrosen, die nicht den Mut beessen hatten, sich der ursprünglichen Rebellion auf offener See anzuschließen, drückten nun furchtlos ihre Solidarität mit ihren Kameraden aus. Doch vor allem kam in Solidarität mit ihnen auch die Arbeiterklasse von Kiel heraus und verbrüderte sich mit den Matrosen. Der Sozialdemokrat Noske, der entsandt wurde, um die Erhebung gnadenlos niederzuschlagen, traf in Kiel am 4. November ein, um die Stadt in den Händen bewaffneter Arbeiter, Matrosen und Soldaten vorzufinden. Darüber hinaus hatten bereits Massendelegationen Kiel in alle Richtungen verlassen, um die Bevölkerung zur Revolution aufzufordern, wobei sie sehr gut wussten, dass sie eine Schwelle überschritten hatten, nach der es keinen Rückweg mehr gibt: Sieg oder sicherer Tod. Noske war völlig überrascht, sowohl von der Geschwindigkeit der Ereignisse als auch von der Tatsache, dass die Rebellen von Kiel ihn als einen Held begrüßten[10].Unter den Hammerschlägen dieser Ereignisse löste sich die mächtige deutsche Militärmaschinerie letztendlich auf. Die Divisionen, die aus Belgien zurückfluteten und mit denen die Regierung bei der „Wiederherstellung der Ordnung“ in Köln geplant hatte, desertierten. Am Abend des 8. November wandten sich alle Blicke nach Berlin, dem Sitz der Regierung und dem Ort, wo die bewaffneten Kräfte der Konterrevolution hauptsächlich konzentriert waren. Es ging das Gerücht herum, dass die Entscheidungsschlacht am nächsten Tag in der Hauptstadt ausgetragen werde. Richard Müller, Führer der Obleute in Berlin, erinnerte später daran. „Am 8. November abends stand ich am Halleschen Tor[11]. Schwer bewaffnete Infanteriekolonnen, Maschinengewehr-Kompanien und leichte Feldartillerie zogen in endlosen Zügen an mir vorüber, dem Inneren der Stadt zu. Das Menschenmaterial sah recht verwegen aus. Es war im Osten zum Niederschlagen der russischen Arbeiter und Bauern und gegen Finnland mit ‚Erfolg‘ verwendet worden. Kein Zweifel, es sollte in Berlin die Revolution des Volkes im Blute ersäufen.“ Müller fährt fort zu schildern, wie die SPD Botschaften zu all ihren Funktionären schickte, in denen letztere instruiert wurden, sich dem Ausbruch der Revolution mit allen Mitteln zu widersetzen. Er fährt fort: „Seit Kriegsausbruch stand ich an der Spitze der revolutionären Bewegung. Niemals, auch bei den ärgsten Rückschlägen nicht, hatte ich am Siege des Proletariats gezweifelt. Aber jetzt, wo die Stunde der Entscheidung nahte, erfaßte mich ein beklemmendes Gefühl, eine große Sorge um meine Klassengenossen, um das Proletariat. Ich selbst kam mir angesichts der Größe der Stunde beschämend klein und schwach vor.“[12]
Die Novemberrevolution: Das Proletariat beendet den Krieg
It has often been claimed that the German proletariat, on account of the culture of obedience and submission which, for historic reasons, dominated the culture in particular of the ruling classes of that country for several centuries, is incapable of revolution. The 9th of November 1918 disproves this. On the morning of that day, hundreds of thousands of demonstrators from the great working class districts which encircle the government and business quarters on three sides, moved towards the city centre. They planned their routes to pass the main military barracks on their way to try and win over the soldiers, and the main prisons, where they intended to liberate their comrades. They were armed with guns, rifles and hand grenades. And they were prepared to die for the cause of the revolution. Everything was planned on the spot and spontaneously.
That day, only 15 people were killed. The November Revolution in Germany was as bloodless as the October Revolution in Russia. But nobody knew or even expected this in advance. The proletariat of Berlin showed great courage and unswerving determination that day.
Midday. The SPD leaders Ebert and Scheidemann were sitting in the Reichstag, the seat of the German parliament, eating their soup. Friedrich Ebert was proud of himself, having just been summoned by the rich and the nobles to form a government to save capitalism. When they heard noises outside, Ebert, refusing to allow a mob to interrupt him, silently continued his meal. Scheidemann, accompanied by functionaries who were afraid the building was going to be stormed, stepped out on the balcony to see what was going on. What he saw was something like a million demonstrators on the lawns between the Reichstag and the Brandenburg Gate. A crowd which fell silent when it saw Scheidemann on the balcony, thinking he had come to make a speech. Obliged to improvise, he declared the "free German republic". When he got back to tell Ebert what he had done, the latter was furious, since he had been intending to save not only capitalism, but even the monarchy.[13]
Around the same moment the real socialist Karl Liebknecht was standing on the balcony of the palace of that very monarchy, declaring the socialist republic, and summoning the proletariat of all countries to world revolution. And a few hours later, the revolutionary Obleute occupied one of the main meeting rooms in the Reichstag. There, they formulated the appeals for delegates to be elected in mass assemblies the next day, to constitute revolutionary workers and soldiers councils.
The war had been brought to an end, the monarchy toppled. But the rule of the bourgeoisie was still far from being over.
Nach dem Krieg: der Bürgerkrieg
Zu Beginn dieses Artikels riefen wir in Erinnerung, was historisch auf dem Spiel stand, wie es von Rosa Luxemburg formuliert worden war, und dass dies sich in der Frage konzentriert: Welche Klasse wird den Krieg beenden? Wir erinnerten an die drei möglichen Szenarien, wie der Krieg enden könnte: durch das Proletariat, durch die Bourgeoisie oder durch gegenseitige Erschöpfung der kriegführenden Parteien. Die Ereignisse zeigen deutlich, dass es letztendlich das Proletariat war, das bei der Beendigung des „Großen Krieges“ die führende Rolle spielte. Diese Tatsache allein veranschaulicht die potenzielle Macht des revolutionären Proletariats. Sie erklärt, warum die Bourgeoisie sich bis zu dem heutigen Tag über die Novemberrevolution 1918 in Schweigen hüllt. Doch dies ist nicht die ganze Geschichte. Bis zu einem gewissen Umfang waren die Ereignisse im November 1918 die Kombination aller drei Szenarien, die von Rosa Luxemburg geschildert wurden. Bis zu einem gewissen Umfang waren diese Ereignisse auch das Produkt der militärischen Niederlage Deutschlands. Zu Beginn November 1918 stand Deutschland wirklich am Rande einer totalen militärischen Niederlage. Ironischerweise ersparte die proletarische Erhebung der deutschen Bourgeoisie das Schicksal einer militärischen Okkupation und zwang die Alliierten, den Krieg zu stoppen, um die Verbreitung der Revolution zu vermeiden. November 1918 enthüllte auch Elemente des „wechselseitigen Ruins“ und der Erschöpfung, vor allem in Deutschland, aber auch in Großbritannien und Frankreich. Tatsächlich war es erst die Intervention der Vereinigten Staaten auf Seiten der westlichen Alliierten ab 1917, die den Ausschlag zugunsten Letzterer gaben und den Weg aus der tödlichen Sackgasse öffneten, in welche die europäischen Großmächte hineingetappt waren.
Wenn wir die Rolle dieser anderen Faktoren erwähnen, dann nicht, um die Rolle des Proletariats zu minimieren. Sie sind jedoch zu wichtig, um unberücksichtigt zu bleiben, denn sie helfen den Charakter der Ereignisse zu erklären. Die Novemberrevolution errang den Erfolg als unwiderstehliche Kraft. Aber auch, weil der deutsche Imperialismus den Krieg bereits verloren hatte, weil seine Armeen sich in voller Auslösung befanden und weil nicht nur die Arbeiterklasse, sondern auch breite Sektoren des Kleinbürgertums und sogar der Bourgeoisie nun den Frieden wollten.
Am Tag nach dem großen Triumph wählte die Bevölkerung von Berlin Arbeiter- und Soldatenräte. Diese ernannten ihrerseits zusammen mit ihrer eigenen Organisation eine Art provisorische sozialistische Regierung, die von der SPD und der USPD unter der Führung von Friedrich Ebert gebildet wurde. Am gleichen Tag unterzeichnete Ebert ein Geheimabkommen mit der neuen militärischen Führung, um die Revolution niederzuschlagen. Im nächsten Artikel wollen wir die Kräfte der revolutionären Avantgarde im Kontext des beginnenden Bürgerkriegs und am Vorabend der entscheidenden Ereignisse der Weltrevolution untersuchen. Steinklopfer im Juli 2008
[12] Richard Müller, „Vom Kaiserreich zur Republik“, S. 143.
[13] Anekdoten dieser Art aus dem Innersten des Lagers der Konterrevolution können in den Memoiren führender Sozialdemokraten zur damaligen Zeit gefunden werden. Philipp Scheidemann („Memoiren eines Sozialdemokraten“), 1928. Gustav Noske: Von Kiel bis Kapp – Zur Geschichte der deutschen Revolution, 1920.
Aktuelles und Laufendes:
- Deutschland 1918 [159]
Leute:
- Liebknecht [154]
- Luxemburg [155]
- Jogiches [156]
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Historische Ereignisse:
- Novemberrevolution [160]
- Deutschland 1918- 1919 [157]
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Theoretische Fragen:
- Internationalismus [69]
Erbe der kommunistischen Linke:
Deutschland 1918 – Teil 3 Gründung der Partei, Abwesenheit der Internationale
- 3565 reads
Nachdem der I. Weltkrieg ausgebrochen war, trafen sich die Sozialisten am 4. August 1914, um den Kampf für den Internationalismus und gegen den Krieg aufzunehmen: Es waren sieben von ihnen in Rosa Luxemburgs Wohnung. Diese Reminiszenz, die uns daran erinnert, dass die Fähigkeit, gegen den Strom zu schwimmen, eine der wichtigsten revolutionären Qualitäten ist, darf uns nicht zur Schlussfolgerung verleiten, dass die Rolle der proletarischen Partei in den Ereignissen, die die damalige Welt erschütterten, peripher gewesen sei. Das Gegenteil war der Fall, wie wir in den ersten beiden Artikeln dieser Serie zum Gedenken des 90. Jahrestages der revolutionären Kämpfe in Deutschland aufzuzeigen versucht haben. Im ersten Artikel stellten wir die These vor, dass die Krise in der Sozialdemokratie, insbesondere in der deutschen SPD (1) – der führenden Partei der Zweiten Internationale -, einer der wichtigsten Faktoren gewesen war, die die Möglichkeit für den Imperialismus eröffnet haben, das Proletariat in den Krieg marschieren zu lassen. In Teil 2 argumentierten wir, dass die Intervention von Revolutionären entscheidend war, um die Arbeiterklasse in die Lage zu versetzen, inmitten des Krieges ihre internationalistischen Prinzipien wiederzuentdecken und so das Ende der imperialistischen Schlachterei durch revolutionäre Mittel (die Novemberrevolution von 1918) zu erwirken. Indem sie so verfuhren, legten sie die Fundamente für eine neue Partei und eine neue Internationale.
Und in beiden dieser Phasen, so haben wir hervorgehoben, war die Fähigkeit der Revolutionäre, die Prioritäten des Augenblicks zu begreifen, die Vorbedingung dafür, eine solch aktive und positive Rolle zu spielen. Nach dem Aufbrechen der Internationale angesichts des Krieges war es die Aufgabe der Stunde, die Ursachen dieses Fiaskos zu verstehen und die Lehren daraus zu ziehen. Im Kampf gegen den Krieg war es die Verantwortung wirklicher Sozialisten, die ersten zu sein, um das Banner des Internationalismus zu hissen, den Weg zur Revolution auszuleuchten.
Die Arbeiterräte und die Klassenpartei
Die Arbeitererhebung am 9. November 1918 brachte am Morgen des 10. Novembers 1918 den Krieg zu Ende. Der deutsche Kaiser und zahllose Fürsten waren niedergerungen – nun begann eine neue Phase der Revolution. Obwohl der Novemberaufstand von den Arbeitern angeführt wurde, nannte Rosa Luxemburg ihn eine „Revolution der Soldaten“. Dies darum, weil der Geist, der ihn beherrschte, der Geist einer tiefen Sehnsucht nach Frieden war. Ein Wunsch, den die Soldaten nach vier Jahren in den Schützengräben mehr als jede andere gesellschaftliche Gruppe verkörperten. Dies gab jenem unvergesslichen Tag seine spezifische Färbung, seinen Ruhm und nährte seine Illusionen. Da selbst Teile der Bourgeoisie erleichtert waren, dass der Krieg endlich vorbei war, beherrschte die allgemeine Verbrüderung die damalige Stimmung. Selbst die beiden Hauptprotagonisten des gesellschaftlichen Kampfes, die Bourgeoisie und das Proletariat, waren von den Illusionen des 9. November betroffen. Die Illusion der Bourgeoisie war, dass sie die von der Front heimkehrenden Soldaten noch immer gegen die Arbeiter benutzen könnte. In den folgenden Tagen verflüchtigte sich diese Illusion. Die „grauen Röcke“ (2) wollten nach Hause und nicht gegen die Arbeiter kämpfen. Das Proletariat hatte die Illusion, dass die Soldaten schon jetzt auf ihrer Seite waren und die Revolution wollten. Während der ersten Sitzungen der Arbeiter- und Soldatenräte, die in Berlin am 10. November gewählt worden waren, lynchten die Soldatendelegierten fast die Revolutionäre, die von der Notwendigkeit sprachen, den Klassenkampf fortzuführen, und die die neue sozialdemokratische Regierung als Volksfeind identifizierten.
Diese Arbeiter- und Soldatenräte waren im allgemeinen von der menschlichen Trägheit gekennzeichnet, die merkwürdigerweise den Beginn einer jeden großen sozialen Erhebung auszeichnet. Sehr oft wählten Soldaten ihre Offiziere als Delegierte, und Arbeiter ernannten dieselben sozialdemokratischen Kandidaten, für die sie schon vor dem Krieg gestimmt hatten. So hatten diese Räte nichts Besseres zu tun, als eine Regierung zu ernennen, die von den Kriegstreibern der SPD angeführt wurde, und ihren eigenen Selbstmord im Voraus zu beschließen, indem sie zu allgemeinen Wahlen für ein parlamentarisches System aufriefen.
Trotz der Hoffnungslosigkeit dieser ersten Maßnahmen waren die Arbeiterräte das Herz der Novemberrevolution. Wie Rosa Luxemburg hervorhob, war es vor allem das Auftreten dieser Organe, die den wesentlich proletarischen Charakter dieses Aufstandes bewiesen und verkörperten. Doch jetzt wurde eine neue Phase der Revolution eröffnet, in der die zentrale Frage nicht mehr die der Räte war, sondern die Frage der Klassenpartei. Die Phase der Illusionen kam zu ihrem Ende, der Augenblick der Wahrheit, des Ausbruchs des Bürgerkriegs rückte näher. Die Arbeiterräte waren durch ihre eigentliche Funktion und Struktur als Massenorgane in der Lage, sich selbst von einem Tag zum anderen zu erneuern und zu revolutionieren. Die zentrale Frage war jetzt: Würde die entschlossen revolutionäre, proletarische Auffassung innerhalb dieser Räte, innerhalb der Arbeiterklasse die Oberhand erlangen?
Um siegreich zu sein, bedarf die proletarische Revolution einer vereinten, zentralisierten politischen Avantgarde, in der die Klasse in ihrer Gesamtheit Vertrauen hat. Dies war die vielleicht wichtigste Lehre aus der Oktoberrevolution in Russland im Jahr zuvor. Die Aufgabe dieser Partei ist nicht mehr, wie Rosa Luxemburg 1906 in ihrem Pamphlet über den Massenstreik argumentiert hat, die Massen zu organisieren, sondern der Klasse eine politische Führung und ein wirkliches Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten zu geben.
Die Schwierigkeit bei der Umgruppierung der Revolutionäre
Doch Ende 1918 war in Deutschland eine solche Partei nicht in Sicht. Jene Sozialisten, die sich der Pro-Kriegs-Politik der SPD widersetzten, waren hauptsächlich in der USPD anzutreffen, der früheren Parteiopposition, die Zug um Zug aus der SPD ausgeschlossen worden war. Ein bunte Mix mit Zehntausenden von Mitgliedern, von den Pazifisten und jenen, die eine Versöhnung mit den Kriegstreibern wollten, bis zu den prinzipienfesten revolutionären Internationalisten. Die Hauptorganisation dieser Internationalisten, der Spartakusbund, war eine unabhängige Fraktion innerhalb der USPD. Andere, kleinere internationalistische Gruppen, wie die IKD (3) (die aus der linken Opposition in Bremen hervorkamen), waren außerhalb der USPD organisiert. Der Spartakusbund war unter den Arbeitern wohlbekannt und respektiert. Doch die anerkannten Führer der Streikbewegungen gegen den Krieg waren nicht diese politischen Gruppierungen, sondern die informelle Struktur der Fabrikdelegierten, die „revolutionären Obleute“. Ab Dezember 1918 spitzte sich die Lage zu. Die ersten Geplänkel, die zum offenen Bürgerkrieg führten, hatten bereits stattgefunden. Doch die verschiedenen Komponenten einer potenziellen revolutionären Klassenpartei – der Spartakusbund, die anderen linken Elemente in der USPD, die IKD, die Obleute waren noch immer getrennt und mehrheitlich zaudernd.
Unter dem Eindruck der Ereignisse begann sich die Frage der Parteigründung konkreter zu stellen. Schließlich wurde sie eilig in Angriff genommen.
Der erste nationale Kongress der Arbeiter- und Soldatenräte war am 16. Dezember in Berlin zusammengekommen. Während 250.000 radikale Arbeiter draußen demonstrierten, um Druck auf die 489 Delegierten (von denen nur zehn den Spartakusbund, zehn die IKD repräsentierten) auszuüben, wurde es Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht nicht gestattet, sich an das Treffen zu wenden (unter dem Vorwand, dass sie kein Mandat besäßen). Als dieser Kongress damit endete, dass er seine Macht an ein künftiges parlamentarisches System aushändigte, wurde klar, dass die Revolutionäre darauf mit vereinten Kräften antworten müssen.
Am 14. Dezember veröffentlichte der Spartakusbund eine programmatische Prinzipienerklärung: Was will der Spartakusbund?
Am 17. Dezember rief eine nationale Konferenz der IKD in Berlin zur Diktatur des Proletariats und zur Bildung einer Klassenpartei durch einen Prozess der Umgruppierung auf. Die Konferenz scheiterte dabei, eine Übereinstimmung in der Frage der Teilnahme an den kommenden Wahlen zur parlamentarischen Nationalversammlung zu erzielen.
Etwa zur gleichen Zeit begannen Führer innerhalb der USPD, wie Georg Ledebour, und unter den Fabrikdelegierten, wie Richard Müller, die Frage der Notwendigkeit einer vereinten Arbeiterpartei zu stellen.
Zum gleichen Zeitpunkt trafen sich Delegierte der internationalen Jugendbewegung in Berlin, wo sie ein Sekretariat einsetzten. Am 18. Dezember wurde eine internationale Jugendkonferenz abgehalten, der eine Massenversammlung in Berlin-Neukölln folgte, auf der Karl Liebknecht und Willi Münzenberg sprachen.
In diesem Kontext beschloss ein Treffen der Delegierten des Spartakusbundes am 29. Dezember in Berlin, mit der USPD zu brechen und eine separate Partei zu bilden. Drei Delegierte stimmten gegen diese Entscheidung. Dasselbe Treffen rief zu einer vereinten Konferenz von Spartakus und IKD auf, die am folgenden Tag in Berlin begann und auf der 127 Delegierte aus 56 Städten und Sektionen teilnahmen. Diese Konferenz wurde teilweise durch die Vermittlung von Karl Radek, dem Delegierten der Bolschewiki, möglich gemacht. Viele dieser Delegierten waren sich bis zu ihrer Ankunft nicht im Klaren, dass sie gerufen wurden, um eine neue Partei zu gründen (4). Die Fabrikdelegierten waren nicht eingeladen, da das Gefühl vorherrschte, dass es noch nicht möglich sei, sie mit den sehr entschlossenen revolutionären Positionen zu vereinen, die von der Mehrheit der oft noch jungen Mitglieder und Anhänger von Spartakus und IKD vertreten wurde. Stattdessen herrschte die Hoffnung vor, dass die Fabrikdelegierten der Partei beitreten werden, sobald diese gegründet worden war. (5)
Der Gründungskongress der KPD brachte führende Figuren aus der Bremer Linken (einschließlich Karl Radek, auch wenn er die Bolschewiki auf diesem Treffen vertrat), die meinten, dass die Gründung der Partei lange überfällig war, und des Spartakusbundes, wie Rosa Luxemburg und vor allem Leo Jogiches, zusammen, deren prinzipielle Sorge es war, dass diese Schritt voreilig sein könnte. Paradoxerweise hatten beide Seiten gute Argumente, um ihre Standpunkte zu rechtfertigen.
Die russische Kommunistische Partei (Bolschewiki) sandte sechs Delegierte zur Konferenz, von denen zwei von der deutschen Polizei an der Teilnahme gehindert wurden (6),
Der Gründungskongress: ein großer programmatischer Fortschritt
Zwei der Hauptdiskussionen auf dem Gründungskongress der KPD betrafen die Frage der parlamentarischen Wahlen und der Gewerkschaften. Dies waren Themen, die bereits in den Debatten vor 1914 eine wichtige Rolle gespielt hatten, die aber im Verlaufe des Krieges zweitrangig geworden waren. Nun kehrten sie in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zurück. Karl Liebknecht griff bereits in seiner einleitenden Präsentation über die „Krise in der USPD“ die parlamentarische Frage auf. Der erste nationale Kongress der Arbeiterräte in Berlin hatte bereits die Frage gestellt, die die USPD unvermeidlich spalten musste: Nationalversammlung oder Räterepublik? Es war die Verantwortung aller Revolutionäre, die bürgerlichen Wahlen und ihr parlamentarisches System als konterrevolutionär, als den Tod der Herrschaft der Arbeiterräte zu brandmarken. Doch die Führung der USPD hatte sich sowohl dem Aufruf des Spartakusbundes als auch dem Aufruf der Obleute in Berlin zu einem außerordentlichen Kongress verweigert, um diese Frage zu diskutieren und zu entscheiden.
Als Sprecher der russischen Delegation entwickelte Karl Radek das Verständnis weiter, dass es die historische Entwicklung selbst sei, die nicht nur die Notwendigkeit eines Gründungskongresses, sondern auch seine Tagesordnung bestimmte. Mit dem Ende des Krieges würde sich die Logik der Revolution in Deutschland notwendigerweise von jener in Russland unterscheiden. Die zentrale Frage sei nicht mehr der Frieden, sondern die Nahrungsmittelversorgung und ihre Preise sowie die Frage der Arbeitslosigkeit.
Indem sie die Frage der Nationalversammlung und der „ökonomischen Kämpfe“ auf die Tagesordnung der ersten beiden Tage des Kongresses setzte, hoffte die Führung des Spartakusbundes auf eine klare Position für die Arbeiterräte und gegen das parlamentarische System, gegen die überholte Gewerkschaftsform des Kampfes als solide programmatische Basis für die neue Partei. Doch die Debatten gingen noch darüber hinaus. Die Mehrheit der Delegierten sprach sich gegen jegliche Beteiligung an bürgerlichen Wahlen, selbst als ein Mittel der Agitation gegen sie, sowie gegen die Arbeit innerhalb der Gewerkschaften aus. Auf dieser Ebene war der Kongress einer der stärksten Augenblicke in der Geschichte der Arbeiterbewegung. Er half zum ersten Mal überhaupt, im Namen einer revolutionären Klassenpartei diese radikalen Positionen zu formulieren, die der neuen Epoche des dekadenten Kapitalismus entsprachen. Diese Ideen sollten die Formulierung des Manifestes der Kommunistischen Internationale stark beeinflussen, das einige Monate später von Trotzki verfasst wurde. Und sie sollten zu fundamentalen Positionen der Kommunistischen Linken werden – so wie sie es bis heute sind.
Die Interventionen der Delegierten, die diese Positionen definierten, waren oft von Ungeduld und einem gewissen Mangel an Argumenten gekennzeichnet und wurden von den erfahreneren Mitgliedern kritisiert, auch von Rosa Luxemburg, die nicht ihre radikalsten Schlussfolgerungen teilte. Doch die Protokolle des Treffens illustrieren gut, dass diese neuen Positionen nicht das Produkt von Individuen und ihrer Schwächen, sondern der Ausdruck einer tiefergehenden gesellschaftlichen Bewegung waren, die Hunderttausende von klassenbewussten Arbeitern umfasste (7). Gelwitzki, ein Delegierter aus Berlin, rief die Partei auf, statt der Beteiligung an den Wahlen zu den Kasernen zu gehen, um die Soldaten davon zu überzeugen, dass die Räteversammlung die „Regierung des Weltproletariats“ ist und die Nationalversammlung jene der Konterrevolution. Leviné, Delegierter aus Neukölln (Berlin) wies darauf hin, dass die Teilnahme an den Wahlen nichts anderes bewirke als die Verstärkung der Illusionen der Massen. (8) In den Debatten über die ökonomischen Kämpfe argumentierte Paul Frölich, Delegierter aus Hamburg, dass die alte gewerkschaftliche Form nun überholt sei, da sie auf einer Trennung zwischen den ökonomischen und politischen Dimensionen des Klassenkampfes beruhten. (9) Hammer, Delegierter aus Essen, berichtete, dass die Bergarbeiter vom Ruhrgebiet ihre Gewerkschaftsausweise weggeworfen hatten. Was Rosa Luxemburg selbst angeht, die noch immer für die Arbeit innerhalb der Gewerkschaften aus taktischen Gründen plädierte, so erklärte sie, dass der Kampf des Proletariats für seine Befreiung identisch mit dem Kampf für die Befreiung der Gewerkschaften sei.
Massenstreik und Aufstand
Die programmatischen Debatten auf dem Gründungskongress waren von großer historischer Bedeutung, besonders für die Zukunft.
Doch zum Zeitpunkt des Gründungskongresses selbst lag Rosa Luxemburg völlig richtig, als sie sagte, dass sowohl die Frage der parlamentarischen Wahlen als auch die Frage der Gewerkschaften zweitrangig waren. Einerseits war die Frage der Rolle dieser Institutionen in dem, was sich anschickte, zur Epoche des Imperialismus zu werden, noch zu neu für die Arbeiterbewegung. Sowohl die Debatten als auch die praktischen Erfahrungen waren noch nicht ausreichend, um diese Frage völlig zu klären. Für den Augenblick reichte es aus, zu wissen und zuzustimmen, dass die Masseneinheitsorgane der Klasse, die Arbeiterräte, und nicht das Parlament oder die Gewerkschaften die Mittel des Arbeiterkampfes und der proletarischen Diktatur sind.
Auf der anderen Seite neigten diese Debatten dazu, von der Hauptaufgabe des Kongresses abzulenken, die darin bestand, die nächsten Schritte der Klasse auf dem Weg zur Macht auszumachen. Tragischerweise scheiterte der Kongress darin, diese Frage zu klären. Die Schlüsseldiskussion über dieses Thema wurde von Rosa Luxemburgs Präsentation über „Unser Programm“ am Nachmittag des zweiten Tages (31. Dezember 1918) eingeleitet. Hier erkundete sie den Charakter dessen, was als zweite Phase der Revolution ausgerufen wurde. Die erste Phase, sagte sie, war sofort politisch gewesen, da sie gegen den Krieg gerichtet war. Während der Novemberrevolution wurde die Frage der spezifischen Klassenforderungen der Arbeiter hintangestellt. Dies half seinerseits das verhältnismäßig niedrige Niveau des Klassenbewusstseins zu erklären, welches diese Ereignisse begleitete und sich in dem Wunsch nach Wiederversöhnung und nach einer „Wiedervereinigung“ des „sozialistischen Lagers“ ausdrückte. Für Rosa Luxemburg war das Hauptkennzeichen der zweiten Phase der Revolution die Rückkehr der wirtschaftlichen Klassenforderungen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.
Sie hatte dabei keineswegs außer Acht gelassen, dass die Eroberung der Macht vor allem ein politischer Akt ist. Doch wollte sie einen anderen wichtigen Unterschied zwischen den revolutionären Prozess Russlands und Deutschlands beleuchten. 1917 kam das russische Proletariat ohne größeren Gebrauch der Streikwaffe an die Macht. Doch war dies, wie Rosa Luxemburg hervorhob, nur möglich, weil die Revolution in Russland nicht 1917, sondern 1905 begonnen hatte. Mit anderen Worten, das russische Proletariat hatte bereits vor 1917 die Erfahrung des Massenstreiks gemacht.
Auf dem Kongress wiederholte sie nicht die Hauptgedanken, die von der Linken der Sozialdemokratie über den Massenstreik von 1905 entwickelt worden waren. Sie konnte getrost davon ausgehen, dass sie noch immer in den Köpfen der Delegierten präsent waren. Wir möchten sie an dieser Stelle kurz in Erinnerung rufen: Der Massenstreik ist die Vorbedingung für die Machtergreifung, gerade weil er die Trennung zwischen wirtschaftlichen und politischen Kämpfen wegwischt. Und während die Gewerkschaften selbst in ihren stärksten Zeiten als Instrumente der Arbeiter nur Minderheiten der Klasse organisierten, aktiviert der Massenstreik die „zusammen geknäuelte Masse der Heloten“ des Proletariats, der unorganisierten Massen, die unberührt vom Licht der politischen Bildung sind. Der Arbeiterkampf richtet sich nicht nur gegen die materielle Armut. Er ist eine Erhebung gegen die existierende Arbeitsteilung selbst, angeführt von ihren Hauptopfern, den Lohnsklaven. Das Geheimnis des Massenstreiks ist das Streben der Proletarier nach vollständiger Menschwerdung. Last but not least: Der Massenstreik würde zur Wiederverjüngung der Arbeiterräte führen, indem der Klasse die organisatorischen Mittel verliehen werden, ihren Machtkampf zu zentralisieren.
Daher beharrte Rosa Luxemburg in ihrer Rede auf dem Kongress darauf, dass die bewaffnete Erhebung der letzte, nicht der erste Akt des Machtkampfes sei. Die Aufgabe der Stunde, sagte sie, sei es nicht, die Regierung zu stürzen, sondern sie zu untergraben. Der Hauptunterschied zur bürgerlichen Revolution sei, so argumentierte sie, ihr Massencharakter, indem sie von „unten“ komme. (10)
Die Unreife des Kongresses
Doch genau dies wurde auf dem Kongress nicht verstanden. Für viele Delegierten war die nächste Phase der Revolution nicht von Massenstreikbewegungen, sondern vom unmittelbaren Kampf um die Macht charakterisiert. Diese Konfusion wurde besonders deutlich von Otto Rühle (11) artikuliert, der behauptete, dass es möglich sei, innerhalb von vierzehn Tagen die Macht zu erobern. Selbst Karl Liebknecht wollte, obwohl er die Möglichkeit einer lang hingezogenen Revolution in Betracht zog, nicht die Möglichkeit einer „ganz rapiden Entwicklung“ ausschließen (12)
Wir haben jeden Grund, den Augenzeugenberichten Glauben zu schenken, denen zufolge insbesondere Rosa Luxemburg von den Resultaten dieses Kongresses schockiert und alarmiert war. Was Leo Jogiches anbelangt, soll seine erste Reaktion gewesen sein, Luxemburg und Liebknecht zu raten, Berlin zu verlassen und sich für eine Weile zu verstecken. (13) Er befürchtete, dass die Partei und das Proletariat sich auf eine Katastrophe zu bewegten.
Was Rosa Luxemburg am meisten alarmierte, waren nicht die verabschiedeten programmatischen Positionen, sondern die Blindheit der meisten Delegierten gegenüber der Gefahr, die die Konterrevolution darstellte, und die allgemeine Unreife, mit der die Debatten geführt wurden. Viele Interventionen zeichneten sich durch Wunschdenken aus und erweckten den Eindruck, dass eine Mehrheit der Klasse bereits hinter der neuen Partei stünde. Die Präsentation von Rosa Luxemburg wurde mit Jubel begrüßt. Einem Antrag von sechzehn Delegierten, sie so schnell wie möglich als „Agitationsbroschüre“ zu veröffentlichen, wurde sofort stattgegeben. Im Gegensatz dazu gelang es dem Kongress nicht, darüber ernsthaft zu diskutieren. Insbesondere griff kaum eine Intervention Rosas Hauptgedanken auf: dass der Kampf um die Macht noch nicht auf der Tagesordnung war. Eine löbliche Ausnahme war der Beitrag von Ernst Meyer, der über seinen jüngsten Besuch in den ostelbischen Provinzen sprach. Er berichtete, dass große Bereiche des Kleinbürgertums über der Notwendigkeit sprachen, Berlin eine Lektion zu erteilen. Er fuhr fort: „Fast noch erschrockener war ich darüber, dass auch die Arbeiter in den Städten selbst noch nicht das Verständnis dafür hatten, was in dieser Situation notwendig ist. Deshalb müssen wir die Agitation nicht nur auf dem flachen Lande, sondern auch in den Klein- und Mittelstädten mit aller Macht in die Wege leiten.“ Meyer antwortete auch aufs Frölichs Idee, zur Bildung lokaler Räterepubliken anzuspornen. „Es ist geradezu typisch für die konterrevolutionären Bestrebungen, dass sie die Möglichkeit von selbständigen Republiken propagieren, worin sich nichts anderes äußert als der Wunsch, Deutschland in verschiedene Bezirke zu zerteilen, die sozial voneinander abweichen, oder die sozial rückständigen Gebiete dem Einfluss der sozial fortgeschrittenen Gebiete zu entziehen“ (14)
Besonders bedeutsam war die Intervention von Fränkel, einem Delegierten aus Königsberg, der den Vorschlag machte, dass es überhaupt keine Diskussion über die Präsentation geben solle. „Ich bin der Ansicht, dass eine Diskussion die ausgezeichnete Rede der Genossin Luxemburg nur abschwächen kann,“ erklärte er. (15)
Diesem Beitrag folgte eine Intervention von Bäumer, der erklärte, dass die proletarische Position gegen jegliche Beteiligung an Wahlen so evident sei, dass er „auf das Bitterste“ bedauerte, dass es überhaupt eine Diskussion über das Thema gegeben habe. (16)
Rosa Luxemburg wurde vorgeschlagen, das Schlusswort zu dieser Diskussion zu sprechen. Der Vorsitzende verkündete: „Die Genossin Luxemburg ist leider nicht in der Lage, das Schlusswort zu halten, da sie körperlich unpässlich ist.“ (17)
Was Karl Radek später als die „jugendliche Unreife“ des Gründungskongresses beschrieb (18), war also gekennzeichnet von Ungeduld und Naivität, aber auch von einem Mangel an Diskussionskultur. Rosa Luxemburg hatte tags zuvor dieses Problem angesprochen. „Ich habe die Überzeugung, Ihr wollt Euch Euren Radikalismus ein bischen bequem und rasch machen, namentlich die Zurufe „Schnell abstimmen“ beweisen das. Es ist nicht die Reife und der Ernst, die in diesen Saal gehören. Es ist meine feste Überzeugung, es ist eine Sache, die ruhig überlegt und behandelt werden muss. Wir sind berufen, zu den größten Aufgaben der Weltgeschichte, und es kann nicht reif und gründlich genug überlegt werden, welche Schritte wir vor uns haben, damit wir sicher sind, dass wir zum Ziel gelangen. So schnell übers Knie brechen kann man nicht so wichtige Entscheidungen. Ich vermisse das Nachdenkliche, den Ernst, der durchaus den revolutionären Elan nicht ausschließt, sondern mit ihm gepaart werden soll.“ (19)
Die Verhandlungen mit den „Fabrikdelegierten“
Die revolutionären Obleute aus Berlin sandten eine Delegation zum Kongress, um über ihren möglichen Beitritt zur neuen Partei zu verhandeln. Eine Eigentümlichkeit dieser Verhandlungen war, dass die Mehrheit der sieben Delegierten sich selbst als Repräsentant der Fabriken ansah und ihre Stimme zu besonderen Fragen auf der Grundlage einer Art von Proportionalsystem, nur nach Konsultation mit „ihren“ Arbeitskollegen gab, die sich anscheinend bei Gelegenheit versammelten. Liebknecht, der die Verhandlungen für Spartakus leitete, berichtete dem Kongress, dass zum Beispiel in der Frage der Teilnahme an den Wahlen zur Nationalversammlung 26 Stimmen dafür abgegeben wurden und 16 Stimmen dagegen. Liebknecht fügte hinzu: „Aber unter der Minderheit befanden sich u.a. die Vertreter der äußerst wichtigen Spandauer Betriebe, die allein 60.000 Mann hinter sich haben“ Däumig und Ledebour, die Repräsentanten der Linken der USPD waren, nicht Obleute, nahmen nicht an der Abstimmung teil.
Ein weiterer Zankapfel war die Forderung der Obleute nach Parität in der Programm- und Organisationskommission, die vom Kongress nominiert wurde. Dies wurde aus dem Grunde abgelehnt, dass die Delegierten zwar einen großen Teil der Arbeiterklasse von Berlin repräsentierten, die KPD aber die Klasse im gesamten Land repräsentiere.
Doch der Hauptstreit, der die Atmosphäre der Verhandlungen, die sehr konstruktiv begonnen hatten, offensichtlich vergiftete, betraf die Strategie und Taktik für die kommende Periode, d.h. jene Frage, die eigentlich im Mittelpunkt der Kongressberatungen hätte stehen müssen. Richard Müller forderte, dass der Spartakusbund davon abkehrte, was er die „putschistische Taktik“ nannte. Er schien sich insbesondere auf die Taktik der täglichen bewaffneten Demonstrationen durch Berlin zu beziehen, die vom Spartakusbund angeführt wurden, und dies zu einem Moment, als, laut Müller, die Bourgeoisie versuchte, eine vorzeitige Konfrontation mit der politischen Vorhut in Berlin zu provozieren. Wie Liebknecht dem Kongress berichtete „Ich sagte dem Genossen Richard Müller, er scheine ein Sprachrohr des Vorwärts zu sein“ (20) (die konterrevolutionäre Zeitung der SPD).
Wie Liebknecht dem Kongress schilderte, schien dies der negative Wendepunkt der Verhandlungen gewesen zu sein. Die Obleute, die bis dahin sich damit zufrieden gaben, fünf Repräsentanten in den o.g. Kommissionen zu haben, zogen nun ihre Stimme zurück, um acht zu fordern etc. Die Fabrikdelegierten fingen sogar an, damit zu drohen, eine eigene Partei zu bilden.
Der Kongress seinerseits verabschiedete eine Resolution, die „einige scheinradikale Mitglieder der bankrotten USPD“ für das Scheitern der Verhandlungen verantwortlich machte. Unter verschiedenen „Vorwänden“ würden diese Elemente versuchen, „unter verschiedenen, zum Teil anmaßenden unzulässigen Vorwänden suchen diese Leute Kapital zu schlagen aus ihrem Einfluss unter den revolutionären Arbeitern“ (ebenda, S.281) (21)
Der Artikel über den Kongress, der in der Ausgabe der Roten Fahne vom 3. Januar 1919 erschien und von Rosa Luxemburg verfasst wurde, drückte einen anderen Geist aus. Dieser Artikel sprach vom Beginn der Verhandlungen zur Vereinigung mit den Obleuten und den Delegierten der großen Berliner Fabriken, von dem Beginn eines Prozesses, der „ganz selbstverständlichen, unaufhaltsamen Prozesses der Vereinigung aller wirklich proletarischen und revolutionären Elemente in einem organisatorischen Rahmen. Dass die revolutionären Obleute Großberlins, die moralischen Vertreter des Kerntrupps des Berliner Proletariats, mit dem Spartakusbund zusammengehen, hat die Zusammenwirkung beider Teile in allen bisherigen revolutionären Aktionen der Berliner Arbeiterschaft bewiesen“ (ebenda S. 302). (22)
Der angebliche „Luxemburgismus“ der jungen KPD
Wie kann man diese schweren Geburtsnarben der KPD erklären?
Nach der Niederlage der Revolution in Deutschland wurde eine Reihe von Erklärungen sowohl innerhalb der KPD als auch in der Kommunistischen Internationale vorgestellt, die die spezifischen Schwächen der Bewegung in Deutschland insbesondere im Vergleich mit Russland betonten. Der Spartakusbund wurde beschuldigt, eine „spontaneistische“ und so genannte Luxemburgistische Theorie der Parteibildung vertreten zu haben. Man suchte hier die Ursprünge von allem, von dem angeblichen Zögern der Spartakisten, sich von den Kriegstreibern der SPD zu trennen, bis zur so genannten Nachsicht Rosa Luxemburgs gegenüber den jungen „Radikalen“ in der Partei.
Die Ursprünge der angeblichen „spontaneistischen Theorie“ der Partei werden gewöhnlich auf Rosa Luxemburgs Broschüre über die Russische Revolution von 1905 – Der Massenstreik, die politische Partei und die Gewerkschaften – zurückgeführt, wo sie angeblich zur Intervention der Massen im Kampf gegen den Opportunismus und den Reformismus der Sozialdemokratie als Alternative zum politischen und organisatorischen Kampf innerhalb der Partei selbst aufruft. In Wahrheit war die Erkenntnis, dass der Fortschritt der Klassenpartei von einer Reihe „objektiver“ und „subjektiver“ Faktoren abhängt, von denen die Evolution des Klassenkampfes einer der wichtigsten ist, eine Grundthese der marxistischen Bewegung lange vor Rosa Luxemburg. (23)
Vor allem hatte Rosa Luxemburg sehr wohl einen sehr konkreten Kampf innerhalb der Partei vorgeschlagen: der Kampf zur Wiederherstellung der politischen Kontrolle der Partei über die sozialdemokratischen Gewerkschaften. Es ist allgemeiner Glaube, insbesondere unter Syndikalisten, dass die organisatorische Form der politischen Partei viel anfälliger ist, vor der Logik des Kapitalismus zu kapitulieren, als die Gewerkschaften, die die Arbeiter direkt im Kampf organisieren. Rosa Luxemburg verstand sehr gut, dass das Gegenteil der Fall war, da die Gewerkschaften die herrschende Arbeitsteilung widerspiegelten, die die tiefste Grundlage der Klassengesellschaft ist. Sie verstand, dass die Gewerkschaften, und nicht die SPD, die Hauptträger der opportunistischen und reformistischen Ideologie in der Vorkriegs-Sozialdemokratie waren. Unter dem Mantel der Parole ihrer „Autonomie“ waren die Gewerkschaften in Wirklichkeit dabei, die politische Arbeiterpartei zu übernehmen. Es ist wahr, dass die Strategie, die von Rosa Luxemburg vorgeschlagen wurde, sich als unzureichend erwies. Doch dies macht sie noch lange nicht „spontaneistisch“ oder syndikalistisch (!), wie manchmal behauptet wird! Genausowenig drückte die Orientierung von Spartakus während des Kriegs auf die Formierung einer Opposition zunächst in der SPD und schließlich in der USPD eine Unterschätzung der Partei aus, sondern eine unerschütterliche Entschlossenheit, für die Partei zu kämpfen, zu verhindern, dass ihre besten Elemente in die Hände der Bourgeoisie fielen.
In einer Intervention auf dem vierten Kongress der KPD im April 1920 behauptete Clara Zetkin, dass Rosa Luxemburg in ihrem letzten Brief an Zetkin geschrieben habe, dass der Gründungskongress einen Fehler gemacht habe, als er die Akzeptanz der Beteiligung an den Wahlen nicht zu einer Bedingung für die Mitgliedschaft in der neuen Partei machte. Es gibt keinen Grund, die Ehrlichkeit von Clara Zetkins Behauptung anzuzweifeln. Die Fähigkeit, zu lesen, was andere Leute wirklich schreiben, und nicht, was man selbst will oder von den anderen erwartet, ist wahrscheinlich seltener, als man allgemein annimmt. Der Brief von Luxemburg an Zetkin, datiert vom 11. Januar 1919, wurde später veröffentlicht. Was Rosa Luxemburg schrieb, ist folgendes: „Also vor allem, was die Frage der Nichtbeteiligung an den Wahlen betrifft: Du überschätzt enorm die Tragweite dieses Beschlusses. Es gibt gar keine „Rühlianer“, Rühle war gar kein „Führer“ auf der Konferenz. Unsere „Niederlage“ war nur der Triumph eines etwas kindischen, unausgegorenen, geradlinigen Radikalismus... Wir haben alle einstimmig beschlossen, den Casus nicht zur Kabinettsfrage zu machen und nicht tragisch zu nehmen. In Wirklichkeit wird die Frage der Nationalversammlung von den stürmischen Ereignissen ganz in den Hintergrund geschoben, und wenn die Dinge so weiter verlaufen, wie bisher, erscheint es recht fraglich, ob es überhaupt zu Wahlen und Nationalversammlung kommt“ (Brief Rosa Luxemburgs an C. Zetkin vom 11. Januar 1919). (24)
Die Tatsache, dass die radikalen Positionen häufig von jenen Delegierten vorgetragen wurden, die am deutlichsten die Ungeduld und Unreife jener Konferenz ausdrückten, trug mit zum Eindruck bei, dass diese Unreife das Produkt der Weigerung sei, sich an bürgerlichen Wahlen oder in Gewerkschaften zu beteiligen. Dieser Eindruck sollte ein Jahr tragische Konsequenzen haben, als die Führung auf dem Heidelberger Kongress die Mehrheit aufgrund ihrer Position zu den Wahlen und der Gewerkschaften ausschloss. (25) Dies war nicht die Haltung von Rosa Luxemburg, die wusste, dass es für die Revolutionäre keine Alternative zur Notwendigkeit gibt, ihre Erfahrungen zur nächsten Generation weiterzureichen, und dass eine Klassenpartei nicht ohne die Beteiligung der jüngeren Generation gegründet werden kann.
Der angeblich „deklassierte“ Charakter der „jungen Radikalen“
Nach dem Ausschluss der Radikalen aus der KPD und der KAPD aus der Kommunistischen Internationale gab es den Ansatz einer Theoretisierung der Rolle der „Radikalen“ innerhalb der jungen Partei als Ausdruck des Gewichtes der „entwurzelten“ und „deklassierten“ Elemente. Es trifft sicherlich zu, dass es unter den jungen Anhängern des Spartakusbundes während des Krieges und noch mehr innerhalb der Reihen von Gruppierungen wie die „Roten Soldaten“, die Kriegsdeserteure, die Invaliden, etc. Strömungen gab, die von der Zerstörung und dem „totalen revolutionären Terror“ träumten. Einige dieser Elemente waren hochgradig dubios, und die Obleute waren ihnen gegenüber zu Recht misstrauisch. Andere waren Hitzköpfe oder einfach junge Arbeiter, die vom Krieg politisiert wurden und es nicht gelernt hatten, ihre Gedanken anders als durch den Kampf mit der Waffe zu artikulieren, und die sich nach jener Art von „Guerrilla“-Kampagnen sehnten, wie sie bald von Max Hoelz praktiziert wurden. (26)
Diese Interpretation wurde erneut in den 1970er Jahren von Autoren wie Fähnders und Rector in ihrem Buch Linksradikalismus und Literatur aufgegriffen. (27) Sie versuchten, ihre These der Verbindung zwischen dem Linkskommunismus und der „Verlumpung“ durch das Beispiel der Biographien radikaler Künstler und Schriftsteller der Linken zu illustrieren, von Rebellen, die, wie Maxim Gorki oder Jack London, die herrschende Gesellschaft abgelehnt hatten, indem sie sich außerhalb ihrer setzten. Bezüglich eines der einflussreichsten Führer der KAPD schrieben sie: „Adam Scharrer war einer der radikalsten Vertreter dieses internationalen – auch in der Literatur international verbreiteten – Rebellentums, das ihn zu seiner so extrem starren Position des Linkskommunismus führte“ (28) (S. 262)
In Wirklichkeit wurden die meisten der jungen Militanten der KPD und der Kommunistischen Linken in der sozialistischen Jugendbewegung vor 1914 politisiert. Politisch waren sie nicht ein Produkt der durch den Krieg verursachten „Entwurzelung“ und „Verlumpung“. Doch ihre Politisierung kreiste sehr wohl um die Frage des Krieges. Im Gegensatz zur älteren Generation der sozialistischen Arbeiter, die unter dem Gewicht von Jahrzehnten der politischen Routine in der Epoche der relativen Stabilität des Kapitalismus gelitten hatte, wurde die sozialistische Jugend direkt durch das Gespenst des heraufziehenden Krieges mobilisiert und entwickelte eine starke „antimilitaristische“ Tradition. (29) Und während die marxistische Linke innerhalb der Sozialdemokratie zu einer isolierten Minderheit wurde, war ihr Einfluss innerhalb der radikalen Jugendorganisationen weitaus stärker. (30)
Was die Beschuldigungen angeht, dass die „Radikalen“ in ihrer Jugend Vagabunden gewesen seien, so lässt dies außer acht, dass diese „Wanderjahre“ eine typische Episode in proletarischen Biographien damals waren. Teils ein Überbleibsel aus der alten Tradition der wandernden Handwerksgesellen, die die ersten sozialistischen politischen Organisationen in Deutschland charakterisierten, wie den Bund der Kommunisten, war diese Tradition vor allem die Frucht des Arbeiterkampfes, um Kinderarbeit aus der Fabrik zu verbannen. Viele junge Arbeiter wollten eine Auszeit nehmen, um „die Welt zu sehen“, ehe sie sich dem Joch der Lohnsklaverei unterordneten. Zu Fuß unterwegs, wollten sie die deutschsprechenden Länder, Italien, den Balkan und gar den Nahen Osten erforschen. Jene, die mit der Arbeiterbewegung verknüpft waren, fanden freie oder billige Unterkunft in den Gewerkhäusern der großen Städte, politische und soziale Kontakte sowie Unterstützung in den örtlichen Jugendorganisationen. Auf diese Weise entstanden rund um politische, kulturelle, künstlerische und wissenschaftliche Entwicklungen Angelpunkte des internationalen Austausches. (31) Andere gingen zur See, lernten Sprachen und etablierten sozialistische Verbindungen rund um den Globus. Kein Wunder, dass diese Jugend zur Vorhut des proletarischen Internationalismus überall in Europa wurde! (32)
Wer waren die „revolutionären Obleute“?
Die Konterrevolution beschuldigte die Obleute, bezahlte Agenten ausländischer Regierungen - erst der Entente und dann des „Weltbolschewismus“ - zu sein. Im allgemeinen gingen sie in die Geschichte ein als eine Art Basisgewerkschafter, als eine lokalistische und fabrikorientierte Anti-Partei-Strömung. In „operaistischen“ Kreisen werden sie bewundernd als eine Art von revolutionärer Konspiration anerkannt, die den imperialistischen Krieg sabotiert habe. Wie kann man sonst die Art und Weise erklären, in der sie die Schlüsselsektoren und –fabriken der deutschen Waffenindustrie „infiltrierten“?
Bleiben wir bei den Tatsachen. Die Obleute begannen als ein kleiner Kreis von sozialdemokratischen Parteifunktionären und –mitgliedern, die durch ihre unerschütterliche Opposition gegen den Krieg das Vertrauen ihrer Kollegen erworben hatten. Sie hatten eine besonders starke Basis in der Hauptstadt Berlin und in der Metallindustrie, vor allem unter den Drehern. Sie gehörten zu den intelligentesten, gebildeten Arbeitern mit den höchsten Löhnen. Doch sie waren berühmt wegen ihres Sinnes für Unterstützung und Solidarität gegenüber anderen, schwächeren Bereichen der Klasse, wie die Frauen, die mobilisiert wurden, um die männlichen Arbeiter zu ersetzen, die an die Front geschickt wurden. Im Verlaufe des Krieges wuchs ein ganzes Netzwerk von politisierten Arbeitern um sie heran. Weit davon entfernt, eine Anti-Partei-Strömung zu sein, waren sie fast ausschließlich aus früheren Sozialdemokraten zusammengesetzt, die nun Mitglieder oder Sympathisanten des linken Flügels der USPD waren, einschließlich des Spartakusbundes. Sie beteiligten sich leidenschaftlich an allen politischen Debatten, die im revolutionären Untergrund während des gesamten Krieges stattfanden.
Die besondere Form dieser Politisierung war zu einem großen Teil durch die Bedingungen der klandestinen Aktivitäten bestimmt, die Massenversammlung rar und eine offene Diskussion unmöglich machten. In den Fabriken dagegen schützten die Arbeiter ihre Führer vor der Repression, häufig mit bemerkenswertem Erfolg. Das extensive Spitzelsystem der Gewerkschaften und der SPD scheiterte regelmäßig daran, auch nur die Namen der „Rädelsführer“ herauszufinden. Im Falle der Verhaftung hatte jeder dieser Delegierten einen Ersatz nominiert, der sofort die Lücke schloss.
Das „Geheimnis“ ihrer Fähigkeit, die Schlüsselsektoren der Industrie zu „infiltrieren“, war sehr einfach. Sie gehörten zu den „besten“ Arbeitern, so dass die Kapitalisten miteinander konkurrierten, um sie zu verpflichten. Auf diese Weise setzten die Arbeitgeber selbst, ohne es zu wissen, diese revolutionären Internationalisten in Schlüsselpositionen der Kriegswirtschaft.
Die Abwesenheit der Internationale
Es ist keine Eigentümlichkeit der Lage in Deutschland, dass die drei o.g. Kräfte innerhalb der Arbeiterklasse eine kreuzwichtige Rolle im Drama der Formierung der Partei spielten. Eines der Merkmale des Bolschewismus während der Revolution in Russland war die Weise, wie er im Grunde die gleichen Kräfte in der Arbeiterklasse vereint: die Vorkriegs-Partei, die das Programm und die organisatorische Erfahrung verkörperte; die fortgeschrittenen, klassenbewussten Arbeiter in den Fabriken und an den Arbeitsplätzen, die die Partei in der Klasse verankerten und eine entscheidende, positive Rolle bei der Lösung verschiedener Krisen in der Organisation spielten; und die revolutionäre Jugend, die durch den Kampf gegen den Krieg politisiert wurde.
Daran gemessen, fällt in Deutschland die Abwesenheit eines ähnlichen Grades an Einheit und gegenseitigem Vertrauen zwischen diesen wesentlichen Komponenten auf. Dies, und nicht irgendeine untergeordnete Qualität dieser Elemente selbst, war entscheidend. So besaßen die Bolschewiki die Mittel, um ihre Konfusionen zu klären und gleichzeitig ihre Einheit aufrechtzuerhalten und zu stärken. In Deutschland war dies nicht der Fall.
Die revolutionäre Avantgarde in Deutschland litt an einem tiefer verwurzelten Mangel an Einheit und Vertrauen in ihre eigene Mission.
Eine der Haupterklärungen dafür ist, dass die Deutsche Revolution sich einem mächtigeren Feind gegenübersah. Die Bourgeoisie in Deutschland war sicherlich grausamer als in Russland. Darüber hinaus hatte ihr die geschichtliche Phase, die durch den Weltkrieg eingeläutet worden war, eine neue und mächtige Waffe in ihre Hände gelegt. Deutschland vor 1914 war das Land mit den entwickeltsten Organisationen der Arbeiterbewegung weltweit gewesen. In der neuen Ära, in der die Gewerkschaften und die sozialdemokratischen Massenparteien nicht mehr der Sache des Proletariats dienen konnten, wurden diese Instrumente zu enormen Hindernissen. Hier war die Dialektik der Geschichte am Werk. Was einst eine Stärke der deutschen Arbeiterklasse gewesen war, wurde nun zu ihrer Schwäche.
Es bedarf Mut, um solch eine furchteinflößende Festung anzugreifen. Die Versuchung kann sehr stark sein, die Stärke des Feindes zu ignorieren, um sich selbst in Sicherheit zu wiegen.
Doch das Problem war nicht nur die Stärke der deutschen Bourgeoisie. Als das russische Proletariat 1917 den bürgerlichen Staat stürmte, war der Weltkapitalismus durch den imperialistischen Krieg noch immer gespalten. Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass das deutsche Militär tatsächlich Lenin und andere bolschewistische Führer zur Rückkehr nach Russland verhalf, da es hoffte, dass dies irgendwie den militärischen Widerstand seines Gegners an der Ostfront schwächen würde.
War der Krieg erst einmal vorbei, vereinigte sich die Weltbourgeoisie gegen das Proletariat. Einer der stärkeren Momente des ersten Kongresses der KPD war die Annahme einer Resolution, die die militärische Kollaboration der britischen und deutschen Militärs mit den lokalen Grundbesitzern in den baltischen Staaten beim Training konterrevolutionärer paramilitärischer Einheiten identifizierten und anprangerten, welche sich gegen „die russische Revolution heute“ und die „deutsche Revolution morgen“ richtete.
In solch einer Lage konnte nur eine neue Internationale den Revolutionären und dem gesamten Proletariat das notwendige Vertrauen und Selbstvertrauen geben. Die Revolution konnte in Russland noch erfolgreich sein ohne die Präsenz einer Weltpartei, weil die russische Bourgeoisie relativ schwach und isoliert war – aber dies traf nicht auf Deutschland zu. Die Kommunistische Internationale war noch nicht gegründet, als die entscheidende Konfrontation der Deutschen Revolution in Berlin stattfand. Nur eine solche Organisation hätte, indem sie die theoretischen Errungenschaften und die Erfahrungen des gesamten Proletariats zusammengebracht hätte, sich der Aufgabe, eine Weltrevolution anzuführen, als ebenbürtig erwiesen.
Erst bei Ausbruch des Großen Krieges dämmerte den Revolutionären die Notwendigkeit einer wirklich vereinten und zentralisierten internationalen linken Opposition. Doch unter den Bedingungen des Krieges war es äußerst schwer, sich organisatorisch zusammenzutun oder die politischen Divergenzen zu klären, die noch immer die beiden wichtigsten Strömungen in der Vorkriegs-Linken voneinander trennten: die Bolschewiki um Lenin und die deutsche und polnische Linke um Rosa Luxemburg. Dieser Mangel an Einheit vor dem Krieg machte es um so schwerer, die politischen Stärken von Strömungen in verschiedenen Ländern zum gemeinsamen Erbe aller zu machen und die Schwächen eines jeden zu vermindern.
In keinem Land saß der Schock nach dem Kollaps der Zweiten Internationale so tief wie in Deutschland. Hier wurde das Vertrauen in solche Qualitäten wie der theoretischen Bildung, der politischen Führung, der Zentralisierung oder der Parteidisziplin schwer erschüttert. Die Bedingungen des Krieges, der Krise der Arbeiterbewegung erschwerte die Wiederherstellung solch eines Vertrauens. (33)
Schlussfolgerung
In diesem Artikel haben wir uns auf die Schwächen konzentriert, die bei der Formierung der Partei auftauchten. Dies war notwendig, um die Niederlage Anfang 1919 zu verstehen, das Thema des nächsten Artikels. Doch trotz dieser Schwächen waren jene, die zur Gründung der KPD zusammenkamen, die besten Repräsentanten ihrer Klasse und verkörperten all das Edelmütige und Großherzige in der Menschheit, die wahren Repräsentanten einer besseren Zukunft. Wir werden auf dieses Thema am Ende dieser Serie zurückkommen.
Die Vereinigung der revolutionären Kräfte, die Bildung einer politischen Führung des Proletariats, die den Namen verdient, war zur zentralen Frage der Revolution geworden. Niemand verstand dies besser als jene Klasse, die von diesem Prozess direkt bedroht war. Vom 9. November an war die Hauptstoßrichtung des politischen Lebens der Bourgeoisie auf die Liquidierung des Spartakusbundes gerichtet. Die KPD war inmitten dieser Pogromatmosphäre gegründet worden, die die entscheidenden Schläge gegen die Revolution vorbereitete, die bald folgen sollten.
Dies wird das Thema des nächsten Artikels sein.
Steinklopfer
(1) Sozialdemokratische Partei Deutschlands
(2) Deutsche Soldaten in „feldgrauer“ Uniform.
(3) Internationale Kommunisten Deutschlands
(4) Die Tagesordnung, die im Einladungsschreiben angekündigt worden war, war: 1. Die Krise in der USPD; 2. Programm des Spartakusbundes; 3. Nationalversammlung; 4. Internationale Konferenz.
(5) Jogiches auf der anderen Seite wollte offensichtlich, dass die Obleute an der Gründung der Partei teilnehmen.
(6) Sechs der Militanten, die auf dieser Konferenz anwesend waren, sind in den darauf folgenden Monaten von den deutschen Behörden ermordet worden.
(7) Der Gründungsparteitag der KPD. Protokoll und Materialien. Herausgeber: Hermann Weber.
(8) Eugen Leviné wurde einige Monate später als einer der Führer der bayrischen Räterepublik hingerichtet.
(9) Frölich, ein prominenter Repräsentant der Bremer Linken, sollte später eine berühmte Biographie über Rosa Luxemburg schreiben.
(10) Protokoll und Materialien, S. 222.
(11) Obgleich er bald darauf jegliche Klassenpartei vollständig als bürgerlich ablehnte und eine eher individuelle Auffassung über die Entwicklung des Klassenbewusstseins entwickelte, blieb Otto Rühle dem Marxismus und der Sache der Arbeiterklasse treu verbunden. Schob auf dem Kongress war er Anhänger der „Einheitsorganisationen“ (politisch-ökonomische Gruppierungen), die nach seiner Auffassung sowohl die Partei als auch die Gewerkschaften ersetzen sollten. Luxemburg antwortete auf diese Auffassung, dass die Alternative zu den Gewerkschaften die Arbeiterräte und Massenorgane seien, nicht die Einheitsorganisationen.
(12) Protokoll und Materialien, S. 222.
(13) Laut Clara Zetkin wollte Jogiches in Reaktion auf die Diskussionen den Kongress scheitern lassen, d.h. die Parteigründung verschieben.
(14) Ebenda, S. 214.
(15) Ebenda, S. 206. Laut den Protokollen wurde dieser Vorschlag mit Rufen wie: „Ganz richtig!“ begrüßt. Glücklicherweise wurde Fränkels Antrag niedergestimmt.
(16) Ebenda, S. 209. Aus dem gleichen Grunde sagte Gelwitzki am Vortag, dass es eine Schande gewesen sei, die Frage überhaupt diskutiert zu haben. Und als Fritz Heckert, der nicht den gleichen revolutionären Ruf genoss wie Luxemburg oder Liebknecht versuchte, die Position des Zentralkomitees zur Beteiligung an den Parlamentswahlen zu verteidigen, wurde er durch einen Zwischenruf von Jakob unterbrochen, „hier spricht der Geist Noskes“ (S. 117). Noske, der sozialdemokratische Innenminister der damaligen bürgerlichen Regierung ging in die Geschichte ein als der „Bluthund der Konterrevolution“.
(17) Ebenda S. 224
(18) „Der Kongress verdeutlichte stark die Jugend und Unerfahrenheit der Partei. Die Verbindung zu den Massen war sehr schwach. Der Kongress bezog eine ironische Haltung gegenüber den linken Unabhängigen. Ich hatte nicht das Gefühl, schon eine Partei vor mir zu haben“.
(19) Ebenda S. 99-100
(20) Ebenda S. 271
(21) Ebenda S. 290
(22) Ebenda S. 302
(23) Siehe die Argumente Marxens und Engels im Bund der Kommunisten nach der Niederlage der Revolution 1848-1849.
(24) Protokolle und Materialien, S. 42, 43
(25) Ein Großteil der ausgeschlossenen Mehrheit gründete später die KAPD. Plötzlich gab es in Deutschland zwei kommunistische Parteien, eine wahrlich tragische Spaltung der revolutionären Kräfte!
(26) Max Hoelz, Sympathisant der KPD und der KAPD, dessen bewaffnete Unterstützer in Mitteldeutschland Anfang der 1920er Jahre aktiv waren.
(27) Walter Fähnders, Martin Rector: Linksradikalismus und Literatur, Untersuchungen zur Geschichte der sozialistischen Literatur in der Weimarer Republik.
(28) S. 262, Adam Scharrer, ein führender Kopf der KAPD, verteidigte bis zur Niederschlagung der linkskommunistischen Organisationen 1933weiterhin die Notwendigkeit einer revolutionären Klassenpartei.
(29) Die erste radikale sozialistische Jugendbewegung tauchte in Belgien in den 1860er Jahren auf, als junge Militante (mit einigermaßen Erfolg) unter den Soldaten in den Kasernen Agitation betrieben, um sie daran zu hindern, gegen streikende Arbeiter eingesetzt zu werden.
(30) Siehe Scharrers 1929 geschriebener Roman Vaterlandslose Gesellen sowie die Bibliographie und die Kommentare in „Arbeitskollektiv proletarisch-revolutionärer Romane“, veröffentlicht vom Oberbaumverlag Berlin.
(31) Einer der wichtigsten Zeitzeugen dieses Kapitels der Geschichte is Willi Münzenberg zum Beispiel in seinem Buch Die Dritte Front (Aufzeichnungen aus 15 Jahren proletarischer Jugendbewegung), zuerst 1930 veröffentlicht.
(32) Der anerkannte Führer der sozialistischen Vorkriegsjugend in Deutschland war Karl Liebknecht und in Italien Amadeo Bordiga.
(33) Das Beispiel der Reifung der sozialistischen Jugend in der Schweiz unter dem Einfluss regelmäßiger Diskussionen mit den Bolschewiki während des Krieges belegt, was unter günstigeren Bedingungen möglich war. „Mit großem psychologischem Geschick zog Lenin die Jugendlichen an sich heran, ging zu ihren Diskussionsabenden, lobte und kritisierte stets in offensichtlicher Teilnahme. Ferdy Böhny schrieb später: „Die Art, wie er mit uns diskutierte, glich dem sokratischen Gespräch.“ (Babette Gross, Willi Münzenberg, Eine politische Biografie, S. 93).
Leute:
- Liebknecht [154]
- Luxemburg [155]
- Jogiches [156]
- Richard Müller [161]
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Historische Ereignisse:
- Deutsche Revolution 1918 [162]
- 1919 [163]
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Theoretische Fragen:
- Internationalismus [69]
Erbe der kommunistischen Linke:
Griechenland: Gewerkschaftshausbesetzung: Bestimmen wir unsere Geschichte selbst, oder andere werden sie ohne uns bestimmen
- 4053 reads
Wir veröffentlichen eine Erklärung von kämpfenden Arbeitern aus Athen, die sich selbst als „aufständische Arbeiter" bezeichnen. Sie besetzen seit dem 17. Dezember den Sitz der GSEE (Allgemeiner Gewerkschaftsbund Griechenlands), welcher der Zentralsitz der Gewerkschaft ist und haben daraus einen Ort gemacht, wo man Vollversammlungen abhalten kann, Versammlungen die offen für alle sind.
Wir veröffentlichen eine Erklärung von kämpfenden ArbeiterInnen aus Athen, die sich selbst als „aufständische Arbeiter" bezeichnen. Sie halten seit dem 17. Dezember den Sitz der GSEE (Allgemeiner Gewerkschaftsbund Griechenlands) besetzt und haben daraus einen Ort gemacht, wo man Vollversammlungen abhalten kann, Versammlungen, die offen für alle sind.
Der Text auf dem Transparent, das fast eine ganze Fassadenseite der besetzten Gewerkschaftszentrale bedeckt, lautet:
* Angefangen von den so genannten Arbeitsunfällen bis hin zu den kaltblütigen Hinrichtungen - Staat und Kapital morden!
* Stoppt die Repression - sofortige Freilassung der Gefangenen!
* Generalstreik!
* Die Selbstorganisation der Arbeiter wird das Grab der Bosse sein!
Hervorzuheben gilt auch, dass ein fast identisches Szenario an der ökonomischen Fakultät der Athener Universität abläuft.
Wir werden später detaillierter auf die Ereignisse zurückkommen, die sich seit dem 6. Dezember in ganz Griechenland abspielen. Im Moment wollen wir die Schweigemaur durchbrechen, die von der verlogenen Berichterstattung der bürgerlichen Medien aufgebaut worden ist. Die Kämpfe werden lediglich als Krawalle einzelner jugendlicher Anarchisten dargestellt, die die Bevölkerung terrorisieren. Die Erklärung zeigt im Gegenteil, wie das solidarische Gefühl der Arbeiterklasse diese Bewegung auszeichnet und somit auch die verschiedenen Generationen der Proletarier verbindet.
***********
Wir, Handarbeiter, Angestellte, Erwerbslose, Zeitarbeiter, ob hier geboren oder eingewandert - wir sind keine passiven Fernsehkonsumenten. Seit dem Mord an Alexandros Grigoropoulos Samstagnacht nehmen wir an den Demonstrationen teil, an den Zusammenstößen mit der Polizei, den Besetzungen der Innenstadt oder der Wohnviertel. Immer wieder haben wir unsere Arbeit und unsere täglichen Verpflichtungen fallen gelassen, um mit den Schülern, Studenten und den anderen kämpfenden Proletariern auf die Straße zu gehen.
Wir haben entschieden, das Gebäude der GSEE zu besetzen:
* um es in einen Ort des freien Meinungsaustausches und in einen Treffpunkt für ArbeiterInnen zu verwandeln;
* um den von den Medien verbreiteten Irrglauben, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen nicht an den Zusammenstößen der letzten Tage beteiligt waren, dass die um sich greifende Wut die Sache von 500 „Vermummten“, „Hooligans“ sei, sowie andere Ammenmärchen, die verbreitet werden, zu widerlegen. Auf den Fernsehschirmen werden die ArbeiterInnen als Opfer der Unruhen dargestellt, während gleichzeitig die unzähligen Entlassungen infolge der kapitalistischen Krise in Griechenland und der restlichen Welt von den Medien und ihren Managern als „Naturereignisse“ betrachtet werden;
* um die Rolle der Gewerkschaftsbürokratie bei der Untergrabung des Aufstandes - und nicht nur dort - aufzudecken. Die GSEE und der ganze seit Jahrzehnten dahintersteckende gewerkschaftliche Apparat untergraben die Kämpfe, handeln Brosamen für unsere Arbeitskraft aus und verewigen das System der Ausbeutung und der Lohnsklaverei. Das Vorgehen der GSEE am letzten Mittwoch (dem Tag des Generalstreiks) ist ziemlich erhellend: Die GSEE sagte eine vorgesehene Demonstration der streikenden ArbeiterInnen ab, stattdessen gab es eine kurze Kundgebung am Syntagma-Platz, bei der Erstere aus Furcht davor, dass sie vom Virus des Aufstandes angesteckt werden, dafür sorgte, dass die Leute in aller Eile den Platz verließen;
* um diesen Ort, der durch unsere Beiträge errichtet wurde, von dem wir aber ausgeschlossen waren, zum ersten Mal zu einem offenen Ort zu machen. Einem offenen Ort, der die gesellschaftliche Öffnung, die der Aufstand hervorgebracht hat, fortsetzt. All die vielen Jahre haben wir schicksalhaft allen möglichen Heilsverkündern geglaubt und dabei unsere Würde verloren. Als Arbeiter und Arbeiterinnen müssen wir unsere Sache selbst in die Hand nehmen und Schluss damit machen, auf kluge Anführer oder „fähige“ Vertreter zu hoffen. Wir müssen unsere Stimme gegen die ständigen Angriffe erheben, uns treffen, miteinander reden, zusammen entscheiden und handeln. Gegen die allgemeinen Angriffe einen langen Kampf führen. Die Entwicklung eines kollektiven Widerstandes an der Basis ist der einzige Weg dazu;
* um die Idee der Selbstorganisation und Solidarität an den Arbeitsplätzen, der Kampfkomitees und des kollektiven Handelns der Basis zu verbreiten und dadurch die Gewerkschaftsbürokratien abzuschaffen.
All die Jahre haben wir das Elend hinuntergeschluckt, die Ausnutzung der Situation der Schwächeren, die Gewalt auf der Arbeit. Wir haben uns daran gewöhnt, die Verkrüppelten und die Toten - die sogenannten „Arbeitsunfälle“ - einfach nur noch zu zählen. Wir haben uns daran gewöhnt, zu ignorieren, dass die Migranten, unsere Klassenbrüder- und schwestern, getötet werden. Wir haben die Schnauze voll davon, mit der Angst um unseren Lohn und in Aussicht auf eine Rente zu leben, die sich mittlerweile wie ein in die Ferne entrückter Traum anfühlt.
So wie wir darum kämpfen, unser Leben nicht für die Bosse und die Gewerkschaftsvertreter zu vergeuden, so werden wir auch keinen der verhafteten Aufständischen allein lassen, die sich in den Händen des Staates und der Justizmaschine befinden.
Sofortige Freilassung der Festgenommenen!
Keine Strafe für die Verhafteten!
Selbstorganisation der Arbeiter und Arbeiterinnen!
Generalstreik!
Die Arbeiter-Versammlung im „befreiten“ Gebäude der GSEE
Mittwoch, 17. Dezember 2008, 18:00 Uhr.
Die Vollversammlung der aufständischen ArbeiterInnen
(Die Besetzung des GSEE-Gebäudes wurde am 21. Dezember beendet und ging am Polytechnischen Institut weiter...)
Geographisch:
- Griechenland [165]
Aktuelles und Laufendes:
- Griechenland [166]
- Studenten- und Arbeiterunruhen [167]
- Studentenbewegung [168]
Leute:
- Aufständische Arbeiter [169]
Theoretische Fragen:
- Arbeiterklasse [58]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Proletarischer Kampf [37]
Solidarität mit der Bewegung der Studenten in Griechenland!
- 4525 reads
Der Ausbruch der Wut und der Revolte der jungen Arbeitergenerationen in Griechenland ist kein isoliertes oder besonderes Phänomen. Ihre Wurzeln liegen in der Weltwirtschaftskrise des Kapitalismus. Der Zusammenstoß der Protestierenden mit dem gewalttätigen Unterdrückungsapparat entblößt das wahre Gesicht der bürgerlichen Herrschaft und des Staatsterrors. Es ist eine direkte Fortsetzung der Mobilisierung der Jugendlichen auf einem Klassenterrain wie in Frankreich im Zusammenhang mit dem CPE-Gesetz im Frühjahr 2006 und dem LRU 2007, als die Studenten und Gymnasiasten sich vor allem als zukünftige Beschäftigte sahen, die gegen ihre künftigen Ausbeutungsbedingungen protestierten. Alle Herrschenden der wichtigsten europäischen Länder haben dies auch so verstanden, denn sie haben ihre Besorgnis zum Ausdruck gebracht, dass ähnliche soziale Explosionen aus Widerstand gegen die Zuspitzung der Krise auch woanders ausbrechen. So hat bezeichnenderweise die herrschende Klasse in Frankreich einen Rückzieher gemacht, indem sie ganz überstürzt ihr Programm zur Reformierung der Gymnasien (siehe dazu den Artikel auf unserer französischsprachigen Website) vorläufig auf Eis gelegt hat. Der internationale Charakter der Proteste und die wachsende Kampfbereitschaft der Studenten und vor allem der Schüler ist schon deutlich zu spüren.
Der Ausbruch der Wut und der Revolte der jungen Arbeitergenerationen in Griechenland ist kein isoliertes oder besonderes Phänomen. Ihre Wurzeln liegen in der Weltwirtschaftskrise des Kapitalismus. Der Zusammenstoß der Protestierenden mit dem gewalttätigen Unterdrückungsapparat entblößt das wahre Gesicht der bürgerlichen Herrschaft und des Staatsterrors. Es ist eine direkte Fortsetzung der Mobilisierung der Jugendlichen auf einem Klassenterrain wie in Frankreich im Zusammenhang mit dem CPE-Gesetz im Frühjahr 2006 und dem LRU 2007, als die Studenten und Gymnasiasten sich vor allem als zukünftige Beschäftigte sahen, die gegen ihre künftigen Ausbeutungsbedingungen protestierten. Alle Herrschenden der wichtigsten europäischen Länder haben dies auch so verstanden, denn sie haben ihre Besorgnis zum Ausdruck gebracht, dass ähnliche soziale Explosionen aus Widerstand gegen die Zuspitzung der Krise auch woanders ausbrechen. So hat bezeichnenderweise die herrschende Klasse in Frankreich einen Rückzieher gemacht, indem sie ganz überstürzt ihr Programm zur Reformierung der Gymnasien (siehe dazu den Artikel auf unserer französischsprachigen Website) vorläufig auf Eis gelegt hat. Der internationale Charakter der Proteste und die wachsende Kampfbereitschaft der Studenten und vor allem der Schüler ist schon deutlich zu spüren.
In Italien fanden am 25. Oktober und am 14. November massive Demonstrationen unter dem Motto „Wir wollen nicht für die Krise blechen“ gegen die Regierungsverordnung von Gelmini statt, die zahlreiche Einschnitte im Erziehungswesen mit drastischen Konsequenzen anstrebt: So sollen zum Beispiel die Zeitverträge von 87.000 Lehrern und 45.000 anderen Beschäftigten des Erziehungswesens nicht verlängert werden. Gleichzeitig sollen umfangreiche Kürzungen in den Universitäten vorgenommen werden.
In Deutschland sind am 12. November ca. 120.000 Schüler in den meisten Großstädten des Landes auf die Straße gegangen und haben zum Teil Parolen gerufen wie „Der Kapitalismus ist die Krise“ (Berlin) oder das Landesparlament in Hannover belagert.
In Spanien sind am 13. November Hunderttausende Studenten in mehr als 70 Städten auf die Straße gegangen, um gegen die neuen, europaweit gültigen Bologna-Bestimmungen der Bildungsreform und der Universitäten zu protestieren, in denen u.a. die Privatisierung der Universitäten und immer mehr Praktika in den Unternehmen vorgesehen sind.
Viele von ihnen identifizieren sich mit dem Kampf der griechischen Studenten. In vielen Ländern sind zahlreiche Kundgebungen und Solidaritätsveranstaltungen gegen die Repression, unter der die griechischen Studenten leiden, organisiert worden, wobei die Polizei auch sehr oft gewaltsam dagegen vorgegangen ist.
Das Ausmaß der Mobilisierung gegen diese gleichen, staatlichen Maßnahmen überrascht keineswegs. Die europaweite Reform des Bildungswesens dient der Anpassung der jungen Arbeitergeneration an eine perspektivlose Zukunft und der Generalisierung prekärer Arbeitsbedingungen sowie der Arbeitslosigkeit.
Der Widerstand und die Revolte der neuen Generationen von Schülern, die die zukünftigen Beschäftigten stellen werden, gegen die Arbeitslosigkeit und dieses ganze Ausmaß an Prekarisierung lässt überall ein Gefühl der Sympathie unter den ArbeiterInnen aufkommen, das bei allen Generationen zu spüren ist.
Gewalt durch Minderheiten oder massiver Kampf gegen die Ausbeutung und den Staatsterror?
Die in den Diensten der Lügenpropaganda des Kapitals stehenden Medien haben permanent versucht, die Wirklichkeit der Ereignisse in Griechenland seit der Ermordung des 15jährigen Alexis Andreas Grigropoulos am 6. Dezember zu verzerren. Sie stellen die Zusammenstöße mit der Polizei entweder als das Werk einer Handvoll autonomer Anarchisten und linksextremer Studenten aus einem wohlbetuchten Milieu dar oder als das Vorgehen von Schlägern aus Randgruppen. Ständig werden in den Medien Bilder von gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei gesendet. Vor allem erscheinen Bilder von Jugendlichen, die Autos anstecken, Schaufenster von Geschäften und Banken zerschlagen, oder Bilder von Plünderungen von Geschäften.
Das ist die gleiche Fälschungsmethode, die 2006 gegen die Proteste gegen den CPE in Frankreich angewandt wurde, als die Proteste der Studenten mit den Aufständen in den Vorstädten von Paris im Herbst 2005 in den gleichen Topf geworfen wurden. Es ist das gleiche Vorgehen wie bei den Protesten gegen den LRU 2007 in Frankreich, als die Demonstranten als „Terroristen“ oder „Rote Khmer“ beschimpft wurden.
Aber auch wenn das Zentrum der Zusammenstöße im griechischen „Quartier Latin“, in Exarcia, lag, kann man heute solch Lügen nur viel schwerer verbreiten. Wie könnten diese aufständischen Erhebungen das Werk von Randalierern oder anarchistischen Aktivisten sein, da sie sich doch lawinenartig auf alle Städte das Landes und selbst bis auf die Inseln (Chios, Samos) und bis in die großen Touristenhochburgen wie Korfu oder Kreta oder Heraklion ausgedehnt haben?
Die Gründe für die Wut
Alle Ingredienzien waren vorhanden, damit die Unzufriedenheit eines Großteils der jungen Arbeitergeneration sich ein Ventil sucht. Diese Generation hat Angst vor der Zukunft, die ihnen der Kapitalismus bietet. Griechenland verdeutlicht die Sackgasse, in welcher der Kapitalismus steckt und die auf alle Jugendlichen zukommen wird. Wenn diejenigen, die die „Generation der 600 Euro-Jobber“ genannt wird, auf dem Arbeitsmarkt auftauchen, haben sie den Eindruck, verarscht zu werden. Die meisten Studenten können ihr Studium nur finanzieren und überleben, indem sie in zwei Jobs schuften. Sie müssen kleine Jobs, meist unterbezahlte Schwarzarbeit, annehmen. Selbst in besser bezahlten Jobs wird ein Großteil des Lohns nicht versteuert, wodurch der Anspruch auf Sozialleistungen geschmälert wird. Insbesondere gelangen sie nicht in den Genuss der Sozialversicherung. Überstunden werden ebensowenig bezahlt. Oft können sie bis Mitte 30 nicht von zu Hause ausziehen, weil sie keine Miete zahlen können. 23 Prozent der Arbeitslosen in Griechenland sind Jugendliche (die Jugendarbeitslosigkeit der 15 bis 24-Jährigen beträgt offiziell 25,2 Prozent). Wie eine französische Zeitung schrieb: „Diese Studenten fühlen sich durch niemanden mehr geschützt: Die Polizei schlägt auf sie ein bzw. schießt auf sie; durch das Bildungswesen stecken sie in einer Sackgasse, einen Job kriegen sie nicht, die Regierung belügt sie.“ (1) Die Jugendarbeitslosigkeit und ihre Schwierigkeiten in der Arbeitswelt haben somit ein Klima der allgemeinen Verunsicherung, der Wut und der Angst geschaffen. Die Weltwirtschaftskrise löst immer neue Wellen von Entlassungen aus. 2009 erwartet man allein in Griechenland den Abbau von mehr als 100.000 Arbeitsplätzen; dies allein würde fünf Prozent mehr Arbeitslose bedeuten. Gleichzeitig verdienen mehr als 40 Prozent der Beschäftigten weniger als 1100 Euro brutto im Monat. In Griechenland gibt es die meisten Niedriglöhner unter den 27 Staaten der EU: 14 Prozent.
Aber nicht nur die Jugendlichen sind auf die Straße gegangen, sondern auch die schlecht bezahlten Lehrer und viele Beschäftigte, die den gleichen Problemen, der gleichen Armut gegenüberstehen und von dem gleichen Gefühl der Revolte angetrieben werden. Die brutale Repression gegen die Bewegung, bei der der Mord an dem 15-jährigen Jugendlichen nur die dramatischste Episode war, hat dieses Gefühl der Solidarität nur noch gestärkt. Die soziale Unzufriedenheit bricht sich immer stärker Bahn. Wie ein Student berichtete, waren auch viele Eltern zutiefst schockiert über die Ereignisse: „Unsere Eltern haben festgestellt, dass ihre Kinder durch die Schüsse eines Polizisten ums Leben kommen“ (2). Sie haben den Fäulnisprozess einer Gesellschaft gerochen, in der ihre Kinder nicht den gleichen Lebensstandard erreichen werden wie sie. Auf zahlreichen Demonstrationen haben sie mit eigenen Augen das gewalttätige Vorgehen der Polizei, die brutalen Verhaftungen, den Einsatz von Schusswaffen durch die Ordnungskräfte und das harte Eingreifen der Bereitschaftspolizei (MAT) beobachten können.
Nicht nur die Besetzer der Polytechnischen Hochschule, das Zentrum der Studentenproteste, prangern den Staatsterror an. Diese Wut über die polizeiliche Repression trifft man auch auf allen Demonstrationen an, wo Parolen gerufen werden wie: „Kugeln gegen die Jugendlichen, Geld für die Banken“. Noch deutlicher war ein Teilnehmer der Bewegung, der erklärte: „Wir haben keine Arbeit, kein Geld; der Staat ist wegen der Krise pleite, und die einzige Reaktion, die wir sehen, ist, dass man der Polizei noch mehr Waffen gibt“ (3).
Diese Wut ist nicht neu. Schon im Juni 2006 waren die Studenten gegen die Universitätsreform auf die Straße gegangen, da die Privatisierung der Unis den weniger wohlhabenden Studenten den Zugang zur Uni verwehrte. Die Bevölkerung hat auch gegen die Schlamperei der Regierung während der Waldbrände im Sommer 2007 protestiert, als 67 Menschen zu Tode gekommen waren. Die Regierung hat bis heute noch nicht jene Menschen entschädigt, die ihre Häuser, ihr Hab und Gut verloren hatten. Aber vor allem die Beschäftigten waren massiv gegen die Regierungspläne einer „Rentenreform“ auf den Plan getreten; Anfang 2008 fand zweimal innerhalb von zwei Monaten ein Generalstreik mit hoher Beteiligung statt. Damals beteiligten sich mehr als eine Millionen Menschen an den Demonstrationen gegen die Abschaffung des Vorruhestands für Schwerabeiter und die Aufkündigung der Vorruhestandsregelung für über 50-jährige Arbeiterinnen.
Angesichts der Wut der Beschäftigten sollte der Generalstreik vom 10. Dezember, der von den Gewerkschaften kontrolliert wurde, als Ablenkungsmanöver gegen die Bewegung dienen. Die Gewerkschaften forderten, mit der SP und der KP an der Spitze, den Rücktritt der gegenwärtigen Regierung und vorgezogene Neuwahlen. Allerdings konnten die Wut und die Bewegung nicht eingedämmt werden - trotz der verschiedenen Manöver der Linksparteien und der Gewerkschaften, um die Dynamik bei der Ausdehnung des Kampfes zu hemmen, und trotz all der Anstrengungen der herrschenden Klasse und ihrer Medien zur Isolierung der Jugendlichen gegenüber den anderen Generationen und der gesamten Arbeiterklasse, indem man versuchte, diese in sinnlose Zusammenstöße mit der Polizei zu treiben. Die ganze Zeit über gab es immer wieder Zusammenstöße: gewaltsames Vorgehen der Polizei mit Gummiknüppel und Tränengaseinsätzen, Verhaftungen und Verprügeln von Dutzenden von Protestierenden.
Die jungen Arbeitergenerationen bringen am klarsten das Gefühl der Desillusionierung und der Abscheu gegenüber einem total korrupten politischen Apparat zum Ausdruck. Seit dem Krieg teilen sich drei Familien die Macht und seit mehr als 30 Jahren herrschen in ständigem Wechsel die beiden Dynastien Karamanlis (auf dem rechten Flügel) und Papandreou (auf dem linken Flügel) - begleitet jeweils von großen Bestechungsaffären und Skandalen. Die Konservativen haben 2004, nach großen Skandalen der Sozialisten in den Jahren zuvor, die Macht übernommen. Viele lehnen mittlerweile den ganzen politischen und gewerkschaftlichen Apparat ab, der immer mehr an Glaubwürdigkeit verliert. „Der Geldfetisch beherrscht die Gesellschaft immer mehr. Die Jugendlichen wollen mit dieser seelenlosen und visionslosen Gesellschaft brechen.“ (4) Vor dem Hintergrund der Krise hat diese Generation von Arbeitern nicht nur ihr Bewusstsein über eine kapitalistische Ausbeutung weiterentwickelt, die sie an ihrem eigenen Leib spürt, sondern sie bringt auch das Bewusstsein für die Notwendigkeit eines gemeinsamen Kampfes zum Ausdruck, indem sie spontan die Methoden der Arbeiterklasse anwendet und ihre Solidarität sucht. Anstatt der Hoffnungslosigkeit zu verfallen, gewinnt sie ihr Selbstvertrauen aus der Tatsache, dass sie die Trägerin einer neuen Zukunft ist; sie setzt sich mit aller Macht gegen den Fäulnisprozess der Gesellschaft zu Wehr, in der sie lebt. So haben die Demonstranten ihren Stolz zum Ausdruck gebracht, als sie riefen: „Wir stellen ein Bild der Zukunft gegenüber einer sehr düsteren Vergangenheit dar“.
Die Lage erinnert an die Verhältnisse im Mai 1968, aber das Bewusstsein dessen, was heute auf dem Spiel steht, geht viel weiter.
Die Radikalisierung der Bewegung
Am 16. Dezember besetzten Studenten wenige Minuten lang die Studios des Regierungsenders NET und rollten vor den Kameras ein Spruchband aus: „Hört auf, Fernsehen zu sehen. Kommt alle auf die Straße!“. Und sie riefen dazu auf: „Der Staat tötet. Euer Schweigen ist seine Waffe. Besetzen wir alle öffentlichen Gebäude!“ Der Sitz der Bürgerkriegspolizei Athens wurde angegriffen und ein Fahrzeug dieser Polizeitruppen angezündet. Diese Aktionen wurden daraufhin sofort von der Regierung als „Versuch des Umsturzes der Demokratie“ gebrandmarkt und auch von der KP Griechenlands (KKE) verurteilt. Am 17. Dezember wurde das Gebäude der größten Gewerkschaft Griechenlands GSEE (Allgemeiner Gewerkschaftsbund Griechenlands) in Athen von Beschäftigten besetzt, die die ArbeiterInnen dazu aufriefen, an diesem Ort zusammenzukommen, um Vollversammlungen abzuhalten, die allen Beschäftigten, allen StudentInnen und den Arbeitslosen offen stehen (siehe dazu die auf unserer Website und in dieser Zeitung veröffentlichte Erklärung). Vor der Akropolis wurden Spruchbänder angebracht, die zu einer Massenkundgebung am folgenden Tag aufriefen. Am Abend versuchten ca. 50 Gewerkschaftsbonzen und deren Führer, die Gewerkschaftszentrale zurückzuerobern, mussten aber vor den Studenten, die schnell Verstärkung erhielten, die Flucht ergreifen. Diese Verstärkung kam vor allem von meist anarchistischen Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, die ebenfalls besetzt und in einen Ort der Versammlungen und Diskussionen umgewandelt worden war, der auch allen Beschäftigen offen stand. Man eilte den Besetzern zur Hilfe und rief: „Solidarität“. Der Verband albanischer Migranten verbreitete u.a. einen Text, in dem er seine Solidarität mit der Bewegung bekundete: „Diese Tage sind auch unsere Tage“! Immer lauter wurde zu einem unbefristeten Generalstreik aufgerufen. Die Gewerkschaften sahen sich gezwungen, am 18. Dezember zu einem dreistündigen Generalstreik im öffentlichen Dienst aufzurufen.
Am Morgen des 18. Dezember wurde ein weiterer Schüler, 16 Jahre alt, der sich an einem Sit-in in der Nähe seiner Schule in einem Athener Vorort beteiligte, von einer Kugel verletzt. Am gleichen Tag wurden mehrere Radio- und Fernsehstudios durch Demonstranten besetzt, insbesondere in Tripoli, Chania und Thessaloniki. Das Gebäude der Handelskammer in Patras wurde besetzt, wo es erneut zu Zusammenstößen mit der Polizei kam. Die gigantische Demonstration in Athen wurde gewaltsam angegriffen. Dabei setzte die Bürgerkriegspolizei neue Waffen ein: lähmende Gase und ohrenbetäubende Granaten. Ein Flugblatt, das sich gegen den Staatsterror richtete, wurde von „revoltierenden Schülerinnen“ unterzeichnet und in der Wirtschaftswissenschaftlichen Universität verteilt. Die Bewegung spürte ganz vage ihre eigenen geographischen Grenzen. Deshalb nahm sie mit Enthusiasmus die internationalen Solidaritätsdemonstrationen in Frankreich, Berlin, Rom, Moskau, Montreal oder in New York auf. Die Rückmeldung lautete: „Diese Unterstützung ist für uns sehr wichtig“. Die Besetzer der Polytechnischen Hochschule riefen zu einem „internationalen Aktionstag gegen die staatlichen Tötungen“ am 20. Dezember auf. Der einzige Weg, die Isolierung dieses proletarischen Widerstandes in Griechenland zu überwinden, besteht darin, die Solidarität und den Klassenkampf, die heute als Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise immer deutlicher in Erscheinung treten, international zu entfalten.
Iannis, 19.12.08
(1) Marianne Nr. 608, 13. Dezember 2008 : „Grèce : les leçons d'une émeute“.
(2) Libération, 12. Dezember 2008.
(3) Le Monde , 10. Dezember 2008.
(4) Marianne, s.o.
Aktuelles und Laufendes:
IKSonline - 2009
- 3631 reads
Januar 2009
- 823 reads
Gaza: Solidarität mit den Opfern erfordert Klassenkampf gegen alle Ausbeuter!
- 4384 reads
Nachdem die Wirtschaft des Gazastreifens durch die Blockade von Öllieferungen und Medikamenten, die Verhinderung des Exportes und es palästinensischen Arbeitern unmöglich gemacht wurde, auf israelischem Gebiet Arbeit zu suchen, zwei Jahre lang erstickt wurde, nachdem der ganze Gazastreifen in ein gewaltiges Gefangenenlager verwandelt wurde, aus dem verzweifelte Palästinenser zu flüchten versuchen, indem sie die Grenze nach Ägypten durchbrechen, unterwirft die israelische Militärmaschine diesen dicht bevölkerten, verarmten Streifen der Erde der ganzen Bestialität einer praktisch endlosen Bombardierung aus der Luft. Hunderte Menschen sind schon ermordet worden und die schon völlig überforderten Krankenhäuser können den endlosen Strom von Verwundeten nicht mehr aufnehmen.
Nachdem die Wirtschaft des Gazastreifens durch die Blockade von Öllieferungen und Medikamenten, die Verhinderung des Exportes und es palästinensischen Arbeitern unmöglich gemacht wurde, auf israelischem Gebiet Arbeit zu suchen, zwei Jahre lang erstickt wurde, nachdem der ganze Gazastreifen in ein gewaltiges Gefangenenlager verwandelt wurde, aus dem verzweifelte Palästinenser zu flüchten versuchen, indem sie die Grenze nach Ägypten durchbrechen, unterwirft die israelische Militärmaschine diesen dicht bevölkerten, verarmten Streifen der Erde der ganzen Bestialität einer praktisch endlosen Bombardierung aus der Luft. Hunderte Menschen sind schon ermordet worden und die schon völlig überforderten Krankenhäuser können den endlosen Strom von Verwundeten nicht mehr aufnehmen. Die Behauptung Israels, es versuche die Zahl ziviler Opfer zu begrenzen, ist ein schmutziger Witz, liegt doch jedes ‚militärische’ Ziel in dicht besiedelten Gebieten, meist direkt neben Wohngebäuden, und da Moscheen und die islamische Universität offen als Ziele ausgewählt wurden, ist die Unterscheidung zwischen zivilen und militärischen Zielen völlig sinnlos geworden. Die Folgen liegen auf der Hand: Unzählige Zivilisten, darunter viele Kinder, wurden getötet oder verletzt, eine noch größere Zahl durch die nicht aufhörenden Bombenangriffe terrorisiert und traumatisiert. Während wir diesen Artikel verfassen, beschreibt der israelische Premierminister Ehud Olmert die Offensive als nur die erste Stufe. Panzer stehen zum Einmarsch bereit und eine breit gefächerte Bodenoffensive wird nicht ausgeschlossen.
Die israelische Rechtfertigung für diese Grausamkeiten – die von der Bush-Administration in den USA unterstützt wird – ist, dass Hamas trotz des sogenannten Waffenstillstandes immer wieder israelische Zivilisten mit Raketen beschossen hat. Das gleiche Argument wurde vor zwei Jahren vorgebracht, um die Invasion des Südlibanons zu rechtfertigen. Es stimmt zwar, dass Hisbollah und Hamas sich hinter der palästinensischen und libanesischen Bevölkerung verstecken und diese zynisch den israelischen Racheakten ausliefern, bei denen jeweils der Tod einer Handvoll von israelischen Zivilisten als ein Beispiel des ‚Widerstandes’ gegen die israelische militärische Besatzung dargestellt wird. Aber die Reaktion Israels ist absolut typisch für das Vorgehen jeder Besatzungsmacht: Die gesamte Bevölkerung wird für die Taten einer Minderheit von bewaffneten Kämpfern bestraft. Dies geschah schon bei der Wirtschaftsblockade, welche eingeführt wurde, nachdem Hamas bei der Kontrolle des Gazastreifens die Fatah besiegte; das gleiche geschah im Libanon und genau das gleiche machen sie heute bei der Bombardierung des Gazastreifens. Dies ist die barbarische Logik aller imperialistischen Kriege, in denen Zivilisten von beiden Seiten als menschliche Schutzschilde und Ziele eingesetzt werden, und bei denen jeweils immer mehr Zivilisten sterben als uniformierte Soldaten.
Wie bei jedem imperialistischen Krieg hat das Leiden, das der Bevölkerung auferlegt wird, und die absichtliche Zerstörung von Häusern, Krankenhäusern und Schulen, nichts anderes zur Folge als die Vorbereitung neuer Zerstörungswellen. Israel verkündet als sein Ziel die Zerschlagung der Hamas und die Förderung von Möglichkeiten, dass eine eher „moderatere“ Palästinenserführung im Gazastreifen gebildet wird. Aber selbst frühere israelische Nachrichtenoffiziere (zumindest einer der …klügeren von ihnen) erkennen die Nutzlosigkeit dieser Herangehensweise. Der ehemalige Mossad Offizier Yossi Alpher meinte anlässlich der Wirtschaftsblockade: „Die ökonomische Belagerung des Gazastreifens hat keines der erwünschten politischen Ziele verwirklicht. Die Palästinenser sind nicht dazu manipuliert worden, die Hamas zu hassen; all das ist wahrscheinlich konterproduktiv gewesen. Es war nur eine sinnlose Kollektivstrafe.“ Das trifft noch mehr zu für die Luftangriffe. Der israelische Historiker Tom Segev meinte dazu: „Israel hat immer geglaubt, indem man der palästinensischen Zivilbevölkerung Leiden zugefügt wird, würde sich diese gegen ihre nationalen Führer erheben. Diese Annahme hat sich immer wieder als falsch herausgestellt.“ (beide Zitate aus The Guardian, 30.12.08). Im Libanon wurde die Hisbollah 2006 durch die israelischen Angriffe gestärkt; die Offensive im Gazastreifen könnte sehr wohl das gleiche Ergebnis für die Hamas bringen. Aber ob geschwächt oder gestärkt, sie wird sicher mit noch mehr Angriffen auf israelische Zivilisten reagieren. Wenn dies nicht mit Raketenangriffen erfolgt, dann durch eine Neuauflage von Selbstmordattentaten.
Die ‘Spirale der Gewalt’ spiegelt den Niedergang des Kapitalismus wider
„Besorgte“ Führer der Welt wie der Papst oder der UN-Generalsekretär Ban Ki-moon sprechen oft davon, dass das Vorgehen Israels nur dazu führe, den nationalen Hass aufzustacheln und die „Spirale der Gewalt“ im Nahen Osten weiter anzufachen. All das stimmt: der ganze Zyklus von Terrorismus und staatlicher Gewalt in Israel/Palästina brutalisiert die Bevölkerung und die Kämpfer auf beiden Seiten und schafft neue Generationen von Fanatikern und ‚Märtyrern’. Aber was der Vatikan und die UN nicht sagen, ist dass der Abstieg in die Hölle des nationalen Hasses das Ergebnis eines Gesellschaftssystem ist, welches überall Fäulniserscheinungen zeigt. Im Irak sieht es ähnlich aus. Dort packen sich Sunniten und Schiiten an die Kehle, auf dem Balkan kämpfen Albaner oder Kroaten gegen Serben, in Indien/Pakistan Hindus gegen Moslems und in den endlosen Kriegen Afrikas kann man die ethnisch begründeten Kriege gar nicht mehr zählen. Die Explosion all dieser Konflikte auf der Erde sind Zeichen einer Gesellschaft, welche der Menschheit keine Zukunft mehr anzubieten hat.
Und die Beteiligung der ‘besorgten’, ‘humanitär denkenden’, demokratischen Weltmächte bei der Zuspitzung dieser Konflikte wird ebenso verschwiegen, es sei denn die gegnerische Seite in einem Konflikt bringt dies zur Sprache. So schwieg zum Beispiel die britische Presse nicht zur Unterstützung Frankreichs für die Mörderbanden der Hutus 1994 in Ruanda. Sie hält sich mehr zurück bei der Rolle britischer und amerikanischer Geheimdienstkräfte hinsichtlich der Spaltungen zwischen Schiiten und Sunniten im Irak. Im Mittleren Osten sind die Unterstützung der USA für Israel und die Irans und Syriens für Hisbollah und Hamas ein offenes Geheimnis, aber auch andere Mächte wie Frankreich, Deutschland, Russland und andere Länder, die eher eine verdecktere bzw. ausgeglichenere Rolle einnehmen, sind nicht unschuldig.
Der Konflikt im Mittleren Osten hat seine besonderen Aspekte und Ursachen, aber er kann eigentlich nur im Zusammenhang der globalen kapitalistischen Maschinerie verstanden werden, welche außer Kontrolle geraten ist. Die Zunahme von Kriegen auf der ganzen Erde, die unkontrollierbare Wirtschaftskrise, die sich zuspitzende Umweltkatastrophe belegen dies deutlich. Aber während der Kapitalismus uns keine Hoffnung auf Frieden und Wohlstand bietet, gibt es eine andere Hoffnung: Die Erhebung der ausgebeuteten Klasse gegen die Brutalität des Systems. Eine Erhebung, die in Europa in den letzten Wochen durch die Bewegung der jungen Generation in Italien, Frankreich, Deutschland und vor allem Griechenlands zu Tage getreten ist. Diese Bewegungen haben die Notwendigkeit von Klassensolidarität hervorgehoben sowie die Überwindung aller nationaler und ethnischer Spaltungen. Obgleich noch in der Anfangsphase steckend, liefern sie ein Beispiel für das, was in anderen Teilen der Erde, die am meisten von den Spaltungen innerhalb der Ausgebeuteten betroffen sind, aufgegriffen werden kann. Dies ist keine Utopie. In den letzten Jahren schon waren Beschäftigte des öffentlichen Dienstes im Gazastreifen in Streik getreten, um gegen ausstehende Lohnzahlungen zu protestieren, während nahezu gleichzeitig Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Israel gegen die Auswirkungen der Sparpolitik streikten, die wiederum eine direkte Folge der Rüstungswirtschaft ist. Diese Bewegungen waren sich der Existenz der jeweils anderen Bewegungen nicht bewusst, aber sie belegen dennoch die objektiv gemeinsamen Interessen der Arbeiter auf beiden Seiten der imperialistischen Lager.
Solidarität mit der notleidenden Bevölkerung der kapitalistischen Kriegsgebiete bedeutet nicht, ein ‚geringeres Übel’ zu oder eine ‚schwächere’ kapitalistische Bande zu wählen wie Hisbollah oder Hamas gegen die scheinbar offen aggressiver auftretenden Mächte wie die USA oder Israel. Hamas hat schon bewiesen, dass sie eine bürgerliche Kraft darstellt, welche die palästinensischen Arbeiter unterdrückt – insbesondere als sie die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes als Kräfte beschimpfte, die gegen die ‚nationalen Interessen’ handelten, und als sie in der Auseinandersetzung mit der Fatah in einem mörderischen Machtkampf um die Kontrolle der Region die Bevölkerung des Gazastreifens als Geisel nahm. Solidarität mit den Opfern der imperialistischen Kriege erfordert, dass man alle Kriegsparteien verwerfen und den Klassenkampf gegen die Herrschenden und Ausbeuter auf der ganzen Welt entfalten muss. 2.Januar 2009
Geographisch:
- Naher Osten [2]
Aktuelles und Laufendes:
- Hamas [171]
- Hisbollah [172]
- Israel [173]
- Internationalismus [174]
- Palästinakonflikt [175]
- Palästina Gaza [176]
Theoretische Fragen:
- Imperialismus [3]
Erbe der kommunistischen Linke:
Februar 2009
- 813 reads
Debatte: Zur Frage der subjektiven und objektiven Faktoren des Klassenkampfes
- 3566 reads
Die IKS bietet auf ihrer Webseite ihren Lesern die Möglichkeit an, Meinungen und Kommentare zu den einzelnen Artikeln zu hinterlassen, und damit öffentliche Diskussionen anzuregen. Von Stellungnahmen unserer Organisation zu den weltweiten Schüler- und Studentenprotesten ausgehend, hat sich seit Anfang der zweiten Januarwoche daraus eine Art spontaner Blog dazu entwickelt, was wir sehr herzlich begrüßen. Dabei haben v.a. zwei Teilnehmer, Hama und Bruno, teils heftigen Einspruch erhoben gegen unsere Sichtweise dieser Jugendproteste als Zeichen des verstärkten internationalen Widerstandes der Arbeiterklasse gegenüber der sich rasant verschärfenden Wirtschaftskrise. Es stellte sich rasch heraus, dass weder die Einschätzung des proletarischen Charakters der Proteste noch die Aussage über den sich formierenden und sich allmählich verstärkenden Widerstand der Klasse insgesamt auf ungeteilte Zustimmung stießen. Wir müssen zugeben, dass wir jedenfalls anfangs Schwierigkeiten hatten, das genauere Anliegen der Genossen zu begreifen, welche hauptsächlich Kritik erhoben hatten. Umso schöner war es für uns zu erleben, wie – im Verlauf der Diskussion und durch die Diskussion – uns die sehr berechtigten Sorgen dieser Genossen klarer wurden. Dazu beigetragen haben die Kritikführer selbst mit ihrer unermüdlichen Bemühung, ihr Anliegen immer deutlicher zu machen, als auch die Einwände und Fragestellungen der anderen Teilnehmer an der Debatte wie etwa der Genosse Riga. Nicht weniger befriedigend ist es zu erleben, wie im Verlauf die Teilnehmer aufeinander eingehen, ihre Ansichten weiter entwickeln und, wenn nötig, auch korrigieren. Wir verweisen also auf die Beiträge dazu und ermuntern alle unsere Leser, sich an diesem und ähnlichen Blogs zu beteiligen.
Wir wollen nun kurz auf einige wenige Beiträge eingehen, in denen aus unserer Sicht wichtige Entwicklungen in der Diskussion stattfanden und die tiefer liegenden Sorgen und Sichtweisen sich erhellten. Wir werden aus Platzgründen nicht ausführlich aus diesen Beiträgen zitieren, sondern die Ideen zusammenfassen, und verweisen unsere Leser auf die Kommentare, die man ja selber nachlesen kann.
Im Beitrag von Bruno vom 19. Jan. 09 „Nicht mit den Wölfen heulen“ merkt der Genosse selbstkritisch an, dass sein(e) „Sarkasmus und Polemik“ gegenüber der These der erwachenden Kampfbereitschaft der Arbeiterklasse „scheinbar“ (wie er schreibt) in Widerspruch stehen zu seinen eigenen Aussagen damals zur Zeit der Eisenbahnerstreiks in Deutschland. Damals vertrat er ja die Ansicht, dass die Argumente der Ausbeuter, etwa dass wir alle in einem Boot sitzen würden, an Glaubwürdigkeit und Integrationskraft verlören. Auch würde die Klasse sich weniger als vorher durch die Erpressung der Arbeitslosigkeit davon abhalten lassen, sich zu wehren, je mehr die Lohnabhängigen mitbekämen, wohin ein solcher Verzicht führe.
Eine Bemerkung zur Frage der Moral
Bruno erklärt nun, diese Widersprüchlichkeit seiner Argumentation sei Ausdruck einer „moralischen Ungeduld“. Das ist eine couragierte Aussage. Es stoße ihm auf, dass die Menschen erst dann reagieren, wenn sie selbst betroffen werden. Somit kritisiert der Genosse seine eigene bisherige Diskussion als Ausdruck einer moralischen und nicht marxistischen Sichtweise des Klassenkampfes. Wir sind mit dieser Argumentationslinie ganz einverstanden, wobei wir, unsererseits, da wir die Rolle der Moral im Klassenkampf hochschätzen, eher von einem „moralisierenden“ als von einem „moralischen“ Ansatz sprechen würden, den es zu überwinden gilt.
Hier hat der Genosse jedenfalls eine sehr wertvolle Anregung geliefert. Anders als die christliche Nächstenliebe (die so leicht in Hass umschlägt) geht die Auffassung des proletarischen Klassenkampfes davon aus, dass Eigenliebe und Nächstenliebe zusammen gehören. Ansonsten läuft man Gefahr, den in Not Geratenen noch mit Vorwürfen zu kommen. Wäre es für die Arbeiterklasse möglich, auf Dauer im Kapitalismus sich sozusagen häuslich einzurichten, wäre eine proletarische Revolution nichts als ein frommer Wunsch. Dann würde es auch nichts bringen, die Klasse dafür zu tadeln. Der Kapitalismus kann aus unserer Sicht nur überwunden werden, wenn es eine Klasse dieser Gesellschaft gibt, welche ein dringendes Eigeninteresse an der Überwindung dieser Gesellschaft hat. Im Verlauf des Kampfes dieser Klasse wird es möglich sein, eine tief verwurzelte Solidarität mit der ganzen Menschheit zu entwickeln, da die Interessen dieser Klasse – die Überwindung der Klassengesellschaft – sich mit denen der Menschheit insgesamt decken. Im übrigen ist in dieser Frage die Haltung Lenins während des Ersten Weltkriegs ein Beispiel. Er hat immer unterschieden zwischen dem Chauvinismus der herrschenden Klasse, welcher ihrem Klasseninteresse entspricht, und dem vieler Arbeiter, welche verwirrt sind und dessen Chauvinismus ihrem Klasseninteressen widerspricht, und deshalb überwunden werden kann und sollte.
Aber auch in einer weiteren wichtigen Frage bringt der Beitrag von Bruno die Debatte weiter, meinen wir: nämlich mit der Frage nach dem Klassencharakter der Jugendproteste. Riga hat zurecht darauf hingewiesen, dass man die subjektiven Faktoren eines Kampfes sehr beachten muss, um eine Bewegung richtig einzuschätzen. Auf das Bewusstsein, auf das Verhalten, auf die Forderungen, auf die Lernfähigkeit und Kampffähigkeit komme es vor allem an; daraus könne man am besten auf den Klassencharakter schließen. Dieser Idee Rigas stimmen wir zu. Allerdings betont Riga, dass man nicht ohne weiteres „objektive“, gewissermaßen ökonomische oder soziale Kriterien anwenden könne, ohne Gefahr zu laufen, die Arbeiterklasse zu verdinglichen, sie als eine Sache und nicht mehr als etwas Lebendiges zu betrachten. Es ist sicher richtig, auf diese Gefahr hinzuweisen. Dennoch meinen wir, dass Bruno zurecht darauf hinweist, dass der Kapitalismus selbst die Lohnabhängigen versachlicht und degradiert, und dass wir folglich gut tun werden, bei der Einschätzung der Klassennatur einer Bewegung auch die objektiven Faktoren zu berücksichtigen, und diese beiden zusammengehörenden Ebenen der Analyse einander nicht gegenüberzustellen.
Welche Einschätzung der weltweiten Schüler- und Studentenbewegung?
Wie ist es also mit den weltweiten Schüler- und Studentenbewegungen in dieser Hinsicht bestellt? „Schüler“ oder „Studenten“ sind ganz gewiss keine Klassenkategorien. Seitdem Schulpflicht besteht, wird den Angehörigen aller Klassen bürgerliche Bildung zuteil. Mit der wachsenden Komplexität und Wissenschaftlichkeit des Produktionsapparates werden auch mehr Arbeiterkinder an die Universitäten geschickt als zu Kaisers Zeiten. Schüler, Studenten, sind klassenübergreifende Kategorien. Hier kommen die von Riga zurecht betonten subjektiven Faktoren ins Spiel. Wenn Schüler, wenn Studenten im Verlauf eines Kampfes proletarische Forderungen stellen, proletarische Kampfmethoden anwenden, so fühlen wir uns berechtigt, anzunehmen, dass es sich im Kampf vorwiegend um die proletarischen Teile der Jugendlichen handelt, oder aber dass innerhalb einer breiteren Bewegung der Einfluss der proletarischen Bestandteile überwiegt. Noch wichtiger dabei als etwa die Vollsammlungen (auch andere Schichten können solche abhalten) erscheint uns die Tatsache, dass man sich an die Klasse insgesamt richtet und ihre Solidarität sucht. Aber dieser subjektive Faktor muss eine objektive Grundlage haben, wie Bruno und auch Hama betonen. Bruno merkt an, dass man als Proletarier nicht geboren wird. Er hat damit, meinen wir, nur bedingt recht. Er hat insofern recht, als es im Kapitalismus, anders z.B. als im Feudalismus eine weitreichende Durchlässigkeit und Fluktuation zwischen den Klassen gibt. Wer in einem schwarzen Ghetto Chicagos zur Welt kommt, kann Frau Obama werden und auch umgekehrt. Er hat insofern nicht recht damit, als auch die Reproduktion der LohnarbeiterInnen durch die Klasse zum Kapitalismus gehört, so dass die Reproduktionskosten der neuen Generation zu den Lohnkosten gehören. Allen Fluktuationen zum Trotz: Es wird immer einen Kern von proletarischen Kindern geben, welche Arbeiterfamilien entstammen, und deren „Schicksal“ ebenfalls die Lohnsklaverei ist. Die Tatsache, dass viele dieser Jugendlichen noch nicht in der Produktion stehen, stellt sie nicht außerhalb der Klasse, ansonsten wären die Erwerbslosen auch nicht Teil der Arbeiterklasse. Die proletarische Jugend ist nicht per se radikaler oder „revolutionärer“ als andere (Hama deutet zurecht auf diese Tatsache hin). Aber die lernenden oder studierenden Proletarier haben, wie die Erwerbslosen auch, zumindest den Vorteil, dass sie (noch) nicht so stark durch die Bedrohung der Arbeitslosigkeit erpressbar sind. Da sie (noch) nicht durch das Eingeschlossensein in den einzelnen Betrieben und durch die Gewerkschaften voneinander so abgetrennt werden, haben sie es leichter, zusammenzukommen. Und dadurch, dass sie jung sind, in die entwickelte kapitalistische Krise sozusagen hinein geboren wurden und dadurch weniger Illusionen haben, können sie vielleicht eher jetzt vorangehen im Kampf der Klasse zu einem Zeitpunkt, in dem die schiere Wucht der Wirtschaftskrise zunächst überwiegend einschüchternd auf die Beschäftigten wirken muss.
Macht es heute noch Sinn, die Kategorien von Klasse noch zu verwenden?
Den Genossen Hama treibt neben dieser auch eine andere Frage um, eine noch grundsätzlichere Frage, meinen wir. Dies kommt deutlich zum Ausdruck im Beitrag des Genossen vom 26. Jan. 09. Dort stellt er die Frage, ob es überhaupt noch richtig ist, an die Kämpfe von heute mit Kategorien von Klassen heranzutreten. Damals, noch in den 1930er Jahren, konnte man von einem Weltproletariat reden, so sein Argument, heute aber eher nicht mehr. Was wir sehen, ist vielmehr Widerstand bestimmter Gruppen, deren Kampf eher keinen deutlichen Klassencharakter hat, und dennoch möglicherweise das Potenzial entwickeln kann, irgendwann in eine kommunistische Richtung zu gehen. Es geht dem Genossen also weniger darum, ob etwa die Bewegung in Griechenland proletarisch sei, sondern v.a. darum, ob es überhaupt noch vertretbar sei, das Instrument der Klassenanalyse anzuwenden und die Lösung der Krise des Kapitalismus von einer bestimmten Klasse der Gesellschaft, spricht durch den Klassenkampf zu erwarten und die Intervention dementsprechend auszurichten? Auf die Frage von Riga, wer denn außer der Arbeiterklasse etwa in der Übergangsperiode nach einer Machtergreifung für eine Ausrichtung hin zum Kommunismus „garantieren“ könne, findet Hama zwar keine schlüssigen Antworten; dennoch müsse diese Tatsache nicht automatisch die anderen nicht den Klassenkampf befürwortenden Ansätze (etwa den der „Wertkritiker“) disqualifizieren.
Hier geht es allerdings ums Grundsätzliche, nämlich um das marxistische Verständnis des Wesens des Kapitalismus als Abschnitt der Menschheitsgeschichte. Wie Engels in Anti-Dühring argumentiert (und wir schließen uns dieser Ansicht an), besteht das besondere, das Revolutionäre am Kapitalismus darin, dass er erstmals in der Geschichte die Einzelproduktion mit vereinzelten Arbeitsinstrumenten ersetzt hat durch eine gesellschaftliche, nur gemeinsam durch viele Menschen anwendbare Produktionsmittel. Durch eine gigantische Steigerung der Produktivität der Arbeit hat der Kapitalismus erstmals die Voraussetzungen für den Kommunismus geschaffen. Diese Steigerung wurde aber ermöglicht durch die Assoziation der Arbeit. Erst dadurch wurde der systematische Einsatz von Maschinen und von Wissenschaft in der Produktion möglich. Der Hauptwiderspruch dieses Systems liegt nun darin, dass die Produktion gewissermaßen „vergesellschaftet“ geschieht, während die Aneignung der Früchte dieser Arbeit weiterhin privat und anarchisch bleibt. Das Wesen der kommunistischen Revolution besteht nun darin, die sozusagen halbe Revolution des Kapitalismus zu vollenden, die Vergesellschaftung zu vollenden. Da der Kapitalismus als System der Konkurrenz und der Verallgemeinerung der Warenzirkulation kein anderes System neben sich duldet, hat er nicht nur einen Weltmarkt, sondern auch noch ein Weltproletariat hervorgebracht. Nach der Sichtweise des Marxismus fällt es nun schwer, sich einen anderen Träger der zuvollziehenden Transformation als das Weltproletariat vorzustellen als die Kraft, welche ohnehin die bereits vorhandene Assoziation verkörpert.
Es stimmt, dass die Arbeiterklasse heute, im Gegensatz zum 19. Jahrhundert, im Gegensatz vielleicht noch zu den 1930er Jahren, ihre Abwehrkämpfe nicht mehr mit dem Bewusstsein führt, dass dies Schritte auf den Weg zum Sozialismus seien. Da das Wesen des proletarischen Klassenkampfes aus marxistischer Sicht wesentlich bestimmt wird durch das Endziel des Kommunismus, ist die Frage mehr als berechtigt, ob Abwehrkämpfe, welche ohne das Bewusstsein eines solchen Ziels ausgetragen werden, überhaupt noch als Klassenkämpfe in diesem Sinne zu betrachten sind. Aber gerade bei dieser Frage wird deutlich, welche Bedeutung neben den „subjektiven“ Faktoren des Bewusstseins gerade die „objektiven“ Faktoren haben müssen. Der Marxismus jedenfalls geht davon aus, dass die Arbeiterklasse der Träger des Kommunismus ist und bleibt, und zwar unabhängig davon, ob die Mehrzahl der Arbeiterinnen und Arbeiter das momentan wissen oder überhaupt wollen.
Die Redaktion von Weltrevolution. 03.02.2009.
Aktuelles und Laufendes:
Ein Willkommensgruß an die neuen Sektionen de IKS in der Türkei und den Philippinen
- 3315 reads
Auf dem letzten Kongress der IKS hoben wir einen internationalen Trend des Auftauchens neuer Gruppen und Einzelpersonen hervor, die sich auf die Positionen der Kommunistischen Linken zubewegen. Wir unterstrichen sowohl die Bedeutung dieses Prozess als auch die Verantwortung, die sich daraus für unsere Organisation ergibt. „Die Arbeit dieses Kongresses drehte sich um die Analyse der Wiederbelebung des Kampfes der Arbeiterklasse und die entsprechende Verantwortung, vor die diese Entwicklung unsere Organisation stellt, insbesondere angesichts einer auftauchenden neuen Generation von Leuten, die sich einer revolutionären politischen Perspektive zuwenden“".[1] “Die Verantwortung der revolutionären Organisation, und vor allem der IKS, besteht darin, aktiver Teil in diesem Denkprozess innerhalb der Klasse zu sein. Dies nicht nur durch aktive Interventionen in den sich entwickelnden Klassenkämpfen, sondern auch durch die Stimulierung der Gruppen und Einzelpersonen, die sich diesem Kampf anschließen wollen“. [2] “Der Kongress hat ebenfalls eine sehr positive Bilanz über unsere Arbeit gegenüber Gruppen und Einzelpersonen gezogen, welche sich für die Verteidigung oder Annäherung an linkskommunistische Positionen einsetzen. (…) der positivste Aspekt dieser Arbeit ist zweifellos die Verstärkung des Kontaktes zu anderen Organisationen, welche revolutionäre Positionen vertreten, und dies wurde durch die Präsenz von vier Gruppen auf unserem 17. Kongress konkretisiert.“ [3]
Auf dem letzten Kongress der IKS wiesen wir auf einen internationalen Trend des Auftauchens neuer Gruppen und Einzelpersonen hin, die sich auf die Positionen der Kommunistischen Linken zubewegen. Wir unterstrichen sowohl die Bedeutung dieses Prozesses als auch die Verantwortung, die sich daraus für unsere Organisation ergibt. „Die Arbeit dieses Kongresses drehte sich um die Analyse der Wiederbelebung des Kampfes der Arbeiterklasse und die entsprechende Verantwortung, vor die diese Entwicklung unsere Organisation stellt, insbesondere angesichts einer auftauchenden neuen Generation von Leuten, die sich einer revolutionären politischen Perspektive zuwenden.“[1] „Die Verantwortung der revolutionären Organisation, und vor allem der IKS, besteht darin, aktiver Teil in diesem Denkprozess innerhalb der Klasse zu sein. Dies nicht nur durch aktive Interventionen in den sich entwickelnden Klassenkämpfen, sondern auch durch die Stimulierung der Gruppen und Einzelpersonen, die sich diesem Kampf anschließen wollen.“ [2] „Der Kongress hat ebenfalls eine sehr positive Bilanz über unsere Arbeit gegenüber Gruppen und Einzelpersonen gezogen, welche sich für die Verteidigung oder Annäherung an linkskommunistische Positionen einsetzen (…) der positivste Aspekt dieser Arbeit ist zweifellos die Verstärkung des Kontaktes zu anderen Organisationen, welche revolutionäre Positionen vertreten, und dies wurde durch die Präsenz von vier Gruppen auf unserem 17. Kongress konkretisiert.“ [3]
So konnten wir auf unserem letzten internationalen Kongress zum ersten Mal seit 25 Jahren Delegationen verschiedener Gruppen begrüßen, die eindeutig internationalistische Klassenpositionen vertreten (OPOP aus Brasilien, SPA aus Korea, EKS aus der Türkei, die Gruppe Internasyonalismo aus den Philippinien (4), obgleich letztere nicht direkt am Kongress teilnehmen konnte). Seitdem haben wir auch mit anderen Gruppen und Leuten aus anderen Teilen der Welt Kontakte geknüpft und Diskussionen geführt, insbesondere in Lateinamerika, wo wir öffentliche Diskussionsveranstaltungen in Peru, Ecuador, und Santo Domingo [5] abhalten konnten. Die Diskussionen mit uns bewogen die Genossen der EKS und Internasyonalismo dazu, ihre Aufnahme in die IKS zu beantragen, nachdem sie immer mehr mit unseren Positionen übereinstimmten. Seit einiger Zeit haben wir Diskussionen im Rahmen des Integrationsprozesses durchgeführt, die sich an dem ausrichteten, was wir in unserem Text "Wie der IKS beitreten?" geschrieben hatten.[6]
In dieser Zeit haben sie vertieft über unsere Plattform diskutiert, wobei sie uns jeweils über den Stand der Diskussionen unterrichtet hatten. Mehrere Delegationen der IKS haben sie vor Ort besucht und waren von der tiefen militanten Überzeugung der GenossInnen und der Klarheit ihrer Übereinstimmung mit unseren Organisationsprinzipien sehr beeindruckt. Nach Abschluss dieser Diskussionen fasste das letzte Plenartreffen des Zentralorgans der IKS den Beschluss der Integration der beiden Gruppen als neue Sektionen unserer Organisation.
Die meisten der IKS-Sektionen befinden sich in Europa [7] oder in Amerika [8] - und bislang war die einzige Sektion außerhalb dieser beiden Kontinente die Sektion in Indien. Die Integration dieser beiden neuen Sektionen in unsere Organisation erweitert somit beträchtlich die geographische Ausdehnung der IKS.
Auf den Philippinen gab es in der letzten Zeit eine hohes industrielles Wachstum, wodurch auch die Zahl der Beschäftigten zunahm - ganz zu schweigen von der Diaspora von acht Millionen im Ausland tätiger philippinischer Arbeiter/Innen. In den letzten Jahren hat dieses Wachstum viele Illusionen über einen angeblich „zweiten Frühling“ des Kapitalismus hervorgerufen. Dagegen wird es heute klar, dass die „Schwellenländer“ jetzt genauso wenig den Auswirkungen der Wirtschaftskrise entkommen können wie die „alten“ kapitalistischen Länder. Die Widersprüche des Kapitalismus werden sich deshalb in der nächsten Zeit in dieser Region gewalttätig zuspitzen, und dies wird unvermeidbar soziale Abwehrkämpfe hervorrufen, die sich nicht auf die Hungerrevolten wie die vom Frühjahr 2008 beschränken werden, sondern auch den Kampf der Arbeiterklasse umfassen werden.
Die Gründung einer Sektion der IKS in der Türkei verstärkt die Präsenz der IKS auf dem asiatischen Kontinent, insbesondere in einer Region, die in der Nähe der kritischsten Konfliktherde der heutigen imperialistischen Spannungen liegt: dem Mittleren Osten. Die GenossInnen der EKS intervenierten schon letztes Jahr mit einem Flugblatt, um die militärischen Manöver der türkischen Bourgeoisie in Nordirak anzuprangen (siehe dazu „Flugblatt der EKS: Gegen die jüngste Militäroperation der Türkei“ auf unserer Webseite).
Die IKS ist mehrfach beschuldigt worden, eine „eurozentristische“ Sichtweise der Entwicklung der Arbeiterkämpfe und der revolutionären Perspektiven zu haben, weil sie auf der entscheidenden Rolle des Proletariats Westeuropas hingewiesen hat. „Nur wenn die Arbeiterkämpfe direkt in den ökonomischen und politischen Zentren des Kapitalismus ausbrechen:
- verbietet sich die Errichtung eines wirtschaftlichen Absperrringes von selbst, wären doch diesmal die reichsten Ökonomien davon betroffen;
- verliert ein politischer Cordon sanitaire seine Wirksamkeit, da nun das höchstentwickelte Proletariat der stärksten Bourgeoisie gegenüberträte. Erst diese Kämpfe werden das Signal für die weltweite Ausdehnung geben.
(…) Nur durch einen Angriff auf das Herz und Hirn kann das Proletariat die kapitalistische Bestie zerstören.
Herz und Hirn der kapitalistischen Welt sind historisch seit Jahrhunderten in Westeuropa angesiedelt. Dort hat der Kapitalismus seine ersten Schritte getan, und dort wird auch die Weltrevolution ihre ersten Gehversuche unternehmen. Dort sind in der Tat alle Bedingungen für die Revolution am offenkundigsten und am weitesten fortgeschritten. (…) Es ist das westeuropäische Proletariat (ein Proletariat, das über die größte Kampferfahrung verfügt und das schon seit Jahrzehnten mit den heimtückischsten Mystifikationen der ‚Arbeiterparteien‘ zu tun hat) das der Vorreiter des Weltproletariats bei der Entwicklung des für die revolutionären Kämpfe unabdingbaren politischen Bewusstseins sein wird."[9]
Dies ist keine „eurozentristische“ Auffassung. Der Kapitalismus hat sich von Europa aus entwickelt, hier existiert das älteste Proletariat mit dem größten Erfahrungsschatz.
Unsere Organisation hat auf diese Beschuldigungen des „Eurozentrismus“ bereits geantwortet.
Vor allem sind wir immer davon ausgegangen, dass die Revolutionäre eine entscheidende Rolle in den Ländern der kapitalistischen Peripherie zu spielen haben.
„Das soll nicht heißen, dass der Klassenkampf oder die Aktivitäten der Revolutionäre in den anderen Weltteilen keinen Sinn machten. Die Arbeiterklasse ist ein unteilbares Ganzes. Der Klassenkampf existiert überall, wo sich Arbeit und Kapital gegenüberstehen. Die Lehren aus den verschiedenen Kämpfen sind für die gesamte Klasse gültig, gleichgültig, wo sie gemacht werden. Insbesondere wird die Erfahrung der Kämpfe in den peripheren Ländern den Verlauf der Kämpfe in den Zentren dieser Welt beeinflussen. Auch wird die Revolution weltweit sein, das heißt alle Länder umfassen. Die revolutionären Strömungen der Klasse sind überall wertvoll, wo die Arbeiterklasse mit der Bourgeoisie zusammenstößt, also auf der ganzen Welt.“ (ebenda).
Dies trifft insbesondere auf Länder wie die Türkei und die Philippinien zu.
In diesen Ländern ist der Kampf zur Verteidigung der kommunistischen Ideen in der Tat sehr schwierig. Man muss den klassischen Mystifikationen der herrschenden Klasse zur Blockierung der Entwicklung des Klassenkampfes und der Bewusstseinsentwicklung der Arbeiterklasse entgegentreten (die Illusionen in die Demokratie und die Wahlen, die Sabotage der Arbeiterkämpfe durch den Gewerkschaftsapparat, das Gewicht des Nationalismus). Aber mehr noch, der Kampf der Arbeiterklasse und der Revolutionäre prallt nicht nur direkt und unmittelbar mit den offiziellen Repressionskräften der Regierung zusammen, sondern auch mit bewaffneten Kräften, die gegen die Regierung kämpfen, wie die PKK in der Türkei oder die verschiedenen Guerillabewegungen auf den Philippinen. Diese stehen in Brutalität und Skrupellosigkeit der Regierung nichts nach, weil auch sie den Kapitalismus - wenn auch unter einem anderen Gewand - verteidigen. Dadurch werden die Aktivitäten der beiden neuen Sektionen der IKS gefährlicher als in Europa oder in Nordamerika sein.
Vor ihrem Beitritt in die IKS veröffentlichten die Genossen auf den Philippinen bereits ihre eigene Webseite auf Tagalog (die offizielle Amtssprache) sowie auf Englisch (das auf den Philippinen sehr weit verbreitet ist). Unter den gegenwärtigen Bedingungen können wir noch keine regelmäßige gedruckte Presse veröffentlichen (abgesehen von gelegentlich veröffentlichten Flugblättern) und unsere Webseite wird somit das Hauptmittel zur Verbreitung unserer Positionen werden.
Die Sektion in der Türkei wird weiterhin die Zeitschrift „Dunya Devrimi“ veröffentlichen, die nunmehr zum IKS-Organ in diesem Land werden wird.
Wie wir in unserer "International Review" Nr. 122 (deutsche Ausgabe Nr. 36, S. 7) schrieben:
"Wir heißen diese Genossinnen und Genossen, die sich den kommunistischen Positionen und unserer Organisation zuwenden, willkommen. Wir rufen ihnen zu: Ihr habt eine gute Wahl getroffen, die einzig mögliche, wenn ihr im Sinn habt, euch in den Kampf für die proletarische Revolution einzureihen. Aber es ist keine einfache Wahl: Ihr werdet nicht sofort Erfolg ernten, ihr werdet Geduld und Hartnäckigkeit brauchen und lernen müssen, nicht aufzugeben, wenn die erreichten Resultate noch nicht den gehegten Hoffnungen entsprechen. Aber ihr seid nicht allein: Die Militanten der IKS sind an eurer Seite, und sie sind sich der Verantwortung bewusst, die eure Annäherung ihnen auferlegt. Ihr Wille, der am 16. Kongress zum Ausdruck kam, ist, auf der Höhe dieser Verantwortung zu sein." (IKS, 16. Kongress.). Diese Worte waren an all die Personen und Gruppen gerichtet, die sich dafür entschieden hatten, die Positionen der Kommunistischen Linken zu verteidigen. Sie treffen natürlich vor allem auf die beiden neuen Sektionen zu, die jetzt unserer Organisation beigetreten sind.
Die IKS heißt die beiden neuen Sektionen und die GenossInnen, die sie gegründet haben, herzlich und brüderlich willkommen.
IKS
Aktuelles und Laufendes:
Streiks in den Erdölraffinerien und Kraftwerken: Arbeiter fangen an, den Nationalismus infrage zu stellen.
- 3169 reads
Die Welle wilder Streiks, die durch den Kampf der Bauarbeiter der Lindsey Raffinerie ausgelöst wurde, war einer der wichtigsten Arbeiterkämpfe in Großbritannien seit den letzten 20 Jahren. Tausende von Bauarbeiter anderer Raffinerien und Kraftwerke traten aus Solidarität in den Streik. Massenversammlungen fanden regelmäßig statt. Arbeitslose Bau-, Stahl,- Hafen und andere Arbeiter schlossen sich den Streikposten an und demonstrierten außerhalb verschiedener Kraftwerke und Raffinerien. Die Arbeiter kümmerten sich nicht im Geringsten um das illegale Vorgehen, als sie ihre Solidarität mit den streikenden Kollegen, ihre Wut gegenüber der anschwellenden Arbeitslosigkeit und der Unfähigkeit der Regierung, dagegen etwas unternehmen zu können, zum Ausdruck brachten. Als 200 polnische Bauarbeiter sich dem Kampf anschlossen, wurde ein Höhepunkt erreicht, indem direkt der Nationalismus infragestellt wurde, welcher von Anfang an diese Bewegung überschattet hat. Die Welle wilder Streiks, die durch den Kampf der Bauarbeiter der Lindsey Raffinerie ausgelöst wurde, war einer der wichtigsten Arbeiterkämpfe in Großbritannien seit den letzten 20 Jahren. Tausende von Bauarbeiter anderer Raffinerien und Kraftwerke traten aus Solidarität in den Streik. Massenversammlungen fanden regelmäßig statt. Arbeitslose Bau-, Stahl,- Hafen und andere Arbeiter schlossen sich den Streikposten an und demonstrierten außerhalb verschiedener Kraftwerke und Raffinerien. Die Arbeiter kümmerten sich nicht im Geringsten um das illegale Vorgehen, als sie ihre Solidarität mit den streikenden Kollegen, ihre Wut gegenüber der anschwellenden Arbeitslosigkeit und der Unfähigkeit der Regierung, dagegen etwas unternehmen zu können, zum Ausdruck brachten. Als 200 polnische Bauarbeiter sich dem Kampf anschlossen, wurde ein Höhepunkt erreicht, indem direkt der Nationalismus infragestellt wurde, welcher von Anfang an diese Bewegung überschattet hat. Die Entlassung von 300 Zeitarbeitern bei der Lindsey Ölraffinerie, der Vorschlag, dass ein anderer Subunternehmer den Auftrag übernehmen und dabei auf 300 italienische und portugiesische Arbeiter zurückgreifen sollte (die wegen schlechterer Arbeitsbedingungen geringere Löhne erhalten), und die Ankündigung, dass kein Beschäftigter aus Großbritannien für diesen Auftrag zum Einsatz käme, brachten das Pulverfass der Unzufriedenheit unter den Bauarbeitern zur Explosion. Seit Jahren schon wurden immer mehr Bauarbeiter nach England gekarrt, die meist geringere Löhne bekamen und schlechtere Arbeitsbedingungen hatten, wodurch der Konkurrenzkampf unter den Arbeitern um Arbeitsplätze verschärft und die Löhne und Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten verschlechtert wurden. Zusammen mit der rezessionsbedingten Welle von Entlassungen in der Baubranche und in anderen Branchen wurde dadurch ein tiefgreifendes Gefühl der Kampfbereitschaft erweckt, welches sich nun in diesen Kämpfen äußert.
Von Anfang an stand diese Bewegung vor einer grundlegenden Frage, die nicht nur die Streikenden betraf, sondern die ganze Arbeiterklasse heute und in der Zukunft: Können wir uns gegen Arbeitslosigkeit und andere Angriffe wehren, indem wir uns als „britische Arbeiter“ betrachten und uns gegen „ausländische Arbeiter“ richten, oder müssen wir uns nicht als Arbeiter mit gemeinsamen Interessen mit allen anderen Arbeitern verstehen, egal woher die Arbeiter kommen. Dies ist eine zutiefst politische Frage, mit der sich diese Bewegung befassen muss.
Von Anfang an schienen die Kämpfe von Nationalismus beherrscht zu sein. Bilder von Arbeitern mit selbst gefertigten Spruchbändern wie „British Jobs for British Workers“ wurden gezeigt, und mehr professionell hergestellte Gewerkschaftsspruchbänder trugen die gleichen Forderungen vor. Offizielle Gewerkschaftsvertreter vertraten mehr oder weniger offen diese Forderung; die Medien sprachen von einem Kampf gegen ausländische Arbeiter und zeigten Arbeiter, die diese Meinung teilten. Diese Bewegung von wilden Streiks hätte potenziell durch den Nationalismus ertränkt und mit einer Niederlage für die Arbeiterklasse enden können, wobei sich die Arbeiter gegenseitig bekämpft und massenhaft nationalistische Forderungen vertreten und verlangt hätten, dass die wenigen Arbeitsstellen britischen Arbeitern vorbehalten bleiben und italienische und portugiesische Arbeiter ihre Stellen verlieren müssten. Die Fähigkeit der Arbeiterklasse, einen Abwehrkampf zu führen, wäre geschwächt worden und der herrschenden Klasse wäre es umso leichter gefallen, die Arbeiterklasse noch schärfer anzugreifen und sie zu spalten.
Die Berichterstattung in den Medien (und was einige der Arbeiter sagten) ließ einen leicht glauben, dass die Forderungen der Lindsey Beschäftigten tatsächlich „British Jobs for British Workers“ lauteten. Aber das stimmt nicht. Die in den Vollversammlungen diskutierten und abgestimmten Forderungen gingen keineswegs in diese Richtung, und es gab auch nicht diese Feindseligkeit gegenüber ausländischen Arbeitskräften. Komisch, wie die Medien dies ‚verpassten’. Sie brachten eher Illusionen in die Fähigkeit der Gewerkschaften zum Ausdruck, die Unternehmer daran zu hindern, die Arbeiter gegeneinander auszuspielen. Aber eine offene Form des Nationalismus trat nicht zutage. Der allgemeine Eindruck, welcher von den Medien vermittelt wurde, war, dass die Streikenden sich gegen ausländische Beschäftigte wandten.
Das fortdauernde Gewicht des Nationalismus
Der Nationalismus ist ein wesentlicher Bestandteil der kapitalistischen Ideologie. Jedes nationale Kapital kann nur durch einen gnadenlosen Konkurrenzkampf auf ökonomischer und militärischer Ebene mit den Rivalen überleben. Ihre Kultur, Medien, Bildung, ihre Unterhaltungsindustrie und Sport – sie alle verbreiten immerzu das nationalistische Gift und versuchen die Arbeiterklasse an die Nation zu fesseln. Die Arbeiterklasse kann dem Einfluss dieser Ideologie nicht entweichen. Aber wichtig an dieser Bewegung war, dass das Gewicht des Nationalismus infragestellt wurde, als die Arbeiter vor der Frage standen, ihre grundlegenden materiellen Interessen zu verteidigen.
Der nationalistische Slogan “British Jobs for British Workers”, welcher durch den Premierminister Gordon Brown von der British National Party (BNP) übernommen wurde, hat ein großes Unwohlsein unter den Streikenden und der Klasse hervorgerufen. Viele Streikenden erläuterten, dass sie keine Rassisten seien und auch nicht die BNP unterstützen, die, als sie bei den Streikposten auftauchte, meist von den Streikenden verjagt wurden.
Neben der Verwerfung der BNP versuchten natürlich viele im Fernsehen interviewte Arbeiter sich zur Bedeutung ihres Kampfes zu äußeren. Sie seien nicht gegen ausländische Arbeiter; sie selbst hätten im Ausland geschuftet, aber sie seien nunmehr arbeitslos oder sie wollten Arbeit für ihre Kinder haben, deshalb meinten sie, die Stellen sollten zunächst an „britische“ Arbeiter vergeben werden. Solche Auffassungen führen immer dazu, dass man davon ausgeht, „britische“ und „ausländische“ Arbeiter hätten keine gemeinsamen Interessen. Man wird somit zu einem Gefangenen des Nationalismus. Aber diese Äußerungen zeigten, dass ein Prozess des Nachdenkens, der Auseinandersetzung stattfindet.
Auf der anderen Seite betonten andere Beschäftigte die gemeinsamen Interessen aller Arbeiter und hoben hervor, dass sie Arbeit für alle Arbeiter wollten. „Ich wurde vor zwei Wochen als ein Stauer entlassen. Ich habe 11 Jahre lang in Cardiff und Barry Docks gearbeitet und bin heute hierher gekommen in der Hoffnung, dass wir die Regierung in Bedrängnis bringen können. Ich meine, das ganze Land sollte in Streik treten, da die ganze britische Industrie den Bach runter geht. Aber ich habe gar nichts gegen ausländische Arbeiter. Man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie dorthin gehen, wo es noch Arbeit gibt“. (Guardian On-Line 20.1.2009). Einige Arbeiter meinten auch, dass der Nationalismus eine wirkliche Gefahr sei. Ein im Ausland beschäftigter Arbeiter warnte auf einem Bauarbeiter-Internetforum vor den Versuchen der Unternehmer, die nationalen Spaltungen gegen die Arbeiter einzusetzen. „Die Massenmedien, die die nationalistischen Kreise aufgestachelt haben, werden sich gegen euch richten und die Demonstranten in das schlechtest mögliche Licht stellen. Das Spiel ist aus. Das Letzte, was die Unternehmer und die Regierung wollen, ist dass sich britische Arbeiter mit den Arbeitern aus anderen Ländern zusammenschließen. Sie meinen, sie könnten uns weiter an der Nase herumführen, dass wir uns gegenseitig bekämpfen. Es wird ihnen kalt den Rücken runter laufen, wenn sie feststellen, dass wir uns zusammenschließen“. Und in einem anderen Beitrag verband er diesen Kampf in Großbritannien mit den Kämpfen in Frankreich und Griechenland und der Notwendigkeit internationaler Verbindungen unter den Arbeitern. „Die massiven Proteste in Frankreich und Griechenland sind nur ein Vorläufer von dem, was wir noch sehen werden. Habt ihr jemals daran gedacht, mit diesen Arbeitern Kontakt aufzunehmen und zu ihnen Verbindungen herzustellen und damit europaweite Proteste gegen die Angriffe auf die Arbeiter zu entfalten? Das scheint ein viel besserer Weg anstatt zuzulassen, dass die wirklich schuldigen Parteien, diese Bande von Unternehmern, korrupten Gewerkschaftsführern und New Labour weiterhin von den Schwächen der Arbeiter profitieren“ (Thebearfacts.org). Arbeiter aus anderen Branchen der Wirtschaft meldeten sich auch auf diesem Forum zu Wort, um den nationalistischen Slogans entgegenzutreten.
Diese Diskussionen unter den am Streik Beteiligten und innerhalb der Klasse insgesamt über die Frage der nationalistischen Slogans erreichte am 3. Februar einen neuen Höhepunkt, als 200 Arbeiter aus Polen sich anderen 400 Beschäftigten in einem wilden Streik zur Unterstützung der Lindsey Arbeiter auf der Baustelle des Langage Kraftwerks in Plymouth anschlossen. Die Medien unternahmen alles, um diesen Schritt internationaler Solidarität zu vertuschen. Das örtliche BBC-Studio erwähnte den Streik überhaupt nicht und auf nationaler Ebene wurde er kaum erwähnt.
Die Solidarität dieser polnischen Arbeiter war besonders wichtig, weil sie sich letztes Jahr an einem ähnlichen Kampf beteiligt hatten. 18 Arbeiter waren seinerzeit entlassen worden und andere Arbeiter legten damals aus Solidarität die Arbeiter nieder, polnische Arbeiter eingeschlossen. Damals versuchte die Gewerkschaft den Kampf in einen Widerstand gegen die Anwesenheit von ausländischen Arbeitern zu verwandeln, aber die Streikbeteiligung von polnischen Arbeitern untergrub dieses Vorhaben.
Die Beschäftigten von Langage nahmen diesen Kampf mit einem gewissen Bewusstsein auf, wie die Gewerkschaften versucht haben, mit Hilfe des Nationalismus die Arbeiter zu spalten. Ein Tag nach der Arbeitsniederlegung wurde auf einer Vollversammlung in Lindsey ein selbst angefertigtes Schild hochgehalten: „"Langage Power Station - Polish Workers Join Strike: Solidarity", (Kraftwerk Langage – Polnische Arbeiter schließen sich dem Kampf an – Solidarität“), was bedeutete, dass einer oder mehrere polnische Arbeiter die siebenstündige Reise auf sich genommen hatten, um dort hinzufahren und dass ein Beschäftigter in Lindsey diese Aktion hervorheben wollte.
Gleichzeitig tauchte bei den Streikposten in Lindsey ein Schild auf, in dem italienische Arbeiter aufgerufen wurden, sich dem Streik anzuschließen. Es war auf englisch und italienisch verfasst, und es wurde berichtet, dass einige Arbeiter Parolen hochhielten wie „Arbeiter aller Länder, vereinigt Euch“ (Guardian, 5.2.09). Kurzum, wir sehen den Anfang einer bewussten Anstrengung seitens einiger Arbeiter, für einen wirklich proletarischen Internationalismus einzutreten; ein Schritt, der nur zu mehr Nachdenken und Diskussionen innerhalb der Klasse führen kann.
All dies erfordert, dass der Kampf eine neue Stufe erreichen muss, in dem man sich direkt gegen die Kampagne wendet, den Kampf als eine nationalistische Regung darzustellen. Das Beispiel der polnischen Arbeiter zeigt die Möglichkeit auf, dass sich Tausende von ausländischen Arbeitern dem Kampf auf den größten Baustellen in Großbritannien wie auf den Baustellen der Olympiade in Ost-London anschließen. Es bestand auch die Gefahr, dass die Medien die internationalistischen Sogans nicht hätten vertuschen können. Damit wären die nationalistischen Hürden überwunden worden, welche die Herrschenden zwischen den kämpfenden Arbeitern und dem Rest der Klasse errichtet haben. Es ist kein Zufall, dass der Konflikt so schnell gelöst wurde. Innerhalb von 24 Stunden wechselten die Gewerkschaften, die Unternehmer und die Regierung den Ton. Während sie anfangs sagten, es werde Tage, wenn nicht Wochen dauern, um den Streik beizulegen, wurde er dadurch schnell beigelegt, dass zusätzlich 102 Arbeitsplätze errichtet werden, auf die sich „britische Arbeitskräfte“ bewerben können. Dies war eine Einigung, mit der die meisten Streikenden sich scheinbar zufrieden gaben, weil damit kein Verlust von Arbeitsplätzen für die italienischen und portugiesischen Arbeiter verbunden war, sondern wie ein Streikender meinte: „warum sollten wir kämpfen müssen, nur um Arbeit zu bekommen?“
Innerhalb von wenigen Wochen fanden die größten wilden Streiks seit Jahrzehnten statt. Arbeiter haben Vollversammlungen abgehalten und ohne zu zögern illegale Solidaritätsaktionen durchgeführt. Ein Kampf, der im Nationalismus hätte erstickt werden können, fing an, dieses Gift infrage zu stellen. Dies bedeutet nicht, dass damit die Gefahr des Nationalismus abgewendet ist. Er ist eine ständige Gefahr, aber diese Bewegung hat für spätere Kämpfe viele wichtige Lehren zu bieten. Der Anblick von Spruchbändern auf angeblich nationalistischen Streikposten, auf denen „Arbeiter aller Länder, vereinigt Euch“ gefordert wird, wird innerhalb der herrschenden Klasse große Sorgen über das, was die Zukunft bringen wird, hervorrufen.
Phil, 7.2.09 - aus der Presse der Internationalen Kommunistischen Strömung in Großbritannien
Aktuelles und Laufendes:
- Nationalismus [185]
- wilde Streiks in England [186]
- British jobs for British workers [187]
März 2009
- 845 reads
Die Gründung der Kommunistischen Internationale vor 90 Jahren
- 3179 reads
Wiederveröffentlichung eines Artikels den wir vor 20 Jahren 1989 schrieben
Das Proletariat hat sich heute mehr und mehr von den Ketten der Konterrevolution befreit.
Umso wichtiger ist es, 70 Jahre nach der Gründung der III. Internationale, den Beitrag der Komintern zu verstehen und sich wiederanzueignen. Um diese Aufgabe zu erfüllen, muss man nicht nur die stalinistischen Verfälschungen ablehnen, sondern auch den folgenschweren Fehler Trotzkis, der die Anerkennung der gesamten vier ersten Kongresse der Komintern zur Bedingung und Garantie für den Kampf gegen den Stalinismus machte. Ebenso irrig ist die entgegengesetzte Haltung der Rätekommunisten, die die III. Internationale von Beginn an außerhalb des proletarischen Lagers stellten, weil nach dem 5. Kongress der Prozess der Degeneration voll in Gang kam. Die Grundlage dieser Fehleinschätzungen ist ein mangelndes Verständnis des Prozesses, den die Komintern durchlief: den Versuch der Arbeiterklasse und ihrer Vorhut, den Bruch, den der I. Weltkrieg darstellte, zu begreifen.
„Wenn es uns gelungen ist, uns trotz aller polizeilichen Schwierigkeiten und Verfolgungen zu versammeln, wenn es uns gelungen ist, in kurzer Zeit ohne irgendwelche ernst zu nehmenden Differenzen wichtige Beschlüsse über alle brennenden Fragen der heutigen revolutionären Epoche zu fassen, so verdanken wir das dem Umstand, dass die Massen des Proletariats der ganzen Welt eben diese Fragen schon durch ihr praktisches Auftreten auf die Tagesordnung gestellt und praktisch zu entscheiden begonnen haben“ (Rede Lenins bei Beendigung des I. Kongress der Komintern, 6. 3.1919).
Diese Feststellung Lenins drückt ganz deutlich aus, in welchem Zusammenhang die Komintern gegründet wurde: der Bruch von immer größeren Massen von Arbeitern mit der Konterrevolution, die die endgültige Niederlage der II. Internationale und den Ausbruch des imperialistischen Gemetzels verursacht hatte. Der tragischen Begeisterung für den Krieg folgte ziemlich rasch eine wachsende Abneigung angesichts der Wirklichkeit des Krieges, die die Barbarei eines überholten Systems zuspitzte.
Schon 1916 brachen die ersten großen Meutereien und Streiks aus, insbesondere in Russland. Auch wenn dies anfänglich nur eine Minderheit war, auch wenn die Reaktion der Arbeiter nicht über den Wunsch nach Beendigung des Krieges hinausging, tat sich durch diese Kämpfe ein Bruch in dem grausamen Burgfrieden der Proletarier mit ihren Ausbeutern für das Vaterland auf. Zur gleichen Zeit begannen die wenigen revolutionären Kräfte, die den Verrat vom August 1914 und die Zusammenarbeit der Arbeiterparteien mit dem Imperialismus verworfen hatten, sich zu organisieren und zusammenzufinden (Konferenz von Zimmerwald und Kienthal). Auch da, wo die Bolschewiki, gefolgt von einigen kleinen Gruppen der deutschen Linken als einzige eine wirkliche Alternative zeigten – „Umwandlung des imperialistischen Kriegs in Bürgerkrieg“ -, wurde ein erster Schritt gemacht.
Im Februar 1917 kam diese Entwicklung zum ersten Mal auf breiter Ebene deutlich zum Vorschein. Oktober 1917 war der Höhepunkt und zugleich der Ausgangspunkt für die Ausdehnung der revolutionären Welle: gewaltige Streiks brachen in Italien, Großbritannien, den USA aus; etwas später stand. Deutschland kurz vor dem proletarischen Aufstand, in Ungarn entstand die 2. Räterepublik, während in „weiter entwickelten Kolonien geht der Kampf schon jetzt nicht bloß unter dem Banner der nationalen Befreiung, sondern nimmt gleich einen offen ausgesprochenen sozialen Charakter an“. (Manifest). Die Gründung der Komintern fand in dieser revolutionären Welle statt, in der die Arbeiter mit ihrem neuen Wachhund - der Sozialdemokratie, die zum Feind übergewechselt war - brachen. Unter dem Einfluss dieser Kämpfe verstärkte sich die kommunistische Minderheit. 1916 kündigten sie schon mit Lenin an ihrer Spitze an, dass es nicht möglich sei, die II. Internationale wieder aufzurichten, und dass eine neue Internationale gegründet werden muss.
Die tragische Verspätung bei der Gründung der Komintern (der Bürgerkrieg war seit einem Jahr im Gange) drückte die mangelnde Reife des Proletariats und die sehr große Schwierigkeit für die Revolutionäre aus, die neue Zeit und ihre Erfordernisse zu verstehen. Nur die Umgruppierung der Revolutionäre auf Weltebene konnte die Vertiefung dieses Verständnisses ermöglichen. Darin bestand die Aufgabe, die sich der I. Kongress der Komintern setzte, und insofern war er ein wichtiger Moment in der Geschichte des proletarischen Kampfes.
„Die dritte Internationale ist die Internationale der offenen Massenaktion, die Internationale der revolutionären Verwirklichung, die Internationale der Tat.“(Manifest)
Die KI betonte den unüberwindbaren Widerspruch zwischen Proletariat und Bourgeoisie, die absolute Unmöglichkeit eines schrittweisen und friedlichen Übergangs zum Sozialismus und die Notwendigkeit der gewaltsamen Zerstörung des bürgerlichen Staates.
Der proletarische Internationalismus wurde angesichts des nationalistischen Giftes, das die Sozialdemokratie zerfressen hatte, hochgehalten.
„Die Internationale, die den Interessen der internationalen Revolution die sogenannten nationalen Interessen unterordnet, wird die gegenseitige Hilfe des Proletariats der verschiedenen Länder verwirklichen, denn ohne wirtschaftliche und andere gegenseitige Hilfe wird das Proletariat nicht imstande sein, die neue Gesellschaft zu organisieren“(Richtlinien der Komintern).
Dreh- und Angelpunkt für diese Verteidigung des Marxismus und die Bloßstellung der sozialdemokratischen Parteien als Agenten der Bourgeoisie war die Erkenntnis, dass eine neue Epoche angebrochen war: „Die neue Epoche ist geboren! Die Epoche der Auflösung des Kapitalismus, seiner inneren Zersetzung, die Epoche der kommunistischen Revolution des Proletariats.“
Der gesamte Kongress war von dieser Idee geprägt. Es entstanden neue Erfordernisse mit dieser neuen Epoche:
- Der Kapitalismus ist in unüberwindbare Widersprüche verstrickt und nimmt in seinem Niedergang neue Formen an. So betonte Bucharin in seinem Bericht, dass man nicht nur die allgemeinen Merkmale des kapitalistischen und imperialistischen Systems beschreiben müsse, sondern auch den Zerfallsprozess und den Zusammenbruch des Systems. Das kapitalistische System dürfe nicht nur in seiner abstrakten Form, sondern müsse auch praktisch als Weltkapitalismus, als ökonomische Ganzheit gesehen werden.
Von dem Verständnis, dass der Kapitalismus als System die gesamte Erde erobert hat, hängt die Haltung des Proletariats zu nationalen Befreiungskämpfen und zu vorübergehenden Bündnissen mit Fraktionen der Bourgeoisie ab. Bucharin führte dazu aus:
„Die primitiven Formen des Kapitalismus sind nahezu verschwunden. Dieser Prozess begann schon vor dem Krieg und beschleunigte sich während desselben. Dieser Krieg war ein großer Organisator. Unter seinem Gewicht wurde das Finanzkapital in eine höhere Stufe übergeführt, umgewandelt: Staatskapitalismus.“
Der Staatskapitalismus, wie Bucharin mit Recht feststellte, verringert nicht die kapitalistische Anarchie, sondern bringt sie auf die höchste Stufe, auf die Ebene der Staaten selbst. Darin liegt die Grundlage für das Verständnis der besonderen Form des dekadenten Kapitalismus, wobei die sog. sozialistischen Länder nur eine Spielart dessen sind.
- In einer anderen grundsätzlichen Frage - der Machteroberung und der Diktatur des Proletariats - wird deutlich, dass eine neue Epoche der proletarischen Revolutionen angebrochen war. Die Erfahrung des Klassenkampfes lieferte die Grundlage dieser Erkenntnis. Bis dahin hatte die Pariser Commune einige wertvolle, aber begrenzte Elemente zur Frage geliefert, wie das Proletariat seine Diktatur ausübt. Und diese Erkenntnisse waren durch das Gewicht jahrzehntelangen parlamentarischen Kampfes vergessen worden. „Diktatur des Proletariats! Das war bisher Latein für die Massen. Mit der Ausbreitung des Sowjetsystems in der ganzen Welt ist dieses Latein in alle modernen Sprachen übersetzt worden: die praktische Form der Diktatur ist durch die Arbeitermassen gefunden (...) Alles dieses beweist, dass die revolutionäre Form der proletarischen Diktatur gefunden, dass das Proletariat jetzt praktisch imstande ist, seine Herrschaft auszuüben.“ (Rede Lenins bei Eröffnung des I. Kongresses der KI, 2.3.1919)
Während des ganzen Kongresses wurde die Wichtigkeit der Arbeiterräte betont. Die dringende Notwendigkeit, mit der II. Internationale und ihren linken Spielarten radikal zu brechen, wurde stets im Zusammenhang mit den Arbeiterräten, den Organen des revolutionären Proletariats betrachtet. Der erste Kongress verwarf die Auffassung, übernommen aus der bürgerlichen Revolution, in der eine Minderheit der revolutionären Arbeiterklasse die Macht im Namen aller ausübt. Diese Auffassung war auf die proletarische Revolution übertragen und durch die vielen Jahre des gewerkschaftlichen und parlamentarischen Kampfes verstärkt worden. Durch das Verständnis der Änderung der Periode und der neuen proletarischen Praktiken, die daraus entstanden, konnten die Fragen der Gewerkschaften und des Parlamentarismus neu gestellt werden. Überall da, wo radikale Kämpfe stattfanden, wurden die Gewerkschaften von Streikkomitees verdrängt. Meistens, wie in Deutschland oder Großbritannien, stellten sich die Gewerkschaften offen gegen die revolutionäre Bewegung, während die kämpferischen Arbeiter sich von ihnen abwandten. Dennoch ermöglichte die Vielfalt der Erfahrungen und die Tatsache, dass der Prozess der Einbeziehung der Gewerkschaften in den Staat erst am Anfang stand, es nicht, dass eine klare und umfassende Antwort auf diese Frage gegeben werden konnte. Auch wenn die Möglichkeit einer revolutionären Ausnutzung des Parlaments noch verteidigt wurde, unter anderem auch von den Bolschewiki, wurde die Notwendigkeit, die parlamentarische Frage im Zusammenhang mit der neuen Epoche zu diskutieren, erkannt.
Der wesentliche Beitrag des I. Kongresses der Komintern kann aber nicht auf eine einfache Wiederaneignung des Marxismus reduziert werden. Der Marxismus ist vor allem der Ausdruck der lebendigen Erfahrung des Proletariats und hat nichts mit einer erstarrten Lehre zu tun, die man nur zu bestimmten Zeitpunkten hervorzuholen brauchte. Auf der Grundlage der vergangenen Erfahrungen konnte die Komintern den Marxismus mit neuen Elementen bereichern. Der erste Kongress der Komintern verdeutlichte das revolutionäre Programm des Proletariats in seiner Gesamtheit, so wie es damals von seinen revolutionären Minderheiten aufgefasst und formuliert wurde. Durch die großen Kämpfe des Proletariats gibt es immer eine Bereicherung des Programms, auch auf der Ebene grundsätzlicher Fragen. Mit der Pariser Kommune machte das Proletariat die Erfahrung, dass es den bürgerlichen Staat nicht erobern, sondern zerstören muss. Erst durch die Kämpfe von 1917 konnte es verstehen, welche Form seine Klassendiktatur annehmen muss: die Macht der Arbeiterräte.
Als Ausdruck der revolutionären Welle, der Möglichkeit und Notwendigkeit der kommunistischen Revolution verdeutlichte der I. Kongress eindrücklich die Änderungen der Epoche und die Probleme, die diese Veränderungen für die gesamte Arbeiterklasse mit sich brachten. Aus diesem Grund stellt er einen der wichtigsten Momente in der Geschichte der Arbeiterklasse dar. Heute muss jedes revolutionäre Programm die Errungenschaften der Komintern und insbesondere ihres ersten Kongresses anerkennen. Jedoch genügt es nicht, die von der Komintern entwickelten Positionen vorbehaltlos in ihrer Gesamtheit zu übernehmen. Denn obwohl die Komintern einen enormen Schritt für die Arbeiterbewegung bedeutet hat, konnte sie angesichts des Rückflusses der proletarischen Bewegung und der Tatsache, dass sie an der Schwelle zwischen zwei Epochen des Kapitalismus gegründet wurde, nicht alle Folgen dieser Analyse herausarbeiten und sich völlig von der alten sozialdemokratischen Auffassung befreien. Die Grundlagen, die die Komintern geschaffen hat, haben es den aus der Komintern hervorgegangen Fraktionen der Kommunistischen Linke ermöglicht, diesen Bruch mit der alten sozialdemokratischen Auffassung vollständig zu vollziehen und zu vertiefen. Das Werk der Kommunistischen Internationale heute fortzusetzen bedeutet, die theoretischen, programmatischen und organisatorischen Konsequenzen der vom ersten Kongress entwickelten Analysen vollständig zu ziehen.
(aus Révolution Internationale, Nr. 64, Zeitung der IKS in Frankreich, Dez. 1979).
Historische Ereignisse:
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Erbe der kommunistischen Linke:
Eine Initiative zu debattieren und zusammen zu kommen
- 3256 reads
Wir veröffentlichen nachfolgend eine Stellungnahme, welche von einem Diskussionstreffen angenommen wurde, auf dem zwei große Themenkomplexe behandelt wurden:
Die gegenwärtige Krise des Kapitalismus
Wie können die Arbeiter gegen ihre Verarmung und die sich zuspitzende Verschlechterung ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen kämpfen?
An diesem Treffen beteiligten sich Mitglieder der IKS mit der Absicht, zur Debatte und zu damit verbundenen praktischen Schritten beizutragen.
Aus unserer Sicht erscheint diese Initiative als sehr wichtig und sie reiht sich ein in ähnliche Initiativen in anderen Ländern (z.B. Frankreich, Korea, Peru, Mexiko).
Diese Initiative geht in drei Richtungen:
- die Isolierung und Atomisierung zu überwinden, welche uns dazu treibt, dass sich jeder in seine Ecke zurückzieht und dass jeder nur für sich handelt. All das erschwert die Entwicklung des Kampfes und des Bewusstseins der Arbeiter; diese können nur entstehen als ein Ergebnis der Debatte und eines klar kollektiven Vorgehens.
- eine Debatte unter Revolutionären voranzutreiben, welche Antworten auf die zahlreichen Fragen liefert, die durch den Kampf für eine revolutionäre Alternative der Arbeiterklasse aufgeworfen werden.
- das wirklich revolutionäre und internationalistische Lager von den Leuten abzugrenzen, die sich „sozialistisch“ und „revolutionär“ nennen, aber uns mit ihren Rezepten wie „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ , „Sozialismus mittels staatlichen Eingreifens“ und anderem nationalistischen Plunder hinters Licht führen, weil sie nur zur Aufrechterhaltung des Kapitalismus unter angeblich „neuen Formen“ beitragen.
Aus unserer Sicht sind die Bemühungen dieses Treffens Teil einer internationalen und internationalistischen Bewegung, welche dazu dient, in den Reihen des Proletariats eine Alternative gegenüber dem Spinngewebe falscher Antworten mit unterschiedlichsten Farben und Tendenzen aus dem bürgerlichen Lager zu entwickeln. Deshalb unterstützen wir dieses Treffen und rufen zur Beteiligung daran auf. IKS 20.02.09
(ESPAREVOL): Ort der Debatte und des Zusammenkommens unter Revolutionären
Genoss/Innen aus verschiedenen Städten Spaniens (Barcelona, Alicante, Granada, San Sebastián, Valencia)[1] haben sich am Wochenende vom 31. Januar bis 1. Februar in Barcelona getroffen, um über folgende Themen zu diskutieren:
- die gegenwärtige kapitalistische Krise und ihre Perspektiven
- der Kampf der Arbeiter gegen die Krise
- wie können wir uns zusammenschließen und die Atomisierung und Isolierung all derjenigen überwinden, welche gegen dieses in der Krise versinkende und immer unmenschlicher, ungerechter und zerstörerischer werdende Gesellschaftssystem kämpfen wollen?
In dem Treffen kamen wir zu einer Reihe von Schlussfolgerungen, die wir hier aufführen wollen, damit sie als Anstoß von all denjenigen aufgegriffen werden, die zu diesem Kampf mit beitragen möchten.
Die Krise:
1. Wir glauben nicht, dass es sich um eine zyklische Krise handelt, welche überwunden werden und eine neue Blütephase einleiten wird. Wir meinen, solch eine Sicht verschweigt, dass wir Opfer bringen, die Klappe halten, unseren „weisen Regierungen“ glauben müssen, welche uns mit „ihren Diensten“ aus dem Schlamassel ziehen würden, in welchen sie uns hineingetrieben haben.
2. Wir meinen, dass wir zurzeit vor der zweiten großen Depression des kapitalistischen Systems stehen. Die letzte war die von 1929. Diese zog schwerwiegende Folgen nach sich, unter anderem die Auslösung des 2. Weltkriegs mit 60 Millionen Toten.
3. Wir glauben nicht, dass es sich um eine Krise des „Neoliberalismus“ handelt, sondern um eine Systemkrise des Kapitalismus insgesamt. Das Eingreifen des Staates wird die Probleme nicht aus der Welt schaffen, sondern sie nur noch verschärfen. Zudem handelt dieser nicht neutral noch zugunsten der Beschäftigten, sondern er verteidigt die Interessen des Kapitalismus.
4. Der Großteil der Weltbevölkerung leidet unter der Krise: Massenarbeitslosigkeit, Verzweiflung über die Wohnungsnot, Gefahr des Bankrotts der Rentenkassen, Lohnkürzungen, Hungersnöte in Afrika usw.
5. Die Krise beschränkt sich aber nicht auf den Bereich der Wirtschaft: die Barbarei im Gazastreifen verdeutlicht, wie sehr sie mit dem imperialistischen Krieg verbunden ist. Sie spitzt die Umweltzerstörung weiter zu. Aber sie ist auch eine gesellschaftliche und menschliche Krise, denn die Atomisierung, die Zerstörung der menschlichen Beziehungen, die moralische Barbarei verschärfen sich All dies birgt die Gefahr, dass das Überleben der Menschheit und elementare Solidarität unter den Ausgebeuteten und Unterdrückten untergraben und zerstört werden.
Der Kampf der Arbeiter:
1. Die Arbeiter dürfen nicht die Hände in den Schoß legen. Es gibt keinen individuellen Ausweg. Auch gibt es keine „Nischen“, in die man sich zurückziehen könnte, bis der Sturm vorüber gezogen wäre. Wir brauchen den kollektiven und solidarischen Kampf der Arbeiter.
2. Die Kämpfe der Arbeiter müssen sich auf internationaler Ebene entfalten. Allein im Januar 2009 gab es wichtige Kämpfe in Litauen, Island, Bulgarien und Lettland. In China kommt es immer wieder zu Abwehrkämpfen der entlassenen Arbeiter, die nicht aufs Land zurückkehren wollen. In Griechenland entfalteten sich im Dezember 2008 wichtige Kämpfe. Auch unter den Jugendlichen in Frankreich und Deutschland rumort es. Die Arbeiterkämpfe nehmen immer mehr eine internationale Dimension an. Es ist aufschlussreich, dass ganz in der Nähe eines brutalen barbarischen Kriegsschauplatzes wie im Gaza-Streifen die Arbeiter Ägyptens 2006, 2007 und 2008 wichtige Kämpfe geführt haben.
3. Aber wir sind uns dessen bewusst, dass die Arbeiterkämpfe immer noch sehr schwach und begrenzt sind. Auch herrschen bislang immer noch Spaltungen vor wie jüngst in Großbritannien, als Beschäftigte im Energiebereich gegen die Anstellung von Beschäftigten aus anderen Ländern protestierten. Wir merken, dass immer noch Angst und Unentschlossenheit, das Gefühl der Isolierung, Zerstreuung und Spaltung dominieren.
4. Wir meinen, um zu kämpfen müssen wir selbständig handeln, d.h. gemeinsam und massiv den Kampf aufnehmen. Wir müssen uns alle daran beteiligen. Wir müssen nach Einigkeit streben und versuchen, die Spaltungen in Betriebe, Branchen, Nationalität, Rasse usw. zu überwinden. Wir müssen die Solidarität als Beschäftigte und die eigenständige Organisierung in Vollversammlungen anstreben, die allen Beschäftigten anderer Branchen, anderer Städte usw. offen stehen. Das einzige, was die Gewerkschaften und Parteien, welche von sich behaupten, die Arbeiter zu „vertreten“, tun, ist die Kämpfe zu sabotieren und zu schwächen.
Ein revolutionärer Ort:
1. Wir meinen, dass als ein Beitrag zum Kampf die Einrichtung eines Ortes der Debatte und des Zusammenkommens nützlich ist. Wir wollen als ein unabhängiges Kollektiv handeln, aber wir sind offen für die Beteiligung von proletarischen und internationalistischen Organisationen.
2. Es geht nicht darum, einfach im leeren Raum zu diskutieren. Wir diskutieren um zu handeln. Wir meinen, dass eine lebendige Debatte mit Beteiligung aller, ohne Vorbedingungen und Dogmen, zum Arbeiterkampf und dessen Entwicklung und Stärkung beitragen kann.
3. Wir stellen uns diesen Ort als einen Rahmen vor, in dem man zur Entfaltung der Arbeiterkämpfe beitragen kann. Wir wollen schnell über Kämpfe berichten. Die Kämpfe sollen schnell bekannt werden, damit sich Solidarität entfalten kann und sich die Beschäftigten aus anderen Branchen oder Städten schnell auf die Erfahrung der anderen stützen können.
4. Wir wollen diese Initiative weiter anderen Genoss/Innen öffnen. Deshalb haben wir beschlossen, in anderen Städten auch solche örtlichen Initiativen anzuregen. Wir bieten unsere Bereitschaft an, solche Treffen in anderen Städten zu arrangieren und dazu beizutragen, falls es dazu interessierte Kollektive gibt.
Wir möchten euch dazu auffordern, unsere Initiative zu unterstützen. Nehmt Kontakt mit uns auf: [email protected] [191]
Wir haben einen Blog geschaffen. groups.google.com/g/esparevol?hl=es [192]
[1]Genoss/Innen aus Sevilla und Madrid konnten sich nicht beteiligen, unterstützen aber das Projekt und sie haben schriftliche Diskussionsbeiträge geschickt. Auch haben sich Genoss/Innen beteiligt, die an ähnlichen Initiativen in anderen Städten in Marseille (Frankreich) mitwirken, womit der internationale und internationalistische Charakter des Treffens deutlicher wurde. Mitglieder von zwei politischen Gruppen – die Internationale Kommunistische Strömung und „Democracia Comunista Luxemburguista“ waren ebenso anwesend. Die anderen Mitglieder gehören im Augenblick keiner politischen Organisation an.
Aktuelles und Laufendes:
- Weltwirtschaftskrise [193]
- Arbeiterkämpfe 2009 [194]
USA: Rettunganker - Staatskapitalismus
- 3449 reads
Wir veröffentlichen nachfolgend einen Auszug aus einem Artikel der Presse der IKS in den USA, Internationalism, der sich hauptsächlich mit der Frage befasst, ob das angekündigte massive Eingreifen des Staates in der US-Wirtschaft etwas Neues und eine wirkungsvolle Waffe zur Bekämpfung sei.
* Staatskapitalismus ist keine Wirtschaftspolitik, welche Regierungen nach Gutdünken einführen oder aufgeben kann, sondern eine historisch neue Form des Kapitalismus, den alle Länder seit dem Beginn der Dekadenz dieses Wirtschaftssystems übernommen haben. In einer Welt, die von ständigen ökonomischen Rivalitäten, barbarischen imperialistischen Auseinandersetzungen und dem Gespenst der proletarischen Revolution zerrüttet wird, hat sich die herrschende Klasse seit 1914 um den Nationalstaat geschart, weil dieser als letzte Bastion gegen die Auflösungserscheinungen der Wirtschaftskrise und als Hauptverteidiger der nationalen imperialistischen Interessen auf der Welt wirkt.
* Das wesentliche Merkmal des Staatskapitalismus ist die Tendenz des Staates, jegliches gesellschaftliches Leben in seinen Händen zu bündeln. Auf ökonomischer Ebene äußert sich diese Tendenz darin, dass der Staat die direkte Kontrolle der Produktion und der Verteilung der Waren übernimmt, politisch durch die Bündelung der politischen Macht in den Händen einer übermächtigen Bürokratie, die alle Aspekte des gesellschaftlichen Lebens überwacht. Politische Abweichler werden unterdrückt, insbesondere die aus den Reihen der Arbeiterklasse. Ihre früheren permanent existierenden politischen Organisationen, Parteien und Gewerkschaften sind in den Staat und in die herrschende Klasse integriert worden.
* Der Staatskapitalismus kann je nach historischen Besonderheiten eines Landes oder nach besonderen Umständen verschiedene Formen annehmen. Er tauchte zum ersten Mal im 1. Weltkrieg auf, als jede am Krieg beteiligte Regierung sich gezwungen sah, die Kontrolle über den Produktionsapparat zu übernehmen und alle Kräfte der Gesellschaft auf die Kriegsmobilisierung zu richten. Aber der Staatskapitalismus ist nicht begrenzt auf die Zeiträume von offenen Kriegen oder offenen Wirtschaftskrisen wie Roosevelts "New Deal" usw. Die untergegangene ‚sozialistischen' Regime Russlands und Osteuropas, des ‚kommunistischen' Chinas und Kubas heute, sind nichts anderes als eine besondere Form des Staatskapitalismus. Das gleiche trifft auf die faschistischen Regime und die offenen Militärdiktaturen in vielen Dritte-Welt-Ländern zu. Ebenso gilt dies für die heutigen so-genannten westlichen Demokratien, ihre ideologische Loyalität gegenüber der "freien Marktwirtschaft" und "politischer Freiheit".
- Der Staatskapitalismus ist weder fortschrittlich noch eine Lösung für die Krise des Systems. Im Gegenteil - der Staatskapitalismus ist selbst ein Ausdruck der Krise des Systems. Er spiegelt die Tatsache wider, dass die Produktionsverhältnisse zu eng geworden sie für die heute bestehenden Produktionsmöglichkeiten der Gesellschaft. Wenn die Wirtschaftspolitik des Staats nicht ein einfaches Werkzeug für die Mobilisierung aller Ressourcen der Gesellschaft für den imperialistischen Krieg sind, dient diese Politik des Staates vor allem dazu, den Kapitalismus am Leben zu erhalten, indem die ökonomischen Gesetze des Systems umgangen und ausgetrickst werden. Dies ist die Erklärung hinter der offensichtlich absurden Politik der Regierungen, koste was es wolle Unternehmen zu retten, die "zu groß sind kaputt zu gehen", weil damit das uralte kapitalistische Prinzip des Kapitalismus, dass "nur der stärkste überlebt" verwischt wird.
Mr. Obama New Deal
In Anbetracht der Ähnlichkeiten der gegenwärtigen Wirtschaftskrise mit der großen Depression in den 1930er Jahren, wird oft der Vergleich angestellt zwischen Obamas Machtübernahme und der Rolle Roosevelts 1933. Obamas angekündigte "Steuererleichterungen" mit der Reihe von Steuersenkungen und staatlich finanzierter Infrastrukturprogramme wird als eine Art neuer New Deal dargestellt, mit Hilfe dessen die Wirtschaft erneut angekurbelt werden und der amerikanische Kapitalismus gerettet werden könnte.
Aber ungeachtet der Ähnlichkeiten der heutigen Situation mit der großen Depression damals ist aus unserer Sicht die Lage des Weltkapitalismus heute viel schlimmer als in den 193er Jahren. Natürlich war der Zusammenbruch des Finanzsystems, der Rückgang der Produktion, der Anstieg der Arbeitslosenrate - um nur einige Indikatoren zu nennen - damals in der großen Depression viel dramatischer als das, was wir heute sehen. 1933 war die Arbeitslosigkeit in den USA auf 25% angestiegen; die Inlandsproduktion um 30% gesunken, die Aktien um ca. 90% gefallen, und mehr als ein Drittel der Banken des Landes waren bankrott. Um Vergleich dazu ist die gegenwärtige Arbeitslosenrate von 7.2% noch ganz günstig und die Wachstumszahlen sehen noch nicht so verheerend aus.
Aber damit haben wir noch nicht das ganze Bild gesehen. Die "Spezialisten" vergessen oft, dass die gegenwärtige Krise nicht erst 2007 begonnen hat. Wie wir öfter hervorgehoben haben, ist die gegenwärtige Rezession nur ein Moment in der offenen Krise des Kapitalismus, die Ende der 1960er Jahre begann, und die sich seitdem nur noch verschlechtert hat, trotz all der Wiederankurbelungen, die jeweils den immer schlimmeren Rezessionen während der letzten vier Jahrzehnte folgten. Während all dieser Jahre hat es diese staatskapitalistische Politik - bislang - geschafft, eine dramatischen Zusammenbruch so wie seinerzeit in der Zeit der großen Depression zu verhindern, aber das geschah nur auf Kosten der langfristigen Zuspitzung der chronischen Wirtschaftskrise. So stellt die gegenwärtige Rezession - in den USA und auf der ganzen Welt - mit all den dramatischen Erschütterungen im Finanzbereich und der mangelnden Kehrtwende ungeachtet der zahlreichen Ankurbelungsprogramme der Staaten, eine Abrechnung mit der Wirklichkeit eines Systems dar, welches durch die staatskapitalistische Politik künstlich am Leben erhalten wird.
Die jetzt von Obamas ‚schlauen Leuten' propagierte Politik ist nicht neu. Sie ist nur eine Variante der gleichen kapitalistischen Politik, welche seit den letzten 40 Jahren praktiziert wurde, und die zuvor schon unter Rooselvelt zur Anwendung kam. Aber die Unfähigkeit der wirtschaftlichen Maßnahmen des Staates, eine Änderung herbeizuführen und auch die Unfähigkeit, dieses todgeweihte System am Leben zu halten, verleiht der gegenwärtigen Rezession ihre wahre historische Bedeutung. Und das ist kein gutes Omen für Obama. Heute ist der Spielraum des Staates für sein Eingreifen viel geringer als den 1930er Jahren. Es ist auch ein Mythos zu behaupten, der New Deal habe seinerzeit die Wirtschaftskrise der 1930er Jahre überwinden können. Nachdem es ihm gelang, den 1929 begonnen Abwärtstrend aufzuhalten, ging dem New Deal schnell die Luft aus. Erneut kam es 1937 zu einem katastrophalen Absturz. Der Zeitraum der Depression wurde nur durch die Kriegswirtschaft während der Massaker des 2. Weltkriegs beendet. Und die Blütephase der Zeit nach dem 2. Weltkrieg in der Wiederaufbauphase war nicht nur das Ergebnis staatskapitalistischer Maßnahmen, sondern ein Ergebnis einer besonderen historischen Konstellation, die heute nicht mehr denkbar ist (siehe dazu unsere Artikel in der Internationalen Revue zur Erklärung des Wirtschaftswunders nach dem 2. Weltkrieg).
Wie wir immer wieder betont haben, verfügt die herrschende Klasse über keine Mittel, die Krise zu lösen. Sie kann nur eine noch größere Zuspitzung der Krise und mehr imperialistische Kriege anbieten. Staatskapitalistische Maßnahmen sind nur ein letztes "aufschiebendes" Mittel für ein todgeweihtes kapitalistisches System. E.S. 15.01.09
Aktuelles und Laufendes:
- Obamas Rettungspakete [195]
- Staatskapitalismus USA [196]
April 2009
- 851 reads
Bürgerkrieg in Deutschland 1918 – 19- Teil IV
- 8990 reads
In den ersten drei Teilen unserer Serie über die Deutsche Revolution 1918-19 zeigten wir, wie sich nach dem Zusammenbruch der Sozialistischen Internationale im Angesicht des I. Weltkrieges das Blatt zugunsten des Proletariats wendete, mit dem Höhepunkt der Novemberrevolution von 1918, die, wie die Oktoberrevolution ein Jahr zuvor, ein Aufstand gegen den imperialistischen Krieg war. Während der Rote Oktober den ersten mächtigen Schlag der Arbeiterklasse gegen den „Großen Krieg“ darstellte, war es die Tat des deutschen Proletariats, die ihn letztendlich beendete.
Laut den Geschichtsbüchern der herrschenden Klasse endet damit auch die Parallele zwischen den Bewegungen in Russland und Deutschland. Die revolutionäre Bewegung in Deutschland habe sich lediglich auf den November 1918 beschränkt und gegen den Krieg gerichtet. Im Gegensatz zu Russland habe es in Deutschland nie eine revolutionäre sozialistische Bewegung gegeben, die sich gegen das kapitalistische System als solches gerichtet habe. Die „Extremisten“, die für eine „bolschewistische“ Revolution in Deutschland gefochten hatten, hätten dies nicht begriffen und dafür mit ihrem Leben bezahlt. So die Behauptungen.
In den ersten drei Teilen unserer Serie über die Deutsche Revolution 1918-19 zeigten wir, wie sich nach dem Zusammenbruch der Sozialistischen Internationale im Angesicht des I. Weltkrieges das Blatt zugunsten des Proletariats wendete, mit dem Höhepunkt der Novemberrevolution von 1918, die, wie die Oktoberrevolution ein Jahr zuvor, ein Aufstand gegen den imperialistischen Krieg war. Während der Rote Oktober den ersten mächtigen Schlag der Arbeiterklasse gegen den „Großen Krieg“ darstellte, war es die Tat des deutschen Proletariats, die ihn letztendlich beendete.
Laut den Geschichtsbüchern der herrschenden Klasse endet damit auch die Parallele zwischen den Bewegungen in Russland und Deutschland. Die revolutionäre Bewegung in Deutschland habe sich lediglich auf den November 1918 beschränkt und gegen den Krieg gerichtet. Im Gegensatz zu Russland habe es in Deutschland nie eine revolutionäre sozialistische Bewegung gegeben, die sich gegen das kapitalistische System als solches gerichtet habe. Die „Extremisten“, die für eine „bolschewistische“ Revolution in Deutschland gefochten hatten, hätten dies nicht begriffen und dafür mit ihrem Leben bezahlt. So die Behauptungen.
Doch die herrschende Klasse jener Zeit besaß nicht die Nonchalance der heutigen Historiker hinsichtlich der Unerschütterlichkeit der kapitalistischen Herrschaft. Ihr damaliges Programm: Bürgerkrieg!
Die „Doppelherrschaft“ und das Rätesystem
Diese Orientierung wurde durch eine Situation der Doppelherrschaft veranlasst, die aus der Novemberrevolution resultierte. Wenn die Beendigung des imperialistischen Krieges das Hauptresultat vom November war, so war sein Hauptprodukt das System der Arbeiter- und Soldatenräte, die sich, wie in Russland und Österreich-Ungarn, über das ganze Land erstreckten.
Die deutsche Bourgeoisie, insbesondere die Sozialdemokratie, zog sofort die Lehren aus dem, was in Russland passiert war, intervenierte von Anfang an, um diese Revolutionsorgane zu einer leeren Hülle zu machen. In vielen Fällen erzwangen sie die Wahl von Delegierten auf der Grundlage von Parteilisten, die sich die SPD und die schwankende, versöhnlerische USPD teilten, was im Endeffekt auf den Ausschluss von Revolutionären aus diesen Organen hinauslief. Auf dem ersten nationalen Kongress der Arbeiter- und Soldatenräte in Berlin hinderte der linke Flügel des Kapitals Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg am Sprechen. Vor allem paukte er einen Antrag durch, in dem die Absicht erklärt wird, alle Macht einer kommenden parlamentarischen Regierung auszuhändigen.
Diese Erfolge der Bourgeoisie bilden noch immer die Grundlage des Mythos‘, dass im Gegensatz zu Russland die Räte in Deutschland nicht revolutionär gewesen seien. Dabei wird jedoch übersehen, dass auch in Russland die Räte zu Beginn der Revolution keinen revolutionären Kurs verfolgten, dass die meisten Delegierten, die zunächst gewählt worden waren, keine Revolutionäre waren und dass es auch dort die „Sowjets“ anfangs eilig hatten, ihre Macht abzugeben.
Nach der Novemberrevolution machte sich die deutsche Bourgeoisie keine Illusionen über die angebliche Harmlosigkeit des Rätesystems. Auch wenn sie die Macht für sich beanspruchten, erlaubten diese Räte dem bürgerlichen Staatsapparat auch weiterhin, mit ihnen zusammen zu koexistieren. Andererseits war das Rätesystem durch seine eigentliche Natur dynamisch und elastisch, seine Zusammensetzung, Haltung und Handlungsweise in der Lage, sich allen Wendungen anzupassen und zu radikalisieren. Die Spartakisten, die dies sofort begriffen hatten, begannen mit einer pausenlosen Agitation für die Neuwahl von Delegierten, die eine scharfe Linkswende in der gesamten Bewegung konkretisieren würde.
Niemand verstand die potenzielle Gefahr dieser „Doppelherrschaft“ besser als die deutsche Militärführung. General Groener, dazu ernannt, die Operationen der Reaktion zu leiten, aktivierte umgehend die geheime Telefonverbindung 998 zum neuen Kanzler, den Sozialdemokraten Ebert. Und genauso wie der legendäre römische Senator Cato zweitausend Jahre zuvor jede Rede mit den Worten „Karthago (der Todesfeind Roms) muss vernichtet werden“ beendet hatte, dachte Groener an die Zerstörung der Arbeiterräte und vor allem der Soldatenräte. Obwohl während und nach der Novemberrevolution die Soldatenräte teilweise ein konservatives totes Gewicht darstellten, um die Arbeiter zurückzuhalten, wusste Groener, dass die Radikalisierung der Revolution diese Tendenz umkehren würde, wenn die Arbeiterräte beginnen würden, die Soldaten hinter sich zu ziehen. Vor allem: die Ambitionen der Soldatenräte bestanden darin, das Kommando zu übernehmen und die Herrschaft der Offiziere über die Streitkräfte zu brechen. Dies lief auf nichts anderes hinaus als die Bewaffnung der Revolution. Keine herrschende Klasse hat jemals freiwillig die Aufgabe ihres eigenen Monopols über die Streitkräfte akzeptiert. In diesem Sinn setzte die bloße Existenz des Rätesystems den Bürgerkrieg auf die Agenda.
Mehr noch: die Bourgeoisie begriff, dass im Anschluss an der Novemberrevolution die Zeit nicht mehr auf ihrer Seite war. Die spontane Tendenz der gesamten Situation wies in Richtung Radikalisierung der Arbeiterklasse, Verlust ihrer Illusionen bezüglich der Sozialdemokratie und der „Demokratie“ sowie eines wachsenden Selbstbewusstseins. Ohne das geringste Zögern schlug die deutsche Bourgeoisie den Weg zu einer Politik der systematischen Provozierung militärischer Auseinandersetzungen ein. Ihr Ziel: ihrem Klassenfeind entscheidende Konfrontationen aufzuzwingen, noch bevor die revolutionäre Situation herangereift war. Konkreter: die „Enthauptung“ des Proletariats durch eine blutige Niederlage der Arbeiter der Hauptstadt Berlin, dem politischen Zentrum der deutschen Arbeiterbewegung, bevor die Kämpfe in den Provinzen eine „kritische“ Stufe erreicht hatten.
Der offene Kampf zwischen zwei Klassen, von denen jede entschlossen war, ihre eigene Macht durchzusetzen, jede mit ihren eigenen Organisationen der Klassenherrschaft, konnte nur ein temporärer, instabiler, unhaltbarer Zustand sein. „Doppelherrschaft“ endet im Bürgerkrieg.
Die Kräfte der Konterrevolution
Im Gegensatz zur Lage in Russland 1917 stand die Deutsche Revolution den feindlichen Kräften der gesamten Weltbourgeoisie gegenüber. Die herrschende Klasse war nicht mehr durch den imperialistischen Krieg in zwei rivalisierende Lager gespalten. Als solche stand der Revolution nicht nur die deutsche Bourgeoisie gegenüber, sondern auch die Kräfte der Entente, die sich auf der Westseite des Rheins sammelten, bereit, militärisch zu intervenieren, sollte die deutsche Regierung die Kontrolle über die soziale Lage verlieren. Die Vereinigten Staaten, ein relativer Newcomer auf der weltpolitischen Ebene, spielten die Karte der „Demokratie“ und des „Rechts der Nationen auf Selbstbestimmung“, wobei sie sich selbst als die einzige Garantie für Frieden und Wohlstand präsentierten. Als solche versuchten sie eine politische Alternative zum revolutionären Russland zu formulieren. Die französische Bourgeoisie, die ihrerseits von ihrem eigenen imperialistischen Durst nach Rache besessen war, brannte darauf, tiefer auf deutsches Territorium vorzudringen und die Revolution dabei in Blut zu ertränken. Es war Großbritannien, damals die größte Macht auf der Welt, das die Führung dieser konterrevolutionären Allianz übernahm. Statt das Embargo, das es während des Krieges gegen Deutschland verhängt hatte, aufzuheben, verschärfte Großbritannien es teilweise sogar noch. London war entschlossen, die Bevölkerung Deutschlands solange auszuhungern, bis dieses Land ein politisches Regime installiert hatte, das von der Regierung Ihrer Majestät befürwortet wurde.
Innerhalb Deutschlands selbst war die zentrale Achse der Konterrevolution das Bündnis zwischen den Hauptkräften der Sozialdemokratie und des Militärs. Die Sozialdemokratie war das trojanische Pferd des weißen Terrors, indem sie hinter den Linien des Klassenfeindes operierte, die Revolution von innen sabotierte und ihre verbliebene Autorität als ehemalige Arbeiterpartei (und in Gestalt der Gewerkschaften) nutzte, um ein Maximum an Konfusion und Demoralisierung zu schaffen. Das Militär lieferte die bewaffneten Kräfte, brachte aber auch die Erbarmungslosigkeit, Verwegenheit und strategische Fähigkeit mit, die es seit jeher auszeichnen.
Was für ein schwankender, halbherziger Haufen die russischen Sozialisten um Kerenski 1917 doch waren, verglichen mit den kaltblütigen Konterrevolutionären der deutschen SPD! Was für ein unorganisierter Mob die russischen Offiziere doch im Vergleich mit der grimmigen Effizienz der preußischen Militärelite waren[1]!
In den Tagen und Wochen nach der Novemberrevolution machte sich diese morbide Allianz daran, zwei Hauptprobleme zu lösen: Angesichts der Auflösung der imperialistischen Armeen musste sie den harten Kern einer neuen Kraft, eine Weiße Armee des Terrors, zusammenhalten. Sie bezog ihr Rohmaterial aus zwei Hauptquellen, aus dem alten Offizierskorps und aus jenen entwurzelten Speichelleckern, die durch den Krieg verrückt geworden waren und nicht mehr in das „zivile“ Leben integriert werden konnten. Als gebrochene Opfer des Imperialismus waren diese ehemaligen Soldaten auf der Suche nach einem Ventil für ihren blinden Hass und nach jemanden, der für ihre Dienste zahlte. Aus diesen Desperados rekrutierten und trainierten die adligen Offiziere – politisch unterstützt und gedeckt durch die SPD – das, was zu den Freikorps werden sollte, die Söldner der Konterrevolution, Kern der späteren Nazibewegung.
Diese bewaffneten Kräfte wurden durch eine ganze Reihe von Spionageringen und Agents provocateurs unterstützt, die von der SPD und dem Armeestab koordiniert wurden.
Das zweite Problem war, wie man den Arbeitern gegenüber den Einsatz des weißen Terrors rechtfertigte. Es war die Sozialdemokratie, die dieses Problem löste. Vier Jahre lang hat sie im Namen des Friedens den imperialistischen Krieg gepredigt. Nun predigte sie den Bürgerkrieg im Namen der... Verhinderung des Bürgerkrieges. Wir kennen niemanden, der Blutvergießen will, erklärte sie – außer Spartakus! Zu viele Arbeiter haben ihr Blut vergossen im Großen Krieg – aber Spartakus dürstet nach mehr!
Die damaligen Massenmedien verbreiteten diese schamlosen Lügen: Spartakus mordet und plündert und heuert Soldaten für die Konterrevolution an und kollaboriert mit der Entente und erhält Geld von den Kapitalisten und bereitet eine Diktatur vor. Die SPD beschuldigte Spartakus dessen, was sie selbst tat!
Die erste große Menschenjagd des 20. Jahrhunderts in einer der hoch-„zivilisierten“ Industrienationen Westeuropas richtete sich gegen Spartakus. Und während die höchsten Tiere aus Kapital und Militär enorme Belohnungen für die Liquidierung der Spartakusführer auslobten, wobei sie es vorzogen, anonym zu bleiben, rief die SPD in ihrer Parteipresse offen zur Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg auf. Anders als ihre bürgerlichen Freunde wurde die SPD zu dieser Kampagne nicht nur durch ihren (bürgerlichen) Klasseninstinkt und durch ihr strategisches Denken veranlasst, sondern auch durch einen Hass, der nicht weniger grenzenlos war wie der der Freikorps.
Die deutsche Bourgeoisie ließ sich nicht vom oberflächlichen und flüchtigen Eindruck des Moments blenden: von Spartakus als eine kleine, abseits stehende Gruppe. Sie wusste, dass hier das Herz des Proletariats schlug, und war bereit, zum tödlichen Schlag auszuholen.
Dezember 1918: Erste Siege des Proletariats
Die konterrevolutionäre Offensive begann am 6. Dezember in Berlin mit einem Angriff an drei Fronten. Das Hauptquartier der Roten Fahne, der Zeitung des Spartakusbundes, war Ziel einer Razzia. Eine andere Gruppe von Soldaten versuchte die Führer des Exekutivorgans der Arbeiterräte, die sich in einer Sitzung befanden, festzunehmen. Die Absicht, die Arbeiterräte als solche zu eliminieren, war offensichtlich. Eine weitere Gruppe von Soldaten kam ihnen um der Ecke entgegen und forderte Ebert dazu auf, den Vollzugsrat zu verbieten. Außerdem geriet eine Demonstration von Spartakus nahe des Stadtzentrums, in der Chausseestraße, in den Hinterhalt: 18 Tote, 30 Verletzte. Dank proletarischer Tapferkeit und Erfindungsgabe gelang es, Schlimmeres zu verhüten. Die Führer des Vollzugsausschusses waren in der Lage, den Soldaten diese Aktion auszureden. Und eine Gruppe russischer Kriegsgefangener, die von hinten die Friedrichstraße entlang kam, war imstande, mit ihren bloßen Händen die Maschinengewehrschützen von der Chausseestraße zu überraschen und zu überwältigen[2].
Am folgenden Tag wurde ein Versuch unternommen, Karl Liebknecht in den Büros der Roten Fahne festzunehmen (bzw. zu kidnappen) und zu ermorden. Seine eigene Kaltschnäuzigkeit rettete ihm bei dieser Gelegenheit das Leben.
Diese Aktionen provozierten die ersten gigantischen Solidaritätsdemonstrationen des Berliner Proletariats mit Spartakus. Von nun an waren sämtliche Demonstrationen des Spartakusbundes bewaffnet, mit Maschinengewehrbatterien bestückte Lastwagen an der Spitze. Gleichzeitig intensivierte sich angesichts solcher Provokationen die gigantische Streikwelle, die im November in den Schwerindustrieregionen Oberschlesiens und der Ruhr ausgebrochen war.
Das nächste Ziel der Konterrevolution war die Volksmarinedivision, bewaffnete Matrosen, die von den Hafenstädten an der Küste nach Berlin gekommen waren, um die Revolution zu verbreiten. Ihre bloße Existenz war für die Behörden eine Provokation, dies um so mehr, seitdem sie den Palast der geheiligten preußischen Könige besetzt hatten[3].
Diesmal bereitete die SPD den Boden vorsichtiger. Sie wartete die Resultate des nationalen Rätekongresses ab, die sich als vorteilhaft für die Übergabe der Macht an die SPD-Regierung und an die künftige Nationalversammlung herausstellten. Eine Medienkampagne beschuldigte die Matrosen des Marodierens und Plünderns. Kriminelle, Spartakisten!
Am Morgen des 24. Dezember, Heiligabend, präsentierte die Regierung den 28 Matrosen im Palast und ihren 80 Genossen im Marstall ein Ultimatum[4]: bedingungslose Aufgabe. Die schlecht bewaffnete Armeegarnison gelobte, bis zum letzten Mann zu kämpfen. Genau zehn Minuten später (es war nicht einmal genug Zeit, Frauen und Kinder aus den Gebäuden zu evakuieren) weckte das Donnern der Artillerie die Großstadt.
„Das wäre nun, trotz aller Zähigkeit der Matrosen, weil sie mit ihren Waffen keinen Staat machen konnten, eine verlorene Schlacht geworden – wenn sie irgendwo sonst stattgefunden hätte. Aber sie fand mitten in Berlin statt. Bei Schlachten spielen bekanntlich Flüsse, Hügel, Geländeschwierigkeiten eine große Rolle. In Berlin waren die Geländeschwierigkeiten Menschen.
Wie die Kanonen stolz und großmäulig krachten, weckten sie Zivilisten aus dem Schlaf, die sofort verstanden, was die Kanonen sagten. Sie liefen herbei, um auch ihre Ansicht zu äußern. Und dass sie herbei- und nicht wegliefen, war ein Zeichen, dass sie die Kanonen verstanden.” (Bd. 4. Seite 143)[5]
Anders als Großbritannien oder Frankreich war Deutschland keine dauerhafte zentralisierte Monarchie gewesen. Anders als London oder Paris wurde Berlin nicht zu einer Weltmetropole unter der Anleitung eines Regierungsplanes gestaltet. Ähnlich dem Ruhrtal wucherte Berlin wie ein Krebs. Das Ergebnis war, dass das Regierungsviertel letztendlich auf drei Seiten von einem „roten Gürtel“ riesiger Arbeiterbezirke umgeben war[6]. Bewaffnete Arbeiter eilten zum Ort des Geschehens, um die Matrosen zu verteidigen. Arbeiterinnen und Kinder standen zwischen den Gewehren und deren Zielen, nur mit ihrem Mut, ihrem Humor und ihrer Überzeugungskraft ausgerüstet. Die Soldaten warfen ihren Waffen weg und entwaffneten die Offiziere[7].
Am folgenden Tag nahm die massivste Demonstration in der Hauptstadt seit dem 9. November Besitz vom Stadtzentrum – diesmal gegen die SPD und in Verteidigung der Revolution. Am gleichen Tag besetzten Arbeitergruppen die Büros des Vorwärts, der Tageszeitung der SPD. Es gibt wenig Zweifel daran, dass diese Tat das spontane Ergebnis der tiefen Empörung des Proletariats war. Jahrzehntelang war der Vorwärts das Sprachrohr der Arbeiterklasse gewesen – bis die SPD-Führung ihn während des Weltkrieges stahl. Jetzt war er das schamloseste und unehrlichste Organ der Konterrevolution.
Die SPD sah sofort die Möglichkeit, die Situation für eine neue Provokation auszunutzen, indem sie eine Kampagne gegen den angeblichen „Angriff auf die Pressefreiheit“ startete. Doch die Obleute, die revolutionären Delegierten, eilten zur Zentrale des Vorwärts und überzeugten die Besetzer von der taktischen Klugheit eines vorläufigen Rückzugs, um eine vorzeitige Konfrontation zu vermeiden.
Das Jahr endete mit einer weiteren Demonstration der revolutionären Entschlossenheit: die Beerdigung der elf toten Matrosen aus der Schlacht um den Marstall. Am gleichen Tag verließ die USPD die Koalitionsregierung mit der SPD. Und während die Ebert-Regierung mit dem Gedanken spielte, aus der Hauptstadt zu fliehen, begann der Gründungskongress der KPD.
Die Eichhorn-Affäre und die zweite Vorwärts-Besetzung
Die Ereignisse des Dezember 1918 enthüllten, dass eine tiefgehende Konsolidierung der Revolution begonnen hatte. Die Arbeiterklasse gewann die ersten Konfrontationen in der neuen Phase, entweder durch die Kühnheit ihrer Aktionen oder durch die Klugheit ihrer taktischen Rückzüge. Die SPD hatte zumindest begonnen, ihren konterrevolutionären Charakter vor den Augen der gesamten Klasse zu entblößen. Es stellte sich schnell heraus, dass die bürgerliche Strategie der Provokationen schwierig, ja riskant war.
Mit dem Rücken zur Wand zog die herrschende Klasse mit bemerkenswerter Klarheit die Lehren aus diesen ersten Geplänkeln. Sie realisierte, dass die direkte und massive Anvisierung von Symbolen und Identifikationsfiguren der Revolution – Spartakus, die Führung der Arbeiterräte oder die Marinedivisionen – sich als kontraproduktiv erwies, da sie die Solidarität der gesamten Arbeiterklasse provozierte. Besser die weniger prominenten Figuren angreifen, die nur die Solidarität von Teilen der Klasse genossen, um so die Arbeiter in der Hauptstadt zu spalten und sie vom Rest des Landes zu isolieren. Solch eine Figur war Emil Eichhorn, der dem linken Flügel der USPD angehörte. Ein verrückter Zufall, eine der Parodoxien, die jede große Revolution produziert, hatte diesen Mann zum Präsidenten der Berliner Polizei gemacht. In dieser Funktion begann er Waffen an die Arbeitermilizen zu verteilen. Er war eine Provokation für die herrschende Klasse. Ihn zum Ziel der Angriffe zu machen würde dabei helfen, die Kräfte der Konterrevolution zu galvanisieren, die noch unter den ersten Rückschlägen wankten. Gleichzeitig war die Verteidigung eines Polizeichefs ein zwiespältiger Anlass für die Mobilisierung der revolutionären Kräfte!
Doch die Konterrevolution hatte eine zweite Provokation im Ärmel, nicht weniger zwiespältig, mit nicht geringerem Potenzial, um die Klasse zu spalten und ins Stocken zu bringen. Es war der SPD-Führung nicht entgangen, dass die kurze Besetzung der Vorwärts-Büros sozialdemokratische Arbeiter schockiert hatte. Die meisten dieser Arbeiter schämten sich für den Inhalt dieser Zeitung. Was sie besorgte, war etwas anderes: Es könnte das Menetekel des militärischen Konfliktes zwischen sozialdemokratischen und kommunistischen Arbeitern – mit grellen Farben von der SPD an die Wand gemalt – aus solchen Besetzungen resultieren. Diese Sorge wog umso schwerer – und die SPD-Führung wusste dies -, weil sie von dem realen proletarischen Anliegen, die Einheit der Klasse zu verteidigen, getragen wurde.
Die gesamte Provokationsmaschinerie wurde wieder in Bewegung gesetzt.
Schwall von Lügen: Eichhorn sei korrupt, ein Krimineller, der, von den Russen bezahlt, einen konterrevolutionären Putsch vorbereite!
Ultimatum: Eichhorn müsse umgehend zurücktreten oder mit Gewalt entfernt werden!
Entfaltung roher Gewalt: Diesmal wurden 10.000 Mann im Stadtzentrum postiert, 80.000 in unmittelbarer Nähe zusammengezogen. Miteingeschlossen die höchst disziplinierte Elitedivision des General Maercker, Infanterietruppen, eine „eiserne Brigade“ von der Küste, Milizen aus den bürgerlichen Bezirken und die ersten Freikorps. Doch sie umfassten auch die „Republikanische Garde“, eine bewaffnete Miliz der SPD, wo der Name Eichhorn unbekannt war.
Die fatale Falle des Januar 1919
Wie die Bourgeoisie erwartete, mobilisierte der Angriff gegen Eichhorn nicht jene Truppen in der Hauptstadt, die mit der Revolution sympathisierten. Auch die Arbeiter in den Provinzen, wo der Name Eichhorn unbekannt war, erhoben sich nicht.
Doch es gab eine neue Komponente in der Situation, die alle überraschte. Dies war die Massivität und Intensität der Reaktion des Proletariats von Berlin. Am Sonntag, den 5. Januar, folgten 150.000 dem Aufruf der Revolutionären Obleute[8] zur Demonstration vor dem Polizeipräsidium am Alexanderplatz. Am folgenden Tag legten über eine halbe Million Arbeiter die Werkzeuge beiseite und nahmen das Stadtzentrum in ihren Besitz. Diese Arbeiter waren bereit, zu kämpfen und zu sterben. Sie hatten sofort begriffen, dass es nicht um Eichhorn, sondern um die Verteidigung der Revolution ging.
Obgleich sie von der machtvollen Antwort verblüfft war, war die Konterrevolution kaltblütig genug, mit ihren Plänen weiterzumachen. Einmal mehr wurde der Vorwärts besetzt, aber auch andere Pressebüros im Stadtzentrum. Diesmal allerdings hatten Agents provocateurs von der Polizei die Initiative ergriffen[9].
Die junge KPD warnte sofort die Arbeiterklasse. In einem Flugblatt und in Artikeln auf der ersten Seite der Roten Fahne rief sie das Proletariat dazu auf, neue Delegierte für ihre Räte zu wählen und sich selbst zu bewaffnen, sich aber auch zu vergegenwärtigen, dass der Moment der bewaffneten Erhebung noch nicht gekommen war. Solch eine Erhebung erforderte eine zentralisierte Führung auf der Ebene des gesamten Landes. Diese konnte nur durch die Arbeiterräte geschaffen werden, in welchen die Revolutionäre Einfluss ausübten.
Am Abend des 5. Januar kamen die revolutionären Führer zu Beratungen im Hauptquartier von Eichhorn zusammen. Um die 70 Obleute waren anwesend, von denen gute 80 Prozent Anhänger der Linken in der USPD waren, der Rest Anhänger der KPD. Die Mitglieder des Zentralkomitees der Berliner Organisation der USPD kreuzten genauso wie zwei Mitglieder des Zentralkomitees der KPD, Karl Liebknecht und Wilhelm Pieck, auf.
Zunächst waren sich die Delegierten der Arbeiterorganisationen unsicher darüber, wie sie antworten sollten. Doch dann verwandelte sich die Atmosphäre, ja wurde elektrisiert durch die eintreffenden Berichte. Diese Berichte betrafen die bewaffneten Besetzungen im Zeitungsviertel und die angebliche Bereitschaft verschiedener Garnisonen, sich einer bewaffneten Erhebung anzuschließen. Nun erklärte Liebknecht, dass unter diesen Umständen nicht nur die Zurückweisung des Angriffs gegen Eichhorn notwendig geworden ist, sondern auch die bewaffnete Erhebung.
Die Augenzeugenberichte dieses dramatischen Treffens deuten an, dass die Intervention von Liebknecht der fatale Wendepunkt gewesen war. Den ganzen Krieg hindurch war er für das deutsche, ja für das Weltproletariat der politische Kompass und das moralische Gewissen gewesen. Nun, in diesem eminent wichtigen Moment der Revolution verlor er seinen Kopf und seine Orientierung. Vor allem ebnete er den Weg für die Unabhängigen, die damals noch die dominierende politische Kraft waren. Bar jeglicher klar definierter Prinzipien, einer klaren langfristigen Perspektive und eines tieferen Vertrauens in die Sache des Proletariats, war diese „unabhängige“ Strömung dazu verdammt, unter dem Druck der unmittelbaren Situation beständig hin und her zu schwanken und sich so mit der herrschenden Klasse zu versöhnen. Doch die andere Seite der Münze, des „Zentrismus“, war das starke Bedürfnis nach Teilnahme, wann immer eine unklare „Aktion“ anstand, nicht zuletzt um die eigene revolutionäre Entschlossenheit zu dokumentieren.
„Die Unabhängige Partei hatte kein klares politisches Programm; aber nichts lag ihr ferner, als ein Handstreich gegen die Regierung Ebert-Scheidemann. In dieser Konferenz lag die Entscheidung bei den Unabhängigen. Und da zeigte es sich, daß sich insbesondere jene schwankenden Gestalten, wie sie im Berliner Zentralvorstand saßen, die sich gewöhnlich nicht gern in Gefahr begaben, aber doch überall dabei sein wollten, als die wildesten Schreier und recht ‚revolutionär‘ gebärdeten.“[10]
Laut Richard Müller eskalierte die Situation so in eine Art Konkurrenz zwischen der USPD-Führung und der KPD-Delegation.
„Jetzt wollten die Unabhängigen Mut und Konsequenz zeigen, indem sie das von Liebknecht gesteckte Ziel noch übertrumpften. Konnte Liebknecht angesichts des ‚revolutionären‘ Feuers dieser ‚schwankenden und zagenden Elemente‘ zurückstehen? Das lag nicht in seiner Natur.“[11]
Warnungen wie jener von Soldatendelegierten, die ihre Zweifel über die Kampfbereitschaft der Truppen äußerten, wurde nicht Gehör geschenkt.
„Richard Müller wandte sich in der schärfsten Form gegen das vorgeschlagene Ziel des Kampfes, Sturz der Regierung. Er legte dar, daß dafür weder politisch noch militärisch die Voraussetzungen gegeben seien. Die Bewegung im Reiche wachse von Tag zu Tag. In kurzer Zeit könnten die politischen, militärischen und psychologischen Voraussetzungen für den Kampf um die Macht geschaffen sein. Ein verfrühtes isoliertes Vorgehen in Berlin könne die weitere Entwicklung der Revolution gefährden. – Nur mit Mühe konnte er seine ablehnende Haltung gegen den allseitigen Widerspruch vortragen.“[12]
Drei wichtige Entscheidungen wurden zur Abstimmung gestellt und angenommen. Der Aufruf zu einem Generalstreik wurde einmütig verabschiedet. Die beiden anderen Entscheidungen, die Aufrufe, die Regierung zu stürzen und die Besetzung der Pressebüros aufrechtzuhalten, wurden mit großen Mehrheit angenommen, jedoch mit sechs Gegenstimmen[13].
Schließlich wurde ein „provisorisches revolutionäres Aktionskomitee“ mit 53 Mitgliedern und drei Vorsitzenden, Liebknecht, Ledebour, Scholze, gebildet.
Nun war das Proletariat in die Falle getappt.
Die so genannte Spartakuswoche
Nun folgte eine blutige Woche der Kämpfe in Berlin. Die Bourgeoisie nannte sie die „Spartakuswoche“: die Vereitelung eines „kommunistischen Putsches“ dank der „Helden der Freiheit und Demokratie“. Das Schicksal der deutschen und Weltrevolution wurde in dieser Woche vom 5. bis zum 12. Januar besiegelt.
Am Morgen nach der Konstituierung des Revolutionskomitees war der Generalstreik in der Stadt fast total. Noch mehr Arbeiter als tags zuvor strömten in das Stadtzentrum, viele von ihnen bewaffnet. Doch gegen Mittag waren alle Hoffnungen auf eine aktive Unterstützung durch die Garnisonen zerstoben. Selbst die Matrosendivision, eine lebende Legende, erklärte sich selbst für neutral, ja ging soweit, dass sie ihren eigenen Delegierten, Dorrenbach, wegen seiner in ihren Augen unverantwortlichen Beteiligung am Aufruf zum Aufstand festsetzte. Am Nachmittag desselben Tages wies dieselbe Volksmarinedivision das Revolutionskomitee aus den Marstall, wo es Schutz gesucht hatte. Auch die konkreten Maßnahmen, um die Regierung zu entfernen, wurden vereitelt oder sogar ignoriert, da keine sichtbare bewaffnete Macht hinter ihnen stand[14]!
Den ganzen Tag hindurch waren die Massen auf den Straßen, auf weitere Instruktionen von ihren Führern wartend. Doch es kamen keine solche Instruktionen. Die Kunst der erfolgreichen Ausführung von Massenaktionen besteht in der Konzentration und Ausrichtung aller Energien auf ein Ziel, das über den Ausgangspunkt hinausgeht, das den Teilnehmern das Gefühl des kollektiven Erfolges und der kollektiven Stärke gibt. In der gegebenen Situation war die bloße Wiederholung des Streiks und der Massendemonstrationen früherer Tage nicht genug. Ein wirklicher Fortschritt wäre zum Beispiel die Umzingelung der Kasernen und die Agitation der Soldaten gewesen, um diese für die neue Stufe der Revolution zu gewinnen, die Entwaffnung der Offiziere, der Beginn einer breiteren Bewaffnung der Arbeiter[15]. Doch das selbsternannte Revolutionskomitee schlug keine solche Maßnahmen vor, nicht zuletzt, weil es bereits einen Handlungsrahmen vorgeschlagen hatte, der weitaus radikaler, aber unglücklicherweise auch unrealistischer war. Nachdem es zu nichts Geringerem als den bewaffneten Aufstand aufgerufen hatte, wären konkretere, aber weitaus weniger spektakuläre Maßnahmen eine Enttäuschung gewesen, ein Anti-Höhepunkt, ein Rückzug. Das Komitee und mit ihm das Proletariat waren Gefangene eines fehlgeleiteten, leeren Radikalismus.
Die Führung der KPD war entsetzt, als sie die Neuigkeiten über den vorgeschlagenen Aufstand vernahm. Besonders Rosa Luxemburg und Leo Jogiches beschuldigten Liebknecht und Pieck, sich nicht nur von den Beschlüssen des Parteikongresses in der vorherigen Woche, sondern auch vom Parteiprogramm selbst abgewendet zu haben[16].
Doch diese Fehler konnten nicht ungeschehen gemacht werden und waren als solche (noch) nicht die dringendste Frage. Die Wende in den Ereignissen konfrontierte die Partei mit einem fürchterlichen Dilemma: Wie sollte sie das Proletariat aus der Falle befreien, in der Letztere gefangen war?
Diese Aufgabe war weitaus schwieriger als jene, die während der berühmten „Juli-Tage“ von 1917 in Russland von den Bolschewiki gemeistert worden war, als es der Partei gelang, der Klasse zu helfen, der Falle einer vorzeitigen militärischen Konfrontation auszuweichen.
Die erstaunliche, weil paradoxe Antwort, die die Partei, angetrieben von Rosa Luxemburg, fand, war folgende. Die KPD, der entschlossenste Gegner einer bewaffneten Revolution bis dahin, musste nun zu ihrem glühendsten Protagonisten werden. Dies aus einem einzigen Grund. Die Macht in Berlin zu übernehmen war der einzige Weg, um das blutige Massaker zu verhindern, das nun drohte, die Enthauptung des deutschen Proletariats. Wenn diese Gefahr einmal gebannt war, konnte das Berliner Proletariat das Problem angehen, durchzuhalten oder sich geordnet zurückzuziehen, bis die Revolution im gesamten Land reif war.
Karl Radek, der geheime Emissär der russischen Partei in Berlin, schlug einen alternativen Kurs vor: sofortiger Rückzug bei voller Bewaffnung, aber, falls notwendig, die Aufgabe. Doch die Klasse in ihrer Gesamtheit hatte noch immer keine Waffen. Das Problem war, dass der Schein eines „undemokratischen“ kommunistischen „Putsches“ der Regierung den Vorwand gab, den sie benötigte, um ein Blutbad anzurichten. Kein Rückzug der Kombattanten konnte dies verhindern.
Der von Rosa Luxemburg vorgeschlagene Handlungsverlauf beruhte auf der Analyse, dass das militärische Kräfteverhältnis in der Hauptstadt für das Proletariat nicht ungünstig war. Und in der Tat: auch wenn der 6. Januar die Hoffnungen des Revolutionskomitees auf „seine“ Truppen zerschmetterte, so wurde rasch deutlich, dass die Konterrevolution sich ebenfalls verkalkuliert hatte. Die Republikanische Garde und jene Truppen, die mit der SPD sympathisierten, weigerten sich nun ihrerseits, Gewalt gegen die revolutionären Arbeiter anzuwenden. In ihren Berichten über die Ereignisse bestätigten sowohl der Revolutionär Richard Müller als auch später der Konterrevolutionär Noske die Richtigkeit der Analyse von Rosa Luxemburg: Vom militärischen Standpunkt aus war das Kräfteverhältnis zu Beginn der Woche zu Gunsten des Proletariats.
Doch die entscheidende Frage war nicht das militärische, sondern das politische Kräfteverhältnis. Und dies sprach gegen das Proletariat aus dem einfachen Grund, dass die Führung der Bewegung immer noch in den Händen der „Zentristen“ lag, den schwankenden Elementen, und noch nicht in den Händen konsequenter Revolutionäre. Gemäß der marxistischen „Kunst des Aufstandes“ ist die bewaffnete Erhebung der letzte Schritt in dem Prozess einer im Aufwind befindlichen Revolution, der lediglich die letzten Widerstandsnester wegfegt.
Als das provisorische Komitee die Falle realisierte, in der es sich selbst hineinmanövriert hatte, begann es, statt das Proletariat zu bewaffnen, mit der Regierung zu verhandeln, die es soeben noch als enthoben erklärt hatte, ohne überhaupt zu wissen, worüber es verhandeln wollte. Angesichts des Verhaltens des Komitees zwang die KPD am 10. Januar Liebknecht und Pieck, aus ihm auszutreten. Doch der Schaden war schon angerichtet. Die Politik der Versöhnung lähmte das Proletariat und brachte all seine Zweifel und all sein Zaudern ans Tageslicht. Die Arbeiter einer ganzen Reihe von großen Fabriken kamen mit Erklärungen heraus, in denen die SPD verurteilt wurde, aber auch Liebknecht und die „Spartakisten“ und zur Wiederversöhnung der „sozialistischen Parteien“ aufgerufen wurde.
Zu diesem Zeitpunkt, als die Konterrevolution taumelte, rettete der Sozialdemokrat Noske alles. „Einer muss ja der Bluthund sein. Ich fürchte mich nicht vor der Verantwortung“, erklärte er. Während sie „Verhandlungen“ vortäuschte, um Zeit zu gewinnen, forderte die SPD nun die Offiziere, Studenten, die bürgerlichen Milizen offen auf, den Arbeiterwiderstand in Blut zu ertränken. So gespalten und demoralisiert, wie das Proletariat war, war der Weg nun offen für den grausamsten weißen Terror. Diese Gräueltaten umfassten die Bombardierung von Gebäuden mit Artillerie und Minen, die Ermordung von Gefangenen und sogar von Verhandlungsdelegierten, das Lynchen von Arbeitern, aber auch von Soldaten, die Revolutionären die Hände geschüttelt hatten, die Belästigung von Frauen und Kindern in den Arbeiterbezirken, die Schändung von Leichen, aber auch die systematische Jagd und Ermordung von Revolutionären wie Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Wir werden zum Charakter und zu der Bedeutung dieses Terrors im letzten Artikel dieser Serie zurückkommen.
Revolutionärer Massenstreik, Januar-März 1919
In einem berühmten Artikel, veröffentlicht in der Roten Fahne am 27. November 1918, mit dem Titel „Der Acheron in Bewegung“, kündigte Rosa Luxemburg den Beginn einer neuen Phase in der Revolution an: die Phase des Massenstreiks. Dies wurde bald in beeindruckender Manier bestätigt. Die materielle Lage der Bevölkerung verbesserte sich nicht nach dem Ende des Krieges. Das Gegenteil war der Fall. Inflation, Entlassungen und Massenarbeitslosigkeit, Kurzarbeit und fallende Reallöhne schufen neues Elend für Millionen von Arbeitern, Staatsbeamten, aber auch für große Teile der Mittelschichten. In wachsendem Maße zwang das materielle Elend, aber auch die bittere Enttäuschung über die Resultate der Novemberrevolution die Massen zur Selbstverteidigung. Ihre leeren Bäuche waren ein mächtiges Argument gegen die angeblichen Wohltaten der neuen bürgerlichen Demokratie. Vor allem im ersten Vierteljahr 1919 rollten erfolgreiche Streikwellen durch das Land. Neben den traditionellen Zentren der organisierten sozialistischen Bewegung wie Berlin, die Hafenstädte oder die Ballungsgebiete des Maschinenbaus und der hochtechnologisierten Sektoren[17], wurden auch politisch weniger erfahrene Teile des Proletariats in den revolutionären Prozess gespült. Diese schlossen die, wie Rosa Luxemburg sie in ihrem „Massenstreik“ nannte, „Helotenschichten“ mit ein[18]. Es waren die besonders unterdrückten Teile der Klasse, die wenig von der sozialistischen Erziehung profitiert hatten und auf welche die sozialdemokratischen und gewerkschaftlichen Funktionäre vor dem Krieg oft herabgeblickt hatten. Rosa Luxemburg hatte vorausgesagt, dass sie in einem künftigen Kampf für den Sozialismus eine führende Rolle spielen würden.
Und nun waren sie da. Zum Beispiel die Millionen von Bergarbeiter, Metall- und Textilarbeiter in den Industriebezirken am Niederrhein und in Westfalen[19]. Dort wurden die defensiven Arbeiterkämpfe sofort von einem brutalen Bündnis der Arbeitgeber und ihres bewaffneten Werkschutzes, der Gewerkschaften und der Freikorps konfrontiert. Aus diesen ersten Konfrontationen kristallisierten sich zwei Hauptforderungen der Streikbewegung heraus, die auf einer Konferenz der Delegierten aus der ganzen Region Anfang Februar in Essen formuliert wurden: Alle Macht den Arbeiter- und Soldatenräten! Sozialisierung der Fabriken und des Bergbaus!
Die Situation eskalierte, als das Militär versuchte, den Soldatenrat zu entwaffnen und zu schleifen, und 30.000 Freikorps entsandte, um das Ruhrgebiet zu besetzen. Am 14. Februar riefen die Arbeiter- und Soldatenräte zu einem Generalstreik und zum bewaffneten Widerstand auf. Die Entschlossenheit der Arbeiter war in einigen Gebieten so groß, dass die weiße Söldnerarmee nicht anzugreifen wagte. Die Empörung über die SPD, die das Militär offen unterstützte und den Streik anprangerte, war unbeschreiblich. So groß, dass am 25. Februar die Räte – unterstützt von den kommunistischen Delegierten – beschlossen, den Streik zu beenden. Unglücklicherweise in einem Augenblick, als er in Zentraldeutschland begann! Die Führung befürchtete, dass die Arbeiter die Bergwerke fluten oder sozialdemokratische Arbeiter attackieren[20]. Tatsächlich aber demonstrierten die Arbeiter einen hohen Grad an Disziplin, mit einer großen Minderheit, die den Aufruf zur Rückkehr an die Arbeit respektierte – obwohl sie damit nicht einverstanden war.
Ende März brach ein zweiter gigantischer Massenstreik aus, der trotz der Repression durch die Freikorps einige Wochen lang dauerte.
„Er zeigt auch weiter, daß die sozialdemokratischen Partei- und Gewerkschaftsführer den Einfluß auf die Massen verloren hatten. Die Kraft der revolutionären Bewegung der Monate Februar und März lag nicht in dem Besitz und Gebrauch von militärischen Waffen, sondern in der Möglichkeit, der bürgerlich-sozialdemokratischen Regierung das wirtschaftliche Fundament durch Stillegung der wichtigsten Produktionsgebiete zu entziehen (...) Der gewaltige militärische Aufzug, die Bewaffnung der Bourgeoisie, die Brutalitäten der Militärs, konnten diese Kraft nicht brechen, konnten die streikenden Arbeiter nicht zur Arbeit zwingen.“[21]
Das zweite Zentrum des Massenstreiks lag in Mitteldeutschland[22]. Dort explodierte die Streikbewegung Mitte Februar nicht nur als Reaktion auf die Verarmung und Repression, sondern auch aus Solidarität mit den Opfern der Repression in Berlin und mit den Streiks an Rhein und Ruhr. Wie in der letztgenannten Region deutlich wird, bezog die Bewegung ihre Stärke daraus, dass sie von den Arbeiter- und Soldatenräten angeführt wurde, in denen die Sozialdemokraten rapide an Einfluss verloren.
Doch auch wenn im Ruhrgebiet die Beschäftigten der Schwerindustrie dominierten, umfasste die Bewegung nicht nur Bergarbeiter, sondern nahezu jeden Beruf und jede Industriebranche. Zum ersten Mal seit dem Beginn der Revolution schlossen sich die Eisenbahnarbeiter dem Streik an. Dies war von besonderer Bedeutung. Eine der ersten Maßnahmen der Ebert-Regierung zu Kriegsende bestand darin, die Löhne bei den Eisenbahnen substanziell zu erhöhen. Die Bourgeoisie musste diesen Sektor neutralisieren, um in der Lage zu sein, ihre konterrevolutionären Brigaden von einem Ende Deutschlands zum anderen zu bewegen. Nun wurde zum ersten Mal diese Möglichkeit in Frage gestellt.
Nicht weniger bedeutsam war, dass die Soldaten in den Garnisonen herauskamen, um die Streikenden zu unterstützen. Die Nationalversammlung, die vor den Berliner Arbeitern geflohen war, ging nach Weimar, um ihre konstituierende Parlamentssitzung abzuhalten. Sie traf inmitten eines akuten Klassenkampfes und feindlich gesinnter Soldaten ein und musste sich hinter einer Barriere aus Artillerie und Maschinengewehren treffen[23].
Die selektive Besetzung von Städten durch die Freikorps provozierte Straßenkämpfe in Halle, Merseburg und Zeitz, Explosionen der Massen, erzürnt bis zur Raserei, wie Richard Müller es formulierte. Wie an der Ruhr waren diese militärischen Aktionen nicht imstande, die Streikbewegung zu brechen.
Der Aufruf der Fabrikdelegierten zu einem Generalstreik am 24. Februar sollte eine weitere enorm bedeutsame Entwicklung enthüllen. Er wurde einmütig von allen Delegierten unterstützt, einschließlich jener von der SPD. Mit anderen Worten: die Sozialdemokratie verlor sogar über ihre eigenen Mitglieder die Kontrolle.
„Der Streik hatte sich unmittelbar nach Ausbruch in größtmöglichstem Maße entfaltet. Eine weitere Steigerung war nicht möglich es sei denn durch den bewaffneten Aufstand, der von den Streikenden abgelehnt wurde und auch aussichtslos erschien. Die einzige Möglichkeit den Streik wirksamer zu machen, lag bei der Berliner Arbeiterschaft.“[24]
So forderten also die Arbeiter das Proletariat von Berlin auf, sich anzuschließen, ja die Bewegung anzuführen, die in Zentraldeutschland und an Rhein und Ruhr aufgelodert war.
Und die Arbeiter Berlin antworteten so gut sie konnten, trotz der Niederlage, die sie gerade erlitten hatten. In Berlin verlagerte sich das Epizentrum von den Straßen zu den Massenversammlungen. Die Diskussionen, die in den Fabriken, Büros und Kasernen stattfanden, bewirkten ein kontinuierliches Schrumpfen des Einflusses der SPD und der Anzahl ihrer Delegierten in den Arbeiterräten. Die Versuche der Noske-Partei, die Soldaten zu entwaffnen und ihre Organisationen zu liquidieren, beschleunigte lediglich diesen Prozess. Eine allgemeine Versammlung der Arbeiterräte von Berlin rief am 28. Februar das gesamte Proletariat dazu auf, seine Organisationen zu verteidigen und sich auf den Kampf vorzubereiten. Der Versuch der SPD, diese Resolution zu verhindern, wurde durch ihre eigenen Delegierten durchkreuzt.
Diese Versammlung wählte aufs Neue ihr Aktionskomitee. Die SPD verlor ihre Mehrheit. In den nächsten Wahlen zu diesem Organ am 19. April bekam die KPD fast soviele Delegierte gewählt wie die SPD. In den Berliner Räten wendete sich das Blatt zugunsten der Revolution.[25]
Im Wissen, dass das Proletariat nur triumphieren kann, wenn es von einer vereinten, zentralisierten Organisation geführt wird, begann die Massenagitation in Berlin für die Neuwahlen der Arbeiter- und Soldatenräte im gesamten Land sowie für den Aufruf zu einem neuen nationalen Rätekongress. Trotz der hysterischen Opposition der Regierung und der SPD gegen diesen Vorschlag begannen die Soldatenräte sich zu seinem Gunsten auszusprechen. Die Sozialdemokraten spielten auf Zeit, waren sie sich doch der praktischen Schwierigkeiten bei der Realisierung solcher Pläne damals völlig bewusst.
Doch die Bewegung in Berlin war mit einer weiteren dringenden Frage konfrontiert: der Aufruf zur Unterstützung durch die Arbeiter in Mitteldeutschland. Die allgemeine Versammlung der Arbeiterräte von Berlin traf sich am 3. März, um über diese Frage zu entscheiden. Die SPD, die wusste, dass der Albtraum der Januar-Woche immer noch in den Köpfen des Proletariats der Hauptstadt spukte, war entschlossen, einen Generalstreik zu verhindern. Und tatsächlich zögerten die Arbeiter zunächst... Die Revolutionäre, die für die Solidarität mit Mitteldeutschland agitierten, wendeten allmählich das Blatt. Delegationen aus allen wichtigen Fabriken der Stadt wurden zur Räteversammlung gesandt, um sie darüber zu informieren, dass die Massenversammlungen an den Arbeitsplätzen schon längst beschlossen hatten, die Arbeit niederzulegen. Es wurde klar, dass dort die Kommunisten und Linksunabhängigen nun die Mehrheit der Arbeiter hinter sich wussten.
Auch in Berlin war der Generalstreik fast total. Nur in Betrieben, die von den Arbeiterräten entsprechend angewiesen worden waren (Feuerwehren, Wasser-, Strom- und Gasversorgung, Medizin, Nahrungsmittelproduktion), wurde die Arbeit fortgesetzt. Die SPD und ihr Sprachrohr, der Vorwärts, prangerten umgehend den Streik an und riefen jene Delegierte, die Parteimitglieder waren, dazu auf, genauso zu verfahren. Das Resultat: diese Delegierten erklärten sich nun gegen die Position ihrer eigenen Partei. Darüber hinaus schwenkten auch die Drucker, die zu den wenigen Berufen gehörten, die unter starkem sozialdemokratischen Einfluss standen und sich nicht der Streikfront angeschlossen hatten, jetzt um – aus Protest gegen das Verhalten der SPD. Auf diese Weise wurde ein wichtiger Bestandteil der Hasskampagne der Konterrevolution zum Schweigen gebracht.
Trotz all dieser Anzeichen von Reifung erwies sich das Trauma vom Januar als fatal. Der Generalstreik in Berlin kam zu spät, erst als dieser in Mitteldeutschland endete. Schlimmer noch: die Kommunisten, die in der Tat durch die Januar-Niederlage traumatisiert waren, weigerten sich, sich zusammen mit Sozialdemokraten an der Streikführung zu beteiligen. Die Einheit der Streikfront begann zu bröckeln. Spaltung und Demoralisierung grassierten.
Dies war der Augenblick für die Freikorps, um in Berlin einzumarschieren. Die Lehren aus den Januar-Ereignissen ziehend, versammelten sich die Arbeiter in den Fabriken und nicht auf den Straßen. Doch statt die Arbeiter sofort anzugreifen, marschierten die Freikorps zunächst gegen die Garnisonen und Soldatenräte und begannen dabei mit jenen Regimentern, die sich an der Unterdrückung der Arbeiter im Januar beteiligt hatten, jene, die die wenigsten Sympathien in der Arbeiterbevölkerung genossen. Erst danach wendeten sie sich dem Proletariat zu. Wie im Januar gab es summarische Exekutionen auf den Straßen, Revolutionäre wurden ermordet (unter ihnen Leo Jogiches), die Leichen in die Spree geworfen. Diesmal war der Terror noch schlimmer als im Januar und forderte mehr als tausend Menschenleben. Der Arbeiterbezirk Lichtenberg östlich des Stadtzentrums wurde von der Luftwaffe bombardiert.
Müller schrieb über die Kämpfe zwischen Januar und März: „Das war die gewaltigste Erhebung des deutschen Proletariats, der Arbeiter, Angestellten und Beamten und selbst eines Teils der kleinbürgerlichen Mittelschichten, eine Erhebung, die an Größe und Tiefe bisher noch nicht zu verzeichnen war, und die später in solchem Ausmaße nur noch einmal, im Kapp-Putsch, erreicht wurde. Nicht nur in den hier behandelten Teilen Deutschlands standen die Volksmassen im Generalstreik: in Sachsen, in Baden und Bayern, überall schlugen die Wellen der sozialen Revolution gegen die Mauern der kapitalistischen Produktions- und Eigentumsordnung. Das war es, was dieser Bewegung die Bedeutung gab. Die Arbeitermassen schritten auf dem Weg weiter, der zur Fortführung der politischen Umwälzung vom November 1918 beschritten werden mußte.“[26]
Jedoch:
„Auf der revolutionären Bewegung lastete noch der Fluch der Januaraktion, deren sinnloses Beginnen und tragische Folgen die Berliner Arbeiterschaft so zerrissen, so aktionsunfähig gemacht hatten, daß es wochenlanger zäher Arbeit bedurfte, um zu einem neuen Kampf zu kommen. Wäre der Januarputsch nicht gemacht worden, dann hätte das Berliner Proletariat die Kämpfenden in Rheinland-Westfalen und in Mitteldeutschland rechtzeitig unterstützen können, die Revolution wäre erfolgreich weitergeführt worden und das neue Deutschland hätte ein anderes politisches und wirtschaftliches Gesicht bekommen.“[27]
Hätte die Revolution siegen können?
Das Unvermögen des Weltproletariats, den I. Weltkrieg zu verhindern, erschwerte die Bedingungen für eine erfolgreiche Revolution. Im Vergleich zu einer Revolution, die primär eine Reaktion auf eine Wirtschaftskrise ist, birgt eine Revolution gegen den Weltkrieg einige Nachteile. Erstens tötet oder versehrt der Krieg Millionen von Arbeitern, viele von ihnen erfahrene und klassenbewusste Sozialisten. Zweitens kann die Bourgeoisie, anders als bei einer Wirtschaftskrise, solch einen Krieg stoppen, wenn sie sieht, dass seine Fortsetzung ihr System bedrohen würde. Dies geschah im November 1918. Es bewirkte eine Spaltung innerhalb der Arbeiterklasse jeden Landes zwischen jenen, die mit einer Waffenruhe zufrieden waren, und jenen, für die nur der Sozialismus das Problem lösen konnte. Drittens ist das internationale Proletariat gespalten, zuerst durch den Krieg selbst und dann zwischen den Arbeitern in den „besiegten“ und in den „siegreichen“ Ländern. Es ist kein Zufall, dass eine revolutionäre Situation dort entstand, wo der Krieg verloren wurde (Russland, Österreich-Ungarn, Deutschland) – nicht unter den Hauptmächten der Entente (Großbritannien, Frankreich, die Vereinigten Staaten).
Doch heißt das, dass der Erfolg einer proletarischen Revolution unter diesen Umständen von Anfang an eine Unmöglichkeit war? Wir möchten daran erinnern, dass dies eines der Hauptargumente war, die von der Sozialdemokratie geltend gemacht wurden, um ihre konterrevolutionäre Rolle zu rechtfertigen. Doch in Wahrheit war dies nicht im entferntesten der Fall.
Erstens: obwohl der „Große Krieg“ das Proletariat physisch dezimierte und psychologisch schwächte, hinderte dies die Klasse nicht daran, einen mächtigen revolutionären Angriff gegen den Kapitalismus zu entfesseln. Das Blutbad, das verübt wurde, war immens, aber geringer als das vom II. Weltkrieg ausgelöste und nicht zu vergleichen mit dem, was ein Dritter Weltkrieg mit thermonuklearen Waffen bedeuten würde.
Zweitens: obwohl die Bourgeoisie den Krieg zum Halten bringen konnte, heißt dies nicht, dass sie seine materiellen und politischen Konsequenzen vermeiden konnte. Zu diesen Konsequenzen gehörte die Auspowerung des Produktionsapparates, die Desorganisation der Wirtschaft und die Überausbeutung der Arbeiterklasse in Europa. Besonders in den besiegten Ländern führte die Beendigung des Krieges keineswegs zu einer raschen Restauration des Vorkriegs-Lebenstandards der Bevölkerungsmassen. Das Gegenteil war der Fall. Obwohl die Forderung nach der „Sozialisierung der Industrie“ auch die Gefahr beinhaltete, die Klasse vom Kampf um die Macht abzulenken und zu einer Art von Selbstverwaltungsprojekten zu führen, wie sie die Anarchisten und Syndikalisten favorisierten, war 1919 in Deutschland die Haupttriebfeder hinter dieser Forderung die Sorge um das physische Überleben des Proletariats. Die Arbeiter, die mehr und mehr überzeugt von der Unfähigkeit des Kapitalismus waren, genügend Nahrungsmittel, Kohle, etc. zu erschwinglichen Preisen herzustellen, um die Bevölkerung durch den Winter zu bringen, begannen zu realisieren, dass eine unterernährte und ausgezehrte Arbeitskraft, die vom Ausbruch von Krankheiten und Infektionen gefährdet ist, diese Probleme in die eigene Hand nehmen muss – bevor es zu spät war.
In diesem Sinne endete der Kampf gegen den Krieg nicht mit dem Krieg selbst. Ferner hinterließ der Einfluss des Krieges tiefe Spuren im Bewusstsein der Klasse. Er beraubte der modernen Kriegsführung ihr heroisches Image.
Drittens war der Graben zwischen den Arbeitern in den „besiegten“ Ländern und den Arbeitern in den „Sieger“ländern nicht unüberwindbar. Besonders in Großbritannien gab es mächtige Streikbewegungen sowohl während des Krieges als auch nach Kriegsende. Das auffälligste Phänomen von 1919, dem „Jahr der Revolution“ in Mitteleuropa, war die relative Abwesenheit des französischen Proletariats auf der Bühne. Wo war dieser Sektor der Klasse, der von 1848 bis zur Pariser Kommune 1871 die Vorhut der proletarischen Erhebung gewesen war? Zu einem großen Umfang war er vom chauvinistischen Taumel der Bourgeoisie infiziert, die „ihren“ Arbeitern eine neue Ära des Wohlstandes auf der Grundlage der Reparationen versprach, die sie von Deutschland erzwingen wollte. Gab es kein Gegenmittel zum nationalistischen Gift? Ja, das gab es. Der Sieg des Proletariats in Deutschland wäre dieses Gegenmittel gewesen.
1919 war Deutschland das unerlässliche Scharnier zwischen der Revolution im Osten und dem schlummernden Klassenbewusstsein im Westen. Die europäische Arbeiterklasse von 1919 war im Geiste des Sozialismus erzogen worden. Ihre Überzeugung von der Notwendigkeit und Möglichkeit des Sozialismus war noch nicht von der stalinistischen Konterrevolution ausgehöhlt worden. Der Sieg der Revolution in Deutschland hätte die Illusionen über die Möglichkeit einer Rückkehr zu einer scheinbaren „Stabilität“ der Vorkriegswelt unterminiert. Die Wiedererlangung der führenden Rolle im Klassenkampf durch das deutsche Proletariat hätte das Vertrauen in die Zukunft des Sozialismus enorm gestärkt.
Doch war der Triumph der Revolution in Deutschland selbst jemals eine realistische Möglichkeit? Die Novemberrevolution 1918 offenbarte die Macht und das Heldentum der Klasse, aber auch enorme Illusionen, Konfusionen und Schwankungen. Doch dies war nicht weniger der Fall in Russland Februar 1917. In den folgenden Monaten enthüllte der Verlauf der Russischen Revolution die fortschreitende Reifung eines immensen Potenzials, das zum Sieg im Oktober führte. Doch auch in Deutschland sehen wir von November 1918 an – trotz der Beendigung des Krieges – eine ähnliche Reifung. Im ersten Vierteljahr 1919 haben wir die Ausbreitung von Massenstreiks gesehen, das Hineinziehen der gesamten Klasse in den Kampf, eine wachsende Rolle der Arbeiterräte und der Revolutionäre in ihnen, erste Bemühungen zur Schaffung einer zentralisierten Organisation und Führung der Bewegung, die fortschreitende Entlarvung der konterrevolutionären Rolle der SPD und der Gewerkschaften sowie die Grenzen der Wirksamkeit der Staatsrepression.
Im Verlauf von 1919 wurden lokale Erhebungen und „Räterepubliken“ in den Küstenstädten, in Bayern und anderswo liquidiert. Diese Episoden sind voller Beispiele des proletarischen Heldentums und bitterer Lehren für die Zukunft. Für den Ausgang der Revolution in Deutschland waren sie nicht entscheidend. Die Ausschlag gebenden Zentren lagen anderswo. Erstens in den riesigen industriellen Ballungsgebieten im heutigen Bundesland Nordrhein-Westfalen. In den Augen der Bourgeoisie wurde diese Region von einer finsteren Spezies aus einer Art Unterwelt bevölkert, die nie das Tageslicht erblickte und außerhalb der Grenzen der Zivilisation lebte. Sie war erschrocken, als sie diese ungeheuerliche graue Armee in wuchernden Städten sah, wo die Sonne selten schien und wo der Schnee schwarz war, Folge der Bergwerke und Hochöfen. Erschrocken, ja noch erschrockener, als sie in Berührung kam mit der Intelligenz, der menschlichen Wärme, dem Sinn für Solidarität und Disziplin dieser Armee, nicht mehr das Kanonenfutter imperialistischer Kriege, sondern Protagonist des eigenen Klassenkrieges. Weder 1919 noch 1920 war die kombinierte Brutalität von Militär und Freikorps im Stande, diesen Widersacher auf dessen eigenem Terrain zu zerschmettern. Er wurde erst überwältigt, als diese Arbeiter nach der Abwehr des Kapp-Putsches 1920 den Fehler begingen, ihre „Rote Ruhr-Armee“ aus den Städten und den Kohlehalden hinauszuschicken, um eine konventionelle Schlacht zu kämpfen.
Zweitens in Mitteldeutschland mit seiner sehr alten, hochqualifizierten Arbeiterklasse, von der sozialistischen Tradition durchdrungen[28]. Vor und während des Weltkrieges wurden äußerst moderne Industrien wie die chemische, die Flugzeugindustrie errichtet, die zehntausende von Arbeitern anzogen, unerfahren zwar, aber kämpferisch, radikal, voller Sinn für die Solidarität. Auch dieser Sektor sollte sich in weiteren Massenkämpfen 1920 (Kapp) und 1921 (März-Aktion) engagieren.
Doch wenn Rhein und Ruhr sowie Mitteldeutschland die Lungen, das Herz und die Verdauungsorgane waren, so war Berlin das Gehirn. Berlin, die drittgrößte Stadt in der Welt (nach New York und London), war so etwas wie das Silicon Valley des damaligen Europa. Die Grundlage seines wirtschaftlichen Aufstiegs war die Genialität seiner Arbeitskraft, hoch gebildet, mit einer langen sozialistischen Erziehung, das Herz im Prozess der Bildung der Klassenpartei.
Die Eroberung der Macht war im ersten Vierteljahr 1919 noch nicht auf der Tagesordnung. Aufgabe damals war es, Zeit für die Reifung der Revolution in der gesamten Klasse zu gewinnen und eine entscheidende Niederlage zu vermeiden. Die Zeit war in diesem entscheidenden Moment auf der Seite des Proletariats. Das Klassenbewusstsein reifte heran. Das Proletariat strebte danach, seine für den Sieg notwendigen Organe zu schaffen – die Partei, die Räte. Die Hauptbataillone der Klasse schlossen sich dem Kampf an.
Doch durch die Niederlage im Januar 1919 in Berlin wechselte die Zeit die Seiten, ging über auf die Seite der Bourgeoisie. Die Berliner Niederlage kam in zwei Teilen: im Januar und im März-April 1919. Dabei war der Januar entscheidend, weil er eine moralische und nicht nur eine physische Niederlage war. Die Vereinigung der entscheidenden Sektoren der Klasse im Massenstreik war die Kraft, die in der Lage war, die Strategie der Konterrevolution zu durchkreuzen und den Weg zum Aufstand zu öffnen. Doch dieser Vereinigungsprozess – dem ähnlich, was in Russland Ende des Sommers 1917 angesichts des Kornilow-Putsches stattgefunden hatte – hing vor allem von zwei Faktoren ab: von der Klassenpartei und den Arbeitern in der Hauptstadt. Die Bourgeoisie hatte mit ihrer Strategie der vorbeugenden Zufügung von schweren Verletzungen an diesen beiden entscheidenden Elementen Erfolg. Das Scheitern der Revolution in Deutschland in ihren „Kornilow-Tagen“ war vor allem das Resultat ihres Scheiterns in der deutschen Version der Juli-Tage[29].
Der auffälligste Unterschied zu Russland war die Abwesenheit einer revolutionären Partei, die in der Lage war, eine zusammenhängende und klare Politik gegenüber den unvermeidbaren Stürmen der Revolutionen und den Divergenzen in den eigenen Reihen zu formulieren und zu vertreten. Wie wir im vorhergegangenen Artikel gesagt hatten, konnte die Revolution in Russland auch ohne die Konstituierung einer weltweiten Klassenpartei triumphieren – aber nicht in Deutschland.
Daher widmeten wir einen ganzen Artikel dieser Reihe dem Gründungskongress der KPD. Dieser Kongress begriff viele Fragen, aber nicht die brennendsten Themen der Stunde. Obwohl er formell die Analyse der Lage, die von Rosa Luxemburg vorgestellt wurde, annahm, unterschätzten in Wirklichkeit zu viele Delegierte den Klassenfeind. Obgleich der Text nachdrücklich auf die Rolle der Massen bestand, war ihre Sichtweise der Revolution noch immer von den Beispielen der vergangenen bürgerlichen Revolutionen beeinflusst. Die Machtergreifung durch die Bourgeoisie war nichts anderes als der letzte Akt auf ihrem Weg zur Macht, der durch den Aufstieg ihrer wirtschaftlichen Macht vorbereitet worden war. Da das Proletariat als ausgebeutete Klasse ohne Eigentum keinen Reichtum anhäufen kann, muss es seinen Sieg mit anderen Mitteln vorbereiten. Es muss Bewusstsein, Erfahrung, Organisation anhäufen. Es muss aktiv werden und lernen, sein Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen[30].
Zeitökonomie der Revolution
Die kapitalistische Produktionsweise bestimmt den Charakter der proletarischen Revolution. Die proletarische Revolution enthüllt das Geheimnis der kapitalistischen Produktionsweise. Durch die Stufen der Kooperation, der Manufaktur und der Industrialisierung schreitend, bringt der Kapitalismus die Produktivkräfte hervor, die die Vorbedingung für die klassenlose Gesellschaft sind. Er tut dies durch die Etablierung der assoziierten Arbeit. Dieser „kollektive Produzent“, der Erzeuger von Reichtum, wird von den kapitalistischen Produktionsverhältnissen zum Sklaven gemacht, und zwar durch die private, konkurrenzfähige, archaische Aneignung der Früchte der assoziierten Arbeit. Die proletarische Revolution schafft das Privateigentum ab, indem sie die Aneignungsweise auf eine Linie mit dem assoziierten Charakter der Produktion bringt. Unter dem Kommando des Kapitals hat das Proletariat von Anfang an die materiellen Bedingungen für seine eigene Befreiung geschaffen. Doch die Totengräber der kapitalistischen Gesellschaft können ihre historische Mission nur erfüllen, wenn die proletarische Revolution selbst das Produkt der „assoziierten Arbeit“ ist, der ArbeiterInnen der Welt, die handeln müssen, indem sie als eine Person sprechen. Das Kollektiv der Lohnarbeit muss zur bewussten kollektiven Assoziation des Kampfes werden.
Dieses Zusammenschweißen sowohl der Klasse in ihrer Gesamtheit als auch ihrer revolutionären Minderheiten im Kampf braucht Zeit. In Russland dauerte es über ein Dutzend Jahre, vom Kampf für eine „neue Art der Klassenpartei“ 1903 über die Massenstreiks von 1905/06 und den Vorabend des Ersten Weltkrieges bis zu den berauschenden Tagen von 1917. In Deutschland, in den westlichen Ländern insgesamt gewährte der Kontext des Weltkrieges und die brutale Beschleunigung der Geschichte nur wenig Zeit für diese nötige Reifung. Die Intelligenz und Entschlossenheit der Bourgeoisie nach dem Waffenstillstand von 1918 reduzierten die verfügbare Zeit noch weiter.
Wir haben wiederholt in dieser Artikelserie über die Erschütterung des Selbstvertrauens der Klasse und ihrer revolutionären Avantgarde durch den Zusammenbruch der Sozialistischen Internationale angesichts des Kriegsausbruchs gesprochen. Was bedeutete dies?
Die bürgerliche Gesellschaft begreift die Frage der Selbstvergewisserung als Vertrauen des Individuums in seine eigenen Kräfte. Diese Konzeption vergisst, dass die Menschheit mehr als jede andere Spezies, um zu überleben und sich weiterzuentwickeln, der Gesellschaft bedarf. Dies trifft um so mehr auf das Proletariat zu, die assoziierte Arbeit, die nicht individuell, sondern kollektiv produziert und kämpft, die nicht individuelle Revolutionäre, sondern revolutionäre Organisationen hervorbringt. Die Machtlosigkeit des individuellen Arbeiters – die viel extremer ist als die des einzelnen Kapitalisten oder gar des individuellen Kleineigentümers – enthüllt sich im Kampf als reale, bis dahin verborgene Stärke dieser Klasse. Ihre Abhängigkeit vom Kollektiv nimmt den Charakter der künftigen kommunistischen Gesellschaft vorweg, wo die bewusste Stärkung der Gemeinschaft erstmalig die Entwicklung der vollen Individualität erlaubt. Das Selbstvertrauen des Individuums setzt das Vertrauen der einzelnen Teile im Ganzen, das gegenseitige Vertrauen der Mitglieder der Kampfgemeinschaft voraus.
Mit anderen Worten: nur durch die Zusammenschweißung einer Einheit im Kampf kann die Klasse den Mut und das Vertrauen entwickeln, die notwendig sind für ihren Sieg. Nur auf kollektive Weise können ihre theoretischen und analytischen Waffen ausreichend geschärft werden. Die Fehler der KPD-Delegierten in einem entscheidenden Moment in Berlin waren in Wirklichkeit das Produkt der immer noch unzureichenden Reife dieser kollektiven Stärke der jungen Klassenpartei insgesamt.
Unser Beharren auf den kollektiven Charakter des proletarischen Kampfes leugnet keineswegs die Bedeutung der Rolle von Individuen in der Geschichte. Trotzki schrieb in seinem Buch Die Geschichte der russischen Revolution, dass ohne Lenin die Bolschewiki im Oktober 1917 möglicherweise zu spät den richtigen Augenblick für den Aufstand erkannt hätten. Die Partei war nahe dran, ihr „Rendezvous mit der Geschichte“ zu verpassen. Wenn die KPD statt Karl Liebknecht und Wilhelm Pieck die scharfsinnigen Analytiker Rosa Luxemburg und Leo Jogiches am 5. Januar ins Hauptquartier von Emil Eichhorn geschickt hätte, wären die historischen Folgen möglicherweise andere gewesen.
Wir streiten nicht die Bedeutung von Lenin oder Rosa Luxemburg in den damaligen revolutionären Kämpfen ab. Was wir bestreiten, ist, dass ihre Rolle vor allem das Produkt ihrer individuellen Genialität war. Ihre Bedeutung rührte vor allem aus ihrer Fähigkeit, kollektiv zu sein, wie ein Prisma alles Licht, das von der Klasse und der Partei als Ganzes ausgestrahlt wird, zu konzentrieren und zu lenken. Die tragische Rolle von Rosa Luxemburg in der Deutschen Revolution, die Tatsache, dass ihr Einfluss auf die Partei im entscheidenden Moment nicht groß genug war, ist mit der Tatsache verknüpft, dass sie die lebendige Erfahrung der internationalen Bewegung in einem Augenblick verkörperte, als die Bewegung in Deutschland noch an ihrer Isolation vom Rest des Weltproletariats litt.
Wir möchten betonen, dass die Geschichte ein offener Prozess ist und dass die Niederlage der ersten Welle der Weltrevolution keine vorhersehbare Entwicklung war. Es ist nicht unsere Absicht, zu erzählen, „was gewesen wäre“. Es gibt nie einen Weg zurück in der Geschichte. Es gibt nur einen Weg vorwärts. Im Nachhinein ist der Verlauf, den die Geschichte nimmt, stets „unvermeidlich“. Doch übersehen wir hier, dass die Entschlossenheit – oder der Mangel an Entschlossenheit – des Proletariats, seine Fähigkeit, Lehren zu ziehen und seine Kräfte international zu vereinigen, Bestandteile dieser Gleichung sind. Mit anderen Worten, das, was „unvermeidlich“ wird, hängt auch von uns ab. Unsere Bemühungen um ein bewusstes Ziel sind eine aktive Komponente in der Gleichung der Geschichte.
Im nächsten, abschließenden Kapitel dieser Reihe werden wir die enormen Konsequenzen aus der Niederlage der Deutschen Revolution untersuchen und dabei die Relevanz dieser Ereignisse für heute und morgen berücksichtigen.
Steinklopfer
[1]Dieses Bündnis zwischen dem Militär und der SPD, das sich als entscheidend für den Sieg der Konterrevolution herausstellte, wäre ohne die Unterstützung der britischen Bourgeoisie nicht möglich gewesen. Die Zerschmetterung der Macht der preußischen Militärkaste war eines der Kriegsziele Londons. Diesem Ziel wurde abgeschworen, um die Kräfte der Reaktion nicht zu schwächen. In diesem Sinne ist es keine Übertreibung, von einer Allianz zwischen der deutschen und britischen Bourgeoisie als den Pfeiler der damaligen internationalen Konterrevolution zu sprechen. Wir werden zu dieser Frage im letzten Teil dieser Serie zurückkommen.
[2]Tausende von russischen und anderen Kriegsgefangenen wurden trotz des Kriegsendes noch immer von der deutschen Bourgeoisie festgehalten und zur Zwangsarbeit verurteilt. Sie beteiligten sich zusammen mit ihren deutschen Klassenbrüdern- und schwestern aktiv an der Revolution.
[3]Dieses monumentale barocke Gebäude, das den II. Weltkrieg überlebt hatte, wurde von der DDR gesprengt und vom stalinistischen „Palast der Republik“ ersetzt. Das „wiedervereinigte“ Deutschland hat nun diesen Palast abgerissen und beabsichtigt, die Fassade des alten zu rekonstruieren.
[4]Dieses Gebäude, das hinter dem Palast liegt, existiert immer noch.
[5]Dies ist die Formulierung des Autors Alfred Döblin in seinem Buch Karl und Rosa, dem letzten Teil seiner Novelle in vier Bänden: November 1918. Als ein Sympathisant des linken Flügels der USPD war er Augenzeuge der Revolution in Berlin. Seine monumentale Beschreibung wurde in den 30er Jahren geschrieben und ist von der Konfusion und Verzweiflung angesichts der triumphierenden Konterrevolution gezeichnet.
[6]Im Laufe des Wiederaufbaus des Stadtzentrums nach dem Fall der Berliner Mauer wurden Fluchttunnel verschiedener Regierungen des 20. Jahrhunderts ausgegraben, die in den offiziellen Plänen nicht verzeichnet sind. Denkmäler der Angst der herrschenden Klasse, die dokumentieren, wovor die Bourgeoisie Angst hat.
[7]Es gab Sympathiestreiks, Demonstrationen und Hausbesetzungen in einer Anzahl von Städten, einschließlich Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf.
[8]Revolutionäre Delegierte aus den Fabriken (siehe die vorherigen Artikel dieser Reihe).
[9]Diese Entwicklung, die von Richard Müller in seiner Geschichte der Deutschen Revolution in Gänze dokumentiert wurde, verfasst in den 1920er Jahren, ist heute eine akzeptierte Tatsache unter Historikern.
[10]Band 3 von Müllers Geschichte der Deutschen Revolution: Bürgerkrieg in Deutschland. S. 35, 36.
[11]Ebenda.
[12]Ebenda, S. 33. Richard Müller war einer der erfahrensten und talentiertesten Führer der Bewegung. Es gab gewisse Parallelen zu Trotzki 1917 in Russland. Beide waren Vorsitzende des Aktionsausschusses der Arbeiterräte in der Hauptstadt. Beide wurden schließlich Historiker der Revolution, in der sie direkt beteiligt waren. Es tut weh zu sehen, wie pauschal Wilhelm Pieck die Warnungen solch eines erfahrenen und verantwortungsvollen Führers wegwischte.
[13]Die sechs Gegner waren Müller, Däumig, Eckert, Malzahn, Neuendorf und Rusch.
[14]Der Fall Lemmgen, ein revolutionärer Matrose, ist legendär, aber leider unwahr. Nach dem Scheitern seiner wiederholten Versuche, die Staatsbank, die Reichsbank, zu konfiszieren (ein öffentlich Bediensteter, genannt Hamburger, bestritt die Gültigkeit der Unterschriften unter seiner Anordnung), war der arme Lemmgen so demoralisiert, dass er nach Hause ging und sich in sein Bett vergrub.
[15]Genau dieser Handlungsverlauf wurde öffentlich von der KPD vorgeschlagen, insbesondere in ihrem zentralen Presseorgan, die Rote Fahne.
[16]Besonders die Passage im Programm, die erklärte, dass die Partei nur mit der Unterstützung der großen Massen des Proletariats die Macht annehmen werde.
[17]So wie in Thüringen, die Region um Stuttgart oder das Rheintal seit langem bestehende Bastionen der marxistischen Bewegung.
[18]Die Heloten war Repräsentanten einer höchst militanten revolutionären Bewegung des jüdischen Proletariats in der Antike.
[19]Gelegen an den Flüssen Ruhr und Wupper.
[20]Am 22. Februar griffen kommunistische Arbeiter in Mülheim eine öffentliche Versammlung der SPD mit Maschinengewehren an.
[21]R. Müller, Band 3, S. 141, 142.
[22]Die Provinzen von Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Das Epizentrum war die Stadt Halle und der nahegelegene Chemiegürtel rund um die gigantische Leuna-Fabrik.
[23]Der Begriff „Weimarer Republik“, die sich in der deutschen Geschichte von 1919 bis 1933 erstreckte, kommt ursprünglich aus dieser Episode.
[24]Müller, ebenda, S. 146.
[25]In den ersten Wochen der Revolution hatten die USPD und der Spartakusbund lediglich ein Viertel aller Delegierten hinter sich. Die SPD dominierte massiv. Die Parteimitgliedschaft der Delegierten, die in Berlin zu Beginn 1919 gewählt wurden, war wie folgt:
28. Februar: USPD 305; SPD 271; KPD 99; Demokraten: 73.
19. April: USPD 312; SPD 164; KPD 103; Demokraten 73.
Es sollte bemerkt werden, dass die KPD in dieser Periode nur in der Klandestinität operieren konnte und dass eine beträchtliche Zahl von USP-Delegierten, die gewählt worden waren, in Wahrheit mit den Kommunisten symphatisierte und sich ihnen bald darauf anschließen sollte.
[26]Müller, ebenda, S. 161.
[27]Ebenda, S. 154.
[28]Kein Zufall, dass die Wiege der marxistischen Bewegung in Deutschland mit den Namen thüringischer Städte verbunden wird: Eisenach, Gotha, Erfurt.
[29]Die Juli-Tage von 1917 waren einer der wichtigsten Momente nicht nur in der Russischen Revolution, sondern in der Geschichte. Am 4. Juli bestürmte eine bewaffnete Demonstration, eine halbe Million stark, die Führer des Petrograder Sowjets, die Macht zu übernehmen, zerstreute sich jedoch wieder friedlich nach einem Appell der Bolschewiki. Am 5. Juli eroberten konterrevolutionäre Truppen die Stadt zurück und begannen, die Bolschewiki sowie die militantesten unter den Arbeitern zu jagen. Doch indem es einen vorzeitigen Machtkampf vermied, da es als Klasse insgesamt noch nicht bereit dafür war, hielt das Proletariat seine revolutionären Kräfte intakt. Dies ermöglichte den Arbeitern, die wesentlichen Lehren aus den Ereignissen zu ziehen, insbesondere ihre Erkenntnisse über den konterrevolutionären Charakter der bürgerlichen Demokratie und der neuen Linken des Kapitals – den Menschewiki und Sozialrevolutionären, die die Sache der Arbeiter und der armen Bauern verraten hatten und ins feindliche Lager übergewechselt waren. Nie war die Gefahr einer entscheidenden Niederlage des Proletariats und der Liquidierung der bolschewistischen Partei größer als in diesen dramatischen 72 Stunden. Zu keiner anderen Zeit war das tiefe Vertrauen der fortgeschrittensten Bataillone des Proletariats in ihre Klassenpartei, der kommunistischen Avantgarde, von solcher Bedeutung.
Nach der Niederlage der Arbeiter im Juli dachte die Bourgeoisie, sie könne dem Albtraum der Revolution ein Ende bereiten. Dank der Arbeitsteilung zwischen Kerenskis „demokratischem“ Block und dem offen reaktionären Block des Armeechefs Kornilow organisierte die herrschende Klasse zwischen August und Anfang September den Staatsstreich des Letztgenannten, in dem versucht wurde, die Kosaken und die kaukasischen Regimenter, die noch zuverlässig schienen, gegen die Sowjets einzusetzen. Der Versuch endete in einem Fiasko. Die massive Reaktion der Arbeiter und Soldaten, ihre stabile Organisierung durch das Verteidigungskomitee, das für den Oktoberaufstand verantwortlich war, führte dazu, dass Kornilows Truppen sich entweder ergaben, ohne je mobilisiert worden zu sein, oder, was weitaus häufiger der Fall war, auf die Seite der Arbeiter und Soldaten desertierten.
[30]Anders als Luxemburg, Jogiches oder Marschlewski, die sich während der Revolution von 1905/06 in Polen aufhielten (damals Teil des russischen Reiches), mangelte es den meisten von jenen, die die KPD gründeten, an direkter Erfahrung mit dem Massenstreik; sie hatten Schwierigkeiten, seine Unerlässlichkeit für den Sieg der Revolution zu erkennen.
Leute:
- Rosa Luxemburg [197]
- Leo Jogiches [198]
- Liebknecht [154]
- Richard Müller [161]
- Noske [199]
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Historische Ereignisse:
- Bürgerkrieg in Deutschland [200]
- Spartakuswoche [201]
- revolutionäre Obleute [202]
- USPD [203]
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Darwin und die Arbeiterbewegung
- 5265 reads
In diesem Jahr findet der 200. Geburtstag von Charles Darwin (und der 150. Jahrestag der ersten Veröffentlichung von „Über die Entstehung der Arten im Tier- und Pflanzenreich durch natürliche Züchtung oder Erhaltung der vervollkommneten Rassen im Kampf ums Dasein“) statt. Der marxistische Flügel der Arbeiterbewegung hat Darwins herausragende Beiträge zur Selbsterkenntnis der Menschheit und zu ihrem Verständnis der Natur stets gewürdigt.
In vielerlei Hinsicht war Darwin typisch für seine Zeit. Er interessierte sich für die Beobachtung der Natur und führte begeistert Experimente mit Tieren und Pflanzen durch. In seinen empirischen Arbeiten, die sich durch größte Genauigkeit und Sorgfalt auszeichneten, befasste er sich unter anderem mit Bienen, Käfern, Würmern, Tauben und Rankenfußkrebsen. Darwin befasste sich so beharrlich mit den Rankenfußkrebsen, dass seine jüngere Kinder „zu denken begannen, dass alle Erwachsenen mit ähnlichen Dingen beschäftigt sein müssen, so dass man sich über den Nachbarn fragte: ‚Wohin steckt er seine Rankenfußkrebse?‘“ (Darwin, Desmond & Moore).
In diesem Jahr findet der 200. Geburtstag von Charles Darwin (und der 150. Jahrestag der ersten Veröffentlichung von „Über die Entstehung der Arten im Tier- und Pflanzenreich durch natürliche Züchtung oder Erhaltung der vervollkommneten Rassen im Kampf ums Dasein“) statt. Der marxistische Flügel der Arbeiterbewegung hat Darwins herausragende Beiträge zur Selbsterkenntnis der Menschheit und zu ihrem Verständnis der Natur stets gewürdigt.
In vielerlei Hinsicht war Darwin typisch für seine Zeit. Er interessierte sich für die Beobachtung der Natur und führte begeistert Experimente mit Tieren und Pflanzen durch. In seinen empirischen Arbeiten, die sich durch größte Genauigkeit und Sorgfalt auszeichneten, befasste er sich unter anderem mit Bienen, Käfern, Würmern, Tauben und Rankenfußkrebsen. Darwin befasste sich so beharrlich mit den Rankenfußkrebsen, dass seine jüngere Kinder „zu denken begannen, dass alle Erwachsenen mit ähnlichen Dingen beschäftigt sein müssen, so dass man sich über den Nachbarn fragte: ‚Wohin steckt er seine Rankenfußkrebse?‘“ (Darwin, Desmond & Moore).
Darwin hob sich durch seine Fähigkeit ab, über Einzelheiten hinauszugehen, historische Prozesse zu erforschen und zu theoretisieren, wo andere sich damit begnügten, Phänomene einfach zu katalogisieren oder bestehende Erklärungen zu akzeptieren. Ein typisches Beispiel dafür war seine Reaktion auf die Entdeckung von Meeresfossilen in den Andenhöhen. Ausgestattet mit eigenen Erfahrungen mit einem Erdbeben sowie mit Lyells „Principles of Geology“, war er in der Lage, über das Ausmaß der Erdbewegungen spekulieren, welche dazu geführt hatten, dass der Inhalt des Meeresgrunds in die Berge gespült worden war, ohne dabei auf Erzählungen der Bibel über eine Sintflut zurückgreifen zu müssen. „Ich glaube fest daran, dass es ohne Spekulation keine guten & originalen Beobachtungen geben kann“ (wie er in einem Brief an A.R. Wallace schrieb, 22.12.1857).
Er fürchtete sich nicht davor, Beobachtungen auf einem Gebiet auch anderswo anzuwenden. Während Marx die meisten Schriften von Thomas Malthus mit Verachtung strafte, war Darwin in der Lage, dessen Ideen zum Bevölkerungswachstum bei der Erarbeitung seiner Evolutionstheorie zu verwerten. „Im Oktober 1838 las ich aus Spaß Malthus zur Bevölkerungsfrage. Da ich bereit war, den Existenzkampf zu akzeptieren, der überall durch langwierige Beobachtungen der Gewohnheiten der Tiere und Pflanzen festzustellen ist, fiel mir sofort auf, dass unter solchen Bedingungen günstige Varianten dazu neigten, fortzubestehen, und ungünstige dazu, zerstört zu werden. Das Resultat würde die Bildung neuer Arten sein. Hier hatte ich nun endlich eine Theorie, mit der ich arbeiten konnte.“ (Darwin: „Erinnerungen zur Entwicklung meines Denkens und meines Charakters“, eigene Übersetzung)
Erst 20 Jahre später fand diese Theorie in „Über die Entstehung der Arten“ ihren Weg in die Öffentlichkeit, aber die wesentlichen Ideen waren bereits vorhanden. In „Über die Entstehung der Arten“ erklärte Darwin, dass er „den Begriff 'Kampf ums Dasein'"(…) "in einem weiten breiten und metaphorischen Sinne gebrauche" und „der Bequemlichkeit halber“ (Darwin, Über die Entstehung der Arten, 4. Kapitel, Natürliche Zuchtwahl oder Überleben des Passendsten, Frankfurt 2009, S. 404) benutzt und er versteht unter natürlicher Auswahl "diese Erhaltung günstiger individueller Verschiedenheiten und Abänderungen und die Zerstörung jener, welche nachteilig sind, ist es, was ich natürliche Zuchtwahl nenne oder Überleben des Passendsten" (Darwin, Über die Entstehung der Arten, 4. Kapitel, Natürliche Zuchtwahl oder Überleben des Passendsten, Frankfurt 2009, S. 414).
Die Evolutionsidee war nicht neu, aber schon 1838 entwickelte Darwin eine Erklärung dafür, wie sich Arten entwickelten. Er verglich die Technik von Windhund- und Taubenzüchtern (künstliche Zucht) mit natürlicher Selektion und hielt das für „den schönsten Teil meiner Theorie“ (Darwin, zitiert von Desmond & Moore).
Die Methode des historischen Materialismus
Drei Wochen nach der Veröffentlichung von "Über die Entstehung der Arten" schrieb Engels an Marx: „Übrigens ist der Darwin, den ich jetzt gerade lese, ganz famos. Die Teleologie war nach einer Seite hin noch nicht kaputt gemacht, das ist jetzt geschehen. Dazu ist bisher noch nie ein so großartiger Versuch gemacht worden, historische Entwicklung in der Natur nachzuweisen, und am wenigsten mit solchem Glück.“ (Engels an Marx, 11/12. Dezember 1859, MEW Bd. 29, S. 524). Die Zerstörung der Teleologie bezieht sich auf den Schlag, den „Über die Entstehung der Arten“ allen religiösen, idealistischen oder metaphysischen Ideen versetzte, welche die Phänomene durch ihren Zweck anstatt durch ihre Ursache zu „erklären“ versuchen. Dies ist für eine materialistische Sicht der Welt wesentlich. Wie Engels im Anti-Dühring schrieb, versetzte Darwin der metaphysischen Auffassung der Natur den schwersten Schlag durch seinen Beweis, dass alles organische Leben, Pflanzen, Tiere und der Mensch selber Ergebnisse eines Entwicklungsprozesses sind, der seit Millionen Jahren andauert.
In seinen Planskizzen zu „Dialektik der Natur“ unterstrich Engels die Bedeutung des Buches „Über die Entstehung der Arten“. "Darwin, in seinem epochemachenden Werk, geht aus von der breitesten vorgefundnen Grundlage der Zufälligkeit. Es sind grade die unendlichen zufälligen Verschiedenheiten der Individuen innerhalb der einzelnen Arten, Verschiedenheiten, die sich bis zur Durchbrechung des Artcharakters steigern und deren selbst nächste Ursachen nur in den wenigsten Fällen nachweisbar sind, die ihn zwingen, die bisherige Grundlage aller Gesetzmäßigkeit in der Biologie, den Artbegriff in seiner bisherigen metaphysischen Starrheit und Unveränderlichkeit, in Frage zu stellen.“ [Engels: Dialektik der Natur, S. 339. Digitale Bibliothek Band 11: Marx/Engels, S. 8662 (vgl. MEW Bd. 20, S. 489)]
Aber ohne den Artbegriff war die ganze Wissenschaft nichts. Alle ihre Zweige hatten den Artbegriff als Grundlage nötig.
Marx las „Über die Entstehung der Arten“ ein Jahr nach der Veröffentlichung und schrieb sofort an Engels (19. Dezember 1860), dies sei „das Buch, das die naturhistorische Grundlage für unsere Ansicht enthält”. (MEW, Bd. 30, S. 131). Später schrieb er, dass das Buch „die naturwissenschaftliche Unterlage des geschichtlichen Klassenkampfes“ (Brief an Lassalle, 16.1.1861, ebenda S. 578) liefert.
Trotz ihrer Begeisterung für Darwin übten Marx und Engels auch Kritik an ihm. Sie waren sich des Einflusses von Malthus bewusst und auch, dass Darwins Erkenntnise vom „Sozialdarwinismus“ benutzt wurden, um den Status quo der viktorianischen Gesellschaft mit ihrem großen Wohlstand für einige und Gefängnis, Arbeitshaus, Krankheiten, Hunger und Auswanderung für die Armen zu rechtfertigen. In seiner Einleitung zur „Dialektik der Natur“ ging Engels dabei auf einige der sich daraus ergebenden Folgen ein. „Darwin wußte nicht, welch bittre Satire er auf die Menschen und besonders auf seine Landsleute schrieb, als er nachwies, daß die freie Konkurrenz, der Kampf ums Dasein, den die Ökonomen als höchste geschichtliche Errungenschaft feiern, der Normalzustand des Tierreichs ist.“ [Engels: Dialektik der Natur, S. 29. Digitale Bibliothek Band 11: Marx/Engels, S. 8352 (vgl. MEW Bd. 20, S. 324)] Erst „eine bewußte Organisation der gesellschaftlichen Produktion“ kann die Menschheit vom Überlebenskampf zur Erweiterung der Produktionsmittel als die Lebensgrundlage führen, und diese „bewußte Organisation“ erfordert eine Revolution durch die Produzenten, die Arbeiterklasse.
Engels erkannte auch, wo die Kämpfe der Menschheit (und das marxistische Verständnis für sie) über Darwins Rahmen hinausgingen. "Schon die Auffassung der Geschichte als einer Reihe von Klassenkämpfen ist viel inhaltsvoller und tiefer als die bloße Reduktion auf schwach verschiedne Phasen des Kampfs ums Dasein." [Engels: Dialektik der Natur, S. 483. Digitale Bibliothek Band 11: Marx/Engels, S. 8806 (vgl. MEW Bd. 20, S. 566)]
Aber diese Kritik entwertet keineswegs Darwins Verdienst um die Geschichte des wissenschaftlichen Denkens. In seiner Rede an Marx‘ Grab betonte Engels: „Wie Darwin das Gesetz der Entwicklung der organischen Natur, so entdeckte Marx das Entwicklungsgesetz der menschlichen Geschichte“. (Engels: Das Begräbnis von Karl Marx, MEW Bd. 19, S. 335)
Der Marxismus nach Darwin
Während Darwin im bürgerlichen Denken immer wieder in und aus der Mode gekommen ist (bei. seriösen Wissenschaftlern aber nicht), hat der marxistische Flügel der Arbeiterbewegung ihm nie den Rücken gekehrt.
In einer Fußnote seines Textes „Zur Frage der Entwicklung des monistischen Geschichtsauffassung“ (Kapitel 5, Der moderne Materialismus) geht Plechanow auf die Beziehung zwischen dem Denken Darwins und Marx‘ ein. „Darwin gelang es, die Frage zu lösen, wie die Pflanzen- und Tierarten im Existenzkampf entstehen. Marx gelang es, die Frage zu lösen, wie die verschiedenen Arten gesellschaftlicher Organisation im Kampf der Menschen um ihre Existenz entstehen. Logischerweise beginnt Marxens Untersuchung gerade dort, wo Darwins Untersuchung endet (...) Der Geist der Forschung ist bei beiden Denkern völlig gleich. Darum kann man auch sagen, dass der Marxismus der auf die Gesellschaftswissenschaften angewandte Darwinismus ist.“ (Frankfurt, 1975, S. 279).
Ein Beispiel der wechselseitigen Beziehung zwischen dem Marxismus und den Beiträgen von Darwin liefert uns Kautskys „Ethik und materialistische Geschichtsauffassung“. Obgleich Kautsky die Bedeutung Darwins überschätzt, bezog er sich auf „Die Abstammung des Menschen und geschlechtliche Zuchtwahl“ (1875), als er versuchte, die Bedeutung altruistischer Gefühle und sozialer Instinkte in der Entwicklung der Moral zu umreißen. Im 5. Kapitel von „Die Abstammung des Menschen und geschlechtliche Zuchtwahl“ beschreibt er, wie der Urmensch“ sozial wurde und "sie werden sich gegenseitig vor drohender Gefahr gewarnt und bei Angriff und Verteidigung unterstützt haben. Dies alles bedingt einen gewissen Grad von Sympathie, Treue und Mut." Er betonte: "Wenn zwei in selbem Gebiet lebende Stämme von Urmenschen in Wettbewerb traten, von denen der eine bei sonst gleichen Verhältnissen eine große Zahl mutiger, einander ergebener und treuer Mitglieder umfasste, die in Not und Gefahr stets bereit waren, einander zu warnen, zu helfen und zu verteidigen, so ging schließlich dieser Stamm als Sieger aus dem Wettstreit hervor. Vergessen wir nicht, welche überragende Bedeutung der Treue und dem Mut in den unaufhörlichen Kämpfen der Wilden zukommt. Die Überlegenheit disziplinierter Soldaten über undisziplinierte Horden entspringt hauptsächlich dem Vertrauen jedes einzelnen in seine Gefährten. (…) Selbstsüchtige, unverträgliche Menschen können nicht zusammenhalten, und ohne Eintracht kann nichts erreicht werden." (Charles Darwin, Die Abstammung des Menschen, 5. Kapitel: Über die Entwicklung der intellektuellen und moralischen Fähigkeiten während der vorgeschichtlichen und zivilisierten Zeiten; Frankfurt/M, 2009, S. 161).
Darwin übertrieb zweifelsohne, wenn er sagte, dass die primitiven Gesellschaften ständig Krieg gegeneinander führten; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit als Überlebensgrundlage war bei Aktivitäten wie der Jagd und der Verteilung des gesellschaftlichen Produkts nicht weniger wichtig. Dies ist die andere Seite des „Kampfes ums Dasein“, wo wir den Triumph der gegenseitigen Solidarität und des Vertrauens über Widerspenstigkeit und Egoismus erleben.
Von Darwin zu einer kommunistischen Zukunft
Anton Pannekoek war nicht nur ein großer Marxist, sondern auch ein herausragender Astronom (ein Krater auf dem Mond und ein Asteroid wurden nach ihm benannt). Man kann das Thema „Marxismus und Darwinismus“ nicht umfassend behandeln, ohne Bezug zu nehmen auf seinen 1909 erschienenen Artikel mit eben diesem Titel. Zunächst entwickelt Pannekoek unser Verständnis des Verhältnisses zwischen Marxismus und Darwinismus weiter.
„Hier sehen wir also, wie dasselbe Grundprinzip des Kampfes ums Dasein, das Darwin formulierte und Spencer betonte, bei Mensch und Tier verschieden wirkt. Das Prinzip, dass der Kampf zu einer Vervollkommnung der Waffen führt, womit gekämpft wird, erzeugt bei Mensch und Tier verschiedene Merkmale. Bei dem Tier führt er zu einer stetigen Entwicklung der natürlichen Leibesorgane; dies ist die Grundlage der Abstammungslehre, der Kern des Darwinismus. Bei dem Menschen führt er zu einer stetigen Entwicklung der Werkzeuge, der Technik, der Produktivkräfte. Dies ist aber die Grundlage des Marxismus.
Hier stellt sich nun heraus, dass Marxismus und Darwinismus nicht zwei unabhängige Lehren sind, deren jede auf ihrem eigenen Gebiet gilt, die aber miteinander nichts zu tun haben. Sie kommen in Wirklichkeit auf dasselbe Grundprinzip hinaus. Sie bilden eine Einheit. Die neue Richtung, die mit der Entstehung des Menschen eingeschlagen wird, die Ersetzung der natürlichen Organe durch künstliche Werkzeuge, bewirkt, dass dieses Grundprinzip sich in der Menschenwelt in ganz anderer Weise als in der Tierwelt äußert, dass dort der Darwinismus, hier der Marxismus das Entwicklungsgesetz bestimmt. (Anton Pannekoek, Marxismus oder Darwinismus, 1914, 2. Auflage, S. 40)
Pannekoek ging auch auf die Idee des sozialen Instinktes auf der Grundlage der Beiträge von Kautsky und Darwin ein.
„Diejenige Herde, die sich den Feinden gegenüber am besten zu behaupten weiß, bleibt in diesem Kampfe bestehen, während die schlechter Veranlagten zugrunde gehen. Nun werden sich aber diejenigen am besten behaupten in denen die sozialen Triebe am stärksten entwickelt sind. Wo sie schwach sind, fallen die Tiere am leichtesten den Feinden zum Opfer oder finden sie weniger günstige Futterplätze. Diese Triebe werden zu wichtigsten und entscheidenden Merkmalen, die über das Überleben im Kampfe ums Dasein entscheiden. Deshalb werden die sozialen Triebe durch den Daseinskampf zu allesbeherrschender Kraft herangezüchtet.
Die Tiergruppe, worin die gegenseitige Hilfe am stärksten ausgeprägt ist, behaupten sich am besten in dem Daseinskampf“ (ebenda, S. 29)
Der Unterschied zwischen geselligen Tieren und dem Homo sapiens liegt unter anderem im Bewusstsein. „Für den Menschen gilt nun alles, was für die sozialen Tiere gilt. Unsere affenähnlichen Vorfahren und die sich aus ihnen entwickelnden Urmenschen waren wehrlose schwache Tiere, die, wie fast alle Affenarten, ursprünglich in Trupps zusammenlebten. Hier mussten also dieselben sozialen Triebe und Gefühle entstehen, die sich nachher bei den Menschen zu sittlichen Gefühlen entwickelten. Daß unsere Sichtlichkeit und Moral nichts anderes als die sozialen Gefühle der Tierwelt sind, ist allbekannt; auch Darwin sprach schon von den mit ihren sozialen Institutionen in Verbindung stehenden Eigenschaften der Tiere, „die man bei den Menschen moralisch nennen würde“. Der Unterschied liegt nur in dem Maße des Bewusstseins; sobald die sozialen Gefühle den Menschen selbst klar bewusst werden, bekommen sie den Charakter sittlicher Gefühle.“ (ebenda, S. 30)
Auch Pannekoek griff den „Sozialdarwinismus“ scharf an. Er zeigte, wie die „bürgerlichen Darwinisten“ sich im Kreis drehen - die Welt, wie sie von Malthus und Hobbes beschrieben wurde, ähnelt wenig überraschend der Welt, welche... von Hobbes und Malthus beschrieben wurde.
„Daher kommt es, dass unter dem Kapitalismus die Menschenwelt am meisten der Welt der Raubtiere ähnelt. Daher kommt es, dass die Bourgeois-Darwinisten bei den einsam kämpfenden Tieren ihre Vorbilder für die Menschengesellschaft suchten; sie gingen dabei in der Tat von der Erfahrung aus, und ihr Fehler bestand nur darin, dass die kapitalistischen Verhältnisse für die ewig menschlichen ansahen. Die Verwandtschaft der besonderen kapitalistischen Kampfesverhältnisse mit denen der alleinlebenden Tiere hat Engels in der historischen Darstellung in seinem Anti-Dühring in dieser Weise ausgedrückt: „Die große Industrie endlich und die Herstellung des Weltmarkts haben den Kampf universell gemacht und gleichzeitig ihm eine unerhörte Heftigkeit gegeben. Zwischen einzelnen Kapitalisten wie zwischen ganzen Industrien und ganzen Ländern entscheidet die Gunst der natürlichen oder geschaffnen Produktionsbedingungen über die Existenz. Der Unterliegende wird schonungslos beseitigt. Es ist der Darwinsche Kampf ums Einzeldasein, aus der Natur mit potenzierter Wut übertragen in die Gesellschaft. Der Naturstandpunkt des Tiers erscheint als Gipfelpunkt der menschlichen Entwicklung.“ (ebenda, S. 43)
[Engels: Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, S. 58. Digitale Bibliothek Band 11: Marx/Engels, S. 8296 (vgl. MEW Bd. 19, S. 216)]
Aber die kapitalistischen Verhältnisse bestehen nicht ewig, und die Arbeiterklasse hat die Fähigkeit, sie zu überwinden und die Spaltung der Gesellschaft in Klassen mit antagonistischen Klasseninteressen zu beenden.
„Mit der Beseitigung der Klassen wird die ganze zivilisierte Menschheit zu einer einzigen großen solidaren Produktionsgemeinschaft. Dafür gilt dasselbe, was für jede gesellschaftliche Gruppe gilt: in ihr hört der gegenseitige Kampf ums Dasein auf; dieser wird nur noch nach außen geführt. Aber an Stelle der früheren kleinen Gruppen ist jetzt die ganze Menschheit getreten. Das bedeutet also, dass der Kampf ums Dasein innerhalb der Menschenwelt aufhört. Er wird nur noch nach außen geführt, nicht mehr als Wettkampf gegen Artgenossen, sondern als Kampf um den Lebensunterhalt gegen die Natur. Aber die Entwicklung der Technik und der damit zusammengehenden Wissenschaft bewirkt, dass dieser Kampf kaum noch ein Kampf zu nennen ist. Die Natur ist den Menschen untertan geworden bietet ihnen mit leichter Mühe einen sicheren, überschüssigen Lebensunterhalt. Damit tritt die Entwicklung der Menschheit in neue Bahnen; die Periode, worin sie sich allmählich aus der Tierwelt emporhob und den Kampf ums Dasein in eigenen, durch den Werkzeuggebrauch bestimmten Formen führte, nimmt ein Ende; die menschliche Form des Kampfes ums Dasein hört auf; ein neuer Abschnitt der menschlichen Geschichte fängt an.“ (ebenda S. 44) Car 28/1/9
Aktuelles und Laufendes:
- Darwin Arbeiterbewegung [204]
- Marxismus Darwinismus [205]
Leute:
Historische Ereignisse:
- Darwin Arbeiterbewegung [208]
- Marxismus Darwinismus [209]
Theoretische Fragen:
- Umwelt [24]
Der Balkankrieg 1999 - Artikelsammlung von Artikeln der IKS vor 10 Jahren zum Balkankrieg
- 6213 reads
Wir veröffentlichen nachfolgend 7 Artikel zum Jugoslawienkrieg, welcher 1999 von den westlichen Mächten ausgelöst wurde. Diese Artikel erschienen in unserer Zeitung Weltrevolution Nr. 93 + 93 im Frühjahr 1999.
Der Krieg hatte auf dem Balkan nur wenige Monate nach dem Ende des ersten Golfkriegs im Frühjahr 1991 unter Bush Sen. seinen Einzug gehalten. Kroatien und Slowenien hatten, durch Deutschland ermuntert, ihre Unabhängigkeit von Jugoslawien erklärt und damit die Auflösung des künstlichen, von Serbien dominierten Gebildes Jugoslawien eingeleitet. Eine Reihe von militärischen Auseinandersetzungen (z.B. Belagerung Sarajevos) und Massakern (z.B. Srebrenica) sollte von Anfang der 1990 Jahre nahezu ein Jahrzehnt lang Hunderttausende Menschen in die Flucht treiben. Die Tendenz des „jeder für“ und „jeder gegen jeden“ begann zu wüten. Die früheren Großmächte Deutschland, Frankreich, Großbritannien, welche in der Zeit des kalten Krieges in einer Blockdisziplin unter den USA zusammengehalten wurden, prallten auf dem Balkan aufeinander, und nützten den Nationalismus rivalisierender bürgerlicher Fraktionen vor Ort zu ihren Gunsten aus. Russland, traditionell ‚Schutzmacht’ Serbiens, mischte mit und natürlich die USA unter der Führung des demokratischen Präsidenten Bill Clinton. Die Reihe von militärischen Auseinandersetzungen erreichte mit dem Balkankrieg im Frühjahr 1999 nur eine neue Stufe.
Der damaligen Rot-Grünen Regierung steht das große Verdienst zu, zum ersten Mal nach dem 2. Weltkrieg wieder die direkte Beteiligung des deutschen Militärs bei Kriegshandlungen ermöglicht zu haben. Dies sollte der Auftakt sein zu einer Reihe von mittlerweile weltweiten Einsätzen des deutschen Militärs. Angewidert von der kriegerischen Politik der Rot-Grünen Regierung hatte deren Verhalten einen wichtigen Prozess des Nachdenkens in den Reihen politisierter Leute über die Rolle nicht nur der linken Regierungen, sondern auch der nationalen Frage im Kontext des heutigen Kapitalismus gefördert.
Mehr dazu in unserer Presse…
Aus Weltrevolution Nr. 93 (April-Mai 1999)
Nato-Bombardierungen in Jugoslawien - Kapitalismus heißt Krieg, Krieg dem Kapitalismus!
Erneut wird das ehemalige Jugoslawien verwüstet. Aber heute handelt es sich nicht mehr um Massaker zwischen ethnischen Gruppen, wie es sie seit 1991 immer wieder gegeben hat, und die im übrigen nur möglich waren aufgrund der Waffenlieferungen und der Unterstützung der Großmächte für diese oder jene nationalistische Clique.
Heute entfesseln die „Demokratien“, die innerhalb der NATO zusammengeschlossen sind, ein Inferno gegen die Bevölkerungen Serbiens, Montenegros und des Kosovos. Denn wir brauchen uns nichts vorzumachen: den Bomben fallen nicht nur militärische Anlagen zum Opfer. Zu den Opfern gehören auch: Soldaten, die sich nicht freiwillig am Krieg beteiligen, und die Arbeiter und Bauern in Uniform sind; die zivile Bevölkerung, Frauen, Kinder, Alte, die das Pech haben, in der Nähe der Militärbasen, der Rüstungsbetriebe und der Raffinerien zu leben, d.h. hauptsächlich Arbeiterfamilien. Zehntausende Menschen, die hilflos und terrorisiert diesen Angriffen ausgesetzt sind, werden in die Flucht getrieben.
Die kapitalistische „Ordnung“ zeigt erneut ihr wahres Gesicht, das einer beispiellosen Barbarei, wo die „Wunder“ der Technik der Großmächte der „zivilisierten“ Welt in den Dienst des Mordens und der Zerstörung gestellt werden.
Vorbei die Illusionen über einen neuen „Friedenszeitraum“, der uns beim Zusammenbruch des Ostblocks versprochen wurde! Der Untergang dieses so genannten „sozialistischen“ Blocks und das Ende des „kalten Krieges“ haben kein Ende der kriegerischen Konflikte gebracht. Im Gegenteil! Seit 1989 haben die Massaker und die militärischen Spannungen nur noch zugenommen: im Irak, im ehemaligen Jugoslawien, in den Republiken der ehemaligen UdSSR, auf dem ganzen afrikanischen Kontinent, in Afghanistan, in Indien, in Pakistan usw.
Das ist die Wirklichkeit der von den großen Demokratien nach dem Zusammenbruch des russischen Blocks so viel gepriesenen neuen „Weltordnung“: ein immer blutigeres Chaos, das sich jetzt im Herzen Europas breit macht.
Es ist der Weltkapitalismus, der in all seinen Formen – ob „demokratisch“ oder „totalitär“ – den Krieg hervorbringt.
Milosevic, Clinton und Konsorten: Alle sind Gangster und Mörder!
Während der furchtbaren Operation „Wüstensturm“ im Golfkrieg im Januar 1991 wollten uns alle Regierungen der „schönen“ westlichen „Demokratien“ glauben machen, dass man einen „sauberen und chirurgischen“ Krieg zur Verteidigung des „internationalen Rechts“ und zur Beseitigung des „Schlächters von Bagdad“ geführt hätte. Heuchlerische Schufte!
Dieser „saubere“ Krieg hat mehrere Hunderttausend Tote hinterlassen und heute noch muss die Zivilbevölkerung die Kosten für dieses schreckliches Abschlachten bezahlen, während Saddam weiterhin im Irak seine Diktatur ausübt. Unter dem Vorwand, „Diktatoren“ zu bekämpfen, werden die von diesen Diktatoren unterdrückten Bevölkerungen mit Bombenteppichen belegt und ausgehungert.
Was das „internationale Recht“ angeht, haben die großen Demokratien Europas und Amerikas dieses immer wieder mit Füßen getreten.
Heute noch wird das noch klarer: die Nato-Bombardierungen in Serbien, die nicht einmal das Feigenblatt eines UNO-Mandats besitzen, zeigen überdeutlich auf, dass die „Großen“, die die Welt regieren, nichts mit diesem „internationalen Recht“ zu tun haben.
All diese imperialistischen Gangster behaupten, dem „Recht“ Geltung zu verschaffen. Das stimmt, aber welchem Recht? Ihr Recht ist das Recht des Dschungels, des Stärkeren, das Recht der Gangster, das Recht der kapitalistischen Barbarei!
Milosevic ist wie Saddam ein blutiger Diktator der schlimmsten Art. Aber die großen Demokratien stehen ihm in nichts nach. In Hiroshima, Korea, Algerien, Vietnam, im Irak... haben sie nie vor Folter und großen Massakern an der Bevölkerung zurückgeschreckt.
Und der Zynismus dieser angeblichen Verteidiger der unterdrückten Völker ist das nicht die Höhe, wenn man weiß, dass die meisten dieser von „Diktatoren“ geführten Regime wie Milosevic (Pinochet, Saddam Hussein, Mobutu, Kabila und Konsorten) gerade von denen an die Macht gebracht, bewaffnet und unterstützt wurden, die heute lauthals deren Taten anprangern.
Die linken Parteien – Speerspitze der kriegerischen Barbarei
Die linken Parteien – Sozialisten, Sozialdemokraten, Labour-Partei oder „Grüne“ – beanspruchen heute die Verteidiger der Unterdrückten und Ausgebeuteten, Verfechter der „Menschenrechte“ und Friedensapostel zu sein.
Diese linken Regierungen heute stehen in der Mehrzahl an der Spitze der Regierungen, die sich an den Massakern beteiligen Parteien. An der Regierung handelt die Linke als loyaler Verteidiger der Wirtschaftsinteressen des Kapitalismus, wobei sie immer mehr die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse angreifen. Und wo immer an der Regierung beteiligen sich die linken Parteien voll und ganz, ohne zu zögern an der kriegerischen Barbarei des Kapitalismus hinter dem „Demokraten“ Clinton.
Schröder, Jospin, Blair und Konsorten sind die würdigen Erben der „sozialistischen“ Führer von 1914, die aktiv die Arbeiter für den Ersten Weltkrieg mobilisierten und die Massaker an den Arbeitern verübten, als die Arbeiter wie in Deutschland 1919 versucht hatten, den Kapitalismus zu stürzen.
Der Kapitalismus bedeutet immer mehr Chaos und immer mehr Massaker
Krieg führen, um den „Frieden“ zu bewahren und die „menschlichen Werte der Demokratie“ zu schützen – diese Lüge ist so alt wie abscheulich! Die Bourgeoisie hat die Massaker des 1. Weltkriegs ausgelöst und sie dargestellt als den allerletzten Krieg, der im Namen der „Zivilisation“ geführt wurde. 20 Jahre später kam es noch zu einem schlimmeren Abschlachten. Der Sieg der Alliierten im 2. Weltkrieg war angeblich der der „Demokratie“ gegen die „barbarischen Nazis“. Seitdem hat es immer wieder Kriege gegeben, mit genau so viel Toten insgesamt wie während des Weltkriegs selber.
All diese blutigen Schufte, die sich beim Waffengang zwischen der NATO und Milosevic beteiligen, sind sehr wohl „würdige“ Repräsentanten des Systems, das die Welt beherrscht. Ein System, das selbst in den „wohlhabendsten“ Staaten Dutzende von Millionen von Menschen in die Armut treibt, sie auf die Straße wirft, und ¾ der Menschheit dem Hunger, Epidemien und endlosen Massakern ausliefert. Ein System, das heute ein wahnsinniges Chaos hervorbringt.
Indem sie ihren schrecklichen Militärapparat entfesselt haben, behaupten die USA als Boss und ihre europäischen Komplizen, dass sie dieses Chaos bekämpfen und die Massaker an der Bevölkerung aufhalten wollen. Aber nichts ist falscher als das! Die Folgen der Operation „Entschlossene Kraft“ können nur neue Massaker an der albanischen Bevölkerung sein, die man angeblich schützen will; ein Großbrand auf dem Balkan, die Entfesselung eines blutigen Chaos in Europa.
Die Koalitionskräfte der NATO mögen wohl -um ein „Beispiel zu setzen“ -so viele Menschenleben in Serbien massakrieren wie sie wollen. Aber aus diesem neuen „humanitären“ Kreuzzug wird genauso wenig wie im Irak eine „Weltordnung“ hervorgehen.
Kriege sind nicht auf „Fehler der Diplomatie“ zurückzuführen oder auf den „mangelnden Willen“ der Führer dieser Welt. Sie sind die einzige Antwort des Kapitalismus auf die unüberwindbare Wirtschaftskrise. Diese Krise verschärft die Konkurrenz und die Rivalitäten zwischen allen Nationen. Je mehr sich diese Krise zuspitzt, wie das heute der Fall ist, und je mehr der Kapitalismus Massaker verüben wird, desto mehr wird sich der Krieg auf die höchst entwickelten Staaten zubewegen.
Und genau das kann man heute beobachten: zum ersten Mal seit einem halben Jahrhundert entfesseln die Großmächte offen und massiv den Krieg auf dem Boden Europas. Und das ist noch nicht das Ende. Die Zukunft wird noch mehr Blut und Barbarei bringen als die Vergangenheit.
Nur der Klassenkampf des Proletariats kann die kapitalistische Barbarei beenden
Heute wie damals sind die Zivilbevölkerungen und insbesondere die Arbeiterklasse die ersten Opfer des imperialistischen Krieges. In Serbien wie im Irak sind es zum Großteil Arbeiter in Uniform und nicht die Regierungsmitglieder, die als Kanonenfutter abgeschlachtet werden. In den Ländern der NATO, die sich an diesem Angriff beteiligen, werden die Arbeiterfamilien ihre toten Kinder zu beweinen haben, wenn es zum Einsatz von Bodentruppen kommt.
Aber im Krieg ist die Arbeiterklasse nicht nur das Hauptopfer. Sie ist auch die einzige Kraft, die wirklich die kapitalistische Barbarei bekämpfen kann. Durch ihren revolutionären Kampf in Russland 1917 und in Deutschland 1918 hat die Arbeiterklasse die Bourgeoisie dazu gezwungen, den 1. Weltkrieg zu beenden.
Und sie konnte den 2. Weltkrieg nicht verhindern oder beenden, weil sie von der stalinistischen Konterrevolution geschlagen, vom Faschismus terrorisiert oder von den Linksparteien für die „Volksfronten“ und die „Resistance“ mobilisiert worden waren.
Weil die Weltarbeiterklasse seit den massiven Streiks vom Mai 1968 in Frankreich ihre Kämpfe entfaltet und sich damit geweigert hat, sich der Logik des krisengeschüttelten Kapitalismus zu unterwerfen, hat sie die Auslösung eines 3. Weltkriegs verhindern können.
Alle Fraktionen der Bourgeoisie wollen diese Kraft der Arbeiterklasse, die sie in sich birgt, ihr gegenüber vertuschen:
- indem ihr glauben gemacht werden soll, dass Krieg und „Frieden“ nur von dem diplomatischen Schacher zwischen den Führern der Welt abhingen,
- indem ihre Ängste und ihre Wut auf das verfaulte Terrain der Illusionen über einen „friedlichen“ Kapitalismus abgelenkt werden sollen.
Der „Pazifismus“ war immer der beste Komplize der kriegerischen Propaganda. Die Massaker werden nicht verhindert durch Demonstrationen für Verhandlungen und Aufrufe an die Regierungen zu mehr „Umsicht“. Dies zeigt die Erfahrung aus der Zeit vor den beiden Weltkriegen, dem Vietnamkrieg oder im Golfkrieg. All diese Maskeraden haben immer nur dazu gedient, um die Arbeiterklasse von ihrem einzigen Kampf abzulenken, der wirklich einen Widerstand gegen den Krieg darstellen und die Barbarei endgültig aus der Welt schaffen kann: der massive und vereinigte Kampf der ausgebeuteten Klasse gegen ihre Feindesklasse, die Ausbeuter und Massakrierer.
Indem die Arbeiter die Opfer verweigern, die ihnen die Bourgeoisie zur Finanzierung ihrer Kriege und zur Hinnahme der Auswirkungen der Wirtschaftskrise ihres Systems auferlegen will, entwickeln die Arbeiter die gemeinsame Stärke, um sich dem höchsten Opfer entgegenzustellen, nämlich ihr Leben im imperialistischen Krieg zu lassen.
Indem sie sich weigern, sich durch die grauenhafte Demonstration der Stärke seitens der Großmächte einschüchtern zu lassen, können sie ihr Gefühl der Hilflosigkeit überwinden und wieder das Selbstvertrauen in ihre Fähigkeit finden, eine entscheidende Rolle für die Zukunft der Menschheit zu spielen.
Indem sie massiv ihre Kämpfe für die Verteidigung ihrer Interessen als ausgebeutete Klasse gegen die Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen entwickeln, indem sie in diesen Kämpfen ihre Solidarität, ihre Einheit und ihre Klassenstärke entfalten, indem sie ihr Bewusstsein über das vorantreiben, was in der gegenwärtigen Lage auf dem Spiel steht, werden die Arbeiter aller Länder dazu in der Lage sein, den Kapitalismus und all seine Barbarei zu überwinden.
Die Arbeiter haben kein Vaterland!
Arbeiter aller Länder, vereinigt Euch!
Dem Krieg der imperialistischen Gangster müssen wir unseren Klassenkrieg entgegenstellen!
Wir müssen den Kapitalismus zerstören, bevor er die Menschheit zerstört!
Internationale Kommunistische Strömung (25.3.1999)
Dieses Flugblatt wird in Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien Mexiko, Niederlande, Schweden, Schweiz Spanien, USA, Venezuela, Österreich, Australien, Russland verteilt.
Ein blutiger Konflikt um die imperialistische Hackordnung 26.03.1999
Es sind Szenen, wie man sie in Europa seit dem 2.Weltkrieg nicht mehr zu sehen bekommen hat. Hunderttausende Zivilisten versuchen sich in Luftschutzräumen vor Bomben und Raketen in Sicherheit zu bringen. In den großen Städten Jugoslawiens brennen Fabriken, Munitions- und Treibstofflager, Kasernen und Wohnhäuser. In den Vororten der jugoslawischen Hauptstadt Belgrad: Einschlagkrater, Tote und Verletzte. In allen Teilrepubliken Jugoslawiens – in Serbien, Montenegro, im Kosovo - Bilder der Verwüstung, Opfer unter der schutzlosen Zivilbevölkerung. Einige hundert Kilometer vor den Toren Wiens und Budapests werden auch im Norden Serbiens Ziele von der NATO unter Beschuss genommen. In den Hauptstädten Westeuropas und Nordamerikas treten Verteidigungsminister und hohe Militärs vor die Presse und verkünden siegesgewiss militärische Erfolge. Im Kosovo, dessen Bevölkerung durch diese Militäraktion angeblich geschützt werden soll, herrscht indessen Pogromstimmung. Sondereinheiten der serbischen Polizei und die Soldateska der albanischen UCK machen Jagd auf die Bevölkerung der "Gegenseite". Nachbarn werden gelyncht. Während dort Hunderttausende auf der Flucht sind, treten die Innenminister der Abschiebestaaten Europas in Konsultationen darüber ein, wie das Flüchtlingsproblem bewältigt werden könne. Erste Maßnahmen werden bereits getroffen: die Grenzen der Nachbarländer werden geschlossen, damit die gejagten Menschen nicht entkommen können.
Das Jahrhundert schließt, wie es begonnen hat, mit einem imperialistischen Krieg in Europa. Das letzte Jahrzehnt des Jahrtausends endet, wie es begann: mit einem mörderischen militärischen Feldzug der "Staatengemeinschaft" gegen ein zum "Schurkenstaat" abgestempeltes Land - damals Irak, diesmal Jugoslawien. So sehen der "Triumph des Kapitalismus" und die "neue Weltordnung" aus, welche der amerikanische Präsident George Bush vor zehn Jahren mit seinen Bomben auf Bagdad feierlich verkündete. Damals wie heute treten die "großen Demokratien des Westens" mit Marschflugkörpern und lasergesteuerten Bomben für internationales Recht, für Frieden und Freiheit ein. Damals gab man vor, das kleine Kuwait, heute das kleine Kosovo vor einer "humanitären Katastrophe" zu bewahren. Indessen wird deutlicher: die "humanitäre Katastrophe" ist der Kapitalismus, der militaristische Imperialismus selbst.
Acht Jahren nach dem Golfkrieg von 1991 zeigt der Krieg in Jugoslawien, wie blutig und gefährlich die militärischen Widersprüche des niedergehenden Kapitalismus sich zugespitzt haben. Die neue Weltordnung ist außer Kontrolle geraten. Denn inzwischen ist der Krieg vom Persischen Golf bis ins Zentrum des Weltkapitalismus nach Europa vorgerückt. Inzwischen ist der führende imperialistische Staat Europas, ist die deutsche Wehrmacht zum ersten Mal seit 1945 an Kriegshandlungen beteiligt. Wie 1941 bombardiert die deutsche Luftwaffe heute wieder Jugoslawien: Befehligt von einem sozialdemokratischen Kanzler und einem friedensbewegten Außenminister in den militärischen Fußstapfen Hitlers und Görings.
Ein blutiger Konflikt um die imperialistische Hackordnung
Wie im Golfkrieg 1991 ist die militärische Strafexpedition heute eine Machtdemonstration des Weltpolizisten USA. Serbien wird angegriffen, nicht wegen der "ethnischen Säuberungen" im Kosovo, sondern weil Milosevic sich nicht dem Diktat Washingtons auf der "Friedenskonferenz" von Rambouillet beugte, und damit die Autorität Amerikas in Frage stellte. Wie damals die Bomben auf Bagdad, so gelten die amerikanischen Raketen auf Belgrad heute politisch nicht nur Serbien, sondern allen imperialistischen Herausforderern der USA. Sie sind eine deutliche Warnung sowohl an die imperialistischen Gönner Serbiens wie Russland und (wenn auch diskreter) Frankreich und Großbritannien ebenso wie an die historischen Erzfeinde Serbiens wie Deutschland oder die Türkei. Schon der erste Golfkrieg war eine solche Warnung. Damals schon zwangen die USA ihre imperialistischen Rivalen, sich in einer Kriegskoalition der amerikanischen Führung unterzuordnen. Bereits damals ging es nicht um Kuwait und nicht um Öl, sondern um die Autorität der Weltführungsmacht gegenüber ihren ehemaligen westlichen Verbündeten nach dem Verschwinden des gemeinsamen Gegners aus dem Kalten Krieg. Gerade heute geht es wieder um die Hackordnung unter den imperialistischen Gangstern, und nicht um das Schicksal der Flüchtlinge im Kosovo. Nicht um Milosevics Militärpotential auszuschalten muss Washington heute seine Milliarden-teuren Tarnkappenbomber Stealth über den Atlantik zum Einsatz fliegen, sondern um die lieben Verbündeten einzuschüchtern und bei der Stange zu halten.
Deshalb kommt in London, Paris oder Berlin - allen Erfolgsmeldungen des NATO-Militärs zum Trotz - keine Siegesstimmung auf. Die europäische Bourgeoisie hat Clintons Warnung sehr gut verstanden. Seit Monaten beschwert man sich ja in den Hauptstädten Europas darüber, dass ein NATO-Einsatz gegen den "souveränen Staat" Jugoslawien völkerrechtlich nicht zulässig sei, weil es dafür kein Mandat des UN-Weltsicherheitsrates gibt. Für den Golfkrieg 1991 gab es ein solches Mandat, weil damals die USA noch mächtig genug waren, um ein solches durchzusetzen. In der Zwischenzeit allerdings wurden die Vereinten Nationen zunehmend von den anderen ständigen Mitgliedern des Weltsicherheitsrates - Großbritannien, Frankreich, Russland und China - instrumentalisiert, um die Politik Amerikas vor allem gegenüber dem Irak und auf dem Balkan zu sabotieren. Infolgedessen griffen die USA, nur unterstützt von Großbritannien, im Dezember 1998 den Irak erstmals ohne ein solches Mandat militärisch an. Noch bemühte sich damals die amerikanische Bourgeoisie um den Anschein der "Legalität", indem sie sich auf bisherige Resolutionen des Weltsicherheitsrates berief. Jetzt aber, gegenüber Jugoslawien, musste Washington auch diese Fassade fallenlassen. Da ein Mandat hierfür nicht zu haben war, - die diskret pro-serbischen Regierungen in London und Paris konnten sich hinter dem klaren Veto Russlands und Chinas verstecken - erhob Washington ein neues Prinzip zur Richtschnur der imperialistischen Weltpolitik: die der "humanitären Notlage".
Das "Völkerrecht" stellt nichts anderes dar als die Spielregeln beim rücksichtslosen Kampf der imperialistischen Gangster untereinander. Es ist bezeichnend für die neue Weltunordnung des zerfallenden Kapitalismus, dass ausgerechnet der Weltpolizist USA, der eigentlich dazu berufen ist - und als Einziger dazu in der Lage wäre - die Einhaltung dieser Spielregeln durchzusetzen, selbst gezwungen ist, sie über Bord zu werfen. Das Prinzip der humanitären Hilfe bedeutet, dass künftig allein die USA als mit Abstand stärkster Macht bestimmen wollen, wann und gegen wen Krieg geführt werden soll, ohne Rücksicht zu nehmen auf die "berechtigten Interessen" der "Freunde und Verbündeten". Der Krieg in Jugoslawien bedeutet, dass die USA bereit und imstande sind, jeden Herausforderer mit Tod und Verderben zu überziehen - nicht nur im Nahen Osten oder in Afrika, sondern in Europa selbst. Mit dem Jugoslawienkrieg hält der Krieg als Mittel der imperialistischen Konfliktregelung in Europa wieder Einzug. Die Bomben, die heute auf Belgrad niederprasseln, können und werden in Zukunft auch andere europäische Hauptstädte heimsuchen.
Dieser Krieg bedeutet eine weitere Zuspitzung des imperialistischen Jeder gegen Jeden, eine neue Stufe des weltweiten Chaos, eine Entwicklung, die selbst von den Großmächten immer weniger beherrscht wird.
Das Jeder gegen Jeden in Europa und die Untergrabung der Autorität der USA
Die Warnung der Weltmacht an ihre wichtigsten Herausforderer in Europa geht weit über das hinaus, was in den letzten Jahren am Persischen Golf geschah. Aber nicht hierin liegt der Hauptunterschied zum damaligen Golfkrieg, sondern in der Tatsache, dass es den USA selbst trotz immer brutalerer Militärschläge immer näher zum Zentrum des Systems hin immer weniger gelingt, ihren Führungsanspruch durchzusetzen.
Bereits die Notwendigkeit dieser erneuten Machtdemonstration heute beweist am besten das politische Scheitern des Golfkrieges von 1991. Zwar besitzen die USA mehr militärische Machtmittel als alle ihre Herausforderer zusammengenommen, trotzdem reichen diese Mittel nicht aus, um die einstigen Verbündeten Amerikas zum Gehorsamkeit zu zwingen, weil seit dem Zusammenbruch des Ostblocks 1989 der gemeinsame Gegner fehlt. Militärbündnisse werden nicht durch die Freundschaft der Verbündeten, sondern durch die Angst vor gegnerischen Bündnissen zusammengehalten. Wurde der Golfkrieg damals absichtlich von den Vereinigten Staaten angezettelt, um die übrige Welt zu disziplinieren, so folgte dem sehr bald ein Krieg in Europa, der gegen den Willen Amerikas von seinem Hauptherausforderer Deutschland angefacht wurde. Dies war der erste Jugoslawienkrieg, der durch die Anerkennung der Unabhängigkeit Sloweniens und Kroatiens von Seiten Deutschlands und Österreichs begünstigt wurde und zur Auflösung des Bundesstaates Jugoslawiens führte.
Es war kein Zufall, dass die Sprengung Jugoslawiens die erste unabhängige außenpolitische Handlung des gerade wiedervereinigten Deutschlands war. Es ist ebenso wenig ein Zufall, dass der erste Kriegseinsatz Deutschlands seit 1945 in Jugoslawien stattfindet. Bereits vor dem 1. Weltkrieg wurde der Balkan zum wichtigsten Aufmarschgebiet des deutschen Imperialismus, seinem Einfallstor zur Weltgeltung via Mittelmeer, Mittlerer Osten und Asien. Nach dem 1. Weltkrieg schmiedeten die Siegermächte von Versailles - Großbritannien und Frankreich - in Mittel- und Südosteuropa folgerichtig eine "Kleine Entente" gegen Deutschland, aus den neuen Staaten Polen, Tschechoslowakei und Jugoslawien bestehend. Jugoslawien, unter der Führung Serbiens wurde damals „gestiftet“, um Deutschland vom Mittelmeer und dem Donauraum abzuschneiden. Hitler-Deutschland wiederum jagte Jugoslawien schon am Anfang des 2.Weltkrieges auseinander, und setzte die kroatische Bourgeoisie als Statthalter ihrer Interessen in der Region ein. Die Niederlage Deutschlands im 2. Weltkrieg und die Teilung Europas entlang des "Eisernen Vorhangs" schnitt daraufhin die deutsche Bourgeoisie bis 1989 von ihrer traditionellen Südost-Expansionsroute ab - auch wenn sie nie darauf verzichtete, "besondere Verhältnisse" zu Jugoslawien und der Türkei zu pflegen, ganz bewusst ihre "Gastarbeiter" vornehmlich von dort bezog usw. Als der Bundesstaat Jugoslawien 1991 auseinanderbrach, und damit die Südostroute für Deutschland sich wieder öffnete, erklärte ein französischer Diplomat, sein Land habe damit nachträglich nicht nur den Zweiten, sondern auch noch den Ersten Weltkrieg verloren.
Was folgte, war eine entschlossene Reaktion der anderen europäischen Mächte, um Deutschlands Vormarsch Richtung Mittelmeer und Mittelasien aufzuhalten. In Bosnien, Slawonien und der Krajina griffen Großbritannien, Frankreich und Russland, zunehmend auch Italien für die Serben Partei gegen die Kroaten. Das Schlimmste - aus der Sicht Amerikas - war aber, dass diese blutigen Konflikte der europäischen Mächte in Kroatien und Bosnien ausbrachen, ohne dass irgend jemand von ihnen sich um die Meinung - geschweige denn die Erlaubnis - der Weltmacht geschert hätte. Um sich als Führungsmacht zu verteidigen, griffen die USA in die Kriegswirren auf dem Balkan ein und erzwangen mit dem Daytoner Abkommen zu Bosnien eine Art Pax Americana für das ehemalige Jugoslawien.
Mit dieser Pax Americana konnten die europäischen Herausforderer der USA nichts anfangen. Vor allem Deutschland konnte nicht akzeptieren, dass ein restjugoslawischer Staat unter serbischer Führung überleben sollte, der weiterhin dem wachsenden deutschen Einfluss entlang der Donau einen Riegel vorschieben würde. Das Anliegen Deutschlands wurde durch die Tatsache begünstigt, dass auch Restjugoslawien ein "Vielvölkerstaat" ist. Diskret aber wirkungsvoll begann Deutschland, von Österreich und der Schweiz unterstützt, die Kosovo-Albaner mittels der so genannten Befreiungsarmee UCK zur Loslösung von Belgrad zu verhelfen. London, Paris, Moskau und Rom hingegen ermunterten Serbien dazu, den albanischen Separatismus erbarmungslos niederzuwerfen. Man begreift somit die abgrundtiefe Heuchelei der "großen Demokratien", welche heute vorgeben, militärisch einzugreifen, um eine menschliche Katastrophe herbeizuführen, die sie selbst herbeigeführt haben. Man begreift ebenfalls, wie fadenscheinig die Einheit der jetzigen "Wertegemeinschaft" der NATO in Wirklichkeit ist.
Und nicht zuletzt war die Autorität der USA erneut, aber diesmal viel gravierender herausgefordert. Washington begriff, dass es hier nicht mehr allein um seine globale Führung ging, sondern um seine Stellung in der europäischen Politik, um seinen Platz im Herzen des Weltkapitalismus, im Zentrum der imperialistischen Spannungen in diesem Jahrhundert.
In Rambouillet bei Paris wollte Washington also der serbischen und kosovo-albanischen Bourgeoisie eine neue Pax Americana aufzwingen, und somit das Daytoner Abkommen absichern und seine Führungsrolle auf dem Balkan unterstreichen. Dieser Versuch misslang kläglich. Tatsächlich waren die Amerikaner als Einzige am Gelingen eines solchen Abkommens interessiert. Für Serbien war die Stationierung von NATO-Truppen auf seinem Territorium ebenso wenig hinnehmbar wie für die UCK das Verbleiben Kosovos im jugoslawischen Verbund. Die kosovo-albanische Seite leistete schließlich doch ihre Unterschrift aus ihrer Position der Schwäche heraus, vor allem aber weil sie (von Deutschland gut beraten) sicher sein konnte, dass Serbien ohnehin nicht unterschreiben, das Abkommen somit auch nicht rechtsgültig werden könnte. Damit wurden die USA unter Zugzwang gesetzt, die in der Weltöffentlichkeit sich weigernde serbische Seite "zur Raison" bringen zu bringen.
An diesem Punkt wird das ganze Ausmaß der Untergrabung der Position der USA seit dem Golfkrieg sichtbar. Der Golfkrieg war eine von vorn herein von den Vereinigten Staaten geplante und beherrschte Operation, wobei Saddam Hussein in eine amerikanische Falle hineingelockt wurde, indem man ihm vorher zu verstehen gab, nichts gegen eine irakische Annexion Kuwaits zu haben. Auch noch im vergangenen Dezember beim letzten größeren Angriff gegen den Irak brannten die Amerikaner förmlich darauf loszuschlagen. Jetzt hingegen, nach dem Scheitern von Rambouillet, wollten die USA ganz offensichtlich eine Militäraktion gegen Jugoslawien umgehen. Immer wieder ließ Washington Ultimaten verstreichen, immer wieder wurden der serbischen Regierung - die gar nicht darum bat - neue "Bedenkzeiten" eingeräumt.
Die gesamte Weltlage ließ der einzig verbleibenden Supermacht keine andere Wahl, als den Machtapparat des serbischen Staates in Grund und Boden zu bombardieren. Nichts Geringeres wird reichen, um die Autorität Amerikas angesichts des Ausmaßes der Anfechtungen zu untermauern. Aber es ist offensichtlich, dass eine solche Schwächung der serbischen Seite keineswegs im strategischen Interesse der Vereinigten Staaten liegt. Es droht damit das Auseinanderfallen Restjugoslawiens, wobei zunehmend nicht nur das Kosovo, sondern auch Montenegro abtrünnig wird. Es droht die Destabilisierung der gesamten Balkanhalbinsel. Bereits in den ersten Tagen des NATO-Angriffs gegen Jugoslawien brachen z.B. schwere Unruhen in Mazedonien aus, wo gewichtige serbische und albanische Minderheiten einander gegenüberstehen. Ein eventueller Zerfall Mazedonien wiederum würde den Kampf zwischen Serbien, Bulgarien und Griechenland um die Überreste dieses kaum überlebensfähigen Ministaates mächtig anheizen - mit kaum überschaubaren Folgen für die gesamte Region. Es droht die weitere Entfremdung Russlands gegenüber den USA, und damit die verstärkte Annäherung des zerfallenden Riesenreichs an Europa. Der Angriff gegen Jugoslawien löst eine Kettenreaktion aus, die die Führungsmacht selbst nicht mal überblicken, geschweige denn beherrschen kann. Dies ist auch der Sinn des Ausspruchs des kränkelnden russischen Präsidenten Jelzins, dass nach diesem Krieg Europa nicht mehr dasselbe sein wird.
Nicht zuletzt wird dieser Krieg die Konflikte innerhalb der NATO sichtbar werden und zuspitzen lassen. Nach der UNO wird die NATO selbst, das Hauptinstrument des amerikanischen Führungsanspruchs in Europa, zum zentralen Schlachtfeld des Gerangels unter den führenden "Demokratien". Allen Einigkeitsbeschwörungen zum Trotz zeigen sich diese Zwistigkeiten seit Beginn der Operation "Entschlossene Kraft". Der NATO-"Partner" Griechenland - ein traditioneller Verbündeter Serbiens und Großbritanniens - hat von Anfang an die Beteiligung seiner Streitkräfte an dieser Mission ausgeschlossen. Der ebenfalls Serbien-freundliche NATO-"Partner" Italien machte rasch deutlich, seine auch nur halbwegs aktive Teilnahme an Militäroperationen würde zum Sturz der Regierung in Rom führen. Auch die Streitkräfte des beispielsweise gegenüber dem Irak sonst so forschen Großbritannien, wie auch der in Afrika nicht weniger forschen französischen Militärs nehmen demonstrativ nur halbherzig an den Kampfhandlungen des Bündnisses teil.
Der Aufstieg Deutschlands schürt die Flammen des Krieges
Aber die aus Sicht des amerikanischen Imperialismus vielleicht gravierendste negative Folge des jetzigen Krieges ist die damit verbundene Verstärkung Deutschlands. Es ist auffallend, wie aktiv die deutsche Kriegsmaschinerie sich neben den Amerikanern am Krieg gegen Serbien beteiligt. Bereits bei der ersten Angriffswelle der NATO flogen deutsche Tornados in der ersten Reihe. Deutschland hat für die jetzige Operation mehr Flugzeuge zur Verfügung gestellt als beispielsweise England. Die ursprünglich für das Amselfeld vorgesehene, aus 12.000 Soldaten bestehende europäische "Friedenstruppe" der NATO, die heute z.T. in Mazedonien stationiert ist, besteht überwiegend aus je ca. 4.000 deutschen und britischen Bewaffneten.
Tatsächlich ergreift die deutsche Bourgeoisie heute besonders gern die Gelegenheit, um ausgerechnet ihren historischen Erbfeind Serbien zu bombardieren. Die USA können sich dieser Hilfe auch nicht erwehren. Washington ist jetzt sogar auf die Hilfe Deutschlands angewiesen, um politisch nicht allein dazustehen.
Indem es Jugoslawien militärisch schwächt, steigert Deutschland nicht nur sein imperialistisches Ansehen in der Welt. Im Gegensatz zu den USA fördert es damit zugleich seine strategischen Interessen in der Region. Durch diesen Krieg wird Deutschland erstmals seinem seit 1989 diskret ausgesprochenen Anspruch gerecht, die führende imperialistische Macht Europas zu sein.
Clinton und seine Berater wissen genau: ein Auseinanderfallen der Republik Jugoslawiens würde für Deutschland das Tor nach Südosten weit aufreißen. Dennoch haben die USA bislang kein Mittel gefunden, um diese Entwicklung wirkungsvoll einzudämmen. So haben die USA alles getan, um Deutschland und die Türkei - das Schüsselland der gesamten deutschen Südostpolitik - auseinanderzudividieren. So hat Washington Ankara immer wieder dazu aufgestachelt, eine nicht realisierbare EU-Mitgliedschaft einzufordern. Es hat zuerst mittels der Unterstützung der PKK, zuletzt durch seine Hilfe bei der Festnahme des PKK-Führers Öcalan versucht, die Kurdenfrage und damit die Bedrohung der staatlichen Einheit in den Mittelpunkt der türkischen Politik zu stellen, um Ankara von der Verfolgung gemeinsamer außenpolitischer Ziele mit Deutschland abzuhalten. Heute aber stehen Deutschland und die Türkei erstmals seit Jahrzehnten auf derselben Seite in einem Krieg, und zwar auf dem Balkan, wo beide Staaten wirklich gemeinsame Interessen haben. Es ist bedeutsam, dass mit Ausbruch des jetzigen Jugoslawienkrieges die deutsche Justiz in Köln einen gewissen Kaplan, (ein besonders berüchtigter "fundamentalistischer" türkischer Regimegegner) verhaften ließ.
Wir Marxisten verteidigen gerade heute das Prinzip der internationalen Arbeitersolidarität zwischen den Proletariern der kriegführenden Länder. Die Arbeiter Westeuropas und Nordamerikas und die Arbeiter des Balkans haben nur einen gemeinsamen Feind: den barbarischen niedergehenden Kapitalismus mit seinen blutrünstigen Vertretern von Clinton bis Milosevic, von Schröder bis Rugova.
In diesen finsteren Tagen der über die westeuropäische „Zivilisation“ hereinbrechenden anti-serbischen Kriegshetze rufen wir gerne die großartige internationalistische Haltung der proletarischen Revolutionäre Serbiens bzw. Jugoslawiens am Anfang dieses Jahrhunderts in Erinnerung. Als im August 1914 mit der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an das „kleine“ Serbien der 1. Weltkrieg begann, lehnte die Mehrheit der sozialistischen Abgeordneten im Belgrader Parlament die Kriegskredite ab – eine Haltung, die Lenin zu Recht vorbildlich nannte. Am Ende dieses grausamen Krieges gründeten diese Internationalisten die Kommunistische Partei Jugoslawiens und traten der Kommunistischen Internationalen bei. Im Angesicht der nationalistischen Hysterie auf dem gesamten Balkan vertrat diese Partei kompromisslos die Zukunft der Menschheit – die kommunistische Weltrevolution. Dafür wurden sie der erbarmungslosesten Verfolgung durch den neugegründeten jugoslawischen Staat ausgesetzt, wobei die Belgrader Regierung die tatkräftigste Unterstützung durch die westlichen Demokratien dafür erhielt. Später wurden die besten Vertreter dieser Partei gerade deshalb von der stalinistischen Konterrevolution gejagt, weil sie eben diese internationalistischen Prinzipien hochhielten (siehe „Das russische Rätsel“ von Anton Ciliga).
Heute bietet allein dieses Prinzip der weltweiten Solidarität des internationalen Proletariats einen Ausweg aus der Barbarei des imperialistischen Krieges. In dieser Tradition steht heute unsere Organisation, wenn wir heute - in 13 Ländern auf drei Kontinenten gleichzeitig – ein internationalistisches Flugblatt gegen den Krieg in Jugoslawien verteilen. 26.3.99
Zweimal in diesem Jahrhundert war Europa das Hauptschlachtfeld imperialistischer Weltkriege. Zweimal wurden die Arbeiter der Industriestaaten millionenfach dahingemordet. Zweimal gelang es der Bourgeoisie, die Proletarier aller Länder dazu zu bringen, einander blutig zu bekämpfen. Der imperialistische Krieg ist eine strenge Prüfung der Treue der revolutionären Kommunisten gegenüber der Arbeiterklasse. Hier wird von den Marxisten das Äußerste verlangt: die unbeugsame Verteidigung des proletarischen Internationalismus angesichts des repressiven Armes des Militarismus und der hysterischen kapitalistischen Kriegspropaganda. Zahlreich sind die Arbeiterorganisation, klangvoll oft die Namen der Revolutionäre, welche im Kriegsfall ihre Klasse verraten haben. Mit dem ersten Weltkrieg ging die Sozialdemokratie, mit dem zweiten Weltkrieg der Trotzkismus ins Lager des Kapitals über. Revolutionäre Führer wie Plechanow und Kautsky schlossen ihren Frieden mit dem blutrünstigen Imperialismus. Und dennoch gab es angesichts des Krieges mitunter auch die ruhmreichsten Sternstunden des Marxismus. Die furchtlose Verteidigung der internationalen Arbeitersolidarität durch Bebel und Wilhelm Liebknecht im Deutsch-Französischen Krieg 1870, durch Lenin und die Bolschewiki, durch Luxemburg, Karl Liebknecht und die Spartakisten im 1. Weltkrieg, durch kleine internationalistische Gruppen in Italien, Holland und Frankreich im 2. Weltkrieg werden unvergessen bleiben, solange es klassenbewusste Arbeiter gibt. Der jetzige Konflikt im ehemaligen Jugoslawien ist die größte Herausforderung des proletarischen Internationalismus seit dem Zusammenbruch des Ostblocks vor 9 Jahren. Bereits gegenüber dem Golfkrieg verteidigten die heute kleinen, aber entschlossenen marxistischen Gruppen den wirklichen Internationalismus. Nicht nur die IKS, auch die anderen Gruppen des revolutionären Milieus entlarvten die kapitalistische Linke, die Sozialdemokraten, Stalinisten und Trotzkisten, welche scheinmarxistische Phrasen droschen, um die Arbeiter auf Seiten einer der beiden Kriegsparteien zu ziehen (zumeist durch die "kritische" Unterstützung des Irak). Gruppen wie Battaglia Comunista und die CWO, Programma Comunista oder Il Comunista (Le Proletaire) haben, wie die IKS, auch gegenüber den Kriegen auf dem Balkan die internationalistische Haltung Lenins und Karl Liebknechts verteidigt.
Klar ist, dass die Frage des Krieges heute eine noch viel wichtigere Rolle spielen wird in der Entwicklung des Klassenbewusstseins als dies vor 1989 der Fall war. Da in der Zeit vor 1989 die Welt in zwei imperialistische Blöcken aufgeteilt war, die einander in Europa waffenstarrend gegenüberstanden, konnte ein größerer Krieg in Europa nur eine Ost-West-Konfrontation, d.h. ein Weltkrieg sein. Da das Proletariat aber für einen solchen Weltkrieg nicht zur Verfügung stand, entwickelte sich der Arbeiterkampf gegen die Krise stetig, aber in einem Kontext, wo es keinen Krieg in Europa gab. Heute ist das anders. Zwischen den Nationalstaaten herrscht das Treiben des "jeder gegen jeden". Zwar steht damit zunächst kein Weltkrieg auf der Tagesordnung. Dafür werden aber größere lokale Konflikte wie jetzt auf dem Balkan wieder möglich.
Aus Weltrevolution Nr. 94, Juni/Juli 1999
Jugoslawien Klassenkampf gegen den Krieg 22.05.1999
Was ist der wirkliche Grund für die NATO-Bombardierungen, für den täglichen Bombenhagel auf Serbien, Montenegro und Kosovo? Was ist der wirkliche Grund für diesen Krieg, an dem zum ersten Mal seit dem Ende des 2. Weltkriegs die europäischen Großmächte militärisch auf dem Boden Europas beteiligt sind, und das nur eine Flugstunde von Frankfurt entfernt?
Man erzählt uns, dass diese schreckliche Barbarei eine „humanitäre“ Aktion sei, um die Bevölkerung im Kosovo zu verteidigen und gar zu retten.
Beim Golfkrieg war es das Gleiche: es wurde behauptet, dass die Großmächte massiv militärisch eingriffen, um der Bevölkerung zu helfen, die unter einer grausamen Diktatur zu leiden hat. Die Medien und die Politiker geben vor, empört zu sein über die Schrecken der von Milosevic angeordneten „ethnischen Säuberungen“. Sie behaupten, tief betroffen zu sein über die Entdeckung von neuen Massengräbern im Kosovo. Sie lassen Krokodilstränen fließen über die Hunderttausenden von Flüchtlingen, die vor den Massakern fliehen und wie Vieh in verdreckten Lagern eingepfercht werden, wo Frauen, Kinder und Alte auf Hilfe oder ein provisorisches Visum warten, und wobei sie jeden Tag mit Hunger, Kälte und Krankheiten kämpfen müssen.
Aber das „humanitäre“ Argument, das von den Regierungen und den Medien vorgebracht wird, ist nichts als eine ekelhafte Lüge.
In Wirklichkeit verfolgen die Großmächte mit ihrem militärischen Eingreifen im ehemaligen Jugoslawien nur ihre nackten imperialistischen Interessen. Hinter der Fassade der Einheit zwischen den Großmächten spielt jede nationale Bourgeoisie ihre eigene Karte, versucht jeder imperialistische Hai seine eigene Einflußsphäre zu verteidigen und die seiner Rivalen auf dem Balkan zu untergraben, eine Zone, die schon seit mehr als einem Jahrhundert ein strategisch wichtiger Zankapfel ist.
Für die Großmächte lautet die wirkliche Frage, welche imperialistische Macht das Rennen gewinnen und welche Macht es schaffen wird, das Protektorat Kosovo zu kontrollieren, welches aus der schlussendlichen Aufteilung dieses Gebietes hervorgeht; genau wie es 1996 darum ging, wer von ihnen den größten Nutzen aus der Aufteilung Bosniens ziehen würde.
Die Heuchelei und der Zynismus der Großmächte
Der wirkliche Grund für diesen Krieg liegt weder in dem Streben nach Frieden in Europa noch in der Verteidigung der Menschenrechte. Es geht auch nicht um den Versuch der Großmächte, dem Chaos Einhalt zu gebieten, wie es die bürgerliche Propaganda behauptet.
In Wirklichkeiten geben die „Demokratien“ einen Scheißdreck um das Schicksal der Bevölkerung im Kosovo. Die Massaker und das Schicksal der Flüchtlinge lässt sie kalt. Die abgrundtiefe Verachtung seitens der Demokratien gegenüber der Bevölkerung, die als Geisel genommen wird und Opfer des Krieges ist, zeigt sich allein schon anhand der Sprache der Medien, der Politiker und Militärs, welche von „Kollateralschäden“ und „Unfällen“ sprechen, wenn sie über Tausende von Opfern in der Zivilbevölkerung – sowohl unter der serbischen Bevölkerung wie unter den albanischen Flüchtlingen – sprechen, die jetzt schon auf das Konto der Nato-Bombardierungen gehen. Die Heuchelei über die „ethnischen Säuberungen“ ist nicht weniger abstoßend. Die amerikanische, englische und deutsche Regierung wie viele andere haben vorbehaltlos Regime unterstützt, die ähnliche Massaker in Indonesien gegen die Chinesen, in der Türkei gegen die Kurden durchgeführt haben. Jüngst erst stellte in Frankreich eine Untersuchungskommission in einem Bericht „Kein einziger Zeuge darf überleben“ fest, dass der Völkermord in Ruanda - von der Hutu-Regierung ausgeführt – lange vorher geplant und abgesprochen worden war mit der französischen Regierung.
Diese schändliche Doppelmoral trifft auch auf das Milosevic-Regime zu. Heute wird er als der „Teufel“ in Person und als „Diktator von Belgrad“ dargestellt, genauso wie seinerzeit Saddam Hussein als „der Schlächter von Bagdad“ galt. Aber 1991 haben die USA, Frankreich und Großbritannien alle Milosevic unterstützt, als es darum ging, dem deutschen Vorstoß in Kroatien entgegenzutreten. Und England und Frankreich haben ihn weiter gegen den wachsenden Einfluss der USA (die in der Zwischenzeit auf die Seite Bosniens übergewechselt waren) verdeckt unterstützt. Unterdessen wurden ethnische Säuberungen von allen dortigen nationalistischen Cliquen – (den serbischen, bosnischen, kroatischen und der Clique im Kosovo) betrieben, mit jeweiliger Unterstützung durch die eine oder andere Großmacht.
Eine ideologische Vergiftungskampagne gegen die Arbeiterklasse
Aber was soll man von der steigenden Zahl von Kritiken an der Art und Weise der Intervention halten, die von den Medien und den bürgerlichen Politikern formuliert werden? So wird behauptet, Milosevics Durchhaltevermögen sei unterschätzt worden, oder umgekehrt dass die NATO überschätzt habe, dass die Bomben Milosevic abschrecken könnten. Oder dass die Intervention zu spät begonnen habe, weil Serbien die ethnische Säuberung im Kosovo seit drei Monaten geplant hatte. Diese Argumente belegen nur, dass der Zynismus und die Heuchelei der Bourgeoisie grenzenlos sind. Denn die „humanitäre Notlage“ der Kosovo-Albaner war nicht nur vorhergesehen, sondern sie ist von den Großmächten selber herbeigeführt worden. Mehr als 2 Jahre wussten die Großmächte von der Unterdrückung der Kosovo-Albaner, und sie waren sich sehr wohl im Klaren, dass eine Bombardierung die Unterdrückung nur noch verschärfen würde. Es waren gerade die Schreckensbilder der Vertreibungen und der Gewaltanwendungen, worauf die Großmächte warteten, um eine Rechtfertigung für ihren Krieg präsentieren zu können (den Umfragen zufolge), wogegen die Bevölkerung anfänglich gegenüber den Bombardierungen zögerte. Mehr noch: diese „unvorhergesehenen Schwierigkeiten“ werden als Vorwand genutzt, um noch mehr Material und Kräfte für die Angriffe einzusetzen.
Und wenn die NATO solange mit einer militärischen Intervention gewartet hat, obwohl die Repression schon mehr als 2 Jahre dauerte, dann nicht deshalb, weil sie irgendwelche Skrupel hätte, einen Krieg auszulösen und Zerstörung zu bringen. Dies geschah nur, weil die meisten der „Alliierten“, insbesondere die USA, froh waren, dass sie Milosevic die Drecksarbeit überlassen konnten, den Aufstand im Kosovo niederzuschlagen, und damit den Bestrebungen ihres Rivalen Deutschland entgegentraten, da Deutschland am meisten an der Unabhängigkeit des Kosovos und dem Projekt eines Großalbanien interessiert ist. Diese gleiche Methode wurde schon im Golfkrieg angewandt, als die amerikanische Bourgeoisie zunächst die Schiiten und Kurden zur Rebellion im Irak antrieb, und sie nachher schutzlos der Repression durch Saddam Hussein überließ, da die USA alles andere als einen kurdischen Staat und keinen weiteren pro-iranischen Staat wollten.
Die ganze gegenwärtige Kampagne über die „Fehler“ und „Schwierigkeiten“ der NATO, über die „Unwirksamkeit ihrer Luftangriffe“ und ihre „Unfähigkeit“, Milosevic zum Nachgeben zu zwingen, verfolgt vor allem das Ziel, die öffentliche Meinung weich zu klopfen, die Bevölkerung der Industriezentren, und vor allem die Arbeiterklasse für eine neue Eskalation in diesem imperialistischen Konflikt vorzubereiten: kurzum für den Einsatz von Bodentruppen. Es stimmt zwar, dass diese vielen Fragen zur Nato die Bemühungen der europäischen Rivalen der USA zum Ausdruck bringen, die absolute Autorität des Weißen Hauses infragezustellen. Aber gleichzeitig müssen alle nationalen Bourgeoisien die Arbeiterklasse dazu bringen, die militärische Eskalation zu schlucken. Deshalb kündigen sie schon an, dass „dieser Krieg lang und blutig“ sein wird, und sie blähen künstlich die erforderliche Zahl von Soldaten für die Bodentruppen auf, so dass ein Gefühl der Erleichterung aufkommt, wenn die tatsächlich notwendigen Zahlen verkündet werden. Die Bourgeoisie muss sich so stark bemühen, den Boden zu bereiten, weil sie weiß, dass die einzige Hürde für die Beschleunigung ihres Strebens hin zum Krieg die Arbeiterklasse der Industriezentren ist.
Die Arbeiterklasse wird bald mit der Tatsache konfrontiert werden, dass mit dem Einsatz von Bodentruppen Tausende von Arbeiterkindern in den Kämpfen getötet werden. Genauso wird vor allem die Arbeiterklasse die astronomische Rechnung für den Krieg zu bezahlen haben. Wenn man berücksichtigt, dass die Kosten des Krieges pro Tag alleine auf 200 Mio. $ geschätzt werden (von denen allein die Hälfte die USA tragen), wissen wir wie viele neue „Opfer“ die Bourgeoisie verlangen wird, und in welchem Maße die Erhöhung der Militärausgaben eine Kürzung der Sozialausgaben mit sich bringen wird.
Auch wenn bislang Informationen zurückgehalten oder entstellt werden über stattgefundene Proteste gegen die Kriegsmaschinerie Milosevics in Serbien, so zeigen die Mitte Mai bekannt gewordenen Proteste in verschiedenen Städten Serbiens, dass auch die serbische Arbeiterklasse keineswegs in „nationaler Eintracht“ hinter dem Klassenfeind Milosevic steht, sondern anfängt, ihre Unzufriedenheit auszudrücken. Fest steht jetzt schon: diese Bewegung kann nur eine wirkliche Perspektive erhalten, wenn die Arbeiterklasse in den Industriezentren Westeuropas und in den USA den Druck auf die Kapitalistenklasse mächtig erhöht.
Die Arbeiterklasse ist nicht einfach Opfer des Krieges. Sie ist die einzige internationalistische Klasse in der Gesellschaft. Sie ist die einzige Kraft, die durch einen rücksichtslosen Abwehrkampf gegen die verschärften Angriffe des Kapitals auf seine Lebensbedingungen das weitere Abgleiten in die militärische Barbarei verhindern kann. Sie ist als einzige Klasse dazu in der Lage, dieses todbringende System zu zerstören und die Tür aufzustoßen für eine menschliche Gesellschaft. 22.5.99
Rot/Grün: Speerspitze des deutschen Militarismus 20. 05.1999
Als der deutsche Imperialismus das letzte Mal vor mehr als einem halben Jahrhundert seine Streitkräfte in den offenen Krieg schickte, hieß die verantwortliche Regierungspartei NSDAP, der Regierungschef Adolf Hitler. 54 Jahre danach führt der deutsche Imperialismus unter einer Koalitionsregierung von SPD und Bündnis 90/Die Grünen mit einem Kanzler Schröder wieder Krieg in Europa.
1933 kam die NSDAP inmitten der Weltwirtschaftskrise an die Regierung, weil diese Partei damals am besten geeignet war, um im Interesse des deutschen Kapitals Krieg zu führen.
1998 gewannen Rot-Grün inmitten der Weltwirtschaftskrise die Bundestagswahlen nicht zuletzt, weil diese Parteien am besten geeignet sind, um im Interesse des deutschen Kapitals Krieg zu führen.
1933 - 15 Jahre nachdem die internationale proletarische Erhebung 1917-18 den 1. Weltkrieg beendet hatte - war die Widerstandskraft der Arbeiterklasse gebrochen. Der Weg zum erneuten Weltkrieg lag somit offen. Weil seine Lage von allen Großmächten am verzweifelsten war, musste Deutschland den 2. Weltkrieg beginnen und diesen Krieg mit unerbittlicher Härte gegenüber der Übermacht seiner Rivalen führen. Dafür war die NSDAP Hitlers die geeignete Partei. 1999 ist - 10 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges - der imperialistische Krieg in Europa wieder unvermeidbar geworden. Das wiedervereinigte Deutschland will wieder die imperialistische Führungsmacht Europas werden und fordert somit seine europäischen Rivalen genauso wie die Weltmacht USA heraus. Der Balkan ist ein entscheidender Schauplatz dieses Kampfes.
Aber 1999 ist die internationale Arbeiterklasse noch nicht geschlagen. Der Weg zum Weltkrieg steht nicht offen. Außerdem, Deutschland
besitzt noch lange nicht die notwendigen Machtmittel, um seine Hauptrivalen, um vor allem die USA offen und militärisch herauszufordern: weder die entsprechenden Waffensysteme noch das erforderliche Bündnissystem eines imperialistischen Blockes. Andererseits aber befindet sich Deutschland gegenüber seinen Rivalen auch nicht in der verzweifelten Lage von 1933.
Weil die Arbeiterklasse nicht geschlagen ist, weil "lokale" Kriege und nicht der Weltkrieg anstehen, können und müssen die imperialistischen Kriege von heute als "humanitäre Missionen" verkauft werden. Alle westlichen Großmächte führen heute nur noch Krieg im Namen der "Demokratie" und der "Menschenrechte". Das ist einer der Gründe, weshalb fast alle am Jugoslawien-Krieg beteiligten NATO-Staaten von linken Regierungen in den Krieg geführt werden. Die"Linken", die "humanistischen" und "pazifistischen" Heuchler, welche die "Freunde des kleinen Mannes" sein wollen, sind am besten geeignet, um die imperialistische Barbarei auf diese Weise zu verkaufen.
Aber in keinem Land der Welt ist eine linke Regierung für die kapitalistische Kriegsführung so wichtig wie heute in Deutschland. Nach Jahrzehnten der unfreiwilligen Abwesenheit von den blutigen Schlachtfeldern dieser Welt muss Deutschland heute dort anknüpfen, wo es in zwei Weltkriegen aufgehört hatte. Z.B. auf dem Balkan, wo heute die deutsche Luftwaffe - nicht mehr unter Göring, sondern unter Scharping - Belgrad bombardieren lässt. Für die deutsche Bourgeoisie, die Bourgeoisie von Auschwitz ist das ein Problem - nicht nur im Hinblick auf die Arbeiterklasse, die heute nicht für den generalisierten Krieg mobilisiert ist. Die imperialistischen Rivalen Deutschlands benutzen die Erinnerung an die Rolle Deutschlands in den Weltkriegen, um die Rolle Deutschlands in den Kriegen von heute einzuengen.
In dieser Hinsicht besitzt die Rot-Grüne Kriegsregierung heute eine politische Bedeutung für das deutsche Kapital, die weit über den jetzigen Balkankonflikt hinausragt. Rot-Grün ist derzeit die unverzichtbare politische Waffe des deutschen Kapitals, um die Behinderungen seiner Kriegsziele, welche von der Vergangenheit herrühren, möglichst abzuschütteln. Indem rechtzeitig zum ersten heißen Kriegseinsatz eine Regierung aus Sozialdemokraten und Pazifisten eingesetzt wurde, soll ein radikaler Bruch mit der militaristischen Vergangenheit des deutschen Imperialismus suggeriert und eine andere, demokratische und antifaschistische, - dazu noch zutiefst nationale Kriegsideologie - geschmiedet werden. Dazu eignet sich prächtig die blutrünstige Sozialdemokratie, welche bereits im 1. Weltkrieg entscheidend dazu beitrug, die Arbeiterklasse für die Schlachtbank zu mobilisieren. Dazu eignen sich nicht weniger die Friedensbewegten von den Grünen mit ihrer "Basisdemokratie" und ihrem "Pazifismus“, um den Krieg als einen „gerechten“ zu rechtfertigen.
Gegenwärtig wird von den verschiedenen Medien und Propagandaministerien so getan, als ob die neue Bundesregierung von den kriegerischen Zuspitzungen überrascht wäre, als ob die Regierungsparteien nur ungern, zähneknirschend ihren Kriegspflichten aus „Bündnistreue“ nachkämen. In Wahrheit ist Rot-Gün derzeit nicht weniger unentbehrlich für den Kriegskurs des Vaterlandes als damals Hitler und die NSDAP. Die Bedeutung der neuen Regierung fand dennoch ihre Würdigung in einem Editorial der Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 07.05.99. Die Linken an der Regierung sollen dafür bürgen, dass heute die deutsche Bourgeoisie, die Bourgeoisie von Auschwitz auf der "richtigen Seite" steht. "Der Kosovo-Krieg markiert nicht nur das Ende einer linken Protest- und Widerstandskultur, sondern er ist auch deren Fortsetzung mit anderen Mitteln.(...) 1968 holte man den Widerstand gegen den "Faschismus", den die Väter versäumt hatten, mit Demonstrationen, Sit-ins und Happenings nach. Heute blickt man, so sagt es der Verteidigungsminister, im Kosovo in die böse Fratze der deutschen Vergangenheit und bekämpft einen blutigen ethnischen Nationalismus kriegerisch im Verein mit dem mächtigsten Militärbündnis der Welt. Die jugoslawische Armee erscheint als Wiedergängerin der Wehrmacht (..) Der erste Kriegseinsatz der Bundeswehr zertrümmert deren Traditionszusammenhang mit der Wehrmacht wirkungsvoller als der radikalste Traditionserlass tun könnte, den ein sozialdemokratischer Verteidigungsminister sich ausdenkt. So erlebt der "Antifaschismus", der als Ideologie totalitärer Diktaturen und antidemokratischer Parteien eine erbärmliche Lüge war, in neuer Form einen unverhofften Frühling."
Die wahren Kriegsgründe 23.04.1999
“Dieser neue Krieg, der jetzt im ehemaligen Jugoslawien mit den NATO-Bombardierungen Serbiens, Kosovos und Montenegros ausgelöst wurde, stellt auf der imperialistischen Bühne das wichtigste Ereignis seit dem Zusammenbruch des Ostblocks Ende der 80er Jahre dar. Die Gründe dafür sind:
- Dieser Krieg findet im Gegensatz zum Golfkrieg 1991 nicht in einem Land der Peripherie sondern in Europa statt.
- Zum ersten Mal seit dem 2. Weltkrieg wird ein Land in Europa - und insbesondere die Hauptstadt - massiv bombardiert.
- Zum ersten Mal greift das Land, das der Hauptverlierer des 2. Weltkriegs war, Deutschland, militärisch direkt in die Kampfhandlungen ein.
Dieser Krieg stellt einen weiteren, schwerwiegenden Schritt im Destabilisierungprozess Europas dar, mit gewaltigen Auswirkungen auf die Zuspitzung des weltweiten Chaos.”
(Resolution zur internationalen Situation, 13. Kongress der IKS, April 1999, Punkt 1)
Die imperialistischen Rivalitäten unter den Großmächten sind für den jetzigen Krieg verantwortlich
“Einer der Aspekte, der am meisten die große Tragweite des jetzigen Krieges verdeutlicht, ist gerade die Tatsache, dass er im Zentrum des Balkans stattfindet, der seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts als das Pulverfass Europas bezeichnet wird (...)
Deshalb zeigte die sehr offensive Haltung Deutschlands gegenüber dem Balkan unmittelbar nach dem Zusammenbruch des Ostblocks (...), dass diese Region erneut zu einem Hauptkonfliktfeld der Zusammenstöße zwischen den imperialistischen Mächten in Europa geworden war.
Heute belegt ein weiterer Faktor den Ernst der Lage. Im Gegensatz zum Ersten oder gar zum Zweiten Weltkrieg behaupten die USA ihre militärische Präsenz in diesem Teil der Welt. Die größte Macht der Welt konnte sich von einer der Hauptbühnen der imperialistischen Zusammenstöße in Europa und im Mittelmeer nicht fernhalten, womit sie ihre Entschlossenheit zum Ausdruck brachte, in allen entscheidenden Gebieten präsent zu sein, wo die unterschiedlichen imperialistischen Interessen aufeinanderprallen.”(ebenda, Punkt 2)
Zu einem Zeitpunkt, wo der 50. Jahrestag der NATO-Gründung gefeiert wurde, die NATO-Luftangriffe gegen den als Nr. 1 deklarierten Hauptfeind Milosevic nun schon mehrere Wochen dauern, und die Alliierten eine weitere Intensivierung der Angriffe angekündigt haben, mit dem eventuellen Einsatz von Bodentruppen, - der – falls er stattfindet – sehr lange dauern und viele Toten auf beiden Seiten hinterlassen wird, treten alle Widersprüche und imperialistischen Spannungen unter den “Verbündeten” wieder ans Tageslicht. Die Fassadeneinheit um die Operation “Entschlossene Kraft” ist dabei zu bröckeln und wird langfristig auseinander brechen. Denn eines der neuen Merkmale dieses Krieges besteht darin, dass “die gegenwärtige Form des Krieges (alle NATO-Länder gegen Serbien) nicht die wirklichen Interessensgegensätze, die zwischen den verschiedenen Kriegsteilnehmern bestehen, widerspiegelt.” (ebenda, Punkt 3)
Dieser Krieg verdeutlicht die Rivalitäten und die Spannungen zwischen den imperialistischen Gangstern, die sich um die Überreste des im Zerfall begriffenen ehemaligen Jugoslawien streiten.
Das wiedervereinigte Deutschland, das seinen neuen Platz in der imperialistischen Hackordnung in Europa gemäß seiner Wirtschaftskraft einnehmen wollte, hat 1991 das Feuer an die Lunte auf dem Balkan gelegt, als es damals seine Bauern im Schachspiel – Slowenien und Kroatien – dazu drängte, ihre Unabhängigkeit zu erklären, womit Deutschland einen strategisch wichtigen Zugang zum Mittelmeer und eine Öffnung hin zum Nahen Osten erhielt. Alle seine Hauptrivalen (USA, Großbritannien, Frankreich, Russland) sind gegen diese Bestrebungen Deutschlands angetreten, indem sie den “schrecklichen Diktator” Milosevic materiell und militärisch im mörderischen Krieg gegen Kroatien unterstützt haben. Am Ende dieser Konfrontation 1992 musste Kroatien hinnehmen, dass fast ein Drittel seines Territoriums von der serbischen Armee und Milizen kontrolliert wurde.
1993 leitete der Ausbruch des Bosnien-Konfliktes eine neue, noch blutigere Etappe in der Auseinandersetzung unter den Rivalen ein. Die imperialistischen Ambitionen wurden durch die Anwesenheit von drei ethnischen Gruppen verschärft, welche gegeneinander aufgestachelt wurden: die Kroaten, die immer von Deutschland unterstützt wurden, die Serben, die von Russland, Frankreich und Großbritannien unterstützt wurden, die Bosnier, die offen von den USA verteidigt wurden (welche sich von 1992 an für die Unabhängigkeit Bosniens ausgesprochen haben). Diese Lage hat die Tendenz des “jeder für sich” gefördert, die den unterschiedlichen imperialistischen Interessen der anwesenden Rivalen entsprach. Insbesondere haben die Initiativen der “zweitrangigen” Staaten wie Frankreich und Großbritannien (Großbritannien bestätigte damals den Bruch seiner historischen Allianz mit den USA), die ihre Präsenz in der Region verteidigen wollen, am stärksten mit zur Eskalation des Konfliktes beigetragen. Die direkte Besatzung des Terrains durch britische und französische Truppen zunächst in UN-Uniformen, dann unter jeweils eigener Nationalfahne durch die ‚Schnellen Eingreiftruppen‘ war sehr stark mit ausschlagend, um die US-Bestrebungen zu vereiteln, mit Hilfe ihrer bosnischen Verbündeten vor Ort fest Fuß zu fassen. Ihre Vorgehensweise, die Aktionen der Bosnier zu behindern oder zu lähmen und der Offensive der serbischen Armee Rückendeckung zu geben, hat die amerikanische Bourgeoisie dazu gezwungen, einerseits direkt in den Konflikt einzugreifen, unter dem Deckmantel der “Hilflosigkeit der Europäer, den Frieden herzustellen”, andererseits haben die USA sich vorübergehend mit Deutschland in einer “kroatisch-moslemischen Föderation” zusammengeschlossen. Die USA haben schließlich ihre Gegenoffensive durch Gewaltanwendung durchgesetzt, indem sie 1995 in Bosnien für den Abzug der UNO-Truppen durch die ersten Bombardierungen Bosniens durch die NATO sorgten.
Den USA gelang es auf Kosten der Zerstückelung des Territoriums, die Lage in Bosnien zu stabilisieren, indem sie direkt mit Milosevic verhandelten und das zerbrechliche Daytoner Abkommen von 1996 durchsetzten. Aber der seinerzeit von den USA mit dem Zustandekommen dieses Abkommens erzielte Sieg war kein endgültiger Sieg in diesem Teil der Welt. Genauso wenig konnte damit die allgemeine Tendenz der Abschwächung ihrer Vorherrschaft in der Welt aufgehalten werden.
Die gleichen Widersprüche, die vorher schon den Zusammenprall unter den Großmächten bewirkten, insbesondere unter den Ländern der “Kontaktgruppe” (Deutschland, USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, Russland), die angeblich im ehemaligen Jugoslawien den “Frieden sicherstellen” sollen, und die schon in verschiedenen Eigenschaften mit vielen Truppen militärisch präsent sind, sind direkt für die Eskalation des Kosovo-Konfliktes verantwortlich. Das Scheitern der Konferenzen von Rambouillet und Paris ist nicht nur zurückzuführen auf die “Unnachgiebigkeit Milosevics” und dessen Weigerung, dem Kosovo einen Autonomiestatus zu verleihen. Der “Diktator von Belgrad” hat übrigens genauso wie seinerzeit Saddam Hussein die unterschiedlichen Interessen zwischen seinen Gegnern geschickt ausgenutzt.
Die Flucht nach vorne in den Krieg und wachsende Schwierigkeiten für alle Beteiligten
Deutschland hat erneut die UCK zur Rebellion getrieben. Die USA haben mit den Bombardierungen losgeschlagen, um ihre Autorität als Weltpolizist zu verteidigen, obgleich sie das militärische Eingreifen monatelang hinausgezögert hatten, in der Hoffnung, mit Milosevic handeln zu können, nachdem man diesen zuvor die Kosovo-Rebellen hatte niederschlagen lassen. Gegenüber Deutschland war die amerikanische Bourgeoisie nämlich überhaupt nicht daran interessiert, dass ein unabhängiges Kosovo geschaffen würde. Die militärische Karte der USA, so wie sie heute von diesen gespielt wird, ist auf das Scheitern der diplomatischen Option (mit der militärischen Erpressung) zurückzuführen, wie es die Mission des amerikanischen Sondergesandten Holbrooke bei Milosevic verdeutlichte, die als diplomatischer Versuch “im letzten Augenblick” wenige Tage vor der Auslösung der militärischen Angriffe durch die NATO gestartet worden war.
Ein Monat nach Beginn der Bombardierungen durch die NATO hat diese Flucht nach vorne in den Militarismus eine ganze Reihe von wachsenden Schwierigkeiten für die am Konflikt beteiligten Großmächte mit sich gebracht.
Für Russland bedeutet die Intervention der NATO gegen Serbien, seinen traditionellen Verbündeten, eine wahre Provokation, die es nur noch mehr destabilisieren kann. Die von Russland immer wieder geäußerten “Drohungen” können kaum seine Hilflosigkeit übertünchen. Sein Wunsch, Serbien zu Hilfe zu eilen, wird durch die völlige wirtschaftliche und finanzielle Abhängigkeit des ehemaligen Blockführers von den westlichen “Zahlungen” vereitelt. Insbesondere reichte es aus, dass der IWF damit drohte, den Geldhahn zuzudrehen, um es zur “Vernunft” zu bringen. Russland ist heute dazu verdammt, eine rein diplomatische Rolle zu spielen; es musste sich gar entwürdigen lassen und als Emissär für die Forderungen der NATO (das Bündnis, das 40 Jahre lang zur Aufgabe hatte, den russischen Imperialismus zu bekämpfen) gegenüber seinem serbischen Verbündeten auftreten. Die Lähmung der Autorität Moskaus kann die vielen Republiken der russischen Föderation nur dazu verleiten, die Zentralregierung in Moskau herauszufordern.
Sicher hat Deutschland am Anfang des Konfliktes einen bedeutenden Punktgewinn erzielen können, nachdem ihm die NATO einen Deckmantel bot und es ihm ermöglichte, das implizite Verbot zu umgehen, das seit seiner Niederlage im 2. Weltkrieg bestanden hatte, außerhalb seiner Grenzen militärisch einzugreifen.
Weil die gegenwärtige Operation gegen Serbien, Erzfeind Deutschlands und Sperrriegel für dessen Vorrücken auf dem Balkan Richtung Naher Osten, gerichtet ist, dient diese den Interessen des deutschen Imperialismus, vor allem, wenn sie durch die Abtrennung des Kosovos zur Zerstückelung der jugoslawischen Föderation und Serbiens selber führen sollte.
Jedoch sind die USA nun gegenüber Deutschland in ein direktes Konkurrenzverhältnis bei der Unterstützung der UCK getreten. Die USA haben es nämlich geschafft, große Teile der Rebellen auf “ihre Seite zu ziehen”, indem sie ihnen hochmoderne Waffen und eine militärische Schnellausbildung gewährt haben.
Die in Vorbereitung befindliche Bodenoperation dient darüber hinaus nicht den imperialistischen Interessen der deutschen Bourgeoisie, denn sie läuft Gefahr, dass die anderen Mächten ihr zuvorkommen, da Deutschland für die Entsendung von Bodentruppen nicht gut vorbereitet ist (auch nicht, was das ideologische Weich klopfen der Bevölkerung angeht). Daraus entsteht für Deutschland ein Nachteil.
Aus der Sicht Großbritanniens und Frankreich hätte eine Nichtbeteiligung an der Operation “Entschlossene Kraft” geheißen, dass sie von Anfang an aus einer so strategisch wichtigen Region herausgeschmissen worden wären. Die Rolle, die sie bei einer diplomatischen Lösung der Jugoslawienkrise spielen könnten, hing vom Umfang ihrer Beteiligung an den militärischen Operationen ab. Aber der Widerspruch zwischen ihrem traditionellen Bündnis mit Serbien und dem gegenwärtigen kriegerischen Eingreifen, zu dem sie gezwungen wurden, untergräbt ihre Glaubwürdigkeit als Großmächte und ihre Fähigkeit, als zuverlässige Verbündete zu handeln, sehr stark. Diese beiden Gangster, die noch durch gemeinsame Interessen miteinander verbunden sind, haben keine andere Wahl als die Karte des Einsatzes von Bodentruppen voll auszuspielen, da sie nur so die Gelegenheit ergreifen können, vor Ort in irgendeiner Form präsent zu sein, und da sie nur so ihre Hauptrivalen, die USA und Deutschland, schädigen können.
Was die USA angeht, so wird deren Vorherrschaft und ihr Anspruch, weiterhin weltweit die Gendarmenrolle zu spielen, gar auf der Ebene untergraben, wo sie bislang ihre erdrückende Überlegenheit einsetzen konnten: auf militärischer Ebene. So bedeuten die zahlreichen Kritiken der letzten Zeit, vor allem von Seiten Großbritanniens und Frankreichs an der Durchführung der militärischen Operationen durch die NATO und der Vorschlag einer Machtverlagerung hin zur UNO oder gar zur OSZE (das noch in den Kinderschuhen steckende Projekt einer gemeinsamen europäischen Verteidigung, die bislang unter strenger NATO-Kontrolle stand) implizit eine Infragestellung der Führung und der ausschließlichen Kontrolle dieser Operationen durch die USA. Um ihr Image als Weltpolizist und ihre Rolle als erste Großmacht der Welt zu verteidigen, sind die USA gezwungen, ihre militärische Karte bis zum Ende auszuspielen, ungeachtet der großen Risiken, in dem Krieg zu versinken. Nachdem sie mehr als einen Monat lang wiederholt hatten, dass sie keine Bodentruppen schicken würden oder dass sie dagegen wären, müssen sie heute ihre früheren Aussagen widerrufen und unter dem Druck von Frankreich und Großbritannien das Szenario ins Auge fassen, gegenüber dem sie am meisten gezögert haben: die Vorbereitung des Einsatzes von Bodentruppen. Dieses Schwanken und die mangelnde Kontrolle hebt sich besonders stark von der Lage im Golfkrieg 1991 ab; damals lag das Szenario, das die USA erstellt hatten, von der ersten bis zur letzten Zeile von vorne herein fest.
Der Krieg, der jetzt ausgelöst wurde, birgt darüber hinaus die Gefahr in sich, ernsthafte Spannungen in den Reihen der Bourgeoisie verschiedener europäischer Staaten hervorzurufen.
Innerhalb der französischen Bourgeoisie hat der Krieg Risse innerhalb der meisten Parteien hervorgerufen, insbesondere innerhalb des RPR, deren Präsident mit einem großen Paukenschlag zurücktrat. Dies ist direkt auf den Widerspruch zwischen der traditionellen Bindung an Serbien und der Beteiligung an den NATO-Schlägen zurückzuführen. Dieser gleiche Spalt ist ebenso innerhalb der britischen Bourgeoisie zu erkennen; dort verwerfen einige konservative Fraktionen die Infragestellung des historischen Bündnisses mit Serbien. Die “pazifistische” Bewegung und die gegen die NATO gerichteten Stellungnahmen sind auf das größte Echo innerhalb der italienischen Bourgeoisie gestoßen, in deren Reihen ein Teil dazu neigt, die Stellung Italiens innerhalb der NATO-Struktur infragezustellen, da Italien wegen seiner geographischen Nähe zum Kriegsschauplatz besonders unter den Nebenwirkungen des Krieges leidet. Dies kann die Risse innerhalb dieser Bourgeoisie nur noch vergrößern und die Anhänger einer pro- oder anti-amerikanischen Orientierung nur noch mehr polarisieren.
Europa versinkt im kriegerischen Chaos
Diese unausweichliche Flucht in den Krieg kann nur zu einer noch größeren Zuspitzung des Chaos auf der Welt führen. Und ein Einsatz von Bodentruppen mit jeweils unterschiedlichen Interessen der beteiligten Konkurrenten wird ebenso die Dynamik des “jeder für sich” beschleunigen.
Hinsichtlich zukünftiger Verhandlungen mit Milosevic gibt es schon verschiedene Pläne zur Aufteilung des Kosovos; ein Plan wurde von den USA erstellt, ein anderer von Frankreich ausgebrütet, ein dritter schließlich stammt aus Deutschland. Ein Einsatz von Bodentruppen wird schließlich den gesamten Balkan weiter destabilisieren. Alle Bedingungen sind vorhanden, damit der imperialistische Beutezug im Kosovo zu einer Beschleunigung des Chaos führt. Der wichtigste Teil des Balkans, Serbien, steht vor der Gefahr, auseinander gerissen zu werden, während die Möglichkeit der Auflösung der Überreste des ehemaligen Jugoslawien (Serbien und Montenegro) in greifbare Nähe rückt.
Die Zunahme von NATO-feindlichen Demonstrationen in Mazedonien, wo viele westliche Truppen stationiert sind (und wo die Bevölkerung schon französische Truppen angegriffen hat) weist auf die Gefahr hin, dass diese Region ihrerseits wiederum von diesem Feuer erfasst wird und im Chaos versinkt. Darüber hinaus aber würden neben diesem Land, dessen Bevölkerung hauptsächlich aus Griechen und einer großen Minderheit bulgarischen Ursprungs zusammengesetzt ist, Bulgarien und Griechenland direkt in die Kriegsspirale mit hineingezogen. Mit der möglichen Beteiligung der Türkei, die dazu versucht sein könnte, ihre alten Streitigkeiten mit ihrem Erzfeind Griechenland zu regeln, beinhaltet die gegenwärtige Krise die Gefahr, einen wahren Flächenbrand in der ganzen Balkanregion und einem beträchtlichen Teil des Mittelmeers auszulösen. Jetzt schon hat der Krieg den Schiffsverkehr auf der Donau lahm gelegt, womit die Wirtschaft Bulgariens und Rumäniens in Mitleidenschaft gezogen wird und Gefahr läuft zu ersticken. Aber die Spirale des Chaos und das Ausufern des Krieges - immer weniger kontrolliert und immer mehr Nahrung erhaltend durch die Auseinandersetzungen zwischen den großen westlichen “Demokratien” - werden nicht nur die Balkanstaaten erfassen, sondern eine tief greifende Destabilisierung des europäischen Kontinentes mit sich bringen.
CY 23.04.99
Die Extreme Linke – nationalistische Kriegstreiber 20.05.1999
Im Krieg muss jede politische Gruppierung Farbe bekennen. In dieser Ausgabe von Weltrevolution haben wir über die entschlossene und unzweideutige internationalistische Position der Gruppen der Kommunistischen Linken berichtet. Im Gegensatz dazu stehen die Positionen der Gruppen der extremen kapitalistischen Linken, die sich mit dem Namen ‚revolutionär‘ schmücken, in Wirklichkeit aber verdeckte Kriegstreiber sind.
Diese linkskapitalistischen Gruppen decken ein ganzes Spektrum ab. Eine Gruppierung beispielsweise kritisiert eher die Nato und die Großmachtpolitik der USA ein. So brandmarkt die trotzkistische Gruppe Linksruck die Rolle der USA, die keinen „Widerspruch gegen die US-Weltherrschaft dulden werden, egal ob von großen oder kleinen Staaten... Die USA versuchen aber, die Nato-Staaten wieder auf Linie zu bringen, indem sie klarmachen, daß sie die einzigen sind, die als Weltpolizist agieren können.“ (Linksruck, Mai 99) Diese Gruppe, die vor den Wahlen noch frenetisch auf Stimmenfang für die kapitalistische SPD ging, hält sich bezeichnenderweise sehr zurück, wenn es darum geht, die kriegstreibende und destabilisierende Rolle Deutschlands bloßzustellen. Eine andere trotzkistische Gruppe, „Voran“, tritt wiederum vehement für ein „unabhängiges, sozialistisches Kosovo ein“. Im Kosovo unterstützen wir die Separation, die Bildung eines unabhängigen Staates.“ (Voran, Mai 99) Dass die Bildung eines angeblich „unabhängigen“ Kosovo den Interessen des deutschen Imperialismus dient, der gerade auf eine Zerstückelung Restjugoslawiens abzielt, stört diese Leute nicht im Geringsten, sondern weist sie als treue Vasallen des deutschen Kapitals aus.
Im Gegensatz zu diesen Gruppierungen, die die Stoßrichtung der deutschen Regierungspolitik „kritisch“ unterstützen, stellt ein anderer Flügel dieser linkskapitalistischen Gruppen dagegen vor allem die deutschen imperialistischen Ambitionen an den Pranger. Mit dem Spruch Liebknechts aus dem 1. Weltkrieg auftretend, „der Hauptfeind steht im eigenen Land“, wollen sie sich als konsequente Internationalisten präsentieren. Aber sind sie wirklich entschlossene Kriegsgegner?
Auf einer Diskussionsveranstaltung in Köln zeigten z.B. eine Vertreterin der Ökologischen Linken, Jutta Dittfurth und der stalinistische Publizist Stefan Eggerdinger, wie viel Blut an den Fingern des deutschen Imperialismus klebt. Insbesondere betonten sie, wie die Zersetzung Jugoslawiens durch Deutschland systematisch vorangetrieben wurde und welche kriegstreibenden Wirkungen dies hatte. Aber während diese Leute sich alle Mühe geben, die „Schandtaten“ des deutschen Imperialismus anzuprangern, verlieren sie kaum ein Wort über die andere Kriegsseite – über Serbien, sowie über die anderen Rivalen Deutschlands in der Nato. Diese Argumentation läuft darauf hinaus, nicht das kapitalistische System insgesamt, sondern allein Deutschland als Ursache des Krieges hinzustellen.
Während die USA durch die Auslösung des jetzigen Krieges um ihre globale Vorherrschaft auf der Welt kämpfen, und sie bereit sind, dafür grenzenlose Zerstörung anzurichten, raufen sich die europäischen Rivalen um ihre Einflußgebiete auf dem Balkan. Wie an anderer Stelle in dieser Zeitung aufgezeigt, will Deutschland Serbien auseinanderreißen; dabei hat es sich immer wieder auf Kroatien stützen können; gleichzeitig ist es auf die deutschen Rivalen – Frankreich, Großbritannien und Russland gestoßen, die jeweils Serbien unterstützt haben. Dieser Krieg ist also ein Krieg aller europäischen Rivalen und der USA. Nach dem Ende der Blöcke nach 1989 heißt die Devise nun: jeder gegen jeden! Es stimmt zwar, dass dadurch die Lage viel komplexer und unübersichtlicher wird, der Frontenverlauf damit nicht mehr so deutlich erkennbar wird. Die Kriegstreiberrolle aber nur einer Seite zuzuschieben, die imperialistischen Ambitionen der jeweiligen Kriegsgegner zu vertuschen, bedeutet das eigentliche Ausmaß des kriegerischen Überlebenskampfes dieses dekadenten Systems zu verharmlosen. Man muss also die imperialistischen Ambitionen aller Rivalen aufdecken! Indem sie das nicht tun, verschweigen diese Gruppen, dass das kapitalistische System selbst den Imperialismus hervorbringt.
„Der Hauptfeind steht im eigenen Land“ – die Gefahr der Irreführung der Arbeiterklasse
Der Schlachtruf „Der Hauptfeind steht im eigenen Land“ wurde von Karl Liebknecht im 1. Weltkrieg dem Verrat der SPD entgegengeschleudert. Damals hatte eine Reihe von ehemaligen Arbeiterparteien die Interessen der Arbeiterklasse verraten und jeweils ihre eigene nationale Bourgeoisie unterstützt. Damals trat noch keine der ehemaligen Arbeiterparteien auf, um die andere Kriegsseite zu unterstützen, sondern sie schlugen sich jeweils auf die Seite der eigenen nationalen Bourgeoisie.
Somit war die Parole „Der Hauptfeind steht im eigenen Land“ damals ein Mittel, um das internationalistische Lager des Proletariats entschieden gegenüber den sozialdemokratischen Vaterlandsverteidigern abzugrenzen. Allerdings war bereits damals diese Parole Liebknechts nicht die klarstmögliche Formulierung der internationalistischen Haltung der Marxisten, da die Idee eines Hauptfeindes zumindest implizit die Tür offenließ für den Gedanken, dass es neben dem Hauptfeind einen Nebenfeind geben kann, womit nicht alle imperialistischen Seiten im gleichen Maße zu bekämpfen wären. So lehnte der holländische Linkskommunist Herman Gorter bereits 1915 in seiner Schrift „Die Ursachen des Nationalismus im Proletariat“ die Idee eines ersten und zweiten Feindes ab und betonte die Notwendigkeit, alle Kriegsfronten abzulehnen. Und während im 2. Weltkrieg auch im Lager der Internationalisten beispielsweise Amadeo Bordiga den US-amerikanischen Imperialismus zum Hauptfeind erklärte, die Revolutionären Kommunisten Deutschlands (RKD) hingegen den sowjetischen Imperialismus, übernahmen andere proletarische Internationalisten, die in ihrer Haltung gegenüber dem Krieg klarer waren, den oben erwähnten Standpunkt Gorters.
Denn im Gegensatz zum 1. Weltkrieg gab es im 2. Weltkrieg bereits viele politische Strömungen der Bourgeoisie, welche die Unterstützung der „eigenen Regierung“ verwarfen, um stattdessen das gegnerische Lager zu unterstützen. Dies traf insbesondere auf die Stalinisten und Trotzkisten am Anfang des Weltkrieges zu, als noch nicht deutlich abzusehen war, auf welcher Seite die UdSSR in den Krieg treten würde.
Genau dies war z.B. im 2. Weltkrieg in Deutschland ab 1941 mit dem Ende des Hitler-Stalin-Paktes der Fall, als „antifaschistische“ und überwiegend stalinistische Kräfte gegenüber dem Hitler-Regime dessen Sturz forderten. Sie wünschten die Niederlage der „eigenen Bourgeoisie“, damit das vom Hitler-Faschismus „befreite“ Deutschland ein Bündnis mit der Sowjetunion gegen die USA einginge. Die Gruppe „Komitee Freies Deutschland“, die von Ulbricht & Co angeführt wurde, bezeichnete Hitler als den Hauptfeind. Ihre Haltung war keineswegs die des proletarischen Internationalismus, also Kampf gegen beide imperialistischen Seiten, sondern eine offen patriotische, da sie aus Sorge um das nationale Interesse Deutschlands ein Bündnis mit Rußland gegen das andere imperialistische Lager vorschlugen.
Diese bürgerliche Version der Haltung, „Der Hauptfeind steht im eigenen Land“, gepaart mit den Beschuldigungen gegen die „eigene Bourgeoisie“ verstärkt die kapitalistische Ideologie, da sie unter dem Deckmantel der Anklage gegen eine kriegstreibende Seite nicht nur die anderen Kriegstreiber ungeschoren davonkommen lässt, sondern auch für den Krieg und für den Imperialismus Partei ergreift. Nicht das System mit seinem Krebsgeschwür – Militarismus und Krieg – werden angeklagt, sondern nur eine Seite.
Kein Wunder, dass viele von diesen Leuten ihre Sympathie für die serbische Seite nicht gerade verbergen. Wie überhaupt auffällt, dass dieser Flügel sich aus enttäuschten Anhängern der untergegangenen DDR und des gesamten Ostblocks rekrutiert, wobei sie Osteuropa als irgendwie etwas „Fortschrittliches und Verteidigenswertes“ darstellen. Aber das Ganze bleibt nicht bei einer Nostalgie für die untergegangenen stalinistischen Regime stehen. Wenn ein Vertreter der deutschen Bourgeoisie wie Gregor Gysi schon kurz nach Ausbruch des Krieges als erster Politiker aus einem Nato-Staat sich vertraulich mit Milosevic treffen kann und vorher seine Reise mit dem Auswärtigen Amt in Bonn abspricht, so wird an diesem Beispiel deutlich, wie die Stalinisten auch heute noch in die Kriegsstrategien auch der eigenen Bourgeoisie eingebunden sind und ihren Handlungsspielraum erweitern. Die besonders engen Beziehungen der deutschen Stalinisten mit ihren politischen Freunden im ehemaligen Ostblock, zumal in Russland, ist eine weitere Trumpfkarte der deutschen Bourgeoisie heute, die den Balkankonflikt unter anderem dazu auszunutzen trachtet, um Russland näher an Deutschland zu ziehen.
Im 2. Weltkrieg und in zahlreichen „nationalen Befreiungskriegen“ in der Zeit des kalten Kriegs haben gerade die Stalinisten und Trotzkisten immer wieder ein verteidigenswertes imperialistisches Lager gefunden, jeweils unter dem Vorwand, es sei „weniger reaktionär“ und ein „Fortschritt gegenüber dem Imperialismus“. Diese Leute vertreten keineswegs eine internationalistische Tradition, sondern sind heimliche Kriegstreiber für eines der beiden imperialistischen Lager.
Heute aber, wo die herrschende Klasse gerade vor dem Dilemma steht, dass sie die Arbeiterklasse in den Industriestaaten nicht für den Krieg mobilisieren kann, können diese Vertreter der extremen Linken noch nicht offen zum Krieg aufrufen. Ihr Hauptbeitrag besteht darin, Verwirrung zu stiften, den wirklichen imperialistischen Charakter des Krieges, den Bankrott des Systems zu vertuschen. Die Arbeiterklasse aber braucht keine „radikal“ erscheinenden Elemente an ihrer Seite, die lauthals eine Kriegstreiberseite anprangern, um heimlich oder offen (wie die trotzkistische „Spartakist–Tendenz“, die offen zur Verteidigung Serbiens aufruft) für die andere Partei zu ergreifen, sondern sie braucht Kräfte, die zum Zusammenschluss aller Arbeiter gegen alle kriegführenden, kapitalistischen Seiten beitragen. 20.05.99
Die Schweiz und der Kosovokrieg - Auch kleine Imperialisten machen mit
Mitte April hat die Schweiz die Initiative ergriffen, direkt ins Kampfgebiet Kosovo Hilfe zu bringen. Die Regierung schickte die Chefs der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) und des Schweizerischen Katastrophenhilfekorps (SKH) nach Belgrad und Moskau. In Zusammenarbeit mit Russland und Griechenland werden nun Dutzende von Hilfskonvois ins Kriegsgebiet geschickt. Diese "Hilfe" auch für die serbische Seite steht in scheinbarem Widerspruch zum offenen Engagement der Schweiz für die andere Kriegspartei. (vgl. dazu unsere Analyse in Weltrevolution Nr. 91) Was ist der Hintergedanke der Schweizer Bourgeoisie bei dieser Initiative?
Die Schweiz macht sich unentbehrlich
Der Krieg im Kosovo reiht sich ein in die Kette der Kriege in Slowenien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina. Auch hier geht es den beteiligten Staaten nicht um die ”humanitäre Katastrophe”, sondern um die imperialistischen Rivalitäten. Die Menschen dieser Region zahlen dafür, dass keine Gross- oder Mittelmacht einem ihrer Konkurrenten einen entscheidenden Vorteil überlassen will. Sogar die Schweiz muss mitmachen. Sie hat nicht einmal die schlechtesten Karten und nimmt sogar in den vorderen Rängen der kapitalistischen Hackordnung ihren Platz ein.
Die Schweiz unterstützt seit einigen Jahren die UCK. Damit hat sie jetzt ein gutes Pfand in der Hand. Ihre sogenannte ”Neutralität” kann die Schweiz am besten ausspielen, wenn sie Kontakte und Einflussmöglichkeiten bei den verschiedenen Kriegsparteien hat, wie dies die jüngsten Kontakte zu Serbien zeigen. Grundsätzlich ist die Schweiz ebenso durchtrieben und machiavellistisch wie alle anderen Staaten auch. Sie ist reich, liegt im Herzen von Europa und wird von einer erfahrenen und alten Bourgeoisie regiert. Die Rangstellung der Schweiz ist für ihre Grösse und Bevölkerungszahl sehr ansehnlich im Vergleich zu anderen. Zudem ist die Schweiz oft vom Krieg verschont geblieben, was sie benutzte, um sich zu bereichern. Sie ist ein kleiner, aber potenter imperialistischer Gangster. Sie kann ihre ”Guten Dienste” aus einer starken Stellung heraus anbieten. Diplomatie, Hilfsgüter, Waffen und auch Truppen sind verkaufbare Güter, die in Zeiten des Krieges hoch bezahlt werden. Nein, die Heuchelei kennt keine Grenzen, denn es ist die Moral der Bourgeoisie, die den Kapitalismus als human bezeichnet.
Es ist immer das selbe Muster, nach dem sich die schweizerische Aussenpolitik verhält: Es geht darum, überall ein Eisen im Feuer zu haben.
Die sogenannten Guten Dienste
Wie wir schon in Weltrevolution Nr. 91 schrieben, will der Schweizer Imperialismus mit Militär vor Ort präsent sein. Seit dem 6. April bringen drei Super-Puma-Helikopter Hilfsgüter nach Tirana; sie sind auch dort stationiert. Armeelastwagen bringen die eingeflogenen Güter in den Norden Albaniens (Aufmarschgebiet der UCK). Und für die albanische Armee bildet Schweizer Militär Offiziere aus. Bis Mitte April bestanden die Einsatzkräfte des Bundespersonals in Albanien, Montenegro, Mazedonien und Serbien aus 81 Personen (Schweizerisches Rotes Kreuz SRK, SKH, DEZA).
Die Schweiz betreibt schon seit 1996 ein Camp von OSZE-Beobachtern in Sarajevo. Auch jetzt bietet sie wieder "Hilfe" an, einerseits die ”Guten Dienste” der Diplomatie, andererseits aber auch bewaffnete Truppen mit Gerät und Maschinen. Der Kriegsminister ergriff die Gelegenheit, um den schon lange geplanten Vorstoss zur Bildung von bewaffneten Kontingenten für den Einsatz im Ausland zu lancieren.
Es ist bemerkenswert, dass die Organisationen, die nun auf dem Balkan zum Einsatz kommen, alle staatlich eingebunden und zentral koordiniert sind. Sie sind übrigens auch in allen anderen Krisengebieten präsent (z.B. Georgien, Aserbaidschan, Tadschikistan, Ruanda, Eritrea und Somalia).
In Zusammenarbeit mit Russland und Griechenland werden ”Hilfskonvois” nach Belgrad gefahren. Somit erhalten jetzt beide Seiten Schlafsäcke der Schweizer Armee. In Pristina wird von diesen drei Ländern gemeinsam eine Vertretung aufgebaut.
Geld und zumindest Handfeuerwaffen gelangen aus der Schweiz zur UCK. Lebensmittel werden grosszügig - aus den ohnehin bis zur Decke gefüllten Lagerhallen - auf den Balkan transportiert. Damit will sich die Schweiz unentbehrlich machen. Die Schweiz kann sich eine solche Politik leisten. Die Unentbehrlichkeit soll aber für die Schweiz eine Investition, ein Faustpfand sein, welches als Erpressungsmittel eingesetzt werden kann.
Die USA fragten (wie schon zuvor England und Deutschland) die Schweiz an, ob sie in Belgrad ihre diplomatische Interessensvertretung übernehme. Allen Seiten wurde eine reservierte Zurückgezogenheit vorgespielt. Obschon Milosevic seinerseits die Schweiz nicht kontaktiert haben will, ist wichtig zu wissen, dass er Millionen von Franken auf Schweizer Bankkonten hat. Pikanterweise wurde gerade von proserbischer Seite, d.h. in französischen Tageszeitungen, auch schon die Ansicht geäussert, dass doch am besten die Grossbanken in der Schweiz bombardiert werden sollten.
Die Schweiz weiss sich im Geschäft zu halten Das humanitäre Geschrei der Schweizer Bourgeoisie dient nur dazu, ihre imperialistischen Interessen zu wahren. Es schert sie keinen Dreck, mit wem sie verhandelt. Hauptsache, das Spiel kann weiter gehen. Wer draussen ist, hat verloren. Das hat die Schweiz gut verstanden. Deshalb versucht sie mit immer neuen diplomatischen Initiativen am Ball zu bleiben. Nur so kann man die eigenen strategischen Interessen verteidigen. Gegenwärtig gibt es keine dauerhaften Bündnisse mehr. Es gilt das Gesetz: jeder für sich. Jeder Staat ist sich der Nächste. Auch die Schweiz.
Diese Haltung des schweizerischen Imperialismus soll vertuscht werden mit der humanitären Hilfe. Wie bei allen anderen Imperialisten auch. Die humanitären Interventionen der westlichen Demokratien sind das Feigenblatt dazu.
In diesem Zusammenhang kann die Stellung der Schweiz nur noch im internationalen Ringen um Einfluss auf dem Balkan gesehen werden.
Was tun?
Auf ihrer letzten öffentlichen Veranstaltung in Zürich (wie auch an verschiedenen anderen Orten auf der Welt) hat die IKS die Frage des Krieges aufgegriffen. Die Aktualität des Themas hat eine grosse Anzahl von Leuten angesprochen. Es kamen sehr unterschiedliche Leute. Allen gemeinsam war der Drang, gegen den Krieg unmittelbar etwas zu tun.
Die IKS hob hervor, dass gegen den Krieg in erster Linie eine internationalistische Position eingenommen werden muss. Bevor man über ein gemeinsames Vorgehen sprechen kann, muss man sich über die Einschätzung und die Grundhaltung einig sein. In der Arbeiterklasse besteht eine Tradition zur Frage des Krieges. Im 20. Jahrhundert mit den 2 Weltkriegen wurde die Position zum imperialistischen Krieg zum entscheidenden Kriterium, welches das proletarische Lager von der Bourgeoisie trennt. Die IKS rief in Erinnerung, dass auch in diesem Krieg wieder die Interventionen der Gruppierungen des revolutionären Millieus diese Tradition darstellen. Es gibt einige Flugblätter dieser revolutionären Organisationen zum Krieg, die wir an dieser Veranstaltung ausgelegt haben.
Auch fordert die IKS immer wieder dazu auf, die Diskussion zu suchen. Unsere Betroffenheit muss sich darin manifestieren, dass darüber gesprochen wird. Gesprochen wird über den Krieg und seine Gründe, seine Auswirkungen. In der Arbeiterklasse ist die öffentliche Diskussion das Mittel, die Politisierung voranzutreiben.
”Der Krieg spaltet die SP”
Die Sozialdemokraten haben seit 2-3 Jahren in zahlreichen Ländern die Regierungsgeschäfte übernommen. Ist das Zufall? In den USA sind es die Demokraten, welche den Krieg als Zuspitzung der Krise im Kapitalismus managen sollen.
Die linke Fraktion der Bourgeoisie gibt sich kämpferisch. Die Sozialdemokratie befürwortet nicht nur den Krieg, sie führt ihn auch. Gegen die Interessen der Arbeiterklasse! Wenn der Kapitalismus ausweglos in der Krise steckt, verwaltet die Sozialdemokratie das alte System oft am besten, nämlich die Klasseninteressen eines kleinen Teiles der Gesellschaft, der Bourgeoisie. Die Sozialdemokratie kann diese Interessen am besten vertreten: "die Sozialdemokratie, die Hauptströmung, die für die Niederschlagung der Weltrevolution nach 1917-1918 verantwortlich ist; die Strömung, die seinerzeit den Kapitalismus gerettet hat und die heute wieder die Regierungsgeschäfte übernimmt, um die bedrohten Interessen der Kapitalistenklasse zu verteidigen" (Resolution zur internationalen Lage, 13.Kongress der IKS).
Ganz bewusst versucht die Linke der Bourgeoisie möglichst die ganze Arbeiterklasse gegenüber dem Krieg auf den ideologischen Boden des Kapitals zu locken, indem einige SP-Politiker (z.B. die Parteipräsidentin Koch) "die Entsendung von Bodentruppen nach Kosovo" befürworten und andere Exponenten der gleichen Partei (z.B. Ex-Bundesratskandidat Cavalli) gegen die NATO-Bombadierungen Stellung beziehen. So titelte der Tages Anzeiger: ”Der Krieg spaltet die SP”. Die Arbeiterklasse soll damit in Diskussionen verwickelt werden, welche Politik für die Schweiz die beste sei. Die Proletarier sollen sich nach dieser Logik mit dem Interesse der nationalen Bourgeoisie identifizieren. Und damit sollen sie auch für jede Konsequenz des Kriegsverlaufs verantwortlich gemacht werden: Wenn Bodentruppen geschickt werden, sind die Arbeiter angeblich mitschuldig für den Tod der Soldaten; wenn keine geschickt werden, sind sie mitverantwortlich für die Leiden der Zivilbevölkerung.
Nur die Arbeiterklasse kann der Barbarei entgegentreten
In der Diskussionsveranstaltung der IKS war bei vielen Teilnehmern eine Ungeduld zu spüren. Sie wollten sofort und unmittelbar etwas gegen den Krieg unternehmen. Andere Teilnehmer wiesen darauf hin, dass nur die Arbeiterklasse eine Antwort auf den Krieg hat. Der 1. Weltkrieg wurde durch die revolutionären Kämpfe des Proletariats in Russland, Deutschland, Österreich, Ungarn und zahlreichen anderen Ländern beendet. Auch nach 1968 war es die Arbeiterklasse, die mit ihren Kämpfen den Weg zum 3. Weltkrieg bis heute versperrt hat.
Wir müssen uns aber bewusst sein, dass der gegenwärtige Krieg auf dem Balkan aufgrund des gegenwärtigen Kräfteverhältnisses zwischen den Klassen nicht durch das Proletariat beendet werden kann. Es wird nach diesem Krieg eine neue Stufe der imperialistischen Unordnung geben, die wieder zu neuen Kriegen führt. Dies ist die einzige Perspektive, die der Kapitalismus anzubieten hat.
Gleichzeitig spitzt sich aber auch die Wirtschaftskrise zu, was die Arbeiterklasse zunehmend zwingen wird, ihre Kämpfe auf dem eigenen Terrain zu entwickeln. In diesen Kämpfen wird die Einheit der Klasse geschmiedet und das Bewusstsein vertieft. Gerade in diesen Kämpfen wird sich die Arbeiterklasse auch bewusst, dass die zunehmende Verschärfung der Angriffe auf die Lebensbedingungen und die Kriegstreiberei zusammenhängen und eine existenzielle Bedrohung darstellen. Schon heute stellt man fest, dass der Krieg bei einer Minderheit innerhalb der Klasse dazu führt, das System zu hinterfragen. Dies zeigen zahlreiche Diskussionen auf öffentlichen Veranstaltungen oder beim Flugblattverteilen.
Auch heute ist sich die Bourgeoisie bewusst, dass das Zusammentreffen von Krise und Krieg ihre Ideologie untergräbt. Deshalb ist das Wichtigste, was wir tun können, die Diskussion über die Folgen von Krise und Krieg zu suchen. Insbesondere in der Arbeiterklasse den Prozess des Nachdenkens zu fördern und die Zweifel und Kritik zu verstärken.
Einzig die Arbeiterklasse hat das historisch-politische Programm für diese Aufgabe. Die Arbeiter haben kein Vaterland. Daraus ist die Haltung des revolutionären Defätismus abzuleiten, wie ihn bereits die Zimmerwalder Linke 1915 vertreten hat. Dies ist die Haltung der Revolutionäre gegen den Krieg. Der Heuchelei der Pazifisten müssen wir den Klassenkampf entgegenstellen. Nur der ”Burgfrieden” erlaubt es der Bourgeoisie, das Proletariat in den Krieg zu mobilisieren. Deshalb ist der Klassenkampf das einzige Mittel gegen den Krieg. ST
Aktuelles und Laufendes:
- Balkankrieg [210]
Historische Ereignisse:
- Balkankriege 1990er Jahre [211]
- Balkankrieg 1999 [212]
- Rot-Grün und Kriegsfrage [213]
Theoretische Fragen:
- Imperialismus [3]
Gaza und die nationale Frage
- 2996 reads
Überall auf der Welt haben Menschen ihre Abscheu und ihren Horror vor den israelischen Massakern im Gaza-Streifen zum Ausdruck gebracht. Das Ziel dieses Artikels ist nicht, hier auf die Details der Kämpfe im Einzelnen einzugehen. Aber die Zahl der Todesopfer, man schätzt ca. 1200 oder mehr Palästinenser und 13 Israelis starben, spricht für sich selbst. Sie zeigt, dass es sich nicht um einen Kampf zwischen zwei gleichstarken Mächten handelte, sondern ganz einfach um ein Massaker. Dies ist ein wichtiger Punkt, den man berücksichtigen muss, wenn man die Frage stellt, wie Kommunisten Konflikte dieser Art einschätzen.
Überall auf der Welt haben Menschen ihre Abscheu und ihren Horror vor den israelischen Massakern im Gaza-Streifen zum Ausdruck gebracht. Das Ziel dieses Artikels ist nicht, hier auf die Details der Kämpfe im Einzelnen einzugehen. Aber die Zahl der Todesopfer, man schätzt ca. 1200 oder mehr Palästinenser und 13 Israelis starben, spricht für sich selbst. Sie zeigt, dass es sich nicht um einen Kampf zwischen zwei gleichstarken Mächten handelte, sondern ganz einfach um ein Massaker. Dies ist ein wichtiger Punkt, den man berücksichtigen muss, wenn man die Frage stellt, wie Kommunisten Konflikte dieser Art einschätzen.
Obgleich es in einigen Ländern Unterstützung für Israels militärisches Vorgehen und gar einige Kundgebungen zur Verteidigung der Massaker gab, gab es wesentlich mehr Proteste und Kundgebungen gegen die Massaker. Massendemonstrationen mit Hunderttausenden Teilnehmern wurden aus Damaskus, Madrid, Kairo, Istanbul und gar aus Israel selbst gemeldet. Auch wenn viele Staaten sich weigerten, den israelischen Angriff zu verurteilen oder ihn zu befürworten, gab es nirgendwo auf der Welt eine große öffentliche Unterstützung für dieses Vorgehen. In der ‚islamischen Welt’ insbesondere wurde es fast einhellig verurteilt. In Syrien organisierte der Staat selbst die Demonstrationen, und hier in der Türkei gelang es Präsident Gül irgendwie zu beschließen, dass „Israels Bombardierung des Gaza-Streifens einen mangelnden Respekt für die Republik Türkei“ darstellt, und Tayip sorgte zeitweilig für großes Aufsehen in den Medien. Tatsächlich waren in der Türkei wie auch in den meisten arabischen Ländern alle politischen Kräfte in der Gesellschaft gegenüber diesem Thema einer Meinung.
Wenn diese Art ‚nationaler Eintracht’ entsteht, müssen die Revolutionäre als erstes fragen, wessen Klasseninteressen hier vertreten werden? Natürlich muss die Antwort lauten: Es werden nicht die Interessen der Arbeiterklasse vertreten.
In Wirklichkeit unterscheiden sich die politischen Klassen in der Türkei und Israel nicht. Jeder, der den israelischen Politikern bei deren Rechtfertigung der von ihren Truppen verübten Morde zuhörte, hätte genau die gleichen Töne aus dem Munde türkischer Politiker hören können, die seit Jahren nichts anderes sagen. Die Armee „verteidigte unschuldige Zivilisten gegen mörderische Terroristen“. Wir wissen alle, von wem wir solche Sprüche immer wieder hören. Die Lügen des israelischen Staates zur Rechtfertigung seiner Kriege sind genau die gleichen, wenn nicht gar wortgenau die gleichen wie die des türkischen Staates bei der Rechtfertigung seiner Barbarei im Südosten und in den kurdischen Gebieten des Nordirak.
Natürlich sticht die Heuchelei der herrschenden Klassen sofort ins Auge. Die Argumente einiger linker Organisationen sind jedoch viel subtiler. Letzten Endes laufen diese darauf hinaus, die palästinensische nationale „Befreiungsbewegung“ zu unterstützen, insbesondere HAMAS. Die große Mehrzahl dieser Organisationen weiß sehr wohl, dass HAMAS eine reaktionäre, arbeiterfeindliche Organisation ist. Einige werden sich sogar daran erinnern, dass HAMAS im September 2006 Lehrer und andere Beschäftigte des öffentlichen Dienstes angriff. Aber sie behaupten dessen ungeachtet, es sei für Sozialisten notwendig, HAMAS zu unterstützen, da sie die einzige Kraft seien, die gegen die Israelis kämpften, und die einzigen, die das palästinensische Volk verteidigen könnten.
Aber die Tatsachen vor Ort widerlegen dies. Die Zahl der Opfer belegt, dass sie völlig unfähig sind, die palästinensische Bevölkerung zu schützen. Der Mythos des Kampfes der Palästinenser, welcher von den Linken verbreitet wird, ist der, dass diese ‚tapferen nationalen Kräfte’ eines Tages über das ‚israelische zionistische Regime’ siegen werden. Und seine Propagandawerkzeuge sind Bilder von Nationalfahnen, toten Kindern, hübschen jungen Frauen mit Sturmgewehren. Aber es scheint nur ein Hauptproblem bei der ganzen Sache zu geben, und das ist, dass all dies gar nicht der Wirklichkeit entspricht.
Die palästinensische Nationalbewegung wird nie dazu in der Lage sein, Israel alleine zu zerstören. Die eingangs erwähnten Opferzahlen sind selbstredend. Für jeden getöteten Israeli starben nahezu 100 Palästinenser. Kommunisten, die eine internationalistische Position vertreten, nämlich keine Unterstützung für irgendeine der beiden Seiten im Krieg der Kapitalisten, wurde von den linksextremen Organisationen entgegnet, dass der Kampf völlig ungleich sei, und wenn man nicht HAMAS Kampf unterstütze, würde man für die Imperialisten eintreten. Natürlich stimmt es, dass die beiden Seiten ungleich sind. Aber während es verständlich sein mag, den Schwächeren in einem Fußballspiel zu unterstützen, zum Beispiel wenn Haccetepe bei Fener spielt, kann man darauf keine politische Analyse stützen.
Der Imperialismus beschränkt sich heute nicht auf die USA und ihre Verbündeten. Der Imperialismus ist zu einem Weltsystem geworden. Alle großen Länder verfechten imperialistische Interessen. Nicht nur die die USA, Großbritannien und Frankreich. Russland und China vertreten auch imperialistische Interessen, genauso wie viel kleinere Staaten wie die Türkei, Syrien, Iran. Und im Kampf zwischen diesen Mächten zählen die Belange verschiedener nationaler Minderheiten wenig mehr als die Belange von Bauern auf einem Schachbrett. Das Beispiel der Kurden ist aufschlussreich. Jahrelang haben sich kurdische nationalistische Organisationen mit all den regionalen und Großmächten verbündet. Das Beispiel der Unterstützung Syriens für die PKK ist nur eines von vielen. In der heutigen Zeit können nationale Befreiungsbewegungen kaum etwas anderes sein als Werkzeuge im Kampf zwischen den verschiedenen Mächten; so auch in diesem Fall im Kampf zwischen Syrien und dem Iran gegen Israel.
Sprechen wir die Verhältnisse klar aus: es gibt gegenwärtig absolut keine Möglichkeit eines palästinensischen Sieges. Das ‚beste’, worauf sie hoffen können, ist eine Art ‚Homeland’ wie die Bantustans im Apartheidregime Südafrikas, bei dem palästinensische Polizei die von Israel diktierte Ordnung aufrechterhält. Gegenwärtig kann man keine militärische Niederlage Israels und seiner Unterstützer, der USA, erwarten. Das wird einfach nicht passieren.
Die einzige Möglichkeit, dass solch eine militärische Niederlage eintreten würde, wäre, wenn es zu einer tiefgreifenden Umwälzung der Machtverhältnisse käme, wenn die USA von ihrem Thron als Herrscher im Mittleren Osten gestoßen würden. Eine neue Koalition von verbündeten Mächten müsste sich zusammenschließen, um die US-Hegemonie herauszufordern. Für den Mittleren Osten würde dies sicherlich eine Verschärfung des mörderischen Zyklus der nationalistischen-ethnischen-religiösen Konflikte bedeuten, welche die Region immer tiefer in die Barbarei treiben. Ein Sieg der Palästinenser im Gaza-Streifen würde nur neue Massaker bedeuten, nur dass diesesmal Araber Juden massakrieren würden.
… Und die palästinensische Arbeiterklasse? Die Geschichte der nationalen Befreiungsbewegungen zeigt, was sie erwarten würde. Siegreiche nationalistische Bewegungen neigen dazu, Kehrtwendungen zu vollziehen und Unterstützer aus den Reihen der Arbeiterklasse oder der Sozialisten zu massakrieren, wenn diese etwas mehr wollen. Die Ermordung von Tausenden von Arbeitern und Kommunisten in Shanghai 1927 ist eines der am besten bekannten Beispiele. Aber dies ist nur ein Teil einer langen Kette von Erfahrungen, die von Musta Suphi und den Führern der Türkischen Kommunistischen Partei zu den kurdischen Nationalisten im Irak reicht, die heute streikende Beschäftigte in Zementwerken niederschießen.
Die Rolle der Kommunisten und Revolutionäre besteht nicht darin, die schwächere Seite in einem Kampf zu unterstützen. Ebenso wenig besteht ihre Aufgabe darin, Arbeiter zu mobilisieren, um für Bosse zu sterben. Wir stammen aus einer anderen Tradition.
Es ist eine Tradition, die die Klasseninteressen an erste Stelle setzt und nicht die nationalen Interessen. Es handelt sich um die Tradition Lenins und der revolutionären Aufstände, die den Ersten Weltkrieg beendeten. Es ist eine Tradition, die damals wie heute sagt, dass Arbeiter kein Vaterland haben.
Sabri -
Der Artikel wurde aus unserer türkischen Presse entnommen
Aktuelles und Laufendes:
- Nationalismus [185]
- Israel [173]
- Palästina [214]
- Gaza [215]
- Nahost-Konflikt [216]
Mai 2009
- 823 reads
Der G20 Gipfel in London: eine neue kapitalistische Welt ist nicht möglich
- 3828 reads
„Die erste globale Krise der Menschheit“ (Welthandelsorganisation, April 2009)[1]. Die „schlimmste und am stärksten überall gleichzeitig wirkende Rezession in der Menschheitsgeschichte“ (OECD, März 2009)[2]! Selbst die großen internationalen Institutionen müssen eingestehen, dass die gegenwärtige Wirtschaftskrise ein bisher noch nie da gewesenes Ausmaß erreicht hat. Um ihr entgegenzuwirken, mobilisiert die herrschende Klasse seit Monaten alle Kräfte. Sie versucht mit allen Mitteln, den Abstieg in die Hölle der Weltwirtschaftskrise zu verhindern. Das Treffen der G20 ist sicherlich das stärkste Symbol dieser internationalen Reaktion[3]. Alle Hoffnungen der Kapitalisten ruhten auf London, wo dieser rettende Gipfel Anfang April stattfand; er sollte die „Wirtschaft wieder ankurbeln und dem Kapitalismus einen moralischen Auftrieb“ verleihen. Den Erklärungen der verschiedenen Führer der Welt zufolge war dieser Gipfel ein echter Erfolg. „An diesem Tag hat sich die Welt versammelt, um gegen die Rezession anzukämpfen“, erklärte der britische Premierminister Gordon Brown. „Wir haben viel mehr erreicht als erwartet“, äußerte bewegt der französische Präsident Nicolas Sarkozy. „Es handelt sich um einen historischen Kompromiss gegenüber einer außergewöhnlichen Krise“, meinte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und aus Barack Obamas Sicht war der Gipfel eine „Wende“.
Natürlich sieht die Wirklichkeit ganz anders aus.
Der einzige Erfolg des Gipfeltreffens der G20 ist, dass es stattgefunden hat!
In den letzten Monaten hat die Wirtschaftskrise die internationalen Spannungen stark angefacht. Zunächst ist die Versuchung des Protektionismus gestiegen. Jeder Staat neigt zunehmend dazu, einen Teil seiner Wirtschaft durch Subventionen und die Gewährung von Privilegien für einheimische Unternehmen gegen die ausländische Konkurrenz zu retten. Das war zum Beispiel beim Unterstützungsplan für die französische Automobilindustrie der Fall, der von Nicolas Sarkozy beschlossen wurde und der von seinen europäischen „Freunden“ scharf kritisiert wurde. Schließlich gibt es eine wachsende Tendenz, ohne gemeinsame Absprachen Ankurbelungsprogramme zu verabschieden, insbesondere um den Finanzsektor zu retten. Dabei versuchen viele Konkurrenten, die missliche Lage der USA, dem Epizentrum des Finanzbebens und Schauplatz einer schlimmen Rezession, auszunutzen, um die wirtschaftliche Führungsrolle der USA weiter zu untergraben. Dies ist jedenfalls das Anliegen hinter den Aufrufen Frankreichs, Deutschlands, Chinas, der südamerikanischen Staaten zum „Multilateralismus“ …
Der Gipfel von London war von Spannungen überschattet, die Debatten müssen in der Tat sehr erregt gewesen sein. Aber man hat den Schein bewahren können. Die Herrschenden konnten das katastrophale Bild eines chaotischen Gipfels vermeiden. Die herrschende Klasse hat nicht vergessen, in welchem Maße mangelnde internationale Abstimmung und die Tendenz des „Jeder für sich“ zum Desaster von 1929 beigetragen haben. Damals wurde der Kapitalismus von der ersten großen Wirtschaftskrise im Zeitalter seines Niedergangs erfasst[4]; die herrschende Klasse wusste noch nicht, wie sie reagieren sollte. Und so reagierten die Staaten zunächst überhaupt nicht. Von 1929 bis 1933 wurde fast keine Maßnahme ergriffen, während Tausende von Banken der Reihe nach Bankrott gingen. Der Welthandel brach buchstäblich zusammen. 1933 zeichneten sich erste Reaktionen ab – der New Deal Roosevelts[5] wurde beschlossen. Dieser Ankurbelungsplan umfasste eine Politik der großen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und der staatlichen Verschuldung, aber auch ein protektionistisches Gesetz, den „Buy American Act“[6]. Damals stürzten sich alle Länder in ein protektionistisches Wettrennen. Der Welthandel, der bereits sehr stark geschrumpft war, erlitt einen weiteren Schock. So haben die herrschenden Klassen in den 1930er Jahren durch ihre eigenen Maßnahmen die Weltwirtschaftskrise noch verschärft.
Heute also wollen alle herrschenden Klassen eine Wiederholung dieses Teufelskreises von Krise und Protektionismus verhindern. Sie sind sich dessen bewusst, dass sie alles unternehmen müssen, um die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen. Es war unbedingt erforderlich, dass dieser Gipfel der G20 die Einheit der Großmächte gegenüber der Krise zur Schau stellt, insbesondere um das internationale Finanzsystem zu stützen. Der IWF hat dazu gar einen besonderen Punkt in seinem „Arbeitsdokument“ zur Vorbereitung des Gipfels formuliert, um gegen diese Gefahr des „Jeder für sich“ zu warnen[7]. Es handelt sich um den Punkt 13: „Das Gespenst des Handels- und Finanzprotektionismus stellt eine wachsende Sorge dar“: „Ungeachtet der von den G20-Ländern [im November 2008] eingegangenen Verpflichtungen, nicht auf protektionistische Maßnahmen zurückzugreifen, ist es zu besorgniserregenden Entgleisungen gekommen. Es ist schwer, zwischen dem öffentlichen Eingreifen, das darauf abzielt, die Auswirkungen der Finanzkrise auf die in Schwierigkeiten geratenen Bereiche einzudämmen, und den nicht angebrachten Subventionen für die Industrien zu unterscheiden, deren langfristige Überlebensfähigkeit infrage gestellt werden muss. Bestimmte Unterstützungsmaßnahmen für den Finanzbereich verleiten auch die Banken dazu, Kredite in ihre Länder zu lenken. Gleichzeitig gibt es wachsende Risiken, dass bestimmte Schwellenländer, die mit einem von Außen kommenden Druck auf ihre Konten konfrontiert sind, danach streben, Kapitalkontrollen aufzuerlegen.“ Und der IWF war nicht der einzige, der solche Warnungen äußerte: „Ich befürchte, dass eine allgemeine Rückkehr des Protektionismus wahrscheinlich ist. Denn die defizitären Länder wie die USA glauben damit ein Mittel gefunden zu haben, die Binnennachfrage und die Beschäftigung anzukurbeln. […] Wir befinden uns in einem entscheidenden Moment. Wir müssen eine Wahl treffen zwischen einer Öffnung nach Außen oder einem Rückzug auf Lösungen ‚innerhalb‘ eines Landes. Wir haben diesen zweiten Lösungsansatz in den 1930er Jahren versucht. Dieses Mal müssen wir den ersten versuchen.“ (Martin Wolf, vor der Kommission auswärtiger Angelegenheit des US-Senats, am 25. 6.2009)[8].
Der Gipfel hat die Botschaft vernommen: Die Führer der Welt konnten das Bild einer scheinbaren Einheit bewahren und dieses in ihrer Abschlusserklärung schriftlich festhalten: „Wir werden die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen“. Die Welt atmete auf. Wie die französische Wirtschaftszeitung „Les Echos“ am 3. April schrieb: „Die erste Schlussfolgerung, die man nach dem gestrigen G20 von London ziehen kann, ist, dass er nicht gescheitert ist, und das ist schon viel wert. Nach den Spannungen der letzten Wochen haben die 20 größten Länder ihre Einheit gegenüber der Krise gezeigt.“
Konkret haben sich die Länder verpflichtet, keine Handelsschranken zu errichten, auch nicht gegen Finanzströme. Die Welthandelsorganisation wurde beauftragt, sorgfältig darauf zu achten, dass diese Verpflichtungen eingehalten werden. Darüber hinaus wurden 250 Milliarden Dollar für die Unterstützung des Exports oder von Investitionen zugesagt, um den internationalen Handel wieder anzukurbeln. Aber vor allem haben die gestiegenen Spannungen die Atmosphäre auf diesem Gipfel nicht vergiften können, der sonst in einen offenen Faustkampf ausgeartet wäre. Der Schein bleibt also gewahrt. Dies ist der Erfolg des Gipfels der G20. Und dieser Erfolg ist sicherlich zeitlich beschränkt, denn der Stachel der Krise wird die internationalen Divergenzen und Spannungen weiter verschärfen.
Die Verschuldung von heute bereitet die Krisen von morgen vor
Seit dem Sommer 2008 und der berühmten „Subprime“-Krise verabschiedeten die Regierungen wie entfesselt ein Konjunkturprogramm nach dem anderen. Nach der ersten Ankündigung von massiven Kapitalspritzen im Milliardenumfang kam vorübergehend Optimismus auf. Doch da sich die Krise unbeirrt weiter zuspitzte, wuchs mit jedem jeden neuen Programm auch die Skepsis. Paul Jorion, ein auf den Wirtschaftsbereich spezialisierter Soziologe (er war zudem einer der ersten, die die gegenwärtige Krise ankündigten) macht sich lustig über dieses wiederholte Scheitern: „Wir sind unbemerkt von den kleinen Anschüben des Jahres 2007 im Umfang von einigen Milliarden Euro oder Dollar zu den großen Paketen von Anfang 2008 übergegangen, dann kamen schließlich die gewaltigen Pakete von Ende 2008, die mittlerweile Hunderte von Milliarden Euro oder Dollar umfassen. 2009 ist das Jahr der ‚kolossalen‘ Anschübe, die diesmal Summen von ‚Trillionen‘ Euro oder Dollar beinhalten. Und trotz pharaonischer Ambitionen gibt es noch immer nicht das geringste Licht am Ende des Tunnels“[9].
Und was schlägt der Gipfel vor? Man überbietet sich mit einer Reihe von Maßnahmen, von denen die eine noch unwirksamer ist als die andere! Bis Ende 2010 sollen 5.000 Milliarden Dollar in die Weltwirtschaft gepumpt werden[10]. Die Bourgeoisie verfügt über keine andere „Lösung“; sie offenbart damit ihre eigene Machtlosigkeit[11]. Die internationale Presse hat sich in dieser Hinsicht nicht geirrt. „Die Krise ist noch lange nicht vorüber, man muss naiv sein zu glauben, dass die Beschlüsse des G20 alles ändern werden“ (La Libre Belgique), „Sie sind zu einem Zeitpunkt gescheitert, als die Weltwirtschaft dabei war zu implodieren“ (New York Times).
Die Vorhersagen der OECD, die normalweise ziemlich optimistisch sind, lassen für 2009 keinen Zweifel daran aufkommen, was auf die Menschheit in den nächsten Monaten zukommen wird. Ihnen zufolge wird die Rezession in den USA zu einer Schrumpfung des Bruttoinlandprodukts von vier Prozent, in der Euro-Zone von 4.1 Prozent und in Japan von 6.6 Prozent führen. Die Weltbank prognostizierte am 30. März für das Jahr 2009 „einen Rückgang des Welt-BIP von 1.7 Prozent, was den stärksten, je registrierten Rückgang der globalen Produktion bedeutet“. Die Lage wird sich also in den nächsten Monaten noch weiter zuspitzen, wobei die Krise bereits heute verheerendere Ausmaße als 1929 angenommen hat. Die Ökonomen Barry Eichengreen und Kevin O’Rourke haben errechnet, dass der Rückgang der Weltindustrieproduktion allein in den letzten neun Monaten schon so stark war wie 1929, die Aktienwerte zweimal so schnell verfielen und auch der Welthandel schneller schrumpft[12].
All diese Zahlen entsprechen einer sehr konkreten und dramatischen Wirklichkeit für Millionen von ArbeiterInnen auf der Welt. In den USA, der größten Wirtschaftsmacht der Erde, wurden allein im März 2009 663.000 Arbeitsplätze vernichtet, womit sich die Zahl der vernichteten Arbeitsplätze innerhalb der letzten beiden Jahre auf 5.1 Millionen erhöht hat. Heute werden alle Länder von der Krise brutal erfasst. So erwartet Spanien 2009 einen Anstieg der Arbeitslosigkeit auf über 17 Prozent.
Aber diese Politik ist heute nicht nur einfach unwirksam; sie bereitet auch noch gewaltigere Krisen in der Zukunft vor. Denn all diese Milliardenbeträge können nur dank massiver Verschuldung zur Verfügung gestellt werden. Doch eines Tages (und dieser Tag liegt nicht in der fernen Zukunft) müssen diese Schulden zurückgezahlt werden. Selbst die Bourgeois sagen: „Es liegt auf der Hand, die Folgen dieser Krise sind mit hohen Kosten verbunden. Die Menschen werden Reichtümer, Erbgüter, Einkommen, Ersparnisse, Arbeitsplätze verlieren. Es wäre demagogisch zu denken, dass irgendjemand davon verschont werden wird, alles oder einen Teil dieser Rechnung zu bezahlen“ (Henri Guaino, Sonderberater des französischen Staatspräsidenten, 3.04.2009).[13] Durch die Anhäufung dieses Schuldenbergs ist letzten Endes die wirtschaftliche Zukunft des Kapitalismus mit einer gewaltigen Hypothek belastet.
Und was soll man zu all den Journalisten sagen, die sich darüber freuen, dass der IWF eine viel größere Bedeutung erlangt hat? Seine Finanzmittel sind in der Tat vom Gipfel verdreifacht worden; er verfügt nun über 750 Milliarden Dollar Mittel, hinzu kommen 250 Milliarden Dollar Sonderziehungsrechte.[14] IWF-Präsident Dominique Strauss-Kahn erklärte, dass es sich um den größten „jemals in der Geschichte beschlossenen koordinierten Ankurbelungsplan“ handelt. Er wurde beauftragt, „den Schwächsten zu helfen“, insbesondere den am Rande der Pleite stehenden osteuropäischen Staaten. Aber der IWF ist eine seltsame letzte Rettung. Denn diese Organisation ist zu Recht verrufen wegen der drakonischen Sparmaßnahmen, die sie in der Vergangenheit stets dann erzwungen hat, wenn ihre „Hilfe“ gefordert wurde. Umstrukturierungen, Entlassungen, Arbeitslosigkeit, Abschaffung bzw. Kürzung von medizinischen Leistungen, Renten usw.- all das sind die Folgen der „Hilfe“ des IWF. Diese Organisation hat – um nur ein Beispiel zu nennen – am vehementesten jene Maßnahmen vertreten, die Argentinien in den 1990er Jahren auferlegt wurden, bis dessen Wirtschaft 2001 kollabierte…
Der Gipfel der G20 hat also nicht nur den kapitalistischen Horizont nicht aufgehellt, sondern im Gegenteil bewirkt, dass noch dunklere Wolken aufziehen werden.
Der große Bluff eines moralischeren Kapitalismus
In Anbetracht der sattsam bekannten Unfähigkeit der G20, wirkliche Lösungen für die Zukunft anzubieten, fiel es den Bourgeois schwer, eine schnelle Rückkehr zum Wachstum und zu einer strahlenden Zukunft zu versprechen. Unter den Arbeitern breitet sich eine tiefe Verachtung gegen den Kapitalismus aus; immer mehr machen sich Gedanken über die Zukunft. Die herrschende Klasse ihrerseits ist eifrig darum bemüht, auf ihre Art auf diese Infragestellungen einzugehen. So hat denn auch dieser Gipfel mit großem Tamtam einen neuen Kapitalismus versprochen, der besser reguliert, moralischer, ökologischer sein werde…
Aber dieses Manöver ist so auffällig wie lächerlich. Um zu beweisen, wie ernst sie es mit einem „moralischeren“ Kapitalismus meinen, haben die G20-Staaten ihren Zeigefinger gegen einige „Steuerparadiese“ erhoben und mit eventuellen Sanktionen gedroht, über die man bis zum Ende des Jahres nachdenken werde (sic!), falls diese Länder keine Anstrengungen um größere „Transparenz“ unternehmen. Insbesondere wurde auf vier Länder verwiesen, die nunmehr die berühmte „schwarze Liste“ anführten: Costa Rica, Malaysia, die Philippinen, Uruguay. Auch anderen Ländern wurden Vorhaltungen gemacht; sie wurden auf eine „graue Liste“ gesetzt. Unter anderem gehören Österreich, Belgien, Chile, Luxemburg, Singapur und die Schweiz dazu.
Die großen „Steuerparadiese“ dagegen kommen allem Anschein nach ihren Pflichten nach. Die Kaiman-Inseln und ihre Hedgefonds, die von der britischen Krone abhängigen Territorien (Guernsey, Jersey, Ilse of Man), die Londoner City, die US-Bundesstaaten wie Delaware, Nevada oder Wyomin - all diese Gebiete sind offiziell weiß wie Schnee und gehören der weißen Liste an. Diese Klassifizierung der Steuerparadiese durch den Gipfel der G20 bedeutet, den Bock zum Gärtner zu machen.
Als Gipfel der Heuchelei kündigte nur wenige Tage nach dem Gipfel in London die OECD, die für diese Einstufungen verantwortlich ist, die Streichung der vier o.g. Länder von der schwarzen Liste an, nachdem diese Anstrengungen zu mehr Transparenz angekündigt hatten!
All dies kann nicht überraschen. Wie könnte man von all diesen Verantwortlichen des Kapitalismus, die in Wirklichkeit Gangster ohne Gesetz und Glauben sind, eine „moralischere Haltung“ erwarten?[15] Und wie kann ein System, das auf Ausbeutung und Profitstreben beruht, „moralischer“ werden? Niemand erwartete übrigens von diesem Gipfel einen „menschlicheren Kapitalismus“. Dieser existiert nicht, auch wenn die politischen Führer davon reden, wie Eltern ihren Kindern vom Weihnachtsmann erzählen. Diese Krisenzeiten enthüllen im Gegenteil noch deutlicher die unmenschliche Fratze dieses Systems. Vor fast 130 Jahren schrieb Paul Lafargue: „Die kapitalistische Moral […] belegt das Fleisch des Arbeiters mit einem feierlichen Bannfluch: Ihr Ideal besteht darin, die Bedürfnisse des Produzenten (das heißt des wirklich Produzierenden) auf das geringste Minimum zu reduzieren, seine Genüsse und Leidenschaften zu ersticken und ihn zur Rolle einer Maschine zu verurteilen, aus der man ohne Rast und ohne Dank Arbeit nach Belieben herausschindet“ (Paul Lafargue, Das Recht auf Faulheit, Vorwort). Wir könnten hinzufügen: Die einzig mögliche „Ruhe“ ist die Arbeitslosigkeit und das Elend. Wenn die Krise zuschlägt, werden Beschäftigte entlassen und fliegen auf die Straße wie Ausschuss. Der Kapitalismus ist und bleibt stets ein brutales und barbarisches Ausbeutungssystem.
Aber das Manöver ist so offensichtlich wie entlarvend. Es zeigt, dass der Kapitalismus der Menschheit keinen Ausweg mehr anzubieten hat, außer noch mehr Verarmung und Leid. Die Aussichten auf einen „ökologischen“ oder „moralischen“ Kapitalismus sind genauso groß wie die Aussichten eines Alchimsten, Blei in Gold zu verwandeln.
Der Londoner Gipfel belegt jedenfalls eins: Eine andere kapitalistische Welt ist nicht möglich. Es ist wahrscheinlich, dass der Krisenverlauf Höhen und Tiefen durchschreiten wird, wobei es zeitweise auch zu einem Wachstum kommen kann. Aber im Wesentlichen wird der Kapitalismus weiter in der Krise versinken, noch mehr Armut und Kriege hervorrufen.
Von diesem System kann man nichts erwarten. Mit ihren internationalen Gipfeln und Konjunkturprogrammen stellt die herrschende Klasse keinen Teil der Lösung dar, sondern sie selbst ist das Problem. Nur die Arbeiterklasse kann die Welt umwälzen, dazu muss sie aber Vertrauen in die Gesellschaft entwickeln, die sie aufbauen muss: den Kommunismus! Mehdi, 16.04.09
[1]Déclaration de Pascal Lamy, Erklärung des Generaldirektors der Welthandelsorganisation.
[2]Rapport intermédiaire – Zwischenbericht der OECD.
[3]Der G20 besteht aus den Mitgliedsländern des G8 (Deutschland, Frankreich, USA, Japan, Kanada, Italien, Großbritannien, Russland), zu dem jetzt Südafrika, Saudi-Arabien, Argentinien, Australien, Brasilien, China, Südkorea, Indien, Indonesien, Mexiko, Türkei und schließlich die Europäische Union dazu gekommen sind. Ein erster Gipfel hatte im November 2008 inmitten der Finanzerschütterungen stattgefunden.
[4]Siehe unsere Artikelserie „Die Dekadenz des Kapitalismus begreifen“
[5]Weit verbreitet ist heute der Mythos, dass der New Deal von 1933 es der Weltwirtschaft ermöglicht habe, aus dem wirtschaftlichen Schlamassel herauszukommen. Daher die logische Schlussfolgerung, heute zu einem neuen „New Deal“ aufzurufen. Aber in Wirklichkeit blieb die US-Wirtschaft zwischen 1933-38 besonders kraftlos. Erst der zweite New Deal, der 1938 beschlossen wurde, ermöglichte die Ankurbelung der Wirtschaft. Doch dieser zweite New Deal war nichts anderes als der Beginn der Kriegswirtschaft (die den 2. Weltkrieg vorbereitete). Es ist verständlich, dass diese Tatsache weitestgehend verschwiegen wird!
[6]Dieses Gesetz verpflichtete die US-Behörden zum Kauf von auf US-Märkten hergestellten Produktionsgütern.
[7]Quelle: contreinfo.info/prnart.php3?id_article=2612
[8]Martin Wolf ist ein britischer Wirtschaftsjournalist. Er war assoziierter freischaffender Redakteur und Chef-Kommentator im Bereich Wirtschaftsfragen bei der Financial Times.
[9]„L’ère des ‘Kolossal’ coups de pouce“ (Die Ära der „kolossalen“ Anschübe), veröffentlicht am 7 April 2009.
[10]Tatsächlich handelt es sich um 4.000 Milliarden Dollar, die von den USA als Rettungsmaßnahmen während der letzten Monate angekündigt wurden.
[11]In Japan wurde jüngst ein neues Konjunkturprogramm im Umfang von 15.400 Milliarden Yen (116 Milliarden Euro) beschlossen. Dies ist das vierte Programm, das innerhalb eines Jahres von Tokio beschlossen wurde!
[13]Zur Rolle der Verschuldung im Kapitalismus und zu seinen Krisen siehe den Artikel in dieser Ausgabe der Internationalen Revue Nr. 43, „Die schlimmste Wirtschaftskrise in der Geschichte des Kapitalismus“.
[14]Die Sonderziehungsrechte sind ein Währungskorb, der aus Dollar, Euro, Yen und britischen Pfund-Sterling besteht.
Insbesondere China hat auf diesen Sonderziehungsrechten bestanden. In den letzten Wochen hat das Reich der Mitte mehrere offizielle Erklärungen abgegeben und zur Schaffung einer internationalen Währung aufgerufen, die den Dollar ablösen soll. Zahlreiche Ökonomen auf der Welt haben diese Forderung aufgegriffen und vor dem unaufhaltsamen Verfall der US-Währung und den wirtschaftlichen Erschütterungen gewarnt, die daraus resultieren würden.
Es stimmt, dass die Schwächung des Dollars mit jedem weiteren Versinken der US-Wirtschaft in der Rezession eine echte Bedrohung für die Weltwirtschaft darstellt. Kurz vor Ende des II. Weltkrieges als internationale Leitwährung eingeführt, fungierte der Dollar seither als ein Stützpfeiler für die kapitalistische Stabilität. Dagegen ist die Einführung einer neuen Leitwährung (ob Euro, Yen, Britisches Pfund oder die Sonderziehungsrechte des IWF) vollkommen illusorisch. Keine Macht wird die USA ersetzen können, keine wird deren Rolle als internationaler ökonomischer Stabilitätsanker übernehmen können. Die Schwächung der US-Wirtschaft und ihrer Währung bedeutet somit wachsendes monetäres Chaos.
[15]Lenin bezeichnete den Völkerbund, eine andere internationale Institution, als „Räuberbande“.
Aktuelles und Laufendes:
- Weltwirtschaftskrise [193]
- G 20 London [218]
Filmbesprechung: Charles Darwin und der Baum des Lebens
- 2967 reads
David Attenboroughs BBC-Beitrag zur 200-Jahresfeier Darwins (Charles Darwin und der Baum des Lebens, 1.2.09) war eine meisterhafte Verteidigung der Evolutionstheorie. Attenborough vermittelte dabei mit seiner bekannten Fähigkeit komplexe wissenschaftliche Ideen. Er benutzte eine unkomplizierte Sprache und viele tolle Darstellungen durch Filme. Sein Enthusiasmus sprang wieder auf den Zuschauer über, und wie immer zeigte er Respekt vor der Natur.
David Attenboroughs BBC-Beitrag zur 200-Jahresfeier Darwins (Charles Darwin und der Baum des Lebens, 1.2.09) war eine meisterhafte Verteidigung der Evolutionstheorie. Attenborough vermittelte dabei mit seiner bekannten Fähigkeit komplexe wissenschaftliche Ideen. Er benutzte eine unkomplizierte Sprache und viele tolle Darstellungen durch Filme. Sein Enthusiasmus sprang wieder auf den Zuschauer über, und wie immer zeigte er Respekt vor der Natur.
Indem er die Ideen Darwins in ihren historischen Kontext einbettete, hob Attenborough die subversiven Folgen der Evolutionstheorie durch natürliche Zuchtwahl hervor, da das wissenschaftliche Establishment, mit dem Darwin es in den 1840er und 1850er Jahren zu tun hatte, noch stark durch eine statische Sicht der Natur beeinflusst war, der zufolge Wesen durch göttliche Schöpfung geschaffen wurden. Damals wurden weite Bereiche der Frühgeschichte der Erde durch die Entwicklung der Geologie zum ersten Mal erforscht. Attenborough zeigte sehr deutlich auf, wie Darwin mitgerissen wurde von der Kraft dieses neuen Fortschrittes des Bewusstseins der Menschen über ihre Stellung in der Natur, trotz seines Widerwillens, seine fromme Frau zu beleidigen und einen Skandal in der ‚höflichen’ Welt hervorzurufen. Abgesehen davon, dass sie ein mächtiger Ansporn für Darwin war die Veröffentlichung seines Werkes voranzutreiben, belegte die zeitgleiche Formulierung einer Theorie der natürlichen Zuchtwahl durch Alfred Wallace die unwiderstehliche Macht der Entwicklung der Ideen, wenn die Bedingungen dafür gereift sind.
Als er auf die zeitgenössischen Einwände gegen Darwins Theorie einging, behandelte Attenborough diese aber nicht mit Verachtung. Er ordnete sie lediglich auf dem Hintergrund der historischen Grenzen ein und zeigte mit großer Überzeugung, wie neue Erkenntnisse der Paläontologie und der Zoologie deren Grundlagen zerstörten. Mit besonderer Freude erzählte er die Geschichte der Archaeopteryx und des Schnabeltiers, Übergangsformen zwischen Reptilien und Vögeln und Säugetieren, die eine solide Antwort auf die Frage lieferte: „Wenn sich Arten entwickeln, wo sind die fehlenden Glieder?“
Natürlich war Darwin das Erzeugnis eines Bürgertums, das sich noch sehr in seiner Aufstiegsphase befand. Ein klares Zeichen, dass diese Phase lange hinter uns liegt, sieht man darin, dass heute, im 21. Jahrhundert, ziemlich einflussreiche Flügel der herrschenden Klasse – ob die christliche Rechte in den USA oder die verschiedenen islamischen Parteien in der ganzen Welt – sich zurückentwickelt haben und an der wortgetreuen Version des Kreationismus der Bibel oder des Korans klammern und Darwin weiterhin verteufeln, obgleich in den letzten 150 Jahren eine Menge Beweise für seine grundlegenden Ideen zusammengetragen wurden. Aber wie Pannekoek und andere hervorgehoben haben, wurden die Tendenzen des Bürgertums, in Religion zu flüchten und die kühnen, bilderstürmerischen Auffassungen ihrer revolutionären Blütezeit aufzugeben, ersichtlich, sobald das Proletariat offen als eine dem Kapitalismus entgegen gesetzte Kraft in Erscheinung trat (vor allem nach den Aufständen von 1848). Und ebenso begriff die Arbeiterbewegung sofort die revolutionären Folgen einer Theorie, die aufzeigte, dass Bewusstsein aus den unbewussten Schichten des Lebens als Reaktion auf ein materielles Umfeld entstehen kann und nicht durch die Vermittlung eines Herrschers von Oben. Die offensichtlichen Konsequenzen daraus waren, dass die weitestgehend unbewussten Massen auch ihr Bewusstsein über sich selbst entwickeln können mittels ihres Kampfes zur Befriedigung ihrer eigenen materiellen Bedürfnisse.
Natürlich hat sich nicht gesamte bürgerliche Klasse zum Kreationismus zurück entwickelt; es gibt nämlich auch einen bürgerlichen Konsensus, dem zufolge Wissenschaft und Technologie als solche fortschrittlich seien. Aber indem man sie von den gesellschaftlichen Verhältnissen abstrahiert, die deren Entwicklung ermöglichten, ist es unmöglich zu erklären, warum so viel wissenschaftliche Forschung und so viele technologische Durchbrüche dazu verwandt wurden, die Gesellschaft und die Natur zugrunde zu richten. Gerade diese Entwicklung hat viele derjenigen, die aus dem gegenwärtigen Gesellschaftssystem keinen Nutzen ziehen, dazu bewogen, nach Antworten in den Mythologien der Vergangenheit zu suchen. Das gleiche Phänomen der Abstoßung trifft auch auf die Auffassung von der Stellung des Menschen im Universum zu, die so viele bürgerliche 'Verteidiger' der Wissenschaft vertreten. Es handelt sich dabei um eine grenzenlos düstere Sicht, denn sie bringt eine zutiefst entfremdete Auffassung der grundlegenden Trennung des Menschen von einer feindlichen Umwelt zum Vorschein. Aber Attenborough gehört nicht dieser Kategorie an. Fliegende Vögel bewundernd oder spielende Schimpansen anlachend, schloss Attenborough seine Vorstellung im Film damit ab, indem er an eine andere Konsequenz der Darwinschen Theorie erinnerte, dass sie nämlich eine Infragestellung der Auffassung der Bibel vom Menschen als einem Wesen ist, das die Natur "beherrscht". Stattdessen bekräftigt er das tiefgehende Verhältnis der Menschen mit anderen Lebewesen und unsere völlige gegenseitige Interdependenz mit diesen. An dieser Stelle hörte sich Attenborough ein wenig an wie Engels und dessen Aussage in "Der Anteil der Arbeit in der Menschwerdung des Affen“ der eine Warnung gegen Hybris (Anmaßungen) aber auch eine Perspektive für die Zukunft enthält:
„Schmeicheln wir uns indes nicht zu sehr mit unsern menschlichen Siegen über die Natur. Für jeden solchen Sieg rächt sie sich an uns. Jeder hat in erster Linie zwar die Folgen, auf die wir gerechnet, aber in zweiter und dritter Linie hat er ganz andre, unvorhergesehene Wirkungen, die nur zu oft jene ersten Folgen wieder aufheben. Die Leute, die in Mesopotamien, Griechenland, Kleinasien und anderswo die Wälder ausrotteten, um urbares Land zu gewinnen, träumten nicht, daß sie damit den Grund zur jetzigen Verödung jener Länder legten, indem sie ihnen mit den Wäldern die Ansammlungszentren und Behälter der Feuchtigkeit entzogen. Die Italiener der Alpen, als sie die am Nordabhang des Gebirgs so sorgsam gehegten Tannenwälder am Südabhang vernutzten, ahnten nicht, daß sie damit der Sennwirtschaft auf ihrem Gebiet die Wurzel abgruben; sie ahnten noch weniger, daß sie dadurch ihren Bergquellen für den größten Teil des Jahrs das Wasser entzogen, damit diese zur Regenzeit um so wütendere Flutströme über die Ebene ergießen könnten. Die Verbreiter der Kartoffel in Europa wußten nicht, daß sie mit den mehligen Knollen zugleich die Skrofelkrankheit verbreiteten. Und so werden wir bei jedem Schritt daran erinnert, daß wir keineswegs die Natur beherrschen, wie ein Eroberer ein fremdes Volk beherrscht, wie jemand, der außer der Natur steht - sondern daß wir mit Fleisch und Blut und Hirn ihr angehören und mitten in ihr stehn, und daß unsre ganze Herrschaft über sie darin besteht, im Vorzug vor allen andern Geschöpfen ihre Gesetze erkennen und richtig anwenden zu können.“ [Engels: Dialektik der Natur, S. 274. Digitale Bibliothek Band 11: Marx/Engels, S. 8597 (vgl. MEW Bd. 20, S. 453)]
Amos 6.2.09, aus World Revolution, Zeitung der IKS in Großbritannien
Stellungnahme des Treffens kommunistischer Internationalisten in Lateinamerika
- 3179 reads
Wir veröffentlichen nachfolgend die gemeinsame Stellungnahme, die von sieben Gruppen oder Organisationen verabschiedet wurde, welche in acht lateinamerikanischen Staaten existieren[1]. Diese Stellungnahme berichtet über ein Internationalistisches Treffen, das neulich stattfand[2]. Dieses Treffen, dessen Projekt vor einem Jahr geplant worden war, ist in erster Linie möglich geworden durch die Entstehung dieser Gruppen, von denen die meisten (mit Ausnahme von OPOP und der IKS) vor drei Jahren noch nicht existierten. Zweitens wäre dieses Treffen nicht möglich gewesen ohne den gemeinsamen Willen aller Teilnehmer, die Isolierung zu durchbrechen und eine gemeinsame Arbeit zu entfalten[3]. Die Grundlage dieser Arbeit bestand darin, dass die Teilnehmer die Kriterien akzeptieren – welche in der Stellungnahme aufgeführt werden -, die diese als Bestandteile einer Abgrenzung zwischen der proletarischen und bürgerlichen Seite betrachten.
Der erste Schritt dieses Treffens war notwendigerweise die politische Diskussion, welche eine Klärung der bestehenden Konvergenzen und Divergenzen unter den Teilnehmern ermöglichen sollte, mit dem Ziel, einen Diskussionsrahmen zu erstellen, welcher zu einer Klärung der Divergenzen führen sollte.
Wir begrüßen aufs wärmste, dass dieses Treffen stattgefunden hat und dazu in der Lage war, wichtige Diskussionen abzuhalten wie zum Beispiel zum Thema gegenwärtige Lage des internationalen Klassenkampfes und Wesen der gegenwärtigen Krise, welche den Kapitalismus erschüttert. Wir haben volles Vertrauen, dass die Fortsetzung der Debatte fruchtbringende Klärungen hervorbringen wird[4].
Wir sind uns dessen bewusst, dass das Treffen nur ein kleiner Schritt hin zur Bildung eines internationalen Bezugspols ist, dessen Existenz, öffentliche Debatten und Interventionen, den Genossen, Kollektiven und Gruppen eine Orientierung bieten kann, die jetzt überall auf der Welt auftauchen und die Suche nach einer proletarischen internationalistischen Antwort auf eine immer schlimmere Lage darstellen, in welche der Kapitalismus die Menschheit treibt.
Aber wenn wir mit früheren Erfahrungen vergleichen – wie zum Beispiel den Internationalen Konferenzen der Kommunistischen Linken vor 30 Jahren[5] – stellt dieses Treffen eine Überwindung gewissser Schwächen dar, die damals aufgetreten waren. Während diese Konferenzen unfähig waren, eine gemeinsame Position gegenüber dem Afghanistankrieg zu verabschieden, welcher eine große Bedrohung für die Menschheit darstellte, vertritt die jetzige, einstimmig von den Teilnehmern angenommene Stellungnahme klare proletarische Positionen gegenüber der Krise des Kapitalismus.
Insbesondere wollen wir die entschlossene Anprangerung der kapitalistischen Alternativen der ‘Linken’ durch die Stellungnahme hervorheben, die überall auf dem amerikanischen Kontinent in Mode sind und auf der Welt nicht wenige Illusionen verbreiten. Von den USA mit dem Phänomen Obama bis zum argentinischen Patagonien, wird der Kontinent heute von Regierungen beherrscht, die von sich behaupten, die Armen, die Arbeiter, die Marginalisierten zu verteidigen, und die sich als Beschützer eines ‘sozialen’, ‘menschlichen’ Kapitalismus darstellen, oder in seinen ‘radikaleren’ Versionen, die – wie im Falle Chávez in Venezuela, Morales in Bolivien und Correa in Ecuador – beanspruchen, nichts weniger als den “Sozialismus des 21. Jahrhunderts” zu verkörpern.
Es erscheint uns höchst wichtig, dass gegenüber solchen Betrügern ein einheitlicher, brüderlicher und kollektiver Pol von internationalistischen Minderheiten seine Stimme erhebt, welche den Weg bereiten für Diskussionen und Stellungnahmen für internationale Solidarität, den unnachgiebigen Klassenkampf für die Weltrevolution, gegenüber dem Staatskapitalismus, dem Nationalismus, der Verewigung der Ausbeutung, welche von diesen “neuen Propheten” verkörpert wird. IKS, 26.4.09
Stellungnahme des Treffens in Lateinamerika
Nachfolgend veröffentlichen wir die gemeinsame Stellungnahme, die von dem Internationalistischen Treffen verabschiedet wurde. Demnächst werden wir die Beiträge der verschiedenen Teilnehmer für die Vorbereitung des Treffens und auch eine Synthese der Diskussionen veröffentlichen, die während des Treffens stattfanden.
Gemeinsame Stellungnahme
Der Kampf für den authentischen Kommunismus, d.h.. für eine klassenlose Gesellschaft, ohne Armut und ohne Kriege, ruft erneut ein wachsendes Interesse in einer Minderheit auf der ganzen Welt hervor. Als Zeuge dieses Phänomens hat im März 2009 aufgrund einer Initiative der Internationalen Kommunistischen Strömung und von Oposição Operaria (OPOP) in Lateinamerika ein Treffen internationalistischer Diskussion stattgefunden, an dem sich verschiedene Gruppen, Zirkel und einzelne Genoss/Innen des Kontinentes beteiligt haben, die klar internationalistische und proletarische Positionen vertreten. Neben der IKS und OPOP haben die folgenden Gruppen teilgenommen:
- Grupo de Lucha Proletaria (Perú)
- Anarres (Brésil)
- Liga por la Emancipación de la Clase Obrera (Costa Rica und Nicaragua)
- Núcleo de Discusión Internacionalista aus der Dominikanischen Republik
- Grupo de Discusión Internacionalista aus Ecuador
Darüber hinaus haben Genoss/Innen aus Peru und Brasilien ebenfalls an den Arbeiten dieses Treffens teilgenommen. Andere Genoss/Innen aus anderen Ländern wollten ebenfalls teilnehmen, konnten dies aber wegen materieller oder administrativer Schwierigkeiten nicht tun. Alle Teilnehmer erkennen die Kriterien an, welche wir nachfolgend zusammenfassen und die global ebenfalls bei der Durchführung der Konferenzen der Gruppen der Kommunistischen Linken in den 1970er und 1980er Jahren angenommen worden waren:
- Berufung auf den proletarischen Charakter des Oktober 1917 und der Kommunistischen Internationale, wobei diese Erfahrungen einer kritischen Bilanz unterzogen werden müssen, welche dann neue revolutionäre Anstürme des Proletariats leiten sollen.
- Bedingungslose Verwerfung jeglicher Idee, dass heute auf der Welt Länder bestehen, die sozialistisch wären oder von einer Arbeiterregierung geführt würden, auch wenn sie als “degeneriert” bezeichnet werden; Verwerfung ebenso jeglicher staatskapitalistischer Regierungsformen und der Ideologie des “Sozialismus des 21. Jahrhunderts” .
- Verwerfung der Sozialistischen und Kommunistischen Parteien und all deren Anhängsel als Parteien des Kapitals.
- Kategorische Verwerfung der bürgerlichen Demokratie, des Parlamentarismus und der Wahlprozesse, da dies Waffen sind, mit denen die Herrschenden es wiederholt geschafft haben, die Arbeiterkämpfe einzudämmen und abzulenken, indem fälschlicherweise zwischen Demokratie und Diktatur, Faschismus und Antifaschismus gewählt werden soll.
- Verteidigung der Notwendigkeit, dass die internationalistischen Revolutionäre hin zur Bildung einer internationalen Organisation der politischen Avantgarde voranschreiten sollen, die eine unabdingbare Waffe für den Sieg der proletarischen Revolution ist.
- Verteidigung der Rolle der Arbeiterräte als Organe der Arbeitermacht, sowie der Autonomie der Arbeiterklasse gegenüber den anderen Klassen und Schichten der Gesellschaft.
Auf der Tagesordnung der Diskussion standen die folgenden Punkte:
- Die Rolle des Proletariats und die gegenwärtige Situation, das Kräfteverhältnis zwischen den Klassen;
- Die Lage des Kapitalismus [der Hintergrund für die Entwicklung der gegenwärtigen Kämpfe], und als eine globalere Überlegung das Konzept der Dekadenz des Kapitalismus und/oder Strukturkrise des Kapitalismus;
- Die sich zuspitzende Umweltkatastrophe, in welche uns das System treibt. Obgleich dieser Punkt aus Zeitgründen nicht mehr behandelt werden konnte, wurde beschlossen, die Diskussion dazu im Internet durchzuführen.
Hinsichtlich des ersten Punktes wurden Beispiele aus Lateinamerika verwendet, um die Analyse der gegenwärtigen Entwicklung des Klassenkampfes zu verdeutlichen, aber das Anliegen der meisten Teilnehmer war, dies als einen Teil der allgemeinen Bedingungen des Arbeiterkampfes auf internationaler Ebene einzuordnen. Dennoch hat das Treffen beschlossen, die Entblößung der verschiedenen Regierungen hervorzuheben, die sich “links” schimpfen, und in den meisten Ländern Lateinamerikas an der Macht sind. Sie sind Todesfeinde der Arbeiterklasse und deren Kampfes. Auch wurden die Kräfte angeprangert, die die ‘linken’ Regierungen ‘kritisch’ unterstützen. Ebenso hat das Treffen die Kriminalisierung der Arbeiterkämpfe durch diese Regierungen verworfen. Es hat betont, dass die Arbeiterklasse keine Illusionen in legalistische und demokratische Kampfmethoden haben darf, sondern nur Vertrauen haben darf in ihren eigenen, autonomen Kampf.Dabei wurden insbesondere die folgenden Regierungen angeprangert:
· Kirchner in Argentinien,
· Morales in Bolivien,
· Lula in Brasilien,
· Correa en Ecuador,
· Ortega in Nicaragua
· Und insbesondere Chávez in Venezuela, dessen proklamierter "Sozialismus des 21. Jahrhunderts” nichts anderes ist als seine große Lüge, die dazu dient, Arbeiterkämpfe in diesem Land zu sabotieren und niederzuschlagen und den Arbeitern in den anderen Ländern Sand in die Augen zu streuen.
Beim zweiten Punktes stimmten alle Teilnehmer überein hinsichtlich der Schwere der gegenwärtigen Krise des Kapitalismus und der Notwendigkeit, sie tiefer innerhalb des Rahmens einer theoretischen und historischen Perspektive zu begreifen. Als Schlussfolgerung haben die Teilnehmer übereinstimmend erklärt:
- Die Durchführung des Treffens ist ein Ausdruck der gegenwärtigen Tendenz der Entwicklung des Kampfes und der revolutionären Bewusstwerdung des Proletariats auf internationaler Ebene.
- Die beträchtliche Zuspitzung der gegenwärtigen Krise des Kapitalismus kann langfristig nur diese Tendenz zur Entfaltung der Arbeiterkämpfe verstärken; damit wird die Verteidigung von revolutionären Positionen innerhalb des Proletariats immer notwendiger.
- In diesem Sinn halten alle Teilnehmer die Fortführung der Anstrengungen für erforderlich, die dieses Treffen mit dem Ziel zum Ausdruck bringt, eine aktive Rolle beim Kampf des internationalen Proletariats zu spielen.
Konkret haben wir als ersten Schritt dieser Anstrengungen beschlossen:
- Einrichtung einer Internet-Webseite auf Spanisch und Portugiesisch unter der gemeinsamen Verantwortung der Teilnehmergruppen am Treffen. Auch haben wir die Möglichkeit der Veröffentlichung einer Broschüre auf Spanisch mit Texten von der Webseite erörtert.
- Auf dieser Webseite sollen veröffentlicht werden:
- Diese Stellungnahme (welche ebenso auf den Webseiten der teilnehmenden Gruppen veröffentlicht wird)
- Die Beiträge zur Vorbereitung des Treffens
- Eine Synthese der Protokolle der verschiedenen Diskussionen
- Jeder Beitrag der anwesenden Gruppen und Einzelpersonen sowie jeder anderen Gruppe oder Genoss/In, die mit den Prinzipien und Anliegen, die in diesem Treffen im Mittelpunkt standen, übereinstimmen.
Das Treffen legt insbesondere Wert auf der Notwendigkeit einer offenen und brüderlichen Debatte unter Revolutionären und verwirft jedes Sektierertum und Kapellengeist.
[1]Mexiko, Dominikanische Republik, Brasilien, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador, Peru und Venezuela.
[2]Die Teilnehmer waren OPOP, IKS, LECO (Liga por la Emancipación de la Clase Obrera, Costa Rica - Nicaragua), Anarres (Brasil), GLP (Grupo de Lucha Proletaria, Peru), Grupo de Discusión Internacionalista de Ecuador, Núcleo de Discusión Internacionalista aus der Dominikanischen Republik, sowie einzelne Genossen.
[3]Wir haben von diesen neuen Regungen in unserem Artikel “Zwei neue Sektionen der IKS” berichtet. Siehe es.internationalism.org/cci-online/200902/2494/salud-a-las-nuevas-secciones-de-la-cci-en-turquia-y-filipinas [219]
[4]Eine der Entscheidungen des Treffens war die Schaffung eines Internet Forums [88], in dem die gemeinsame Stellungnahme und die Debatten veröffentlicht werden sollen.
[5]Siehe z.B. https://es.internationalism.org/node/2065 [220]
Aktuelles und Laufendes:
Leute:
- Chavez [223]
Theoretische Fragen:
- Internationalismus [69]
Juli 2009
- 886 reads
Der Krieg in Pakistan - Die USA verwandeln Pakistan in einen Kriegsschauplatz
- 2862 reads
(Der Artikel wurde von unserer Sektion in Indien geschrieben)
Wenige Tage bevor der pakistanische Präsident Zardari Präsident Obama treffen sollte, machte die Nachricht die Runde, dass die Taliban die Stadt Buner eingenommen hätten. Sofort wurde die Angst geschürt: Die Taliban kommen nach Islamabad, sie stehen nur noch 60 km vor der Stadt. Vielleicht ergreifen sie gar in ganz Pakistan die Macht und gewinnen somit die Kontrolle über die Atomwaffen. Als Zardari ins Flugzeug zu seiner Reise in die USA stieg, forderte das pakistanische Militär die Menschen im Swat-Tal und woanders auf, ihre Häuser zu verlassen und sich in Flüchtlingslager zu begeben. Bevor das Flugzeug Zardaris am 6 Mai in den USA landete, hatte die pakistanische Armee angefangen, Buner und andere Teile Pakistans aus Hubschraubern, Kampfflugzeugen, Panzern und mit Artillerie zu beschießen und zu bombardieren. Bald darauf flüchteten ca. 3 Mio. Menschen aus dem Kriegsgebiet, in dem sich die Armee und die pakistanischen Taliban bekämpften. Als Zardari in den USA am 6. Mai eintraf, verkündete Pakistan, 38 Talibankämpfer getötet zu haben. Natürlich erhielt Zardari dafür Lob von Obama.
Der pakistanische Staat macht keinen Hehl daraus, dass er von den USA dazu gezwungen wurde, gegen die Taliban Maßnahmen zu ergreifen. Aber die Wahrheit liegt ganz woanders, und es mag keine Überraschung sein, wenn man eines Tages herausfinden wird, dass die Taliban vom pakistanischen Geheimdienst ISI oder den US-Geheimdiensten dazu ermuntert wurden, sich in Buner niederzulassen, damit man einen Vorwand für diesen Krieg hat. Erregte Propaganda über den Feldzug der Taliban auf Islamabad ermöglichte es der pakistanischen Bourgeoisie in diesem Krieg die Bevölkerung um sich zu scharen. So konnte Amerika den Eindruck erwecken, es habe Pakistan dazu getrieben, diesen Krieg zu seinem eigenen Vorteil auszulösen.
In Wirklichkeit geht es bei diesem Krieg nicht darum, Osama bin Laden oder die islamischen Terroristen zu besiegen. Es ist bekannt, dass die USA selbst Osama bin Laden und die islamischen Mudschaheddin groß gezogen haben, um sie für ihre imperialistischen Interessen gegen die Sowjetunion einzusetzen. Sowohl die Taliban- und islamischen fundamentalistischen Horden, welche heute in Pakistan aktiv sind, wurden vom pakistanischen Staat hochgepäppelt, um sie als Werkzeug bei dessen imperialistischer Politik und als soziales Kontrollmittel zu verwenden. Es stimmt, "die Geister, die ich rief, werd' ich nun nicht mehr los", aber bei diesem Krieg geht es um mehr als dies.
Seit dem Zusammenbruch des Ostblocks und später des westlichen Blocks bemühen sich die USA darum, ihre globale Vormachtstellung aufrechtzuerhalten und sie der Welt weiterhin aufzuzwingen. Während der letzten beiden Jahrzehnte ist ihre Macht immer mehr untergraben worden, aber ihre Entschlossenheit die Nummer Eins unter den globalen imperialistischen Gangstern zu bleiben, hat nicht nachgelassen. Die USA begannen den Krieg im Irak, um ihre Rivalen abzuschrecken und in einer Region Fuß zu fassen, die von großer strategischer Bedeutung ist. Ihr Angriff gegen Afghanistan 2001 und der seitdem fortdauernde Krieg sollen dazu dienen, ihre Vorherrschaft in Süd- und Zentralasien zu errichten, um ihre Rivalen China und Russland auszubremsen. Indem Pakistan zu einem Kriegsschauplatz wurde, haben die USA ihre Position aber nicht nur in Afghanistan ausgebaut. Sie haben damit auch den Einfluss Chinas in Pakistan eingedämmt sowie den US-Einfluss in der ganzen Region erweitert, um so auch den imperialistischen Träumen Indiens entgegentreten zu können. Diese Ziele vor Augen, haben die USA seit einem Jahr Schritte unternommen, um Pakistan noch mehr in den Krieg zu treiben.
Der jüngste Krieg in Pakistan wälzt die ganze Region von Südasien bis zum Mittleren Osten erneut um. Auch werden dadurch nur neue, zukünftige Kriege vorbereitet. Als ein kleiner Gangster, der in den Klauen eines großen Gangsters festhängt, wurde Pakistan gezwungen, sich einzureihen, aber selbst in dieser sehr gefährlichen Lage verzichtet es nicht darauf, seine eigenen imperialistischen Interessen auszufechten.
Die Geschichte der imperialistischen Politik Pakistans
Der maoistischen und stalinistischen Legende zufolge, ist der Imperialismus nur das Merkmal der USA und anderer westlicher Staaten. Ihnen zufolge spielen herrschende Cliquen in Drittweltländern wie Indien und Pakistan, wenn sie sich in blutigen militärischen Abenteuern gegenseitig bekämpfen, nur die Rolle von "Kompradoren" oder Lakaien von der einen oder anderen Großmacht, ohne jeweils eigene imperialistische Ambitionen zu haben.
Es gibt natürlich auf der ganzen Welt endlos viele Beispiele, die diese Mythen der Linken entlarven und aufzeigen, dass die herrschende Klasse jeder Nation, egal wie arm und erbärmlich sie sind, von den gleichen imperialistischen Appetiten wie die "Großmächte" getrieben werden. Vor wenigen Monaten lieferte Sri Lanka ein skrupelloses und blutiges Beispiel einer kleinen kapitalistischen Bande, die sich in einen Quasi-Völkermord an den Tamilen stürzte, um deren weitere Unterdrückung sicherzustellen.
Die Geschichte Pakistans ist ein deutliches Beispiel einer hartnäckigen, rücksichtslosen Verteidigung der imperialistischen Interessen selbst gegenüber der feindseligen Haltung der globalen Mächte. Die herrschende Klasse Pakistans wurde nie durch 'minderwertige' Aspekte abgeschreckt wie der Tatsache, dass die Bevölkerung in großer Armut und mittelalterlicher Rückständigkeit lebt, die Wirtschaft am Rande des Bankrotts taumelt und der politische Apparat immer dabei ist sich zu zerfetzen, wo "gewählte" Regierungen regelmäßig von Militärjuntas abgelöst werden, die "Zivilverfassungen" nur als Toilettenpapier benutzen.
Die Bruchstücke ihres eigenen Staates und der auseinander brechenden Gesellschaft lassen die herrschende Klasse Pakistans nur noch rücksichtsloser werden. Dies spiegelt sich in ihren Genoziden an Bangladeshis wider, ihrem Schwarzhandel mit Nuklearprodukten, den nur gering verschleierten terroristischen Angriffen gegen ihren Rivalen Indien oder durch die frenetische Unterstützung der fundamentalistischen Gangs, mit denen sie sich jetzt herumschlägt.
"Goldene" Jahre pakistanischer imperialistischer Politik
In vieler Hinsicht waren die Jahre des Krieges gegen Russland in Afghanistan und die Zeit danach die "goldenen" Jahre der imperialistischen Politik Pakistans. Obgleich damals der Konflikt im Wesentlichen zwischen den USA und der UdSSR geführt wurde, passte dieser gut den imperialistischen Ambitionen Pakistans. Die afghanischen Mudschaheddin entstanden und später die Taliban, welche von den USA als ein Kriegswerkzeug gegen die Sowjets bewaffnet und finanziert wurden; aber die direkte Kontrolle dieser Kräfte lag in den Händen der Armee und der Geheimdienste Pakistans, der ISI. Als die Sowjets Afghanistan verließen und einige Jahre später die Taliban Kabul übernahmen, bedeutete dies einen großen Sieg Pakistans. Pakistan verfügte nun mit Afghanistan über einen Satellitenstaat. Es konnte davon träumen, seinen Einfluss in Zentralasien auszudehnen, und seine Armee prahlte damit, nun mehr strategisches Gewicht gegenüber Indien gewonnen zu haben. Darüber hinaus konnte es seinen Rivalen Indien mit Hilfe der Gewalt der Separatisten in Kashmir, die damals ihren Höhepunkt erreichte, an die Wand drängen.
Aber als die USA Afghanistan bei ihrem "Krieg gegen den Terror" angriffen und das Taliban-Regime in Kabul im November 2001 fiel, erlitt Pakistan einen herben Rückschlag. All seine Gewinne aus den vergangenen zwei Jahrzehnten waren verloren. Nicht nur verfügte Pakistan nun über keinen Einfluss mehr in Afghanistan, sondern auch sein Erzfeind Indien war dabei, dort Fuß zu fassen. Aber wie alle anderen imperialistischen Staaten konnte Pakistan nicht umhin, seine imperialistischen Interessen zu verteidigen. Selbst als die US-geführte Allianz in Kabul einmarschierte und die Taliban dort verjagt wurden, versuchte Pakistan seine "strategischen Pfründe" zu retten – die ganze Taliban-Führung zog nach Pakistan um und ihr wurde vom pakistanischen Geheimdienst ISI eine Fluchtstätte in Balutschistan angeboten. Seitdem hat Pakistan trotz seines Bündnisses mit den USA die Taliban-Führung, die in Quetta ihr Quartier aufgeschlagen hat, eifrig geschützt.
Nach November 2001 blieben die USA in ihrem Krieg im Irak stecken, ihre Macht ist geschwächt, der Einfluss der Taliban ist in Afghanistan wieder auf dem Vormarsch, ein Prozess, bei dem Pakistan keine geringfügige Rolle gespielt hat. Bis zum Hals im Irak in Schwierigkeiten steckend, hat der US-Imperialismus "sorgsam ignoriert, dass sich die afghanischen Taliban und die Führung von Al Quaida in den Stammesgebieten Pakistans versammeln…". Der pakistanische Staat hat dies dazu ausgenutzt, um "die Taliban als Stellvertreter Pakistans für den Krieg einzuspannen… Bis 2008 sah es so aus, als ob Pakistan das Spiel gewinnen würde" (Ahmed Rashid, Yale Global, 18.09.2008).
Aber in dem Maße wie die Taliban stärker wurden und die US-Kontrolle über Afghanistan infrage stellten, fing die US-Armee Mitte 2008 an, gegenüber der Präsenz der afghanischen Taliban in den Stammesgebieten Pakistans zu reagieren. Seit August 2008 haben die USA regelmäßig Angriffe mit Drohnen in afghanischen Talibanhochburgen in FATA in Pakistan durchgeführt. Im September 2008 drangen US-Soldaten in FATA ein. Sie wollten eine deutliche Botschaft an den pakistanischen Staat übermitteln, um diesen zu zwingen, sich den imperialistischen Interessen der USA unterzuordnen. Seitdem bedroht die US-Bourgeoisie ständig Pakistan, "entweder geht ihr gegen die Taliban-Hochburgen in Pakistan vor oder wir gehen selbst gegen sie vor".
Diese Af-Pak genannte Politik ist seit der Machtübernahme durch Obama nur intensiviert worden. Kernpunkt dieser Politik ist, wenn die USA in Afghanistan siegen wollen, müssen sie Pakistan zwingen, gegen afghanische und pakistanischeTaliban in Pakistan Krieg zu führen. Aber es geht den USA nicht nur um einen Sieg in Afghanistan.
Die Af-Pak Politik bringt auch Pakistan unter eine strengere und direktere Kontrolle der USA, so dass sie sich besser mit China und Russland in unmittelbarer Umgebung befassen können. Diese Politik bringt auch die indische Bourgeoisie in Bedrängnis, weil diese nun nicht weiß, was sie tun soll.
Um ihre Ziele zu verfolgen, müssen die USA den pakistanischen Staat genau wie den Nachbarstaat Afghanistan in einen Bürgerkrieg und Chaos stürzen – koste es was es wolle!
Die Taliban – ein Monster, das aus imperialistischem Krieg und dem Zerfall der Gesellschaft geboren wurde.
NWFP, FATA und die Nördlichen Territorien in Pakistan, in denen mehr als 30 Millionen Paschtunen wohnen, sind vielleicht die ärmsten Gebiete eines verarmten Landes. In einem Gebiet wie den FATA, wo 5.6 Mio. Menschen wohnen, leben nur 3% der Menschen in Städten, lediglich 17% können lesen und schreiben. Der große Landadel, dessen Wurzeln bis in den Feudalismus zurückreichen, besteht weiterhin und raubt eine verarmte Bauernschaft aus. Das Verwaltungssystem, (agency system) wurde von den Briten im 19. Jahrhundert eingeführt, um die Paschtunen niederzuhalten. Bis vor einigen Jahren besaß die Bevölkerung kein Wahlrecht und sie durfte auch keiner politischen Partei beitreten. In diesen verarmten Gegenden brodelten oft ethnische Unruhen. Paschtunen kämpften gegen den pakistanischen Staat. In den 1960er und 1970er Jahren entstand eine größere paschtunische Separatistenbewegung, die von Indien und Afghanistan unter Zahir Shah unterstützt wurde.
Diese Bewegung wurde niedergeschlagen, aber die Feindseligkeit der Paschtunen gegenüber der von Punjabis beherrschten Region des pakistaninschen Staats verschwand damit nicht. Dem pakistanischen Staat gelang es lediglich während des Kampfes gegen die Russen in Afghanistan diese für sich einzuspannen. Damals flüchteten Millionen von Menschen aus Afghanistan, meistens Paschtunen, in Lager in NWFP und FATA. Als die USA und Pakistan mit der Rekrutierung und dem Aufbau der islamischen Mudschaheddin und später den Talibankräften für Afghanistan begannen, unterstützten sie islamisch fundamentalistische Kräfte im Interesse ihrer Infrastruktur.
Einige Jahre lang konnte Pakistan zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen – als es die militärischen Verbände der Mudschaheddin und der Taliban aufstellte, um den USA und seinen eigenen imperialistischen Interessen in Afghanistan zu dienen, wurde die paschtunische Bevölkerung zur Unterstützung dieser militärischen Verbände geworben und mobilisiert. Damit nahm der Einfluss der islamischen Fundamentalisten und der Taliban in dieser Region zu.
Aber diese Entwicklung blieb nicht auf den Nordwesten Pakistans beschränkt. Durch ein Gefühl der eigenen "Unverzichtbarkeit" für die USA in Afghanistan beflügelt, förderte der pakistanische Staat ebenfalls fundamentalistische Organisationen in anderen Teilen des Landes. Diese dienten einerseits als ein Werkzeug für die Aufrechterhaltung des sozialen Zusammenhaltes in einer auseinanderbrechenden Gesellschaft und als Rekrutierzentren für afghanische Taliban und für die eskalierende Separatistenbewegung in Kaschmir in Indien, die damals die blutigsten Ausmaße annahm. Fundamentalistische und Jihad-Ideologie drangen in den pakistanischen Staat vor, vor allem in seine Armee und seine Geheimdienste, so dass es schwierig wurde zwischen "Steuernden" und "Gesteuerten" zu unterscheiden.
Diese Politik gelang solange die Taliban in Kabul an der Macht waren. Aber das Spiel wurde gefährlich, als die Taliban 2001 ihre Macht verloren. Seitdem ist der paukistische Staat gezwungen, ein doppeltes Spiel zu betreiben – sowohl mit den Amerikanern als auch mit den islamischen Kräften in Pakistan selbst. Gleichzeitig bietet er vertriebenen afghanischen Führungskräften Schutz an und einen Nährboden für deren örtlichen islamischen Gangs in NWFP, FATA, um diese wieder mit neuen Kräften zu versorgen. Gleichzeitig muss der pakistanische Staat aufgrund von US-amerikanischen Drohungen, Angriffen von Drohnen und anderen militärischen Vorstößen von Zeit zu Zeit gegen lokale islamistische und Taliban vorgehen.
Die Einheit, die zuvor zwischen den islamistischen Kräften und großen Teilen des pakistanischen Staates bestanden hatte, neigte dazu sich aufzulösen, als islamistische und pakistanische Talibans anfingen, gegen den pakistanischen Staat zu kämpfen. Aber bis zum letzten Moment, bis wenige Wochen vor dem 5. Mai 2009, war der pakistanische Staat unwillig einen Krieg gegen die Taliban in Pakistan zu starten, da er spürte, man werde auf einen noch größeren Abgrund zusteuern. Die letzten Ereignisse weisen darauf hin, dass selbst nachdem der pakistanische Staat in einen Abgrund stürzt, dieser nicht aufgehört hat, den Mullah Omar und andere afghanische Taliban als eine Verhandlungsmasse mit den USA zu benutzen.
Die ausgebeutete Bevölkerung wird in eine wahre menschliche Tragödie gestürzt
Als die Armee mit der Bombardierung der Städte und Dörfer am 6. Mai 2009 begann, wurde der ursprünglich auf Bunder und das Swat-Tal begrenzte Aufruf, die Häuser zu verlassen, auf mehrere Bereiche des NWFP (NorthWest Frontier Province) Nordwestliche Grenzprovinz, oder auch kurz Nordwestprovinz genannt, und FATA Federally Administered Tribal Areas/Stammesgebiete unter Bundesverwaltung) Pakistans ausgedehnt. Wer dem Aufruf nicht folgte, wurde zur Flucht gezwungen, als "Hubschrauber, Kampfflugzeuge und Artillerie loslegten und die Gegend beschossen" (The Dawn, 8.5.2009) und Zivilisten sowohl von den Taliban als auch von der Armee als menschliche Schutzschilde verwendet wurden, die Panzer in engen, dicht bevölkerten Straßen stationierte. Straßen wurden entweder von den Taliban oder der Armee blockiert. "Telefonnetze, Wasser und Elektrizität wurden alle von den Behörden der Stadt Mingora unterbrochen" (BBC, 9.5.09).
Bald stieg die Zahl der Binnenflüchtlinge, d.h. Menschen, die vor dem Krieg zwischen zwei bürgerlichen Lagern, der Armee und den Taliban, flüchten mussten, auf fast drei Millionen. In einigen der Bezirke wie Buner mussten bis zu 90% der Bevölkerung ihre Wohnungen verlassen. In anderen Bezirken wie dem Swat-Tal, Bajaur und Mohmand ist die Hälfte der Bevölkerung geflüchtet. Städte wie Mingora, in denen ca. 500.000 Menschen leben, wurden zu Geisterstädten, in denen Panzer auf den Straßen patrouillierten. Während die pakistanische Armee, die nur sich selbst verantwortlich ist, und die war-lords der Taliban ihre Kämpfe gnadenlos untereinander austragen – das Verhalten der beiden Seiten zeigt den Zerfall des pakistanischen Staates -, leben drei Millionen Menschen in Zelten oder nur auf der Straße und in Slums. Einige der Flüchtenden "starben auf der Straße", niemand war bereit uns irgendeine Hilfe anzubieten, weder die Armee noch die Taliban. Sie verüben beide Grausamkeiten und Gewalttaten an der Zivilbevölkerung" (Al Jazira, 11.5.09, Berichte eines Flüchtlings).
Am ersten Tag der Kämpfe starben 35 Zivilisten. Seitdem zählt das Militär die Zahl der Toten unter den Zivilisten nicht mehr, obgleich sie behaupten, ca. 1600 Taliban-Kämpfer getötet zu haben. Aus der Sicht des Herrn Gilani, den pakistanischen Premierminister, stellt die Tötung von Zivilisten durch die Armee lediglich ein "Kollateralschaden" dar. Aber für die drei Millionen Flüchtlinge und all die armen Dorfbewohner, die erst gar nicht fliehen konnten, ist das eine riesige Tragödie. Für sie ist die Rolle der Taliban und der Armee abscheulich. Unter Tränen berichtete ein junges, geflüchtetes Mädchen der pakistanischen Zeitung, The Dawn, am 8.5.09: "Wir haben Angst vor den Taliban und der Armee… Wenn sie sich gegenseitig bekämpfen wollen, sollten sie sich gegenseitig töten, sie sollten aber nicht in unsere Häuser flüchten".
Kein Ende der Kriege und der Barbarei innerhalb des Kapitalismus
Afghanistan wird seit mehr als drei Jahrzehnten durch Bürgerkrieg und Chaos zerrüttet. Unfähig die Lage in Afghanistan trotz ihrer mehr als achtjährigen Anwesenheit zu stabilisieren, haben die USA nun Pakistan dazu getrieben, sich in einen Bürgerkrieg und noch mehr Chaos zu stürzen. Die Voraussetzungen für noch mehr Kriege in der Zukunft werden geschaffen. Die ganze Region, von Pakistan über Afghanistan und Irak, ist zu einem Kriegsschauplatz geworden, mit einer unglaublichen Barbarei und menschlichen Tragödien.
Die pakistanische Armee mag verkünden, einen schnellen Sieg über die Taliban im Swat-Tal errungen zu haben, aber diesem Krieg in Pakistan wird damit kein schnelles Ende gesetzt. Ein Bericht der New York Times schrieb. "Die Taliban schmolzen sozusagen ohne einen größeren Kampf hinweg; vielleicht nur um wieder aufzutauchen, sobald sich das Militär zurückgezogen hat oder um woanders Kämpfe anzuzetteln." NYT, 27.6.2009. Nachdem der Krieg nach Süd-Wasiristan und andere Gebiete Pakistans gebracht wurde, muss die pakistanische Armee in den 'eroberten Gebieten' nun verbleiben, um dort weiterhin Kämpfe auszutragen. Es gibt jetzt schon Anzeichen, dass der Krieg zwischen pakistanischen Taliban und dem pakistanischen Staat zu einem Krieg zwischen Paschtunen und den pakistanischen Staat mutieren könnte. Als ein Hinweis auf zukünftige Kämpfe meinte ein früherer pakistanischer Botschafter in Afghanistan, ein Paschtune, Rustam Shah Mohmand, das militärische Vorgehen sei ein "Genozid an den Paschtunen" (Al Dschasira, 12. Mai 2009).
Auch amerikanische Experten sehen diese Gefahr. "Die pakistanische Armee beseht größtenteils aus Pundjabis. Die Taliban sind ausschließlich Paschtunen. Jahrhunderte lang haben Paschtunen dafür gekämpft, Pundjabis vom Eindringen abzuhalten. Wenn man Pundjabi-Soldaten in Paschtunengebiet zur Bekämpfung von Djihad-Kämpfern schickt, treibt dies das Land in einen ethnisch bestimmten Bürgerkrieg“ (Selig S. Harrison, Washington Post, 11h May 2009).
All das zeigt nicht in Richtung Frieden sondern bereitet nur noch mehr Kriege unter rivalisierenden bürgerlichen Fraktionen und noch mehr Barbarei und menschliche Misere für die Arbeiterklasse und die ausgebeuteten Schichten vor.
Eingeklemmt zwischen dem globalen Zerfall ihres Systems und der größten Krise ihrer Geschichte, hat die herrschende Klasse der Arbeiterklasse und den anderen ausgebeuteten Schichten nichts anderes als Kriege und Barbarei anzubieten. Für die Arbeiterklasse wäre es ein großer Rückschlag und ein Sieg für die Herrschenden, wenn es diesen gelingen sollte, die Arbeiterklasse hinter den pakistanischen Staat zu mobilisieren oder hinter Teilen der ethnisch sich abgrenzenden Bourgeoisie (Paschtunen, Balutschen, Sindhi).
Der einzige Weg vorwärts für die Arbeiterklasse und die ausgebeuteten Schichten ist die Entwicklung des Klassenkampfes und die Errichtung der Einheit als Klasse über alle ethnischen und nationalen Grenzen hinweg. Nur so kann die Arbeiterklasse die Mittel entwickeln, um das faulende kapitalistische System zu überwinden und die Spirale der Barbarei zu zerschlagen. AM, 5.7.09
Die pakistanische [224] Nordwestliche Grenzprovinz, auch North-West Frontier Province [1] [225] (englisch), NWFP oder auch kurz Nordwestprovinz genannt, ist die flächenmässig kleinste der vier pakistanischen Provinzen. Sie ist überwiegend von Paschtunen [226] bevölkert. Große Teile der Provinz gehörten einst zu Afghanistan [227]. Die Hauptstadt der NWFP ist Peschawar [228]. Die Nordwestprovinz und die Stammesgebiete unter Bundesverwaltung [229] (FATA) werden von den Afghanen Ost-Afghanistan oder auch Paschtunistan genannt.
Deutsche Revolution Teil V: Die von der Sozialdemokratie eingeleitete Repression bereitete dem Faschismus den Weg
- 4337 reads
Die Niederlage der proletarischen Revolution in Deutschland war ein entscheidender Wendepunkt im 20. Jahrhundert, weil sie auch die Niederlage der Weltrevolution bedeutete. In Deutschland markierte die Etablierung des Nazi-Regimes, das auf der Zerschmetterung des revolutionären Proletariats aufbaute, die Beschleunigung des Marsches Deutschlands in den Zweiten Weltkrieg. Die besondere Barbarei des Nazi-Regimes sollte sehr bald als eine Rechtfertigung für die antifaschistischen Kampagnen dienen, die darauf abzielten, das Proletariat des „demokratischen“ imperialistischen Lagers in den nahe bevorstehenden Krieg zu zwingen. Laut der antifaschistischen Ideologie war der demokratische Kapitalismus das kleinere Übel, das bis zu einem gewissen Grad die Bevölkerung vor all dem Schlechten in der bürgerlichen Gesellschaft bewahren könne. Diese Mystifikation, die noch immer gefährliche Auswirkungen auf das Bewusstsein der Arbeiterklasse hat, wird durch die revolutionären Kämpfe in Deutschland widerlegt. Sie wurden von der Sozialdemokratie besiegt, die eine Herrschaft des Terrors entfesselte und so den Weg für den Faschismus ebnete. Dies ist einer der Gründe, warum die herrschende Klasse es vorzieht, diese Ereignisse in einen dicken Mantel des Schweigens zu hüllen.
Die Niederlage der proletarischen Revolution in Deutschland war ein entscheidender Wendepunkt im 20. Jahrhundert, weil sie auch die Niederlage der Weltrevolution bedeutete. In Deutschland markierte die Etablierung des Nazi-Regimes, das auf der Zerschmetterung des revolutionären Proletariats aufbaute, die Beschleunigung des Marsches Deutschlands in den Zweiten Weltkrieg. Die besondere Barbarei des Nazi-Regimes sollte sehr bald als eine Rechtfertigung für die antifaschistischen Kampagnen dienen, die darauf abzielten, das Proletariat des „demokratischen“ imperialistischen Lagers in den nahe bevorstehenden Krieg zu zwingen. Laut der antifaschistischen Ideologie war der demokratische Kapitalismus das kleinere Übel, das bis zu einem gewissen Grad die Bevölkerung vor all dem Schlechten in der bürgerlichen Gesellschaft bewahren könne. Diese Mystifikation, die noch immer gefährliche Auswirkungen auf das Bewusstsein der Arbeiterklasse hat, wird durch die revolutionären Kämpfe in Deutschland widerlegt. Sie wurden von der Sozialdemokratie besiegt, die eine Herrschaft des Terrors entfesselte und so den Weg für den Faschismus ebnete. Dies ist einer der Gründe, warum die herrschende Klasse es vorzieht, diese Ereignisse in einen dicken Mantel des Schweigens zu hüllen.
Ordnung herrscht in Berlin
Am Abend des 15. Januars 1919 verlangten fünf Mitglieder der bewaffneten bürgerlichen Selbstschutztruppe des wohlhabenden Bezirks Wilmersdorf in Berlin, unter ihnen ein Geschäftsmann und ein Branntweinbrenner, Einlass in die Wohnung der Familie Marcusson, wo sie drei Mitglieder des Zentralorgans der jungen Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) entdeckten: Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg und Wilhelm Pieck. „Konventionelle“ Geschichtsbücher sagen noch immer, dass die KPD-Führer „verhaftet“ worden seien. In Wahrheit wurden Liebknecht, Luxemburg und Pieck verschleppt. Obwohl die Aktivisten der „Bürgermiliz“ davon überzeugt waren, dass ihre Gefangenen Kriminelle waren, händigten sie sie nicht der Polizei aus. Stattdessen brachten sie sie in das Luxushotel Eden, wo erst am Morgen desselben Tages die Garde-Kavallerie-Schützen-Division (GKSD) ihr neues Hauptquartier eingerichtet hatte.
Die GKSD war eine Eliteeinheit der kaiserlichen Armee gewesen, ursprünglich die Leibwache des Kaisers selbst. Wie ihre Nachfolger im II. Weltkrieg, die SS, entsandte sie „Schock“truppen an die Kampffront, hatte aber auch ihr eigenes Spionage- und Sicherheitssystem. Sobald die Neuigkeiten vom Ausbruch der Revolution die Westfront erreicht hatten, marschierte die GKSD heimwärts, um die Führung der Konterrevolution zu übernehmen, und erreichte den Großraum Berlin am 30. November. Dort führte sie den Angriff vom Heiligabend gegen die revolutionären Matrosen im kaiserlichen Stadtschloss an, wobei sie Artillerie und Gasgranaten inmitten der City einsetzte.[1]
In seinen Memoiren rief der Oberbefehlshaber der GKSD, Waldemar Pabst, in Erinnerung, wie einer seiner Offiziere, ein katholischer Aristokrat, Rosa Luxemburg zu einer „Heiligin“ erklärte, nachdem er eine Rede von ihr gehört hatte, und ihn bat, ihr zu gestatten, sich an seine Einheit zu wenden. „In diesem Augenblick“, erklärte Pabst, „erkannte ich die ganze Gefährlichkeit der Frau Luxemburg. Sie war gefährlicher als alle anderen, auch die mit der Waffe“.[2]
Die fünf kühnen Vertreter von Recht und Ordnung aus Wilmersdorf wurden, als sie das Paradies von Hotel Eden erreichten, stattlich für ihre Dienste belohnt. Die GKSD war eine der drei Organisationen in der Hauptstadt, die beträchtliche finanzielle Belohnungen für die Ergreifung von Liebknecht und Luxemburg ausgelobt hatten.[3]
Pabst erstattete einen kurzen Bericht über das Verhör Rosa Luxemburgs an jenem Abend. „Sind Sie Frau Luxemburg?“, fragte er. „Entscheiden Sie bitte selber. „Da sagte ich, nach dem Bilde müssen Sie es sein. Darauf entgegnete sie mir: Wenn Sie es sagen“ (ebenda, S. 28). Dann nahm sie eine Nadel heraus und begann, ihr Kleid zu flicken, dessen Saum bei ihrer Festsetzung zerrissen worden war. Schließlich begann sie eines ihrer liebsten Bücher – Goethes Faust – zu lesen und die Anwesenheit ihres Verhörers zu ignorieren.
Sobald sich die Nachricht von der Ankunft der ergriffenen „Spartakisten“ verbreitete, brach eine Pogromatmosphäre unter den Gästen des eleganten Hotels aus. Pabst jedoch hatte seine eigenen Pläne. Er rief die Leutnants und Offiziere der Marine, hoch respektierte Ehrenmänner, zusammen. Männer, deren „Ehre“ in besonderer Weise verletzt worden war, da es ihre eigenen Untergebenen, die Matrosen der Reichsflotte, waren, die gemeutert und die Revolution begonnen hatten. Diese Herrschaften schworen schließlich einen Eid unter Ehrenmännern, ein Schweigegelübde für den Rest ihres Lebens über das, was nun folgen sollte.
Ihnen ging es darum, ein Gerichtsverfahren zu vermeiden, eine „standrechtliche Exekution“ oder ähnliches, die die Opfer als Helden oder Märtyrer erscheinen lassen würde. Die „Spartakisten“ sollten einen schändlichen Tod sterben. Es wurde verabredet vorzutäuschen, Liebknecht ins Gefängnis zu bringen, dabei einen Autoschaden im Tiergarten vorzutäuschen und ihn „auf der Flucht“ zu erschießen. Da solch eine Lösung wohl kaum glaubwürdig gewesen wäre, was Rosa Luxemburg mit ihrem allseits bekannten Hüftschaden, der sie humpeln ließ, betraf, wurde beschlossen, dass sie dem Schein nach einem Mob von Zivilisten zum Opfer fallen sollte. Die Rolle des Mobs wurde dem Marineleutnant Herman Souchon überantwortet, dessen Vater, Admiral Souchon, im November 1918 als Kommandant von Kiel schändlicherweise dazu gezwungen wurde, mit den revolutionären Arbeitern und Matrosen zu verhandeln. Er sollte außerhalb des Hotels warten, um zum Auto hinüberzulaufen, Rosa Luxemburg wegzureißen und ihr in den Kopf zu schießen.
Im Verlaufe der Ausführung dieses Plans trat ein unvorhergesehenes Element auf, in Gestalt eines Soldaten namens Runge, der mit seinem Hauptmann, einen Mann namens Petri, vereinbart hatte, nach seinem Feierabend um 23 Uhr dienstbereit zu bleiben. Sie waren entschlossen, die Hauptbelohnung für die Liquidierung dieser Revolutionäre einzuheimsen. Als Liebknecht zum Auto vor dem Hotel gebracht wurde, versetzte Runge ihm mit dem Gewehrkolben einen heftigen Schlag auf den Kopf – eine Tat, die die Story, Liebknecht sei „auf der Flucht erschossen“ worden, erheblich in Misskredit brachte. Bei der allgemeinen Konsternierung, die diese Tat verursachte, dachte niemand daran, Runge vom Ort zu entfernen. Als Rosa Luxemburg aus dem Hotel gebracht wurde, schlug Runge, in voller Uniform, sie bewusstlos, indem er dasselbe Mittel anwendete. Als sie auf dem Boden lag, versetzte er ihr einen zweiten Schlag. Nachdem sie halbtot in das wartende Auto geworfen wurde, versetzte ihr ein anderer dienstbereiter Soldat, von Rzewuski, einen weiteren Schlag. Erst dann rannte Souchon nach vorn, um sie zu exekutieren. Was folgte, ist hinreichend bekannt. Liebknecht wurde im Tiergarten erschossen. Die Leiche Rosa Luxemburgs wurde in den nahe gelegenen Landwehrkanal versenkt[4]. Am folgenden Tag hatten die Mörder ihre Fotos zu ihrer Feier mitgenommen.
Nachdem sie ihr Entsetzen und ihre Verurteilung dieser „Gräueltaten“ ausgedrückt hatte, versprach die sozialdemokratische Regierung die „rigoroseste Untersuchung“ – die sie in die Hände der Garde-Kavallerie-Schützen-Division legte... Der Leiter der Untersuchung, Jorns, der durch Enthüllungen über den Völkermord der deutschen Armee in „Deutsch-Südwestafrika“ vor dem Krieg zu einer gewissen Reputation gelangt war, richtete sein Büro im Hotel Eden ein, wo er in seinen „Ermittlungen“ von Pabst und einem der beschuldigten Mörder, von Pflugk-Harrtung, assistiert wurde. Der Plan, auf Zeit zu spielen und dann die Idee eines Gerichtsfalls zu begraben, wurde jedoch von einem Artikel durchkreuzt, der am 12. Februar in der Roten Fahne, der Zeitung der KPD, erschien. Dieser Artikel, der dem bemerkenswert nahe kam, was sich als konkrete historische Wahrheit dieser Mörder herausstellen sollte, löste einen öffentlichen Aufschrei aus[5].
Der Prozess begann am 8. Mai 1919. Das Gerichtsgebäude wurde unter den „Schutz“ bewaffneter Kräfte der GKSD gestellt. Der angekündigte Richter war ein weiterer Repräsentant der Reichsflotte, Wilhelm Canaris, ein persönlicher Freund von Pabst und Pflugk-Harrtung. Später wurde er Chef der Spionage in Nazi-Deutschland. Erneut ging alles nach Plan – außer, dass Einzelne aus dem Personal des Hotels Eden trotz der Angst davor, den Arbeitsplatz zu verlieren und auf die Abschussliste der militärischen Killerkommandos zu geraten, wahrheitsmäßig bezeugten, was sie gesehen hatten. Die junge Raumpflegerin Anna Berger berichtete eingehend, dass sie die Offiziere darüber sprechen gehört habe, was für ein „Empfang“ Liebknecht im Tiergarten bevorstünde. Die Kellner Mistelski und Krupp, beide 17 Jahre alt, identifizierten Runge und enthüllten seine Verbindung zu Petri. Trotz alledem akzeptierte das Gericht ungefragt die „Erschossen auf der Flucht“-Version und sprach die Offiziere, die geschossen hatten, frei. Was Rosa Luxemburg anbetraf, bestand die Schlussfolgerung darin, dass zwei Soldaten versucht hätten, sie zu töten, aber dass es sich um keinen Mord handle. Auch sei ihre Todesursache nicht bekannt, da ihr Körper nicht gefunden worden war.
Erst am 31. Mai 1919 fanden Arbeiter an einer Kanalschleuse den toten Körper von Rosa Luxemburg. Als er vernahm, dass „sie“ wiedererschienen war, ordnete SPD-Innenminister Gustav Noske sofort eine Nachrichtenblockade in dieser Frage an. Erst drei Tage später wurde ein offizielles Statement veröffentlicht, in dem behauptet wurde, dass die sterblichen Überreste Rosa Luxemburgs gefunden worden seien, aber nicht von Arbeitern, sondern von einer Militärpatrouille.
Entgegen aller Regeln lieferte Noske die Leiche an seine militärischen Freunde aus, in die Hände von Rosas Mörder. Die verantwortlichen Behörden konnten nicht eingreifen und wiesen darauf hin, dass Noske faktisch eine Leiche gestohlen habe. Offensichtlich fürchteten sich die Sozialdemokraten selbst vor dem toten Körper Rosa Luxemburgs.
Der Mantel des Schweigens, der im Hotel Eden ausgebreitet wurde, hielt jahrzehntelang. Doch wurde das Schweigen schließlich von Pabst selbst gebrochen. Er konnte es nicht mehr aushalten, keine öffentliche Anerkennung für seine Tat zu erhalten. In den Jahren nach dem II. Weltkrieg begann er in Interviews mit den neuen Magazinen (Spiegel, Stern) dunkle Andeutungen zu machen und wurde noch deutlicher in Diskussionen mit Historikern und in seinen Memoiren. In der demokratischen westdeutschen Bundesrepublik bot der „Antikommunismus“ des Kalten Krieges günstige Bedingungen. Pabst berichtete, dass er am Abend des 15. Januars 1919 mit dem sozialdemokratischen Innenminister Noske telefoniert habe, um sich dessen Rat einzuholen, wie er mit seinen illustren Gefangenen umgehen solle. Sie stimmten in der Notwendigkeit überein, dem Bürgerkrieg ein Ende zu bereiten. Über die Mittel, mit denen man zu diesem Ende kommen wollte, sagte Noske: „Das soll der General tun, es sind seine Gefangenen“[6] In einem Brief an Dr. Franz schrieb Pabst 1969: „Noske und ich waren uns in dieser Auffassung restlos einig. Die Anordnungen konnte Noske natürlich nicht selbst geben[7]. Und in einem anderen Brief schrieb Pabst: „Tatsache ist: Die Durchführung der von mir angeordneten Befehle [...] ist erfolgt, und dafür sollten diese deutschen Idioten Noske und mir auf den Knien danken, uns Denkmäler setzen und nach uns Straßen und Plätze genannt haben! Der Noske war damals vorbildlich, und die Partei (bis auf ihren halbkommunistischen linken Flügel) hat sich in dieser Affäre damals tadellos benommen. Dass ich die Aktion ohne Noskes Zustimmung gar nicht durchführen konnte (mit Ebert im Hintergrund) und auch meine Offiziere schützen musste, ist klar“[8].
Das System des politischen Mordes
Die Jahre 1918 bis 1920 in Deutschland waren historisch sicherlich nicht einzigartig darin, dass einer versuchten proletarischen Revolution oder Erhebung mit einem schrecklichen Massaker, das bis zu 20.000 Proletariern das Leben kostete, begegnet wurde. Ähnliche Szenen wurden auch in Paris während der Juli-Revolution 1848 und der Pariser Kommune 1871 beobachtet. Und während die erfolgreiche Oktoberrevolution von 1917 fast ohne Blutvergießen ausging, kostete der Bürgerkrieg, den das internationale Kapital als Reaktion darauf erzwang, Millionen Menschen das Leben. Was neu an Deutschland war, das war die Anwendung eines System des politischen Mordes nicht erst am Ende des revolutionären Prozesses, sondern von Beginn an[9].
In dieser Frage können wir uns nach Klaus Gietinger auf einen weiteren Zeugen berufen: Emil Julius Gumbel, der 1924 ein berühmtes Buch veröffentlichte, Vier Jahre politischer Mord. Wie Klaus Gietinger war Gumbel kein revolutionärer Kommunist. Tatsächlich war er ein Vertreter der in Weimar etablierten bürgerlichen Republik. Doch er war vor allen Dingen ein Mann auf der Suche nach der Wahrheit, bereit, sein Leben im Prozess zu riskieren[10].
Für Gumbel war das, was die Entwicklungen in Deutschland charakterisierte, der Übergang vom „handwerklichen Mord“ zu dem, was er eine „industriellere“ Methode nannte[11]. Diese beruhte auf Todeslisten, die von Geheimorganisationen zusammengestellt und von Todeskommandos „abgearbeitet“ wurden, die sich aus Offizieren und Soldaten zusammensetzten. Diese Todeskommandos existierten nicht nur in friedlicher Koexistenz mit den offiziellen Organen des demokratischen Staates – sie kooperierten darüber hinaus aktiv mit Letzterem. Eine Schlüsselrolle in dieser Strategie wurde von den Medien gespielt, die die Anschläge vorbereiteten und rechtfertigten und im Nachhinein den Toten all das, was ihnen geblieben war, raubten: ihren guten Ruf.
Nachdem er den linken, hauptsächlich individuellen Terrorismus[12] vor dem Krieg mit dem neuen rechten Terror verglichen hatte, schrieb Gumbel: „Die unglaubliche Milde des Gerichts ist den Tätern wohl bekannt. So unterscheiden sich die heutigen politischen Morde in Deutschland von den früher in anderen Ländern üblichen durch zwei Momente: Ihre Massenhaftigkeit und ihre Unbestraftheit. Früher gehörte zum politischen Mord immerhin eine gewisse Entschlusskraft. Ein gewisser Heroismus war dabei nicht zu leugnen: Der Täter riskierte Leib und Leben. Flucht war nur unter außerordentlichen Mühen möglich. Heute riskiert der Täter gar nichts. Mächtige Organisationen mit ausgebreiteten Vertrauensleuten im ganzen Lande sichern ihm Unterkunft, Schutz und materielles Fortkommen. Gut ‚gesinnte‘ Beamte, Polizeipräsidenten geben falsche ‚richtige‘ Papiere, zur eventuell nötigen Auslandsreise... Man lebt in den besten Hotels herrlich und in Freuden. Kurz, der politische Mord ist aus einer heroischen Tat zur alltäglichen Handlung, ja beinahe zu einer leichten Erwerbsquelle... geworden“[13]
Was auf den individuellen Mord gemünzt war, trifft ohne weiteres auch auf einen rechten Putsch zu, der benutzt wurde, um in massivem Umfang zu töten – was Gumbel den „halborganisierten Mord“ nannte. „Gelingt der Putsch, um so besser, misslingt er, so werden die Gerichte schon dafür sorgen, dass den Mördern nichts passiert. Und sie haben dafür gesorgt. Kein einziger Mord von Rechts ist wirklich gesühnt. Selbst gegen geständige Mörder wird das Verfahren aufgrund der Kapp-Amnestie eingestellt.“(ebenda, S. 125).
Als Antwort auf den Ausbruch der proletarischen Revolution in Deutschland wurde eine große Anzahl solcher konterrevolutionären Organisationen gebildet[14]. Und als sie endlich im restlichen Land gebannt wurden, als das Kriegsrecht und die Sondergerichte aufgehoben wurden, wurde all dies in Bayern weiter aufrechterhalten, so dass München zum „Nest“ der deutschen (und russischen Exil-)Rechtsextremen wurde. Was als „bayrischer Partikularismus“ dargestellt wurde, entsprang in Wahrheit einer Arbeitsteilung. Die Hauptträger dieser „bayrischen Fronde“ waren Ludendorff und seine Unterstützer aus dem militärischen Hauptquartier, die keinesfalls nur Bayern waren[15].
Die Sozialdemokratie, das Militär und das System des Terrors
Wie wir im zweiten Teil dieser Serie angemerkt hatten, wurde die „Dolchstoßlegende“ im September 1918 von Ludendorff in die Welt gesetzt. Sobald er realisiert hatte, dass der Krieg verloren war, rief er zur Bildung einer Zivilregierung auf, die den Frieden erwirken würde. Seine ursprüngliche Idee bestand darin, die Zivilisten dazu zu veranlassen, die Schuld auf sich zu nehmen und die Reputation der Streitkräfte zu bewahren. Die Revolution war noch nicht ausgebrochen. Doch sobald dies geschah, gewann die Dolchstoßlegende eine neue Bedeutung. Die Propaganda, dass ruhmreiche Streitkräfte, die auf dem Schlachtfeld ungeschlagen war, im letzten Moment durch die Revolution um ihren Sieg gebracht worden seien, zielte auf eine irre gemachte Gesellschaft ab, besonders auf die Soldaten, mit ihrem brennenden Hass auf die Revolution.
Als den Sozialdemokraten zunächst ein Sitz in einer solchen zivilen „Regierung der Schande“ angeboten wurde, wollte der clevere Scheidemann in der SPD-Führung dieses Angebot ausschlagen, da er erkannte, dass es eine Falle war[16]. Er wurde von Ebert überstimmt, der dafür plädierte, das Wohl des Vaterlandes über die „Parteipolitik“ zu stellen[17].
Als am 10. Dezember 1918 die SPD-Regierung und das militärische Oberkommando Massen von Soldaten, die von der Front heimkehrten, durch die Straßen Berlins marschieren ließen, war es ihre Absicht, diese Kräfte zu benutzen, um die Revolution zu zerschmettern. Zu diesem Zweck richtete sich Ebert am Brandenburger Tor an die Truppen und begrüßte die Armee als „auf dem Schlachtfeld nie besiegt“. In diesem Augenblick machte Ebert die Dolchstoßlegende zu einer offiziellen Doktrin der SPD und seiner Regierung[18].
Natürlich beschuldigte die Dolchstoß-Propaganda nicht wörtlich die Arbeiterklasse für Deutschlands Niederlage. Dies wäre auch nicht ratsam gewesen in einem Moment, als der Bürgerkrieg begann, d.h. als es für die Bourgeoisie notwendig wurde, die Klassenteilungen zu verwischen. Es mussten Minderheiten gefunden werden, die die Massen manipuliert und in die Irre geführt haben und die als die wahren Missetäter identifiziert werden konnten.
Einer dieser Missetäter waren die Russen und ihr Agent, der deutsche Bolschewismus, die eine primitive, asiatische Form des Sozialismus repräsentierten, den Sozialismus des Hungers und ein Bazillus, der die „europäische Zivilisation“ bedrohte. Diese Themen waren, unter anderer Bezeichnung, eine direkte Fortsetzung der antirussischen Propaganda der Kriegsjahre. Die SPD war der größte und verkommenste Verbreiter dieses Gifts. Das Militär war im Grunde viel zögerlicher hier, da einige seiner wagemutigsten Vertreter zeitweise mit der Idee des, wie sie es nannten, „Nationalbolschewismus“ spielten (die Idee, dass ein militärisches Bündnis des deutschen Militarismus mit dem proletarischen Russland gegen die „Versailler Mächte“ auch ein geeignetes Mittel sein könnte, die Revolution sowohl in Deutschland als auch in Russland moralisch zu zerstören).
Der andere Missetäter waren die Juden. Ludendorff hatte sie von Anfang an im Kopf. Auf dem ersten Blick mag es erscheinen, als folgte die SPD diesem Beispiel nicht. In Wahrheit wiederholte ihre Propaganda im Grunde den Schmutz, den die Offiziere verbreitet hatten - ausgenommen das Wort „Jude“, das durch „Fremde“, „Elemente ohne nationalen Wurzeln“ oder „Intellektuelle“ ersetzt wurde. Begriffe, die im damaligen kulturellen Kontext dasselbe meinten. Dieser anti-intellektuelle Hass auf die „Bücherwürmer“ ist ein wohlbekanntes Merkmal des Antisemitismus. Zwei Tage, bevor Liebknecht und Luxemburg ermordet wurden, veröffentlichte der Vorwärts, der SPD-Tageszeitung ein „Gedicht“ – tatsächlich ein Pogromaufruf – namens Das Leichenhaus, in dem bedauert wurde, dass unter den Getöteten nur Proletarier seien, während „Karl, Rosa, Radek“ und „dergleichen“ entkommen seien.
Die Sozialdemokratie sabotierte die Arbeiterkämpfe von innen. Sie leitete die Bewaffnung der Konterrevolution und ihre militärischen Kampagnen gegen das Proletariat. Indem sie die Revolution besiegte, schuf sie die Möglichkeit für den späteren Triumph des Nationalsozialismus, bereitete ihm unwissentlich den Weg. Die SPD tat gar noch mehr als ihre Pflicht bei der Verteidigung des Kapitalismus. Indem sie half, die inoffizielle Söldnerarmee der Freikorps zu bilden, indem sie die Todeskommandos der Offiziere schützte, die Ideologien der Reaktion und des Hasses verbreitete, die das politische Leben Deutschlands im nächsten Vierteljahrhundert dominieren sollten, war sie aktiv an der Kultivierung des Milieus beteiligt, das das Hitler-Regime zum Leben verhalf.
„Ich hasse die Revolution wie die Sünde“, erklärte Ebert brav. Dies war nicht der Hass der Industriellen und Militärs, die um ihr Eigentum fürchteten und für die die herrschende Ordnung so natürlich erschien, dass sie nicht anders konnten, als alles andere zu bekämpfen; die Sünden, die die Sozialdemokraten hassten, waren die Sünden ihrer eigenen Vergangenheit, ihrer Verwicklung in einer Bewegung zusammen mit überzeugten Revolutionären und proletarischen Internationalisten – selbst wenn viele von ihnen niemals solche Überzeugungen geteilt hatten. Es war der Hass der Renegaten auf die verratene Sache. Die Führer der SPD und der Gewerkschaften glaubten, dass die Arbeiterbewegung ihr eigenes Eigentum sei. Als sie sich bei Ausbruch des Weltkrieges mit der imperialistischen Bourgeoisie zusammentaten, nahmen sie an, dass dies das Ende des Sozialismus sei, ein illusorisches Kapitel, das sie nun zu schließen gedachten. Als die Revolution nur vier Jahre später ihr Haupt erhob, war es wie die Wiedererscheinung eines entsetzlichen Albtraums aus der Vergangenheit. Der Hass auf die Revolution war gleichzeitig Angst vor ihr. Da sie ihre eigenen Gefühle auf ihre Feinde projizierten, fürchteten sie auch, von den „Spartakisten“ gelyncht zu werden (eine Furcht, die sie mit den Offizieren der Todeskommandos teilten)[19]. Ebert war zwischen Heiligabend und Neujahr 1918 auf dem Sprung, aus der Hauptstadt zu fliehen. All dies kristallisierte sich vor allem in einer Person: Rosa Luxemburg, die zur Hauptzielscheibe ihres Hasses wurde. Die SPD war zum Sammelbecken alles Reaktionären im verwesenden Kapitalismus geworden. So war die bloße Existenz von Rosa Luxemburg, ihre Prinzipientreue, ihr Mut, ihre intellektuelle Brillanz, die Tatsache, dass sie eine Ausländerin war, jüdischer Herkunft und eine Frau, eine einzige Provokation für sie. Sie nannten sie die „rote Rosa“, ein Flintenweib, blutrünstig und auf Rache aus.
Wir müssen dies vor Augen haben, wenn wir eines der auffälligsten Phänomene der Revolution in Deutschland untersuchen: das Ausmaß der Unterwürfigkeit der Sozialdemokratie gegenüber dem Militär, das selbst die preußische Offizierskaste abstoßend und lächerlich fand. Während der gesamten Periode der Kollaboration des Offizierskorps‘ mit der SPD hörten Erstere nie auf, öffentlich ihre Absicht kundzutun, Letztere „zur Hölle“ zu schicken, sobald sie sie nicht mehr benötigen. Nichts von alledem konnte die hündische Loyalität der SPD erschüttern. Diese Unterwürfigkeit war natürlich nicht neu. Sie hatte das Verhalten der Gewerkschaften und der reformistischen Politiker lange vor 1914 geprägt[20]. Doch nun wurde sie kombiniert mit der Überzeugung, dass allein das Militär den Kapitalismus und somit auch die SPD schützen könne.
Im März 1920 putschten rechtsextreme Offiziere gegen die SPD-Regierung – der Kapp-Putsch. Unter den Putschisten finden wir die Kollaborateure von Ebert und Noske beim Doppelmord am 15. Januar: Pabst und sein General von Lüttwitz, die GKSD und die oben erwähnten Leutnants von der Marine. Kapp und Lüttwitz hatten ihren Truppen eine erkleckliche finanzielle Belohnung für den Sturz Eberts in Aussicht gestellt. Der Coup wurde nicht durch die Regierung (die nach Stuttgart floh) vereitelt, auch nicht durch das offizielle Militärkommando (das sich selbst für „neutral“ erklärte), sondern durch das Proletariat. Die drei Konfliktparteien der herrschenden Klasse, die SPD, die „Kappisten“ und das militärische Oberkommando (nun nicht mehr neutral) taten sich erneut zusammen, um die Arbeiter zu besiegen. Der Zweck heiligt die Mittel! Außer eins: Was macht man mit den armen Meuterern und ihren Hoffnungen auf Belohnung für den Sturz Eberts? Kein Problem! Die Ebert-Regierung zahlte, zurück im Amt, selbst diese Belohnung aus.
Soviel zum Argument (vorgetragen zum Beispiel von Trotzki vor 1933), dass die Sozialdemokratie trotz ihrer Integration im Kapitalismus sich noch immer gegen die Behörden auflehnen und den Faschismus verhindern könnte – um ihre eigene Haut zu retten.
Kapitalistische Diktatur und Sozialdemokratie
In der Tat war das Militär nicht so sehr gegen die Sozialdemokratie und die Gewerkschaften als vielmehr gegen das herrschende System an sich[21]. Schon das Vorkriegs-Deutschland war nicht von politischen Parteien regiert worden, sondern von der Militärkaste, einem System, das die Monarchie symbolisierte. Schritt für Schritt wurde die weitaus mächtigere industrielle und finanzielle Bourgeoisie in dieses System integriert, durch inoffizielle Strukturen und insbesondere durch den Alldeutschen Verein, der das Land vor und während des Weltkrieges sehr wirksam beherrschte[22].
Das Parlament im Deutschen Reich (der Reichstag) hatte so gut wie keine Macht dagegen zu setzen. Die politischen Parteien hatten keine reale Regierungserfahrung und waren eher Lobbygruppen für verschiedene wirtschaftliche oder regionale Fraktionen als irgendetwas anderes.
Was ursprünglich ein Produkt der politischen Rückständigkeit Deutschlands gewesen war, stellte sich als ein enormer Vorteil dar, sobald der Weltkrieg einmal ausgebrochen war. Um mit dem Krieg und der ihm folgenden Revolution fertigzuwerden, war die diktatorische Kontrolle des Staates über die Gesamtheit der Gesellschaft eine Notwendigkeit. In den alten westlichen „Demokratien“, insbesondere in den angelsächsischen Ländern mit ihren raffinierten Zweiparteiensystemen, entwickelte sich der Staatskapitalismus durch ein allmähliches Verschmelzen der politischen Parteien und der verschiedenen ökonomischen Fraktionen der Bourgeoisie mit dem Staat. Diese Form des Staatskapitalismus erwies sich zumindest in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten als äußerst effektiv. Doch es beanspruchte eine relativ lange Zeit zur Entstehung.
In Deutschland existierte die Struktur für solch eine diktatorische Staatsintervention bereits. Eines der größten „Geheimnisse“ der Fähigkeit Deutschlands, mehr als vier Jahre lang einen Krieg gegen fast alle anderen Großmächte der Welt – die die Ressourcen ihrer Kolonialreiche hinter sich wussten - auszuhalten, liegt in der Effizienz dieses Systems. Auch deswegen spielten die westlichen Alliierten nicht nur „für die Galerie“, als sie am Kriegsende die Liquidierung des „preußischen Militarismus“ forderten.
Wie wir im Verlaufe dieser Reihe bereits gesehen haben, wollte nicht nur das Militär, sondern auch Ebert selbst die Monarchie am Ende des Krieges bewahren, mit einem Reichstag im Stile der Vorkriegszeit. Mit anderen Worten, sie wollten jene staatskapitalistischen Strukturen aufrechterhalten, welche sich während des Krieges bewährt hatten. Angesichts der Gefahr der Revolution mussten sie jedoch abgeschafft werden. Das ganze Arsenal und Gepränge der politischen Parteidemokratie wurde gebraucht, um die Arbeiter ideologisch in die Irre zu führen.
Dies produzierte das Phänomen der Weimarer Republik: ein Wirt von unerfahrenen und ineffektiven Parteien, die größtenteils unfähig waren, zusammenzuarbeiten oder sich selbst diszipliniert in das staatskapitalistische Regime einzufügen. Kein Wunder, dass das Militär sie loswerden wollte! Die einzig wirkliche politische Partei der Bourgeoisie, die in Deutschland existierte, war die SPD.
Doch wenn die Aufrechterhaltung des staatskapitalistischen[23] Kriegsregimes durch die Revolution verunmöglicht worden war, so wurde auch der Plan Großbritanniens und insbesondere der USA durch die Revolution unmöglich gemacht. Die westlichen „Demokratien“ mussten den Kern der Militärkaste und ihrer Macht intakt lassen, um das Proletariat zu zerschmettern. Dies blieb nicht ohne Konsequenzen. Als 1933 die traditionellen Führer Deutschlands, die Streitkräfte und die Großindustrie, der Weimarer Republik den Laufpass gaben, gewann Deutschland im Zuge der Vorbereitung des II. Weltkrieges seinen organisatorischen Vorteil gegenüber den imperialistischen Rivalen des Westens zurück. Auf der Ebene seiner Zusammensetzung war der Hauptunterschied zwischen dem alten und dem neuen Regime, dass die SPD von der NSDAP, der Nazi-Partei, ersetzt wurde. Die SPD war derart erfolgreich bei der Niederringung des Proletariats gewesen, dass ihre Dienste nicht mehr erforderlich waren.
Russland und Deutschland: Dialektische Pole der Weltrevolution
Im Oktober 1917 rief Lenin die Partei und die Sowjets in Russland zum Aufstand auf. In einer Resolution an das bolschewistische Zentralkomitee, geschrieben „von Lenin mit Bleistiftstummel auf einer karierten Kinderheftseite“ (Trotzki)[24], schrieb er: „Das Zentralkomitee stellt fest, dass sowohl die internationale Lage der russischen Revolution (der Aufstand in der deutschen Flotte als höchster Ausdruck des Heranreifens der sozialistischen Weltrevolution in ganz Europa, ferner die Gefahr eines Friedens der Imperialisten mit dem Ziel, die Revolution in Russland zu erdrosseln, als auch die militärische Lage (der nicht zu bezweifelnde Entschluss der russischen Bourgeoisie sowie Kerenski & Co., Petrograd den Deutschen auszuliefern, und die Eroberung der Mehrheit in den Sowjets durch die proletarische Partei – dass all dies im Zusammenhang mit dem Bauernaufstand und mit der Tatsache, dass sich das Vertrauen des Volkes unserer Partei zugewandt hat, (die Wahlen in Moskau) und endlich die offenkundige Vorbereitung eines zweiten Kornilow-Putsches... – dass all dies den bewaffneten Aufstand auf die Tagesordnung setzt“[25]
Diese Formulierung enthält die gesamte damalige marxistische Sichtweise der Weltrevolution und der Schlüsselrolle Deutschlands in diesem Prozess. Einerseits müsse die Erhebung in Russland als Reaktion auf den Beginn der Revolution in Deutschland erfolgen, die das Signal für Gesamteuropa sei. Andererseits beabsichtige die russische Bourgeoisie, unfähig, die Revolution auf dem eigenen Territorium niederzuschlagen, diese Aufgabe der deutschen Regierung, dem Gendarmen der Konterrevolution auf dem europäischen Festland, anzuvertrauen (dabei Petersburg den Deutschen überlassend). Lenin zürnte über die innerparteilichen Gegner eines Aufstandes, jene, die ihre Solidarität mit der Revolution in Deutschland erklärten und dabei die russischen Arbeiter aufriefen, auf das deutsche Proletariat zu warten, um ihm die Führung anzuvertrauen.
„Man bedenke nur: Die Deutschen haben, unter verteufelt schwierigen Verhältnissen, mit nur einem Liebknecht, (der dazu noch im Zuchthaus sitzt) ohne Zeitungen, ohne Versammlungsfreiheit, ohne Sowjets, angesichts einer ungeheuren Feindseligkeit aller Bevölkerungsklassen bis zum letzten begüterten Bauern gegen die Idee des Internationalismus, angesichts der ausgezeichneten Organisation der imperialistischen Groß-, Mittel- und Kleinbourgeoisie, die Deutschen, d.h. die deutschen revolutionären Internationalisten, die Arbeiter im Matrosenkittel, haben einen Aufstand in der Flotte begonnen – bei einer Chance von vielleicht 1:100. Wir aber, die wir Dutzende von Zeitungen, die wir Versammlungsfreiheit haben, über die Mehrheit in den Sowjets verfügen, wir, die wir im Vergleich zu den proletarischen Internationalisten in der ganzen Welt die besten Bedingungen haben, wir werden darauf verzichten, die deutschen Revolutionäre durch unseren Aufstand zu unterstützen. Wir werden argumentieren, wie die Scheidemänner und die Renaudel: Das Vernünftigste ist, keinen Aufstand zu machen, wenn man uns niederknallt, so verliert die Welt in uns so prächtige, so vernünftige, so ideale Internationalisten !!)“[26]. Als er diesen berühmten Text, „Die Krise ist herangereift“, verfasste (29. September 1917) waren jene, die den Aufstand in Russland verschieben wollten: „wären Verräter, denn sie würden durch ihr Verhalten die deutschen revolutionären Arbeiter verraten, die in der Flotte einen Aufstand begonnen haben“[27].
Dieselbe Debatte fand in der bolschewistischen Partei anlässlich der ersten politischen Krise statt, die der Machtergreifung folgte: Unterzeichnung des Vertrages von Brest-Litowsk mit dem deutschen Imperialismus – ja oder nein. Oberflächlich betrachtet, scheint es, als haben die Fronten in der Debatte gewechselt. Es war nun Lenin, der zur Vorsicht mahnt: Wir müssen die Demütigung dieses Vertrages akzeptieren. Doch tatsächlich gibt es eine Kontinuität. In beiden Fällen wurde, da das Schicksal der Russischen Revolution auf dem Spiel stand, die Perspektive einer Revolution in Deutschland zum Fokus der Debatten. In beiden Fällen bestand Lenin darauf, dass alles davon abhängt, was in Deutschland passiert, aber auch, dass der Sieg der Revolution dort länger dauern und unendlich schwieriger sein wird als in Russland. Daher musste die Russische Revolution im Oktober 1917 die Führung übernehmen. Daher musste, wie in Brest-Litowsk, die russische Bastion darauf vorbereitet sein, einen Kompromiss zu machen. Sie habe die Verantwortung, „durchzuhalten“, um in der Lage sein, die deutsche und die Weltrevolution zu unterstützen.
Von Anbeginn war die Deutsche Revolution durchdrungen von einem Verantwortungssinn gegenüber der Russischen Revolution. Es lag am deutschen Proletariat, die russischen Arbeiter aus ihrer internationalen Isolation zu befreien. Wie Rosa Luxemburg im Gefängnis in ihren Notizen über Die russische Revolution, 1922 posthum erschienen, schrieb:
„Alles, was in Russland vorgeht, ist begreiflich und eine unvermeidliche Kette von Ursache und Wirkungen, deren Ausgangspunkte und Schlusssteine: das Versagen des deutschen Proletariats und die Okkupation Russlands durch den deutschen Imperialismus“[28]
Den russischen Ereignissen gebührt der Ruhm, mit der Weltrevolution begonnen zu haben.
„Dies ist das Wesentliche und Bleibende der Bolschewiki-Politik. In diesem Sinne bleibt ihnen das unsterbliche, geschichtliche Verdienst, mit der Eroberung der politischen Gewalt und der praktischen Problemstellung der Verwirklichung des Sozialismus dem internationalen Proletariat vorangegangen zu sein und die Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit in der ganzen Welt mächtig vorangetrieben zu haben. In Russland konnte das Problem nur gestellt werden. Es konnte nicht in Russland gelöst werden. Es kann nur international gelöst werden. Und in diesem Sinne gehört die Zukunft überall dem ‚Bolschewismus‘“[29]
Die praktische Solidarität des deutschen mit dem russischen Proletariats ist also die die revolutionäre Eroberung der Macht, die Zerstörung der Hauptbastion der militaristischen und sozialdemokratischen Konterrevolution in Kontinentaleuropa. Allein dieser Schritt kann die in Russland erreichte Bresche in eine weltweite revolutionäre Flut verwandeln.
In einem anderen Beitrag aus ihrer Gefängniszelle, Die russische Tragödie, warf Rosa Luxemburg ein Licht auf die beiden tödlichen Gefahren der Isolation der Russischen Revolution. Die erste Gefahr sei die eines schrecklichen Massakers, das vom Weltkapitalismus – zum damaligen Zeitpunkt repräsentiert vom deutschen Militarismus - eigenhändig verübt werden kann. Die zweite Gefahr sei jene einer politischen Degenerierung und eines moralischen Bankrotts der russischen Bastion selbst, ihre Eingliederung in das imperialistische Weltsystem. Zu dem Zeitpunkt, als sie diese Zeilen verfasste (nach Brest-Litowsk), sah sie diese Gefahr von der Seite kommen, die zur so genannten nationalbolschewistischen Denkrichtung innerhalb des deutschen militärischen Establishments werden sollte. Diese konzentrierte sich rund um die Idee, dem „bolschewistischen Russland“ ein Militärbündnis anzubieten, nicht nur um den deutschen Imperialismus zur Welthegemonie gegen seine europäischen Rivalen zu verhelfen, sondern auch um gleichzeitig die Russische Revolution moralisch zu korrumpieren – vor allem durch die Zerstörung ihrer Grundprinzipien des proletarischen Internationalismus.
Tatsächlich überschätzte Rosa Luxemburg bei weitem die Bereitschaft der deutschen Bourgeoisie zu jener Zeit, sich auf solch ein Abenteuer einzulassen. Doch lag sie völlig richtig bei der zweiten Gefahr und als sie erkannte, dass ihre Realisierung das direkte Resultat aus der Niederlage der deutschen und der Weltrevolution sein werde. Wie sie schloss:
„Jeder politische Untergang der Bolschewiki im ehrlichen Kampfe gegen die Übermacht und Ungunst der geschichtlichen Situation wäre diesem moralischen Untergang vorzuziehen“ (Rosa Luxemburg, Die russische Tragödie, Gesammelte Werke Bd. 4, S. 390).
Die Russische und die Deutsche Revolution können nur zusammen verstanden werden. Sie sind zwei Momente ein und desselben Prozesses. Die Weltrevolution begann am Rande Europas. Russland war das schwache Glied im Imperialismus, weil die Weltbourgeoisie durch den imperialistischen Krieg gespalten war. Ihm musste ein zweiter Schlag folgen, ausgetragen im Herzen des Systems, wenn die Weltrevolution eine Chance haben sollte, den Weltkapitalismus zu stürzen. Dieser zweite Schlag wurde in Deutschland ausgeführt, und er begann mit der Novemberrevolution 1918. Doch die Bourgeoisie war in der Lage, diesen tödlichen Schlag gegen ihr Herz abzuwenden. Dies wiederum besiegelte das Schicksal der Revolution in Russland. Die Folgen dort entsprachen jedoch nicht der ersten, sondern der zweiten Hypothese Rosa Luxemburgs, jene, die sie am meisten fürchtete. Entgegen aller Wahrscheinlichkeit besiegte das rote Russland die einfallenden weißen, konterrevolutionären Kräfte. Eine Kombination von drei Hauptfaktoren machte dies möglich. Erstens die politische und organisatorische Führung des russischen Proletariats, das durch die Schule des Marxismus und durch die Schule der Revolution gegangen war. Zweitens die schiere Größe des Landes, die bereits geholfen hat, Napoleon zu besiegen, die dazu beitragen sollte, Hitler zu besiegen, und die auch hier zum Nachteil der konterrevolutionären Invasoren wurde. Drittens das Vertrauen der Bauern, der großen Mehrheit der russischen Bevölkerung, in die revolutionäre Führung des Proletariats. Es war die Bauernschaft, die den Löwenanteil der Truppen der Roten Armee unter Trotzki stellte.
Was folgte, war die kapitalistische Degenerierung der isolierten Revolution von innen: eine Konterrevolution im Namen der Revolution. So war die Bourgeoisie in der Lage gewesen, das Geheimnis der Niederlage der Russischen Revolution zu vertuschen. All dies basierte auf der Fähigkeit der Bourgeoisie, die Tatsache geheimzuhalten, dass es eine revolutionäre Erhebung in Deutschland gegeben hat. Das Geheimnis ist, dass die Russische Revolution nicht in Moskau oder Petersburg besiegt wurde, sondern in Berlin und an der Ruhr. Die Niederlage der Deutschen Revolution ist der Schlüssel zum Verständnis der Niederlage der Russischen Revolution. Die herrschende Klasse hatte diesen Schlüssel verborgen. Ein großes historisches Tabu, an dem sich alle verantwortlichen Zirkel hielten. Im Hause des Henkers erwähnt man den Strick nicht.
In einem gewissen Sinn ist die Existenz revolutionärer Kämpfe in Deutschland eher ein Problem als in Russland. Genau aus diesem Grund wurde die Revolution in Deutschland von der Bourgeoisie in einem offenen Kampf besiegt. Nicht nur die Lüge, dass Stalinismus gleich Sozialismus sei, sondern auch die Lüge, dass die bürgerliche Demokratie, dass die Sozialdemokratie in unüberbrückbarem Gegensatz zum Faschismus stünden, steht und fällt damit, dass die deutschen Kämpfe der Vergessenheit anheimgefallen sind.
Was bleibt, ist Verlegenheit. Ein Unbehagen, das sich vor allem bezüglich der Ermordung Luxemburgs und Liebknechts äußert, die zum Symbol für den Triumph der Konterrevolution geworden war[30]. In der Tat ist dieses Verbrechen, das für Zehntausende andere steht, das Sinnbild für die Unbarmherzigkeit, für den bedingungslosen Siegeswillen der Bourgeoisie bei der Verteidigung ihres Systems. Doch wurde dieses Verbrechen nicht unter der Führung der bürgerlichen Demokratie begangen? War es nicht das gemeinsame Produkt der Sozialdemokratie und der Rechtsextremen? Waren nicht seine Opfer, und nicht seine Täter, die Verkörperung des Besten, des Humansten, die besten Repräsentanten der glänzendsten Zukunft für unsere Spezies? Und warum sind schon damals und auch heute jene, die sich verantwortlich fühlen für diese Zukunft, so aufgewühlt durch diese Verbrechen und so angezogen von jenen, die ihnen zum Opfer fielen? Diese prahlerischen Verbrechen, die dabei halfen, das System vor 90 Jahren zu retten, mögen sich jetzt als ein Bumerang erweisen.
In seiner Untersuchung des Systems der politischen Morde in Deutschland zieht Emil Gumbel eine Verbindung zwischen dieser Praxis und der individualistischen, „heroischen“ Vision der Vertreter der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung, die die Geschichte als Produkt von Individuen betrachten. „Entsprechend ist die Rechte geneigt zu hoffen sie könne die linke Opposition, die getragen ist durch die Hoffnung auf eine radikal andere Wirtschaftsordnung, dadurch vernichten, dass sie die Führer beseitigen“[31] Doch die Geschichte ist ein kollektiver Prozess, gemacht und erlebt von Millionen von Menschen, nicht nur von der herrschenden Klasse, die deren Lehren zu monopolisieren versucht.
In seiner Untersuchung der Deutschen Revolution, in den 1970er Jahren verfasst, folgerte der „liberale“ deutsche Historiker Sebastian Haffner, dass diese Verbrechen eine offene Wunde hinterlassen haben und ihre langfristigen Resultate noch immer eine offene Frage seien.
„Heute sieht man mit Schrecken, dass diese Episode das eigentliche geschichtsträchtige Ereignis des deutschen Revolutionsdramas gewesen ist. Aus dem Abstand eines halben Jahrhunderts betrachtet, hat sie etwas von der unheimlich, unberechenbar weit tragenden Wirkung des Ereignisses auf Golgotha bekommen – das ja ebenfalls kaum etwas zu ändern schien als es stattfand.“ Und: „Der Mord vom 15. Januar 1919 war ein Auftakt – der Auftakt zu den tausendfachen Morden in den folgenden Monaten der Noske-Zeit, zu den millionenfachen Morden in den folgenden Jahrzehnten der Hitler-Zeit. Es war das Startzeichen für alle anderen“.
Kann sich die gegenwärtige und künftige Generation der Arbeiterklasse diese historische Realität wiederaneignen? Ist es langfristig möglich, revolutionäre Ideen zu liquidieren, indem man jene tötet, die sie in die Welt setzen? Die letzten Worte des letzten Artikels von Rosa Luxemburg, bevor sie starb, wurden im Namen der Revolution gesprochen: „Ich war, ich bin und ich werde sein.“
[1]Dieser Angriff wurde durch eine spontane Mobilisierung der Arbeiter vereitelt. Siehe die vorangegangenen Artikel dieser Serie
[2]Zitiert von Klaus Gietinger: Eine Leiche im Landwehrkanal. Die Ermordung Rosa Luxemburgs, S. 17, Hamburg 2008. Gietinger, Soziologe, Drehbuchautor und Regisseur, hat einen bedeutenden Teil seines Lebens der Aufklärung der Umstände der Ermordung Luxemburgs und Liebknechts gewidmet. Sein jüngstes Buch – „Waldemar Pabst: Der Konterrevolutionär – stützt sich auf die Einsicht in Moskau und Ostberlin vorhandene historische Dokumente, welche die Verstrickung der SPD noch umfassender belegen.
[3]Die anderen waren das monarchistische „Regiment Reichstag“ sowie die Spitzelorganisation der SPD unter der Leitung von Anton Fischer.
[4]Wilhelm Pieck war der einzige der drei Verhafteten, der mit seinem Leben davonkam. Es bleibt bis heute unklar, ob er sich herausreden konnte, ob er freigelassen wurde, weil man ihn nicht kannte, oder ob man ihm die Flucht gestattete, nachdem er seine Genossen verraten hatte. Pieck wurde später Präsident der Deutschen Demokratischen Republik.
[5]Der Autor dieses Artikels, Leo Jogiches, wurde ein Monat später „auf der Flucht“ erschossen.
[6]General von Lüttwitz.
[7] Anlässlich des 70. Jahrestages dieser Verbrechen schlug die Liberale Partei Deutschland (FDP) die Errichtung eines Denkmals für Noske in Berlin vor. Profalla, Generalsekretär der CDU, rechte Hand der Kanzlerin Angela Merkel, beschrieb die Aktionen Noskes als „eine mutige Verteidigung der Republik“ (Zitat aus der Berliner Tageszeitung „Tagesspiegel“, 11.01.2009).
[8]K. Gietinger, Die Ermordung Rosa Luxemburgs, siehe Kapitel „74 Jahre danach“.
[9]Die Wichtigkeit dieses in Deutschland unternommenen Schrittes wurde unterstrichen durch den Schriftsteller Peter Weiss, ein deutscher Künstler jüdischen Ursprungs, der nach Schweden floh, um der Verfolgung der Nazis zu entkommen. In seinem monumentalen Roman „Die Ästhetik des Widerstandes“ erzählt er die Geschichte des schwedischen Innenministers Palmstierna, der im Sommer 1917 einen Emissär nach Petrograd schickte, um – vergeblich – Kerenski, Ministerpräsident der Entente-freundlichen russischen Regierung, dazu aufzurufen, Lenin zu ermorden. Kerenski lehnte dies ab, wobei er leugnete, dass Lenin eine wirkliche Gefahr darstellte.
[10]E. Gumbel, Vier Jahre politischer Mord (Malek-Verlag, Berlin), wiederveröffentlicht 1980 durch Wunderhorn Heidelberg.
[11]Wer kann diese Wörter heute lesen ohne an Auschwitz zu denken?
[12]Beispielsweise den westeuropäischer Anarchisten oder den russischer Narodniki und Sozialrevolutionäre.
[13]Gumbel führt „einige“ dieser Organisationen in seinem Buch auf. Wir geben diese Liste an dieser Stelle wider, nur um einen Eindruck der Dimension des Phänomens zu vermitteln:
Verband nationalgesinnter Soldaten, Bund der Aufrechten, Deutschvölkische Schutz- und Trutzbund, Stahlhelm, Organisation “C”, Freikorps und Reichsfahne Oberland, Bund der Getreuen, Kleinkaliberschützen, Deutschnationaler Jugendverband, Notwehrverband, Jungsturm, Nationalverband Deutscher Offiziere, Orgesch, Rossbach, Bund der Kaisertreuen, Reichsbund Schwarz-Weiß-Rot, Deutschsoziale Partei, Deutscher Orden, Eos, Verein ehemaliger Baltikumer, Turnverein Theodor Körner, Allgemeiner deutschvölkischer Turnvereine, Heimatssucher, Alte Kameraden, Unverzagt, Deutscher Eiche, Jungdeutscher Orden, Hermannsorden, Nationalverband deutscher Soldaten, Militärorganisation der Deutschsozialen und Nationalsozialisten, Olympia (Bund für Leibesübungen), Deutscher Orden, Bund für Freiheit und Ordnung, Jungsturm, Jungdeutschlandbund, Jung-Bismarckbund, Frontbund, Deutscher Waffenring (Studentenkorps), Andreas-Hofer-Bund, Orka, Orzentz, Heimatbund der Königstreuen, Knappenschaft, Hochschulring deutscher Art, Deutschvölkische Jugend, Alldeutscher Verband, Christliche Pfadfinder, Deutschnationaler Beamtenbund, Bund der Niederdeutschen, Teja-Bund, Jungsturm, Deutschbund, Hermannsbund, Adler und Falke, Deutschland-Bund, Junglehrer-Bund, Jugendwanderriegen-Verband, Wandervögel völkischer Art, Reichsbund ehemaliger Kadetten.
[14]Es war General Ludendorff, der eigentliche Diktator Deutschlands während des Ersten Weltkriegs, welcher den sog. Hitlerputsch von 1923 in München mit organisierte.
[15]Scheidemann selbst wurde das Ziel eines (erfolglosen) Attentatsversuchs von Rechtsaußen, da man ihm vorwarf, den sogenannten Versailler-Diktat der Westmächte hingenommen zu haben.
[16]Die Hochachtung des ehemaligen Kanzlers Helmut Schmidt für das staatsmännische Verhalten Eberts ist wohlbekannt.
[17]Jedoch, angesteckt durch die revolutionäre Stimmung in der Hauptstadt, verbrüderten sich die meisten Truppen mit der Bevölkerung oder lösten sich auf.
[18]Nachdem sie Karl Liebknecht ermordet hatten, äußerten Mitglieder der GKSD die Befürchtung, dass sie gelyncht werden könnten, falls sie im Gefängnis landeten.
[19]Während des Massenstreiks Dezember 1918 in Berlin war Scheidemann von der SPD Teil einer Abordnung von Arbeitern, welche entsandt wurde, um im Regierungsgebäude zu verhandeln. Als sie dort ankamen, wurden sie ignoriert. Die Arbeiter beschlossen, wieder abzuziehen. Scheidemann hingegen flehte die Beamten an, die Delegation zu empfangen. Sein Gesicht flammte rot vor Freude auf, als einige dieser Beamten vage Versprechen abgaben. Die Delegation wurde nicht empfangen. Dieser Vorfall wurde von Richard Müller erzählt – in „Vom Kaiserreich zur Republik“, S. 106
[20]Insgesamt hegte das Militär eine große Wertschätzung insbesondere für Ebert und Noske. Stinnes, der reichste Mann im Nachkriegsdeutschland, nannte seine Yacht nach Kurt Legien, der Anführer der sozialdemokratischen Gewerkschaft ADGB.
[21]Laut Gumbel war er auch der Hauptorganisator des Kapp-Putsches.
[22]Oder „statt Sozialismus“ wie Walter Rathenau, Präsident des Elektroriesen AEG es enthusiastisch bezeichnete“.
[23]Trotzki, Geschichte der russischen Revolution, 3 Bände, 2. Teil –Oktoberrevolution; S. 816)
[24]Sitzung des Zentralkomitees der SDAPR (B), 10. (23.) Oktober 1917, Resolution, Bd. 26, (Lenin Gesammelte Werke), S. 178
[25]Lenin, Gesammelte Werke, Bd. 26, S. 191 – Brief an den Genossen!.
[26]Lenin, Bd. 26, , Die Krise ist herangereift, Bd. 26, S. 64
[27]Rosa Luxemburg, Zur Russischen Revolution, Gesammelte Werke Bd. 4, S. 364,
[28]Rosa Luxemburg, Zur Russischen Revolution, Gesammelte Werke Bd. 4, S. 365,
[29]Die hartgesottenen Liberalen der FDP in Berlin schlugen vor, einem öffentlichen Ort in Berlin auf Noskes Namen zu taufen, wie wir oben erwähnten. Die SPD, die Partei Noskes, lehnte dieses Ansinnen ab. Es wurde keine plausible Erklärung für diese untypische Bescheidenheit geliefert.
[30]Gumbel, ebenda, S. 146
[31]S. Haffner, 1918/1919 – Eine deutsche Revolution, Hamburg, 1981, S. 147, S. 158
Leute:
- Rosa Luxemburg [197]
- Karl Liebknecht [230]
- Leo Jogiches [198]
- Noske [199]
- Pabst [231]
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Historische Ereignisse:
- politischer Mord [232]
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Einige Anmerkungen zu den jüngsten Studentenprotesten in Frankreich und Spanien
- 4358 reads
n mehreren Ländern Europas fanden in der jüngsten Zeit Studentenproteste statt. Die Schüler- und Studentenproteste in Deutschland, über die wir in unserer Presse berichteten, reihen sich ein in diese breitere internationale Bewegung. Wir veröffentlichen nachfolgend einige Beobachtungen und Anmerkungen zu den Bewegungen in Frankreich und Spanien In mehreren Ländern Europas fanden in der jüngsten Zeit Studentenproteste statt. Die Schüler- und Studentenproteste in Deutschland, über die wir in unserer Presse berichteten, reihen sich ein in diese breitere internationale Bewegung. Wir veröffentlichen nachfolgend einige Beobachtungen und Anmerkungen zu den Bewegungen in Frankreich und Spanien.
Frankreich
Seit Oktober 2007 werden die Beschäftigten des Bildungswesen und die Studenten mit einer Reihe von Reformen konfrontiert, insbesondere dem LRU-Gesetz, das die Autonomie der Unis regelt, und das zur Folge hat: eine allgemeine Prekarisierung der zukünftigen Dozenten, Schließung bestimmter Institute wie IUFM, Reform des Studentenwerks, Verschärfung der Konkurrenz unter den Beschäftigten bei ihrer Beförderung, Schließung wenig rentabler Einrichtungen, drastische Mittelkürzungen beim Wartungspersonal, für die Bibliothekare, Sekretariate usw. Bei den "öffentlichen Universitäten" ,die als ein illusorisches Eldorado der Arbeiterkinder gelten, ist nichts vor dem Rotstift sicher. Jedes Jahr drängen sich immer mehr Studenten in die überfüllten Hörsäle, deren Bauzustand sich immer mehr verschlechtert. Viele von ihnen hoffen auf eine Stelle im Bildungswesen, durch die sie aber keinen privilegierten Status erhalten. Je mehr der Kapitalismus in der Krise versinkt, werden sich immer mehr über die miserablen Zukunftsaussichten bewusst, die ihnen dieses System bietet. Mit den Abschlüssen an den öffentlichen Universitäten, die immer mehr zu "Müll-Unis" werden, bleibt oft nichts anderes übrig als sich in die Schlangen an den Arbeitsämtern einzureihen. Denn ungeachtet der Lügen, die die Studenten als faule und privilegierte Kinder darstellen, sieht die Wirklichkeit im universitären Bildungsbereich ganz anders aus. Ein Großteil der Wirtschaftselite hat sich aus den Unis zurückgezogen und ist in die großen Privatunis übergewechselt, welche unbezahlbare Studiengebühren verlangen, aber über große Mittel verfügen. Abgesehen von schlechten Zukunftsaussichten sind viele Studenten jetzt schon zur Finanzierung ihres Studiums dazu gezwungen, unter schrecklichen Bedingungen Geld zu verdienen. Immer mehr Studenten schuften z.B. in den Schnellrestaurants.
Gegenüber diesen Angriffen ist es immer häufiger zu Protesten und Mobilisierungen gekommen, insbesondere im Herbst 2007 und Anfang 2009. Dabei kam es zu zahlreichen Demonstrationen mit Zehntausenden Teilnehmern, der Blockierung von Universitätseinrichtungen und "Kommando-Aktionen". Aber die Wut der Studenten und der Uni-Beschäftigten ist nur ein Aspekt der breiteren Dynamik der zunehmenden Kampfbereitschaft der Arbeiterklasse und insbesondere der Jugend: Im Dezember 2004 und im April 2005 schon beteiligten sich viele Studenten an Protesten gegen das Gesetz Filon (ca. 165.000 Protestierende), am Kampf gegen das CPE mit Millionen Protestierenden im Frühjahr 2006. Schließlich die Reaktionen der Jugend 2008 in Griechenland, Italien, Spanien, Frankreich (insbesondere in den Schulen), in Deutschland, die viele Regierungen ins Schwitzen gebracht haben, weil sie Angst hatten vor dem griechischen Beispiel und der daraus hervorgehenden Gefahr der "Ansteckung". Ungeachtet der lange andauernden Bewegung, die langsam ausläuft, ungeachtet all der vielen Blockierungen, ungeachtet einer gewissen Radikalität, hat der jüngste Kampf in den Universitäten in Frankreich der Regierung keine Angst eingejagt. Stattdessen konnte diese sogar provozierend vorgehen, wie die frechen Aussagen von Xavier Darcos, dem Bildungsminister, zeigen. "Es wird keine Streikdiplome, keine Master für Wiederholer und keine Doktorwürden für Blockierer geben". Wie kann man erklären, dass die jüngste Bewegung im Vergleich zur früheren Bewegung der Gymnasiasten und Studenten gegen das CPE gescheitert ist?
Rezepte für einen siegreichen Streik?
Die Geschichte des Klassenkampfes zeigt uns, dass es keine Regel in dieser Frage gibt. Es gibt kein magisches Rezept für einen siegreichen Streik, denn die Bedingungen für einen wirksamen Kampf hängen von dem Kontext, dem Grad der Mobilisierung, dem möglichen Kräfteverhältnis usw. ab. Während zum Beispiel die Blockaden während des Konfliktes gegen den CPE eine wertvolle Waffe waren, wurden dessen Grenzen in dem jüngsten Konflikt schnell deutlich. Dagegen gibt es ein Prinzip, welches sich das Proletariat unbedingt aneignen muss, um siegen zu können. Dieses Prinzip entspringt einer seiner Stärken, seiner Zahl, auf die die Arbeiterklasse, die über keine ökonomische und politische Macht verfügt, zählen kann: ihre Einheit! Mit anderen Worten: wenn die Studenten und Beschäftigten des Erziehungswesens sich mobilisieren, muss ihr Hauptziel darin bestehen, ihre Bewegung so weit wie möglich auszudehnen. Sie müssen über ihre Universität hinausgehen, sie auf alle Bereiche ausdehnen. Der Kampf gegen den CPE, bei dem es zu einer echten Solidarität kam, war deshalb erfolgreich, weil es sich nicht um einen klassischen Konflikt an der Uni handelte, sondern um eine Auseinandersetzung, von der sich alle betroffen fühlten und mitmachen konnten. Die Studenten, die anfangs allein in den Konflikt eingetreten waren, konnten sehr schnell vermitteln, weshalb dieses Gesetzprojekt alle betraf und dass es ein Teil eines Gesamtangriffs gegen die ganze Arbeiterklasse war. Auch im November 2007 hat ein Teil der Schüler versucht, ihre Bewegung mit den streikenden Eisenbahnern zusammenzuführen. Und in Griechenland entfaltete sich Ende 2008 eine gewaltige Solidaritätsbewegung um die "Generation der 200 Euros". Beschäftigte, Rentner, Arbeitslose, alle kamen auf der Straße zusammen, um die junge Generation zu unterstützen, deren Zukunft völlig düster ist.
Aber der Bewegung an den Universitäten 2009 in Frankreich gelang es nicht, ihren Kampf auszudehnen. Sie blieben isoliert und damit machtlos. Dennoch waren die Lehren aus der Bewegung gegen den CPE präsent. Denn am Anfang der Bewegung haben viele Vollversammlungen die Frage der Notwendigkeit der Ausdehnung der Bewegung gestellt. So beschloss beispielsweise eine Vollversammlung in der Normandie, in Caen, die Beteiligung aller Menschen zu ermöglichen. Auch in Toulouse wurden die Vollversammlungen auf alle Toulouser Unis ausgedehnt. Mit den Beschäftigten wurde Kontakt aufgenommen, das Gespräch gesucht. In vielen Unis kamen zum Beispiel die Beschäftigten der Universitäten und die Studenten zusammen, wie in Nancy. Dies geschah jeweils gegen den Widerstand der Studentenverbände.
Aber während in mehreren Vollversammlungen die Absicht bekundet wurde, die Bewegung auszudehnen, haben die Gewerkschaften sofort alles unternommen, um die Bewegung zu schwächen und abzuwürgen. Die studentenspezifischen Belange wurden in den Vordergrund gestellt; das Gemeinsame und Verbindende zwischen Studenten und Beschäftigten wurde vernebelt und in den Hintergrund gedrängt. Die Folge: niemand konnte sich dann mit diesem Kampf identifizieren. Von Außen betrachtet erschien es als eine Auseinandersetzung, die nur Studenten und Forscher etwas anging. Die Einschränkung auf bestimmte Branchen oder Ausbildungsrichtungen nahm manchmal lächerliche Formen an. So gab es eine Vielzahl von Vollversammlungen in verschiedenen Fakultäten, als ob die Interessen z.B. von zukünftigen Geschichtslehrern unterschiedlich seien als die von zukünftigen Psychologen.
Ein anderer gewerkschaftlicher Trick war, die Debatten in den VV ausschließlich auf die Frage der Blockierung der Universitätsgebäude zu richten. Während des Konfliktes um den CPE dienten die Blockierungen in der Phase, als sich die Solidarität entfaltete, dazu, die Vollversammlungen zu einem Ort der Diskussionen zu machen. Aber 2009 drehten sich die Vollversammlungen aufgrund der Isolierung der Studenten nur darum, die jeweiligen Blockademaßnahmen abzustimmen, zudem diese von den Gewerkschaften als die einzig mögliche Kampfmaßnahme und das Wesen des Kampfes selbst dargestellt wurden. Auch wurden viele Studenten für sinnlose Aktionen mobilisiert wie Unterschriftensammeln vor Wahlveranstaltungen zu den Europawahlen usw. und ihr Blick total eingeschränkt auf spezifische Belange.
Die Herrschenden wissen, dass die Einheit der Arbeiterklasse eine Kraft ist, gegen die sie nichts ausrichten können. Und sie wissen, indem sie die Arbeiterklasse spalten, können sie sie besiegen. Deshalb versuchen sie mit Hilfe der Gewerkschaften, den Organisationen der Extremen Linken und den Studentenverbänden Verwirrung zu stiften und den Zusammenschluss der Betroffenen zu verhindern. V, (leicht gekürzter Artikel aus unserer Presse in Frankreich).
Spanien
Die Wichtigkeit der Solidarität
Spanische Studenten wehren sich gegen den "Bologna-Prozess", der es wohlhabenderen Studenten ermöglichen wird, leichter im Ausland zu studieren. Die Studenten in Barcelona haben in den jüngsten Kämpfen unter Beweis gezeigt, dass sie ungeachtet ihrer eigenen unmittelbaren schwierigen Situation nicht umhin können über die Zukunft des Kapitalismus nachzudenken und das, was er der gesamten Arbeiterklasse – allen Generationen - anzubieten hat. Hinzu kommen ihre Angst und Hoffnungen, eine Arbeit nach Abschluss ihres Studiums zu finden. Sie waren ebenso sehr empört über die Unterdrückung der jungen Leute durch die Mosso-Einheit (regionale katalanische Polizei), welche unter dem Befehl der linken Regierungskoalition in Katalonien (dieser gehören Sozialisten, katalanische Nationalisten, ehemalige Stalinisten an) steht. Diese Einheit hatte Studenten zusammengeschlagen, viele gewaltsam verhaftet und besetzte Einrichtungen geräumt. Es lag auf der Hand, wenn sie den Rahmen eines Kampfes in den Universitäten nicht überwinden, stünden sie isoliert da, den Manövern und der Repression durch die Regionalregierung allein ausgesetzt. Als sie versuchten, ihren Kampf auf Lehrer und andere Beschäftigte auf anderen Branchen auszudehnen sowie auf Schüler, gewannen sie an Stärke und ließen die Regierung zögern. In einer Demonstration von 30.000 Lehrern am 18. März in Barcelona spielten sie eine große Rolle, denn dort wurden sie ganz normal in der Demo integriert und nicht gezwungen, einen separaten Block zu bilden.
Nachdem ihre Besetzung der Uni von der Polizei gewaltsam beendet und die Repression abends mit vielen Verhaftungen und der Verletzung von 60 Teilnehmern von einer Gesamtzahl von 5000 fortgesetzt gesetzt wurde, reagierten die Studenten mit der Organisierung einer Solidaritätsdemo. Die katalonische Regierung wurde dazu gezwungen, sich zu entschuldigen, im Innenministerium mussten Leute abtreten. Seitdem wurden Vollversammlungen abgehalten, gestreikt, Gebäude besetzt und Unterstützer getroffen. Man hat mit anderen Universitäten debattiert und sich mit ihnen ausgetauscht, insbesondere Valencia und Madrid.
Ein Flugblatt wurde verteilt, in dem man hervorhob: "Wir sind keine Delinquenten, keine Rebellen ohne Grund, noch sind wir Kanonenfutter für die Mossos (katalanische Polizei) und Bürokraten. (…) "Dank einer breiten Studentenbewegung, und weil Einheit Stärke bedeutet, wollen wir nicht nur die Angriffe des Kapitals zurückschlagen, sondern wir kämpfen auch für eine gerechte, tolerante, und freie solidarische Gesellschaft, denn wir meinen, wir sind dazu in der Lage die Welt, in der wir leben, zu ändern." ("Einige Überlegungen …. Zu den Ereignissen vom 18. März in Barcelona", ein Flugblatt, das am 26. März auf einer Demonstration verteilt wurde). Diese Demonstration stützte sich auf die Solidarität derjenigen, die sich auch dessen bewusst sind, dass die Lage immer schlechter wird und keine Anzeichen einer Verbesserung in Sicht sind. Sie stützten sich auf ihre Gesinnungsgenossen, Lehrer, auf alle, die ihre Sorgen teilen, und wissen, dass sie die Beschäftigten von Morgen sind.
Die Regionalregierung bereitete sich inzwischen auf die Demonstrationen vor, indem sie systematisch die Angst schürte vor gewaltsamen Auseinandersetzungen, so wie es zum Beispiel die herrschende Klasse in Großbritannien anlässlich der Proteste gegen den G20 in London gemacht hatte. Die Mossos sollten sich auf alle möglichen Situationen einstellen. All das wurde durch eine intensive Medienkampagne zur Vorbereitung eines Gewalteinsatzes begleitet.
Die Studenten und andere blieben trotz der Angst vor Repression sehr tapfer und standfest während der Demonstration. Als die Mossos der Demonstration den Weg versperrte, wichen sie der Provokation aus und schlugen eine andere Richtung ein. Im Gegensatz zu einer von den Gewerkschaften organisierten Demo wurde auf dieser Demo diskutiert, man trug eigene Forderungen vor. Immer mehr Menschen schlossen sich der Demo an, Studenten, ihre Eltern, Beschäftigte, so dass zum Schluss ca. 10.000 Menschen mitmarschierten.
Aktuelles und Laufendes:
- Studentenproteste Frankfreich [233]
- Spanien [234]
- Mosso [235]
- CPE [236]
August 2009
- 773 reads
September 2009
- 869 reads
Debatte über den „Luftbrücken“-Artikel der IKS - Das Menetekel des Kapitalismus
- 2956 reads
Bereits in Weltrevolution, Nr. 154, der Juni-Juli Ausgabe der deutschsprachige Zweimonatszeitung der IKS, haben wir Kommentare zu unserem Artikel über die Berliner Luftbrücke unsererseits kommentiert, wo es um die uns unterstellte Leugnung des Unterschieds zwischen Faschismus und Demokratie ging. Wir versuchten dort aufzuzeigen, dass die Kommunistische Linke keineswegs Unterschiede zwischen diesen beiden Formen der Diktatur des Kapitals leugnet. Die italienische Fraktion der Kommunistische Linke hat Mitte der 1930er Jahre vielmehr auf diesen Unterschied hingewiesen, um die Tatsache zu erklären, dass nach dem Sieg des Hitlerfaschismus in Deutschland es der Bourgeoisie der westlichen Demokratien nun möglich geworden war, auch ohne vorherige physische Zerschlagung die eigene Arbeiterklasse für den zweiten imperialistischen Weltkrieg zu mobilisieren, und zwar mittels des Antifaschismus. Für uns sind Faschismus und Demokratie nicht gleich, aber sie sind historisch betrachtet gleich reaktionär, gleichermaßen Feinde des Proletariats.
Debatte über den „Luftbrücken“-Artikel der IKS
Das Menetekel des Kapitalismus
Bereits in Weltrevolution, Nr. 154, der Juni-Juli Ausgabe der deutschsprachige Zweimonatszeitung der IKS, haben wir Kommentare zu unserem Artikel über die Berliner Luftbrücke unsererseits kommentiert, wo es um die uns unterstellte Leugnung des Unterschieds zwischen Faschismus und Demokratie ging. Wir versuchten dort aufzuzeigen, dass die Kommunistische Linke keineswegs Unterschiede zwischen diesen beiden Formen der Diktatur des Kapitals leugnet. Die italienische Fraktion der Kommunistische Linke hat Mitte der 1930er Jahre vielmehr auf diesen Unterschied hingewiesen, um die Tatsache zu erklären, dass nach dem Sieg des Hitlerfaschismus in Deutschland es der Bourgeoisie der westlichen Demokratien nun möglich geworden war, auch ohne vorherige physische Zerschlagung die eigene Arbeiterklasse für den zweiten imperialistischen Weltkrieg zu mobilisieren, und zwar mittels des Antifaschismus. Für uns sind Faschismus und Demokratie nicht gleich, aber sie sind historisch betrachtet gleich reaktionär, gleichermaßen Feinde des Proletariats.
In einem seiner ersten Kommentare zum Luftbrücken-Artikel auf unsere Webseite vermisst der Genosse Hama den „großen Zusammenhang“ in diesem Artikel, den er wie folgt formuliert: „Systematische Verfolgung und Vernichtung der Juden überall auf der Welt (soweit sie den Nazis und Kollaborateuren zugänglich waren), Menschenversuche und schrecklichste Folter in den Kzs und Vernichtungsstätten, Erfassung und Vernichtung ‚unwerten Lebens‘ - unglaubliches Wüten der deutschen Armeen und Sonderstäbe in den überfallenden Ländern -
Wenn ich da hergehe und sage, es war Krieg der Imperialisten in all seiner Grausamkeit und nur die Arbeiterklasse konnte dem ein Ende bereiten. Und dann einsetze mit Nachkrieg und sage, die Alliierten haben die Arbeiterklasse bewusst dezimieren wollen, weil sie sich gefürchtet haben, es könne erneut zu einer revolutionären Erhebung kommen...dann bin ich auch ohne die ‚Todeslager‘- Argumentation (die direkt aus dem Arsenal der Holocaustleugner und Neofaschistin stammt) mitten dabei, über all das, was ich oben aufgezählt habe, elegant hinwegzusehen.“ (Bereits zitiert in „Faschismus = Demokratie?“ in Weltrevolution, Nr. 154).
So schreibt Hama an anderer Stelle: „Der Artikel der IKS enthält Aussagen, die sich nicht relativieren oder zurecht biegen lassen: dazu sind sie zu unmissverständlich geschrieben worden. Sie lassen sich nur ausdrücklich zurücknehmen. Der Satz, mit Besetzung Deutschlands durch die Alliierten sei es ein Todeslager geworden ist neofaschistisch, nicht nur, weil im Artikel die Vernichtung der Juden, für die Deutschland tatsächlich zum Todeslager wurde, keine Rolle spielt.“
(Siehe die Kommentare auf unserer Webseite).
Diese von Hama erhobene Forderung findet Unterstützung. Estragon schreibt (19.07.2009): „Hama hat ganz recht, der Artikel muss auf alle Fälle zurückgenommen werden, er ist absolut unseriös und hält einer marxistisch-materialistischen Analyse nicht stand. Seine Motivation ist rein moralischer Natur und versucht Äpfel mit Birnen zu vergleichen, stellt Dinge in falsche Zusammenhänge und bedient sich dabei Argumentationen, die man eher im neonazistischen Umfeld vermutet.“ Riga (20.07.2009) „befürchtet“ dass „weder der Appell von Estragon, noch der von Hama dafür sorgen wird, dass dieser und ähnliche Artikel zum Thema Faschismus/Antifaschismus von der IKS in absehbarer Zeit revidiert werden.“
Die Frage der Quellen
Zunächst einmal sind wir sehr dankbar gegenüber allen GenossInnen, die sich die Mühe gemacht und ihr Herzblut eingesetzt haben, um unsere Presse zu kommentieren. Sie haben nicht nur die Kommentarseite unserer Webseite belebt und bereichert, sie haben die IKS auch konkret weiter geholfen. Zum Beispiel Anonymous, der zu Recht darauf hinwies (05.05.2009), dass wir in manchem Artikel dubiose Quellen benutzt haben. „Ich stehe ja der IKS in vielen Positionen nicht allzu fern, aber gewisse Texte der IKS rund um den 2. Weltkrieg finde ich schon sehr schwierig. V.a. zitiert die IKS immer mal wieder Revisionisten und/oder Holocaust-Leugner wie z.B. David Irving oder, wie in diesem Text, James Bacque und gibt diesen Herren und ihren Positionen damit eine gewisse Legitimation (und suggeriert im schlimmsten Fall gar, dass die Revisionisten sowas wie eine kritische, fortschrittliche Position in der Debatte rund um den 2. Weltkrieg einnehmen würden)“. Tatsächlich werden nicht alle Historiker, die die Verbrechen der Alliierten untersuchen, von der Wahrheitssuche und wissenschaftlichen Ethik geleitet. Manche von ihnen sind offene oder versteckte Sympathisanten der von Hitlerdeutschland im Zweiten Weltkrieg angeführten Koalition. Ihr Motiv besteht tatsächlich darin, durch die Übertreibung der Verbrechen der „Anderen“ und die Verharmlosung der „eigenen“ Untaten das eine imperialistische Lager gegenüber dem anderen in ein besseres Licht erscheinen zu lassen. So wäre es tatsächlich besser, bei konkreten historischen Gegebenheiten die unterschiedlichen Zahlen und ihre Quellen anzugeben und kritisch zu kommentieren, anstatt eine bestimmte Version herauszugreifen. Eine solche Vorsicht walten zu lassen ist wichtig, denn ungenaue Zahlen und dubiose Quellen können nur dazu führen, die Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft der politischen Aussagen zu schwächen.
Die Frage der Todeslager
Ein anderer Stein des Anstoßes ist folgende Formulierung im Luftbrücken-Artikel: „Deutschland wurde in der Tat durch die russischen, britischen und US-amerikanischen Besatzungsmächte zu einem Todeslager.“ Dabei bezieht sich der Artikel auf die vielen Opfer unter den Vertriebenen aus dem Osten, unter den Kriegsgefangenen sowie unter der hungernden Zivilbevölkerung.
Man mag sich darüber streiten, ob die Formulierung „Todeslager“ angemessen ist oder nicht. Wir finden, man soll sich darüber „streiten“, womit wir meinen, solidarisch darüber debattieren. Die IKS ist keine monolithische Organisation. Die Artikel, die in unserer Presse veröffentlicht werden, bringen von ihrer politischen Ausrichtung her entweder die Meinung der Organisation bzw. der Redaktion zum Ausdruck, oder sie werden als divergierende Meinung als solche gekennzeichnet. Texte, welche die Meinung der Organisation insgesamt zum Ausdruck bringen, werden ebenfalls als solche gekennzeichnet, entweder als von unseren Kongressen verabschiedete Dokumente oder mit dem Namen der Organisation unterschrieben. Das Gros der Artikel in unserer Presse bringt also in seiner Ausrichtung zwar die Meinung der Organisation zum Ausdruck, in den einzelnen Formulierungen aber die Meinung des jeweiligen Autoren. Daher werden diese Artikel persönlich gezeichnet. Die Formulierung „Deutschland als Todeslager“ ist mithin keine Position oder Meinung der IKS als Organisation. Die politische Ausrichtung des Artikels hingegen schon. Wir sehen jedoch keinen Anlass, diese Formulierung „zurückzunehmen“, da der Genosse zur Unterstützung seiner Formulierung ernstzunehmende Argumente angeführt hatte, die es verdienen, weiter diskutiert zu werden. Außerdem finden wir ganz entschieden, dass weder der Artikel als solcher noch die „Todeslager“-Formulierung irgendetwas „Neofaschistisches“ an sich hat. Diesen Vorwurf können wir beim besten Willen nicht verstehen.
Ein Beispiel: nach 1989 wurde von bürgerlicher Seite viel Aufhebens gemacht um die stalinistischen Konzentrations- und Todeslager in der UdSSR, China, Kambodscha usw. Die Absicht war klar. Man wollte den Stalinismus benutzten, um den Kommunismus zu diskreditieren und darüber hinaus die westliche Demokratie als das denkbar beste Gesellschaftssystem erscheinen zu lassen. Aber es gab auch genügend Sympathisanten der Rechtsextremen, die die Gunst der Stunde, sprich: die „Enthüllungen“ über die Verbrechen des Stalinismus aufgegriffen haben, um die Verbrechen der Nazis zu relativieren bzw. um sie als verständliche, gegenüber den „Bolschewismus“ rein defensiv motivierte Aktionen erscheinen zu lassen. Das zum einem.
Auf der anderen Seite hat die Kommunistische Linke, wie auch andere proletarische Oppositionelle, sehr früh das System der Konzentrationslager in der UdSSR entlarvt und angeprangert. Sie setzte diesen Kampf fort, auch und gerade zu den Zeiten, als die westlichen Demokratien von der Existenz dieses Lagersystems nichts wissen wollten. Es ist klar: Das Anprangern des GULAG durch die Revolutionäre hatte und hat ein völlig anderes Motiv, eine vollkommen unterschiedliche Bedeutung als das Anprangern desselben Phänomens durch die faschistische und die demokratische Bourgeoisie. Die Revolutionäre bekämpften den GULAG, weil die eigenen GenossInnen drin saßen, weil er ein Teil der Konterrevolution gegen die Arbeiterklasse war, ein Teil der alten Welt, die man zu Grabe tragen will. Die Bourgeoisie bekämpfte das Lagersystem nicht, sondern nutzte es für die eigene Propaganda (oder auch nicht, je nachdem was gerade passend war).
Das Gleiche gilt für die Verbrechen der Alliierten. Die Rechtsradikalen sprechen davon, um das von ihnen befürwortete Ausbeutungsregime in ein besseres Licht erscheinen zu lassen und um die Konkurrenten möglichst schlecht aussehen zu lassen. Die proletarischen Internationalisten sprechen darüber, um das Ausmaß der Barbarei des gesamten Systems anzuprangern. Schlimm wäre es (und ein Sieg für die Demokratie, ja für den Kapitalismus), wenn wir aus lauter Angst davor, mit den Rechten in einen Topf geschmissen zu werden, über die Verbrechen der Demokratien schweigen oder sie nicht beim Namen nennen würden. Denn es geht darum aufzuzeigen, dass diese Barbarei nicht das Produkt ausschließlich einer bestimmten Form des Kapitalismus ist, sondern ein Produkt des Kapitalismus insgesamt.
Der Kapitalismus ist ein Konkurrenzsystem. Nicht nur einzelne Kapitalisten, auch Nationen, ja Staatenkoalitionen bekämpfen sich. Die Lebensweise dieser Gesellschaft beherrscht das Alltagsbewusstsein so sehr, dass es vielen in der heutigen Zeit schier unmöglich zu sein scheint, anders als in Kategorien von miteinander konkurrierenden Lagern und Ideologien zu denken. Entlarvt man die eine Seite, so wird zunächst angenommen, man sei für die andere Bande. Das ist ein Problem, was sich nicht leicht beheben lässt, solange es innerhalb der Arbeiterklasse nicht wieder üblich wird, in Klassenkategorien zu denken.
Estragon z.B. hat einen sehr interessanten Kommentar geliefert, worin er auf recht präzise und differenzierte Weise die Unterschiede aufweist zwischen der Lage der Bevölkerung in Deutschland am Kriegsende und der Lage der Insassen des Konzentrationslagers Bergen-Belsen. Anders als die Opfer der Konzentrationslager konnte die deutsche Bevölkerung sich frei bewegen, arbeitete z.T. in der Landschaft, besaß Anbauparzellen oder konnte sich über den Schwarzmarkt mit Lebensmittel versorgen. Er weist darauf hin, dass die Lage in der französisch besetzten Zone schlimmer war als in der britischen oder amerikanischen, da Frankreich selbst durch den Krieg stark ausgepowert war; dass unter der deutschen Zivilbevölkerung das städtische Proletariat und die Flüchtlinge mehr unter Hunger litten als das Landvolk usw. Alles richtig (außer vielleicht, dass der internierte Teil der Bevölkerung sich eben nicht frei bewegen konnte). Ziel dieser Ausführungen ist es, den „Bergen-Belsen-Vergleich“ der IKS zu widerlegen. Der besagte IKS-Artikel aber „vergleicht“ Bergen-Belsen nicht mit Deutschland 1945. Die Herangehensweise des Artikels ist: Bergen-Belsen ist schlimm, die Behandlung der deutschen Zivilbevölkerung nach 1945 durch die Alliierten war schlimm. Solches darf nicht hingenommen werden! Der Artikel schreibt: „In der französischen Besatzungszone, wo die Lage am schlimmsten war, betrug 1947 die Ration 450 Kalorien pro Tag, die Hälfte der Ration des berühmt-berüchtigten KZ's in Bergen-Belsen.“ Ist das ein Vergleich? Es ist eine Tatsache, von dem der Artikel überzeugt ist. Daraus schließt der Artikel, dass die damals von den Militärbehörden angegebenen Mortalitätsraten zu niedrig angesetzt sind. Estragon liefert eine andere, nicht weniger plausible Erklärung, nämlich dass sich die Bevölkerung mehr Nahrung beschaffen konnte, als ihr offiziell zustand. Vielleicht waren beide Aspekte am Werk. Nun schreibt Estragon: „Die Kalorienzuteilungen lagen 1947 in der französischen Zone mindestens zwischen 900 und 1100 Kalorien. Diese schlossen jedoch die mögliche Selbstversorgung mit Lebensmitteln nicht aus, sondern setzten sie voraus – was in Bergen-Belsen jedoch nicht der Fall war.“ Wenn wir richtig verstehen, so wird hier den französischen Militärbehörden ein Versorgungspflichtgedanke unterstellt: Sie hätten die Mindestrationen nur deshalb so niedrig angesetzt, weil sie sicher waren, dass sich die Bevölkerung ohnehin mehr und ausreichend zum Überleben verschaffen werde. Das kann stimmen, muss aber nicht. Was dagegen spricht, ist die jahrzehntelange Erfahrung von Krieg im Kapitalismus und was sie hervorrufen: Chauvinismus, Völkerhass, Rachegelüste. Man wünscht dem Gegner den Tod.
Die Frage des Luftkriegs
Auch in seiner Abhandlung über den Luftkrieg und Bombenterror ist Estragon bemüht, jeden Gedanken zu widerlegen, dass die Demokratien Massentötung betrieben haben könnten. Zunächst wird der IKS unterstellt, den Bombenkrieg als eine „Spezialität der Alliierten“ hinzustellen. Allerdings steht das weder in diesem noch in irgendeinem anderen Artikel der IKS. Dafür wird uns vorgeworfen, den Luftkrieg der deutschen Luftwaffe „ausgeblendet“ zu haben. „Hier bewegt man sich ganz im herrschenden Diskurs und bedient deutschnationale Vorurteile.“ Aber warum, bitte schön, sollten wir in einem Artikel über die Verbrechen der Alliierten und über den beginnenden Kalten Krieg über die Massenmorde der deutsche Luftwaffe schreiben? Und warum sollten wir „deutschnationale Vorteile“ bedienen wollen? Wie dem auch sei, Estragon führt weiter aus: „Die Luftangriffe auf den sowjetischen Städte wurden in der klaren Absicht ausgeführt, die dortige Bevölkerung ohne jegliche Rücksicht zu dezimieren, gemäß den Vorgaben eines erklärten Vernichtungskrieges mit dem der deutsche Imperialismus über die Länder im Osten hergefallen war. Derartige Beweggründe lassen sich aber dem britischen und amerikanischen Imperialismus nicht unterstellen, auch wenn die Opferzahlen in Deutschland durch den Luftkrieg annähernd vergleichbar waren.“ Es gehörte zu den strategischen Kriegszielen des deutschen Imperialismus, große Gebiete Osteuropas zu entvölkern, d.h. die dort lebende Bevölkerung zu ermorden und durch deutsche Ansiedler zu „ersetzen“. Von den demokratischen Imperialisten sind keine solchen Kriegspläne gegen Deutschland für die Zeit während und unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg bekannt. Soweit können wir der Argumentationsweise von Estragon folgen. Und weiter: „Auf dem westlichen Kriegsschauplatz hatte sich der Bombenkrieg gegenseitig und allmählich zum Vergeltungskrieg hochgeschaukelt und wurde schließlich zur einer Art Selbstläufer, an dem vor allem die blühende Bombenindustrie in den Vereinigten Staaten ein gesteigertes Interesse hatte. Und obwohl in den militärischen Stäben an der militärischen Sinnhaftigkeit der Bombardierungen gezweifelt wurde, musste der ständig wachsende Output vor allem der amerikanischen Bombenindustrie verwertet werden. Auch die Atombombenabwürfe auf das quasi bereits geschlagene Japan sollten schließlich den weltpolitischen Profit bringen, der den ungeheuren Investitionen der amerikanischen Bourgeoisie in das Alamo-Projekt entsprach.“ Das alles klingt ein wenig verharmlosend in unseren Ohren, nach dem Motto: Die Nazis betreiben Massenmord, die Demokratien Geschäfte. Betreiben die Nazis keine Geschäfte? Betreiben die Demokratien keinen Massenmord? War Hiroshima, war Nagasaki kein Massenmord? Was haben wir uns unter „weltpolitischen Profit“ vorzustellen? Haben die US-Imperialisten ihre Atombomben verkauft, oder haben sie ihre Atombomben abgeworfen? Und warum war die Bombenindustrie der Vereinigen Staaten eine „blühende“? Hing diese Blüte nicht damit zusammen, dass auch die USA in diesen Krieg das Ziel verfolgte, möglichst viele Menschen der gegnerischen Seite zu töten? Abgesehen von der besonderen Massenmordpolitik der Nazis - ist es nicht das eigentliche „Geschäft“, ja das Wesen des modernen kapitalistischen Krieges, möglichst effektive Massentötungen zu veranstalten, auch und gerade gegenüber der Zivilbevölkerung?
Die Unterscheidung zwischen Mord und unterlassener Hilfeleistung
Auf die IKS Bezug nehmend, schreibt Estragon weiter. „Es zeigt sich, wie wenig man den Artikel Bordigas ‚Auschwitz oder das große Alibi‘ verstanden hat. Bordiga zweifelt keinesfalls die ‚Singularität‘ des Holocaust an, die eben nicht in der Tatsache des millionenfachen Mordens, sondern in ihrer industriellen, durchgerechneten und durchgeplanten Ausführung liegt. Er macht lediglich darauf aufmerksam, daß diejenigen, die heute Auschwitz dazu benutzen, ihre moralische Überlegenheit darzustellen, nicht weniger menschenverachtend sind. Die Nazis sind einstweilen geschlagen, das Morden für Profit geht weiter (...) Bordiga, so jedenfalls verstehe ich ihn, kommt nicht zu dem fatalen Schluss: ‚Die Alliierten und Nazis sind beide verantwortlich für das Holocaust‘, dann nämlich setzt man der Simplifizierung die Krone auf, unterscheidet nicht mehr zwischen ‚Mord‘ und ‚unterlassene Hilfeleistung‘. Mit dieser Schablone sind wir alle ‚schuldig‘ und wir bewegen uns auf dem Niveau christlich-bürgerlicher Moral anstatt einer marxistisch-materialistischen Analyse.“ Wir lassen es dahingestellt, ob der angesprochene „Auschwitz-Alibi“-Artikel tatsächlich von Amadeo Bordiga geschrieben wurde, wie Estragon behauptet. Wir lassen es dahingestellt, ob dieser Artikel „lediglich“ „diejenigen“ als nicht weniger menschenverachtend entlarvt, die Auschwitz benutzen, um ihre moralische Überlegenheit darzustellen (immerhin macht der Artikel den Kapitalismus insgesamt dafür verantwortlich und meint mit „diejenigen“ unmissverständlich die Demokratie!). In unserer Zeitung Weltrevolution haben wir auf den Vorwurf geantwortet, dass wir nicht zwischen Faschismus und Demokratie „unterscheiden“ Jetzt wirft man uns vor, nicht zwischen Mord und unterlassener Hilfeleistung zu unterscheiden. Was ist damit gemeint? Vermutlich dies: die Nazis haben die Juden ermordet, die Demokratien haben es unterlassen, Hilfe zu leisten. Das ist nicht das Gleiche, sagt Estragon (womit er Recht hat). Trotzdem sagen wir, dass die Demokratien mitverantwortlich sind für den Holocaust. Hat Estragon also doch Recht mit diesem Vorwurf? Wir meinen: Nein. Außerdem scheint Estragon zu meinen, die IKS würde die „Singularität“ des Holocaust leugnen. Woher nimmt Estragon das eigentlich? Der Holocaust war „singulär“ (sprich: einmalig), und nicht nur aufgrund seiner „industriellen Ausführung“, wie Estragon zu glauben scheint. Dieser Massenmord widersprach zu radikal und tief jeder bisherigen Vorstellung von menschlicher Moral, so dass er nur inoffiziell, sozusagen im Halbverborgenen ausgeführt werden konnte. So mussten die Euthanasiekampagne in Deutschland, die Pogrome in Dänemark oder in Bulgarien stillschweigend heruntergefahren werden, nachdem einzelne couragierte Kirchenvertreter sich öffentlich dagegen ausgesprochen hatten. Die Frage ist oft gestellt worden, weshalb die Alliierten die Bahnlinien nach Auschwitz nicht durch ihre Bombardierungen zu unterbinden versucht hatten. Man kann noch mehr fragen. Hätten die Alliierten, nachdem sie (recht früh) vom Völkermord erfahren hatten, in aller Form erklärt, alle daran beteiligten Personen nach Kriegsende dafür zur Rechenschaft zu ziehen, hätte das sehr wahrscheinlich dieser mörderischen Maschinerie zumindest einen starken Dämpfer versetzt.
Hama wiederum wirft uns vor, nur die üblichen marxistischen Schemata wie Mehrwertauspressung und Klassenanalyse ins Feld führen zu können, um den Holocaust zu erklären. In einem Kommentar vom 24.05.2009 springt Riga Hama bei. Hama wolle, so Genosse Riga, auf das Irrationale der Shoa, auf den durch keine ökonomische Klassenanalyse erklärbaren, irrationalen Vernichtungswillen hinaus. Wir dürfen nicht bei der Feststellung stehenbleiben, so Riga weiter, dass die Niederlage des Weltproletariats diese Katastrophe ermöglicht hat, sondern wir brauchen eine tiefere Erklärung, die die Entfremdung, aber auch psychische und moralische Aspekte mit berücksichtigt.
In der Tat. Allein, wir wissen nicht, wie die Genossen dazu kommen, der IKS vorzuwerfen, die Rolle des Irrationalen, der Moral oder der Psychologie zu verleugnen. Warum auch immer - der deutsche imperialistische Staat wurde von einer Bande in den Zweiten Weltkrieg geführt, die extreme, schockierende Anzeichen des Irrsinns aufwies. Großbritannien und den USA hingegen wurden von eher traditionellen, gewachsenen Gruppierungen, von Churchill und Roosevelt, von der konservativen bzw. demokratischen Partei angeführt. Die eine Seite, die teilweise irrsinnige, ermordete sechs Millionen Juden. Die andere Seite, die „normalen“ und „gesunden“ Imperialisten, schauten weg. Ist das das Gleiche? Keineswegs. Ist das eine weniger „schlimm“ als das andere? Nicht unbedingt. Nicht, wenn die Hilfe unterlassen wird, um selbst ungehindert weiter morden zu können.
Das Menetekel
Es gibt auf Englisch den häufig benutzten Ausdruck: „The writing is on the wall“. Das bringt einen weit verbreiteten Glauben zum Ausdruck, dass die von politischen Aktivisten, Dichter oder Verrückte an Mauern und Unterführungen geschriebenen Parolen und Graffitis dringende, ernstzunehmende Warnungen enthalten. Das Ganze bezieht sich auf eine Bibelgeschichte aus dem Buch Daniel, auf ein geheimes Schriftzeichen, das das Ende des Königsreichs von Babylon Belsazar, dem Sohn des Nebukadnezar II, ankündigte.
„Und sieh! Und sieh! An weißer Wand
Da kam`s hervor wie Menschenhand;
Und schrieb, und schrieb an weißer Wand
Buchstaben von Feuer, und schrieb und schwand.
Der König stieren Blicks da saß,
Mit schlotternden Knien und totenblass.
Die Knechtenschar saß kalt durchgraut,
Und saß gar still, gab keinen Laut.
Die Magier kamen, doch keiner verstand
Zu deuten die Flammenschrift an der Wand.“
So stellte sich der Dichter Heinrich Heine die Szene vor (in seinem Gedicht „Belsatzar“). Man sagt, die herbeigerufenen Schriftgelehrten haben die Schrift deshalb nicht zu deuten gewusst, weil die Wörter „mene mene tekel u- pharsin“ in der aramäischen Sprache ein Wortspiel enthalten, die sie nicht verstanden hatten. Seitdem gilt das Menetekel als eine Unheil verkündende Warnung, einen ernsten Mahnruf oder ein Vorzeichen drohenden Unheils. Die Tücken der Geschichtsdeutung liegen darin, dass die Zeichen der Zeit oft etwas Geheimnisvolles haben oder Wortspiele enthalten. Sie sind zweideutig. Werden die Zeichen der Zeit nicht richtig, nicht rechtzeitig gelesen, so lässt sich die Katastrophe nicht mehr abwenden. Aber in Wahrheit gibt es nicht nur ein Zeichen, der Gang der Geschichte drückt sich vielfältig aus. So wie die einzelnen Wörter erst zusammen ihren Sinn preisgeben, so müssen die Schlüsselereignisse der Geschichte, auch und gerade die unheilvollen, zusammen und nicht gegeneinander gelesen werden. An der Somme und an der Marne, im Ersten Weltkrieg, begann das Zeitalter der maschinellen Vernichtung von Menschen, die Massenproduktion des Todes. In diesem Stadium brachten sich die Opfer gegenseitig um. Das waren die zivilisierten Staaten Europas, damals noch das Zentrum des Kapitalismus. Auschwitz lag nicht mehr an der Front, Völkermord als Industriezweig, voll ausgelastet. Das waren die Nazis. Dann kam Hiroshima. Die Wissenschaft erobert die Fähigkeit, die Menschheit selbst auszulöschen, und stellte es unter Beweis. Das war die Demokratie (die Nazis hätten das auch gern getan, aber tatsächlich war es die US-Bourgeoisie). Nun gibt es die Diskussion, ob man Auschwitz mit Hiroshima vergleichen kann, was schlimmer sei, ob man das eine verharmlost, wenn man vom anderen spricht. So dachten vermutlich die Schriftgelehrten von Babylon auch. Sie verstanden es nicht, die Zeichen zusammen zu lesen.
Marx sprach davon, dass Niedergangsphasen in der menschlichen Vorgeschichte dann eintreten, wenn die Produktionsverhältnisse, Eigentumsverhältnisse zu Fesseln werden. Die Produktivkräfte rebellieren gegen diese Enge, das sind die Überproduktionskrisen. Die Produzenten rebellieren gegen eine Ausbeutung, die nicht mehr hinnehmbar erscheint. Das ist der revolutionäre Kampf. Es zeigt sich aber, dass diese Enge, die zu einer Erstickung zu werden droht, auch zu einer explosionsartigen Entwicklung der Zerstörungskräfte führt. Darunter verstehen wir die Anhäufung und Perfektionierung der Waffen, aber auch die Akkumulation von Hass und Zerstörungswut, was sich verträgt mit einer unheimlichen, für den Kapitalismus eigentümlichen eisigen Erstarrung der Welt. Dieses Menetekel hat schon die große Mehrheit der Sozialdemokratie vor 1914 nicht zu deuten gewusst. Man hielt krampfhaft an einem naiven Fortschrittsglauben fest, wollte von der nahenden Katastrophe nichts wissen. Aber auch der Antifaschismus ist blind gegenüber der „Schrift an der Wand“. Die Lehre aus Auschwitz, dass der Faschismus, der Nationalsozialismus ein Monstrum ist, ist vollkommen richtig – aber zu wenig. Wenn man daraus schließt, dass andere Formen des Kapitalismus weniger „schlimm“ sind, so kehrt sich Wahrheit in ihr Gegenteil um. Für uns ist die Lehre aus Auschwitz, dass der Kapitalismus als solcher und in seiner Gesamtheit dringendst überwunden werden muss, bevor es zu spät ist.
In einem Kommentarbeitrag (24.05.2009) schreibt der Genosse Riga, dass man die Welt nicht verändern kann, wenn man nicht die Köpfe und die Herzen der Proletarier für die Sache der Befreiung gewinnt, und dass man die Köpfe und Herzen nicht gewinnen kann, wenn man die Leute von jeder Verantwortung freispricht. Damit hat der Genosse zutiefst Recht. Zugleich wirft er aber der IKS vor, die Unschuld der ArbeiterInnen in Deutschland gegenüber der Nazizeit beweisen zu wollen. Was er hier mit „Schuld“ und „Unschuld“ genau meint, wissen wir nicht. Es wäre sicherlich für die Diskussion fruchtbar, wenn er dass erläutern würde.
Was wir aber wissen, ist, dass die Ideologie des Antifaschismus die Leute unfähig macht, Mitgefühl gegenüber den Opfern des Zweiten Weltkrieges und der Nachkriegszeit innerhalb der deutschen Bevölkerung zu empfinden. Doch die Sache der Emanzipation wird nur dann siegreich sein, wenn es Mitgefühl und Solidarität mit allen Opfern des Kapitalismus empfinden kann.
Die Redaktion Weltrevolution. 15/09/2009.
Historische Ereignisse:
- Luftbrücke Berlin [237]
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
- Italienische Linke [86]
Theoretische Fragen:
- Krieg [25]
Debatte über die subjektiven und objektiven Faktoren der Revolution
- 3550 reads
Verschiedene Artikel der IKS über die weltweiten Jugendproteste der letzten Zeit haben eine lebhafte Debatte auf unserer Webseite ausgelöst in Form von Kommentaren zu unseren Artikeln und zu unseren Kommentaren zu den Kommentaren. Es geht bei dieser Debatte zum bedeutenden Teil um die Frage, wie man die Klassennatur von solchen Bewegungen überhaupt einschätzt. Wir haben uns dafür ausgesprochen, dass man sowohl objektive wie auch subjektive Kriterien hierzu anwenden sollte, um zu einer richtigen Einschätzung zu kommen, d.h. man sollte sowohl die Rolle der Akteure in der kapitalistischen Wirtschaft ebenso in Betracht ziehen wie ihren Bewusstseinsstand, ihre angewandten Kampfmethoden, ihre aufgestellten Forderungen. Darüber hinaus argumentierten wir, dass das eventuelle Zustandekommen eines kommunistischen Bewusstseins und einer revolutionären Situation das Vorhandensein und Zusammenkommen von objektiven und subjektiven Faktoren zur Voraussetzung hätte.
Verschiedene Artikel der IKS über die weltweiten Jugendproteste der letzten Zeit haben eine lebhafte Debatte auf unserer Webseite ausgelöst in Form von Kommentaren zu unseren Artikeln und zu unseren Kommentaren zu den Kommentaren. Es geht bei dieser Debatte zum bedeutenden Teil um die Frage, wie man die Klassennatur von solchen Bewegungen überhaupt einschätzt. Wir haben uns dafür ausgesprochen, dass man sowohl objektive wie auch subjektive Kriterien hierzu anwenden sollte, um zu einer richtigen Einschätzung zu kommen, d.h. man sollte sowohl die Rolle der Akteure in der kapitalistischen Wirtschaft ebenso in Betracht ziehen wie ihren Bewusstseinsstand, ihre angewandten Kampfmethoden, ihre aufgestellten Forderungen. Darüber hinaus argumentierten wir, dass das eventuelle Zustandekommen eines kommunistischen Bewusstseins und einer revolutionären Situation das Vorhandensein und Zusammenkommen von objektiven und subjektiven Faktoren zur Voraussetzung hätte.
In seinem Kommentar zu diesem Beitrag vertritt Bruno nun den Standpunkt, dass die objektiven Bedingungen (sprich die Krisen und Katastrophen des Kapitalismus) niemals von alleine eine revolutionäre Situation und ein revolutionäres Bewusstsein schaffen werden. „Die Krise wird es nicht richten und nicht das kollektive Bewusstsein für die richtigen Schlüsse der Arbeiterklasse erzeugen“, so Bruno.
Wir sind damit einverstanden. Es war eine der fatalsten Schwächen der Sozialistischen Internationalen, welche das Versagen dieses Organs gegenüber dem Ersten Weltkrieg ermöglichte, an eine Unvermeidbarkeit des Sozialismus geglaubt zu haben, welcher sich gewissermaßen als Ergebnis der Widersprüchlichkeiten des Kapitalismus wie ein Naturgesetz realisiert. Demgegenüber haben zunächst Friedrich Engels und dann Rosa Luxemburg die Alternative aufgestellt: Sozialismus oder Barbarei. Diese Alternative schließt die Möglichkeit ein, dass die Arbeiterklasse im Kampf um eine klassenlose Gesellschaft letztendlich versagen kann. In diesem Fall hätte sich die zentrale Arbeitshypothese des Marxismus – dass das Proletariat imstande ist, den Kapitalismus zu überwinden – nicht bewahrheitet. Es schließt ebenfalls die Erkenntnis ein, dass nicht alle objektiven Faktoren der Krise des niedergehenden Kapitalismus für die Realisierung des Sozialismus günstig sind. Dazu zählt nicht zuletzt das schiere Ausmaß der Zerstörung (auch der inneren Zerstörung im Menschen selbst), welche das System anrichtet.
Bruno’s Pochen auf der Unabdingbarkeit der subjektiven Faktoren, der Entwicklung des Bewusstseins oder des revolutionären Willens, ist somit mehr als berechtigt. Wir haben dies aber auch nicht bestritten. Uns ging es um die notwendige Einheit zwischen den objektiven und subjektiven Bedingungen. Ohne revolutionäre Organisation, ohne die Entwicklung von Klassenbewusstsein, ohne die „Schule des Kommunismus“ kann es keinen revolutionären Ansturm geben. Aber ohne objektive Erschütterung des Systems, ohne Wirtschaftskrise und andere Katastrophen, ohne Massenverelendung des Proletariats auch nicht. Fehlt auch nur einer dieser Faktoren, so kann es keine Revolution geben.
Bruno scheint mit diesem Gedanke zu hadern. Es will uns scheinen, dass er beide Faktoren nicht als Einheit sieht, sondern sie gegeneinander zu stellen geneigt ist. Er schreibt: „Es stellt sich vielmehr die Frage, benötigt die Menschheit das Drama der Exzesse von Gewalt und Verarmung, um ein Bewusstsein für eine sozialistische und demokratische Gesellschaft zu erlangen.“
Zur Zeit der Sozialistischen Internationalen gab es neben der Idee von der „Unvermeidbarkeit des Sozialismus“ einen anarchistischen Gegenpart. Dessen Idee war, dass die Revolution keine andere Voraussetzung kennt als die subjektive, als die Entwicklung des Bewusstseins, als den Willen und den Entschluss, den Kapitalismus zu stürzen. Folgerichtig glaubte diese Denkrichtung, dass die Revolution jederzeit losbrechen kann, etwa in Form eines Generalstreiks, wenn nur genügend Massen dafür sind. Dies lässt aber die Frage offen, wie es möglich ist, dass die große Masse der Proletarier zu einem revolutionären Bewusstsein gelangt. Allein durch die Propaganda der Revolutionäre? In dieser Sichtweise ist der wissenschaftliche Anspruch des Marxismus, demzufolge der Sozialismus selbst ein Produkt des Kapitalismus und dessen Widersprüche ist, demzufolge das Proletariat nicht eine künftige Gesellschaft aus dem blauen Dunst ausheckt, sondern dass das Proletariat die Hebamme, die Geburtshelferin, der klassenlosen Gesellschaft darstellt, aufgegeben. Der Sozialismus wird wieder zu einer Utopie. Und so drehte sich die Debatte zwischen Sozialdemokraten und Anarchisten und Anarcho-Syndikalisten vor dem Ersten Weltkrieg sinnlos im Kreis. Man warf sich gegenseitig, und zurecht, entweder Fatalismus oder Utopismus vor, anstatt zu erkennen, wie Rosa Luxemburg oder Lenin es taten, dass nur das Zusammenkommen von gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten und revolutionärer Subjektivität der Klasse zur Revolution führt. Mit anderen Worten: Einerseits muss das Proletariat durch wachsende Unsicherheit und wachsendes Elend zu einer Auseinandersetzung mit der Notwendigkeit und Möglichkeit einer klassenlosen Gesellschaft „gezwungen“ werden. Aber diese Revolution siegt nicht zwangsläufig, sondern nur wenn die Klasse die Notwendigkeit der Revolution versteht und bejaht. Das Proletariat wird gezwungen, aber es muss auch können und wollen! Und warum ist das so? Weil wir noch in der „Vorgeschichte der Menschheit“ leben, noch nicht im „Reich der Freiheit“, um Formulierungen von Engels zu gebrauchen. Und dennoch wäre die proletarische Revolution der erste große Schritt in dies Reich der Freiheit. Denn Freiheit bedeutet nicht Willkür, sondern die Fähigkeit, das, was notwendig ist, zu erkennen und es freiwillig und mit Überzeugung zu tun.
Wir haben zumindest den Eindruck, dass Genosse Bruno ziemlich sauer auf die Arbeiterklasse ist, da sie offenbar den Stachel der Verelendung braucht, um für die Interessen der Menschheit zu kämpfen.
„Der Wunsch an dem Konsum und Erwerb ihres eigenen Arbeitsproduktes teilnehmen zu können treibt die Menschen in die Lohnarbeit und der Klassenkampf verbleibt innerhalb der legalistischen Formen juristischer Eigentumstitel, der lediglich der reproduktiven Verteilung des Arbeitsproduktes dient, der Aufrechterhaltung der Konsumfähigkeit der Arbeiterklasse“.
Als Beschreibung des Systems der Lohnsklaverei klingt das sogar ein wenig beschönigend. Statt „Wunsch an dem Konsum und Erwerb ihres Arbeitsproduktes teilnehmen zu können“ könnte man auch schreiben, dass es der Hunger ist, die indirekte, weil ökonomische Gewalt, die radikale und blutige Trennung von den Produktionsmittel, welche die Menschen in die Lohnarbeit treibt. Bruno spricht vom Konsum „ der Lebensmittel, von dem der individuelle Arbeiter versucht möglichst viel abzubekommen. Darin unterscheidet er sich um nichts von anderen Subjekten.“ Das klingt merkwürdig vorwurfsvoll, als ob die Lohnabhängigen sich auch noch ihres „Konsums“ schämen müssten. Warum übrigens unterscheidet sich der Kampf der Proletarier um ihre Lebensmittel, sprich um ihr Überleben, „in nichts“ von der Revenue, vom Protz und Luxus der herrschenden Klasse?
Es gibt Leute, die dem Proletariat sogar moralische Vorwürfe machen, weil sie ihre Arbeitskraft an den Kapitalisten verkaufen, anstatt die Revolution zu machen. Wenn man aber versteht, dass das ein bitterer Zwang ist, dass es immer nur kleine (und immer kleiner werdende) Minderheiten sein werden, welche diesen Zwang austricksen können, um ihrem individuellen „Kampf gegen die Arbeit“ zu fronen, so hat man mehr Verständnis dafür, dass diese Masse der Lohnabhängigen nur wagen kann, offen gegen das System aufzutreten und an eine revolutionäre Alternative zu denken, wenn es die Geborgenheit der Massenkämpfe, der Kampfgemeinschaft erfährt. Und das geht ohne die Stachel des Elends und der Unsicherheit nicht.
Diskussionsveranstaltung der IKS in Peru - Eine internationalistische Debatte
- 3001 reads
Letzten August fand in Lima eine öffentliche Diskussionsveranstaltung der IKS zum Thema "Gegenüber der Krise ist die einzige Alternative der Arbeiterkampf" statt.
Es waren zahlreiche Teilnehmer erschienen. Aber vor allem die Debatte war sehr tiefgehend und dynamisch. Es beteiligten sich dabei zwei internationalistische Gruppen aus Peru: der "Proletarische Kern aus Peru" (Núcleo Proletario de Perú-NPP) und die "'Gruppe proletarischer Kampf" (Grupo de Lucha Proletaria – GLP). Ebenso anwesend war ein Genosse, der von den Internationalistischen Kernen aus Ecuador (Núcleos Internacionalistas de Ecuador) entsandt worden war. Ein Genosse der Oposición Obrera (Arbeiteropposition) Brasiliens wollte am Treffen teilnehmen, aber er war schließlich verhindert.[1] D.h. das Treffen trug einen deutlich internationalistischen Charakter[2].
Nach einer kurzen Einführung, deren Ziel es nicht war, irgendwelche "Lehren zu erteilen"[3] sondern eine Debatte voranzutreiben, gab es mehrere Wortbeiträge zu verschiedenen Themen, die wir kurz zusammenfassen wollen[4].
Es gab Übereinstimmung darin, die verheerende Tragweite der Krise und die furchtbaren Kosten für die Arbeiterklasse und die anderen nicht-ausbeutenden Schichten zu unterstreichen. So meinte ein Genosse der NPP: „Wir stehen vor der größten Krise des Kapitalismus; nie zuvor hat es in früheren Systemen das gegeben, was wir heute im Kapitalismus erleben: Hunger nicht aufgrund eines Mangels an Produkten, sondern wegen überschüssiger Produkte.“
Die Krise entsteht nicht, wie uns immer wieder eingetrichtert wird, aufgrund schlechten Managements oder wegen zu wenig Staatsintervention, sondern weil der Kapitalismus sich auf die Lohnarbeit und die Warenproduktion stützt und unter einer ausweglosen Überproduktion leidet, welche zu immer mehr Barbarei, Zerstörung und Verarmung des Großteils der Bevölkerung führt.
"Die Krise ist wie ein schwarzes Loch, das Leben und 'Illusionen' verschluckt", sagte ein anderer Teilnehmer. Die Krise kann nicht auf makro-ökonomische Zahlen reduziert werden und auch nicht auf Erfolgsrechnungen. Das Hauptmerkmal der Krise sehen wir anhand des Leidens von Millionen von Menschen, die trotz ihrer manchmal übermenschlichen Anstrengungen in einen Strudel der Verarmung, Ausgrenzung und Zerstörung hineingezogen werden. Ein Beispiel zeigt das: In Guatemala gibt es „eine große Hungersnot, unter der mehr als 54.000 arme Familien im Lande leiden, die seit Anfang des Jahres mindestens 462 Menschen das Leben gekostet hat" (El País, 9.9.09).
Sind Internationalismus und Nationalismus vereinbar?
Aber der größte Teil der Diskussion drehte sich nicht um die Krise und ihr Wesen, sondern um die Frage, wie man gegen diese kämpfe könne. Ist das Proletariat die einzige revolutionäre Klasse, die in der Lage ist, einen Ausweg aus der Krise des Kapitalismus zu finden? Mit welchen Mitteln kämpft die Arbeiterklasse? Für welche Gesellschaft kämpft sie?
An dieser Stelle kam eine Prinzipienfrage auf, zu der es in der Diskussion eine wichtige Klärung gab: Kann man gleichzeitig Nationalist und Internationalist sein?
Dies fragte ein Genosse, der eine trotzkistische Orientierung vertrat und sich aktiv an der Diskussion beteiligte. Er meinte einerseits, "das Proletariat ist eine internationale Klasse und es muss mit den Kämpfen solidarisch sein, die auf der Welt entstehen", aber andererseits meinte er auch, dass "Peru an die chilenische Bourgeoisie verkauft werde"; ein anderer Teilnehmer fügte dem hinzu "Peru wird gegenwärtig von ausländischem Kapital überflutet".
In mehreren Wortbeiträgen wurde dem entgegengehalten, dass die Verbündeten des Proletariats in Peru die Proletarier in Chile sind,[5] dass das Proletariat nur die notwendige Kraft zum kämpfen entwickeln kann, wenn es von einer Klassensolidarität ausgehend kämpft, die sich über alle Landesgrenzen, Rassen oder Branchengräben hinwegsetzt. Ein Genosse des NPP warf ein wesentliches Argument ein: "Der Kapitalismus ist ein weltweit operierendes Produktionssystem, das die Arbeit der Proletarier zu einer weltweiten Kollektivität werden lässt".
Nationalismus und Internationalismus sind nicht vereinbar, sie sind wie Wasser und Feuer. Das deutlichste Symbol des Triumphes der Konterrevolution waren in den 1930er Jahren 1936 die Streiks in Frankreich, als man in den besetzten Fabriken gleichzeitig die Trikolore des "ewigen Frankreichs" und rote Fahnen schwenkte und die Arbeiter gleichzeitig die Marseillaise und die Internationale sangen.
Ist es nicht übertrieben, vom Proletariat als einer revolutionären Klasse zu sprechen?
Neben der Klärung der Frage des Internationalismus drehte sich die Diskussion um die Frage des revolutionären Wesens des Proletariats.
Ein Genosse anarchistischer Ausrichtung meinte, dass "wir nicht in eine Fetischisierung des Proletariats verfallen sollten, zudem dieses zahlenmäßig geschrumpft und großen Änderungen unterworfen sei, die sein Bewusstsein zurückentwickelt oder gar bewirkt haben, dass es kein Klassenbewusstsein habe".
Es stimmt, dass im Verlaufe von drei Jahrhunderten seit der Entstehung des Proletariats dieses in seiner soziologischen Zusammensetzung große Änderungen durchlaufen hat; auch hat sich die Form der Arbeit, der Konzentrationsgrad, die technische und kulturelle Bildung usw. desselben gewandelt. Mitte des 19. Jahrhunderts war ein herausragendes Merkmal noch Heimarbeit, während Ende des 19. Jahrhunderts und am Anfang des 20. Jahrhunderts die hoch technisierte Arbeit vorherrschte. In den 1970er Jahren waren viele Arbeiter in Großfabriken tätig; dagegen herrscht heute eine weltweit assoziierte Arbeit vor, so dass man gegenwärtig bei keinem Produkt sagen kann, dass es ausschließlich von den Arbeitern dieses oder jenes Landes oder Werkes produziert wurde. Wesentlich ist die weltweite Arbeitsteilung in der Produktion, wodurch die objektiven Grundlagen für die internationale Einheit des Proletariats gelegt werden.
Die Genossen des NPP betonten, dass diese Umwälzungen jedoch nichts am Wesen der Arbeiterklasse geändert haben. "Die Arbeiterklasse ist die Mehrwert produzierende Klasse, die ausgebeutete Klasse", aber andere fügten ein weiteres Argument hinzu: "Wer kann eine andere Gesellschaft herbeiführen? Nur die Arbeiterklasse, weil sie die produzierende Klasse ist, aber auch vor allem weil sie eine Klasse mit Geschichte ist." Das Proletariat ist der kollektive Produzent des Großteils der Reichtümer der Welt. Aber es ist nicht nur die Hauptproduzentin der Gesellschaft, es ist auch eine Klasse, die ein kollektives Bewusstsein entwickeln kann über mehrere Generationen hinweg. Ihr Kampf stützt sich auf eine historische Kontinuität, welche ihr über mehrere Generationen hinweg ermöglicht, Lehren aus ihren Kämpfen zu ziehen, aus ihren Fehlern zu lernen, klarer und deutlicher ihre Prinzipien und Ziele zu formulieren. In dieser Hinsicht unterscheidet sie sich von den früheren ausgebeuteten Klassen – den Sklaven und den Leibeigenen- die ebenfalls produzierende Klassen waren, aber deren Kampf keine Kontinuität und keine Zukunft hatte. Die Arbeiterklasse ist die erste ausgebeutete Klasse der Geschichte, die gleichzeitig revolutionär ist.
Die Kampfmittel des Proletariats
Die jetzige Lage des Proletariats ermöglicht aber keine empirische und unmittelbare Überprüfung dieser Wirklichkeit. Die gegenwärtigen Kämpfe weisen wichtige Merkmale der Suche nach Solidarität und der Bewusstwerdung auf, aber sie erreichen noch keine massiven und größeren Ausmaße, die den Arbeitern die soziale und geschichtliche Kraft vor Augen führt und der Bevölkerung verdeutlicht, dass das Proletariat die einzige Klasse mit einer eigenen Perspektive ist.
Dies ruft Zweifel hervor an der Fähigkeit des Proletariats, an seinen Kampfmitteln; diese kamen in der Diskussion offen zur Sprache.
Ein Teilnehmer wandte ein: "Wenn die Arbeiter 12 bis 14 täglich arbeiten, welche Zeit verbleibt ihnen dann zu diskutieren und sich zu mobilisieren?" In der Tat, wenn man sich die Arbeiter vor Augen führt, wie sie eingeschüchtert werden durch die Krise und immer noch sehr atomisiert sind, ist es schwierig sich vorzustellen, dass sie in der Lage sein sollen, massiv und gemeinsam wie eine eigenständige Klasse mit einer eigenen Alternative zu handeln. Aber Rosa Luxemburg zeigte anhand der russischen Revolution von 1905 auf, dass sich unter den allgemeinen Bedingungen des Massenstreiks "der vorsichtige Familienvater, der sich um seine Kinder kümmert, zu einem romantischen Revolutionär" wird.
In der Diskussion wurden die Wege zu dieser psychologischen Umwälzung besprochen, die heute als ein Wunder erscheinen mag. Ein Mittel ist die wachsende Einheit zwischen Forderungskampf und revolutionärem Kampf. Aber diese Frage konnte in der Diskussion selbst nicht weiter vertieft werden. Aus unserer Sicht gibt es keinen Gegensatz zwischen beiden Dimensionen des proletarischen Kampfes: der Forderungskampf gegen die Ausbeutung und der revolutionäre Kampf zur Abschaffung der Ausbeutung[6].
Wie ein Genosse des NPP hervorhob: "Der Klassenkampf ist kein Kampf von Minderheiten, sondern ein Massenkampf", und diesem entspricht die Notwendigkeit, dass das Proletariat sich eine massive und allgemeine Organisation schafft, die dazu in der Lage ist, seine Kraft zu bündeln und als Ort der Debatte und Entscheidungen dient. In der Diskussion wurde betont, dass diese Organisation in der Geschichte seit den Erfahrungen von 1905 und 1917 in Russland die Arbeiterräte sind. Eine Genossin der GLP meinte, diese seien "eine Einheitsorganisation, an der sich alle beteiligen können".
An dieser Stelle fragte ein Genosse anarchistischer Orientierung: "Propagiert ihr hinsichtlich der Arbeiterräte das russische Modell?" Aus der Diskussion ging hervor, dass man die Arbeiterräte von 1905 und 1917 nicht als unfehlbare Modelle ansehen darf, wie eine Art Rezept, das in allen zukünftigen Kämpfen benutzt werden könnte. Die Arbeiterräte von 1917-23 in Russland und in anderen Ländern Europas und Amerika sind eine wertvolle Erfahrung, die kritisch untersucht werden muss, damit man klar ihre Schwächen und Unzulänglichkeiten erkennen und Schlussfolgerungen formulieren kann, die für die zukünftigen Kämpfe des Proletariats wesentlich sind.
Auf die Frage des gleichen Genossen, ob "wir Anhänger des leninistischen Parteimodells sind", antworteten wir – wie auch andere Teilnehmer der Diskussion – im gleichen Sinne: Wir wollen keine Modelle nachahmen, wir können uns auf Erfahrungen stützen, die uns Lehren für die gegenwärtige historische Epoche anbieten. Der Bolschewismus hat uns einen unnachgiebigen Internationalismus überliefert, der ihn an die Spitze des Kampfes gegen den Krieg treten ließ. Sie verstanden die Rolle der Arbeiterräte als "diese Form ist das Sowjetsystem mit der Diktatur des Proletariats”, was sich in der klaren Losung “Alle Macht den Räten” niederschlug. Aber sie vertraten auch falsche Auffassungen, die übrigens auch von anderen proletarischen Strömungen der damaligen Zeit vertreten wurden, wie die, dass die Partei die Macht im Namen der Klasse ausübt, was sicherlich zur Niederlage und zum Niedergang der Revolution mit beitrug[7].
Der Kommunismus und die revolutionäre Perspektive
Wie eine Genossin meinte: "Was ist das Ziel einer Organisation des Proletariats? Ich glaube dies kann nur eins sein: der Kommunismus." Das Treffen debattierte weiter über das historische Ziel des Arbeiterkampfes und dies geschah als eine Antwort auf die konkrete Überlegung, die ein Genosse anarchistischer Orientierung aufgeworfen hatte: "Als die UdSSR existierte, gab es noch ein Modell. Genau so gab es das Modell des Guerilla-Kampfes, bei dem 'freie Zonen' geschaffen wurden. Aber mittlerweile haben alle Modelle Schiffbruch erlitten. Ein neues Modell wäre die Selbstverwaltung, sie würde tatsächlich Zonen – Stadtteile, Betriebe - schaffen, die von den Ausgebeuteten befreit wären."
In der Diskussion wurde unterstrichen, dass die UdSSR kein Modell war, sondern eine der Erscheinungsformen des Staatskapitalismus war. Genauso wenig war die Guerilla ein Modell, weil es sich um blutige Zusammenstöße zwischen Flügeln der Herrschenden handelt, die Arbeiter und Bauern als Geiseln nehmen.
Aber wenn man weiter schaut, "kann das Ziel des Proletariats ein Modell einer neuen Gesellschaft sein?" Mehrere Wortbeiträge betonten, dass es gerade ein Fehler sei, ein "Modell" zu suchen, weil dies dann nur eine sektiererische und doktrinäre Vorgabe für den Rest der Arbeiterklasse sein würde. Die Russische Revolution und die ganze weltweite Welle revolutionärer Kämpfe im Anschluss daran (1917-23) waren keineswegs ein "Gesellschaftsexperiment im Labor", sondern die Antwort des Proletariats auf die furchtbare Entwicklung der Barbarei und der Zerstörung, welcher der Erste Weltkrieg mit sich brachte. All dies wurde durch den Eintritt des Kapitalismus in seine Niedergangsphase verursacht, d.h. den Zeitraum, in dem dieser zu einer Fessel für die gesellschaftliche Entwicklung wird, und nachdem er zunächst eine fortschrittliche Rolle gespielt hat, schlug er in sein dialektisches Gegenteil um: er wurde zu einer zerstörerischen, barbarischen Kraft, die eine Bedrohung für das Überleben der Menschheit darstellt[8].
Der Kommunismus ist kein Idealzustand. Der Kommunismus bedeutet die Überwindung und Lösung der Widersprüche, die unter dem Kapitalismus die Menschheit ins Verderben und Zerstörung treiben. So ist die Überproduktion, die unter dem Kapitalismus zu Hunger und Arbeitslosigkeit führt, im Kommunismus die Grundlage für die volle Befriedigung der Bedürfnisse der Menschheit. Der gesellschaftliche und weltweite Charakter der Produktion, der im Kapitalismus die Konkurrenz anspornt und Kriege zwischen Nationen auslöst, ist im Kommunismus die Grundlage für die brüderliche Zusammenarbeit aller Arbeiter, für die Organisierung einer weltweiten Menschengemeinschaft.
In der Diskussion wurde ebenso hervorgehoben, dass der Kommunismus nur weltweit bestehen kann oder gar nicht. Deshalb wurde in mehreren Redebeiträgen das stalinistische Modell des "Sozialismus in einem Land" oder das Guerilla-Modell der "befreiten Zonen" verworfen. Aber in der Diskussion wurde ebenso betont, dass die Selbstverwaltung kein Mittel ist, den nationalistischen Rahmen zu überwinden. Weder der "Sozialismus in einer einzigen Fabrik" noch der "Sozialismus in einem Stadtteil" sind eine Alternative für den „Sozialismus in einem Land“ des Stalinismus[9].
Die Perspektive neuer Debatten
Eine Genossin kommentierte, « die Debatte ist sehr gut. Sie dient dazu, dass jeder versteht, was der andere sagt, denn jeder spricht seinen eigenen Jargon. „ Wir glauben, dass die intensive Debatte in der öffentlichen Diskussionsveranstaltung dazu diente, sich besser zu verstehen, die Anliegen der Teilnehmer besser in der Tiefe zu begreifen und darauf einzugehen, die Besonderheiten zu überwinden, die uns abgrenzen: die Jargons, das gegenseitige Misstrauen, das mangelnde gegenseitige Verstehen…
Eine Genossin der NPP trat für eine Orientierung ein, die wir teilen: „Unsere Hauptaufgabe ist die Entfaltung einer Debatte, Studienkreise zu schaffen, Fragen zu vertiefen. Das ist unsere kurzfristige Funktion. Dies sind Mittel für die revolutionäre Umwälzung. Der revolutionäre Wechsel kann nicht aufgezwungen werden; er muss aus den Bedingungen für denselben hervorgehen“.
Wir meinen, neue öffentliche Veranstaltungen sind erforderlich, in denen neue Themen aufgegriffen werden, welche die verschiedenen Diskussionsstränge vertiefen, die in der letzten Diskussion offen geblieben sind. Die Debatte in Peru ist ein Teil einer Tendenz zur internationalen Debatte, welche sich mehr entfaltet, und die durch das jüngste lateinamerikanische Treffen internationalistischer Kommunisten einen Impuls erhalten und eine Ausrichtung erhalten hat. So sind die Diskussionsveranstaltung in Peru und die neuen Diskussionen, welche in Gang kommen können, ein Teil dieses internationalen Mediums und stellen einen aktiven Beitrag zu demselben dar. Wie wir in der Berichterstattung über die erste öffentliche Diskussionsveranstaltung in Peru 2007 schrieben: „Für den Aufbau eines Milieus einzutreten, bei dem die proletarische Debatte im Mittelpunkt des politischen Lebens steht, ist eine Perspektive in Peru wie auf der ganzen Welt, welche die zukünftige Weltrevolution vorbereiten wird.“[10] IKS 10.09.09
(aus der Presse der IKS in Spanien).
[1]Es gab mehrere Treffen mit beiden Gruppen, an denen sich der Genosse aus Ecuador beteiligte, wo ebenfalls wichtige Diskussionen zu den Themen Arbeiterräte, das Proletariat, die Weltpartei, die Übergangsperiode zwischen Kapitalismus und Kommunismus stattfanden. Auf diesen Treffen wurde der Brief der Genossen von Oposición Obrera aus Brasilien vorgelesen (siehe unsere spanische Webseite).
[2]Vorher haben wir schon 2007 und 2008 öffentliche Diskussionsveranstaltungen in Peru durchgeführt. Siehe “Hin zum Aufbau eines Umfeldes der Debatte und der Klärung” (https://es.internationalism.org/node/2107 [238]) und „Öffentliche Diskussionsveranstaltung in Peru „Eine leidenschaftliche Debatte zur Krise“(https://es.internationalism.org/node/2385 [239])
[3]Siehe den Anhang auf unserer spanischen Webseite.
[4]Wir haben versucht, die Wortmeldungen der Teilnehmer/Innen so gut wie möglich wiederzugeben, aber wenn jemand meint, wir hätten ihre Beiträge unrichtig zitiert oder interpretiert, bitten wir euch um eventuelle Korrektur.
[5]1879 brach der Pazifische Krieg aus, bei dem Peru von seinem chilenischen Rivalen besiegt wurde, dessen Militär sogar bis nach Lima vordrang. Seither warnt der peruanische Nationalismus immer vor der „chilenischen Invasion“. Gewerkschaften und Linksparteien sind noch stärker antichilenisch als die Rechten. Gegenüber dieser nationalistischen Phobie muss das Proletariat in Erinnerung rufen, dass in Iquique 1907 chilenische, peruanische und bolivianische Arbeiter gemeinsam aus gegenseitiger Solidarität in einen Streik traten, der von dem chilenischen Staat mit Unterstützung seiner Rivalen in Peru und Bolivien niedergemetzelt wurde.
[6]Um genau zu sein: der Forderungskampf hat nichts mit dem gewerkschaftlichen Kampf zu tun, die nur einen verzerrten Kampf führen, und die ökonomischen Forderungen der Arbeiter den Bedürfnissen des Kapitals unterwerfen.
[7]Zu unserer Position zur Partei und ihre Beziehungen zur Klasse siehe es.internationalism.org/revista-internacional/200604/892/el-partido-y-sus-lazos-con-la-clase [240] und „Die entstellte Partei – die bordigistische Partei“ in es.internationalism.org/node/2132 [241]. Zum Bolschewismus siehe: „Sind wir zu Leninisten geworden? [242]“.
[8]Wie sonst könnte man die dramatische Entwicklung bezeichnen, die durch die Krise, die Kriege – wie den Afghanistan-Krieg oder die gewaltige Aufrüstung, an der sich die meisten südamerikanischen Staaten beteiligen -, und die gigantische Umweltzerstörung, von der die Zerstörung des Urwaldes am Amazonas nur ein Ausdruck ist, bezeichnen?
[9]Es gab keine Zeit, um die tragische Erfahrung in Spanien 1936 und die wahre Bedeutung der selbstverwalteten Kollektive, auf die sich die Anarchisten berufen, zu diskutieren.
[10]siehe unsere Webseite https://es.internationalism.org/node/2556 [243]
Aktuelles und Laufendes:
Historische Ereignisse:
- Krieg Peru Chile [247]
Oktober 2009
- 860 reads
Der Sozialdarwinismus – eine reaktionäre Ideologie des Kapitalismus
- 8211 reads
Die Faktoren, welche der menschlichen Gattung den Aufstieg zur Zivilisation ermöglicht haben, gehören zu den wichtigsten Themen, die jahrhundertelang Philosophen und andere Denker beschäftigt haben. Es geht um nichts weniger als um die Entdeckung des Motors der Geschichte. 1848 bot das Kommunistische Manifest eine revolutionäre Auffassung zu dieser Frage an, die den Menschen und seine Tätigkeiten auf gesellschaftlicher Ebene in den Mittelpunkt des menschlichen Fortschritts stellte. Diese Auffassung stimmte natürlich nicht mit den Ideen der neuen herrschenden Klasse, der Bourgeoisie, überein, die sehr enthusiastisch war wegen der damals aufsteigenden Entwicklung des kapitalistischen Systems. Dieser Aufstieg war zum einen begleitet von einer Ideologie des Individualismus, zum anderen war es für die herrschende Klasse noch zu früh, auch nur im geringsten die Möglichkeit zu erwägen, dass die kapitalistische Gesellschaft überwunden werden könnte.
Die Faktoren, welche der menschlichen Gattung den Aufstieg zur Zivilisation ermöglicht haben, gehören zu den wichtigsten Themen, die jahrhundertelang Philosophen und andere Denker beschäftigt haben. Es geht um nichts weniger als um die Entdeckung des Motors der Geschichte. 1848 bot das Kommunistische Manifest eine revolutionäre Auffassung zu dieser Frage an, die den Menschen und seine Tätigkeiten auf gesellschaftlicher Ebene in den Mittelpunkt des menschlichen Fortschritts stellte. Diese Auffassung stimmte natürlich nicht mit den Ideen der neuen herrschenden Klasse, der Bourgeoisie, überein, die sehr enthusiastisch war wegen der damals aufsteigenden Entwicklung des kapitalistischen Systems. Dieser Aufstieg war zum einen begleitet von einer Ideologie des Individualismus, zum anderen war es für die herrschende Klasse noch zu früh, auch nur im geringsten die Möglichkeit zu erwägen, dass die kapitalistische Gesellschaft überwunden werden könnte.
Als 11 Jahre später Charles Darwin das Ergebnis seiner Untersuchungen über die Entwicklung der Organismen als Ergebnis der natürlichen Zuchtwahl veröffentlichte, konnte die herrschende Klasse nicht umhin, einen Erklärungsansatz für die Entwicklung menschlicher Gesellschaften vorzuschlagen, der sich ausschließlich auf den Mechanismen der Selektion der am besten angepassten Individuen stützte. Diese Tendenz, die unter dem Sammelbegriff 'Sozialdarwinismus' zusammengefasst werden kann, ist heute noch weit verbreitet, auch wenn ihre Hypothesen noch unter Beweis gestellt werden müssen und dern Ausgangspunkt, der Wettbewerb ums Überleben, von Darwin hinsichtlich der menschlichen Entwicklung selbst sehr schnell verworfen wurde[1].
Definition des 'Sozialdarwinismus'
"Der Sozialdarwinismus ist eine Art Soziologie, deren Postulate folgende sind:
a) Dass die Gesetze der menschlichen Gesellschaft direkt oder fast direkt die Gesetze der Natur sind, da der Mensch ein Teil der Natur ist.
b) Dass die Gesetze der Natur das Überleben des Fähigsten sind, der Kampf ums Überleben und die Vererbungsgesetze.
c) Dass es für das Wohlergehen der Menschheit notwendig ist, auf die richtige Anwendung dieser Gesetze in der Gesellschaft zu achten.
"Man unterscheidet zwei Formen des Sozialdarwinismus. Eine, individualistischer Inspiration, geht davon aus, dass die gesellschaftliche Basiszelle das Individuum ist, und ausgehend von einem Kampf zwischen Individuen der gleichen Gattung die grundlegenden Gesetze der Kampf zwischen Individuen einer gleichen Gruppe sind, und wo der Kampf zwischen ethnischen Gruppen (oder Rassen) nur die Ausdehnung desselben ist. Die andere, ganzheitlicher Inspiration, geht dagegen davon aus, dass die gesellschaftliche Basiszelle die Gesellschaft und der Motor der Geschichte der Kampf zwischen den Rassen ist, und der Kampf zwischen Individuen einer gleichen Gruppe ein zweitrangiges Gesetz darstellt, d.h. gar eine Beeinträchtigung bedeutet für das Überleben der Rasse. (…)
"Der Sozialdarwinismus entfaltete sich seit den 1850er Jahren (d.h. schon vor der Veröffentlichung des Buches von Darwin "Die Entstehung der Arten") und war eine wichtige Ideologie bis in die 1880er Jahre (…) Er ging meistens einher mit der Ideologie des ökonomischen laissez-fair und befürwortete das Nicht-Eingreifen des Staates (…). Der ganzheitliche Sozialdarwinismus, oft offen rassistisch, blühte vor allem nach 1880 auf. Meistens trat er für ein Eingreifen des Staates in der Gesellschaft und protektionistische Maßnahmen ein (ökonomische Schutzmaßnahmen, aber auch Schutzmaßnahmen für die Rasse (…). Die Rassenreinheit ist in Gefahr"[2].
Der am meisten bekannte Vertreter dieser Ideologie war ein englischer Zeitgenosse Darwins, Herbert Spencer. Als Ingenieur, Philosoph und Soziologe erblickte er in der "Entstehung der Arten" den Schlüssel für das Begreifen der Entwicklung der Zivilisation und damit des Postulats, dass die menschliche Gesellschaft sich nach den gleichen Prinzipien entfaltet habe wie lebendige Organismen. Davon ausgehend sei der Mechanismus der natürlichen Zuchtauswahl, wie er von Darwin beschrieben wurde, auch ganz auf die Gesellschaft übertragbar. Spencer war ein bürgerlicher Ideologe, welcher die damalige Epoche gut widerspiegelte. Er war stark geprägt vom damals vorherrschenden Individualismus und Optimismus der herrschenden Klasse, als der Kapitalismus sich noch in voller Entfaltung befand. Von den damals in Mode befindlichen Theorien, wie zum Beispiel dem Utilitarismus Benthams, ließ er sich stark beeinflussen. Plechanow meinte von ihm, er sei ein "konservativer Anarchist, ein bürgerlicher Philosoph"[3]. Aus Spencers Sicht bringt die Gesellschaft brillante Menschen hervor und formt diese, welche dann ausgewählt werden, um dieser Gesellschaft weitere Fortschritte zu ermöglichen. Durch Berufung auf die Theorie Darwins wurde die Auffassung Spencers zu einer "Auswahl der Fähigsten", die man auf die Gesellschaft anwandte.
Der Sozialdarwinismus, wie er später von seinem Verfechter Spencer genannt wurde, beansprucht im Prinzip die Überlegenheit der Vererbung über Erziehung, d.h. die Vorherrschaft der angeborenen über die erworbenen Eigenschaften. Falls die Prinzipien der natürlichen Zuchtauswahl in der Gesellschaft wirken, kommt es darauf an, ihnen keine Fesseln anzulegen, um den gesellschaftlichen Fortschritt und die langfristige Auflösung des "Unnormalen" wie Armut und der verschiedenen Fähigkeiten sicherzustellen.
Später wurde der Sozialdarwinismus als Grundlage vieler politischer Positionen und Rechtfertigung übernommen, die von den Bedürfnissen der kapitalistischen Entwicklung diktiert wurden.
Heute noch dient die Theorie Herbert Spencers als pseudo-wissenschaftliche Rechtfertigung für die reaktionäre Ideologie des Gewinners und des Gesetz des Stärkeren.
Fortdauernder ideologischer Einfluss und Konsequenzen
Aus rein wissenschaftlicher Sicht trieben die Auffassungen Spences zu den unterschiedlichsten Untersuchungen an wie Kraniologie (Untersuchung der Form und Größe des menschlichen Schädels, dessen Ergebnisse zurechtgebogen wurden), Versuche der Messung menschlicher Intelligenz oder der kriminellen Anthropologie mit der Theorie des "zum Verbrecherdasein Geborenen" von Lambroso, dessen Auffassungen heute noch unter bestimmten bürgerlichen politischen Kreisen verbreitet sind, wenn man den zukünftigen Kriminellen so früh wie möglich aufspüren will.
Das Übergewicht des Angeborenen bewog Spencer auch den Rahmen einer Erziehungspolitik aufzuzeigen, dessen Folgen noch heute in den britischen Grundschulen zu sehen sind, wo man versucht, dem Kind eine für seine persönliche Entfaltung, seine eigenen Forschungen und Entdeckungen günstige Umgebung zu bieten anstatt ihm Lernmethoden anzubieten, welche die Entwicklung neuer Fähigkeiten ermöglichen würden. Dies ist ebenso die theoretische Grundlage des Konzeptes "Chancengleichheit".
Aber der bekannteste Ableger des Sozialdarwinismus ist vor allem die Eugenik. Francis Galtan, ein Vetter Charles Darwins, vertrat als erster eugenistische Auffassungen, wobei er sich auf die unterschwellige Intuition Spencers stützte, derzufolge die natürliche Zuchtwahl automatisch zu gesellschaftlichem Fortschritt führt, und alles, was diesen behindert, kann nur den Zugang der Menschen zum Glück verzögern. Vereinfacht gesagt befürchtete Galton, dass die Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Ordnung, von denen viele unter dem Druck des Klassenkampfes ergriffen wurden, langfristig einen globalen Niedergang der Zivilisation auslösen.
Während Spencer eher ein Anhänger des "laisser-faire", des nicht-Eingreifens des Staates war (eines seiner Werke, das 1850 erschien, lautete "Das Recht, den Staat zu ignorieren), befürwortete Galton dagegen aktive Maßnahmen, um den Fortschritt der natürlichen Zuchtwahl zu begünstigen. So lieferte er lange und mehr oder weniger direkt Rechtfertigungen für die Sterilisierungspolitik von Geisteskranken, die Praxis der Todesstrafen für Kriminelle usw. Die Eugenik wird immer als eine zentrale wissenschaftliche Rechtfertigung für die faschistischen und Naziideologien gesehen, auch wenn schon bei Spencer Elemente vorhanden sind, die zur Rechtfertigung der rassistischen Auffassungen vorhanden waren, die zu einer Hierarchiesierung der Rassen führten. Schon im 19. Jahrhundert wurden die Auffassungen Spencers als Rechtfertigung für die biologischen Grundlagen des technologischen und kulturellen Hinterherhinkens der Bevölkerung der sog. "Wilden" benutzt. Damit wurde die Kolonialpolitik 'wissenschaftlich' begründet, indem man ihr eine moralische Charakterisierung der Zivilisation zuschrieb.
Aber die Eugenik ermöglichte einen zusätzlichen Schritt zu vollziehen, als man die massenhafte Auslöschung von Individuen anstrebte, die als unfähig und als mögliche Bremser für den gesellschaftlichen Fortschritt angesehen wurden. Alexis Carrel ging sogar 1935 so weit, dass sie bis ins Detail die Schaffung von Einrichtungen vorschlugen, in denen generalisierte Euthanasie betrieben werden sollte.
Aber man darf den Sozialdarwinismus nicht nur unter dem theoretischen und wissenschaftlichen Blickwinkel sehen. Dieses Konzept muss in seinem historischen Kontext gesehen werden, mit dem er einhergeht und zu dessen Rechtfertigung er dient. Dieser historische Kontext muss jeweils eingeordnet werden. Der Einfluss des historischen Kontextes ist wesentlich, wenn man begreifen will, wie sich diese Strömung entwickeln konnte. Auch wenn die von ihm angebotenen Antworten im Wesentlichen falsch sind, sind die Fragen, die vom Sozialdarwinismus aufgeworfen worden, immer noch zentral für das Begreifen des Wesens des Menschen für die eigene gesellschaftliche Entwicklung.
Die wissenschaftliche Theoretisierung des aufsteigenden Kapitalismus
Als Darwin "Die Entstehung der Arten" veröffentlichte, befand sich England inmitten des viktorianischen Zeitalters. Die europäische Bourgeoisie hatte die Macht übernommen und war bereit die Welt zu erobern. In der Gesellschaft wimmelte es von Beispielen von "self-made men"; von Menschen, die mit nichts angefangen hatten, die vom kapitalistischen industriellen Aufschwung getragen wurden und an die Spitze blühender Unternehmen gelangen konnten. Damals war die herrschende Klasse von radikalen Strömungen geprägt, die die vererbten Privilegien infrage stellten, welche zu Fesseln der neuen Entwicklungsmöglichkeiten des Kapitalismus geworden waren. Spencer hatte mit diesem "Dissidenten"-Milieu Kontakt, das sehr stark anti-sozialistisch eingestellt war[4]. Die große Armut der Arbeiterklasse in England bezeichnete er als ein provisorisches Stigma einer sich wandelnden, anpassenden Gesellschaft, die unter dem Bevölkerungsdruck sich neu organisieren muss, der als ein Faktor des Fortschritts angesehen werden kann. Aus seiner Sicht war der Fortschritt unvermeidbar, weil die Menschen sich an die Entwicklung der Gesellschaft anpassen, solange man sie frei handeln lässt.
Diese Euphorie wurde damals von der gesamten Gesellschaft geteilt. Hinzu kam ein starkes Zugehörigkeitsgefühl zu einer Nation, die im Aufbau begriffen war und durch Kriege gestärkt wurde, wie der zwischen Preußen und Frankreich. Die Entwicklung des Klassenkampfes, die mit der Entfaltung des Kapitalismus einherging, trieb die herrschende Klasse dazu, eine andere Auffassung der gesellschaftlichen Solidarität zu vertreten, die sich auf Gegebenheiten stützte, die sie für unantastbar hielt. Das war der Boden für die Theoretisierung des kapitalistischen Aufstiegs und seiner unmittelbaren Wirkungen: die Proletarisierung im Schweiß, die vor Blut triefende Kolonialisierung, die schmutzige Konkurrenz.
Dies ist ein wesentliches Merkmal des Sozialdarwinismus, denn aus wissenschaftlicher Sicht liefert er keine richtige Antwort auf die grundsätzlichen Fragen, mit denen er sich auseinandersetzte.
Eine ideologische Rechtfertigung ohne wissenschaftliche Grundlagen
Der Wissenschaft ist es – auch trotz größter Anstrengungen – nie gelungen, die grundlegenden Hypothesen des "Sozialdarwinismus" zu belegen. Schon der Name dieser Geistesströmung ist falsch. Darwin ist nicht der Vater der Eugenik, genauso wenig wie er der Ziehvater des ökonomischen Liberalismus, der kolonialen Expansion und des 'wissenschaftlichen' Rassismus war. Darwin war auch kein Malthusianer. Im Gegenteil, er war einer der ersten, der den Theorien Spencers und Galtons widersprach.
Nachdem er seine Auffassung von der Entwicklung der Lebewesen in "Die Entstehung der Arten" dargelegt hatte, befasste sich Darwin 12 Jahre später mit den Mechanismen seiner eigenen Gattung, der Mensch. Durch die Veröffentlichung der "Abstammung des Menschen" im Jahre 1871 stellte er sich gleichzeitig gegen das Gedankengut des Sozialdarwinismus. Aus Darwins Sicht ist der Mensch das Ergebnis der Evolution und somit ein Teil des natürlichen Selektionsprozesses. Aber bei den Menschen bedeutete der Überlebenskampf nicht die Auslöschung der Schwachen[5].
Das Evolutionsprinzip ermöglicht es dem Menschen, sich von den Mechanismen der natürlichen Zuchtwahl zu befreien, indem er über den Überlebenskampf all das stellt, was den Prozess der Zivilisation fördert, d.h. die moralischen Qualitäten, Bildung, Kultur, Religion…, welcher Darwin die "Sozialinstinkte" nennt. Damit stellt er die Auffassung Spencers von der Vorherrschaft des Angeborenen über das Erworbene, der Natur über die Kultur infrage. Auf gesellschaftlicher Ebene, in der Zivilisation wirkt die natürliche Zuchtwahl nicht mehr auf der Ebene der Organismen. Sie wird im Gegenteil zu einer Auswahl des gesellschaftlichen Verhaltens getrieben, bei der man sich den Gesetzen der natürlichen Zuchtwahl entgegenstellt. Dies wurde von Patrick Tort mit seiner Theorie des "Umkehreffektes der Evolution" bewiesen[6].
Während der Sozialdarwinismus in der Entwicklung der menschlichen Gesellschaften nur das Ergebnis der Selektion der fähigsten Individuen sieht, begriff Darwin dies im Gegenteil als die wachsende Reproduktion der Sozialinstinkte wie Selbstlosigkeit, Solidarität, Sympathie usw. Der Sozialdarwinismus stellte den Kapitalismus als den besten Rahmen für den "gesellschaftlichen Fortschritt" dar, während Darwin mit Nachdruck bewies, dass die ökonomischen Gesetze des Kapitalismus, die sich auf Konkurrenz stützen, die Menschen daran hindern, seine Sozialinstinkte voll zu entfalten. Indem diese letzte historische Fessel überwunden, der Kapitalismus abgeschafft wird, kann die Menschheit eine Gesellschaft errichten, in der diese Sozialinstinkte sich voll entfalten und die ganze menschliche Zivilisation aufblühen lassen. GD
[1]Dieser Artikel stützt sich auf Zitate und Hinweise auf mehrere Artikel und Texte, die nicht systematisch im Einzelnen dargestellt werden. Unter anderem wurden folgende Quellen verwendet:
- Wikipedia (insbesondere die Artikel zu Sozialdarwinismus, Herbert Spencer und Francis Galton).
– Dictionnaire de sociologie, le Robert, Seuil, 1999 (Wörterbuch der Soziologie)
– Brian Holmes, Herbert Spencer, “Perspectives”, vol. XXIV, n° ¾, 1994.
– Patrick Tort, Darwin et le darwinisme, Que sais-je?, PUF.
– Pierre-Henri Gouyon, Jacques Arnould, Jean-Pierre Henry, les Avatars du gène, la théorie néo-darwinienne de l’évolution, Belin, 1997.
[2]Dictionnaire du darwinisme et de l’évolution, PUF, pages 1008-1009.
[3]Dans “Anarchisme et socialisme”.
[4]“Ich hasse sowohl den Krieg als auch den Sozialismus in all seinen Formen", zitiert von Duncan, “The Life and letters of Herbert Spencer”, 1908.
[5]Charles Darwin, Die Abstammung des Menschen 1871.
[6]Siehe unseren Artikel unseren Artikel zum letzten Buch Patrick Torts ": Der Darwineffekt (Webseite der IKS, iksonline und Weltrevolution Nr. 153, 2009).
Die Welt am Rande einer Umweltkatastrophe (II) – Wer ist verantwortlich?
- 4179 reads
Im ersten Artikel dieser Serie zur Umweltfrage, der auf unserer Webseite und in der Internationalen Revue Nr. 41 veröffentlicht wurde, haben wir eine Bestandsaufnahme gemacht und versucht, das Wesen der Gefahr herauszuarbeiten, vor der die ganze Menschheit steht. Zu den bedrohlichsten Erscheinungen auf dem ganzen Erdball gehören:
- Die Zunahme des Treibhauseffektes
- Die enorme Müllproduktion und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für dessen Entsorgung
- Die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen und die Tatsache, dass diese von Umweltverschmutzung bedroht sind.
Wir setzen die Artikelserie mit diesem zweiten Artikel fort. Wir wollen aufzeigen, dass die Umweltprobleme nicht die Schuld irgendeiner Einzelperson oder bestimmter Unternehmen sind, die Umweltschutzgesetze nicht respektieren würden – obgleich man natürlich auch von der Verantwortung Einzelner oder einzelner Betriebe sprechen muss –, sondern dass der Kapitalismus mit seinen Gesetzen der Profitmaximierung der wahre Verantwortliche ist.
Anhand einer Reihe von Beispielen wollen wir versuchen aufzuzeigen, auf welcher Ebene die spezifischen Mechanismen des Kapitalismus die ausschlaggebenden Probleme der Umweltverschmutzung hervorrufen, unabhängig vom Willen irgendeines Kapitalisten. Die weit verbreitete Auffassung, der zufolge der heute erreichte wissenschaftliche Fortschritt uns immer besser vor Naturkatastrophen schützen und entscheidend dazu beitragen könnte, Umweltprobleme zu vermeiden, werden wir verwerfen. Anhand einiger Zitate von Amadeo Bordiga werden wir aufzeigen, dass die moderne kapitalistische Technologie keinesfalls gleichzusetzen ist mit Sicherheit, und dass die Entwicklung der Wissenschaft und der Forschung nicht von der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse geleitet wird, sondern den kapitalistischen Erfordernissen der Realisierung des größtmöglichen Profits unterworfen ist. Diese unterliegen den Gesetzen des Kapitalismus, der Konkurrenz und den Regeln des Marktes – und wenn notwendig – auch den Erfordernissen des Krieges. Im dritten und letzten Artikel wollen wir dann auf die Lösungsvorschläge der verschiedenen Bewegungen der Umweltschützer usw. Eingehen, um deren völlige Wirkungslosigkeit ungeachtet des guten Willens der meisten Umweltschützer aufzuzeigen und zu verdeutlichen, dass aus unserer Sicht nur die kommunistische Weltrevolution eine Lösung bringen kann.
Die Identifizierung des Problems und seiner Ursachen
Wer ist für die verschiedenen Umweltkatastrophen verantwortlich? Die Beantwortung dieser Frage ist von größter Wichtigkeit, nicht nur aus ethischer und moralischer Sicht, sondern auch und vor allem weil die richtige oder falsche Identifizierung der Ursachen des Problems entweder zur richtigen Lösung des Problems oder in eine Sackgasse führen kann. Wir werden zunächst eine Reihe von Gemeinplätzen, falschen Antworten oder nur teilweise richtigen Antworten besprechen, von denen es keiner gelingt, die wirkliche Ursache und den Verantwortlichen für die heute wachsende Umweltzerstörung zu identifizieren. Wir wollen im Gegenteil zeigen, in welchem Maße diese Dynamik keine gewünschte oder bewusste, sondern eine objektive Folge des kapitalistischen Systems ist.
Das Problem wäre nicht so schwerwiegend, wie man uns glauben machen will.
Heute stellt sich jede Regierung jeweils "grüner" dar als alle anderen. Die Aussagen der Politiker, die man jahrzehntelang hören konnte, haben sich geändert. Aber diese Einschätzung ist immer noch eine klassische Position der Unternehmer, die gegenüber einer Gefahr, welche Arbeiter, die Bevölkerung oder die Umwelt bedroht, ganz einfach dazu neigt, die Tragweite des Problems herunterzuspielen, weil Maßnahmen für die Sicherheit am Arbeitsplatz bedeutet, mehr Geld auszugeben und aus den Arbeitern weniger Profit herauszupressen. Dies wird jeden Tag ersichtlich anhand der Hunderten von Toten, die tagtäglich auf der ganzen Welt auf der Arbeit sterben, was den Aussagen der Unternehmer zufolge nur als einfache Fatalität angesehen werden soll, obwohl es sich in Wirklichkeit um ein echtes Produkt der kapitalistischen Ausbeutung der Arbeitskraft handelt.
Das Problem besteht, aber seine Wurzeln sind umstritten
Der große Müllberg, der von der gegenwärtigen Gesellschaft produziert wird, wäre einigen Erklärungen zufolge auf „unseren“ Konsumrausch zurückzuführen. Tatsächlich aber haben wir es mit einer Wirtschaftspolitik zu tun, die zur Förderung von Wettbewerbsvorteilen beim Verkauf von Waren seit Jahrzehnten danach strebt, Kosten zu senken, indem ungeheure Mengen nicht abbaubares Verpackungsmaterial verwendet werden[1].
Anderen zufolge wäre die Umweltverschmutzung des Planeten die Folge eines mangelnden Bürgersinns, dem gegenüber man reagieren müsse, indem man Kampagnen zur Säuberung von Stränden, Parks usw. anleiert, um so die Bevölkerung besser zu erziehen. Aus gleicher Perspektive beschuldigt man einen Teil der Regierungen unfähig zu sein, die Anwendung der Gesetze im Schiffsverkehr usw. zu überwachen. Oder auch die Mafia und ihr Handel mit verseuchtem Müll werden herangezogen, als ob die Mafia diesen produzieren würde und nicht die Industrie, welche zum Zweck der Kostensenkung bei der Produktion auf die Mafia zurückgreift, um ihre schmutzigen Geschäfte zu verrichten. Industrielle seien tatsächlich schuld, aber nur die schlechten unter ihnen, die Habgierigen.
Als ein Vorfall bekannt wurde wie der Brand bei Thyssen Krupp in Turin im Dezember 2007, bei dem sieben Arbeiter aufgrund der Nichtbeachtung der Sicherheitsnormen und des Brandschutzes ums Leben kamen, kam es auch unter Industriellen zu Solidaritätsäußerungen. Aber dabei wurde nur die irreführende Idee geäußert, dass solche Vorfälle nur eintreten, weil es skrupellose Manager gebe, die sich auf Kosten der anderen bereicherten.
Aber stimmt das wirklich? Gibt es auf der einen Seite gierige Kapitalisten, und auf der anderen solche, die sich verantwortlich verhalten und gute Manager ihres Unternehmens sind?
Einzig verantwortlich für die Umweltkatastrophe - das kapitalistische Produktionssystem
Alle Ausbeutungsgesellschaften, die dem Kapitalismus vorhergingen, haben zur Umweltverschmutzung insbesondere im Bereich der Produktion mit beigetragen. Einige Gesellschaften, die die ihnen zur Verfügung stehenden Reichtümer der Natur exzessiv ausgebeutet haben, wie dies wahrscheinlich bei den Bewohnern der Osterinseln[2] der Fall war, sind aufgrund der Erschöpfung dieser Reichtümer untergegangen. Aber die dadurch entstandenen Schäden stellten in diesen Gesellschaften keine solch große Gefahr dar, dass dadurch das Überleben des Planeten selbst bedroht gewesen wäre, wie das heute mit dem Kapitalismus der Fall ist. Ein Grund dafür liegt darin, nachdem der Kapitalismus einen ungeheuer gewaltigen Schub des Wachstums der Produktivkräfte ermöglichte, hat der Kapitalismus auch zu einem ähnlich gewaltigen Anwachsen der damit verbundenen Gefahren geführt, die nun den gesamten Erdball bedrohen, nachdem das Kapital diesen vollständig erobert hat. Aber dies ist nicht die wesentlichste Erklärung, da die Entwicklung der Produktivkräfte als solche nicht notwendigerweise bezeichnend für die mangelnde Beherrschung derselben ist. Es geht vor allem darum, wie diese Produktivkräfte von der Gesellschaft verwendet und verwaltet werden. Dabei stellt sich der Kapitalismus als der Höhepunkt eines historischen Prozesses dar, bei dem alles der Herrschaft der Waren geopfert wird und ein weltweit bestimmendes, Waren produzierendes System regiert, in dem alles verkauft werden kann. Wenn die Gesellschaft aufgrund der Herrschaft der Warenbeziehungen in ein Chaos gestürzt wird, das weit über das enge Phänomen der Umweltverschmutzung hinausgeht, sondern auch zu einer Verknappung der Reichtümer der Natur führt, es dabei immer mehr zu einer wachsenden Verwundbarkeit durch "Naturkatastrophen" kommt, geschieht dies aufgrund einer Reihe von Gründen, die wir kurz zusammenfassen können:
- die Arbeitsteilung, mehr noch die Produktion unter der Herrschaft des Geldes und des Kapitals spaltet die Menschheit in eine Vielzahl von konkurrierenden Einheiten ;
- das Ziel ist nicht die Produktion von Gebrauchswert, sondern die Produktion von Tauschwert; von Waren, die um jeden Preis abgesetzt werden müssen, egal welche Konsequenzen dabei für die Menschheit und den Planeten entstehen, damit so Profite realisiert werden können.
Diese Notwendigkeit zwingt die Kapitalisten ungeachtet der mehr oder weniger großen Moral der einzelnen Kapitalisten dazu, ihr Unternehmen der Logik der größtmöglichen Ausbeutung der Arbeiterklasse zu unterwerfen.
Dies führt zu einer Verschwendung und einem gewaltigen Verschleiß der menschlichen Arbeitskraft und der Ressourcen der Erde, auf die Marx schon in Das Kapital hingewiesen hat:
"Wie in der städtischen Industrie wird in der modernen Agrikultur die gesteigerte Produktivkraft und größre Flüssigmachung der Arbeit erkauft durch Verwüstung und Versiechung der Arbeitskraft selbst. Und jeder Fortschritt der kapitalistischen Agrikultur ist nicht nur ein Fortschritt in der Kunst, den Arbeiter, sondern zugleich in der Kunst, den Boden zu berauben, jeder Fortschritt in Steigerung der Fruchtbarkeit für eine gegebne Zeitfrist zugleich ein Fortschritt im Ruin der dauernden Quellen dieser Fruchtbarkeit. (…) Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen alles Reichtums untergräbt : die Erde und den Arbeiter" (Karl Marx, Das Kapital, Bd 1, IV. Abschnitt: Die Produktion des relativen Mehrwerts; 13. Kapitel: Maschinerie und große Industrie, 10. Große Industrie und Agrikultur, MEW Bd 23, S. 529).
Als Gipfel der Irrationalität und der Absurdität der Produktion im Kapitalismus findet man nicht selten Unternehmen, die chemische Erzeugnisse herstellen, welche die Umwelt stark verschmutzen aber gleichzeitig auch Kläranlagen verkaufen, die den Boden und das Wasser von den gleichen Umweltverschmutzern säubern sollen. Andere stellen Zigaretten her und Produkte, die den Zigarettenkonsum verhindern sollen, wiederum andere sind Waffenhändler, verkaufen aber gleichzeitig pharmazeutische Produkte und medizinische Geräte.
Dies sind Gipfel, die in früheren Gesellschaften nicht existierten, als die Güter im Wesentlichen noch wegen ihres Gebrauchswertes hergestellt wurden (oder weil sie nützlich für die Produzenten oder die Ausgebeuteten waren oder dem Prunk der herrschenden Klasse dienten).
Das wahre Wesen der Warenproduktion macht es den Kapitalisten unmöglich, sich für den Nutzen, die Art und die Zusammensetzung der hergestellten Güter zu interessieren. Ihn interessiert einzig und allein, wie man damit Geld machen kann. Dieser Mechanismus hilft uns zu verstehen, warum eine Reihe von Waren nur eine begrenzte Haltbarkeit hat, wenn sie nicht gar vollständig nutzlos sind.
Da die kapitalistische Gesellschaft vollständig auf Konkurrenz fußt, bleiben die Kapitalisten, auch wenn sie in Teilbereichen Absprachen treffen können, im Wesentlichen unnachgiebige Konkurrenten. Die Marktlogik verlangt nämlich, dass das "Glück" des einen dem "Pech" des anderen entspricht. Dies bedeutet, dass jeder Kapitalist nur für sich selbst produziert, jeder ist Rivale des anderen, und es kann keine wirkliche Planung geben, die von allen Kapitalisten lokal und international abgestimmt wird, sondern nur einen ständigen Wettbewerb mit Verlierern und Gewinnern. Und in diesem Krieg ist einer der Verlierer gerade die Natur.
Bei der Wahl eines neuen industriellen Produktionsstandortes oder der Flächen und der Modalitäten eines neuen landwirtschaftlichen Anbauproduktes berücksichtigt der Unternehmer nur seine unmittelbaren Interessen; für ökologische Belange gibt es keinen Raum. Auf internationaler Ebene gibt es kein zentralisiertes Organ, welches über genügend Autorität verfügt, um eine Orientierung zu geben oder einzuhaltende Grenzen oder Kriterien zu erzwingen. Im Kapitalismus werden Entscheidungen nur getroffen aufgrund der Realisierung des höchst möglichen Profites, so dass z.B. ein Einzelkapitalist am profitträchtigsten produzieren und verkaufen kann, oder der Staat die Maßnahmen durchsetzt, die am besten den Interessen des nationalen Kapitals entsprechen und damit global den Kapitalisten der jeweiligen Nation.
Es gibt zwar in jedem Land Gesetze, die gewisse Grenzen setzen. Wenn sie zu starke Einschränkungen mit sich bringen, geschieht es häufig, dass ein Unternehmen zur Erhöhung seiner Rentabilität einen Teil seiner Produktion in Länder verlagert, wo diese Auflagen geringer sind. So hatte Union Carbide, ein amerikanischer Chemie-Multi eines seiner Werke in Bhopal, Indien, errichtet, ohne dort allerdings ein ausreichendes Kühlsystem zu installieren. 1984 entwich in diesem Werk eine giftige Gaswolke mit 40 Tonnen Pestiziden. Unmittelbar und in den darauffolgenden Jahren starben mindestens 16.000 Menschen, ca. Eine Million Menschen erlitten irreparable physische Schäden[3]. Die Regionen und Meere in der Dritten Welt werden oft als billige Müllhalden benutzt, wo Firmen, die ihren Sitz in den entwickelten Ländern haben, ihren Giftmüll entweder legal oder illegal entsorgen, weil die Kosten für die Entsorgung in den Industriestaaten sehr viel höher liegen.
Solange es auf internationaler Ebene keine koordinierte und zentralisierte Planung für die Landwirtschaft und Industrie gibt, welche die notwendige Abstimmung der heutigen Bedürfnisse und die Erhaltung der Umwelt für morgen sicherstellt, werden die Mechanismen des Kapitalismus weiterhin die Natur mit all ihren dramatischen Folgen zerstören.
Häufig wird die Schuld für diese Zustände den Multis oder einer besonderen Industriebranche aufgrund der Tatsache zugeschoben, dass die Ursprünge des Problems in den "anonymen" Mechanismen des Marktes liegen.
Aber könnte der Staat diesem Wahnsinn ein Ende setzen, wenn er verstärkt eingreifen würde? Nein, weil der Staat diese Anarchie nur "regulieren" kann. Durch die Verteidigung der Landesinteressen trägt der Staat zur Verstärkung der Konkurrenz bei. Im Gegensatz zu den Forderungen der NGO (Nicht-Regierungsorganisationen) und der Antiglobalisierungsbewegung vermag ein verstärktes Eingreifen des Staates die Probleme der kapitalistischen Anarchie nicht zu lösen. Übrigens hat der Staat ungeachtet des früher proklamierten "Liberalismus", und wie die jüngste Krisenentwicklung wieder offenbarte, in Wirklichkeit schon verstärkt eingegriffen.
Quantität gegen Qualität
Wie wir gesehen haben ist das einzige Anliegen der Verkauf von Waren zu einem Höchstprofit. Aber es geht hier nicht um den Egoismus eines einzelnen, sondern um ein Gesetz des Systems, dem sich kein Unternehmen, ob groß oder klein, entziehen kann. Das wachsende Gewicht der Investitionskosten in der Industrie bedeutet, dass diese gewaltigen Investitionskosten nur durch einen immer größeren Absatz amortisiert werden können.
So muss zum Beispiel der Flugzeughersteller Airbus mindestens 600 Exemplare seines Großflugzeuges A 380 absetzen, bevor er damit Gewinn macht. Oder PKW-Hersteller müssen Hunderttausende Autos verkauft haben, bevor sich ihre Investitionskosten amortisieren. Kurzum, jeder Kapitalist muss so viel wie möglich verkaufen und dafür ständig nach neuen Märkten suchen. Aber dazu muss er sich auf einem gesättigten Markt gegenüber seinen Konkurrenten durchsetzen, was ihn wiederum zwingt, mit einem Riesenaufwand Werbung zu betreiben, die eine große Verschwendung menschlicher Arbeit und natürlicher Ressourcen mit sich bringt, wie z.B. der Druck von Tausenden Tonnen Werbematerial auf Hochglanzpapier.
Diese Gesetze der Wirtschaft (welche zur Kostensenkung treiben, und damit auch eine Minderung der Produktionsqualität und Massenproduktion erforderlich machen) bewirken, dass der Kapitalist sich kaum um die Zusammensetzung seiner Produkte kümmert und sich auch nicht die Frage stellen muss, ob die Erzeugnisse gefährlich sind. Obwohl die Gesundheitsgefährdung durch fossile Brennstoffe (als Krebserreger) seit langem bekannt ist, ergreift die Industrie keine entsprechenden Maßnahmen, um das Übel zu bekämpfen. Die Gesundheitsgefährdungen durch Asbest sind auch seit Jahren bekannt. Aber erst das qualvolle Dahinsiechen und der schreckliche Tod von Tausenden von Arbeitern haben die Industrie gezwungen, sehr spät zu reagieren. Viele Nahrungsmittel sind mit Zucker und Salz oder mit Glutamaten angereichert, um deren Absatz auf Kosten von Gesundheitsschädigungen zu erhöhen. Eine unglaublich große Menge von Nahrungsmittelzusätzen wird verwendet, ohne dass die daraus entstehenden Risiken für den Verbraucher bekannt sind, obwohl man mittlerweile festgestellt hat, dass viele Krebsarten ernährungsbedingt sind.
Einige altbekannten Irrationalitäten der Produktion und des Verkaufs
Einer der irrationalsten Aspekte des gegenwärtigen Produktionssystems ist, dass die Waren oft um die Welt befördert werden, bevor sie als Endprodukt auf den Markt gelangen. Dies hängt keineswegs mit der Beschaffenheit der Waren zusammen oder einem Erfordernis der Produktion, sondern einzig weil die Verarbeitung in dem einen oder anderen Land günstiger ist. Ein berühmtes Beispiel ist die Herstellung von Joghurt. Milch wird von Deutschland nach Italien über die Alpen transportiert, wo sie zu Joghurt verarbeitet wird, um dann wieder von Italien nach Deutschland befördert zu werden. Ein anderes Beispiel ist das der Automobilproduktion. Die Einzelteile kommen aus verschiedenen Ländern, bevor sie in der Endmontage am Fließband zusammengeführt werden. Im Allgemeinen, bevor ein Gut auf dem Markt zur Verfügung steht, haben seine Bestandteile schon Tausende von Kilometern in der unterschiedlichsten Form zurückgelegt. Elektro- oder Haushaltsgeräte werden z.B. in China in diesem Fall aufgrund der sehr niedrigen Löhne hergestellt, und weil es dort quasi keine oder nur ganz wenige Umweltauflagen gibt, obwohl es aus technischer Sicht keine Schwierigkeiten gegeben hätte, diese Produkte dort zu produzieren, wo sie verkauft werden. Oft werden Produkte zunächst im "Verbraucherland" auf den Markt gebracht, bevor deren Produktion dann später ausgelagert wird, weil die Produktionskosten, vor allem die Löhne anderswo niedriger sind.
Das Beispiel von Weinen, die in Chile, Australien oder in Kalifornien hergestellt und auf europäischen Märkten verkauft werden, während gleichzeitig in Europa die Reben aufgrund der Überproduktion verfaulen, oder das Beispiel der Äpfel, die aus Südafrika importiert werden, während die europäischen Apfelbauern nicht mehr wissen wohin mit ihren Überschüssen, sprechen auch für sich.
Aufgrund der Logik des maximalen Profits anstatt eines rationalen Einsatzes und aufgrund des minimalen Einsatzes von Menschen, Energie und natürlichen Ressourcen, werden die Waren irgendwo auf dem Planeten hergestellt, um dann in andere Teile der Welt zum Verkauf befördert zu werden. Deshalb wundert es nicht, dass Waren mit gleicher technologischer Zusammensetzung und Wert wie Automobile, die von verschiedenen Herstellern auf der Welt produziert werden, in Europa zusammengebaut werden, um anschließend in Japan oder den USA verkauft zu werden, während gleichzeitig in Japan oder Korea fabrizierte Autos auf dem europäischen Markt verkauft werden. Dieses Transportnetz an Waren – in dem nur Waren hin- und her gekarrt werden aufgrund der Profitgesetze, der Konkurrenz und den Marktgesetzen, ist völlig wahnwitzig und ursächlich mitverantwortlich für die katastrophalen Folgen der Umweltzerstörung.
Eine rationale Planung der Produktion und des Vertriebs könnte diese Güter zur Verfügung stellen, ohne dass sie diese verrückten Transportwege hinter sich gelegt haben, die nur ein Ausdruck des kapitalistischen Wahnsinns sind.
Der Gegensatz zwischen Stadt und Land
Die Umweltzerstörung, die aufgrund des aufgeblähten Transportnetzes entsteht, ist keine vorübergehende Erscheinung, da deren Wurzeln im tiefgreifenden Widerspruch zwischen Stadt und Land zu finden sind. Ursprünglich hat die Arbeitsteilung innerhalb der Länder Industrie und Handel von der Arbeit auf dem Land abgeschnitten. Daraus ist der Gegensatz zwischen Stand und Land mit den daraus folgenden Interessensgegensätzen entstanden. Im Kapitalismus hat dieser Gegensatz seinen Höhepunkt des Wahnsinns erreicht[4].
Zur Zeit der Landwirtschaft im Mittelalter, als die Produktion ausschließlich aus Subsistenzgründen erfolgte, war es kaum erforderlich, Waren zu transportieren. Anfang des 19. Jahrhunderts, als die Arbeiter oft in der Nähe der Fabrik oder des Bergwerkes lebten, war es meist möglich, zu Fuß zu Arbeit zu gehen. Seitdem haben sich die Entfernungen zwischen Arbeitsplatz und Wohnort immer mehr erhöht. Zudem haben die Konzentration von Kapital an bestimmten Standorten (wie zum Beispiel in Industriegebieten oder unbewohnten Gebieten, um Steuervorteile oder günstige Bodenpreise auszunutzen), die Deindustrialisierung und die Explosion der Arbeitslosigkeit, verbunden mit dem Verlust von Arbeitsplätzen, die Transportwege ohnehin stark verändert. So müssen jeden Tag Hunderte von Millionen Menschen oft über lange Entfernungen pendeln. Viele von ihnen sind dabei auf Autos angewiesen, weil sie oft mit öffentlichen Verkehrsmitteln ihre Arbeitsstätte nicht erreichen.
Aber schlimmer noch: die Konzentration von großen Menschenmassen am gleichen Ort wirft eine Reihe von Problemen auf, die ebenso die Umwelt in bestimmten Gebieten gefährden. Die Funktionsweise einer Bevölkerungskonzentration von 10-20 Millionen Menschen auf engstem Raum führt zu einer Anhäufung von Müll (menschliche Ausscheidungen, Haushaltsmüll, Abgase aus Fahrzeugen, der Industrie und Heizungen…), an einem Ort, der zu eng und klein geworden ist, um die Abfälle ausreichend zu entsorgen.
Der Albtraum der Nahrungs- und Wasserknappheit
Mit der Entwicklung des Kapitalismus wurde die Landwirtschaft den tiefst greifenden Umwälzungen ihrer mehr als 10.000 jährigen Geschichte unterworfen. Diese traten ein, weil die Landwirtschaft im Kapitalismus im Gegensatz zu den früheren Produktionsformen, als die Landwirtschaft für die direkten Bedürfnisse der Menschen produzierte, sich seitdem den Gesetzen des Weltmarktes unterwerfen musste. Dies bedeutete immer auf Kostensenkungen ausgerichtet zu sein. Die Notwendigkeit, ständig die Rentabilität zu erhöhen, hat katastrophale Auswirkungen auf die Qualität der Böden gehabt.
Diese Konsequenzen, die untrennbar mit dem Aufkommen des starken Gegensatzes zwischen Stadt und Land verbunden sind, wurden schon im 19. Jahrhundert von der Arbeiterbewegung angeprangert. Anhand der folgenden Zitate kann man erkennen, wie schon Marx auf die untrennbare Verbindung zwischen der Ausbeutung der Arbeiterklasse und der Verwüstung der Böden hingewiesen hat: "Auf der anderen Seite reduziert das große Grundeigentum die agrikole Bevölkerung auf ein beständig sinkendes Minimum und setzt ihr eine beständig wachsende, in großen Städten zusammengedrängte Industriebevölkerung entgegen; es erzeugt dadurch Bedingungen, die einen unheilbaren Riss hervorrufen in dem Zusammenhang des gesellschaftlichen und durch die Naturgesetze des Lebens vorgeschriebenen Stoffwechsels, infolge wovon die Bodenkraft verschleudert und diese Verschleuderung durch den Handel weit über die Grenzen des eigenen Landes hinausgetragen wird." (Marx, Das Kapital, Bd 3, VI. Abschnitt, Verwandlung von Surplusprofit in Grundrente; 47. Kapitel-Genesis der kapitalistischen Grundrente; V. Die Metäriewirtschaft und das bäuerliche Parzelleneigentum, MEW Bd 25, S. 821).
Die Landwirtschaft musste ständig immer mehr chemische Produkte verwenden, um höhere Erträge zu erzielen und mehr Anbauflächen zu schaffen. In den meisten Gebieten der Erde praktizieren Bauern Anbaumethoden, die ohne den Einsatz von großen Mengen Pestiziden, Düngemitteln und künstlichen Bewässerungen unmöglich wären. Dabei wäre es möglich, durch den Anbau von Pflanzen in anderen Gebieten auf diese Mittel zu verzichten oder diese nur in geringen Maßen zu verwenden. Alfalfa in Kalifornien, Zitrusfrüchte in Israel, Baumwolle am Aralsee in der ehemaligen Sowjetunion, Getreide in Saudi-Arabien oder im Jemen, d.h. Pflanzen in Gegenden anzubauen, in denen die natürlichen Wachstumsbedingungen nicht gegeben sind, führt zu einer gigantischen Wasserverschwendung. Die Liste der Beispiele ist endlos, denn gegenwärtig werden 40% der landwirtschaftlichen Erzeugnisse durch künstliche Bewässerung angebaut mit der Folge, dass 75% des auf der Erde verfügbaren Wassers von der Landwirtschaft verwendet wird.
So hat zum Beispiel Saudi-Arabien ein Vermögen ausgegeben, um Grundwasser abzupumpen und eine Million Hektar Fläche in der Wüste zu bewässern, weil dort Getreide angebaut wird. Für jede Tonne Getreide liefert die Regierung 3000 Kubikmeter Wasser, d.h. dreimal mehr als der übliche Wasserbedarf von Getreide. Und dieses Wasser kommt aus Brunnen, die nicht durch Regenwasser aufgefüllt werden. Ein Drittel der Bewässerungsanlagen auf der Welt greift auf Grundwasser zurück. Aber obgleich diese Grundwasservorkommen nicht wieder erneuert werden und dabei sind auszutrocknen, bestehen die Bauern der indischen Region Gujarat, die verzweifelt Wasser brauchen, darauf, Milchkühe zu züchten. So erfordert die Gewinnung von einem Liter Milch den Aufwand von 2000 Liter Wasser. In einigen Gebieten der Erde benötigt man bis zu 3000 Liter Wasser zur Gewinnung von einem Kilo Reis. Die Folgen der Bewässerung und des breitgefächerten Einsatzes von chemischen Produkten sind desaströs: Versalzung, Überdüngung, Verwüstung, Bodenerosion, sinkende Grundwasserpegel und infolge dessen versiegende Trinkwasserreserven.
Verschwendung, Urbanisierung, Dürre und Umweltverschmutzung verschärfen die weltweite Wasserkrise. Millionen und Millionen Liter Wasser verdunsten beim Einsatz von offenen Bewässerungskanälen. Vor allem in den Gebieten um die Megastädte, aber auch in ganzen Landstrichen sinkt der Grundwasserpegel ständig und irreversibel.
In der Vergangenheit war China ein Land der Wasserwirtschaft. Seine Wirtschaft und Zivilisation haben sich dank seiner Fähigkeit entwickelt, trockene Flächen zu bewässern und Dämme zu bauen, um das Land vor Überschwemmungen zu schützen. Aber im heutigen China erreicht das Wasser des mächtigen Gelben Flusses, der großen Arterie im Norden, an mehreren Monaten im Jahr nicht das Meer. 400 der 600 Städte Chinas leiden an Wassermangel. Ein Drittel der chinesischen Brunnen sind ausgetrocknet. In Indien sind 30% der Anbauflächen durch Versalzung bedroht. Auf der ganzen Welt sind insgesamt ca. 25% von dieser Geißel gefährdet.
Aber die Gewohnheit, Pflanzen in Gegenden anzubauen, die aufgrund ihres Klimas oder der Beschaffenheit ihres Bodens für deren Anbau nicht geeignet sind, ist nicht die einzige Absurdität der gegenwärtigen Landwirtschaft. Insbesondere aufgrund des Wassermangels ist die Kontrolle über Flüsse und Deiche zu einer grundlegenden strategischen Frage geworden, gegenüber der alle Nationalstaaten sich rücksichtslos über die Interessen der Natur hinwegsetzen.
In mehr als 80 Ländern wurde eine Wasserknappheit gemeldet. Einer UN-Prognose zufolge werden in den nächsten 25 Jahren ca. 5.4 Milliarden Menschen unter Wasserknappheit leiden. Obgleich es viele Anbauflächen gibt, nimmt die Zahl der tatsächlich nutzbaren Anbauflächen aufgrund der Versalzung und anderer Faktoren ständig ab. In Urgesellschaften mussten Nomadenstämme weiterziehen, als das Wasser knapp wurde. Im Kapitalismus fehlt es an Grundnahrungsmitteln, obgleich das System selbst an Überproduktion leidet. Aufgrund der verschiedenen Schäden in der Landwirtschaft ist die Nahrungsmittelknappheit vorprogrammiert. So hat zum Beispiel seit 1984 das Wachstum der Getreideproduktion nicht mehr mit dem Bevölkerungswachstum Schritt gehalten. Innerhalb von 20 Jahren ist die Getreideproduktion von 343 kg pro Person auf 303 kg pro Person gesunken.
So scheint das Gespenst der Nahrungsmittelknappheit, das von Anfang an über der Menschheit hing, jetzt wieder Einzug zu halten, nicht weil es an Anbauflächen oder an Mitteln für die Landwirtschaft fehlt, sondern aufgrund der absoluten wahnsinnigen Verwendung der Ressourcen der Erde.
Eine fortgeschrittene Gesellschaft garantiert nicht mehr Sicherheit
Während der Fortschritt der Wissenschaften und der Technologie der Menschheit Werkzeuge zur Verfügung gestellt hat, deren Existenz man in der Vergangenheit sich nicht einmal vorstellen konnte, und die heute Unfälle und Naturkatastrophen verhindern können, ist nicht von der Hand zu weisen, dass dieser Einsatz sehr kostspielig ist und die Werkzeuge nur benutzt werden, wenn sich daraus ökonomische Vorteile ergeben. Wir wollen erneut betonen, dass nicht eine egoistische und habsüchtige Haltung einzelner Unternehmer ursächlich dafür verantwortlich ist, sondern dahinter steckt der Zwang, dem sich alle Betriebe und Länder beugen müssen, die Produktionskosten der Waren oder Dienstleistungen so stark wie möglich zu senken, um in der weltweiten Konkurrenz zu überleben.
In unserer Presse haben wir dieses Problem oft aufgegriffen. Dabei haben wir aufgezeigt, dass die angeblichen Naturkatastrophen kein Zufall und auch keine Schicksalsfügung sind, sondern das logische Ergebnis der Senkung der Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen, um Geld zu sparen. So schrieben wir beispielsweise anlässlich des Wirbelsturms Hurrikans Katrina in New Orleans 2005:
"Das Argument, demzufolge diese Katastrophe nicht vorhergesehen wurde, ist Unfug. Seit fast 100 Jahren haben Wissenschaftler, Ingenieure und Politiker darüber diskutiert, wie der Verletzbarkeit New Orleans durch Überschwemmungen und Hurrikans begegnet werden könnte. Mitte der 1980er Jahre wurden durch verschiedene Gruppen von Wissenschaftlern und Ingenieuren mehrere Projekte entwickelt, die (unter der Verwaltung Clinton) 1998 zum Vorschlag des Projektes Küste 2050 führten. Dieses Projekt beinhaltete die Verstärkung und den Umbau der bestehenden Deiche, den Bau eines Systems von Schleusen und die Schaffung neuer Kanäle, durch welche das mit Sedimenten gefüllte Wasser abgeleitet würde, um die Sumpfgebiete wieder herzustellen, welche als Pufferzone im Delta dienten. Dieses Projekt erforderte allerdings die Investition von 14 Milliarden Dollar in einem Zeitraum von 10 Jahren. Washington gab zur Zeit Bushs nicht seine Zustimmung,erst unter Clinton" (International Review, 2005, Nr. 124).
Letztes Jahr hat die Armee 105 Mio. Dollar für den Kampf gegen Zyklone und Überschwemmungen in New Orleans angefordert, aber die Regierung hat nur 42 Millionen gebilligt. Gleichzeitig stimmte der Kongress der Zahlung von 231 Mio. Dollar für den Bau einer Brücke zu einer kleinen, unbewohnten Insel in Alaska zu[5]. Wir haben auch den Zynismus und die Verantwortung der Herrschenden beim Tod von 160.000 Menschen infolge des Tsunamis vom 26. Dezember 2004 angeprangert.
Heute wird selbst offiziell klar eingestanden, dass keine Warnung ausgegeben wurde aus Furcht vor Schäden für den Tourismus! Mit anderen Worten: Zehntausende Menschenleben wurden geopfert für die Verteidigung von schmutzigen ökonomischen und finanziellen Interessen.
Diese Verantwortung der Regierungen zeigt erneut den wahren Charakter dieser Klasse auf, die sich wie Haifische bei der Verwaltung des Lebens und der Produktion in dieser Gesellschaft verhält. Die bürgerlichen Staaten sind bereit, wenn notwendig genau so viele Menschenleben zu opfern, um die Ausbeutung und die kapitalistischen Profite zu verteidigen. Und die Interessen der Kapitalisten bestimmen ebenso die Politik der herrschenden Klasse. Im Kapitalismus ist die Vorbeugung keine rentable Tätigkeit, wie heute alle Medien zugeben müssen: "Bislang haben Länder der Region sich taub gestellt, wenn es darum ging, ein Frühwarnsystem zu installieren, weil damit gewaltige finanzielle Kosten verbunden sind. Den Experten zufolge würde ein Frühwarnsystem Dutzende Millionen Dollar kosten, aber damit könnten Zehntausende Menschenleben geschützt werden." (Les Echos, 30.12.)[6]
Man könnte auch noch das Beispiel des Öls nehmen, das jedes Jahr ins Meer geschüttet wird (egal ob absichtliche oder ungewollte Verknappungen von Öl, ob aus endogenen Quellen oder ob das Öl aus Flüssen mitgeschleppt wurde usw.): Man spricht von drei bis vier Millionen Tonnen Öl jedes Jahr. Die Legambiente berichtete: "Wenn man die Ursachen der Störfälle untersucht, kann man von 64% Störfällen ausgehen, die auf menschliches Versagen zurückzuführen sind. 16% aufgrund technischer Pannen und 10% aufgrund der Struktur von Schiffen, während die verbleibenden 10% keiner eindeutig festzulegenden Ursache zuzuordnen sind"[7].
Man kann leicht nachvollziehen, wenn man von "menschlichem Versagen" spricht – wie zum Beispiel bei Unfällen im Eisenbahnbetrieb, die auf Fehler eines Eisenbahners zurückzuführen sind -, meint man Fehler, die ein Beschäftigter begangen hat, weil seine Arbeitsbedingungen starken Stress und Erschöpfung hervorrufen. Zum Beispiel lassen Ölgesellschaften oft Öltanker verkehren, selbst wenn sie alt und heruntergekommen sind, um das schwarze Gold zu befördern, denn im Fall eines Schiffuntergangs verlieren sie höchstens den Wert der Ladung, während der Kauf eines neuen Schiffs sie sehr viel mehr kostet. Deshalb sieht man immer häufiger untergegangene oder havarierte Öltanker vor den Küsten, deren Ladung entweicht. Man kann behaupten, dass insgesamt mindestens 90% der Ölpest-Vorfälle die Folge einer totalen Schlampigkeit der Ölgesellschaften sind, die darauf zurückzuführen ist, dass sie die Kosten so stark wie möglich senken und den Profit so hoch wie möglich schrauben wollen.
Es ist das Verdienst Amadeo Bordigas[8] in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg die durch den Kapitalismus verursachten Katastrophen auf eine systematische, scharfsinnige, tiefgreifende und argumentierte Art und Weise entblößt zu haben. In dem Vorwort zu seinem Buch "Drammi gialli e sinistri della moderna decadenza sociale" (Gelbe und finstere Dramen des modernen gesellschaftlichen Niedergangs), in dem verschiedene Artikel Amadeo Bordigas zusammengetragen wurden, schrieb dieser: "In dem Maße, wie der Kapitalismus sich entfaltet und dann in sein Stadium der Fäulnis eintritt, prostituiert er mehr und mehr diese Technik, die eigentlich eine Befreiung sein könnte, den Bedürfnissen der Ausbeutung, der Vorherrschaft und der imperialistischen Plünderung. Dabei wird der Punkt erreicht, wo er dessen eigene Fäulnis überträgt und sie gegen den Gattung Mensch richtet. (…) In allen Bereichen des Alltagslebens der "friedlichen" Phasen, wo wir in einer Zeit zwischen zwei imperialistischen Massakern oder zwei Unterdrückungsmaßnahmen leben, pfercht das ständig auf der Suche nach einem Höchstprofit befindliche Kapital die Menschen zusammen, und die prostituierte Technik vergiftet, erstickt, verstümmelt, massakriert die Individuen. (…) Der Kapitalismus trägt auch seine Verantwortung bei den sogenannten "Naturkatastrophen". Ohne das Wirken von Naturkräften, die der Mensch nicht kontrollieren kann, beiseite zu lassen, zeigt der Marxismus auf, dass viele Katastrophen indirekt durch gesellschaftliche Ursachen hervorgerufen oder verschlimmert wurden. (…) Die bürgerliche Zivilisation kann nicht nur aufgrund ihrer Jagd nach Profiten und durch den überragenden Einfluss des Geldes auf den Verwaltungsapparat direkt Katastrophen hervorrufen (…), sondern sie erweist sich als unfähig, einen wirksamen Schutz vor diesen Gefahren zu organisieren, weil die Vorbeugung keine rentable Angelegenheit ist."[9]
Bordiga entschleierte die Legende, der zufolge: "die gegenwärtige kapitalistische Gesellschaft mit der gemeinsamen Entwicklung der Wissenschaften, Technik und Produktion die Gattung Mensch in die ausgezeichnete Lage versetzen würde, gegen die Schwierigkeiten der natürlichen Umwelt zu kämpfen"[10]. Bordiga fügte hinzu, "während das wirtschaftliche und industrielle Potential der kapitalistischen Welt weiter anwächst und nicht zurückgeht, kann man sagen, je größer dessen Kraft ist, desto schlimmer sind die Lebensbedingungen der Menschen gegenüber den Katastrophen der Natur und der Geschichte."[11] Zur Beweisführung seiner Behauptungen analysierte Bordiga eine Reihe von Katastrophen, die an verschiedenen Orten der Welt stattfanden. Er zeigte jedes Mal auf, dass sie keinem Zufall oder einer Fatalität geschuldet waren, sondern der dem Kapitalismus immanenten Tendenz, Höchstprofite herauszuschlagen, indem so wenig wie möglich in Sicherheit investiert wird, wie das Beispiel des Flying Enterprise aufzeigt.
"Das ganz neue prunkvolle Schiff, das Carlsen so polieren ließ, dass es wie ein Spiegel glänzte, und welches eine garantiert sichere Überquerung ermöglichen sollte, fuhr mit Flachkiel. Wie war es möglich, dass ganz moderne Werften wie Flying die Methode des "flachen Kiels", d.h. der Seeschiffe übernommen haben? Eine Zeitung schrieb es ungeschminkt: um die Produktionskosten pro Einheit zu reduzieren; (…) hier handelt es sich um den Schlüssel der ganzen modernen Wissenschaft. Ihre Untersuchungen, ihre Forschungen, ihre Berechnungen, ihre Innovationen zielen auf dieses Ziel ab: die Kosten (auch Transportkosten) zu reduzieren. Daher der Prunk der Spiegelsäle und Vorhänge um die Wohlhabenden anzulocken, verlauste Knauserigkeit bei den tragenden Teilen, die am Rande der mechanischen Haltbarkeit liegen, und auch bei Größe und Gewicht. Diese Tendenz zeichnet die ganze moderne Ingenieurswissenschaft aus, vom Bau bis zur Mechanik, d.h. einen Eindruck des Reichtums zu erwecken, um die Bürgerlichen zu beeindrucken; Erscheinungen und Ausführungen zu benutzen, die jeder Dummkopf bewundern kann (die gerademal ein Kulturniveau des Schunds erreichen, welches man sich im Kino und in den Klatschblättern abgeschaut hat), und bei den tragenden Strukturen. welche dem Laien unsichtbar und unverständlich sind, ist mannachlässig"[12].
Auch wenn die von Bordiga analysierten Katastrophen keine ökologischen Konsequenzen hatten, ändert das nichts an den Kernaussagen. Denn anhand dieser Beispiele wie auch anhand der Beispiele, die in dem Vorwort zu seiner Artikelreihe "Menschliche Gattung und Erdoberfläche" dargestellt werden, von denen wir einige zitieren, kann man sich leicht die Auswirkungen der gleichen kapitalistischen Logik vorstellen, wenn diese sich direkt und entscheidend auf die Umwelt auswirkt, wie zum Beispiel bei der Planung und Wartung der Atomreaktoren: "In den 1960er Jahren, explodierten mehrere britische Flugzeuge des Typs "Comet", welches als der letzte Schrei der höchst entwickelten Technik galt, in der Luft und töteten dabei alle Insassen. Die langwierigen Untersuchungen brachten schließlich hervor, dass die Explosionen auf eine Materialermüdung der Metallschichten des Flugzeugs zurückzuführen waren, weil diese zu dünn angelegt worden waren, denn man wollte beim Metall, bei der Reaktorstärke, den gesamten Produktionskosten sparen, um höhere Profite zu machen. 1974 führte die Explosion einer DC 10 über Ermenonville zum Tod von mehr als 300 Menschen. Man wusste, dass das Türschließsystem des Gepäckraums schadhaft war, aber dieses zu erneuern, hätte Geld gekostet… Aber der wahnsinnigste Bericht erschien in der englischen Zeitschrift The Economist (24.9.1977) nach der Entdeckung von Rissen im Metall von 10 Trident Flugzeugen und der unerklärlichen Explosion eines Boeing-Flugzeuges. Der "neuen Auffassung" zufolge, die beim Bau von Transportflugzeugen angewandt wird, werden diese nicht mehr nach einer gewissen Anzahl von Flugstunden aus dem Verkehr gezogen und generalüberprüft, sondern man ging davon aus, dass diese "sicher" wären… bis man erste Risse aufgrund von Materialermüdung des Metalls feststellte. Man kann sie also so lange wie möglichen nutzen, da sie bei einer zu frühen Stilllegung zu große Verlust für die Fluggesellschaften verursachen würden."[13] Wir haben schon im ersten Teil dieser Artikelserie den Unfall im Atomkraftwerk 1986 in Tschernobyl erwähnt. Im Wesentlichen handelt es sich um das gleiche Problem, das 1979 bei der Fusion eines atomaren Reaktors auf der Insel Three Mile Island in Pennsylvania, USA, zum Tragen kam.
Die Wissenschaft im Dienste der Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft
Es ist von größter Bedeutung, den Platz der Technik und der Wissenschaft in der kapitalistischen Gesellschaft zu begreifen, wenn man herausfinden will, ob diese eine Hilfe sind, um das Voranschreiten der Umweltzerstörung einzudämmen und wirksame Instrumente gegen einige der Auswirkungen derselben zu entwickeln.
Wenn die Technik, wie eben gesehen, sich im Dienst der Bedürfnisse des Marktes prostituieren muss, trifft das auch zu auf die Entwicklung der Wissenschaften und der wissenschaftlichen Forschung? Gibt es Mittel sicherzustellen, dass diese außerhalb des Interessensbereichs der Wirtschaft wirken?
Um diese Frage zu beantworten, müssen wir von der Erkenntnis ausgehen, dass die Wissenschaft eine Produktivkraft ist und ihre Entwicklung eine schnellere Entfaltung und Bereicherung der Ressourcen der Gesellschaft ermöglicht. Die Kontrolle der Entwicklung der Wissenschaften ist deshalb eine wichtige Frage für die Verwalter der Wirtschaft und des Staates. Deshalb wird die wissenschaftliche Forschung, insbesondere einige Bereiche besonders üppig, mit großen finanziellen Mitteln ausgestattet. Die Wissenschaft ist deshalb kein neutraler Bereich – in einer Klassengesellschaft wie dem Kapitalismus könnte es nicht anders sein -, in dem es eine Freiheit der Forschung gäbe, und die vor ökonomischen Interessen geschützt wäre, weil die herrschende Klasse sehr davon profitiert, die Wissenschaft und die Wissenschaftler ihren Interessen unterzuordnen. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Entwicklung der Wissenschaften und der Erkenntnis im Zeitraum des Kapitalismus nicht durch eine eigenständige und unabhängige Dynamik getrieben wird, sondern dem Ziel untergeordnet ist, einen höchst möglichen Profit zu erwirtschaften.
Dies hat wichtige Folgen, über die man sich selten bewusst ist. Nehmen wir zum Beispiel die Entwicklung der modernen Medizin. Die medizinischen Untersuchungen und Behandlungen des Menschen sind unter Dutzende verschiedene Spezialisten aufgeteilt worden, denen in letzter Instanz eine Gesamtübersicht der Funktionsweise des menschlichen Körpers fehlt. Warum ist es dazu gekommen? Weil das Hauptziel der modernen Medizin in der kapitalistischen Welt nicht darin besteht, dass jeder Mensch gut lebt, sondern "die menschliche Maschine" wieder "repariert" werden muss, wenn sie eine Panne hat und sie so schnell wie möglich wieder hergerichtet werden soll, um weiter arbeiten zu können. Auf diesem Hintergrund versteht man gut, warum so massiv auf Antibiotika zurückgegriffen wird, und warum die Diagnosen immer die Ursachen der Erkrankungen unter den Besonderheiten suchen anstatt in den allgemeinen Lebensbedingungen der untersuchten Menschen.
Eine andere Folge der Abhängigkeit von der wissenschaftlichen Entwicklung gegenüber der Logik der kapitalistischen Welt ist, dass Forschung ständig auf die Produktion neuen Materials gerichtet ist (resistenter und billiger), deren Auswirkungen aus toxikologischer Sicht auf unmittelbarer Ebene nie ein großes Problem dargestellt haben, wodurch auf wissenschaftlicher Ebene sehr wenig oder gar nichts ausgegeben wird, um das auszulöschen oder unschädlich zu machen, was die Sicherheit der Produkte bedroht. Aber Jahrzehnte später muss man die Rechnung begleichen, oft weil bei den Menschen irgendein Schaden aufgetreten ist.
Anhand nachfolgender Zitate kann man sehen, in welchem Maße die wissenschaftliche Entwicklung der staatlichen Kontrolle und militärischen Bedürfnissen untergeordnet ist, so dass in der Nachkriegszeit überall wissenschaftliche "Kommissionen" entstanden, die geheim für das Militär arbeiteten, während anderen Wissenschaftlern das Endziel der Forschungen unbekannt war, die verdeckt betrieben wurden : "Die Wichtigkeit der Mathematik für die Offiziere der Kriegsmarine und der Artillerie erforderte eine besondere Ausbildung in Mathematik; so war im 17. Jahrhundert die größte Gruppe, die von sich behaupten konnten, über Kenntnisse in Mathematik zu verfügen (zumindest Grundlagenkenntnisse), Armeeoffiziere. (…) (Im Großen Krieg) wurden zahlreiche neue Waffen geschaffen und perfektioniert – Flugzeuge, U-Boote, Sonaranlagen zum Kampf gegen diese, Chemiewaffen. Nach einigen Zögerungen des Militärapparates wurden zahlreiche Wissenschaftler für die Entfaltung des Militärs eingesetzt, auch wenn es nicht darum ging, Forschung zu betreiben, sondern sie waren als Ingenieure tätig, die auf höchster Ebene ihren schöpferischen Beitrag leisteten. (…) Auch wenn es nicht mehr im 2. Weltkrieg wirksam zum Einsatz kommen konnte, wurde 1944 das "Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach" in Deutschland gegründet. Zwar gefällt dies deutschen Mathematikern nicht so sehr, aber es handelte sich um eine sehr klug geplante Struktur, die darauf abzielte, den ganzen Bereich der Mathematik "nützlich" zu machen : der Kern bestand aus einer kleinen Gruppe Mathematiker, die gut im Bilde waren über die Probleme, vor denen das Militär stand, und die in der Lage waren, die Probleme zu entdecken, die sich mathematisch lösen ließen. Um diesen Kern sollten andere, sehr kompetente Mathematiker, welche sich gut in den Kreisen der Mathematiker auskannten, diese Probleme in mathematische Fragen übersetzen und sie nach deren Aufbereitung spezialisierten Mathematikern vorlegen (die sich mit militärischen Fragen, welche am Anfang der Fragestellungen standen, nicht auskennen mussten und sie auch gar nicht kennen sollten). Sobald die Lösungen vorlagen, funktionierte das Netz in der entgegengesetzten Richtung.
In den USA gab es während des Krieges schon eine ähnliche Struktur, auch wenn sie ein wenig improvisiert war, um Marston Morse. In der Nachkriegszeit war eine ähnliche Struktur namens „Wisconsin Army Mathematics Research Center" (…) tätig, die jedoch nicht mehr improvisiert war.
Der Vorteil solcher Strukturen besteht darin, dass sie es der Militärmaschinerie ermöglichen, die Kompetenzen vieler Mathematiker auszunutzen, ohne dass sie "direkt für sie" arbeiten, mit all dem, was damit verbunden ist : Verträge, die Notwendigkeit von Abmachungen, Unterordnung usw"[14].
1943 wurden in den USA spezialisierte Forschungsgruppen eingerichtet, die sich eigens mit Fragen beschäftigten wie der Größe von Schiffskonvois, der Wahl von Kriegszielen bei Luftangriffen, dem Aufspüren und der Abwehr von feindlichen Flugzeugen. Während des 2. Weltkriegs wurden im Vereinten Königreich, in Kanada und in den USA allein 700 Mathematiker eingesetzt. "Im Vergleich zur britischen Forschung zeichnete sich die amerikanische Forschung seit dem Anfang durch einen höher entwickelteren Einsatz der Mathematik aus, und insbesondere der Wahrscheinlichkeitsrechnung und ein häufigerer Rückgriff auf Modellrechnungen (…). Operations Research (die in den 1950er Jahren ein eigenständiger Bereich der angewandten Mathematik wurde) machte somit ihre ersten Schritte als eine Reaktion auf strategische Schwierigkeiten und der Optimierung kriegerischer Ressourcen. Was ist die beste Taktik im Luftkampf? Was ist die beste Aufstellung von Soldaten bei bestimmten Angriffspunkten? Wie können Rationen an die Soldaten verteilt werden, indem man am wenigsten verschwendet und die bestenfalls sättigen?"[15]
"(…) Das Projekt Manhattan(…) war das Zeichen für eine große Wende, nicht nur weil darin die Arbeit von Tausenden von Wissenschaftlern und Technikern aus verschiedenen Fachbereichen in einem Projekt zusammengebündelt wurde, welches von Militärs gesteuert und kontrolliert wurde, sondern auch weil es einen gewaltigen Sprung für die Grundlagenforschung bedeutete, da es – wie man es später nannte – die "big science" einläutete. (…) Die wissenschaftliche Gemeinschaft für ein genaues Projekt, das unter direkter Kontrolle der Militärs stand, einzuspannen, war eine Notmaßnahme gewesen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht ewig dauern konnte (dazu gehörte azch die "Freiheit der Forschung", die von den Wissenschaftlern beansprucht wurde) Das Pentagon konnte jedoch auf die wertvolle, unverzichtbar gewordene Mitarbeit der Gemeinschaft der Wissenschaftler verzichten. Auch musste es eine Form der Kontrolle ihrer Aktivitäten aufrechterhalten: man musste zwangsweise eine neue Strategie einschlagen und eine andere Sprache benutzen. (…) 1959 wurde aufgrund einer Initiative von anerkannten Wissenschaftlern, die auch die US-Regierung berieten, eine halb-ständig tagende Expertengruppe eingerichtet, die regelmäßig Treffen abhielt. Diese Gruppe wurde "Divsion Jason" genannt, in Anlehnung an den mythischen griechischen Helden, der sich auf die abenteuerliche Suche nach dem Goldenen Vlies mit dem Argonauten, Jason, begab. Es handelte sich um eine Elitegruppe von ca. 50 Wissenschaftlern, von denen mehrere mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden waren. Sie trafen sich jeden Sommer einige Wochen lang, um ganz unbeschwert die Fragen der Sicherheit, der Verteidigung und der Kontrolle der von dem Pentagon angeschafften Waffen zu besprechen, sowie dem Energieministeriums und anderen Bundesbehörden. Sie erstellten detaillierte Berichte, welche zum Großteil 'geheim' blieben und direkt die Politik der nationalen Sicherheit mit bestimmten. Die Division Jason spielte während des Vietnamkrieges eine herausragende Rolle gegenüber Verteidigungsminister Robert McNamara, indem sie drei besonders wichtige Studien lieferten, welche einen wichtigen Einfluss auf die Strategie der USA haben sollten. Hinsichtlich der Wirksamkeit der strategischen Bombardierungen zur Unterbrechung der Nachschublinien der Vietkong, zum Bau einer elektronischen Schranke durch Vietnam und zu den taktischen Nuklearwaffen."[16]
Die Angaben aus diesen langen Zitaten zeigen, dass die Wissenschaft heute ein wichtiger Eckpfeiler der Aufrechterhaltung des kapitalistischen Systems und der Festlegung des Kräfteverhältnisses zwischen den Klassen ist. Die wichtige Rolle der Wissenschaftler während und nach dem 2. Weltkrieg konnte nur noch weiter anwachsen, auch wenn die Bourgeoisie diese systematisch vertuscht.
Zusammenfassend können wir sagen, dass wir versucht haben aufzuzeigen, wie die ökologischen und Umweltkatastrophen, selbst wenn sie von Naturphänomen ausgelöst wurden, die Menschen, insbesondere die Ärmsten brutal treffen, weil dahinter eine bewusste Wahl seitens der herrschenden Klasse hinsichtlich der Verteilung der Ressourcen und dem Einsatz der wissenschaftlichen Forschung selbst steckt. Die Auffassung, dass die Modernisierung, die Entwicklung der Wissenschaften und der Technologie automatisch mit der Schädigung der Umwelt und einer stärkeren Ausbeutung des Menschen verbunden sind, muss kategorisch verworfen werden. Im Gegenteil, es gibt ein großes Potential zur Entwicklung der menschlichen Ressourcen, nicht nur auf der Ebene der Produktion von Gütern sondern – was am wichtigsten ist- hinsichtlich der Möglichkeiten anders zu produzieren, in Harmonie mit der Umwelt und dem Wohlergehen des Ökosystems, zu dem der Mensch gehört. Die Perspektive ist also nicht die einer Rückkehr in die Vergangenheit, weil es unmöglich ist, zu unserem Ursprung zurückzukehren, als die Umwelt noch mehr verschont war. Im Gegenteil, die Menschheit muss auf einem anderen Weg vorwärts gehen, den der Entwicklung, die wirklich in Harmonie mit dem Planeten Erde steht.
Ezechiele, 5. April 2009.
[1]Siehe den ersten Teil dieses Artikels "Die Welt am Vorabend einer Umweltkatastrophe", veröffentlicht in Internationale Revue Nr. 41.
[2]Siehe den ersten Teil dieser Serie in Internationale Revue Nr. 42.
[3]ebenda
[4]Im 20. Jahrhundert gab es eine wahre Explosion des Wachstums der Megacities. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es sechs Städte mit mehr als einem Millionen Einwohner; Mitte des 20. Jahrhunderts gab es nur vier Städte mit mehr als fünf Millionen Einwohnern. Vor dem 2. Weltkrieg gab es Megacities nur in den Industriestaaten. Heute befinden sich die meisten Megacities in den Ländern der Peripherie. In einigen Städten ist die Bevölkerung innerhalb von Jahrzehnten um das Zehnfache angestiegen. Gegenwärtig lebt die Hälfte der Erdbevölkerung in Städten, 2020 werden es zwei Drittel sein. Aber keine dieser Städte, in die jeden Tag mehr als 5.000 Zuwanderer strömen, ist in der Lage, solch einem unnatürlichen Bevölkerungswachstum Stand zu halten, so dass die Zuwanderer, die nicht in das soziale Netz der Stadt integriert werden können, die Vorstadtslums weiter anschwellen lassen, und fast immer fehlt es völlig an Dienstleistungen und adäquaten Infrastrukturen.
[5]"Hurrikan Katrina – der Kapitalismus ist verantwortlich für die gesellschaftliche Katastrophe", International Review Nr. 123,
[6]Tödliche Flutwelle in Südostasien: die wahre Katastrophe ist der Kapitalismus" Révolution Internationale, Nr. 353
[8]Bordiga, Führer der linken Strömung der Kommunistischen Partei Italiens, zu deren Gründung er 1921 wesentlich mit beitrug, und aus der er 1930 nach dem Prozess der Stalinisierung ausgeschlossen wurde, beteiligte sich aktiv an der Gründung der Internationalen Kommunistischen Partei 1945.
[9](Anonymes) Vorwort zu "Drammi gialli e sinistri della moderna decadenza sociale" von Amadeo Bordiga, Edition Iskra, Seiten 6, 7, 8 et 9. auf Französisch: Vorwort zu "Espèce humaine et Croûte terrestre“; Petite Bibliothèque Payot 1978, Préface, pages 7,9 et 10)
[10]Veröffentlicht in Battaglia Comunista n°23 1951 und auch in "Drammi gialli e sinistri della decadenza sociale", édition Iskra, Seite 19.
[11]ebenda
[12]A. Bordiga, Politica e ”costruzione”, veröffentlicht in Prometeo, serie II, n°3-4, 1952 und auch in "Drammi gialli e sinistri della decadenza sociale", edition Iskra, Seiten 62-63.
[13]Vorwort zu "Espèce Humaine et Croûte terrestre", op.cit. (Menschengattung und Erdkruste)
[14]Jens Hoyrup, Universität von Roskilde, Dänemark. "Mathematik und Krieg", Konferenz Palermo, 15. Mai 2003. Forschungshefte Didaktik, N°13, GRIM (Départment of mathematics, University of Palermo, Italy) http//math.unips.it/-grim/Horyup_mat_guerra_quad13.pdf.
[15]Annaratone, http//www.scienzaesperienza.it/news.php?/id=0057 [249]
[16]Angelo Baracca, "Fisica fondamentale, ricerca e realizzazione di nuove armi nucleari”.
Aktuelles und Laufendes:
- Umweltverschmutzung [143]
- Ökologie [250]
- Stadt Land [251]
- Bhopal [252]
- Umweltzerstörung [253]
- Mensch Natur [254]
- Kapitalismus Umweltzerstörung [255]
- Wasserknappheit [256]
- Wissenschaft Kapitalismus [257]
November 2009
- 788 reads
Der Kampf der Automobilarbeiter von Gurgaon
- 2655 reads
Am Abend des 18.Oktobers 2009, einem Sonntag, versuchten die Beschäftigten von RICCO Auto, Gurgaon, die sich seit dem 3. Oktober im Streik befanden, Streikbrecher aufzuhalten. Der Wachdienst des Betriebs und Streikbrecher, meistens Kriminelle, die zur Einschüchterung der Arbeiter rekrutiert worden waren, reagierten mit einem gewaltsamen Angriff auf die streikenden Arbeiter. Die Polizei, die seit Streikbeginn an den Fabriktoren zur Einschüchterung der Streikenden aufmarschiert war, eröffnete das Feuer auf die Arbeiter. Ein Arbeiter wurde erschossen und 40 weitere verletzt.
Diese gewaltsame Repression löste eine Welle von Empörung unter den Arbeitern im Industriegürtel von Gurgaon-Manesar aus, von denen sich 30.000 Beschäftigte in den letzten Monaten gegen die Arbeitgeber in mehreren Werken zur Wehr gesetzt hatten. Aber auch Arbeiter in anderen Betrieben reagierten empört.
Am Abend des 18.Oktobers 2009, einem Sonntag, versuchten die Beschäftigten von RICCO Auto, Gurgaon, die sich seit dem 3. Oktober im Streik befanden, Streikbrecher aufzuhalten. Der Wachdienst des Betriebs und Streikbrecher, meistens Kriminelle, die zur Einschüchterung der Arbeiter rekrutiert worden waren, reagierten mit einem gewaltsamen Angriff auf die streikenden Arbeiter. Die Polizei, die seit Streikbeginn an den Fabriktoren zur Einschüchterung der Streikenden aufmarschiert war, eröffnete das Feuer auf die Arbeiter. Ein Arbeiter wurde erschossen und 40 weitere verletzt.
Diese gewaltsame Repression löste eine Welle von Empörung unter den Arbeitern im Industriegürtel von Gurgaon-Manesar aus, von denen sich 30.000 Beschäftigte in den letzten Monaten gegen die Arbeitgeber in mehreren Werken zur Wehr gesetzt hatten. Aber auch Arbeiter in anderen Betrieben reagierten empört.
Diese Wut äußerte sich darin, dass die beiden Zwillingsstädte Gurgaon und Manesar am 20. Oktober 2009 am ersten Regelarbeitstag nach der Tötung des Arbeiters bei RICCO Auto die Arbeit niederlegten. Obgleich die Gewerkschaften zu dem Streik aufgerufen hatten, gingen Massen von Arbeitern aus den Betrieben, in denen sich die Arbeiter zuvor schon zur Wehr gesetzt hatten, auf die Straße und riefen andere Beschäftigte auf, die Arbeit niederzulegen. Vom frühen Dienstagmorgen an legten die Arbeiter von RICCO Auto und Sunbeam Casting mit ihren Protesten los. Die Autobahn 8 wurde blockiert. Ihnen schlossen sich Unmengen von Arbeitern aus anderen Betrieben an wie Sona Koyo Steering Systems, TI Metals, Lumax Industries, Bajaj und Hero Honda Motors Ltd.. Die Stadtverwaltung erklärte offiziell, ca. 100.000 Beschäftigte aus 70 Autozulieferbetrieben in Gurgaon-Manesar hätten sich an dem Tag in Streik begeben.
Obgleich die Arbeiter der meisten Betriebe am 21. Oktober die Arbeit wieder aufnahmen und der Kampf sich nicht ausdehnte, stellen diese Ereignisse einen wichtigen Schritt voran bei den Arbeiterkämpfen in Indien dar. Sie sind das Ergebnis der Intensivierung des Klassenkampfes in verschiedenen Teilen Indiens. So waren in Gurgaon-Manesar im Juli 2005 Arbeiter der Honda Motorcycles Werke mit dem Staat zusammengeprallt. Seitdem hat eine Reihe von Kämpfen die Entschlossenheit der Arbeiter bekräftigt, sich gegen die Unternehmer zu wehren – dabei sind immer mehr Kämpfe gleichzeitig ausgebrochen.
Bittere Ernte des Wirtschaftsbooms
Während all der “Boom-Jahre” bis 2007, als die indische Wirtschaft beträchtlich expandierte, hat sich die Lage der Arbeiterklasse unaufhörlich verschlechtert. Offensichtlichstes Merkmal dieser Verschlechterung war der Verlust von Arbeitsplätzen. Trotz der Expansion der Wirtschaft während der „Boomjahre“ haben die Unternehmer ganz massiv Stammbelegschaften reduziert und sie durch viel schlechter bezahlte prekär Beschäftigte ersetzt, die zudem keine Sozialleistungen erhalten. Betriebe wie Hero Honda, Maruti und Hyundai, deren Produktion in diesen Boomjahren um ein mehrfaches zunahm (so vervielfachte sich die Produktion bei Hero Honda von 200.000 auf mehr als 3.6 Millionen), haben ständig Arbeitsplätze abgebaut. Gleichzeitig wurden Teilzeitbeschäftigte eingestellt. So verlief es bei allen Firmen in Indien. Die Betriebe der Automobilindustrie und andere Autoteilelieferanten in Indien, die alle einem mörderischen Konkurrenzkampf ausgesetzt sind, standen an vorderster Front dieser Angriffe gegen die Arbeiter. Aber in den ersten Jahren, vor allem in den ersten Jahren dieses Jahrzehnts, fanden die Arbeiter es schwierig, sich gegen diese Angriffe zu wehren. Unaufhörliche Angriffe seitens der Arbeitgeber und das Unvermögen sich entsprechend zu wehren waren das Merkmal der bitteren Lage der Arbeiterklasse auch in anderen Ländern.
Mit dem Beginn der wirtschaftlichen Talfahrt 2007 hat sich die Lage noch zugespitzt. In allen Bereichen wurden massiv Arbeitsplätze abgebaut, Löhne und Sozialleistungen gekürzt. Gleichzeitig zogen die Preise der wichtigsten Konsumgüter stark an. Die Preise von Grundnahrungsmitteln wie Gemüse, Hülsenfrüchte und anderen Lebensmittel haben sich mehr als verdoppelt. Dies war keine jahreszeitlich bedingte Erscheinung, sondern dies hat sich nun schon mehr als zwei Jahre hingezogen. Nach dem Einfrieren der Löhne und dem Anstieg der Preise sind die Lebensbedingungen der Beschäftigten nur immer prekärer und verzweifelter geworden.
Auch wenn die Unternehmer heute von einem Ende der Rezession und einem erneuten großen Wachstum der indischen Wirtschaft reden, hat sich die Lage der Arbeiter nicht verbessert. Die Prekarisierung der Arbeitsbedingungen dauert an, die Löhne sind weiter eingefroren.
Die Entfaltung des Klassenkampfes
Aber in den letzten Jahren hat die Entschlossenheit der Arbeiter, sich zu wehren, zugenommen. Die Einsicht breitet sich stärker aus, wenn man sich nicht zusammenschließt und sich wehrt, werden die Unternehmer immer mehr Druck ausüben. Diese Erkenntnis äußert sich in einer verstärkten Kampfbereitschaft, die in den letzten Jahren deutlicher Gestalt angenommen hat. Diese Entwicklung ist auch in anderen Ländern erkennbar, wie zum Beispiel die zweimonatige Fabrikbesetzung in Ssangyong, dem fünft größten Autohersteller in Korea im Juli 2009, die Besetzung des Visteon Werkes im April 2009 und Vestas Windsystems im Juli 2009 in Großbritannien, oder der Postbeschäftigtenstreik im Oktober 2009 ebenso in Großbritannien. (…)
Die Arbeiterklasse in Indien tritt häufiger in den Kampf
Gegenüber der Krise und den Angriffen der Bosse haben sich die Arbeiter stärker zur Wehr gesetzt. Es gab zum Beispiel im öffentlichen Dienst wichtige Streiks: Die Angestellten der Banken streiken, ein landesweiter Streik der Beschäftigten der Ölförderung im Januar 2009, der Streik der Air India-Piloten, ein Streik von (250.000) Staatsbediensteten in West-Bengal, ein Streik der Regierungsbeschäftigten im Januar 2009 in Bihar. Einige dieser Konflikte waren harte Auseinandersetzungen, bei denen der Staat brutal zuschlagen und die Arbeiter niederschlagen wollte. Das war zum Beispiel beim Kampf der Ölarbeiter der Fall, als der Staat auf Sondergesetze zurückgriff, um die Beschäftigten auf die Knie zu zwingen und sie mit Repressionsmaßnahmen bestrafte. Auch Regierungsbeschäftigte in Bihar bekamen die harte Hand des Staates zu spüren, der den Beschäftigten eine Lehre erteilen wollte. Gegenüber den Ölbeschäftigten musste die Regierung nachgeben, da die Gefahr der Ausdehnung der Streiks auf andere staatliche Beschäftigte die Regierung von einem härteren Vorgehen abhielt.
Wie ihre Kolleg/Innen im öffentlichen Dienst haben auch Beschäftigte aus anderen Branchen gekämpft. Einer der massivsten und radikalsten Kämpfe war der der Beschäftigten in der Diamentenindustrie 2008 in Gujarat. Die Mehrheit der Beschäftigten der Diamentenindustrie arbeitet in kleinen Betrieben, in denen die Gewerkschaften nicht so die Oberhand haben. Die Streiks brachen dort aus und dehnten sich schnell als Massenrevolte auf mehrere Städte aus - Surat, Ahmedabad, Rajkot, Amerli usw. – und der Staat ergriff polizeiliche Repressionsmaßnahmen in all diesen Städten.
Zudem gab es in allen größeren Automobilzentren Indiens - Tamilnadu, Maharashtra, und Gurgaon-Manesar wiederholte und hartnäckige Versuche seitens der Beschäftigten, um für ihre Arbeitsplätze und gegen die Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen zu kämpfen.
Arbeiter im zweitgrößten Automobilwerk in Indien, Hyundai Motor in Chennai, traten mehrfach im April, Mai und Juni 2009 für höhere Löhne in den Streik. Seit langem schon versuchen die Unternehmer die Kämpfe der Arbeiter zu unterdrücken; oft haben sie z.B. mit Werksschließungen gedroht. In der Nähe von Coimbatore haben Beschäftigte des Automobilzulieferers Pricol Indien sich mehr als zwei Jahre lang gegen die Entlassungspläne ihres Arbeitgebers und den Abbau der Stammbelegschaft und deren Ersetzung durch Beschäftigte mit Zeitverträgen usw. gewehrt. Der Kampf nahm jüngst einen gewaltsamen Verlauf, als das Management 52 Beschäftigte der Stammbelegschaft feuern wollte und beschloss, sie im September 2009 durch Zeitarbeiter zu ersetzen. Bei darauf folgenden gewaltsamen Auseinandersetzungen wurde ein leitender Manager von Pricol am 22. September 2009 getötet. Beschäftigte der MRF Reifenfabrik und Nokia Werke in Namilnadu kämpften zur gleichen Zeit.
In Maharashtra traten Beschäftigte von Mahindra und in Nasik für höhere Löhne im Mai 2009 in den Ausstand. Und bei den Cummins Werken in Puna und dem Autoteilehersteller Bosch kam es ebenfalls vom 15.-25. September zu Arbeitsniederlegungen, um der Forderung nach höheren Löhnen Nachdruck zu verleihen und gegen Prekarisierung zu protestieren.
Gleichzeitig von Kämpfen und die Entwicklung der Klassensolidarität
Heute beobachten wir, dass mehr und mehr Arbeiter bereit sind den Kampf gegen die Angriffe des Kapitals aufzunehmen. Mit einer Häufung der Kämpfe in mehreren Teilen Indiens, nimmt auch die Gleichzeitigkeit von Kämpfen in der gleichen Region zu. Dies bereitet die Möglichkeit vor, die Kämpfe zu verbinden und sie auszudehnen. Die massiven Streiks der Beschäftigten der Diamantenindustrie in Gujarat, die in mehreren Städten gleichzeitig spontan in den Ausstand traten, belegt dies. Auch Streiks der Beschäftigten der Autoindustrie in Tamilnadu und Puna und Nasik, die in mehreren Gegenden gleichzeitig in den Streik traten, gehen in die gleiche Richtung. In anderen Fällen spürte die herrschende Klasse diese Gefahr und nahm Repressionsmaßnahmen zurück. Diese Gleichzeitigkeit ist das Ergebnis einer Reihe von gleichartigen Angriffen gegen alle Beschäftigten heute.
Vor den jüngsten Kämpfen hatten schon Beschäftigte in einer Reihe von Werken in Gurgaon-Manesar die Auseinandersetzung mit den Arbeitgebern aufgenommen. Bei Hondo Motorcycles ist die Lage seit Monaten sehr angespannt, nachdem Arbeiter mehrfach für höhere Löhne und gegen die Einführung von mehr Zeitverträgen protestiert haben. Dem Management zufolge ist dadurch die Produktion um die Hälfte gesunken; ein neues Fertigungsband konnte nicht in Betrieb genommen werden. Um die Arbeiter einzuschüchtern drohte das Honda Motorcycles Management am 10. Oktober mit der Schließung des Werkes in Indien oder das Werk in andere Teile des Landes zu verlagern. 2500 Beschäftigte von RICO Autowerken protestierten Ende September gegen die Entlassung von 16 Kollegen und für bessere Löhne. Am 3. Oktober traten sie in den Ausstand. Obgleich es noch nicht zu Arbeitsniederlegungen kam, häufen sich die Proteste von 25.000 Beschäftigten bei TI Metals, Microtech, FCC Rico, Satyam Auto und mehreren anderen Betrieben seit September, bei denen vor allem für höhere Löhne protestiert wird.
Business Line berichtete am 2. Oktober 2009: “Nachdem mittlerweile 25.000-30.000 Beschäftigte der Zulieferindustrie in dem Industriegürtel von Gurgaon-Manesar seit sechs Tagen für Unruhe sorgen, stehen die großen Automobilhersteller, die von diesen Zulieferern abhängig sind, vor schwierigen Zeiten.“ Und die Sorge der Unternehmer aufgreifend schrieb die Economic Times [of India] am 11. Oktober 2009: „Die wiederholt auftretenden Arbeitskämpfe im Gurgaon und Manesar-Gürtel sind ein Grund zur Sorge für die gesamte Industrie. Die fortdauernden Arbeiterproteste bei einigen Zulieferern haben schon große Autohersteller wie Honda und Maruti Suzuki erfasst.“
Die Tatsache, dass Arbeiter aus mehreren Firmen in den Streik getreten waren und gleichzeitig mehrere Tausend Beschäftigte aus anderen Betrieben ebenfalls streikten, bietet die Möglichkeit der Ausdehnung und Vereinigung dieser Kämpfe, denn dies ist der einzige Hebel, um sich gegen die Angriffe der Unternehmer zu wehren und diese zurückzudrängen. Davor fürchten sich die Herrschenden und die Gewerkschaften wollen so etwas unbedingt vermeiden. Bei den Kämpfen in Gurgaon, als sich die Wut der Arbeiter über die Erschießung eines Kollegen bei RICCO entlud, bestand die Rolle der Gewerkschaften darin, den Kampf in eine Sackgasse zu führen und die Tendenz zur Ausdehnung und Vereinigung zu blockieren. Durch den Aufruf zu eintägigen Aktionen wollen sich die Gewerkschaften dem Bestreben zusammenzukommen und Klassensolidarität zu entfalten, entgegenstellen. Ungeachtet dessen war der Streik vom 20. Oktober eine Demonstration der Klassensolidarität von nahezu 100.000 Beschäftigten. Er verdeutlichte deren Entschlossenheit, sich den Angriffen des Kapitals entgegenzustellen.
Gleichzeitig haben bei den Kämpfen in Gurgaon und bei Hyundai, Pricol, M & M und in anderen Auseinandersetzungen um höhere Löhne und gegen Arbeitsplatzabbau die Gewerkschaften auch versucht, diese in Sackgassen zu drängen und sie zu Kämpfen für Gewerkschaftsrechte umzumünzen.
Ohne Zweifel gibt es eine starke Dynamik zur Entwicklung des Klassenkampfes, seiner Ausdehnung und Entwicklung der Klassensolidarität. Aber um diese Dynamik umzusetzen, ist es wichtig, dass die Arbeiter die Tricks der Gewerkschaften durchschauen und den Kampf in die eigenen Hände nehmen. Die Lage entwickelt sich in eine Richtung, in der es für Revolutionäre wichtig ist, in dieser Dynamik einzugreifen, damit sie mit dazu beitragen können, dass die kämpfenden Arbeiter das Potenzial und die Stärken dieser Kämpfe sowie die gewerkschaftlichen Fallen erkennen. AM, 27.10.2009
Aktuelles und Laufendes:
- Streiks Indien [258]
- Gurgaon [259]
- Manesar [260]
- indischer Wirtschaftsboom [261]
Honduras – Das Proletariat darf bei der Auseinandersetzung zwischen Banditen keine Seite unterstützen
- 2631 reads
Wir veröffentlichen nachfolgend eine Stellungnahme unserer Sektion in Venezuela, die sie kurze Zeit nach dem Militärputsch in Honduras im Sommer 2009 verfasste.
Auch wenn die Ereignisse mittlerweile aus dem Fokus der Medien verschwunden und enige Monate vergangen sind, ist es wichtig, diese in einen größeren Rahmen zu stellen und zu analysieren. Unsere Genossen in Venezuela gehen dabei sowohl auf die imperialistischen Ambitionen der venezolanischen Bourgeoisie, die angeschlagene Vormachtstellung der USA sowie auf Bestrebungen anderer Länder der Region, z.B. Brasilien ein, die Schwächung der USA zu ihren Gunsten auszunutzen. Während bislang aus erklärlichen Gründen die imperialistischen Konflikte im Mittleren Osten im Vordergrund standen, müssen wir die Lage in anderen Teilen der Welt jedoch auch verfolgen. Vor allem auf unserer spanischen Webseite bieten wir mehr Hintergrundmaterial zur Entwicklung in Südamerika und die dadurch entstehenden Debatten.
Wir veröffentlichen nachfolgend eine Stellungnahme unserer Sektion in Venezuela, die sie kurze Zeit nach dem Militärputsch in Honduras im Sommer 2009 verfasste.
Auch wenn die Ereignisse mittlerweile aus dem Fokus der Medien verschwunden und enige Monate vergangen sind, ist es wichtig, diese in einen größeren Rahmen zu stellen und zu analysieren. Unsere Genossen in Venezuela gehen dabei sowohl auf die imperialistischen Ambitionen der venezolanischen Bourgeoisie, die angeschlagene Vormachtstellung der USA sowie auf Bestrebungen anderer Länder der Region, z.B. Brasilien ein, die Schwächung der USA zu ihren Gunsten auszunutzen. Während bislang aus erklärlichen Gründen die imperialistischen Konflikte im Mittleren Osten im Vordergrund standen, müssen wir die Lage in anderen Teilen der Welt jedoch auch verfolgen. Vor allem auf unserer spanischen Webseite bieten wir mehr Hintergrundmaterial zur Entwicklung in Südamerika und die dadurch entstehenden Debatten.
Honduras – Das Proletariat darf bei der Auseinandersetzung zwischen Banditen keine Seite unterstützen
Unsere Sektion in Venezuela, Internacionalismo, hat zu den Auseinandersetzungen in Honduras folgende Analyse erstellt. Die politische Krise, die mit dem Putsch gegen den Präsidenten Manuel Zelaya am 28. Juni ausgelöst wurde, stellt nicht einfach einen “weiteren Putsch” in dieser armen und kleinen ‘Bananenrepublik’ mit 7.5 Millionen Einwohnern dar. Diese Ereignisse sind von großer geopolitischer Bedeutung, aber sie haben auch wichtige Folgen für den Klassenkampf.
Die Tatsachen
Zelaya, Unternehmer und Angehöriger der honduranischen Oligarchie begann seine Amtszeit Anfang 2006 als eine Führungsfigur der Liberalen Partei Honduras. Seit 2007 näherte er sich der Politik Chávez des ”Sozialismus des 21. Jahrhunderts”. Im August 2008 gelang es ihm mit Unterstützung seiner Partei, den Kongress dazu zu bewegen, dass sich Honduras der ALBA (Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe) anschließt, ein von der Regierung Chávez geschaffener Mechanismus, um sich dem Einfluss der von den USA unterstützten ALCA (Amerikanische Freihandelszone) entgegenzustellen. Dieser Schritt, welcher von politischen Kreisen und Unternehmern kritisiert wurde, ermöglichte es dem honduranischen Staat seine Ölrechnung zu begleichen, die in der Wirtschaft des Landes ein großes Gewicht ausmacht.
Mit dem Beitritt zum ALBA erhielt es einen Kredit von 400 Millionen Dollar für den Kauf von Energie aus Venezuela, welche zu vorteilhaften Bedingungen bezahlt werden konnte. Es handelte sich um eine wichtige “Hilfe” für ein Land mit einem BIP von 10.800 Millionen Dollar (Angaben des CEPAL für 2006). Die honduranischen Energieeinfuhren machen ca. 30% des BIP aus (gleiche Quelle). Aber der “Sozialismus des 21. Jahrhunderts” ist kein einfaches Handelsprodukt. Dieser fordert nämlich, dass die Regierungen, die ihn übernehmen wollen, eine Reihe von populistischen Maßnahmen linksradikaler Couleur ergreifen; dass die Exekutive offen die Staatsinstitutionen und die öffentliche Hand kontrolliert, sowie ein Frontalangriff gegen die alten nationalen “Oligarchien” gehört dazu. Deshalb schlug Zelaya innerhalb weniger Monate eine politische Kehrtwende um 180° ein; von einem Rechtsliberalen wurde er zu einem Linken, der die Armen und den “Sozialismus” verteidigte. In Anbetracht der bevorstehenden Wahlen im November 2008 erhöhte Zelaya von Februar 2008 an den Druck auf die staatlichen Institutionen, um seine Wiederwahl zu begünstigen. Dies führte zu Konflikten sowohl zwischen der Exekutive und anderen staatlichen Kräften als auch mit seiner eigenen Partei. Letzten Mai übte er mit Hilfe von gewerkschaftlichen und “Volksorganisationen” Druck auf das Militär aus, um einen Plebiszit zur Änderung der Verfassung mit dem Ziel seiner Wiederwahl durchzusetzen. Dieses Vorgehen wurde von der Armeeführung des Landes verworfen.
Am 24. Juni 2008 setzte Zelaya den Vorsitzenden des Gemeinsamen Stabschefs ab, welcher darauf hin sofort wieder vom Obersten Gerichtshof eingesetzt wurde. Dies diente als Auslöser für den Staatsstreich am 28. Juni 2008. Dieser Tag war von der Exekutive als der Tag der Volksabstimmung geplant gewesen. An jenem Tag wurde Zelaya vom Militär gezwungen, “im Schlafanzug und barfuß” aus Tegucigalpa (Hauptstadt Honduras) nach San José (Costa Rica) auszureisen. Mit der Unterstützung des Militärs und dem Obersten Gerichtshof ernannte der Kongress Roberto Micheletti (Vorsitzender des Kongresses) als neuen Präsidenten.
Unsere Analyse
Es ist offensichtlich, an der Wurzel der politischen Krise Honduras stecken die imperialistischen Ambitionen Venezuelas in der Region. In dem Maße wie sich der Chavismus konsolidiert hat, versucht die venezolanische Bourgeoisie ihr neues geopolitisches Interesse, Venezuela zu einer Regionalmacht zu erheben, zu verfolgen. Zu diesem Zweck benutzt es das Projekt des “Sozialismus des 21. Jahrhunderts”, dessen gesellschaftliche Stütze vor allem die ärmsten Schichten des Landes sind, und das die Ölvorkommen und die Öleinnahmen als eine Waffe zur Überzeugung und als Zwang benutzt. Die zunehmende Verarmung, der Zerfall der alten führenden Schichten und die geopolitische Schwächung der USA auf der Welt haben es der venezolanischen Bourgeoisie ermöglicht, schrittweise ihre Pläne in mehreren Ländern der Region voranzutreiben: Bolivien, Ecuador, Nicaragua, Honduras und in einigen Ländern der Karibik.
Das Projekt Chávez erfordert aufgrund seiner populistischen Eigenschaften und seines ‘radikalen’ Antiamerikanismus die totalitäre Kontrolle der staatlichen Institutionen. Ebenso schafft er eine politische Polarisierung zwischen “Reichen und Armen”, “Oligarchen gegen das Volk” usw., dadurch wird es zu einer ständigen Quelle der Regierungsunfähigkeit für das eigene nationale Kapital. Seine Umsetzung erfordert ebenfalls Verfassungsänderungen durch die Schaffung von verfassungsgebenden Versammlungen, welche ihr eine legale Basis für die notwendigen Änderungen verschaffen, um die neuen ‚sozialistischen’ Eliten an der Macht zu festigen und die Wiederwahl von Präsidenten zu befürworten. Dieser Maßnahmenkatalog, welche der Chavismus anwendet, ist hinreichend bei den Bürgerlichen der Region bekannt. Honduras ist ein kostbares geostrategisches Ziel des Chavismus. Damit würde Venezuela die Errichtung eines Brückenkopfes durch die Hafenstadt Cortés an der zentralamerikanischen Atlantikküste gelingen. Dieser Hafen dient auch dem Außenhandel El Salvadors und Nicaraguas. Somit würde Venezuela über einen “Landweg” verfügen, der den Atlantik mit dem Pazifik über Nicaragua verbindet. Wenn Nicaragua und Honduras unter Venezuelas Kontrolle stünden, würde es noch mehr Einfluss in El Salvador gewinnen, womit der von den USA und Mexiko vorgeschlagene Plan Puebla Panamá auf mehr Schwierigkeiten stoßen würde.
Andererseits zählt Honduras auf die ”natürlichen” Bedingungen für die Entwicklung des linkspopulären Projektes Chávez, denn es ist das drittärmste Land Amerikas nach Haiti und Bolivien. Die Masse der Verarmten, deren Zahl durch die Verschärfung der Krise immer mehr zunimmt, wird am meisten durch die falschen Hoffnungen getäuscht, die Armut überwinden zu können. Darauf baut das Arzneibuch des ”Sozialismus im 21. Jahrhundert”. Die Botschaft Chávez richtet sich an diese Massen. Dazu ist eine permanente Mobilisierung notwendig, mit Unterstützung der Gewerkschaften, der Linksparteien, der extremen Linken, der Bauernorganisationen, der Einheimischen usw. Der Chavismus, der selbst ein Ergebnis des Fäulnisprozesses der Herrschenden Venezuelas und der Welt ist, schlachtet die Erscheinungen des Zerfalls innerhalb der Herrschenden der Region aus und verschärft sie. Aufgrund der Notwendigkeit der Polarisierung der Zusammenstöße zwischen den bürgerlichen Fraktionen wird der Chavismus zu einem Faktor der Unregierbarkeit, welche wiederum eine Eigendynamik des Zerfalls entfaltet. Die jüngste Krise in Honduras stellt eine Zuspitzung der Lage in den ”Bananenrepubliken” Mittelamerikas dar, die seit den 1980er Jahren nicht mehr so tief in einer Krise versunken waren, als damals die Konflikte in Guatemala, El Salvador und Nicaragua fast eine halbe Million Tote und Millionen Vertriebener hinterließen.
Unglaubliche Heuchelei
Schon kurze Zeit vor dem Staatsstreich hatte Chávez seine geopolitische Maschinerie in Gang gesetzt ; er warnte die « befreundeten » Präsidenten und prangerte die « Gorilla-Militärs » an. Sobald der Putsch vorüber war, rief er ein Dringlichkeitstreffen der ALBA-Mitgliedsstaaten in Nicaragua ein, auf dem er ankündigte, die Lieferung von Öl an Honduras werde gestoppt. Auch drohte er mit der Entsendung von Truppen, falls die venezuelanische Botschaft in Honduras angegriffen werden sollte. Ebenso stellte er Zelaya Mittel des venezuelanischen Staates zur Verfügung : der Außenminister ist quasi zu einem persönlichen Assistenten des Präsidenten geworden, nachdem er diesem anbot, ihn auf dessen Auslandsreisen zu begleiten ; die staatlichen Medien, hauptsächlich der internationale Fernsehsender TV Telesur, überschütten uns mit Informationen über Zelaya. Dabei wird er als Opfer und als großer Menschenfreund und Verteidiger der Armen dargestellt. Die Rede Zelayas vor der UNO wurde im venezolanischen Radio und Fernsehen live übertragen. Chávez ruft unaufhörlich die « Völker Amerikas » zur Verteidigung der Demokratie auf, die von den « nach Staatsstreichen dürstenden militärischen Gorrillas » bedroht werden. Vielleicht will er damit vergessen machen, dass er selbst 1992 in Venezuela einen Staatsstreich gegen den sozialdemokratischen Präsidenten Andrés Pérez anführte. Dabei sind es gerade diese « militärischen Gorrillas », die Polizei des von Chávez angeführten Staates und dessen Schocktruppen, die die Repression ausüben. Dies richtet sich nicht nur gegen Oppositionelle, die gegen das Regime demonstrieren, sondern auch gegen die Arbeiter in Venezuela, wie Internacionalismo schon öfters angeprangert hat (siehe « El Estado "socialista" de Chavez nuevamente reprime y asesina proletarios, https://es.internationalism.org/node/2589 [262])
Aber die ganze „internationale Gemeinschaft“ verhält sich so unglaublich heuchlerich. Die OAS (Organisation amerikanischer Staaten) , die UNO, die Europäische Union und viele andere Länder haben den Putsch verurteilt und die Wiedereinsetzung Zelayas gefordert. Viele haben ihre Botschafter aus Honduras abgezogen. Aber all das sind nur formalistische Schritte; sie sollen Sand in die Augen streuen und das schlechte Ansehen der bürgerlichen Demokratie und all der Organisationen, die immer mehr an Glaubwürdigkeit verlieren, aufmöbeln.
Wie kann man das Verhalten der USA gegenüber der Krise erklären?
Sehr zur Überraschung der sogenannten „Linken“ und der „Extremen Linken“ haben die USA ebenso den Putsch veurteilt und die Rückkehr Zelayas verlangt. Den Aussagen von Hilary Clinton, der US-Außenministerin, haben die US-Botschaft in Honduras und Tom Shannon, Unterstaatssekretär im Außenministerium eine aktive Rolle in den Monaten vor dem Putsch gespielt, um eine Krise zu vermeiden. Die Frage steht im Raum, ob den USA die Lage entglitten ist? Ist die US-Diplomatie derart geschwächt nach der Regierungszeit von Bush?
Wir können die Möglichkeit nicht ausschließen, dass die USA tatsächlich die verschiedenen, im Clinch liegenden Fraktionen der honduranischen Bourgeoisie nicht nicht im Griff haben. Dies wäre ein Anzeichen für den Grad des Zerfalls der Bürgerlichen und der geopolitischen Schwächen der USA in ihrem „Hinterhof“. Für die USA ist es schwierig, sich den Auswirkungen des linken Neopopulismus seitens der Regierungen entgegenzustellen, deren Präsidenten auf demokratische Art gewählt wurden (in vielen Fällen durch eine überwältigende Mehrheit),. Aber sobald diese Leute das Präsidentenamt übernommen haben, übernehmen sie die Kontrolle im Staat und treten als wahre Diktatoren auf mit einem demokratischen make-up. Aber wir meinen, dass diese Vermutung falsch ist. Mit der Verurteilung des Putsches und der Forderung nach der Wiedereinsetzung Zelayas benutzen die USA die Krise in Honduras, um zu versuchen, ihr Ansehen in der Region aufzupolieren, das unter Bush ziemlich ramponiert wurde. Wenn Obama so wie Bush gehandelt hätte (als dieser zum Beispiel den versuchten Staatsstreich gegen Chávez im Apirl 2002 unterstützte), würde damit der Antiamerikanismus in der Region weiter angefacht und die Strategie der diplomatischen Öffnung der neuen Administration unter Obama geschwächt.
Es ist nicht auszuschließen, dass die USA zugelassen haben, dass die Krise in Honduras „ihren Lauf“ nimmt, und die USA die Krise zur Schwächung des Chavismus in der Region ausnutzen wollen. Die Vorgehensweise der USA zwingt Chávez , „die Suppe auszulöffeln“, um seinen Zögling Zelaya zu stützen. Auch können die USA somit darauf hoffen, dass die brandstiftende Rolle von Chávez in der honduarnischen Krise sich entblößt.
Andererseits wird somit der OAS und anderen Führern in der Region ermöglicht, nach einer Krisenlösung zu suchen, bei der die USA ein weiterer Beteiligter sein würden. So könnte die “amerikanische Gemeinschaft” als Helfer zur Überwindung der Krise auftreten, während es langsam immer deutlicher wird, dass Chávez und Zelaya die Verursacher dieser Krise sind. Die Verwerfung der Entscheidung der OAS, Zelaya als gewählten Präsidenten zu betrachten, die Maßnahmen der Micheletti-Regierung am 5.Juli, die Landung des aus Washington kommenden venezolanischen Flugzeuges mit Zelaya an Bord zu verhindern, haben die Krise nur noch weiter verschärft und Chávez geschädigt, der dahinter ein Drahtziehen des “Yankee-Imperialismus” sah und von Obama, der “Opfer dieses Imperialismus” sei, forderte, dass dieser viel energischer in Honduras eingreife.
Zweifelsohne ist die Lage für die USA sehr kompliziert. Einerseits wollen sie Chávez und seinen Nachläufern eine Lehre erteilen; andererseits zwingen sich den USA andere geopolitische Prioritäten auf – wie Afghanistan, die Krise mit Nordkorea usw. Darüber hinaus kann der Fäulnisprozess der honduranischen Bourgeoisie wie der Bourgeoisie der ganzen Region eine unkontrollierbare Lage hervorrufen. Wir haben soeben erfahren, dass Zelaya die Vermittlung auf Bitten der US-Außenministerin H. Clinton durch den Präsidenten Costa Ricas Oscar Arias angenommen habe. Damit wird die zentrale Rolle der USA in dieser Krise ersichtlich.
Einige Überlegungen zur Geopolitik in der Region
Die Krise in Honduras ist von größerem Ausmaß als die jüngste Krise zwischen Kolumbien, Ecuador und Venezuela hinsichtlich der Frage des FARC, bei der ebenso die Regierung Chávez an herausragender Stelle mit beteiligt war. Nicaragua, das mit Chávez verbunden ist, steht in einem Konflikt mit Kolumbien hinsichtlich des Archipels St. Andrés in der Karibik. Bei diesen Konflikten war immer die Rede von Mobilisierung von Truppen. Auch Venezuela setzte an der kolumbianischen Grenze seine Truppen in Marsch, als der Konflikt mit Ecuador losbrach. Obgleich diese Mobilisierungen das Ziel verfolgen, einen möglichst großen Medienwirbel zu verursachen, um die Arbeiterklasse und die Bevölkerung insgesamt abzulenken, benutzt die herrschende Klasse auf dem Hintergrund des Versinkens in der Krise und ihrem Zerfall eine immer kriegerische Sprache und immer mehr militärische Mittel. So ist der Einfluss Chávez und seiner Anhänger bei den letzten Krisen und Zusammenstößen in Bolivien zu spüren, bei den Wahlfälschungen, welche die Opposition in den letzten Wochen bei den Kommunalwahlen in Nicaragua anprangerte, und die peruanische Regierung verurteilte auch, dass sich Bolivien und Venezuela bei den Zusammenstößen von Bagua eingemischt hätten. Es wurden Bündnisse mit Staaten und Organisationen aufgebaut, welche sich durch ihren radikalen Antiamerikanismus auszeichnen: Iran, Nordkorea, Hamas usw. Andererseits hat sich die Lage in Venezuela im Lande ziemlich zugespitzt infolge rückläufiger Öleinkünfte (im Wesentlichen aufgrund der Geopolitik des venezolanischen Staates) aufgrund der Krise und der Entwicklung von Arbeiterkämpfen, welche die Regierung dazu zwingen, ein Klima starker Spannungen nach Innen und Außen aufrechtzuerhalten.
Die USA befinden sich im Nachteil, um Ordnung in ihrem Hinterhof herzustellen. Regionale Bourgeoisien wie die Mexikos, welche sich dem Chavismus und den politischen Krisen in ihrem natürlichen Einflussgebiet Zentralamerika entgegenstellen könnten, sind offenbar durch innere Krisen und die Auseinandersetzungen mit den Drogenhändlern beansprucht. Ein US-amerikanischer Senator meinte gar vor kurzem, es gebe keinen mexikanischen Staat mehr. Kolumbien, die US-Bastion in der Region, hat keine freie Hand, um der Offensive Chávez entgegenzutreten; stattdessen stehen Kolumbien und Venezuela in einem sehr zerbrechlichen Verhältnis zueinander. Brasilien, wiederum, das wirtschaftliche Interessen in Zentralamerika verfolgt (das Land hat viel Geld in den Anbau von Biokraftstoffen in der Region investiert), hat schon geopolitische Schritte eingeleitet, was zu einer Verstärkung seiner regionalen Vormachtstellung geführt hat. Scheinbar hat es genauso wenig wie die anderen Länder ein großes Interesse daran, eine von Chávez angestachelte Krise zu lösen. Die beiden treten als Rivalen in der Region auf. Vermutlich wird es Venezuela "im eigenen Saft schmoren lassen", obwohl es auch Anzeichen dafür gibt, für eine gewisse Stabilität in der Region sorgen zu wollen. Es handelt dabei als eine Macht, die sich ihren eigenen Freiraum in der Region verschaffen will; deshalb gerät es auch mit den USA aneinander. Die Perspektiven in der Region deuten klar auf mehr Konflikte hin; dies wiederum wird umfangreiche Kampagnen erforderlich machen um zu versuchen, die Arbeiterklasse dafür einzuspannen. Dabei wird es zu einer politischen Polarisierung um diese Fragen kommen. Diese Fragen müssen im internationalistischen Milieu vertieft werden.
Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Arbeiterklasse?
Zweifelsohne geht die herrschende Klasse aus dieser Krise verstärkt gegenüber der Arbeiterklasse hervor. Gleich ob Zelaya zurückkehrt oder nicht, die politische Polarsierung in Honduras ist losgetreten worden und wird weiter an Schärfe zunehmen. All dies führt zu Spaltungen und Konfrontationen innerhalb der herrschenden Klasse selbst, wie wir es in Venezuela, Bolivien, Nicaragua und Ecuador sehen. Andererseits wird die herrschende Klasse die Lage ausschlachten, um die demokratische Mystifikation zu verstärken. Sie wird vorgeben, sie sei in der Lage sich selbst zu kritisieren, um die staatlichen Institutionen zu säubern. Deshalb wird der Wirbel um die anstehenden Wahlen die demokratische Mystifizierung verstärken.
Die Krise wird die Verarmung in einem der ärmsten Länder Zentralamerikas weiter verschärfen. Die Geldüberweisungen, die die Auslandshonduraner an ihre Familien leisten (ca. 25% des BIP) versiegen langsam. Der gesellschaftliche Zerfall, der Hunderttausende Jugendliche dazu verurteilt, vom Bandenwesen zu « leben », die Kriminalität und Drogen, wird sich aufgrund der Krise und des politischen Zerfalls in den Reihen der Herrschenden noch zuspitzen. Diese Masse Armer ist ein ausgezeichneter Nährboden für das Aufkommen neuer lokaler oder regionaler Gestalten wie Chávez, welche jeweils Hoffnung unter den Verarmten verbreiten, aber nie einen wirklichen Ausweg anbieten. Deshalb muss das honduranische Proletariat, aber auch das Proletariat in der Region und auf der Welt sowie das internationalistische Milieu jegliche Unterstützung irgendeines Flügels der nationalen oder regionalen Bourgeoisie verwerfen. Man muss die politische Polarisierung, die durch die Konflikte unter den Herrschenden gezeugt wird und schon viele Opfer gefordert hat, ablehnen. Die Auseinandersetzungen in Honduras zeigen, dass der Kapitalismus immer mehr verfault und Teile der Herrschenden (in einen Land oder zwischen kleinen, mittelstarken und größeren Ländern )immer mehr aneinander geraten. Diese Konflikte werden sich noch mehr zuspitzen. Ungeachtet seiner zahlenmäßigen Schwäche kann nur der Kampf der honduranischen Arbeiter auf ihrem Klassenterrain mit Unterstützung des Proletariats in der Region und auf der Welt sich dieser ganzen Barbarei entgegenstellen. Internacionalismo, 12.07.09
Aktuelles und Laufendes:
- Honduras [263]
- Zelaya [264]
- Chávez [265]
- Imperialismus in Südamerika [266]
- Mittelamerika [267]
- Lateinamerika [268]
- Imperialismus Brasilien [269]
Leute:
Mexiko: Die Liquidierung von Luz y Fuerza del Centro (LyFC) (staatlich kontrollierter Energielieferant Mexikos)
- 2717 reads
(Der nachfolgende Text wurde jüngst in Mexiko von drei Gruppen gemeinsam verfasst und als Flugblatt verteilt: Grupo Socialista libertario, Revolución Mundial Sektion in Mexico der Corriente Comunista Internacional (IKS) und Proyecto Anarquista Metropolitano)
Entlassungen und mehr Angriff: Wir müssen kämpfen, aber nicht unter den Gewerkschaften!
Am Samstagabend, den 10. Oktober, besetzte die Bundespolizei alle Stationen und Zentren von LyFC;[1] ihr Vorgehen entsprach dem Präsidentendekret, das die Auflösung des Unternehmens und die Entlassung von ca. 44.000 Beschäftigten angeordnet hatte. Dies hat eine große Verwirrung, gar einen Schock, Wut und ein Gefühl der Ohnmacht ausgelöst… und damit der Arbeiterklasse einen weiteren Schlag durch den Staat versetzt. Diese Situation verlangt notwendigerweise, dass nach Methoden und Reaktionen des Widerstandes gesucht wird, die von der Einheit unserer Klasse ausgehen.
Der Angriff ist gegen uns alle gerichtet, wir müssen uns gemeinsam wehren!
Die sich weiter ausdehnende Wirtschaftskrise, die die gesamte kapitalistische Welt erfasst hat, zwingt die Herrschenden in jedem Land dazu, immer brutalere Maßnahmen zu ergreifen, um die schlimmsten Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die Arbeiterklasse abzuwälzen. Durch diese „Anpassungsmaßnahmen“ verschlechtern sich die Lebensbedingungen der Beschäftigten, gleichzeitig erfolgen Angriffe auf ihre Renten, Löhne, Sozialleistungen usw. Weil die Kapitalisten versuchen, sich somit über Wasser zu halten, haben die Regierungen in allen Ländern den Weg eingeschlagen, „die Renten anzupassen“ (d.h. zu senken), die Lebensarbeitszeit zu erhöhen. Überall nimmt die Kaufkraft ab, die Arbeitsbedingungen werden immer unerträglicher, und die Arbeitslosigkeit ist schlussendlich der Gipfel unseres Alltagselends.
Was wir in Mexiko erleben, ist also keine „Folklore oder einen Fehltritt“ im Kapitalismus. Der Staat, der der Repräsentant der herrschenden bürgerlichen Klasse ist, hat zur Aufgabe, stets deren Interessen auszufechten. Dies trifft auf rechte wie linke Regierungen zu.
Die LyFC aufzulösen war schon lange ein Vorhaben der Herrschenden. Ihre Umsetzung war lediglich verzögert worden, weil sie (wer ist „sie“?) sich auf die gewerkschaftlichen Strukturen verlassen konnten (erinnert sei daran, dass die SME [mexikanische Gewerkschaft] seinerzeit den Präsidentschaftskandidaten Carlos Salinas unterstützte und dass dieser mit der Wiederherstellung des Betriebes liebäugelte).
Doch die Zuspitzung der Krise hat die Herrschenden vor eine neue Lage gestellt, in der es keinen Weg mehr zurück gibt; die katastrophale Lage lässt sich nicht mehr leugnen. Hinzu kommt die Notwendigkeit für das Kapital, die Gewerkschaften zu reformieren. Dabei will es keineswegs die Gewerkschaften zerstören, wie die Linke des Kapitals fälschlicherweise vorgibt. Die Arbeiter haben am eigenen Leib die Erpressungen und das Joch der Gewerkschaften erfahren und gesehen, wie diese die Unzufriedenheit im Griff zu halten und die Mobilisierungen zu sabotieren versuchen. Ungeachtet all der schönen Reden sind die Gewerkschaften Feinde der Arbeiterklasse, von denen die Herrschenden verlangen, dass sie besser und gewiefter die Ausbeutung der Arbeiterklasse durchsetzen und aufrechterhalten.
Erinnern wir uns an die gewaltige Kampagne der Diffamierung und Degradierung, die monatelang gegen die Beschäftigten der Elektrizitätswerke geführt wurde, welche in der Öffentlichkeit als „Privilegierte“, „Ineffiziente“ usw. dargestellt wurden, so dass es heute vielen Arbeitern schwerfällt zu begreifen, dass man diesem Angriff gegen die Elektriker entgegentreten muss (heute sind sie an der Reihe, morgen sind andere dran!).
Die Beschäftigten dürfen die Lügen der Herrschenden und ihrer treuen Diener nicht schlucken: Die Schließung von LyFC bringt dem „mexikanischen Volk“ keinen Nutzen; es handelt sich um einen Frontalangriff gegen die Arbeiterklasse insgesamt. Die neuen Arbeitsverträge (für die übrig gebliebenen Beschäftigten) werden sicherlich viel schlechter sein, während viele schlicht und ergreifend in die Arbeitslosigkeit abgeschoben werden.
Die Herrschenden und ihr politischer Apparat wollen uns die folgende Botschaft eintrichtern: So wie diese Beschäftigten nichts unternehmen konnten, obwohl sie eine „mächtige Gewerkschaft“ an ihrer Seite haben, müssen sich alle Beschäftigten den Bedürfnissen des Kapitals und seines Staates beugen und weitere Opfer hinnehmen. Aber die Arbeiterklasse darf ihren Kampf gegen den Kapitalismus nicht aufgeben. Die Angriffe von heute kündigen nur noch viel Schlimmeres an, falls wir uns nicht als Klasse zur Wehr setzen. In Anbetracht all der Angriffe, die in den letzten Jahren stattgefunden haben, und in Anbetracht der Preissteigerungen und der verstärkten Repression (mit der Verstärkung des Polizei- und Armeeapparates) ist es unabdingbar, dass alle Teile der Arbeiterklasse – Beschäftigte und Arbeitslose, Stammbelegschaften und Leiharbeiter oder Schwarzarbeiter - die Notwendigkeit ihres Zusammenschlusses anerkennen und darauf hinarbeiten. Dazu müssen wir unsere Feinde erkennen.
Gewerkschaften, Regierung und politische Parteien: Alle sind unsere Feinde!
Um diesen Angriff ohne große Mühe über die Bühne zu bringen, haben sich die Kräfte der herrschenden Klasse die Arbeit geteilt. Die einen provozierten mit dem sinnlosen Kampf zwischen verschiedenen Gewerkschaftsflügeln, die sich in Wahlen gegenüberstanden, eine Spaltung unter den Elektrikern. Andere wiederum stellten die Angriffe auf unsere Lebensbedingungen als einen „Angriff auf die Gewerkschaften und die demokratischen Freiheiten“ dar, und wiederum andere machten Stimmung gegen die Beschäftigten, die sie als „Privilegierte“ darstellten. Diese Vorgehensweise erleichterte schließlich ihr Vorhaben, das darin bestand, Arbeiter für eine „Verteidigung der Gewerkschaften“ zu mobilisieren oder für die „Verteidigung des Betriebes und der Volkswirtschaft“ einzuspannen. Solche Forderungen führen nämlich nur dazu, dass die verschiedenen Teile der Arbeiterklasse aus den Augen verlieren, ihre Forderungen als ausgebeutete Klasse zu stellen!
Nach diesem Schlag gegen die Arbeiter wird man jetzt den Überraschungseffekt auszunutzen versuchen und danach streben, die Niederlage und Demoralisierung noch zu verstärken. Die Gewerkschaft spielt dabei eine wirklich reaktionäre Rolle. Heute mit den Gewerkschaften zu kämpfen heißt daher, die Niederlage in Kauf zu nehmen, denn die Gewerkschaften haben zusammen mit dem Staat die Beschäftigten erst in diese Lage gedrängt. Sie werden jetzt die Beschäftigten nicht dazu ermuntern, sich zu wehren - im Gegenteil. Heute zum Beispiel verbreitet die Gewerkschaft SME den Aufruf, man solle eine „juristische Schlacht, vor den Gerichten“ durchführen. Damit werden aber die Beschäftigten erneut in eine Sackgasse gedrängt. Sie sollen Mittel ergreifen, die sie der Hilflosigkeit preisgeben. Erinnern wir uns, wie die Gewerkschaften nach der Änderung der Sozialgesetzgebung die Kämpfe zersplitterten, die Unzufriedenheit verpuffen ließen und die Mobilisierung dank juristischer Ablenkungsmanöver abwürgten. Die juristischen Auseinandersetzungen, in welche die Gewerkschaften die Beschäftigten hineindrängen wollen, führen nur zu sinnlosen Geplänkeln, da die Arbeiter auf dieser Ebene nicht als Klasse handeln, sondern als „Bürger“, die „die Gesetze respektieren und schützen“. Dabei liefern all diese Gesetze nur den juristischen Rahmen für die Rechtfertigung unserer prekären Arbeitsbedingungen und unsere Verarmung.
Es liegt auf der Hand, dass die Gewerkschaften keine Einheit bewirken und eine wirkliche Solidarität verhindern wollen; stattdessen wollen sie uns spalten. Die Tatsache, dass heute die Regierung zu solch einem Schlag gegen die Elektriker ausgeholt hat, kommt nicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel, sondern wurde nur möglich dank der vorher erfolgten Spaltung durch die Gewerkschaften.
Die Strategie der Herrschenden zur Durchsetzung ihres Schachzugs besteht darin, die tatsächlich vorhandene Unzufriedenheit der Elektrizitätsbeschäftigten zu untergraben und zu verhindern, dass die Klassenbrüder und -schwestern ihre Solidarität zum Ausdruck bringen. Sie werden alles unternehmen, um die Reaktionen der Arbeiter auf das Terrain der Verteidigung der Nation und der Gewerkschaften zu zerren; d.h. uns in einen Kampf zu locken, bei dem das kapitalistische Ausbeutungssystem nicht in Frage gestellt wird; schlussendlich werden sie uns dazu aufrufen, unsere ganze Unzufriedenheit beim nächsten Wahlzirkus zum Ausdruck zu bringen.
Es gibt keinen anderen Weg: Gemeinsam kämpfen, die Solidarität als Klasse herstellen!
Die Solidarität ist keine gewerkschaftliche Pantomime, bei der ein gewerkschaftlicher Bonze dem anderen seine Unterstützung erklärt; genauso wenig ist sie eine „moralische Unterstützung“. Echte Solidarität kommt dadurch zustande, dass man selbst in den Kampf tritt. Heute sehen sich die Elektriker, genau wie viele andere Beschäftigte auch, Angriffen ausgesetzt; die anderen Beschäftigten müssen ihre wirkliche Solidarität zum Ausdruck bringen, indem sie selbst den Kampf aufnehmen; indem sie die Gräben überwinden, die zwischen den (noch) Beschäftigten und Arbeitslosen, zwischen verschiedenen Wirtschaftsbranchen und zwischen den Regionen bestehen. Dazu muss zu Vollversammlungen aufrufen werden, die allen Arbeitern offenstehen (Aktiven und Arbeitslosen und anderen Bereichen). Auf diesen Versammlungen muss offen über die Lage geredet werden, in der wir uns alle befinden. Dadurch kann die Unzufriedenheit in Aktionen und Mobilisierungen münden, die von den Betroffenen selbst kontrolliert werden und nicht in den Händen der Gewerkschaften liegen.
Um den Schlag gegen die Arbeiter abzuschließen, werden die Gewerkschaften die Elektrizitätsbeschäftigten von den anderen Beschäftigten zu isolieren und sie für ihre Art von Mobilisierung einzuspannen versuchen, wie die von López Obrador, die darauf abzielt, die Beschäftigten zu fesseln und zu verhindern, dass sie ihre eigenen Kampfinstrumente entwickeln. So sollen die Betroffenen in die falsche Auseinandersetzung zwischen Staatsbetrieb und Privatbetrieb gelockt werden. Deshalb müssen die Beschäftigten angesichts dieser Angriffe, mit denen sie es zu tun haben, gemeinsam nachdenken. Dies muss außerhalb und gegen den Willen der Gewerkschaften geschehen. Nur so können sie sich wirksam zur Wehr setzen. Wenn wir unser Schicksal in die Hände der Gewerkschaften und der politischen Parteien legen, sind wir zur Niederlage verurteilt. Ein Kampfruf des Proletariats geht erneut um die Welt: „Die Befreiung der Arbeiterklasse muss das Werk der Arbeiter selbst sein“. Die Ausgebeuteten haben nichts zu verlieren als ihre Ketten!
Oktoer2009
Grupo Socialista libertario
https://webgsl.wordpress.com/ [272]
Revolución Mundial
Sektion in Mexico der Corriente Comunista Internacional (IKS)
[email protected] [273]
Proyecto Anarquista Metropolitano
proyectoanarquistametropolitano.blogspot.com
[1]staatlich kontrollierter Energielieferant Mexikos
Aktuelles und Laufendes:
- LyFC [274]
- Arbeiterkämpfe Mexiko [275]
- Luz y Fuerza del Centro LyFC [276]
Zusammenarbeit und Annäherung zwischen revolutionären Gruppen: Welche Kriterien (Leserbrief)
- 3290 reads
Ein Leser, der seine Zuschrift mit JM unterzeichnet, hat auf unserer Webseite einen sehr interessanten Kommentar verfasst, in dem die Frage der notwendigen Zusammenarbeit zwischen verschiedenen revolutionären Gruppen aufgeworfen wird. In seiner Zuschrift, die mit "Bedingungen für Bündnisse und Annäherungen zwischen Organisationen" betitelt wird, fragt der Genosse, welche Kriterien die IKS bei ihrer Zusammenarbeit mit einer anderen Organisation verwendet.
Ein Leser, der seine Zuschrift mit JM unterzeichnet, hat auf unserer Webseite einen sehr interessanten Kommentar verfasst, in dem die Frage der notwendigen Zusammenarbeit zwischen verschiedenen revolutionären Gruppen aufgeworfen wird. In seiner Zuschrift, die mit ”Bedingungen für Bündnisse und Annäherungen zwischen Organisationen” betitelt wird, fragt der Genosse, welche Kriterien die IKS bei ihrer Zusammenarbeit mit einer anderen Organisation verwendet.
Unsere nachfolgende Antwort greift zum Teil auf die verschiedenen Kommentare zurück, die im Verlaufe dieser Diskussion verfasst wurden. Wir möchten alle unsere Leser/Innen ermuntern, sich an den Diskussionen auf unserer Webseite zu beteiligen, Kommentare zu verfassen, Kritik zu üben oder Fragen zu stellen zu unseren Artikeln oder Vorschläge zu machen.
Die Zuschrift von JM
In euren Artikeln versucht ihr manchmal, euch anderen Gruppen zu nähern. Zum Beispiel den Anarchisten.
Habt ihr ein offizielles Dokument, das sich mit den Bedingungen für Bündnisse und Annäherungen befasst? Oder geht ihr jeweils von Fall zu Fall vor?
Zum Beispiel hat eine trotzkistische Organisation CIQI vor kurzem ihre Unterstützung der Gewerkschaften, die sie seit langem verteidigten, aufgegeben. Bei dieser Frage haben sie sich der Kommunistischen Linken angenähert. (https://wsws.org/francais/News/2009/sep2009/opel-s19.shtml [277])
Man hat manchmal den Eindruck, wenn sich Organisationen annähern oder von einander abrücken, geschieht dies oft infolge bürokratischer Prinzipien, um nicht zu sagen aus Opportunismus. In dem einen Fall mag eine Organisation nicht mit einer anderen diskutieren, weil die eine von der anderen aufgesaugt werden könnte. Dies spiegelt eine organisatorische Schwäche wider. In dem anderen Fall fühlen sich die Mitglieder der ersten Organisation nicht sattelfest und befürchten, sie könnten durch die andere Organisation einem ”schlechten” Einfluss unterworfen werden. Dies spiegelt eine theoretische Schwäche wider.
Man kann auch behaupten, dass eine Diskussion nicht wünschenswert ist, wenn sie keinen neuen theoretischen Beitrag leistet oder eine Zusammenarbeit zu einer konkreten Frage ermöglicht. Aber ich habe das Gefühl, dass man die technischen Aufgaben nicht gemeinschaftlich genug anpackt, die doch eigentlich politisch neutral sein sollten (Transport, Unterkunft, Informationen usw.) und die politische Zusammenarbeit bei konkreten Fragen (Wortmeldungen in Vollversammlungen usw.) ein wenig auf gut Glück geschieht, ohne dass weitere Schritte folgen. Meines Erachtens bräuchte man einen Text, in dem man aufzeigt, unter welchen Bedingungen und warum eine Zusammenarbeit mit Mitgliedern einer Organisation möglich ist. Dieser Text sollte nicht zu restriktiv noch zu weitgehend formuliert sein, um die Organisation nicht zu lähmen oder zu untergraben. Solch ein Text wäre sehr nützlich. Was haltet ihr davon?
“Nur diejenigen, die nicht genügend Selbstvertrauen haben, fürchten vorübergehende Bündnisse, selbst mit unsicheren Leuten. Keine politische Partei könnte ohne diese Bündnisse bestehen”. (Was tun? Lenin).”
Antwort der IKS
JM wirft eine wesentliche Frage in seinem Beitrag auf. Seit einigen Jahren hat die Arbeiterklasse einen langsamen, aber tiefgreifenden Prozess des Nachdenkens angefangen. Sie wird sich immer mehr über den desaströsen Zustand des Kapitalismus und seiner Unfähigkeit, der Menschheit irgendeine Zukunft anzubieten, bewusst. Konkret, über die noch viel zu selten stattfindenden Kämpfe hinaus wird diese Dynamik vor allem ersichtlich anhand eines reichhaltigeren Lebens in den Reihen des revolutionären Milieus. Relativ alte Gruppen (wie OPOP in Brasilien) und andere noch jüngere oder gerade erst entstandene Gruppen wie auch in Erscheinung getretene Individuen versuchen ein internationales Netz aufzubauen, innerhalb dessen eine offene und brüderliche Debatte stattfindet (2). Die Revolutionäre sind heute auf der ganzen Welt erst ein kleiner Haufen; nichts ist verheerender als die Isolierung. Der Aufbau von Verbindungen und Debatten auf internationaler Ebene ist also lebenswichtig. Die Divergenzen, wenn sie offen und aufrichtig diskutiert werden, sind eine Quelle der Bereicherung für das Bewusstsein der ganzen Arbeiterklasse.
Aber was so augenfällig ist, ist noch nicht für jeden selbstverständlich. Innerhalb des revolutionären Lagers herrscht heute noch eine gewisse Zerstreuung vor; man arbeitet wenig gemeinsam, schlimmer noch - es gibt noch viel Sektierertum! Die verschiedenen Standpunkte und Analysen, welche leider keine aufrichtigen Debatten auslösen, sind viel zu oft ein Vorwand für den Rückzug auf sich selbst. Es gibt eine Tendenz zur Verteidigung der eigenen "Kapelle", eine Art Krämergeist, der eigentlich in der Arbeiterklasse nicht vorhanden sein sollte (um dies zu verdeutlichen, benutzt die IKS lieber den Begriff der "Zusammenarbeit”, "gemeinsame Arbeit", "gemeinsame Stellungnahmen" usw. statt "Bündnis", wie JM es tut). Die Revolutionäre stehen in keinem Konkurrenzverhältnis zueinander. Wir stimmen also vollkommen überein mit JM, wenn er schreibt: “Man hat manchmal den Eindruck, wenn sich Organisationen annähern oder von einander abrücken, geschieht dies oft infolge bürokratischer Prinzipien, um nicht zu sagen aus Opportunismus. In dem einen Fall mag eine Organisation nicht mit einer anderen diskutieren, weil die eine von der anderen aufgesaugt werden könnte. Dies spiegelt eine organisatorische Schwäche wider. In dem anderen Fall fühlen sich die Mitglieder der ersten Organisation nicht sattelfest und befürchten, sie könnten durch die andere Organisation einem ‘schlechten’ Einfluss unterworfen werden. Dies spiegelt eine theoretische Schwäche wider.”
JM hat auch Recht zu verlangen, dass solch eine Zusammenarbeit sich auf klare Kriterien stützt und dass man nicht nach taktischen Erwägungen vorgeht. Die kapitalistische Gesellschaft, so lautet eine Grundlage des Marxismus, ist in zwei unversöhnliche Lager mit entgegengesetzten Interessen gespalten: die bürgerliche Klasse und die Arbeiterklasse. Die ganze Politik unserer Organisation fußt auf dieser Methode. Aus der Sicht der IKS ist in der Tat die größtmögliche Zusammenarbeit zwischen den Organisationen, die dem proletarischen Lager angehören, und die größte Standhaftigkeit gegenüber dem bürgerlichen Lager erforderlich. Dies bedeutet, dass man die grundlegenden Unterschiede zwischen diesen beiden Lagern festlegen muss. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass dieser Unterschied offensichtlich ist. Denn schließlich beruft sich jede Organisation offiziell auf eine Strömung, sei es indem sie offen das gegenwärtige System unterstützt (im Allgemeinen die Rechten), oder indem man behauptet, die Interessen der Arbeiter zu verteidigen (was die Linken und die extremen Linken von sich beanspruchen). Es gibt zahlreiche Gruppen, die von sich behaupten, revolutionär zu sein: Kommunisten, Trotzkisten, Maoisten (die heute zahlenmäßig geschrumpft sind), offizielle Anarchisten…
Aber was eine Organisation von sich selbst behauptet, reicht nicht aus. Die Geschichte wimmelt von Beispielen von Organisationen, die mit der Hand auf dem Herz schwören, die Sache der Arbeiterklasse zu verteidigen, um ihr so nur besser ein Messer in den Rücken stoßen zu können. Die deutsche Sozialdemokratie behauptete 1919 von sich, eine Arbeiterorganisation zu sein, während sie gleichzeitig den Mord an Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und Tausenden anderen Arbeitern organisierte. Die stalinistischen Parteien haben die Arbeiteraufstände von Berlin 1953 und Ungarn 1956 im Namen des "Kommunismus" (d.h. im Interesse der UdSSR) blutig niedergeschlagen.
Wenn die "Verpackung" nicht ausreicht, um das Wesen einer Organisation zu definieren, nach welchen Kriterien soll man deren "Inhalt" dann einschätzen (Programm, Plattform mit den politischen Positionen) ?
JM unterstreicht, dass eine trotzkistische Gruppe, die CIQI, jetzt nicht mehr die Gewerkschaften unterstützt. Er meint, dass bei diesem Punkt die CIQI sich der "Kommunistischen Linken genähert" habe (eine Strömung, aus der die IKS hervorgegangen ist). Aber dieses Kriterium allein reicht nicht aus oder es ist nicht entscheidend für solch eine Annäherung. Gab es doch in Frankreich in den 1970er Jahren maoistische Organisationen wie die Proletarische Linke (welche die Zeitung "Cause du Peuple" herausbrachte), welche die Gewerkschaften auch als bürgerliche Organe ansahen, was sie aber nicht daran hinderte, sich auf Stalin und Mao zu berufen, welche zwei verschworene Feinde und Mörder der Arbeiterklasse waren!
Eine politische Position allein kann deshalb nicht über das Wesen einer Organisation entscheiden. Aus der Sicht der IKS gibt es grundsätzliche Kriterien. Die Unterstützung der Arbeiterklasse gegen den Kapitalismus bedeutet, sowohl unmittelbar gegen die Ausbeutung anzukämpfen (bei Streiks zum Beispiel), als auch immer das historische Ziel vor Augen zu haben: die Überwindung des Ausbeutungssystems durch die Revolution. Dazu darf eine Organisation auf keine Weise irgendeinen Teil der Bürgerlichen (auch nicht auf "kritische", "taktische" Art oder unter dem Vorwand der Wahl des "geringeren Übels") unterstützen: weder die "demokratische" Bourgeoisie gegen die "faschistische" Bourgeoisie, weder die Linke gegen die Rechte, noch die palästinensische gegen die israelische Bourgeoisie usw.. Solche eine Politik hat zwei konkrete Auswirkungen:
1) Man muss jede Unterstützung von Wahlen und Zusammenarbeit mit den Parteien ablehnen, die das kapitalistische System verwalten oder als Verteidiger des Systems in der einen oder anderen Form tätig sind (Sozialdemokratie, Stalinismus, "Chavismus" usw.) .
2) Vor allem bei jedem Krieg muss man einen unnachgiebigen Internationalismus aufrechterhalten, indem man sich weigert, das eine oder andere imperialistische Lager zu unterstützen. Während des 1. Weltkriegs wie während aller Kriege im 20. Jahrhunderts haben all die Organisationen, die diese Politik nicht vertreten haben, den Boden des Kommunismus verlassen und eine der beteiligten imperialistischen Seiten unterstützt; sie haben dabei die Arbeiterklasse verraten und sind dabei endgültig ins Lager der Bürgerlichen gewechselt.
Die Frage der Anarchisten und Trotzkisten
Die kurze Nachricht von JM wirft tatsächlich die Frage auf: Welchem Lager ordnet die IKS die Anarchisten und die Trotzkisten zu?
Die meisten Anarchisten berufen sich nicht auf den Marxismus und vertreten bei vielen Fragen ganz andere Positionen als die IKS. Jedoch wie JM bemerkte: "In euren Artikeln versucht ihr manchmal euch anderen politischen Gruppen anzunähern. Zum Beispiel den Anarchisten." In der Tat laufen seit einigen Jahren Diskussionen zwischen bestimmten anarchistischenen Gruppen oder Individuen und der IKS. Zum Beispiel arbeiten wir mit der KRAS in Russland zusammen (Sektion der anarcho-syndikalistischen AIT), wobei wir ihre internationalistischen Positionen z.B. gegenüber dem Tschetschenienkrieg veröffentlicht und begrüßt haben. Die IKS betrachtet diese Anarchisten, mit denen wir diskutieren, trotz unserer Differenzen als einen Teil des proletarischen Lagers. Warum? Weil sie sich von all den Anarchisten (wie denjenigen der Anarchistischen Föderation) und all jenen "Kommunisten" (wie denjenigen der KPF) abgrenzen, die theoretisch den Internationalismus beanspruchen, sich diesem aber in der Praxis widersetzen, indem sie bei jedem Krieg eine Kriegsseite gegen die andere unterstützen. Man darf nicht vergessen, dass 1914 bei Ausbruch des Weltkrieges und 1917 während der Russischen Revolution die "Marxisten" der Sozialdemokratie auf Seiten der Bourgeoisie gegen die Arbeiterklasse standen, während die spanische CNT den imperialistischen Krieg anprangerte und die Revolution unterstützte! Aus diesem Grunde wurde sie übrigens zum 2. Kongress der Kommunistischen Internationale eingeladen.
Was die Trotzkisten betrifft, denken die meisten, die mit dieser Strömung sympathisieren, aufrichtig, sie kämpften für die Abschaffung des Kapitalismus (was auch viele innerhalb der anarchistischen Strömung denken). Die von der [in Frankreich jüngst gegründeten Partei] NPA angezogenen Jugendlichen sind oft echt empört über die Unmenschlichkeit dieses Ausbeutungssystems. Aber unser Leser sollte sich fragen, ob in Anbetracht der oben erwähnten "grundlegenden Kriterien" der Trotzkismus als Strömung (mit den Organisationen, die sich auf ihn berufen) nicht ins Lager der Bourgeoisie übergewechselt ist. Denn sie haben sich am 2. imperialistischen Weltkrieg auf der Seite der Résistance beteiligt, die UdSSR unterstützt (d.h. das russische imperialistische Lager), HoChiMinh im Vietnamkrieg und heute Chavez unterstützt. Weiter haben sie [in Frankreich] zur Wahl der Linken im zweiten Wahlgang bei den Wahlen aufgerufen (d.h. für Chirac 2002), sind Wahlbündnisse mit der KPF und der PS eingegangen (insbesondere bei Kommunalwahlen), haben gemeinsam eine Wahlkampagne zur Ablehnung des Referendums zur Europawahl im Mai 2005 gemacht.
Aber in Anbetracht dieser fälschlicherweise als proletarisch ausgegebenen, tatsächlich aber eindeutig bürgerlichen Politik ist es sehr wohl möglich, dass Arbeiter, auch wenn sie in diesen Organisationen aktiv sind, sich Fragen stellen und kraft ihres Nachdenkens dazu kommen, sich von diesen Organisationen zu lösen und proletarischen Positionen annähern. Während eine Organisation nicht als solche vom bürgerlichen ins proletarische Lager wechseln kann, ist es immer möglich, dass kleine Minderheiten oder – wahrscheinlicher - einzelne Leute, die sich individuell vom Nationalismus des Trotzkismus lösen, sich internationalistischen proletarischen Positionen nähern. Dies findet übrigens gegenwärtig zum Teil in Lateinamerika statt, wo die an der Macht befindlichen Linksextremisten (Chavez, Lula usw.) jeden Tag mehr ihr arbeiterfeindliches Wesen in den Augen bestimmter Minderheiten offenbaren.
Die IKS ist immer bereit, mit all diesen Leuten offen und mit Enthusiasmus zu diskutieren! Tibo, 16. Oktober 2009
1) Dieser "Kommentar" wurde ausgehend von einem Artikel zu den Kämpfen bei Freescale verfasst, die zwischen April und Juni stattfanden ("Freescale: Wie die Gewerkschaften die Bemühungen der Arbeiter zu kämpfen, sabotieren", Révolution Internationale, Nr. 404, Sept. 2009).
2) In unserer Presse sind wir auf diesen embryonalen Prozess eingegangen. Zwei Beispiele unter vielen: "Internationalistische Erklärung aus Korea gegen Kriegsdrohungen", und "Ein Treffen internationalistischer Kommunisten in Lateinamerika".
Aktuelles und Laufendes:
- Zusammenarbeit revolutionäre Gruppen [278]
- Trotzkismus [279]
- Anarchismus [280]
Politische Strömungen und Verweise:
Dezember 2009
- 886 reads
Die zukünftigen Kämpfe vorbereiten
- 2684 reads
Nachfolgend veröffentlichen wir ein Flugblatt des Kollektivs "Einheit an der Basis in Tours" (1). Diese Genossen, von denen die meisten junge Studenten sind, treffen sich, um sich an Vollversammlungen zu beteiligen, die für alle offen stehen. Sie lehnen die branchenspezifischen Abgrenzungen ab, in welche die Gewerkschaften die Kämpfe einzusperren versuchen. Sie waren lange Zeit sehr aktiv und haben versucht, mit Beschäftigten an deren Arbeitsplatz Kontakt aufzunehmen , um mit ihnen zu diskutieren und sie dazu aufzurufen, den Kampf auszudehnen. Dieses Flugblatt hat das große Verdienst, die Frage der revolutionären Perspektive aufzugreifen und die Notwendigkeit hervorzuheben, dass die gesamte kapitalistische Gesellschaft infrage gestellt werden muss.
Gleichzeitig versucht es Lehren zu ziehen und eine Bilanz der jüngsten Kämpfe zu erstellen. Aus unserer Sicht ist dies eine wichtige politische Herangehensweise, die unerlässlich ist für die Vorbereitung zukünftiger Kämpfe.
Nachfolgend veröffentlichen wir ein Flugblatt des Kollektivs "Einheit an der Basis in Tours" (1). Diese Genossen, von denen die meisten junge Studenten sind, treffen sich, um sich an Vollversammlungen zu beteiligen, die für alle offen stehen. Sie lehnen die branchenspezifischen Abgrenzungen ab, in welche die Gewerkschaften die Kämpfe einzusperren versuchen. Sie waren lange Zeit sehr aktiv und haben versucht, mit Beschäftigten an deren Arbeitsplatz Kontakt aufzunehmen , um mit ihnen zu diskutieren und sie dazu aufzurufen, den Kampf auszudehnen. Dieses Flugblatt hat das große Verdienst, die Frage der revolutionären Perspektive aufzugreifen und die Notwendigkeit hervorzuheben, dass die gesamte kapitalistische Gesellschaft infrage gestellt werden muss.
Gleichzeitig versucht es Lehren zu ziehen und eine Bilanz der jüngsten Kämpfe zu erstellen. Aus unserer Sicht ist dies eine wichtige politische Herangehensweise, die unerlässlich ist für die Vorbereitung zukünftiger Kämpfe.
Flugblatt des Kollektivs
Kann man unser Schicksal in die Hände von Privatinteressen legen?
Die Wirtschaftskrise verschärft sich. Vom der Finanzwelt ausgehend hat sie mittlerweile alle Bereiche der Wirtschaft erfasst. Standorte werden verlagert oder geschlossen. In der Bauindustrie zum Beispiel sind viele Projekte zum Erliegen gekommen. Aber die Betriebe in dieser Branche sind in der Regel keine Großbetriebe. Sie ziehen weniger die Aufmerksamkeit der Medien auf sich, welche auf der Suche nach spektakulären Ereignissen sind und vieles entsprechend aufbauschen.
Gasflaschen
Die Rechnung für die Krise der Bourgeoisie (die Besitzer der Produktionsmittel und des Kapitals), die für diese verantwortlich ist, soll von den Arbeitern und den zukünftigen Beschäftigten aller Länder beglichen werden. Unendlich lange ist die Liste der Werksschließungen, Produktionsverlagerungen, Entlassungen, Kurzarbeit usw. geworden, deren Last die Arbeiter tragen sollen. Die Krise führt zu einer Zuspitzung der Gewalt bei den Beziehungen unter den Klassen. Dies hat einerseits zur Folge, dass immer mehr soziale Errungenschaften abgebaut oder ganz abgeschafft werden. Arbeitszeitverlängerungen ("länger arbeiten um mehr zu verdienen"…), Verzögerung des Renteneintrittalters (67 Jahre, gar 70 Jahre …), Verschlechterung der Arbeitszeitregelungen (Sonntagsarbeit…) usw. Damit wird nur ein Ziel verfolgt: Verschärfung der Ausbeutung! Andererseits nimmt die Entschlossenheit der Arbeiter, sich dagegen zu wehren, zu; die Kampfbereitschaft ist größer geworden. Manager werden von Beschäftigten festgesetzt (3M…), es gibt harte Streiks mit Betriebsbesetzungen (Continental…), auf nationaler und internationaler Ebene werden Beziehungen geknüpft, Beschäftigte aus mehreren Werken eines Konzerns treffen sich an einem Ort (Michelin, Caterpillar…) und es kommt zur Kontaktaufnahme mit Beschäftigten anderer Länder (Continental mit Deutschland…), einige haben sogar gedroht, ihre Fabrik in die Luft zu sprengen, um ordentliche Abfindungen zu erhalten (New Fabris….).
Aber diese Kämpfe scheinen nun eine neue Richtung einzuschlagen. Viele kämpferische Beschäftigte haben keine Hoffnung mehr, ihre Jobs zu behalten und damit den Produktionsstandort zu bewahren. Sie wollen, dass bei den Sozialplänen (die Technokratensprache für Massenentlassungen) möglichst viel herausspringt. So sind die Aktionäre gezwungen, mehr Geld herauszurücken als sie geplant hatten; andererseits können die Beschäftigten trotz der geringen Arbeitslosengeldzahlungen ein wenig länger durchhalten. Damit wird die Frage der Würde und der Lebensbedingungen aufgeworfen. Aber all das ändert nichts daran, dass sie – und wir auch – in einer Sackgasse stecken.
Und was folgt danach?
Wir stehen vor einer wirklichen Krise der Perspektive. Mit ihrer Politik der Krisenbegleitung bieten die Gewerkschaftsverbände keinen Ausweg aus dieser Sackgasse. Dies zeigt, dass wir uns unbedingt anders organisieren müssen, indem wir versuchen neue Perspektiven zu entwickeln, die einen Bruch mit dem Kapitalismus bedeuten würden. Dies zu tun ist dringend und entscheidend. Wie kann man den Reichtum der Gesellschaft egalitär verteilen? Wie kann man die Vorherrschaft der Aktionäre und anderer kleiner Chefs überwinden, die unseren Alltag zerstören? Letztendlich geht es um unser alltägliches Leben, aber auch um die Zukunft der Menschheit, die Zukunft der Erde – es geht um die Entscheidung für oder gegen eine ganze Gesellschaft! Können die Gewerkschaften einen Raum schaffen, um über unseren Alltag hinaus zu überlegen, wie wir diesen umwälzen? Kann man sich vorstellen, dass die Gewerkschaftsbürokratien die Vorstellungskraft und den Kampf für eine Zukunft begünstigen, in dem die gesellschaftlichen Verhältnisse zum zentralen Anliegen der gesellschaftlichen Organisation werden, und wo nicht mehr die Jagd nach Profiten für eine raffgierige Minderheit im Vordergrund steht?
Der Erfolg der großen Mobilisierungen vom 29. Januar und 19. März bot Anlass zu Hoffnung. Aber wir müssen uns eingestehen, dass all das, was die Gewerkschaften seitdem veranstaltet haben, überhaupt nicht unseren Erwartungen entspricht. Die meisten Gewerkschaftsführungen haben sich damit zufrieden gegeben, mit der Regierung zu reden, "Aktionstage" zu veranstalten. Konkret ist daraus nichts wirklich Positives hervorgegangen, um die Stellung der Arbeiter und aller Unterdrückten zu stärken und die Klassensolidarität zu entfalten. Das hat zu den Friedhofsprozessionen vom 26. Mai und 13. Juni geführt.
Viele von uns (Arbeiter, prekär Beschäftigte, Arbeitslose, Rentner, gewerkschaftlich Organisierte…) hofften, raunten oder grölten und wirkten hin auf den unbegrenzten Generalstreik. Aber nichts in diese Richtung wurde unternommen. Die Fesseln, die uns die gewerkschaftlichen Bürokratien angelegt haben, greifen noch. Wir müssen jetzt revolutionäre Perspektiven entfalten, um die kapitalistische Gesellschaft radikal umzuwälzen. Wir müssen uns an der Basis organisieren, Klassensolidarität entfalten, Kampfinstrumente entwickeln, um den Kampf in die eigenen Hände zu nehmen und heute schon anfangen, eine andere Zukunft aufzubauen!
In den Betrieben, in den Stadtvierteln, in den Universitäten… müssen wir Komitees errichten, unsere Kollektive aufbauen und all die Kampfformen entfalten, die uns als nützlich erscheinen.
Überwinden wir die branchenspezifischen Gräben, die uns schwächen!
Solidarität unter allen Ausgebeuteten und Unterdrückten, egal ob sie in Gewerkschaften organisiert sind oder nicht!
Kämpfen wir für die Einheit unserer Klasse, indem wir klar zwischen Freund und Feind unterscheiden
Wir haben die Schnauze voll von den Krümeln, nehmen wir uns die ganze Bäckerei!
Kollektiv – Einheit an der Basis aus Tours (Sommer 2009)
Ein Kommentar der IKS
Dieses Flugblatt zeigt sehr gut auf, dass eine Minderheit der Arbeiterklasse nicht in Passivität versinken möchte und nicht bereit ist, die Ausbeutungsbedingungen dieser Gesellschaft hinzunehmen.
Auch wenn wir nicht mit allen Formulierungen des Flugblattes einverstanden sind, erscheint uns eine Frage ein zentrales Anliegen zu sein: „Wir müssen jetzt revolutionäre Perspektiven entfalten, um die kapitalistische Gesellschaft radikal umzuwälzen“ (…) Dies wirft die Frage nach einer neuen Gesellschaft auf; und wir teilen voll dieses Anliegen.
(…)
Wir meinen, dass es sich um zentrale Fragen handelt, die in der Tat in der Arbeiterklasse diskutiert und die weiter geklärt werden müssen, um so das allgemeine Nachdenken voranzubringen.
Wir meinen, auf dem Hintergrund der heftigen Angriffe gegen die Arbeiterklasse infolge der Krise, müssen diejenigen, die nach einer Perspektive zur Überwindung des Kapitalismus suchen, notwendigerweise die Rolle einer Minderheit bei der politischen Vorbereitung der Aktionen und der Interventionen in den zukünftigen Kämpfen ausüben werden. Nach den ersten Keulenschlägen durch die Wirtschaftskrise, die noch lange andauern wird, wird die Arbeiterklasse, sobald sie den Kampf wieder aufnehmen wird, ihre Kämpfe in die eigenen Hände nehmen, die Initiative selbst ergreifen müssen, um einen wirklich kollektiven Kampf zu führen, in denen die Entscheidungen aus echten Vollversammlungen hervorgehen, die allen offen stehen und souverän sind. Die zukünftigen Vollversammlungen, die wirklich lebendig sein müssen, werden das einzige Mittel sein, um den Kampf wirksam und selbständig zu führen. Es wird die Aufgabe der Beteiligten selbst und nicht der Gewerkschaften sein, Entscheidungen zu treffen, was getan werden soll, weil die Gewerkschaften die Kämpfe nur lähmen und sabotieren. Die Arbeiter selbst müssen ihre Solidarität im und durch den Kampf zeigen, kollektiv handeln, indem sie zum Beispiel massive Delegationen zu anderen Betrieben schicken, um sich mit den anderen Beschäftigten in einem gemeinsamen Kampf zusammenzuschließen. Das Herz des Kampfes schlägt durch Initiativen für gemeinsame, branchenübergreifende, offene Vollsammlungen. Nur wenn die Arbeiter den Kampf selbst in die Hand nehmen, wird eine aktive, wirkliche Solidarität möglich sein, die die anderen Klassenbrüder und –schwestern mit einbezieht. Jedoch stößt die Umsetzung dieses Schrittes auf eine Reihe von Hindernissen. Diese können nur aus dem Weg geräumt werden, wenn die Arbeiter selbst, in den Vollversammlungen darüber diskutieren und nach einem Weg suchen, sie gemeinsam zu überwinden. Es besteht kein Zweifel, die Vollversammlungen bleiben eine wirklich proletarische Organisationsform , die eine echte kollektive Kontrolle über den Kampf ausüben können. Sie stellen gewissermaßen Embryonen der späteren Arbeiterräte dar. Diese Organe, in welchen die Arbeiter massenhaft zusammen kommen können, ermöglichen die Vereinigung der Klasse und können zu einer revolutionären Kraft für die Überwindung des Kapitalismus werden. Sie werden die Überwindung der gesellschaftlichen Ausbeutungsverhältnisse mit dem Ziel der Schaffung einer neuen Gesellschaft ermöglichen.
Zusammenfassend möchten wir hervorheben, dass wir uns erlaubt haben, diese Kommentare mit der Sorge zu verfassen, zum Nachdenken beizutragen. IKS (Oktober 2009)
Aktuelles und Laufendes:
- Studentenproteste [282]
- Studentenproteste Frankreich [283]
Ein kurzer Kommentar zum Ablauf des Klimagipfels in Kopenhagen: Das Schicksal des Planeten in den Händen von…
- 4082 reads
Wir sind an anderer Stelle schon auf die Ursachen der Umweltzerstörung im Kapitalismus, seine Mittel und Möglichkeiten des Umweltschutzes eingegangen. Auch wollen wir auf die „Ergebnisse“ der Konferenz und die zu erwartende weitere Entwicklung später ausführlicher in unserer Presse eingehen. An dieser Stelle möchten wir nur einige Eindrücke von bürgerlichen Pressebeobachtern mit einigen Kommentaren von uns widergeben.
Nach jahrelangen Vorbereitungen, bei denen keine Einigung über die konkreten Schritte erreicht werden konnte, begann Anfang Dezember 2009 der Verhandlungsmarathon mit Delegierten aus mehr als 192 Staaten. Zum Schluss trafen immer mehr Staatschefs ein, um dem Gipfel doch noch zu einem „erfolgreichen Abschluss“ zu verhelfen. Mit großem Pomp ließ sich US-Präsident Obama einfliegen und bilanzierte in seiner Rede nach seiner Ankunft: „Vierzehn Tage dauere diese Konferenz, zwanzig Jahre dauern schon die Klimaverhandlungen, und man habe doch wenig vorzuweisen außer einer drastischen Beschleunigung der Klimawandeleffekte“ (www.faz.net [284]). Schauen wir uns an, wie Beobachter bürgerlicher Medien den Verlauf der Konferenz wahrnahmen und welche Schlussfolgerungen sie daraus ziehen.
Wir sind an anderer Stelle schon auf die Ursachen der Umweltzerstörung im Kapitalismus, seine Mittel und Möglichkeiten des Umweltschutzes eingegangen. Auch wollen wir auf die „Ergebnisse“ der Konferenz und die zu erwartende weitere Entwicklung später ausführlicher in unserer Presse eingehen. An dieser Stelle möchten wir nur einige Eindrücke von bürgerlichen Pressebeobachtern mit einigen Kommentaren von uns widergeben.
Nach jahrelangen Vorbereitungen, bei denen keine Einigung über die konkreten Schritte erreicht werden konnte, begann Anfang Dezember 2009 der Verhandlungsmarathon mit Delegierten aus mehr als 192 Staaten. Zum Schluss trafen immer mehr Staatschefs ein, um dem Gipfel doch noch zu einem „erfolgreichen Abschluss“ zu verhelfen. Mit großem Pomp ließ sich US-Präsident Obama einfliegen und bilanzierte in seiner Rede nach seiner Ankunft: „Vierzehn Tage dauere diese Konferenz, zwanzig Jahre dauern schon die Klimaverhandlungen, und man habe doch wenig vorzuweisen außer einer drastischen Beschleunigung der Klimawandeleffekte“ (www.faz.net [284]). Schauen wir uns an, wie Beobachter bürgerlicher Medien den Verlauf der Konferenz wahrnahmen und welche Schlussfolgerungen sie daraus ziehen.
Zunächst zwei Journalisten der „Welt“:
Kopenhagen gescheitert
US-Präsident Obama stürzt vom Klima-Gipfel
Von D. Wetzel und G. Lachmann 19. Dezember 2009, 13:17 Uhr
Das faktische Scheitern der Klimaverhandlungen in Kopenhagen ist eine schwere Niederlage für US-Präsident Barack Obama auf internationaler Ebene. Nicht nur, dass er und Bundeskanzlerin Angela Merkel vorzeitig abreisten, ohne ein sicheres Ergebnis erzielt zu haben. Er ließ sich zudem von den Chinesen vorführen.
Seiner Ankunft folgte sogleich ein markiger Auftritt. Kaum hatte US-Präsident Barack Obama das Konferenzzentrum betreten, ließ er die Anwesenden wissen: „Die Zeit für Reden ist vorbei.“ Ab jetzt wollte er die Verhandlungsführung übernehmen.
Zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, den „Chefs“ aus Russland, Brasilien, Japan, der Europäischen Union und anderer wichtiger Länder machte sich Obama an die Arbeit. Doch es lief nicht so, wie der Friedensnobelpreisträger es sich vorgestellt hatte. […]
Stattdessen bahnte sich ein Fiasko an. Es begann in der Nacht von Freitag auf Samstag. Ein enger Verhandlungskreis von 30 wichtigen und repräsentativ ausgewählten Staaten, darunter Deutschland, diskutierten noch immer die Grundzüge eines Zwölf-Punkte-Papiers. Es trug den Titel „Copenhagen Accord“ und bestand aus einer dreiseitigen Sammlung vager politischer Absichtserklärungen ohne fest definierte Ziele oder rechtliche Bindung.
Obwohl China zu den größten Klimaverschmutzern zählt und längst zu einer ernst zu nehmenden Industriemacht aufgestiegen ist, fehlte Premier Wen Jiabao bei den Gesprächen. Nicht, dass man ihn nicht hätte dabeihaben wollen. Im Gegenteil.
Nach Gerüchten aus dem Bella Center soll US-Präsident Barack Obama gegen 21 Uhr ungeduldig um ein Gespräch mit Wen Jiabao gebeten haben, um die Dinge voranzubringen. Doch Obama musste warten. Wen, der Gerüchten zufolge sein Hotelzimmer während des gesamten Kongresses kaum je verlassen hatte, war lange Zeit unauffindbar. Schließlich gelang es der US-Delegation, den chinesischen Premier in einem Verhandlungszimmer ausfindig zu machen. Ein offenbar zornentbrannter Obama soll daraufhin in das Zimmer gestürmt sein. „Sind Sie jetzt bereit mit mir zu reden, Herr Premier?“, soll er gerufen haben. „Sind Sie jetzt bereit? Herr Premier, sind Sie bereit mit mir zu reden?“ Welch ein Auftritt eines US-Präsidenten.
Wen war zudem nicht allein im Zimmer, als Obama buchstäblich hereingeplatzt kam, wie es aus Kongresskreisen hieß. Der Chinese befand sich in Gesprächen mit Indiens Staatschef Mammohan Singh und dem Süd-Afrikanischen Präsidenten Jacob Zuma. Urplötzlich sah sich die Gruppe zu einem Gespräch mit dem US-Präsidenten genötigt.
Auf Drängen des ungeduldigen Obama einigte sich diese rein zufällig besetzte Runde schließlich auf einen Minimalkompromiss.
Diesen hätte Obama nun eigentlich mit seinen engsten Partnern, etwa der Europäischen Union oder der G77-Gruppe der Entwicklungsländer abstimmen müssen. Das jedoch habe er unterlassen, so heißt es, und rief stattdessen gegen 22.25 Uhr einige US-Journalisten zu einer improvisierten Pressekonferenz zusammen. Dort verkündete Obama den „Kopenhagen Akkord“ als Abschluss der zweiwöchigen Konferenz. Er sei sich bewusst, dass viele Länder das Ergebnis für ungenügend halten werden, sagte der US-Präsident. Mehr sei aber nicht zu erreichen gewesen.
Er wertete es als Erfolg, dass sich große Schwellenländer wie Indien und China überhaupt erstmals zur Notwendigkeit der Emissionsminderung bekannt hätten und das Ziel, die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu begrenzen, akzeptiert hätten.
Sodann packte er seine Koffer und flog heim. Auch Kanzlerin Angela Merkel machte sich auf den Weg zurück nach Berlin. Beide verließen Kopenhagen, ohne ein klares Ergebnis erzielt zu haben. Und, was noch schwerer wiegt, ohne sich um den weiteren Verlauf der als historisch geplanten Konferenz zu kümmern. Sie überließen das Klima den anderen. Ein folgenschwerer Fehler, wie sich bald zeigen sollte.
Während Obama und Merkel auf dem Heimweg waren, erklärte sich die EU-Kommission spät in der Nacht zähneknirschend bereit, Obamas Minimalkompromiss anzunehmen. Anders als die Europäer waren viele afrikanische Staaten dazu nicht bereit. Als in den frühen Morgenstunden das Plenum zusammentrat, geriet Sudans Staatschef Lumumba Di-Aping geradezu außer sich. Niemand habe das Mandat zur Zerstörung Afrikas, sagte der Sudanese als Sprecher der G77-Entwicklungsländer. Das vorgelegte Dokument töte Millionen Menschen. Schließlich sorgte Di-Aping dann noch mit einem Holocaust-Vergleich für Empörung im Versammlungssaal.“
Kommentar der IKS:
Wir zitieren diese Darstellung aus Welt.de so ausführlich, weil sie – auch wenn diese Schilderung sich nur „auf Gerüchte“ stützt - ein grelles Licht auf die Haltung und den Charakter der Herrschenden wirft.
Zunächst wertet der Artikel den Kopenhagener Gipfel als „schwere Niederlage für US-Präsident Barack Obama auf internationaler Ebene“. Aus der Sicht der Bürgerlichen gibt es meist Gewinner und Verlierer. Dass das Schicksal des Planeten und damit der Menschheit in Kopenhagen in den Hintergrund getreten sind, weil sich die dort versammelten Delegierten und Staatschefs nicht auf entscheidende Schritte einigen konnten, stellt nicht den Fokus der Beobachtungen dar. Stattdessen erhalten wir einen Einblick in die Art und Weise, wie der US-Präsident mit dem chinesischen Staatschef einen Deal auszuhandeln sucht, dieser in Hinterzimmermanier mit Hilfe einiger (zufällig) Anwesender aus der Sicht des US-Präsidenten als akzeptiert betrachteet wird – ohne Abstimmung selbst mit anderen „gewichtigen“ Staaten (wie z.B. europäischen Staaten oder Japan), um dann den restlichen Delegierten der Welt zur Annahme vor die Füße geworfen zu werden…
Dies spricht Bände von der Ernsthaftigkeit und dem Umgang der dort versammelten Führer. Es wirft ein typisches Bild auf die Ruchlosigkeit einer besitzenden und ausbeutenden Klasse.
Der Korrespondent des Spiegel lieferte folgende Eindrücke, von denen wir einige zitieren möchten.
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,668098,00.html [286]
Eskalation beim Gipfel
So lief das Chaos von Kopenhagen
Aus Kopenhagen berichtet Christian Schwägerl
Sie kamen, sahen - und siegten nicht: Barack Obama, Wen Jiabao und andere mächtige Staatschefs wollten der Welt einen Mini-Klimakompromiss diktieren. Doch in stundenlangen Nachtsitzungen geriet die Uno-Beratung darüber zum Fiasko. SPIEGEL ONLINE dokumentiert die dramatische Nacht.
Nachdem die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Länder, von denen einige schon abgereist waren, ohne Konsultation der Führer des Rests der Welt diesen Entscheidung aufzwingen wollten, geschah folgendes:
„Es ist 3.15 Uhr am Samstagmorgen, als Ian Fry aus Tuvalu [nördlich von Neuseeland gelegene pazifische Inselgruppe] im großen Plenarsaal mit zitternder Stimme das Wort erhebt. Der Vertreter eines 26 Quadratkilometer großen Landes mit 12.100 Einwohnen lehnt sich gegen die USA auf, gegen China, Indien, Brasilien - gegen all jene Staatschefs, die am Abend angeführt von US-Präsident Barack Obama einen "Deal" abgeschlossen haben wollen. Und abreisten, bevor sich das Plenum der Uno-Klimakonferenz in Kopenhagen überhaupt mit ihren Vorschlägen befassen konnte.
"Wir führen unsere Verhandlungen nicht über die Medien, sondern hier im Plenum", sagt Ian Fry. Und dann beschreibt er, was der Konsens von rund 30 Staaten, an dem auch Entwicklungsländer beteiligt waren, für seine Nation bedeuten würde: "Den Tod."
Tuvalu fürchtet unterzugehen, wenn die Erderwärmung zwei Grad erreicht, wie es im Mini-Kompromissentwurf der 30 als Obergrenze steht. "1,5 Grad Celsius sind das Maximale", sagt Fry. Dann weist er das Geld zurück, das die Industrieländer für den Klimaschutz in ärmeren Ländern angeboten haben - 30 Milliarden Dollar zwischen 2010 und 2012 und immerhin 100 Milliarden Dollar jährlich ab 2020. (…)
Mit diesem Eklat beginnt die Abschlusssitzung der Weltklimakonferenz.
Und plötzlich steht selbst der dürftige Minimalkompromiss vom Abend zur Disposition. Weil es auf Klimakonferenzen üblich ist, dass Beschlüsse einvernehmlich gefällt werden, droht (…) nun das absolute Fiasko - das komplette Scheitern des Gipfeltreffens ohne jede Abschlusserklärung.
[Die Vertreter Boliviens, Venezuelas und Nicaraguas ergreifen das Wort]. (Nicaraguas Vertreter) … erhebt den Vorwurf, es gebe einen "Übernahmeversuch" einer G-22, also der Gruppe der führenden Staaten bei dem Kompromissentwurf, gegen die G-192, also die Vereinten Nationen. Dann fordert er im Namen von acht Staaten, darunter Kuba und Ecuador, einen vorläufigen Abbruch der Konferenz. (…) Die Debatte im Plenum der Weltklimakonferenz, die viele Staatenvertreter als "beispiellos" in der Geschichte der Vereinten Nationen bezeichnen, kehrt um 7.06 Uhr zu Ian Fry zurück, dem Mann aus Tuvalu. Alle seien müde und emotional, es fielen Worte, die unter anderen Umständen nicht fallen würden. Die Klimakonferenz sei von innenpolitischen Schwierigkeiten eines Landes gefesselt gewesen, deshalb sei es angebracht, die Schwächen des Textes der Gruppe um die USA anzuerkennen. Er dürfe nicht beschlossen werden, vielmehr solle man versuchen, die Verhandlungen später fortzusetzen und "etwas zu erreichen, auf das wir stolz sein können".
Die Blockade löst Verzweiflung aus. "Das ist das fürchterlichste Klimagipfelplenum, das ich je erlebt habe", sagt der Unterhändler Saudi-Arabiens, "nichts ist richtig gelaufen." (…) Das Deal-Dokument könne deshalb "nicht beschlossen werden, jedenfalls nicht hier." Sein Handywecker gehe gerade zum zweiten Mal los, er sei seit 48 Stunden wach und wolle jetzt nach Hause.
Hinter all den Verfahrensvorschlägen verstärken sich knallharte Positionen: Die Länder, die das von Barack Obama ausgehandelte Papier zum Infodokument herabstufen wollen, trachten danach, sich nicht von einem Club der Mächtigen bevormunden zu lassen. Inselstaaten wie Tuvalu fürchten um ihre Existenz.
Um 8 Uhr platzt die Bombe. Nach Beratung mit Rechtsexperten der Vereinten Nationen sagt Rasmussen: "Wir können dieses Papier heute nicht beschließen." Man könne nur ein Register anlegen, in dem die Staaten in den kommenden Monaten ihre Unterstützung für das Papier hinterlegen könnten. Entsetzt beantragt der britische Unterhändler eine Unterbrechung.
Doch die dauert eineinhalb Stunden. Es geht nun um alles. Besonders Präsident Obama hat viel zu verlieren. "Wie ein Kaiser" sei der US-Präsident nach Kopenhagen gekommen, hat die Unterhändlerin von Venezuela kritisiert.
Um 10.30 Uhr sitzt Ministerpräsident Rasmussen nicht mehr auf dem Podium, er wurde durch einen unbekannten Delegierten als Präsident ausgetauscht, der sich nicht vorstellt und keinen Grund für die Ablösung nennt. "Wir versuchen drei Sachen schnell hinzubekommen", sagt der Mann und liest vor: "Die COP nimmt Kenntnis vom Kopenhagen-Akkord vom 18. Dezember. Das ist jetzt so beschlossen", fügt er sekundenschnell hinzu und haut mit seinem Hammer auf den Tisch. Es gibt Applaus, und der neue Chef nutzt den Rückenwind, rattert einen anderen Kurzbeschluss herunter und schlägt wieder mit dem Hammer zu.
Der Gipfel wird zur Farce.
Jetzt geht es nur noch darum, dass die Konferenz nicht in totalem Chaos endet, sondern wenigstens mit einem formalen Beschluss, dass nichts beschlossen worden ist - und mit der Chance, irgendwie weiterzumachen. Die Stakkato-Strategie des Neuen geht nicht auf. Es gibt noch eine Nachfrage des Sudan. Der Präsident versteht sie nicht und bittet um Wiederholung. China meldet sich zu Wort und erhebt Einspruch dagegen, dass der Vorstand der Konferenz eigenmächtig handelt.
"Ladies and Gentlemen, ich fahre jetzt nach Hause"
Indien, Saudi-Arabien, Sudan machen Einwürfe. Um 11.30 Uhr betritt Uno-Generalsekretär Ban Ki Moon die Bühne. Er hält die Rede, die er hätte halten sollen, wenn die Konferenz gelungen wäre: "Es ist ein großes Vergnügen, mit Ihnen an der Bekämpfung des Klimawandels zu arbeiten... Es war sehr schwierig, es gab dramatische und emotionale Momente... Ich hoffe, unsere erhitzte Diskussion hat nicht nur Erderwärmung beigetragen. Sie haben gezeigt, was globale Führungskraft bedeutet... Wir haben uns auf viele wichtige Punkte geeinigt, auf das Zwei-Grad-Ziel, auf den Schutz der Wälder, auf einen Sofortfonds von 30 Milliarden Dollar und einen Grünen Fonds von 100 Milliarden Dollar im Jahr 2020... Eine sofortige Umsetzung ist nötig und eine Transformation dieses Akkords in ein rechtsverbindliches Abkommens im kommenden Jahr... Sie waren der Herausforderung gewachsen während dieser Konferenz. Heute sind wir einen entscheidenden Schritt nach vorne getreten."
Ban Ki Moon sagt vor der Presse, er habe nur zwei Stunden geschlafen. Vielleicht hat er nach dem Aufwachen das Manuskript verwechselt. Seine Abschlussrede ist höchstens ein Ausdruck verzweifelter Hoffnung, wenn nicht von Wirklichkeitsverlust. Denn inhaltlich beschlossen wurde in Kopenhagen nichts. Die Ziele im "Akkord", die in fast jedermanns Urteil weder ausreichend noch verbindlich waren, wurden lediglich "zur Kenntnis genommen."
Um 12 Uhr enthüllt der Konferenzpräsident, woher er kommt: "Ladies and Gentlemen, ich räume diesen Posten und werde durch jemanden ersetzt, denn ich fahre jetzt nach Hause nach Nassau, wo es soweit ich weiß 25 Grad Celsius warm ist."
Der neue Veranstaltungsleiter hat ein Problem: "Ich hoffe, die Übersetzer sind nicht zu müde, um noch arbeiten zu können." Sie halten durch. Die Sprecherin der kleinen Inselstaaten zieht eine vernichtende Bilanz: Kein verbindliches Ergebnis, keine Ziele, die sich an der Wissenschaft orientieren. "Wir entschuldigen uns bei jedem Delegierten, der sich verletzt oder betrogen fühlt. Das genaue Gegenteil war unser Ziel."
Eine rührende Geste.
Noch rührender ist nur, dass die Dame neun Stunden nach Beginn dieser Plenardebatte wieder das 1,5-Grad-Ziel ins Spiel bringt, das die Großmächte doch so effektiv versenkt hatten. Zahlreiche Sprecher geben zu, wegen Müdigkeit nicht mehr ganz im Besitz ihrer Kräfte zu sein.
Alles liegt in Trümmern
Um 12.50 Uhr leeren sich die Reihen. Das Großereignis verliert sich in Bürokratismen: "Wir brauchen eine Fußnote, um diesen Klärungsversuch zu klären." Ein neuer Vertreter des Sudan, Antreiber des Großkonflikts im Saal, dankt für das "wunderbare Ergebnis dieser Sitzung". Das nutzt der Chef-Chinese dazu, sich von dem Dokument zu distanzieren, das sein Ministerpräsident Wen Jiabao erst am Vortag mit Barack Obama abgeschlossen hatte. Es werde nicht akzeptiert oder unterstützt, sondern nur zur Kenntnis genommen, das sei sehr wichtig. Konkrete Verpflichtungen ergäben sich darauf nicht. Irgendwo werde sich schon eine Fußnote finden lassen, wo es sich unterbringen lasse, dass jeder Staat dieses Dokument unterzeichnen könne oder auch nicht.
Die Forderung der USA, den Akkord rechtlich zu stärken, wies China zurück. Selbst die amerikanisch-chinesische Achse, die in Kopenhagen jeden Erfolg verhindert hatte, ist brüchig.
Auch Indien distanziert sich deutlich von dem Akkord, dem Deal-Dokument. Und der Konferenzpräsident muss immer und immer wieder betonen, dass der Text weder beschlossen wurde noch konkrete Verpflichtungen mit sich bringt. "Wir könnten seine Existenz anerkennen, ohne zu sagen, was er ist und was er bedeutet", ergänzt der Unterhändler Russlands.
Um 14 Uhr bringt Jonathan Pershing, stellvertretender Delegationsleiter, Verzweiflung über diese Entwicklung zum Ausdruck: "Wir dachten, dass die Führer dieser Nationen gestern dem Text zugestimmt haben, deshalb sind wir nun ein bisschen überrascht, dass dies wieder in Frage gestellt wird. Ich möchte betonen, dass wir uns selbst an das Dokument binden, es aber nicht mehr verändert werden darf, da es von den Staats-und Regierungschefs vereinbart wurde."
Jetzt liegt endgültig alles in Trümmern: Der Text des großen Führertreffens vom Freitag, der im Plenum des Gipfels an einer kleinen Gruppe Länder scheiterte, wird nicht einmal von seinen Initiatoren respektiert. Ein Uno-Polizist fragt, wann die Konferenz zu Ende ist. Als er hört, dass es noch lange dauert, sagt er: "Fuck."
Der Gipfel des Versagens endet absurd und bitter.
Mitarbeit: Christoph Seidler 19.12.2009
Kommentar der IKS
Wenn man diese Beobachtungen über den Ablauf des Gipfels liest, kann man eigentlich nicht genügend Abscheu vor den dort versammelten Führern finden.
Während sich immer mehr besorgniserregende Nachrichten über die zunehmende Umweltzerstörung häufen und es klar wird, dass die Zeit abzulaufen droht, haben diese Leute nichts anderes im Sinn gehabt, als ihre nationalen Wirtschaftsinteressen auf höchster Ebene zu vertreten. Hinter den üblichen Festungsmauern, um sich vor den Demonstranten zu schützen, für die man genügend Repressionsmittel bereit hielt, fetzten die Führer der Welt sich um die Kostenübernahme der ohnehin schon völlig unzureichenden Reduktionsmaßnahmen. Was kann man von den Vertretern der Kapitalistenklasse anders erwarten?
Das Anliegen der Staatschefs der „armen“ und Schwellenländer war angeblich die Verteidigung ihrer nationalen Souveränität. Man wolle sich von den „reichen“ Ländern, den Industriestaaten nichts aufzwingen lassen, sondern selbstbestimmt handeln. Ob den Führern der großen oder kleinen, reichen oder armen Staaten, ihnen allen ging es tatsächlich nur ums nationale Interesse. Anstatt sich um den Fortbestand des Planeten zu kümmern, haben die Führer dort ein plastisches Beispiel der Art und Weise gezeigt, wie Konkurrenz und nationalstaatliche Interessensvertretung dazu führen, den Planeten und die Menschheit auf dem Altar des Profits zu opfern.
Und während der US-Präsident nach seinem Coup schon wieder Richtung Washington düste, wurde dort am gleichen Tag der US-Verteidigungshaushalt vorgelegt.
„Der US-Senat hat grünes Licht für den größten Verteidigungshaushalt der Geschichte der Vereinigten Staaten gegeben. Mit 88 zu zehn Stimmen verabschiedeten die Senatoren am Samstag (19.12.) den Etat in Höhe von 626 Milliarden Dollar für das bereits vor drei Monaten angelaufene Haushaltsjahr. Der Etat sieht Ausgaben von 128,3 Milliarden Dollar für die Kriege im Irak und in Afghanistan vor. Die US-Regierung hat bereits signalisiert, dass sie schätzungsweise weitere 30 Milliarden Dollar benötigen wird, nachdem Obama kürzlich die Entsendung 30 000 zusätzlicher Soldaten nach Afghanistan.“
Damit wir uns der Proportionen und Prioritäten bewusst sind: Während die ganze Staatengemeinschaft gerade mal 30 Milliarden Dollar als Sofortfonds und 100 Milliarden Dollar im Jahre 2020 bereitstellen will, absorbiert das Krebsgeschwür Militarismus in Afghanistan allein in einem Jahr für die Entsendung von 30.000 zusätzlicher Soldaten nach Afghanistan 30 Milliarden Dollar…
Wir werden in kürze näher auf die Ergebnisse des Kopenhagener Gipfels eingehen. Weltrevolution 20.12.09
Aktuelles und Laufendes:
- Ökologie [250]
- Kopenhagen Klimagipfel [287]
- Umweltpolitik [288]
Internationalisme 1947: Was die Revolutionäre von den Trotzkisten unterscheidet
- 4082 reads
Nachfolgend veröffentlichen wir zwei Artikel aus dem Jahr 1947 aus der Zeitschrift Internationalisme, Organ der Kommunistischen Linken Frankreichs (GCF)[1], die sich mit der Frage des Trotzkismus befassen. Damals schon hatte sich der Trotzkismus durch seine Aufgabe des proletarischen Internationalismus hervorgetan, als er sich im Gegensatz zu den Gruppen der Kommunistischen Linken[2] am 2. Weltkrieg beteiligte. In den 1930er Jahren hatte die Kommunistische Linke der opportunistischen Welle widerstanden, welche durch die Niederlage der weltweiten Welle revolutionärer Kämpfe von 1917-23 entstanden war. Unter diesen Gruppen definierte die Italienische Linke um die Zeitschrift Bilan (sie wurde 1933 gegründet) die Aufgaben der Stunde richtig. Gegenüber dem Weg in den Krieg darf man nicht die Grundprinzipien des Internationalismus verraten, man muss die 'Bilanz' des Scheiterns der revolutionären Welle und der russischen Revolution insbesondere erstellen. Die Kommunistische Linke bekämpfte die von der degenerierenden Dritten Internationalen verbreiteten opportunistischen Positionen, insbesondere die von Trotzki vertretene Politik der Einheitsfront mit den sozialistischen Parteien, die jegliche zuvor gewonnene Klarheit hinsichtlich der ins Lager des Kapitalismus übergewechselten Parteien über Bord warf. Mehrfach musste sie ihre politische Herangehensweise mit der Methode der damals noch proletarischen Strömung um Trotzki direkt gegenüberstellen, insbesondere als versucht wurde, die verschiedenen politischen Gruppen, die sich der Politik der Komintern und der stalinisierten Parteien entgegenstellten, zu vereinigen.[3]
Mit der gleichen Methode, die Bilan angewandt hatte, analysierte die Kommunistische Linke Frankreichs die Politik des Trotzkismus, die sich nicht so sehr durch ihre "Verteidigung der UdSSR" auszeichnet, auch wenn diese Frage am klarsten ihre Verirrung zum Ausdruck bringt, sondern durch ihre Haltung gegenüber der Frage des imperialistischen Krieges. Wie der erste Artikel "Die Funktion des Trotzkismus" zeigt, wurde die Beteiligung am Krieg seitens dieser Strömung nicht an erster Stelle bestimmt durch deren Willen zur Verteidigung der UdSSR, wie die Tatsache belegt, dass einige ihrer Tendenzen, welche die These vom "entarteten Arbeiterstaat" verwarfen, sich dennoch am imperialistischen Krieg beteiligten. Noch entscheidender war die Idee des „geringeren Übels“, der Beteiligung am Kampf gegen „die ausländische Besatzung“ und der „Antifaschismus“. Dieses Merkmal des Trotzkismus tritt besonders deutlich im zweiten Artikel "Bravo Abd-al-Krim oder die kurze Geschichte des Trotzkismus" zum Vorschein, in der festgestellt wird, dass die "gesamte trotzkistische Geschichte sich um die Frage der "Verteidigung" von irgendetwas dreht", die im Namen des geringeren Übels erfolgt. Dieses "irgendetwas" war alles andere als etwas Proletarisches. Dieses Markenzeichen des Trotzkismus hat sich seitdem nicht geändert, wie die verschiedenen aktivistischen Illustrationen des gegenwärtigen Trotzkismus belegen, wie auch sein Drängen, für ein Lager gegen ein anderes in den zahlreichen Konflikten, die den Planeten auch seit der Auflösung der UdSSR übersäen, Stellung zu beziehen.
An der Wurzel dieser Irrfahrt des Trotzkismus findet man, wie der erste Artikel betont, die Zuweisung einer fortschrittlichen Rolle "bestimmter Fraktionen des Kapitalismus, bestimmter kapitalistischer Länder (und wie das Übergangsprogramm ausdrücklich sagt, der meisten Länder).
Dieser Auffassung zufolge "ist die Befreiung des Proletariats nicht das Ergebnis des Kampfes, bei dem das Proletariat als Klasse gegenüber dem gesamten Kapitalismus auftritt, sondern diese wird das Ergebnis einer Reihe von politischen Kämpfen sein, im engen Sinne des Wortes und bei denen dieses durch schrittweise Bündnisse mit verschiedenen politischen Fraktionen der Bourgeoisie gewisse Fraktionen eliminieren wird und es somit schrittweise schaffen wird, die Bourgeoisie zu schwächen, sie zu besiegen, indem sie gespalten und scheibchenweise geschlagen wird.“ Da gibt es nichts mehr revolutionär Marxistisches.
Die Funktion des Trotzkismus
(Internationalisme n° 26 – September 1947)
Es ist ein großer, weit verbreiteter Fehler zu meinen, was die Revolutionäre von den Trotzkisten unterscheidet, sei die Frage der "Verteidigung der UdSSR".
Es ist selbstverständlich, dass die revolutionären Gruppen, welche die Trotzkisten gerne mit ein wenig Verachtung als "extreme Linke" bezeichnen (eine verächtliche Einschätzung der Trotzkisten gegenüber den Revolutionären, die dem gleichen Geist entspricht wie dem der "Hitler-Trotzkisten", welchen die Stalinisten verwenden); es ist selbstverständlich, dass die Revolutionäre jede Art Verteidigung des russischen kapitalistischen Staates (Staatskapitalismus) verwerfen. Aber den russischen Staat nicht zu verteidigen, ist keineswegs die theoretische und programmatische Grundlage revolutionärer Gruppen. Und es ist nur eine politische Konsequenz, die ganz normal in ihren allgemeinen Auffassungen, ihrer revolutionären Plattform enthalten ist und aus diesen hervorgeht. Umgekehrt stellt die "Verteidigung der UdSSR" keineswegs die Besonderheit des Trotzkismus dar.
Wenn von allen politischen Positionen, die sein Programm darstellen, die "Verteidigung der UdSSR" wirklich am stärksten hervorsticht und ihre Verirrung und Blindheit am deutlichsten zum Ausdruck bringt, würde man trotzdem einen großen Fehler begehen, wenn man den Trotzkismus nur aus diesem Blickwinkel betrachtet. Im äußersten Fall spiegelt diese Verteidigung die typischste und klarste abszessartige Fixierung des Trotzkismus wider. Dieser Abszess ist so offensichtlich, dass sein Anblick immer mehr Mitglieder der Vierten Internationale anekelt, und wahrscheinlich ist es eine der Ursachen dafür, dass einige ihrer Sympathisanten davor zurückschrecken, in diese Organisation einzutreten. Aber dieser Abszess ist nicht die Krankheit, sondern nur die Stelle, wo diese in Erscheinung tritt.
Wenn wir so sehr auf diesem Punkt bestehen, geschieht dies, weil beim Anblick der äußeren Erscheinungen einer Krankheit so viele Leute sich erschrecken, aber diese dann auch sehr leicht dazu neigen, sich schnell zu beruhigen, sobald die äußeren, erkennbaren Zeichen aus dem Blick geraten. Sie vergessen, dass eine "weißgewaschene Krankheit" keine geheilte Krankheit ist. Diese Art Leute sind sicherlich ebenso gefährlich, ebenso anfällig, wenn nicht noch mehr für die Verbreitung von Korruption wie diejenigen, die aufrichtig meinen, davon geheilt zu sein.
Die "Workers' Party" in den USA (eine dissidente trotzkistische Organisation, die durch den Namen ihres Führers, Shachtman bekannt ist), die Tendenz G. Munis in Mexiko[4], die Minderheiten um Gallien und Chaulieu in Frankreich, all diese Minderheitentendenzen der IV. Internationale, die aufgrund der Tatsache, dass sie die traditionelle Verteidigung Russlands verwerfen, glauben vom "Opportunismus" der trotzkistischen Bewegung geheilt zu sein (jedenfalls behaupten sie dies). In Wirklichkeit bleiben sie weiterhin von dieser Ideologie stark geprägt und von ihr total eingenommen.
Das wird dadurch offensichtlich, wenn man die brennendste Frage anschaut, nämlich diejenige, die am wenigsten Ausflüchte offen lässt, welche am unnachgiebigsten die Klassenpositionen des Proletariats und der Bourgeoisie aufeinander prallen lässt, d.h. die Frage der Haltung gegenüber dem imperialistischen Krieg. Was sehen wir?
Die einen wie die anderen, Mehrheiten und Minderheiten, beteiligen sich alle mit unterschiedlichen Slogans am imperialistischen Krieg.
Man möge jetzt nicht die mündlichen Erklärungen der Trotzkisten gegen den Krieg zitieren, um dies zu widerlegen. Wir kennen diese sehr gut. Worauf es ankommt, sind nicht die Erklärungen, sondern die praktische Politik, die aus all den theoretischen Positionen hervorgeht und die in der ideologischen und praktischen Unterstützung der kriegstreibenden Kräfte konkretisiert wird. Es zählt hier nicht, mit welchem Argument diese Beteiligung gerechtfertigt wurde. Die Verteidigung der UdSSR ist sicherlich eine der wichtigsten Kernfragen, durch die das Proletariat an den imperialistischen Krieg gefesselt und in diesen getrieben wird. Aber dies ist nicht der einzige Schlüssel. Die trotzkistischen Minderheiten, welche die Verteidigung der UdSSR verwarfen, haben genau wie die Linkssozialisten und die Anarchisten andere Gründe gefunden, die nicht weniger gültig und nicht weniger von einer bürgerlichen Ideologie inspiriert waren, um ihre Beteiligung am imperialistischen Krieg zu begründen. Aus der Sicht der einen war es die Verteidigung der « Demokratie », aus der Sicht der anderen der « Kampf gegen den Faschismus » oder die Unterstützung der « nationalen Befreiung » oder des « Selbstbestimmungsrechts der Völker ».
Für alle war es eine Frage des "geringeren Übels", welche sie zur Kriegsbeteiligung oder in die Résistance auf Seiten eines imperialistischen Blocks gegen einen anderen trieb.
Die Partei Shachtmans hatte völlig recht, den offiziellen Trotzkisten vorzuwerfen, dass sie den russischen Imperialismus unterstützten, welcher aus ihrer Sicht kein "Arbeiterstaat" mehr war; aber damit wurde Shachtman noch lange nicht zu einem Revolutionär, denn er erhob diesen Vorwurf nicht ausgehend von einer Klassenposition des Proletariats gegen den imperialistischen Krieg, sondern aufgrund der Tatsache, dass Russland ein totalitäres Land ist, wo es weniger "Demokratie" als anderswo gibt. Seiner Ansicht nach musste man konsequenterweise Finnland gegen den russischen Aggressor unterstützen, das weniger "totalitär" und demokratischer sei[5].
Um das Wesen seiner Ideologie zu zeigen, insbesondere hinsichtlich der zentralen Frage des imperialistischen Kriegs, braucht der Trotzkismus keineswegs, wie wir eben gesehen haben, auf die Position der Verteidigung der UdSSR zurückzugreifen. Diese Verteidigung der UdSSR erleichtert natürlich seine Position der Kriegsbeteiligung, wodurch er diese hinter einer pseudo-revolutionären Phrase verbergen kann, aber von sich aus vertuscht er sein tieferes Wesen und verhindert, die Frage des Wesens der trotzkistischen Ideologie in aller Deutlichkeit zu stellen.
Lassen wir einmal zur Erreichung einer größeren Klarheit die Existenz Russlands außer Acht, oder besser gesagt all die Spitzfindigkeit hinsichtlich des sozialistischen Wesens des russischen Staates, mit Hilfe derer die Trotzkisten das eigentliche Problem des imperialistischen Krieges und der Haltung des Proletariats vernebeln. Stellen wir deutlich die Frage der Haltung der Trotzkisten im Krieg. Die Trotzkisten werden natürlich mit einer allgemeinen Antwort gegen den Krieg reagieren.
Aber sobald die Litanei vom "revolutionären Defätismus" im Abstrakten korrekt heruntergeleiert worden ist, fangen sie sofort konkret an, mit spitzfindigen "Unterscheidungen" Einschränkungen zu machen, sie sagen "aber"… usw., was sie in der Praxis dazu führt, dass sie Partei für einen Kriegsteilnehmer ergreifen und die Arbeiter dazu aufrufen, sich am imperialistischen Abschlachten zu beteiligen.
Wer mit dem trotzkistischen Milieu in Frankreich während der Jahre 1939-45 irgendwie in Kontakt stand, kann Zeugnis davon ablegen, dass die bei ihnen vorherrschenden Gefühle nicht so sehr von der Position der Verteidigung Russlands bestimmt waren, sondern von der Wahl des "geringeren Übels", der Wahl des Kampfes gegen die "ausländische Besatzung" und den "Antifaschismus".
Dies erklärt ihre Beteiligung an der ‘Résistance’[6], an der F.F.I.[7] und bei der Befreiung. Und wenn die PCI[8] Frankreichs von den Sektionen anderer Länder gelobt wurde für die Rolle, die sie bei dem, die wie sie es nannten « Volksaufstand » der Befreiung spielte, lassen wir ihnen die Befriedigung, die sie durch den Bluff der Bedeutung ihrer Beteiligung empfinden (welch große Bedeutung mögen die wenigen Dutzenden Trotzkisten bei der « großen Volkserhebung » gehabt haben !). Aber wir wollen vor allem den politischen Inhalt solch eines Lobs im Kopf behalten.
Welches Kriterium für die revolutionäre Haltung im imperialistischen Krieg ?
Die Revolutionäre gehen von der Feststellung des imperialistischen Stadiums aus, das von der Weltwirtschaft erreicht worden ist. Der Imperialismus ist kein nationales Phänomen. Die Gewalt der kapitalistischen Widersprüche zwischen dem Grad der Entwicklung der Produktivkräfte – des gesamten gesellschaftlichen Kapitals – und der Entwicklung des Marktes bestimmt die Gewalt der Widersprüche unter den Imperialisten. Auf dieser Stufe gibt es keine nationalen Kriege mehr. Die imperialistische Weltstruktur bestimmt die Struktur aller Kriege. Im Zeitalter des Imperialismus gibt es keine « fortschrittlichen » Kriege. Der einzige Fortschritt besteht nur in der gesellschaftlichen Revolution. Die historische Alternative, vor der die Menschheit steht, ist die sozialistische Revolution oder der Niedergang, das Versinken in der Barbarei durch die Zerstörung des durch die Menschheit angehäuften Reichtums, die Zerstörung der Produktivkräfte und die ständigen Massaker des Proletariats in einer unendlichen Reihe von lokalen und generalisierten Kriegen. Es handelt sich also um ein Klassenkriterium gegenüber der Analyse der geschichtlichen Entwicklung der Gesellschaft, das durch die Revolutionäre aufgeworfen wird.
« Aber nicht alle Länder der Welt sind imperialistisch. Im Gegenteil. Die Mehrheit der Länder sind Opfer des Imperialismus. Einige Kolonialländer oder Halbkolonialländer versuchen zweifelsohne den Krieg auszunutzen, um die Geissel der Versklavung abzuschütteln. Was diese Länder betrifft, ist der Krieg kein imperialistischer, sondern ein Befreiungskrieg. Die Aufgabe des internationalen Proletariats besteht darin, den im Krieg unterdrückten Ländern gegen die Unterdrücker zu helfen » (Das Übergangsprogramm, Kapitel : Der Kampf gegen Imperialismus und Krieg).
So bezieht sich das trotzkistische Kriterium nicht auf die historische Periode, in der wir leben, sondern es schafft und bezieht sich auf einen abstrakten und falschen Begriff des Imperialismus. Nur die Bourgeoisie eines dominierenden Landes sei imperialistisch. Der Imperialismus ist keine politisch-ökonomische Stufe des Weltkapitalismus, sondern nur des Kapitalismus in einigen Ländern, während die anderen kapitalistischen Länder, welche die Mehrheit ausmachen, nicht imperialistisch sind. Wenn man dies rein formell betrachtet, werden heute alle Länder der Welt ökonomisch von zwei Ländern beherrscht: den USA und Russland. Kann man daraus schlussfolgern, dass ausschließlich die Bourgeoisie dieser beiden Länder imperialistisch ist und die Gegnerschaft des Proletariats gegenüber dem Krieg nur in diesen beiden Ländern zum Tragen kommt?
Besser noch, wenn man der trotzkistischen Argumentation folgt und Russland dabei herausnimmt, da das Land per Definition „nicht imperialistisch“ ist, gelangt man zu der absurden Schlussfolgerung, dass nur ein Land auf der Welt imperialistisch ist: die USA. Damit kommen wir zu der tröstlichen Schlussfolgerung, dass das Proletariat allen anderen Ländern der Welt helfen muss, da sie alle ‚nicht-imperialistisch und unterdrückt sind’. Schauen wir konkret, wie diese trotzkistische Unterscheidung sich in der Praxis äußert.
1939 ist Frankreich ein imperialistisches Land: revolutionärer Defätismus
1940-45 war Frankreich besetzt: Von einem imperialistischen Land wurde es zu einem unterdrückten Land. Sein Krieg wurde ein "Befreiungskrieg", "Es ist Aufgabe des Proletariats diesen Kampf zu unterstützen". Perfekt! Aber plötzlich wurde Deutschland 1945 zu einem besetzten und 'unterdrückten' Land. Damit wurde es zur Aufgabe des Proletariats, eine eventuelle Befreiung Deutschlands gegen Frankreich zu unterstützen. Was für Frankreich und Deutschland zutrifft, gilt ebenso für irgendein anderes Land: Japan, Italien, Belgien usw. Man braucht jetzt nicht die Kolonien und halb-kolonialen Länder zu erwähnen. Im Zeitalter des Imperialismus wird jedes Land, das beim rücksichtslosen Konkurrenzkampf zwischen den Kapitalisten nicht das Glück oder die Kraft hat Sieger zu werden, de facto zu einem "unterdrückten" Land. Beispiel: Deutschland und Japan, und im entgegengesetzten Sinn – China.
Das Proletariat hätte somit zur Aufgabe, seine Zeit damit zu verbringen, auf der imperialistischen Waagschale hin-und her zu hüpfen, je nach dem, welche Anweisungen von den Trotzkisten erteilt werden. Es sollte sich dabei abschlachten lassen im Namen dessen, was die Trotzkisten folgendermaßen umschreiben: "Einen gerechten und fortschrittlichen Krieg zu unterstützen…" (siehe das Übergangsprogramm – gleiches Kapitel).
Dies ist der grundsätzliche Charakter des Trotzkismus, der jeweils in allen Situationen und allen seinen Positionen dem Proletariat eine Alternative anbietet, die einen echten Gegensatz und eine Lösung als Klasse gegen die Bourgeoisie darstellt, aber in Wirklichkeit nur eine Wahl zwischen zwei "unterdrückten" kapitalistischen Kräften bedeutet: zwischen einer faschistischen und antifaschistischen Bourgeoisie, zwischen "Reaktionären " und "Demokraten", zwischen Monarchie und Republik, zwischen imperialistischen Krieg und "gerechten und fortschrittlichen" Kriegen.
Ausgehend von dieser ewigen Wahl zwischen dem "geringeren Übel" haben sich die Trotzkisten am imperialistischen Krieg beteiligt. Die Notwendigkeit der Verteidigung der UdSSR stand keineswegs im Vordergrund. Bevor diese verteidigt wurde, hatten sie sich schon am Spanienkrieg (1936-1938) im Namen der Verteidigung des republikanischen Spaniens gegen Franco beteiligt. Dann verteidigten sie das China Chiang Kai-Sheks gegen Japan.
Die Verteidigung der UdSSR erscheint somit nicht mehr als Ausgangs- sondern als Endpunkt ihrer Positionen. Sie spiegelt unter anderem ihre Grundprinzipien wider. Diese Grundprinzipien verlangen nicht, dass die Arbeiterklasse eine eigenständige Klassenposition gegenüber dem imperialistischen Krieg hat, sondern dass sie eine Unterscheidung zwischen den verschiedenen nationalen kapitalistischen Gruppierungen treffen kann und muss, die sich zu einem gewissen Zeitpunkt gegenüberstehen. Sie müssen als „fortschrittlich“ erachtet werden und ihre Hilfe erhalten; d.h. in der Regel soll der schwächere, rückständigere, der ‚unterdrückte’ Flügel der Bourgeoisie unterstützt werden.
Diese Position zu einer so grundsätzlichen, zentralen Frage wie der des Krieges stellt die Trotzkisten von vornherein als politische Strömung außerhalb des Proletariats und rechtfertig als solche schon die Notwendigkeit eines totalen Bruchs der proletarischen revolutionären Kräfte mit ihnen.
Die Trotzkisten machen die Arbeiterklasse zum Anhängsel der für „fortschrittlich“ erklärten Bourgeoisie
Aber wir haben nur eine Wurzel des Trotzkismus aufgegriffen. Im Allgemeinen stützt sich die trotzkistische Auffassung auf die Idee, dass die Befreiung des Proletariats nicht das Ergebnis eines „reinen“ Kampfes sei, bei dem das Proletariat als Klasse gegenüber dem gesamten Kapitalismus reagiert, sondern das Ergebnis einer Reihe von politischen Kämpfen in einem engeren Sinne, bei dem nach schrittweisen Bündnissen mit verschiedenen Fraktionen der Bourgeoisie einige ausgelöscht werden sollten, wodurch es dem Proletariat stufenweise gelingen würde, die Bourgeoisie zu schwächen, sie mittels Spaltung zu besiegen und sie scheibchenweise zu schlagen.
Dies ist sicherlich eine strategisch sehr weitsichtige, subtile und maliziöse Sicht, die sich in dem Slogan „getrennt marschieren, gemeinsam schlagen….“ spiegelt. Es handelt sich um eine der Grundlagen der trotzkistischen Auffassung, die auch in der Theorie der „permanenten Revolution“ bestätigt wird (eine neue Art). Der zufolge meint die permanente Revolution, dass die Revolution selbst als eine ständige Abfolge von politischen Ereignissen als eines von vielen anderen Ereignissen gesehen wird. Dieser Auffassung zufolge ist die Revolution kein Prozess der ökonomischen und politischen Überwindung einer in Klassen gespaltenen Gesellschaft. Der Aufbau des Sozialismus aber ist nur möglich und kann erst begonnen werden, nachdem das Proletariat die Macht ergriffen hat.
Es stimmt, dass diese Auffassung von der Revolution zum Teil dem Schema Marxens « treu » bleibt. Aber dies ist nur eine Treue gegenüber dem Wort. Marx vertrat dieses Schema 1848, als die Bourgeoisie noch eine historisch revolutionäre Klasse darstellte. In der Hitze der bürgerlichen Revolutionen, die über eine Reihe von Ländern Europas hinweg zogen, hoffte Marx, dass diese nicht auf der Stufe einer bürgerlichen Revolution stehen bleiben würden, sondern von dem Proletariat weiter bis zur sozialistischen Revolution getragen würden.
Auch wenn die Wirklichkeit Marx nicht bestätigt hat, handelte es sich bei ihm um eine sehr gewagte revolutionäre Auffassung, die den historischen Möglichkeiten voraus war. Die permanente Revolution der Trotzkisten ist aber eine völlig andere Sache. Den Worten Marxens bleibt sie schon treu, aber sie bleibt dem Geist nicht treu. Ein Jahrhundert nach dem Ende der bürgerlichen Revolutionen, zur Zeit des Weltimperialismus, während die kapitalistische Gesellschaft insgesamt in ihren Niedergang eingetreten ist, meint der Trotzkismus, dass bestimmte Fraktionen des Kapitalismus in einigen kapitalistischen Ländern (und wie es das Übergangsprogramm ausdrücklich sagt, in den meisten Ländern) eine fortschrittliche Rolle spielen können.
Marx wollte das Proletariat 1848 an die Spitze der Gesellschaft treten lassen; aber die Trotzkisten lassen die Arbeiterklasse 1947 zu einem Anhängsel der als « fortschrittlich » ernannten Bourgeoisie werden. Man kann sich kaum eine groteskere Karikatur, eine gröbere Verzerrung des Schemas der permanenten Revolution von Marx als die der Trotzkisten vorstellen.
So wie Trotzki dies im Jahre 1905 wieder aufgegriffen und formuliert hatte, behielt dieses Schema der permanenten Revolution seine revolutionäre Bedeutung. 1905, zu Beginn des Zeitraums des Imperialismus, als der Kapitalismus noch viele Jahre Wohlstand vor sich zu haben schien, kam Trotzki in dem Land, das in Europa mit am rückständigsten war, und wo weiterhin noch eine politisch feudale Infrastruktur bestand, wo die Arbeiterbewegung ihre ersten Schritte machte, gegenüber all den Fraktionen der russischen Sozialdemokratie, die den Eintritt der bürgerlichen Revolution ankündigten, gegenüber Lenin, der aufgrund vieler Einschränkungen nicht wagte weiter zu gehen, als der zukünftigen Revolution bürgerliche Reformen unter einer demokratisch revolutionären Führung durch Arbeiter und Bauern zuzuschreiben, in dieser Situation kam Trotzki unzweifelhaft das Verdienst zu, verkündet zu haben, dass die Revolution entweder eine sozialistische sein werde, die der Diktatur des Proletariats, oder dass sie keine Revolution sein werde.
Die Betonung der Theorie der permanenten Revolution lag auf der Rolle des Proletariats, das damals zur einzig revolutionären Klasse geworden war. Diese war eine sehr kühne revolutionäre Verkündung, die sich ganz gegen die kleinbürgerlichen, verängstigten und skeptischen sozialistischen Theoretiker richtete sowie gegen die zögernden Revolutionäre, denen es an Vertrauen in die Arbeiterklasse mangelte.
Während heute die Erfahrung von mehr als 40 Jahren diese theoretischen Elemente vollauf bestätigt hat, ist die Theorie der permanenten Revolution "neuen Verschnitts" in einer kapitalistischen Welt, die ihren Höhepunkt überschritten hat und schon in ihren Niedergang eingetreten ist, nur gegen die revolutionären "Illusionen" dieser Tollköpfe der extremen Linke, dieser Sündenböcke des Trotzkismus, gerichtet.
Heute wird die Betonung auf die rückständigen Illusionen der Proletarier gelegt, auf die Unvermeidbarkeit der Zwischenstufen, auf die Notwendigkeit einer realistischen und positiven Politik, auf die Arbeiter- und Bauernregierungen, auf die gerechten Kriege und fortschrittlich nationalen Revolutionen der Befreiung.
Dies ist heute das Schicksal der permanenten Revolution, sie liegt in den Händen der Jüngeren, die nur die Schwächen aufrechterhalten haben, aber nichts von der Größe, der Stärke und der revolutionären Tugend des Meisters übernommen haben.
Die "fortschrittlichen" Tendenzen und Fraktionen der Bourgeoisie und den revolutionären Weg des Proletariats zu unterstützen, die Spaltung und Gegensätze unter den Kapitalisten auszunutzen, sind nichts als die beiden Seiten der gleichen trotzkistischen Theorie. Wir haben gesehen, was aus der ersten geworden ist, schauen wir uns nun die zweite an.
Worin bestehen die Divergenzen im kapitalistischen Lager?
Erstens in der Art und Weise, wie man besser die kapitalistische Ordnung schützt. D.h. besser die Ausbeutung des Proletariats sicherstellt. Zweitens hinsichtlich der unterschiedlichen ökonomischen Interessen verschiedenen Gruppen der Kapitalistenklasse. Trotzki, der sich oft durch seinen bildhaften Stil und seine Metapher hat fortreißen lassen, so dass er manchmal den wirklichen gesellschaftlichen Inhalt aus den Augen verlor, hat stark auf diesem zweiten Aspekt bestanden. "Man darf nicht den Kapitalismus als eine Einheit sehen", meinte er. "Die Musik ist auch ein Ganzes, aber man wäre ein schlechter Musiker, wenn man nicht die unterschiedlichen Noten lesen könnte." Diese Metapher wandte er auch auf die gesellschaftliche Bewegung und die Klassenkämpfe an. Niemand würde wirklich vorhandene Interessensunterschiede - auch nicht innerhalb der Kapitalistenklasse - und die daraus entstehenden Kämpfe leugnen oder verkennen. Es geht darum, welchen Platz diese Interessensunterschiede in der Gesellschaft und in den verschiedenen Kämpfen einnehmen. Man wäre ein sehr schlechter revolutionärer Marxist, wenn man die Kämpfe zwischen den Klassen und den Kampf zwischen Gruppen innerhalb der gleichen Klasse auf die gleiche Ebene stellt. "Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen“. Diese Grundsatzthese des Kommunistischen Manifestes verkennt natürlich nicht die Existenz von zweitrangigen Auseinandersetzungen verschiedener wirtschaftlicher Gruppen und Individuen innerhalb der gleichen Klasse und deren relative Bedeutung. Aber der Motor der Geschichte sind nicht diese zweitrangigen Faktoren, sondern der Kampf zwischen der herrschenden Klasse und der unterdrückten Klasse. Wenn eine neue Klasse in der Geschichte entsteht und eine alte ersetzt, die unfähig geworden ist, die Gesellschaft zu führen, d.h. in einer historischen Epoche der Umwälzungen und der gesellschaftlichen Revolution, bestimmt und dominiert der Kampf zwischen diesen beiden Klassen absolut all die gesellschaftlichen Ereignisse und alle zweitrangigen Konflikte. In solchen historischen Zeiträumen wie unserem auf die zweitrangigen Konflikte zu bestehen, mit deren Hilfe man die Richtung der Bewegung des Klassenkampfes, seine Richtung und sein Ausmaß bestimmen möchte, zeigt sonnenklar auf, dass man nichts von den Grundsätzen der marxistischen Methode verstanden hat. Man betreibt nur abstrakte Spielereien mit Musiknoten und unterwirft konkret den gesellschaftlichen historischen Kampf des Proletariats den Zufälligkeiten der politischen Konflikte unter den Kapitalisten.
Diese ganze Politik beruht im Kern auf einem tiefgreifenden Mangel an Vertrauen in die eigenen Kräfte des Proletariats. Offensichtlich haben die letzten drei Jahrzehnte ununterbrochener Niederlagen tragisch die Unreife und die Schwäche des Proletariats deutlich werden lassen. Aber es wäre ein Fehler, die Wurzel dieser Schwächen in der Selbstisolierung des Proletariats zu suchen, in der Abwesenheit eines ausreichend weichen, anpassungsfähigen Verhaltens gegenüber den anderen Klassen, Schichten und politischen Strömungen, die der Arbeiterklasse feindlich gegenüber eingestellt sind. Das Gegenteil ist der Fall. Seit der Gründung der Komintern warnte man unaufhörlich vor der Kinderkrankheit der Linksradikalen; man entwarf die unrealistische Strategie der Eroberung der großen Massen, der Eroberung der Gewerkschaften, der revolutionären Ausnutzung der Parlamentstribüne, der politischen Einheitsfront mit dem "Teufel und seiner Großmutter" (Trotzki), der Beteiligung an Arbeiterregierungen in Sachsen usw.
Und das Ergebnis?
Ein Desaster. Jeder neuen Eroberung mit einer "sanften Strategie" folgte eine noch größere und tiefergreifende Niederlage. Um diese Schwäche auszugleichen, für die das Proletariat verantwortlich gemacht wurde, stützte man sich zur "Stärkung" des Proletariats nicht nur auf Kräfte, die außerhalb des Proletariats standen (Sozialdemokraten), sondern auch auf ultrareaktionäre Kräfte: "revolutionäre" Bauernparteien; internationale Bauernkonferenzen, internationale Konferenzen der Kolonialvölker. Je mehr Niederlagen das Proletariat einstecken musste, desto mehr Bündnisse en masse wurden errichtet und die Politik der Ausbeutung triumphierte in der Kommunistischen Internationale. Sicher liegt die Wurzel dieser Politik in der Existenz des russischen Staates, der seine Existenz zu rechtfertigen suchte und von seinem Wesen her nichts mit sozialistischer Revolution zu tun hatte, denn er war dem Proletariat fremd und Gegner der Ziele desselben.
Zur Aufrechterhaltung seiner Existenz und seiner Stärkung muss der Staat Bündnisse mit den "unterdrückten" Bourgeoisien, den "Völkern" und Kolonien und "fortschrittlichen" Ländern suchen; diese findet er auch, denn diese sozialen Gruppierungen müssen ebenso einen Staat errichten. Er kann über die Spaltung und die Konflikte zwischen anderen Staaten und kapitalistischen Gruppen spekulieren, weil er das gleiche Klassenwesen wie diese besitzt.
In diesen Konflikten kann die Schwächung einer dieser Antagonismen zu einer Bedingung für seine Verstärkung werden. Dies trifft aber auf die Arbeiterklasse und ihre Revolution nicht zu. Sie kann sich auf keinen dieser Verbündeten oder Kräfte stützen. Sie steht alleine da und steht immer in einem unüberwindbaren historischen Widerspruch zu all diesen Kräften und Leuten, die sich ihr gegenüber zu einer untrennbaren Einheit zusammenfügen.
Das Proletariat sich seiner Position und seiner historischen Aufgabe bewusst werden zu lassen, ihm die großen Schwierigkeiten seines Kampfes nicht zu vertuschen, ihm aufzuzeigen, dass es aber auch keine Wahl hat, wenn es seine menschliche und physische Existenz bewahren will, ihm zeigen, dass es trotz dieser Schwierigkeiten siegen kann und muss, dies ist der einzige Weg der Stärkung des Proletariats für seinen Sieg.
Aber wenn man versucht, diesen Schwierigkeiten auszuweichen, indem man für die Arbeiterklasse mögliche Verbündete sucht (auch nur vorübergehende) und ihm "fortschrittliche" Kräfte anderer Klassen anbietet, auf die sie sich in ihrem Kampf stützen sollte, heißt die Arbeiterklasse zu täuschen, um sie zu trösten, zu entwaffnen und sie in die Irre zu führen. Darin besteht die Funktion der Trotzkisten heute. Marc
"Bravo Abd-al-Krim" oder eine kurze Geschichte des Trotzkismus
(Internationalisme n° 24 – Juli 1947)
Einige Leute leiden unter einem Minderwertigkeitsgefühl, andere unter Schuldgefühlen, wieder andere unter Verfolgungswahn. Der Trotzkismus wiederum leidet unter einer Krankheit, die man mangels besserer Bezeichnung "Verteidigungsmanie" nennen könnte. Die ganze Geschichte des Trotzkismus dreht sich um die "Verteidigung" von irgendetwas. Und wenn die Trotzkisten unglücklicherweise in 'flauen Wochen' nichts und niemanden zum Verteidigen finden, werden sie sprichwörtlich krank. Dann erkennt man sie an ihren traurigen Gesichtern, ihren niedergeschlagenen Minen, ihrem verstörten Blick, wie sie wie ein Drogenabhängiger ihre tägliche Giftdosis suchen: eine Sache oder ein Opfer, für dessen Verteidigung sie eintreten könnten.
Gott sei Dank gibt es ein Russland, in dem es einmal eine Revolution gegeben hat. Dies dient den Trotzkisten ewig zur Rechtfertigung ihres Dranges der Verteidigung. Was immer in Russland passiert, bleiben die Trotzkisten unerschütterlich für die "Verteidigung der UdSSR", denn sie haben in Russland eine unerschöpfliche Quelle gefunden, welche ihr Laster der "Verteidigung" befriedigt.
Aber nicht nur die großen Verteidigungen zählen. Um das Leben des Trotzkismus zu bereichern, braucht man zusätzlich zu der großen Verteidigung die unsterbliche, bedingungslose "Verteidigung der UdSSR" – welche die Grundlagen und die Daseinsberechtigung des Trotzkismus liefern. Der Trotzkismus ist erpicht auf die "alltäglichen…Verteidigungen", das, was er "jeden Tag verteidigen" kann.
In der Niedergangsphase des Kapitalismus entfesselt dieser eine allgemeine Zerstörung, von der die Arbeiterklasse betroffen ist, die wie immer Opfer des Regimes wird. Repression und Massaker breiten sich aus, sogar bis in die Kapitalistenklasse hinein pflanzt sich die Zerstörung fort. Hitler massakrierte die republikanischen Bürgerlichen, Churchill und Truman hängten und erschossen Goering und Co., Stalin erhielt das Einverständnis aller, als er verschiedene Leute massakrierte. Ein blutiges allgemeines Chaos, die Auslösung einer perfektionierten Bestialität und ein bislang unbekannter raffinierter Sadismus sind das zu zahlende unausbleibliche Lösegeld, wenn es dem Kapitalismus unmöglich geworden ist, seine Widersprüche zu überwinden. Gott sei gelobt. Welch ein Glücksfall für diejenigen, die auf der Suche einer verteidigungswerten Sache sind. Unsere Trotzkisten freuen sich! Jeden Tag bieten sich für unsere modernen Ritter neue Möglichkeiten, bei denen sie ihr großzügiges Wesen ihres Kampfes zur Wiedergutmachung jeglichen Unrechts und der Rache der Beleidigten zeigen können.
Werfen wir einen Blick auf die Geschichte des Trotzkismus
Im Herbst 1935 fing Italien eine militärische Kampagne gegen Äthiopien an. Es handelte sich zweifelsohne um einen imperialistischen Krieg der kolonialen Eroberung eines rückständigen Landes, Äthiopiens, das wirtschaftlich und politisch noch halbfeudal war, durch ein fortgeschrittenes kapitalistisches Land, Italien. In Italien herrschte das Regime Mussolinis, in Äthiopien das Regime Negus, der "König der Könige". Aber der italienisch-äthiopische Krieg ist viel mehr noch als ein einfacher, klassischer Kolonialkrieg. Es handelte sich um die Vorbereitung, den Auftakt des sich ankündigenden Weltkriegs. Aber die Trotzkisten brauchen nicht so weit voraus zu schauen. Es reicht zu sehen, dass Mussolini der "böse Angreifer" gegen das "arme Königreich" des Negus ist, um unmittelbar die "bedingungslose" Verteidigung der nationalen Unabhängigkeit Äthiopiens zu übernehmen. Ah, aber wie! Sie reihen ihre Stimme in den allgemeinen Chor ein (vor allem den Chor des angel-sächsischen "demokratischen" Blocks, welcher noch in der Bildung begriffen ist und sich noch sucht), um internationale Sanktionen gegen die "faschistische Aggression" zu fordern. Die stärksten Verteidiger unter allen, die zudem von niemanden in diesen Fragen Lehren erhalten können, schelten und prangern sie die aus ihrer Sicht unzureichende Verteidigung durch den Völkerbund an[9], und rufen die Arbeiter der Welt dazu auf, die Verteidigung Äthiopiens und des Negus zu übernehmen. Es stimmt zwar, dass die Verteidigung des Königs Negus durch die Trotzkisten diesem nicht besonders viel Glück gebracht hat, weil er trotz deren Verteidigung geschlagen wurde. Aber gerechterweise muss man sagen, dass ihnen die Schuld dieser Niederlage nicht angehaftet werden kann, denn wenn es um die Verteidigung geht, selbst die eines Negus, nörgeln die Trotzkisten nicht. Sie sind zur Stelle und wie!
1936 brach der Spanienkrieg los. In Gestalt eines inneren "Bürgerkrieges", durch welchen die spanische Bourgeoisie in einen frankistischen und republikanischen Clan gespalten wurde, wurde dieser auf Kosten des Lebens und des Bluts der Arbeiter geführt. Er war das Vorspiel für den bevorstehenden Weltkrieg. Die Regierung, welche aus Republikanern, Stalinisten und Anarchisten zusammengesetzt war, war offensichtlich militärisch unterlagen. Natürlich eilten die Trotzkisten der Republik zur Hilfe, die "durch die faschistische Gefahr bedroht wurde". Ein Krieg kann natürlich nicht fortgesetzt werden, wenn es an Kämpfern und Material fehlt. Er würde zum Erliegen kommen. Aus Angst vor solch einer Perspektive, wo man nichts mehr verteidigen könnte, setzen die Trotzkisten alles daran, Kämpfer für die internationalen Brigaden zu rekrutieren und bringen alle Mittel für die Entsendung von "Kanonen für Spanien" auf. Aber die republikanische Regierung, zu der Azaña, Negrin, Francos Freunde von gestern und heute gehören, sind die Feinde der Arbeiterklasse. Die Trotzkisten schauen nicht so genau hin. Sie verhandeln nicht ihre Hilfe. Man ist für oder gegen die Verteidigung. Wir Trotzkisten, wir sind Neo-Verteidiger. Punkt, basta!
1938 tobte der Krieg im Fernen Osten. Japan griff das China Tschiang Kai-Sheks an.Ah! Keine Zögerungen! "Alle geschlossen wie ein Mann für die Verteidigung Chinas". Trotzki selbst erklärte, dies sei nicht der Zeitpunkt, um das blutige Massaker der Tausenden und Tausenden Arbeiter Shanghais und Kantons durch die Armeen des gleichen Tschiang Kai-Sheks während der Revolution von 1927 in Erinnerung zu rufen. Die Regierung Tschiang Kai-Shek mag wohl eine kapitalistische Regierung sein, die im Solde des amerikanischen Imperialismus steht, und die bei der Ausbeutung und der Repression der Arbeiter dem japanischen Regime in nichts nachsteht, all das zählt wenig angesichts des höheren Prinzips der nationalen Unabhängigkeit. Das internationale Proletariat, das für die Unabhängigkeit des chinesischen Kapitalismus mobilisiert wurde, bleibt immer unabhängig… vom Yankee-Imperialismus, aber Japan hat tatsächlich China verloren und ist geschlagen worden. Die Trotzkisten können zufrieden sein. Zumindest haben sie die Hälfte ihres Ziels erreicht. Es stimmt, dass dieser antijapanische Sieg Dutzende Millionen von Arbeitern, die im sieben Jahre dauernden Krieg an allen Fronten während des Weltkriegs massakriert wurden, das Leben gekostet hat.[10] Aber zählt das neben der garantierten Unabhängigkeit Chinas?
1939 griff Hitler-Deutschland Polen an. Vorwärts mit der Verteidigung Polens. Aber der russische "Arbeiterstaat" griff ebenfalls Polen an, und fiel zudem noch in Finnland ein und entriss Rumänien Gebietsstreifen. Das stiftet ein wenig Verwirrung in den Köpfen der Trotzkisten, die wie die Stalinisten erst wieder klarer sehen als die Feindseligkeiten zwischen Deutschland und Russland ausbrachen. Danach wurde die Lage wieder einfacher, zu einfach, tragisch einfach. Fünf Jahre lang riefen die Trotzkisten die Arbeiter aller Länder dazu auf, sich für die "Verteidigung der UdSSR" abschlachten zu lasen und auf Umwegen alle Verbündeten der UdSSR. Sie bekämpften die Regierung Vichys, die das französische Kolonialreich Deutschland dienstbar machen wollte und somit "seine Einheit" aufs Spiel setzte. Sie bekämpften Pétain und andere Quisling[11]. In den USA forderten sie die Kontrolle der Armee durch die Gewerkschaften, um besser die Verteidigung der UdSSR gegen die Bedrohung durch den deutschen Faschismus sicherzustellen. Sie waren bei allen Maquis, allen Résistance in allen Ländern präsent. Dies war die Blütezeit der "Verteidigung".
Der Krieg mag wohl zu Ende kommen, aber der tiefgreifende Wunsch der Trotzkisten nach "Verteidigung" ist unbegrenzt. Das weltweite Chaos, das dem offiziellen Ende des Krieges folgte, die verschiedenen Bewegungen rasender Nationalismen, die bürgerlich-nationalistischen Erhebungen in den Kolonien, waren allemal Ausdrücke des weltweiten Chaos nach dem offiziellen Ende des Krieges, welches schließlich durch die Großmächte benutzt und angefacht wurde, um sie ihren imperialistischen Interessen unterzuordnen. Sie lieferten genug Stoff für die Trotzkisten zur Rechtfertigung ihrer "Verteidigungsargumentation". Vor allem im Namen der bürgerlichen Kolonialbewegungen, unter den Fahnen der "nationalen Befreiung" und des "Kampfes gegen den Imperialismus" (eine verbalradikaler Schlachtruf) schlachtete man weiter Tausende Arbeiter ab. All das stellt den Höhepunkt der „Verteidigungsaufrufe“ der Trotzkisten dar.
In Griechenland prallten der russische und anglo-amerikanische Block um die Vorherrschaft auf dem Balkan aufeinander; vor Ort geschah dies in Form von Partisanenkämpfen gegen die offizielle Regierung. Die Trotzkisten waren mit dabei. "Finger weg von Griechenland", schrien sie, und sie kündigten die gute Nachricht den Arbeitern an, nämlich die Gründung von internationalen Brigaden auf dem jugoslawischen Territorium des Befreiers Tito[12], wo sie die Arbeiter dazu aufriefen, in Brigaden zum Kampf um die Befreiung Griechenlands einzutreten.
Nicht weniger enthusiastisch berichten sie von ihren heldenhaften Kämpfen in China in den Reihen der sog. Kommunistischen Armee, die genau so kommunistisch ist wie die russische Regierung Stalins, von der sie abstammt. Indochina, wo die Massaker ebenfalls gut organisiert worden sind, wird erneut ein Paradebeispiel für die trotzkistische Verteidigung der "nationalen Unabhängigkeit Vietnams" sein. Mit dem gleichen generösen Elan unterstützten und verteidigten die Trotzkisten die nationale bürgerliche Partei Destour in Tunesien, der nationalen bürgerlichen Partei (PPA) in Algerien. Sie fanden Befreiungstugenden bei der MDRM, der bürgerlich nationalistischen Bewegung in Madagaskar. Die Verhaftung von Funktionären der Republik und von Abgeordneten in Madagaskar durch die kapitalistische Regierung Frankreichs trieb die Empörung der Trotzkisten auf den Höhepunkt. Jede Woche wurde La Vérité mit neuen Aufrufen für die Verteidigung der "armen" Abgeordneten Madagaskars gedruckt. "Befreit Ravoahanguy, befreit Raharivelo, befreit Roseta !"Der Platz in der Zeitung reichte nicht mehr, um all die Aufrufe zur "Verteidigung", an der sich die Trotzkisten beteiligen sollten, zu veröffentlichen. Verteidigung der in den USA bedrohten stalinistischen Partei! Verteidigung der pan-arabischen Bewegung gegen den jüdischen Kolonisationszionismus in Palästina, und Verteidigung der Wütenden vor der chauvinistischen jüdischen Kolonisation, der terroristischen Führer des Irgun gegen England!
Verteidigung der Sozialistischen Jugend gegen das Führungskomitee der SFIO.
Verteidigung der SFIO gegen denn neo-sozialistischen Ramadier.
Verteidigung der CGT (französische Gewerkschaft) gegen ihre Führer
Verteidigung der "Freiheiten…. gegen die Bedrohungen durch die "Faschisten um de Gaulle"
Verteidigung der Verfassung gegen die Reaktion
Verteidigung der Regierung von PS-PC-CGT gegen die MRP.
Und über allem stehend Verteidigung des "armen" Russlands Stalins, das von einer Umzingelung durch die USA bedroht ist.
Arme, arme Trotzkisten, auf den zarten Schultern lastet die schwere Bürde so vieler "Verteidiger"!
Am 31. Mai diesen Jahres hat etwas Sensationelles stattgefunden: Abd-al-Krim, der alte Führer des Rifs[13], hat die französische Regierung einfach stehen lassen, indem er bei seiner Überstellung nach Frankreich flüchtete. Diese Flucht wurde durch die Komplizenschaft des Königs Faruk aus Ägypten vorbereitet und ausgeführt, der ihm Asyl anbot, das man königlich nennen kann. Das Ganze erfolgte mit ziemlichem Wohlwollen der USA. Die Presse und die französische Regierung sind bestürzt. Die Lage Frankreichs in den Kolonien ist alles andere als sicher, und es wird neue Unruhen geben. Aber mehr als eine wirkliche Gefahr ist die Flucht Abd-al-Krims vor allem ein Ereignis, das Frankreich lächerlich aussehen lässt, dessen Prestige auf der Welt ohnehin schon angeschlagen ist. Auch versteht man die Proteste der ganzen Presse, die sich über den Vertrauensbruch Abd-al-Krims gegenüber der demokratischen französischen Regierung beschweren, der trotz seines Ehrenwortes flüchtete.
Dies ist natürlich ein "tolles" Ereignis für unsere Trotzkisten, die vor Freude mit den Füßen trampeln. La Vérité vom 6. Juni titelt "Bravo Abd-al-Krim", sie empfindet Mitleid mit dem, der "den heldenhaften Kampf des marokkanischen Volkes anführte".La Vérité lobt die revolutionäre Größe seiner Geste. "Wenn sie diese Herren des Generalsstabs und des Ministeriums der Kolonien getäuscht haben, haben sie das toll gemacht. Man muss wissen, wie man die Bourgeoisie hinters Licht führt, sie belügt, sie austrickst, lehrte uns Lenin", schreibt La Vérité. So wurde Abd-al-Krim zu einem Schüler Lenins gemacht, in Erwartung, dass er ein Ehrenmitglied des Exekutivkomitees der 4. Internationale wird.
Die Trotzkisten versichern uns, "als alter Kämpfer des Rifs, der wie in der Vergangenheit die Unabhängigkeit seines Landes wollte,… so lange wie Abd-al-Krim kämpft, werden alle Kommunisten auf der Welt ihm helfen und ihn unterstützen". Sie sagen zum Schluss: "Was gestern die Stalinisten sagten, wiederholen wir Trotzkisten heute".
Tatsächlich könnte man das nicht deutlicher sagen.
Aber wir werfen den Trotzkisten nicht vor, "das heute zu wiederholen, was die Stalinisten gestern gesagt haben" und das zu tun, was die Stalinisten immer getan haben. Wir werfen den Trotzkisten auch nicht vor, das zu "verteidigen" was sie wollen. Sie erfüllen eigentlich ganz ihre Rolle.
Aber es möge uns gestattet sein, einen Wunsch auszudrücken, einen einzigen Wunsch. Mein Gott! Hoffen wir, dass die Notwendigkeit der Verteidigung der Trotzkisten nicht eines Tages dem Proletariat zufällt. Denn mit dieser Art Verteidigung wird die Arbeiterklasse sich nie mehr erheben können.
Die Erfahrung mit dem Stalinismus reicht vollkommen! Marc
[1]Siehe unsere Broschüre La Gauche Communiste de France [289].
[2]Siehe unseren Artikel La Gauche Communiste et la continuité du marxisme [290].
[3]Siehe dazu das erste Kapitel unserer Broschüre zur "Gauche Communiste de France". Die gescheiterten Versuchte der Schaffung einer Gauche Communiste de France".
[4][Hinweis der Redaktion] Ein besonderer Hinweis auf Munis sei hier angebracht, welcher mit dem Trotzkismus auf der Grundlage der Verteidigung des proletarischen Internationalismus brach. Siehe dazu unseren Artikel in Internationale Revue Nr. 58 (französische Ausgabe). "Dem Gedenken an Munis, Kämpfer der Arbeiterklasse". A la mémoire de Munis, un militant de la classe ouvrière [291].
[5][Hinweis der Redaktion]: Es handelt sich um die russische Offensive 1939, die neben Finnland auch auf Polen gerichtet war (das seinerzeit von Hitler überfallen wurde), sowie auf die Baltischen Staaten und Rumänien.
[6]Es ist ganz typisch, dass die Gruppe Johnson-Forest, die sich von der Partei Schachtmans getrennt hat und sich als "sehr links" bezeichnet, weil sie gleichzeitig die Verteidigung der UdSSR ablehnt und die antirussischen Positionen Schachtmans, dass die gleiche Gruppe heftig die französischen Trotzkisten kritisiert, die ihnen zufolge sich nicht direkt aktiv genug an der 'Résistance' beteiligt haben. Dies ist ein typisches Beispiel des Trotzkismus.
[7][Hinweis der Redaktion]: Forces Françaises de l'Intérieur, Gesamtheit der militärischen Gruppen der französischen inneren Résistance, die im besetzten Frankreich gebildet worden waren, und im März 1944 unter den Befehl des General Königs und der politischen Autorität des General de Gaulles gestellt worden war.
[8][Hinweis der Redaktion] :Parti Communiste Internationaliste, Ergebnis des Zusammenschlusses 1944 der Parti Ouvrier Internationaliste und des Comité Communiste Internationaliste
[9][Hinweis der Redaktion] Völkerbund, Vorläufer vor dem Krieg der Vereinten Nationen
[10]Man lese zum Beispiel La Vérité vom 20.06.1947. « Der heldenhafte Kampf der chinesischen Trotzkisten": "In der Provinz Chandung wurden unsere Genossen zu den besten Kämpfern der Guerilla… In der Provinz Xiang-Chi wurden die Trotzkisten von den Stalinisten als die 'loyalsten Kämpfer gegen Japan' begrüßt. Usw."
[11][Hinweis der Redaktion]: Vidkum Quisling war der Führer der norwegischen Nasjonal Samling (Nazipartei) und Führer der Phantomregierung, die von Deutschland nach der Besetzung Norwegens eingesetzt worden war.
[12][ Hinweis der Redaktion]: Josip Broz Tito war einer der Hauptverantwortlichen der jugoslawischen Résistance am Ende des Krieges.
[13][Hinweis der Redaktion] Mohammed Abd al-Karim Al Khattabi (in Ajdir, Marokko,ca. 1882 geboren), verstorben am 6.Februar 1963 in Kairo in Ägypten), führte einen langen Widerstandskampf gegen die Kolonialbesetzung des Rifs – Bergregion im Norden Marokkos – zunächst gegen die Spanier, dann gegen die Franzosen. Ihm gelang es 1922 , eine "Konföderierte Republik der Stämme des Rifs" auszurufen. Der Krieg zur Niederschlagung dieser neuen Republik wurde von einer Armee von 450.000 Soldaten geführt, die Frankreich und Spanien zusammengestellt hatten. Als er sah, dass seine Sache aussichtslos war, stellte sich Abd-al-Krim den Behörden als Kriegsgefangener, um das Leben von Zivilisten zu schützen, was aber die Franzosen nicht daran hinderte, die Dörfer mit Senfgas zu bombardieren, wodurch 150.000 Menschen getötet wurden. Abd-al-Krim ging ab 1926 nach La Réunion ins Exil, wo er unter Hausüberwachung stand, aber 1947 durfte er nach Frankreich zurückkehren. Als sein Schiff in Ägypten Zwischenstop machte, übertölperte er seine Bewacher, und verbrachte den Rest seines Lebens in Kairo. (siehe Wikipedia).
Aktuelles und Laufendes:
- Trotzkismus Kriegsfrage [292]
Leute:
- Tito [293]
- Abd al Krim [294]
- G. Munis [295]
Politische Strömungen und Verweise:
- Trotzkismus [101]
Historische Ereignisse:
- Spanienkrieg [296]
- Krieg Griechenland [297]
Theoretische Fragen:
- Internationalismus [69]
Erbe der kommunistischen Linke:
Notizen zu den Studentenprotesten:
- 2519 reads
Nachfolgend veröffentlichen wir einige Notizen zu den Studentenprotesten in Deutschland, die wir als Zuschrift erhalten haben. Wir begrüßen solche Reaktionen und möchten sie hiermit zur Debatte stellen. - Weltrevolution -
Notizen zu den Studentenprotesten:
1) Die Gesamtsituation im Juni und jetzt ist unterschiedlich (im Juni z.B. Streik der Erzieherinnen – jetzt mehr Niedergeschlagenheit durch Firmenschließungen wie Karstadt und Quelle)
2) Die Studenten haben im Juni nichts erreicht, die Bourgeoisie hat angesichts der nahenden Sommerferien das Ganze ausgesessen. Deshalb jetztwieder Proteste – sie haben sich nicht entmutigen lassen.
3) Einiges finden ich bemerkenswert bei diesen Protesten:
a) Kämpferisch und motiviert – Die Studenten investieren viel Zeit und Energie, sie lassen sich nicht einlullen durch Versprechungen und angebliches „Verständnis“, hinter denen nichts steckt
b) Kollektives Entscheiden und Handeln – in den besetzten Hörsälen wird diskutiert und gemeinsam entschieden und zwar tagtäglich – die Arbeitskreise, die einzelne Themen erarbeiten, legen regelmäßig Rechenschaft ab.
c) An vielen Orten autonomes Handeln – die Asten und Studentenparlamenten haben Schwierigkeiten, einen Zugang zu den Protesten zu finden und bleiben bei Solidaritätsbekundungen (es ist allerdings je nach Uni unterschiedlich – hier da, dort weniger)
d) Parteien sind selten gern gesehen, aber es gibt nicht unbedingt eine Abneigung gegen Politik – jeder kann reden, egal ob organisiert oder nicht
e) Die Studenten besetzen nicht die Räume, um sich darin einzusperren, sondern als Ort der Zusammenkunft, um auch vor dort aus andere Unis zu besuchen
f) Die Proteste gehen über Städte, Regionen und Länder hinweg – praktischer internationaler Zusammenhalt und Vernetzung. Zwei Beispiele: Die Wuppertaler sind z.B. vor einer Woche abends nach ihrem Plenum spontan zu 40 nach Aachen gefahren, um die dortigen Studenten zu besuchen und zu unterstützen – es hat allen gut getan, sie haben eine spontane Demo gemacht und über zwei Stunden diskutiert ; als sie hörten, dass in Deutschland Unis mit Polizeigewalt geräumt wurden, begaben sich die Wiener Studenten spontan als Demo zu der deutschen Botschaft (bringt zwar nicht viel, aber eine spontane Reaktion der Solidarität)
g) Solidarität ist insgesamt wichtig – eine Demo gegen die Repressalien wird z.B. jetzt am 25.11. in Duisburg stattfinden
h) Die Studenten sind offen auch für andere (Eltern, Dozenten) und freuen sich über Beteiligung
i) Mich begeistert ihre Kreativität, wie sie mit Problemen umgehen, wie sie neue Lösungen und Ideen immer wieder finden, wie sie das Ganze künstlerisch, humorvoll und einfallsreich aufarbeiten
j) Die Reaktionen der Bevölkerung finde ich auch interessant: die Studenten bekommen Unterstützung (einige Beispiele: Anwohner und andere Menschen haben den Studenten in Köln 40 Schüsseln mit Salaten gebracht; Bäckereien schenken Brot und Gebäck; Druckereien drücken umsonst Flyers, etc.)
4) Selbstverständlich sind erhebliche Grenzen auch vorhanden:
a) Während die Studenten sich viel über die Organisation ihres Protestes Gedanken machen, sind inhaltliche Diskussionen oft zu selten – was steckt hinter den Forderungen, in welcher Situation weltweit und in Deutschland/Österreich befinden wir uns, ist der universitäre Rahmen der einzige, um den es geht, was ist mit den Beschäftigten... viele Diskussionsthemen, die stattfinden sollten auch über die verschiedenen Vernetzungsmöglichkeiten, aber es meiner Meinung nach zu wenig tun –allerdings habe ich nur einen eingeschränkten Blick, bin ja nicht überall, es kann auch Unterschiede geben. Insgesamt ist es meiner Meinung nach aber eher unpolitisch und damit eine leichte Beute für die bürgerlichen Medien und Parteien/Organe/Ideologie
b) Die Grenzen liegen in der Natur des Studentendaseins selbst – die Zusammensetzung ist heterogen und sie sind noch nicht im Produktionsprozess integriert – mit Illusionen und wenig Erfahrungen (auch wenn sie instinktiv oft richtig reagieren)
c) Die gesamte Situation bietet wenig Möglichkeiten, dass sie sich bestehenden Kämpfen der Arbeiter anschließen – denn die gibt es im Moment nicht. Dadurch werden Appelle, sich auch an die Arbeiter zu wenden, abstrakt. Da, wo Reaktionen der Arbeiter bestehen, gibt es aber ein natürliches Zusammenkommen mit den Studenten (z.B. letzten Samstag in Wien, als Erzieherinnen für bessere Arbeitsbedingungen demonstrierten, waren die Studenten dabei und haben die Demonstranten zu einer „Kindergartenjause“ im Audimax der Uni eingeladen).
5) Die Reaktion der Bourgeoisie:
a) Der Bourgeoisie ist das Ganze unangenehm. Erst hat sie versucht, es totzuschweigen (über die Proteste in Österreich ist die erste Zeit gar nicht berichtet worden). Dann ging es nicht mehr, also durfte sie den Studenten das Feld nicht überlassen und kein Tag vergeht ohne Berichterstattung, Interviews und „viel Verständnis“ sogar von Merkel! In einer Zeit, in der der soziale Frieden über kurz oder lang Risse bekommt und Kämpfe unvermeidbar werden, ist das Beispiel der Studenten und die Solidarität der Bevölkerung so gar nicht in ihrem Sinne. Sie versucht mit der ganzen Palette von Repression bis Zustimmung das Nachdenken zu verhindern.
b) Reaktionen wie Räumung der Unis durch Polizei und Strafanzeigen halte ich nicht für ein Zeichen der Stärke der Bourgeoisie. Wird da geräumt, gehen sie durch eine andere Tür wieder rein – es beeindruckt sie nicht, macht sich aber in der Bevölkerung nicht besonders gut und gießt Öl aufs Feuer – zumal die Studenten sich durch Gewalt nicht provozieren lassen.
c) Reaktionen der Bildungsministeriums wie Bafögerhöhung oder Sparpläne für zukünftige Studenten (die Oma und Opa anlegen können) sind lächerlich, und was ich mitkriegen konnte, werden auch von Nichtstudenten als solche wahrgenommen.
d) Dass die Bourgeoisie hinter allen Maßnahmen das Sparen bezweckt, wird immer deutlicher – ob Kindergarten oder Uni, es soll billig sein – je mehr Bildung auf der Packung steht, desto weniger ist Bildung drin. Die Unfähigkeit des Kapitalismus, den Menschen u.a. auch in ihrem Bedürfnis nach Lernen eine Perspektive zu bieten, offenbart sich auch zunehmend darin, dass die Bourgeoisie nicht in der Lage sein kann, auf die Studentenproteste wirklich einzugehen. Diese Unfähigkeit des Kapitalismus verstehen die Studenten aber noch nicht und darin liegen ihre Illusionen.
N. 23.11.09
Offener Brief an die Studenten
„Liebe Wuppertaler Studenten, Ich verfolge mit Spannung seit dem Sommer Eure Proteste und war gestern Abend mit Twitter und Lifestream in Gedanken bei Euch, deshalb einige Kommentare:
Bin schwer beeindruckt von dem Durchhaltevermögen und der Entschlossenheit der Studenten in Wuppertal und allen anderen Städten. Während im Sommer viel versprochen, aber nichts gehalten wurde, wollt Ihr jetzt etwas erreichen. Ihr habt recht, es geht ja auch um Eure Zukunft. Erreichen könnt Ihr nur was, wenn Ihr ein Kräfteverhältnis zu Euren Gunsten schafft, d.h. wenn die Verantwortlichen so richtig das Zittern bekommen und ihnen nichts anderes übrigbleibt, als nachzugeben. Das war die Situation 2006 in Frankreich, als die Studenten die Regierung zur Rücknahme eines Gesetzpaketes gezwungen haben. Was macht euch stark? - stark macht euch erst einmal die gesamte Situation in Deutschland (und weltweit): Tausende Beschäftigte verlieren z.Zt. ihre Arbeit (Quelle, Karstadt etc.), Opel steht auf der Kippe, unzählige Zulieferbetriebe der Autoindustrie und andere Branchen haben Kurzarbeit, nicht zu vergessen den Streik der Erzieherinnen im Sommer, die nach wie vor unzufrieden sind – der soziale Frieden, der in Deutschland solange gepflegt wurde, bekommt Risse. - stark macht es Euch aus diesem Grund, wenn Ihr den Kontakt zu den Beschäftigten im Bildungsbereich und woanders sucht, denn Eure Probleme sind im Grunde die gleichen: Studiengebühren und Bachelor haben den Zweck, die Bildung möglichst preisgünstig zu gestalten, an Euch und Eurer Zukunft zu sparen – nicht anders als in Kindergärten oder bei Opel. Damit meine ich nicht in Form von Grußbotschaften der Gewerkschaften, sondern indem Ihr auf die Straße geht oder auch zu Betrieben. Z.B. Auszubildende und Dualstudenten haben schwer zu tragen und sind Eure Verbündete – auch sie könnten sich mit ihren eigenen Forderungen Euch anschließen.
- stark macht es Euch, wenn Ihr so zahlreich wie möglich seid, wenn Ihr miteinander diskutiert, wenn Ihr nicht in eurer Uni eingesperrt bleibt, sondern Gedanken und Erfahrungen mit anderen Unis austauscht – in diesem Sinne sind die Vorschläge, mehrere Unis zu besuchen und geschlossen zu
demonstrieren zu begrüßen. Unibesetzungen sind kein Selbstzweck, sondern bieten eine Gelegenheit, miteinander zu diskutieren, sich zu sammeln und loszuziehen zu anderen Unis, Schulen, zu den Menschen auf der Straße, die Euren Protest oft wohlwollend wahrnehmen, ihn aber als „die Sache der Studenten, mit der sie doch nichts zu tun haben“, betrachten.
- stark macht es Euch, wenn Ihr geschlossen und so zahlreich wie möglich Euch gegen jetzige und zukünftige Repressalien wehrt (Strafanzeigen u.a.)
- dies nicht in Form von Petitionen, denn Papier ist geduldig und beeindruckt wenig.
- ich hoffe, dass ihr genug Zeit findet, viele Diskussionen zu führen und Eure Gedanken auf Papier zu bringen, z.B. in „Talsperre“ und ins Internet, damit sich Studenten und andere Menschen beteiligen können und der Gewinn Eures Protestes sich auch darin ausdrückt.
17.11.09
